Zurzeit sind 544 Biographien in Arbeit und davon 324 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 202



Zürich, Schweiz. Mit Jahrgang 1953 geriet mein Leben in die Sogwirkung der 68er-Bewegung und der Hippie-(Underground)-Kultur.
Und nun mein eigenes, vergangenes Leben beschreiben? Warum? Weshalb? Wozu? Gut, warum nicht, frei nach einem Zitat von Samuel Beckett in "Warten auf Godot":
Was sagen sie?
Angeregt von der Internet-Plattform www.meet-my-life.net begann ich 2019 im Alter von 66 Jahren einen autobiographischen Rückblick auf die Entwicklung meiner Gedankenwelt als Beitrag zur Oral History - denn jede Lebensgeschichte sei es wert, dokumentiert zu werden.

Die optisch dreidimensionale Tiefenschärfe entsteht bei mir nicht automatisch mit meinen Augen. Ein 3D-Bild (Stereogramm) wird beim parallel doppelten Betrachten nicht zu einem dreidimensionalen Bild, sondern ich sehe die verschiedenen Schichten im verschlüsselten Bild, den Aufbau der Figuren. Am Grunde des Bildes flimmert wie beim Fokus einer Spiegel-Reflex-Kamera eine glänzend spiegelnde Stelle, welche beim Fixieren einen schmerzhaften Blitz im Kopf auslöst, was zum Abbruch der Betrachtung führt. Wenn doch ein dreidimensionales Bild aufploppt, zeigt sich dieses hervorgehoben in der Mitte und ich kann mit meiner Hand dahinter durchfahren ohne das Bild zu stören.
Ohne exakte dreidimensionale Tiefenschärfe habe ich einerseits bloss reduziert Zugang zur Gefühlswelt des Unheimlichen oder Bedrohlichen und der damit verbundenen Angst, anderseits aber sinnlich eine unmittelbare Wahrnehmung von Veränderungen. Dazu habe ich dadurch auch keine ausgeprägte Ästhetik: ich sehe nicht, warum etwas schön sein soll oder nicht. Die Dinge sind für mich so wie sie sind. Ebenso merke ich nicht, warum mein gefühlter Zustand gut sein soll oder schlecht. Mein Befinden ist in jeder Situation mir eigen. Auch die üblicherweise angeborene Lebensfreude musste ich erst entdecken als Motivation durch den Reiz der Sinne und mir die Lust am Leben als Lebenskunst gedanklich erarbeiten. Leben an sich empfinde ich nicht als Lust, sondern als Pflicht.
Eine Traumwelt im Schlaf fehlt mir fast vollständig, ich kann mich schon immer nicht an Träume erinnern, obschon ich wie alle Menschen im Schlaf auch geträumt haben muss. Schlafen ist eine meiner liebsten Beschäftigungen, durchschlafen bis ich von selber erwache. Zur Erholung kann ich mich aber auch jederzeit hinlegen und für nur wenige Minuten kurz schlafen.
Die angeborene soziale Kooperation, Wesens-Merkmal der Menschen, könnte bei mir früher zeitweise an ein zwanghaftes Helfer-Syndrom anmahnen. Ich bin oft der Letzte, welcher noch ein Verständnis hat für ein Nicht-Wollen anderer, weil von mir aus gesehen auch ein Wille zuallererst ein Können voraussetzt. Aber erst im Nachhinein, wenn für mich klar ist, dass vorhandene Hürden nicht gemeistert werden können.
Dieser Sachverhalt ist vermutlich wesentlicher Bestandteil meiner Entwicklung und erklärt mir auch mein Interesse für den Unterschied zwischen der gelehrten, allgemein gültigen dualen Logik des entwederoder meiner Umwelt einerseits und andererseits einer Folgerichtigkeit von natürlicher dreieiniger Polarität mit dem Inhalt zwischen zwei sich zwingend gegenseitig bedingenden Tatsachen, wodurch ein Blick über den Teller-Rand hinaus möglich wird. Mein Leben wurde geprägt von einer Art eigenem Kopf-Kino. Im Wach-Zustand ist diese meine Gedanken-Welt mit den Fragen nach Zusammenhängen mehr oder weniger ständig aktiv. Dies kann zu gleichzeitigem anwesend und abwesend sein führen. Je mehr Menschen um mich herum sind, desto einsamer werde ich.
In den vergangenen Jahrzehnten zeitweise anstrengend und mühsam zwar, sich "Gott und die Welt" wie Alles aus dem Nichts selber erklären zu müssen, aber letztlich doch befriedigend, hinterher betrachtet. Denn ich habe für mich die gedanklichen Zusammenhänge, (www.rolfpfischter.ch), gefunden und beschreibe nachstehend diese meine Entwicklung.

Zentrale Aussagen von Kultur- und Sozialwissenschaft lauten sinngemäss, dass nichts so sehr die Eigenschaften der Menschen erkläre wie die Art der Umgebung und die Form der Siedlung, welche die Generationen erfahren haben. Meine Autobiographie beginnt darum mit der Örtlichkeit, in welche ich hineingeboren wurde:


In der Mitte die Grosseltern mit meinem Vater, links die Urgrossmutter Witwe Bertha Pfister-Rusterholz, rechts die Witwe Selina Höhn-Pfister, von welcher mein Grossvater den Hof 1918 übernommen hat.
Horgen war bis zum Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert landwirtschaftlich geprägt, wobei Weinbau und Milchwirtschaft vorherrschten. 1880 hatte Horgen als Bezirkshauptort und einem Zentrum der Seidenindustrie mit dem Beinamen Klein-Lyon am linken Ufer des Zürichsees 5268 Einwohner. Der Weinbau wurde im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts vollkommen aufgegeben infolge einer ab 1850 in Europa einsetzenden Schädigung durch die aus Amerika eingeschleppte Reblaus und der nicht begünstigten Lage (das Getränk wurde von Weinkennern als Suur-Gürpsler von der Pfnüsel-Küste bezeichnet). Ab Mitte des 19. Jahrhundert begann die Erfolgsgeschichte des Apfelweins als Weinersatz. Im Herner war die Viehhaltung schon früh auf ein Minimum reduziert worden nach der Abtretung von grossen Teilen an Weideland für den Bau des Krankenhaus Horgen 1868 und dessen Um- und Ausbau 1951/55. Die grosse Scheune mit den Stallungen im Erdgeschoss wurde umgebaut und vom Feinmechanik-Betrieb Ehrat genutzt mit Büro im Obergeschoss.

Der Landwirt Kaspar Pfister produzierte im Herner Most-Obst zur Kelterung von Apfelwein (suure Moscht), Milch, Butter, Gemüse, Eier, Honig und Schnaps (Trester und Zwetschgen) und Brennholz. Mit wenigen Handgriffen konnte der grosse kupferne Kessel im Waschhaus zur Schnaps-Brennerei umgerüstet werden. Die Hernerholzgasse führte hoch zum eigenen Wald, dessen Umfang durch den Bau der Nationalstrasse N3 im Jahre 1959 stark reduziert wurde. Die Produkte wurden einerseits ab Hof verkauft und andererseits belieferte Kaspar Gebiete bis weit in die Kantone Schwyz und Zug mit seinem Presto Motorlastwagen. Das Fahrzeug wurde auch ausgerüstet zum gelegentlichen Personen-Transport von Gesellschaften.

Hier im Herner wurde 1920 mein Vater Robert Kaspar Pfister geboren als ältester von vier Kindern und lebte an diesem Ort bis zu seinem Umzug 1994 in eine Alters-Siedlung der Gemeinde. Meine gesamte Kindheit und Jugendzeit verbrachte ich in diesem ehemaligen Bauernhof. Innerhalb der Liegenschaft sind wir zwei Mal umgezogen. Das ursprünglich im 18. Jh. gebaute grosse Bauernhaus wurde im 19. Jh. umgebaut und auf der Nord-Hälfte ergänzt mit drei separaten Wohnungen und einem aussen angebauten Treppenhaus bis zum zweiten Stockwerk sowie einer Waschküche im Erdgeschoss. Dort auf der 3. Etage habe ich meine ersten vier Lebens-Jahre gelebt in einer Vier-Zimmer-Wohnung.
Das steinerne Treppenhaus führte nur bis zur 2. Etage, wo sich auch die Toilette mit Wasserspülung befand, welche sich zwei Wohnungen teilen mussten. Von der Wohnungstüre führte eine steile Holztreppe hinauf zur eigentlichen Eintrittstüre in den grossen Vorraum der Wohnung mit Türen zu den Zimmern. Geheizt wurde mit Holz, der Kachelofen im Wohnzimmer reichte bei offenen Zimmertüren für die ganze Wohnung. Vor dem Schlafen wurden mit Kirschen-Kernen gefüllte Kissen, die Steinsäckli, auf dem Kachelofen erhitzt und unter die Decke mitgenommen. An den Fenstern wurden im Spätherbst die Doppelfenster angebracht. Bei grosser Kälte draussen zeigten sich daran schöne Eisblumen. Gekocht wurde mit einem Gasherd, der war aber für uns Kinder tabu. In der Küche waren keine elektrischen Geräte, auch kein Kühlschrank.
Als das neben dem Wohnhaus stehende Holz-Chalet, das frühere Stöckli, frei wurde, haben wir dort gewohnt für die nächsten sechs Jahre, bis die Grosseltern 1963 in eine Wohnung wechselten und wir das Haupthaus beziehen konnten. Im Chalet war eine geräumige Wohn-Ess-Küche, Wohnraum mit Kachelofen beheizt von der Küche aus, eine kleine Plumps-Toilette und im oberen Stockwerk drei Schlafzimmer, unter dem Giebeldach noch ein weiteres. Als einziger Sohn mit Schwestern hatte ich schon früh ein eigenes Zimmer für mich. Die Schlafzimmer waren unbeheizt. Wasser war einzig in der Küche am Schüttstein vorhanden. Gekocht wurde mit Erdgas.
Mit dem Umzug in den Hauptteil des Wohnhauses öffnete sich eine neue Welt. Vom Natur-Keller durchgehend bis zur Räucherkammer im Dachstock konnten wir uns auf fünf Ebenen bewegen. Eine Steintreppe führte zur Türe vom überdachten Eingangsbereich (diese Tür war aber immer offen) und zu einer massiven Haustüre mit einem kunstvoll geschmiedeten Tür-Klopfer. Danach war ein langer Gang, zuerst gleich links die Tür zum Abtritt über der Jauche-Grube (mit einem Holzdeckel und einem Fach für die zugeschnittenen Zeitungen, welche als WC-Papier verwendet wurden). Weiter vorne die Tür zum Vorrat-Raum (wo bald ein Kühlschrank stand nebst einer Tiefkühl-Truhe im Schopf), dann der Durchgang zum Schopf-Anbau und dort rechts eine Besenkammer, welche später zu einer Toilette mit Wasser und Lavabo umgebaut wurde. Zuvorderst geradeaus der Treppenaufgang zum Obergeschoss und rechtswinklig ein offener Vorraum mit Türen zur Küche, zum Wohnzimmer und zur Kellertreppe unter der nach oben führenden Treppe. In der Küche stand ein Elektro-Herd mit vier Platten, daneben befanden sich die Lucke zum Kachelofen und noch ein Kochherd mit Brennholz-Betrieb. Auf der anderen Seite waren ein Geschirr-Schrank und ein alter Tisch mit Schieferplatte.

Von der Haustüre führte ein Draht-Zug um die Ecke bis zur mit einer Spirale gefederten Glocke mit hellem Klang vor der Wohnstube. Im Wohnzimmer war gleich rechts die zweite Türe zurück zur Küche, daneben der mannshohe breite Kachelofen mit Wärme-Seiten-Fach für die Kirschen-Stein-Kissen, auf seiner linken Seite führte eine steile Holzstiege mit tiefen Schubladen unter den Tritten hinauf zu einer Lucke mit Klappe ins Eltern-Schlafzimmer. Auf der Seite zum Wasch-Haus (Südost) war ein Fenster mit mauerdick breitem Fenstersims, darunter ein eingebautes Schränklein, in Richtung Spital (Südwest) zwei ebensolche Fenster. Die vierte Seite hatte eine Tür zum Nebenraum, dem Stübli mit fünf zimmerhohen Einbau-Schränken und einem schwarzen, fest an die Wand montierten Wählscheiben-Telefon.

Im oberen Stockwerk waren vier Schlafzimmer, das grosse Eltern-Eck-Zimmer mit zwei Fenstern. Neben der Türe zum Windfang der Treppe nach oben führte eine Tür hinaus zum Obergeschoss im Schopf-Anbau. Dort waren die Estrich-Abteile der Wohnungen von nebenan und eine unverschlossene Tür in deren Treppenhaus. Im nächsten Stockwerk führte ein Gang bis zum Fenster an der Aussenseite. Links eine Türe zu einer abgeschrägten Kammer mit Einbauschrank, danach die Stiege zum Klapp-Deckel in den Dachstock mit der Räucherkammer, zuvorderst links ein offener Raum und rechts die Türe zu meinem grossen Zimmer mit zwei Fenstern über dem Blechdach vom Schopf mit Blick auf den See bis nach Zürich und einem kleinen Kachelofen, den ich selber beheizen konnte und musste.

Erstmals von zu Hause weg zog ich mit 20 im Jahr 1973, weil meine damalige Freundin, noch nicht volljährig, ihr Daheim verlassen wollte. Ich mietete ein möbliertes Zimmer am Goldbrunnen-Platz in Zürich mit WC/Dusche und Nutzung einer Etagen-Küche. Vier Monate später war die Beziehung nach beinahe vier Jahren zu Ende und ich kehrte wieder ins Elternhaus zurück bis ich 1975 endgültig auszog und seither mit meiner Frau zusammen lebe.
Nach dem Tod beider Eltern meines Vaters im gleichen Jahr 1971 kam es zum Verkauf der Liegenschaft. Der Wert für die noch verbliebenen 7167 m² Land war 1.65 Millionen. (Kaufpreis 1918 ist 78'000 für 14'168 m².) Die Erbengemeinschaft der vier Kinder verkaufte das Land 1976 an die Stiftung Spital Horgen und teilte den Erlös unter sich. Für den Unterhalt der Liegenschaft und die Ordnung besorgt war weiterhin der älteste Sohn vor Ort, mein Vater. Erst nach dessen Umzug 1994 in die Alters-Siedlung Tannenbach realisierte die Stiftung das Neubau-Projekt Tertianum Horgen, welches 2006 eröffnet wurde.
Durch die Real-Teilung unter den Erben mit dem Verkauf des Bodens zwecks Kapitalisierung zur Erb-Auszahlung wurde die Geschichte vom Hof im Herner beendet.

Die ursprüngliche ländlich bäuerliche Bodenleihe hatte ab dem Frühmittelalter (6.-10. Jh.) in der Grund-Herrschaft neue Formen entwickelt. Zur Bewirtschaftung überliessen Adelige und geistliche Grundherren ihren Arbeitskräften einen Teil von ihrem Besitz in Lehen auf Lebenszeit.
Ab Ende des 13. Jh. setzte sich eine neue Leih-Form, die Erbleihe durch, wodurch ein Bauer, ob Freier oder Leibeigen, den Leihe-Hof seinen Nachkommen vererben konnte. Sie wurde noch im 16. Jh. zur wichtigsten Leihe-Form, verdrängte aber die kurzfristigen auf Lebenszeit nicht völlig. Der Leihe-Nehmer übernahm vom Grundherrn ein Einzelgrundstück zu voller Nutzung. Leihe-Form, Laufzeit, Zins und Zinstermin, Zustand des Leihe-Gutes bei Rückgabe wurden nach örtlichem Brauch und in persönlicher Absprache festgelegt. Über den Zins an Geld und Naturalien (Ackerfrüchte, Wein, Fleisch, Eier, Holz, Tuch usw.) partizipierte der Grundherr am Hof-Ertrag, über Frondienste an der Mannsleistung. Zinsnachlässe galten bei Missernten, Naturkatastrophen und Krieg. Das pachtähnliche Zinslehen fiel nach Ablauf der vereinbarten Zeit an den Grundherrn zurück, der frei war, es selbst zu bewirtschaften oder neu zu verleihen. Oft aber blieben kurzfristige Hof-Lehen bei wiederholter Übertragung dem Bauern bis ans Lebensende.
Ein neues Element kam mit dem Erblehen auf: Vererbbarkeit förderte den sorgfältigen Umgang des Bauern mit dem Leihe-Gut, über das er nun volle Sach-Herrschaft ausübte. Nach der allgemeinen Abmachung war der einmal vereinbarte Jahreszins zwar nicht ablösbar, aber auch nicht steigerbar. Die durch Arbeit und Investition erzielte Wert-Vermehrung kam als Mehrwert dem Bauern zu. Aus dem Mehrwert entstand der Verkehrswert, der sich am Zustand, an Erträgen und Zinsbelastung des Hofs bemass. In der Praxis kaufte der Bauer den Hof, d.h. dessen Mehrwert, vom Vorgänger. Er leistete dann dem Grundherrn den Lehen-Eid, ein Treue- und Sorgfaltsversprechen, und empfing von ihm den Hof zu Erb-Lehen.
Die ursprünglich grundsätzlich verbotene Teilung, Tausch, Verkauf, Verpfändung oder Belastung liess sich bei Erblehen nicht mehr durchsetzen: Schon im Spätmittelalter (1250-1500) belasteten Natural- und Geldzinse die Höfe und ab dem 16. Jh. immer mehr auch Bodenkredite (Gült). Hofteilungen mussten ursprünglich vom Lehen-Geber bewilligt werden, doch schon im 17. Jh. war in den Ackerbau-Dörfern Realteilung unter Erben die Regel. Grundstücke wurden zunehmend frei verkauft, gekauft, getauscht, verpfändet und belastet. Die Bauern behandelten Leihe-Gut wie Eigentum. Der Bauer war praktisch zum Eigentümer, der Lehen-Herr zum Bezüger geworden. Insgesamt bewirkte die Erbleihe eine Besitzverschiebung zugunsten der Bauern. Die Helvetik schaffte die Feudal-Lasten 1798 ab und erklärte Boden-Zins für ablösbar (1867 generell gelöscht). Der Lehen-Bauer war damit auch offiziell Eigentümer seines Hofes.
Bei Bauern-Lehen liess sich lehenrechtlich eigentlich nur der Mehrwert teilen, nicht aber der Hof. Das verbreitete Jüngsten-Erbrecht (Minorat) der Einzelhöfe diente der Bewahrung einer wirtschaftlichen Hofgrösse, das vor allem im Adel und ab dem 16. Jh. im Patriziat praktizierte Ältesten-Erbrecht (Majorat) der Herrschafts- und Vermögenserhaltung. Im Weiler- und Einzelhof-Gebiet der Nordostschweiz hielt sich das Allein-Erbrecht eines Sohnes am ungeteilten Hof, mehrheitlich als Minorat; Geschwister wurden nach der tiefen amtlichen Schätzung ausgesteuert. Als Voraus-Erbe für Töchter galt das Braut-Fuder (Zürich). Im Dorfgebiet waren Erben-Gemeinschaften im 16. Jh. zwar häufig, doch selten von langer Dauer. Dafür verbreitete sich die Real-Teilung unter Erben, bis sie schliesslich die Regel war und was, wie in meinem Fall, schliesslich zum Verkauf des Bodens durch meine Vorfahren zwecks Kapitalisierung zur Auszahlung der Erben führte (Hof im Herner in Horgen).
Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), "Leihe" von Anne-Marie Dubler, Version vom 10.02.2012. https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/008974/2012-02-10/


Am 3. März 1951, fünf Monate vor der Geburt der Tochter Ruth, meiner älteren Schwester, heiratete mein Vater 31-jährig am Wohnort der Frau in Langnau im Emmental die 24-jährige Ruth Alice Ramseier, meine Mutter. Verlobung war am Bettag 1949. Kennen gelernt haben sie sich, als er in Langnau ihren Bruder Hans besuchte, den er in Horgen kennen gelernt hatte, als dieser als Elektriker bei der Gemeinde arbeitete. Die Ehe wurde nach 66 Jahren durch den Tod meines Vaters beendet.
Die junge Familie bezog am Wohnort des Mannes 1951 eine Wohnung mit 4 Zimmern im Wohnhaus seiner Eltern, zuoberst im nördlichen Hausteil. Das Wohnhaus war zweigeteilt. Der südliche Eingang führte zur Haupt-Wohnung mit 9 Zimmern auf 3 Stockwerken (kein Parterre) wo meine Grosseltern wohnten, der nördliche Eingang führte über ein Treppenhaus zu 3 Etagen-Wohnungen welche vermietet wurden. 1953 kam ich zur Familie hinzu, 1954 meine Schwester Regi und 1955 meine Schwester Thesi.
Das Verhältnis zwischen meinen Eltern und Grosseltern war und blieb distanziert vom Umstand belastet, dass meine Grossmutter ihre Schwiegertochter nie akzeptiert hatte. Vermutlich aus religiösen Gründen, weil meine Mutter bei der Heirat bereits schwanger war. Bei meiner (reformierten) Grossmutter lag immer eine aufgeschlagene Bibel auf dem Stubentisch. Jeden Sonntag eilte sie zielstrebig in Richtung Dorf zur Kirche, ihren Mann gut zehn Schritte zurück im Schlepptau. Im Gegensatz dazu gingen meine Eltern nie zur Kirche. Die Antipathie zeigte sich deutlich, als meine Mutter etwa sieben Jahre später wegen einer Gebärmutter-Entzündung für eine Woche ins Spital musste. Obschon meine Grossmutter im gleichen Haus wohnte, wurde zur Aufsicht und Betreuung der vier Kinder tagsüber eine fremde Haushalthilfe engagiert, damit mein Vater seiner Arbeit nachgehen konnte.
1957 wechselte die Familie ins frei gewordene Holz-Chalet nebenan mit grosser Wohnküche, Wohnraum und 4 Schlafzimmern. 1963 wurde der Wechsel ins Haupthaus vollzogen und die Grosseltern übernahmen eine frei gewordene Wohnung im ersten Stockwerk des anderen Hausteiles.
Meine Eltern funktionierten irgendwie vollautomatisch in der althergebrachten klassischen Rollenteilung: Die Frau meisterte das Zuhause mit Küche, Einkauf und den Kindern und der Mann sorgte für die Existenz-Sicherung mittels Geldverdienst durch Arbeit. Im Haushalt hatte mein Vater nichts verloren und zu tun, übte aber die Kontrolle über das Haushaltgeld aus, welches die Mutter täglich von neuem erhielt. Für das Finanzielle und für das Schriftliche war mein Vater zuständig. Als alle Kinder schon grösser waren hat die Mutter gelegentlich ihr eigenes zusätzliches Geld verdient durch frühabends Büros reinigen oder frühmorgens Zeitungen austragen. Die Zeitungstour mit dem Velo hat sie aber auch gerne an eines der Kinder delegiert.
Im Grossen und Ganzen würde ich das Familienleben meiner Eltern als harmonisch bezeichnen mit einem gegenseitig respektvollen Umgang. Ich kann mich an keinerlei Beleidigungen oder wüste Auseinandersetzungen erinnern zwischen ihnen. Beide tranken keinen Alkohol, besuchten keine Restaurants und verbrachten alle freie Zeit zusammen mit ihren Kindern zu Hause, also auch keine Vereine und dergleichen. Mein Vater hatte in der Liegenschaft, im Garten mit Gewächshaus, dem Wasch-Haus, dem Schopf-Anbau, der Scheune, der freistehenden Garage-Werkstatt oder dem Bienenhaus immer irgendetwas zu tun.
Wir hatten keinen Fernseher und hörten Radio oder haben gelesen in Büchern und Zeitungen. Oft wurde am Stubentisch gespielt, Eile mit Weile gewürfelt. Später lernten wir jassen, zu Viert den Schieber. Musiziert wurde nicht, auch nicht gesungen ausser an Weihnachten bei Kerzenschein. Meine Schwestern lernten alle Blockflöte je für sich. Vater hatte aus seiner Jugendzeit noch eine kleine Handorgel, ich kam damit aber nicht über den Fritzli-Walzer hinaus. Das Einprägen von Musiknoten war mir zutiefst zuwider.
Ferien war ein Fremdwort, wir waren ein einziges Mal als Familie eine Woche im Reka-Feriendorf Albonago im Tessin. Mit der Bahn durch den Gotthard, wo uns Vater die Kehr-Tunnels erklärte mit der mehrmaligen Sicht der Kirche von Wassen. Im Feriendorf lebten wir in einem modernen Haus wie wir das noch nicht kannten. Bei schönem Herbstwetter wurde täglich gewandert. Dem Luganersee entlang auf dem Höhenweg durch die Rebberge, wo mir nur einen Schritt voraus eine Schlange den Weg kreuzte, nach Gandria. Oder durch Kastanienwälder zum Monte Brè. Auch mal weiter auf Schmuggler-Pfaden zum Monte Boglia an die Landesgrenze. Vater zeigte mir wie die Orientierung mit Landkarte und Kompass funktioniert. Und dass nachts der helle Polarstern immer Norden anzeigt und über das Sternbild vom grossen Wagen zu finden ist. Ausser dieser Woche waren meine Eltern nie in einem Urlaub. Sie haben zeitlebens beide nie ein Flugzeug bestiegen. Auch das Meer haben sie nicht mit eigenen Augen gesehen. Wir Kinder haben während Schulferien manchmal einzeln ein paar Tage auswärts verbringen können bei Verwandten. Als ich zum ersten Mal bei meiner Langnau-Grossmutter in die Ferien durfte, hätte ich mich unter den Stubentisch gesetzt und vor Heimweh geweint. Noch später, in einer Ferienkolonie in Laax, mussten mich die Eltern wieder holen weil ich vom Heimweh geplagt wurde. Ich war schon immer sesshaft und am liebsten zu Hause. Noch heute besteht bei mir das Risiko vom Ferien-Koller bei längerem Aufenthalt in fremder Umgebung.
Wir vier Kinder lebten in unserer Liegenschaft wie auf einer kleinen Insel die keine Wünsche offen lässt. Im Rückblick ein Paradies.

Meine Eltern erzogen uns gewaltfrei, wir wurden nicht geschlagen. Meistens genügte eine Androhung, beispielsweise der Verzicht auf Taschengeld, welches wir wenn ich mich richtig erinnere so ab der 2. Schulklasse bekamen im Umfang von etwa zwei Franken. Wirkungsvoll war auch die Drohung der Mutter, sie sage es dem Vati wenn er von der Arbeit heimkomme.
Im Haushalt war ich als einziger Sohn von Arbeiten dispensiert trotz gelegentlichem Protest meiner drei Schwestern. Obschon, die Mutter hat das Meiste ohnehin selber erledigt. Beim alljährlichen Frühjahr-Putz mussten alle mithelfen. Die Rosshaar-Matratzen und die Bettdecken wurden nach draussen geschleppt und kräftig durchgeklopft. An die Teppichklopf-Stange kamen die Läufer aus den Schlafzimmern und der Stubenteppich.
Am Samstag mussten wir jeweils in der Bäckerei einen Vierpfünder Brot abholen und gleich den nächsten bestellen. Ab und zu mussten wir auch Milch holen mit dem Kesseli. Zuoberst nach der steilen Hernerholzgasse war an der Einsiedelerstrasse eine Milch-Sammelstelle mit Lädeli. Gewöhnlich wurde Milch und Butter geliefert vom Milchmann, ins Milchbüchlein eingetragen und monatlich bezahlt.

Ob meine Eltern religiös waren weiss ich nicht, Religion und der Glaube von anderen war kein Thema. Gewarnt wurden wir Kinder vor einer privaten Bibelstunde in der Nähe, da sollen wir uns nicht ansprechen lassen, das sei eine Sekte. Die Traditionen lernten wir ohne irgendwelche Einbildungen. Zur Fasnacht, das war einfach sich verkleidet begegnen, backte Mutter selber die dünnen Küchlein mit Puderzucker und schneiderte uns Kostüme. An Ostern, das war das Frühlingsfest, wurde mit einem Anke-Lamm mit Butterzopf begonnen, als Mittagessen gab's Chüngel (vom Grossvater gemetzgt und im Schopf abgehangen). Die Eier zum Tütschen wurden selber gefärbt mit Zwiebel-Schalen, umwickelt mit Gräsern und Blumen für ein schönes Dekor. Am ersten August wurde mit Lampions dekoriert. Dann kamen die Dorf-Chilbi und schon bald wieder der Samichlaus, solange wir noch Angst vor ihm hatten und nicht wussten, dass unter dem weissen Bart der Onkel Heiri steckte. Nach dem Aufsagen der Verse genossen wir Lebkuchen und Grittibänz. Die Räbechilbi in Richterswil anfangs November wurde jedes Jahr besucht. Wir Kinder froren manchmal jämmerlich weil es zu kalt war um längere Zeit draussen stehend zu warten. Den Abschluss machte die Wiënacht abends am 25. Dezember mit den Kerzen am geschmückten Tannenbaum aus dem eigenen Wald und zuoberst einem Glöcklein-Spiel. Da mein Vater nicht den schönsten gesunden Baum schnitt, stand meist eher ein Chrutzli im Wohnzimmer. Zuerst wurden die bekanntesten Lieder gesungen und dann Geschenke geöffnet. Jahreswechsel Silvester, Heiligabend und Dreikönig hatten keine Bedeutung. Trotzdem brachte uns Mutter jedes Jahr einen König-Kuchen und Karton-Krone mit aus der Bäckerei.
Politisch waren meine Eltern sachbezogen und sonst neutral, soweit ich dies überhaupt einschätzen kann. Jedenfalls waren sie keiner Partei zugehörig. Mein Vater hat beim Zeitung lesen oft laut kommentiert und seine eigene Meinung geäussert. Das waren dann meistens ausführliche Belehrungen. Ich würde ihn als eher sachlich und sozial gerecht einordnen. Gelernt habe ich von ihm, die Tageszeitung zu lesen und mich darüber hinaus stets nicht einseitig, sondern umfassend zu informieren.


Meine Mutter war für mich die Geborgenheit in Person. Sie war einfach immer da und lebte für ihre Familie. Mit ihrer inneren Ruhe und Geduld entstand Harmonie von selbst. Nicht dass sie auch resolut den Gehorsam erzwingen oder wenn nötig laut werden konnte.
Sie wurde 1927 als jüngstes von 6 Kindern geboren in Langnau im Emmental. Der älteste Bruder war da schon 22, die älteste Schwester 19 Jahre. Nach der Schule absolvierte sie eine Verkäuferinnen-Lehre. Seit der Heirat mit meinem Vater 1951 war sie nie mehr berufstätig, sondern Hausfrau und Mutter. 1946 mit 19 wohnte sie in Bern und arbeitete dort beim Elektrogeschäft Berger im Verkauf. Wie eine Postkarte zeigt, wurde auch für kurzfristige Mitteilungen nicht das Telefon benutzt.
Mit 24 heiratete sie meinen 31-jährigen Vater, zog zu diesem auf den Bauernhof seiner Eltern in Horgen und brachte 1951 ihre erste Tochter zur Welt. Von ihrer Schwiegermutter sei sie von Anfang an abgelehnt worden, vermutlich weil sie bei der Hochzeit bereits guter Hoffnung war. Ich kann mich an kein einziges längeres Gespräch zwischen den beiden erinnern in all den Jahren. Und dazu war auch noch das Verhältnis Ehemann-Schwiegervater vorbelastet. Ihr Mann verliess sein Elternhaus 1939 im Streit, weil ihm der Vater die selbständige Landschaft-Gärtnerei verweigerte.
Meine Mutter war ausgeglichen, selbstsicher und duldsam. Sie wusste was sie wollte und was sie nicht wollte. Gerede von anderen störte sie nicht, die sollen doch. So konnte sie auch die Antipathie ihrer Schwiegermutter einfach wegstecken. Gewohnt wurde zwar im gleichen Haus mit zwei Eingängen, man sah sich, war höflich aber hatte sich nichts zu sagen und blieb distanziert über Jahrzehnte. Sie machte sich nichts daraus, sah grundsätzlich nur das Gute. Sie hat nie geraucht, Alkohol trank sie nur ausnahmsweise anstandshalber zum Anstossen in Gesellschaft.
Der Kontakt zu ihren Eltern und Geschwister war eher spärlich mit Ausnahme zur älteren Schwester Ida (meinem Gotti), welche ebenfalls in Horgen wohnte. Das Emmental war damals nicht gerade am Weg mit vier Kindern und wurde vielleicht einmal im Jahr besucht. Ihr Bruder Ernst war ein Direktor bei den Verkehrsbetrieben Zürich, seine Frau Toni war die Gotte meiner Schwester Ruth. Die Schwester Gret lebte bei Solothurn und war die Gotte meiner Schwester Thesi. Der Bruder Hans lebte in Zürich und kam ab und zu vorbeischauen. Meine Mutter ging später monatlich zwecks Reinigung in seine Wohnung und fand ihn 1981 im Alter von 58 tot hinter der Wohnungstür liegen. Sie habe über ihn hinweg steigen müssen um in der Wohnung telefonieren zu können.
In die Ehe mit der Aussteuer eingebracht hatte sie eine Nähmaschine Pfaff mit Pedal-Antrieb. Damit konnte sie nach Schnitt-Muster die Kleider selber herstellen. Ebenfalls hatte sie zwei dicke Bücher, ein Kochbuch und einen Leitfaden für die perfekte Hausfrau und Mutter. Was sie dann im Vollzeit-Dienst rund um die Uhr auch war.
Mit uns Kindern war die Mutter fürsorglich behutsam und nachsichtig, solange wir nicht über die Stränge schlugen. Bei Bedarf half sie bei den Hausaufgaben für die Schule. Diskutiert wurde nicht im Zweifel, wir mussten gehorchen. Sie kochte gerne und gut. Mein Vater verlangte zu jeder Mahlzeit voraus eine Suppe, der Salat wurde, anders wie heute üblich, erst zum Schluss gegessen. Zum Mittagessen wurden um 12.30 Uhr die Nachrichten auf Radio Beromünster gehört und da durften wir, wenn Vater dabei war keinen Mucks machen. Wir mussten aufessen und am Tisch sitzen bleiben bis alle fertig waren.
Zur Wiënacht trafen sich traditionell am 26. Dezember alle ihre Kinder mit Enkelkindern zum gemeinsamen Essen und anschliessenden Feiern. Die Enkelkinder waren gerne bei ihr zu Besuch, gelegentlich auch während dem Jahr. Zu runden Geburtstagen ihres Mannes wurde im Alter jeweils die Eichloch-Hütte oben im Wald angemietet und dort mit der nahen und weiteren Verwandtschaft gefestet.

Zwei Monate nach ihrer Verlegung in ein Pflegeheim wollte meine Mutter, jetzt ganz bettlägerig, nicht mehr weiterleben und verlangte nach der Freitod-Begleitung durch die Sterbehilfe-Organisation Exit. Als Neumitglied musste sie zuerst 3700 Franken einzahlen und durfte 93-jährig am 3. Juli 2020 im Beisein von zwei ihrer Töchter friedlich sanft entschlafen.


Mein Vater erscheint mit einer natürlich angeborenen Aura der Respekt-Person. Ernsthaft an der Sache interessiert und orientiert. Er war mündlich besser als schriftlich. Eher einer jener welche sich selber gerne reden hören. Er erzählte oft aus seinem Fundus an gelebter Erfahrung, wenn auch sich die Geschichten über die Jahre hinweg wiederholten. Er war umgänglich und zugänglich, konnte überall zu jedem Thema in eine Diskussion einsteigen oder selber ein Gespräch beginnen. Mit seinen Kindern gespielt hat er nicht, ausser manchmal am Abend mitgemacht beim Eile mit Weile. Er hat gerne gejasst, das war für uns dann später schon fast wieder zu viel wenn wir keine Lust dazu hatten.
Politisch hat er nicht Partei genommen, aber Wahlen und Abstimmungen waren ihm Pflicht. Die damals gängigen Klischees, die Vorurteile, hat er uns ohne gross hinterfragen weiter gegeben. Eine Abneigung hatte er vor allem gegen die Italiener, Tschingg genannt wegen ihrem Würfelspiel Cinque, welche in den 60er Jahren zu Tausenden vor allem als Saisonier in die Schweiz arbeiten kamen.
Er absolvierte nach der Sekundarschule eine Lehre als Landschafts-Gärtner in der Gärtnerei Strickler in Richterswil mit Kost und Logis. Bei der militärischen Aushebung zur Rekrutenschule 1939 wurde er für ein Jahr zurückgestellt (mit Körpergrösse 173 bloss 55 kg Gewicht) und schliesslich als Motorfahrer dem Hilfsdienst zugeteilt, wo er das Lenken von schweren Lastwagen lernte.
Die Lehrzeit beendet, hatte er den Wunsch, auf der elterlichen Liegenschaft im Herner selbständig eine Landschafts-Gärtnerei zu betreiben, was ihm aber von seinem Vater verweigert wurde und zum Bruch führte. Er suchte und fand eine Arbeit in Ostermundigen nahe Bern in der Gärtnerei Woodtli und zog dorthin um. 1946 kam er auf Wunsch seines Vaters zwecks Mithilfe wieder zurück in den Herner nach Horgen, weil seine Mutter für längere Zeit arbeitsunfähig wäre.
Gärtnerei Woodtli Ostermundigen, Gärtner
Baumschule Rusterholz Oberrieden, Gärtner und Lastwagen-Fahrer
Baubedarf Zürich, Lastwagen-Fahrer
Wegen seiner Angina Pectoris musste er aufhören beruflich Lastwagen zu fahren. Er besuchte eine kaufmännische Abendschule in Zürich zwecks Zusatz-Ausbildung.
Transport-Kontor Zürich, Rechnungsbüro
Landis & Gyr Zug, Lagerist
Seehotel Meierhof Horgen, Garagenchef
Parkhaus Hallenstrasse Zürich, Operator
Kläranlage Horgen, Betriebsassistent
Gemeindewerke Horgen, Vermessungsamt
Fähre Horgen-Meilen, Kassier
Stäubli Horgen, Privat-Gärtner
Zwischenzeitlich rauchte er die Sargnägel genannten Toscanelli-Stumpen, später dann schmale Brissago-Zigarren und verbrauchte Unmengen Treupel-Tabletten gegen seine Kopfschmerzen.
An seinen Autos hat er gerne gearbeitet mit Reparatur-Anleitungen aus dem Buchladen. In der alleinstehenden Garage im Herner konnten dicke Bahnschwellen unter dem Wagen entfernt und aus der Grube von unten her am Auto gearbeitet werden. Zuerst ein Fiat Topolino mit Faltdach und Reserverad am Heck, dann Simca1000, Simca1300, Renault16. Gegen Fahrzeuge aus England hatte er den Vorbehalt, die würden zu schnell rosten.
Er arbeitete immer, war nie arbeitslos. Trotz seinem eher bescheidenen Einkommen als Allein-Verdiener für die sechsköpfige Familie machten meine Eltern keine Schulden und uns mangelte an nichts. Allen vier Kindern wurde eine Berufslehre ermöglicht.

Mit seinen Geschwistern hatte mein Vater nur sporadisch Kontakt. Sein jüngerer Bruder war Gründer und Verleger vom Dreispitz-Zeitungsverlag in Zürich und Götti meiner älteren Schwester Ruth. Er kam jeweils kurz vorbei wenn er seine Eltern besuchte. Als mein Vater auf dem Weg zur Arbeit in Zürich mit dem Auto unverschuldet in eine Kollision verwickelt wurde, hat sein Bruder ihn nachmittags nach Horgen gebracht am Gehstock mit einem grossen Pflaster an der Stirn. Die Schwester Aline war Gotte meiner Schwester Regi und kam öfter zu Besuch. Sie war Handarbeit-Lehrerin in Zürich, ledig und streng gläubig in einer evangelischen Freikirche. Jede Weihnacht brachte sie allen Kindern Geschenke. Vaters Lieblingsschwester war die Hanna, welche ab und zu besucht wurde in Grüningen. Ihre Kinder waren einzeln auch mal ferienhalber bei den Grosseltern in Horgen.
Als die Erbschaft nach dem Tod beider Eltern verteilt war, arbeitete er noch wenige Jahre Teilzeit als Privat-Gärtner in Horgen für die Villa eines Industriellen. Nachher widmete er sich voll und ganz dem Unterhalt der Liegenschaft, die ihm nicht mehr gehörte.
Anders wie sein Vater war mein Vater mit den Nachkommen grosszügiger: Einem Schwiegersohn verhalf er mit rückzahlbarem Darlehen zum eigenen Optiker-Geschäft, einem anderen Schwiegersohn kaufte er ein Boot auf dem Genfersee und bestand dazu die Schiffer-Prüfung (selbst mit dem Boot gefahren ist er allerdings bloss 2-3 Mal). Mir ermöglichte er zusammen mit meiner Frau die Selbständigkeit durch Kauf eines Lebensmittel-Geschäftes in der Stadt Zürich. Sich selber gönnte er einen Plymouth Barracuda V8 aus Schweizer End-Montage und eine Handharmonika Hohner-Gola. Fortan nahm er Einzel-Unterricht am Instrument, wurde Mitglied in einem Orchester-Verein und besuchte Musiklehre-Vorlesungen an der Volkshochschule in Zürich.
Vor allem interessierte ihn nun die klassische Musik. Sein Cousin war Organist der reformierten Kirche Richterswil und er besuchte oft dessen Johann-Sebastian-Bach-Orgel-Konzerte. Seine Frau musste, wenn auch eher widerwillig, meist auch mit dabei sein.
1994 erfolgte der Umzug in eine Zwei-Zimmer-Wohnung der Alterssiedlung Tannenbach. Ein paar Jahre später verzichtete er freiwillig auf seinen Auto-Führerschein, weil er seine Unsicherheit merkte. Obwohl ich ihm von der Narkose im hohen Alter abriet, liess er sich nach jahrelangen Schmerzen mit 80 noch künstliche Hüften einpflanzen.
Eine sich schon länger ankündigende Demenz wurde schliesslich als Alzheimer erkannt und führte Mitte 2010 nach einem kurzen Spital-Aufenthalt zur Einweisung in ein Pflegeheim, wo er 2017 verstarb. Mutter besuchte ihren Gatten bis zuletzt jeden Sonntag. Als mich der Vater nicht mehr als seinen Sohn erkannte, habe ich auf weitere Besuche verzichtet.


Dieser Ehe entstammten 6 Kinder:
Ernst 1905, Ida 1908, Gret 1911, Willi 1913, Hans 1922, Ruth (meine Mutter) 1927
Bemerkenswert sind die Abstände zwischen den Kindern. Bei der Geburt meiner Mutter war ihr ältester Bruder bereits 22 Jahre, die älteste Schwester 19.

An meine Grosseltern mütterlicherseits habe ich nur noch eine verblasste Erinnerung. Ich durfte als Kind mehrmals jeweils im Sommer eine Woche zu ihnen nach Langnau ins Emmental.
Die ersten Nächte, bis sich Gewöhnung einstellte, wurde ich von den endlos langen Güterzügen geweckt, welche nur dreissig Meter vom Wohnhaus entfernt auf der Eisenbahn-Linie vorbei ratterten. Tagsüber konnte ich allein die Umgebung erkunden. Gerne stieg ich auf den hundert Meter höher gelegenen Mörker, ein naher Aussichtspunkt an der Flanke des Dorfberges von Langnau. Dort im Wald suchte ich nach speziell geformten Wurzeln, als ich, etwa zehnjährig, das Gefühl verspürte, angestarrt zu werden. Mich umschauend bemerkte ich in einiger Entfernung einen Mann, welcher mich beobachtete. Nachdem ich mehrmals die Richtung gewechselt hatte, war dieser Mann noch immer da. Erschrocken ergriff ich nun panisch die Flucht, rannte durch den Wald bergab ins Freie und durch hohes Gras einer Wiese zur einzigen Strasse im Seitental, wo ich noch nie war. Mit einem zufällig vorbei kommenden Pferdefuhrwerk konnte ich mitfahren bis zur Molkerei in der Nähe meiner Grosseltern. Fortan vermied ich die Alleingänge im Wald.
Die beiden gingen damals gegen die 80 Jahre zu. Der Grossvater war ein stiller, schmächtiger Mann, neben der stämmigen Grossmutter wie ein Schatten kaum vorhanden. Sie entsprach, wie meine Mutter, dem typischen Emmentaler-Modi; Pfarrer David Ris aus Trachselwald schrieb 1762 in seiner Beschreibung des Emmentals über die Emmentalerinnen: Die Weibspersonen sind gewöhnlich von starker und etwas besetzter Leibesgestalt, solche, die mit stark roten Wangen und fetten Leibs sind, werden unter die vorzüglichen Schönheiten gerechnet.
Mein Langnau-Grosmuëti war eine fürsorglich liebe und ruhige Frau, ich war gerne bei ihr und fühlte mich geborgen. Oft sass sie lesend im verglasten Eintritt über der Treppe zum Seiten-Eingang, von wo aus sie den Überblick hatte auf die Hauptstrasse und die dort vorbei gehenden Menschen.
Im Untergeschoss mit Oberlicht-Fenstern befand sich die frühere Werkstatt mit zwei grossen Tischler-Bänken aus Holz, einst Arbeitsplätze für das Handwerk meines Grossvaters.
Eine Mansarde mit separatem Treppen-Zugang wurde von einem Cousin bewohnt, welcher von den Grosseltern aufgenommen worden war, nachdem seine Mutter den Vater, ihren Sohn, verlassen hatte. Seine Schwester kam zu ihrer Tante, meiner Gotte, in Horgen.
Johann und Emma Ramseier-Flückiger fanden im hohen Alter zur Pflege Aufnahme in Horgen bei der Tochter Ida Grivel-Ramseier (meinem Gotti). Das Haus an der Burgdorfstrasse in Langnau wurde verkauft. Emma verstarb 1969 mit 84, Johann 1972 mit 89 Jahren.


Mein Urgrossvater Hans Heinrich Pfister, Landwirt im Neuhaus am Rain in Schönenberg verstarb 1909 jung im Alter von erst 48 Jahren. 1882 wurde er wegen einem Herzleiden vom Militärdienst dispensiert. Der Hof wurde verpachtet. Die beiden Kinder Kaspar (mein Grossvater) und Meta kamen unter die Vormundschaft ihres Onkels Arnold Pfister. Kaspar absolvierte eine landwirtschaftliche Ausbildung auf dem Hof von Rudolf Treichler in Samstagern. Die Tochter Meta fand zusammen mit der Mutter Unterkunft bei deren Bruder Konrad Rusterholz-Höhn auf dem Hof zur Buechen in Schönenberg.
Mit Mai 1914 übernahm der nun volljährige Kaspar das väterliche Neuhus als Heimwesen zu Eigentum und Bewerbung auf eigene Rechnung, worauf die ganze Familie, also Mutter und Schwester, wieder dort einzog. 1918 verkaufte er den Hof an die Familie Lardi und erwarb für 78'000 Franken von seiner Tante Seline, Witwe von Landwirt Walter Heinrich Höhn, den Hof im Herner in Horgen (mein Elternhaus) und zog dorthin.
Meta, geb. 1903, kam nach Abschluss der Sekundarschule nach Arosa und arbeitete dort in der Konditorei Simmen an der Kasse. Bereits in Arosa lebte ihre Cousine Martha Emma Pfister, das einzige Kind von Arnold Pfister und Emma Rusterholz. Diese war nach der Schulausbildung in die Saison-Hotellerie geschickt worden, wurde lungenkrank und kam deshalb nach Arosa wo sie den Postbeamten Richard Max Keller heiratete. Die beiden besassen in Arosa mehrere Häuser, deren Wohnungen vorwiegend an Kurgäste vermietet wurden. Das Paar bekam trotz bester Absicht keine Kinder. Nachdem einst Hanna Pfister, Tochter von Kaspar im Herner Horgen bei Kellers in Arosa in den Ferien war, habe Marthas Vater Arnold seinen Neffen und ehemaliges Mündel Kaspar angefragt, ob er nicht seine Tochter Hanna weggeben würde, weil seine Tochter Martha an dieser Gefallen gefunden hätte. Es habe meine Grossmutter sehr getroffen und Arnold habe nie mehr im Herner in Horgen vorbeikommen dürfen.
Mein Grossvater heiratete 24-jährig 1919 die 23-jährige Seidenweberin Alina Laura Leuthert von Ludretikon in Thalwil, Tochter eines Fergger-Meisters in der Seidenweberei mit eigener Web-Stube in Einsiedeln. Grossvater habe getrunken, sauren Most (Apfelwein, Alkoholgehalt mit Bier vergleichbar) und dann betrunken seine Frau geschlagen bis er mit Kontaktverbot für einen Monat von seiner Familie entfernt wurde und nachher unter Kontrolle war durch die Drohung seines Schwiegervaters, er würde seine Tochter samt Kindern nach Einsiedeln holen. Mein Vater habe sehr, auch noch später, darunter gelitten, weil er als Kind vom betrunkenen Vater abgeschlagen worden sei.
Dieser Ehe entstammten 4 Kinder:
Robert 1920 (mein Vater), 1921 Aline, 1923 Hanna, 1925 Hans-Heinrich
Obschon im gleichen Haus wohnhaft sah ich meine Grossmutter eher selten. Sie lebte zurückgezogen. Draussen war sie im Garten, pflegte Gemüse oder war beim jäten. Ich habe nie einen gefühlsmässigen Bezug zu ihr entwickelt.
Anders mein Grossvater. Der war immer irgendwo beim werken und störte sich nicht an uns Kindern. Sonntags nahm er mich manchmal mit auf Reise, immer allein ohne seine Frau. Er hatte Nitro-Glyzerin in der Jackentasche für sein Herz und zeigte mir jedes Mal wo er das hatte, für den Fall der Fälle. Ich half ihm bei der Arnika sammeln, welche dann im Schnaps-Bad an die Sonne gelegt wurden. Oder in den Sihlwald durfte ich mit zum Bürdeli (Reisigbündel) machen. Er hatte zwar eigenen Wald, aber da waren mehr Äste am Boden. Den zusammenklappbaren Bürdli-Bock geschultert mit der Bahn durch den Tunnel nach Sihlbrugg und dort hinauf in den Wald. Ich musste die Äste zutragen und er schnitt sie zurecht. Ich freute mich jeweils auf die Pause mit einem Süssmost, Cervelat und Brot. Die Bürdeli wurden dann von meinem Vater mit dem Auto in den Herner überführt.

Eines Tages, als mein Vater die Ruhe in der Nachbarwohnung bemerkte und niemand reagierte, stieg er über eine Leiter durch ein Fenster in die Wohnung und fand seine Mutter in der Küche am Boden liegend. Sie war hingefallen und konnte nicht mehr aufstehen. Seit Jahren war bei ihr zunehmend, wie damals gesagt wurde, die Arterien-Verkalkung feststellbar an einem starren Blick. Der Grossvater lag schlafend, aber tot in seinem Bett. Sie kam noch ins Spital und verstarb dort gleichen Jahres 1971.

Mit Jahrgang 1953 werde ich bei den mittleren Generationen der sogenannten Babyboomer eingeordnet.
Der starke Anstieg der Geburtenraten zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Pillen-Knick Mitte der 1960er-Jahre wird als Babyboom bezeichnet. In der Zeit des Babybooms war die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau und damit auch die Gesamtzahl der Geburten, im Vergleich zu den vorherigen und den nachfolgenden Jahren, deutlich höher. Diese Periode ist auch als Wirtschaftswunder in Erinnerung. Es herrschte eine positive Aufbruch-Stimmung und Hoch-Konjunktur. Die fruchtbaren Nachkriegsjahre werden auch das goldene Zeitalter von Ehe und Familie genannt, in dem eine grosse Kinderschar erwünscht und auch finanzierbar war. Mitte der 1960er-Jahre gingen die Geburtenzahlen drastisch zurück. Ursache dafür waren nicht nur die verbesserten Methoden der Verhütung, sondern auch Tendenzen zur Individualisierung in der Gesellschaft. (Statistisches Amt des Kantons Zürich, Baumberger 2005).
Durch den gegenteiligen Tatbeweis der Weltkriege wurde für meine Eltern der bisher gläubige Schön-Geist von Universität mit Philosophie und Religion zwecks Nachfolge-Prägung weitgehend hinfällig und durch ein individuelles, kritisch zweifelndes Misstrauen ersetzt. Gedanklich war ich meinem eigenen Denk-Vermögen überlassen, wie vermutlich viele andere der Nach-Kriegs-Generationen ebenfalls.
Nach der Geburt das Familienfest der Taufe. Die Aufnahme der Nachkommen in die soziale (Seelen-)Gemeinschaft wird schon vor Jahrtausenden sichtbar in keltischer Kultur, wo Benelos mit dem Festakt Beltaine (1. Mai) die Taufe vornimmt damit der Lebensbaum weiter getragen wird (ein Bild dieser Szene ist zu finden im berühmten Silber-Kessel von Gundestrup). Inwiefern die heute zunehmend übliche Praxis der blossen Eintragung in die staatlichen Personen-Register zur Aufnahme genügt wird sich noch zeigen.
Obschon meine Eltern beide keine Kirchgänger waren, sie haben alle vier Kinder taufen lassen in der Reformierten Kirche Horgen. Dort, wo sie ihre Kirchensteuer bezahlten, obwohl sie keine Predigt besuchten und nicht im heiligen Buch lasen.
Religion war bei uns zu Hause nie ein Thema. Ich habe weder mit Mutter noch mit Vater je über ihren oder meinen Glauben gesprochen und wurde von ihnen auch nicht diesbezüglich angefragt oder beeinflusst. Der persönliche Glaube von anderen war sozusagen tabu. Anders meine Grossmutter in Langnau. Als ich etwa fünfjährig erstmals bei ihr mehrere Tage zu Besuch sein durfte, setzte sie sich beim gute Nacht wünschen zum Beten an mein Bett und musste mir dann erst mal erklären was das genau sein soll. Am nächsten Tag vor dem Mittag-Schläfchen setzte ich die neue Erkenntnis gleich um und so betete ich innig um 20 Rappen für eine Glace in der Molki. Als ich nach dem Schlaf am vereinbarten Ort nichts vorfand, war ich masslos enttäuscht und die Sache mit dem lieben Gott hatte sich einstweilen erledigt für mich.

Tauf-Gotte war Ida Grivel-Ramseier, die 19 Jahre ältere Schwester meiner Mutter. Ida lebte schon länger in Horgen, zuerst sogar in einem Nachbarhaus beim Herner. Mein Gotti wohnte später etwa 2 Kilometer entfernt und wurde von mir als Kind gerne besucht. Zum einen wegen der feinen Himbo-Limonade, welche sie immer für mich bereit hielt und vor allem wegen dem Fernseher, wo ich jeweils die Serienfilme von Fury oder Lassie sehen durfte. Ihr Mann Heiri, Friedhof-Gärtner in Horgen, lag nach dem Feierabend während dessen auf dem Divan und las stets in einem Wildwest- oder Jerry-Cotton-Roman-Heftli. Auf dem Weg zu ihr an der Zugerstasse befand sich ein Hufschmied, wo ich manchmal zusehen konnte, wie unter dem Vordach ein Pferd beschlagen wurde, nachdem der Schmied das glühende Eisen auf dem Amboss gehämmert hatte.
Tauf-Götti war Hans Leutert-Leuthert, Ehemann von Martha, der Schwester meiner Grossmutter. Im Stammbaum sind beide von Ottenbach. Nach der Reformation anfangs 16. Jahrhundert behielten die katholischen Leuthard den Namen, die reformierten bevorzugten nun Leuthert und Leutert. Hans wohnte in Einsiedeln im eigenen Einfamilienhaus, das ehemalige Elternhaus seiner Frau und war Textil-Handelsreisender. Er besuchte meine Mutter sporadisch, um wieder eine Bestellung aufzunehmen für neue Calida-Unterwäsche, Schlafanzüge oder Bettwäsche. Mutter seufzte manchmal, wenn das Haushaltgeld ohnehin schon überstrapaziert war und der Hans jetzt auch noch unerwartet vorbeikam. Mit dem Götti hatte ich keinen Kontakt, freute mich aber über gelegentliche Geburtstag- oder Weihnachtsgeschenke per Post. Zur Konfirmation schenkte mir der Götti meine erste Uhr, eine automatische Mido-Armbanduhr.

Auch von Hand musste gemäht werden. Im Gerätehaus neben dem Wasch-Haus hingen Sensen und Rechen. Daneben standen Gabeln und der mobile Dengel-Bock. Das Gras wurde nun nicht mehr benötigt und zur Gras-Teeri, der Gras-Trocknungs-Anlage Beichlen gebracht von wo das Heu nicht mehr in den Herner zurückkehrte. Mancher Schnitt wurde auf dem Misthaufen im Garten deponiert, wo Gurken wuchsen und aus dem Kompost mittels Umschichtung am Schluss neue Garten-Erde ausgesiebt wurde. Die Gülle aus der Jauchegrube unter dem Plumpsklo wurde bei Bedarf abgepumpt und mit sechs Meter langen, verzinkten Eisenrohren zum Spritz-Schlauch auf der Wiese geleitet.
Der Ackerbau wurde auf den grosszügig bemessenen Gemüse-Garten für den Eigenbedarf reduziert. Die Garten-Beete vor dem Haus waren mit Stein-Platten eingefasst und konnten zu Zweit mit Glasfenstern abgedeckt werden, welche am Kopf der Beete gestapelt waren. Spannend war jeweils die Suche nach einer Werre (Maulwurfs-Grille) wenn wieder eine im Beet vermutet wurde.
Mein Grossvater war jetzt über 60 und brauchte nach dem Landverkauf kein Einkommen mehr. Bald wurde auch der Hühnerhof hinter dem Waschhaus beim Bienenhaus aufgehoben. Das Hühnerhaus wurde zu einem Kaninchen-Stall umgebaut. Ausser den Bienen und Kaninchen waren auf dem Bauernhof jetzt nur die Katzen (einen Hund hatten wir nie). Immer viele Katzen, deren Anzahl auf die damals übliche Weise nicht Tierschutz gerecht reguliert wurde. Und da waren noch die Feldmäuse, denen der Grossvater nachstellte indem er Draht-Fallen in deren Gänge platzierte.
Beibehalten wurden nebst dem Saison-Gemüse die Obstbäume (Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Pfirsich), die Beeren (Himbeere, Erdbeere, Brombeere, Johannisbeere, Holunder) und die Schnitt-Blumen. Im Gewächshaus, dem Wasch-Haus angebaut mit Zugang von diesem, wurden aus den Samen die Setzlinge kultiviert.
Im Schopf, das war ein Anbau vom Wohnhaus, stand eine imposante Most-Presse mit Riemen-Antrieb. Mit dem elektrisch betriebenen Warenlift wurden die Obst-Harassen ins Obergeschoss gebracht zur Lucke der Obstmühle. Von einem Elektromotor aus setzten breite Lederriemen über Holzräder die messerscharfen Klingen der Häcksel-Einrichtung in Betrieb. Das Obst wurde oben in den Häcksler geleert und die Schnitzel fielen in ein Rund aus dicken Latten wie in ein grosses, oben offenes Fass. Dann wurde ein Deckel aufgesetzt und das Getriebe von Häckseln auf Pressen umgestellt. Der Antrieb erfolgte nun über einen Spindel, welcher den Deckel nach unten drückte und das zerkleinerte Obst auspresste. Der goldfarbene Most sprudelte aus einem Rohr in den grossen Bottich neben der Presse. Ein unvergessenes Erlebnis, diesen noch schäumenden frisch gepressten Süss-Most zu trinken.
Vom Schopf führte eine Rampe aus dicken Holzbrettern in den Natur-Keller des Wohnhauses. Dort standen noch vier mannsgrosse Eichenfässer, die aber keine Verwendung mehr fanden. Der Most für den Eigenbedarf wurde in tragbare 25-Liter-Standflaschen abgefüllt. Der pasteurisierte blieb Süssmost, der andere vergärte zum Sure-Most. Press-Rückstand (Trester) wurde im Fass vergärt und später im Wasch-Haus mit der eigenen Brennerei zum Träsch verarbeitet. Der hochprozentige Schnaps (bis gegen 80%) wurde bei uns nie pur getrunken, sondern zur Aromatisierung von Kaffee verwendet.
Ebenfalls im Schopf war die Brennholz-Säge mit Schiebetisch. Unten auf drei Seiten geschlossen zum Auffangen vom Sägemehl. Im Herner wurde bis zuletzt mit Holz geheizt aus dem eigenen Hernerholz oben am Berg. Das Holz musste mit der Säge zugeschnitten und zuletzt mit dem Beil in ofengerechte Stücke gespalten werden. Nach dem Bau der Autobahn N3 war der Wald von 10'700 m² auf noch 6008 m² geschrumpft.
Aus diesem Umfeld heraus begann 1958 meine Schulzeit. Die selber nicht aktiv religiösen Eltern schickten mich trotzdem in die freiwillige reformierte Sonntag-Schule. Dort erzählte uns eine Frau von den Gleichnissen im christlichen Kontext. Der barmherzige Samariter, der verlorene Sohn und dergleichen mehr. Faszinierend fand ich die Kollekte: Beim Einwurf der obligaten zwanzig Rappen nickte das auf dem Kästchen montierte "Negerli" mit dem Kopf (Menschen mit schwarzer Hautfarbe wurden damals korrekt mit Neger bezeichnet).
Der Kindergarten Brunnenwiesli war in 550 Metern Distanz an der Einsiedlerstrasse, welche mit 30 Meter Höhenunterschied weiter oben über den steilen Hüsliweg erreichbar war. Im Kindergarten lernte ich (mit Mühe) die Schuhe binden. Die Laus-Tante untersuchte alle auf Kopfläuse. Meine Mutter musste mich einmal begleiten, weil ich Angst hatte zum Besuch, da mir auf halbem Weg im Stocker-Rank ein schon älterer Schüler auflauerte und mich drohend bedrängte. Nachdem sie diesen stellen konnte habe ich ihn nie mehr gesehen.
Der Weg zum Kindergarten führte bei einer Metzgerei an der Einsiedlerstrasse vorbei. Eines Tages hörte ich zusammen mit zwei anderen auf dem Heimweg aus dem Hinterhof lautes Gebrüll. Eine Kuh weigerte sich das Gebäude zu betreten. Wir kletterten im Durchgang hoch zu einem offenen Oberfenster und sahen, wie die Kuh drinnen nach dem Bolzenschuss wie vom Blitz getroffen umfiel, das Blut nach dem Schnitt am Hals über den Boden strömte. Dann wurde sie an den Hinterbeinen hochgezogen und mit Wasser abgespritzt. Dabei wurden wir entdeckt und mit einem Wasserstrahl verscheucht. Den Gestank oder besser den eigenartigen Geruch vom Schlacht-Raum habe ich noch heute in meiner Nase wenn ich daran denke. Jedenfalls habe ich seit Kindheit zum Essen lieber kein Fleisch. Essen kann ich zwar alles, aber ob es mir schmeckt kann ich erst sagen wenn ich das Fleisch gekostet habe. Heikel meinen einige, andere sagen kulinarischer Tief-Flieger, egal, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Zu Hause habe ich auch schon früh meinem Grossvater zusehen können wie er im grossen Wasch-Haus mit der Axt dem Huhn den Kopf abschlug oder dem Kaninchen den Kleinkaliber-Schuss setzte, an ein Brett hängte, aufschlitzte (die Innereien fielen in eine grosse Schaufel und wurden im Garten vergraben) und dann das Fell abzog.
Bedingt durch meinen Wohnort musste ich wegen neuer Klasseneinteilungen verschiedene Schulhäuser besuchen. Die 1. Klasse im Schulhaus Tannenbach (500 m Nordwest), die 2. und 3. Klasse im alten Dorfschulhaus (800 m Südost), die 4. Klasse in einem Pavillon-Provisorium beim Spital, die 5. und 6. Klasse wieder im Tannenbach. Die Sekundarschule dann im Berghalden-Schulhaus.
Den Schulstoff lernte ich problemlos. Als geborener Minimalist hatte ich keine Bestnoten, aber immer so zwischen gut und genügend. Am ersten Schultag, als meine begleitende Mutter bereits wieder weg war, habe ich kurz traurig weinen müssen weil mich die Lehrerin beim verteilen der Bleistifte übersehen hatte. Sie bemerkte das Missgeschick aber sofort und alles war wieder gut. Warum ich im Zeugnis bis zur 6. Klassen im Betragen durchgehend ein befriedigend oder unbefriedigend hatte weiss ich bis heute nicht. Vor die Türe gestellt wurde ich auch mal in der 2., aber vorher noch eine Ohrfeige dazu erhielt ich nur ein einziges Mal in der 5. Klasse. Ich blieb dann nicht vor der Schulzimmertüre sondern ging nach Hause und weigerte mich, weiter zur Schule zu gehen. Erst als mein Vater mit dem Lehrer ein Gespräch geführt hatte (ohne mich) war ich wieder zum Schulbesuch bereit.
Selber zu lesen begann ich mit Sprechblasen zu Bildern. Zuerst Globi-Bücher, Tim und Struppi war gratis in Apotheken, Fix-und-Foxi-Heftli vom Kiosk (Micky-Maus mochte ich nicht). Das Heftli holte ich selber am Kiosk, die Gratis-Selbstbedienung mit von der Seite anschleichen, vom Aushang abhängen und nach hinten wegrennen funktionierte bloss ein einziges Mal, nachher war das Heft im Innern.
So ab der 4. Klasse begann ich vermehrt zu lesen. Bebilderte Silva-Bücher und Hefte vom Jugend-Schriften-Werk (SJW). Tante Aline schenkte mir zur Wiënacht das Buch Winnetou von Karl May und dann jede Weihnacht einen Folge-Band. Ich las gern und viel, auch verbotenerweise nach Lichterlöschen unter der Bettdecke mit Taschenlampe. All die Jugendbücher wie die schwarzen Brüder, Onkel Toms Hütte, Kummerbuben, die rote Zora usw.
Zum Indianer spielen benutzten wir selber gemachte Pfeilbogen. Bäume waren vorhanden für den Marterpfahl. In der Senke vom damals noch nicht kanalisierten und eingedohlten Holzbach schloss ich echte Blut-Freundschaft mit einem Kameraden durch (leichtes) Ritzen der Handballen mit einem Sackmesser.
In der Nachbarschaft befanden sich ein Platten-Lager eines Gartenbau-Unternehmens und zwei Baracken, als Unterkunft für dessen italienischen Mitarbeiter. Zwischen den Platten kletterte ich mit Kameraden herum beim Räuber- und Polizei-Spiel. Ich hatte nach längerem Sehnen nun ebenfalls einen silbernen Chäpsli-Revolver aus Kunst-Stoff und konnte mich damit fühlen wie der berühmte Wyatt Earp im Wilden Westen in Amerika. Als ich mal alleine zwischen den Platten auf Erkundungstour war und zwischen ihnen hoch kletterte, löste sich das Abstand-Holzstück, fiel hinunter und die ganze Plattenreihe kippte gegen mich. Ich war eingeklemmt, zum Glück unterhalb vom Brustkorb, so konnte ich weiterhin atmen. Nach langem vergeblichen Rufen und Ausharren, es begann schon langsam zu dunkeln, hörte mich endlich ein heimkehrender Arbeiter und befreite mich aus meiner misslichen Lage.
Während dem Bau der Autobahn N3 Mitte der 60er-Jahre stiegen wir am schulfreien Mittwoch-Nachmittag jeweils hoch zur Baustelle und suchten nach herum liegenden leeren Bierflaschen der Bauarbeiter, welche wir dann bei einer Rücknahme-Stelle in Geld umwandeln konnten. Viele waren das nicht, aber für uns war jeder Rappen eben ein Rappen mehr.
Am See unten war ich oft, in der Boot-Haab stiegen wir unbeaufsichtigt ins tiefe Wasser noch bevor wir richtig schwimmen konnten. In der umzäunten Parkanlage nebenan befand sich ein Bootshaus, aufgehängt war eine alte Luxus-Jacht, die wir vom See her kommend entdeckten und drinnen staunend untersuchen konnten. Im Schwimm-Unterricht der Schule reihte ich mich zu Beginn gleich bei den Schwimmern ein obwohl ich erst den Hunde-Schwumm konnte. Richtig Brustschwimmen lernte ich aber schnell selber noch bevor das bemerkt wurde. Zum Baden ging Mutter schon früh mit uns in die Badeanstalt Seerose. Per Zufall sah ich wie meine zwei Jahre jüngere Schwester an der Ufermauer gerade den untersten Tritt einer Einstiegstreppe ins Wasser verliess und mehrmals verschwand und wieder auftauchte. Selber noch zu klein zum Eingreifen blieb mir nur das schreien und sie wurde aus dem Wasser geholt bevor sie ganz untertauchte. Bis ich mich den Kopfsprung vom Dreimeter-Sprungturm traute, habe ich erst jahrelang zugeschaut.
Bei der Haab haben wir auch gefischt. Ich hatte eine richtige Angler-Rute mit allem Zubehör. Gefangen haben wir selten mal ein Läugeli, dem wurde mit dem Daumen hinter dem Kopf gedrückt bis das Knacken spürbar war, die untere Seite aufgeschlitzt und die Innereien dem See zurückgegeben. Zu Hause wurden die Schuppen von mir geschabt und der Fisch von meiner Mutter speziell für mich gebraten.

In der 6. Klasse nahm mich ein Schulkamerad mit zu seiner Pfadfinder-Übung am Samstag-Nachmittag. Mir gefiel die Kameradschaft in der Gruppe, ich wurde angenommen und bald getauft, indem ich im Wald überfallmässig in einen Sack gesteckt und in eine Höhle verschleppt wurde. Dort wurde ich befreit und musste zur Aufnahme einen ekelhaft grausigen Saft trinken. Ich hiess nun Hecht in der Gruppe Elch im Stamm Troja. Von nun an galt das Motto: Allzeit Bereit! Jeden Tag eine gute Tat. Meine Eltern kauften mir die Ausrüstung, auf die ich mächtig stolz war: den Gurt mit Pfadfinder-Schnalle, Hemd, Halstuch mit dem Krawattenring aus Metall. Neugierig las ich in der Pfadfinder-Bibel und übte Schnur-Knoten nach den Zeichnungen. Im Sommer 1966 durfte ich an einem nur alle 14 Jahre stattfindenden Bundeslager teilnehmen (Domleschg/Bonaduz). Zum ersten Mal im Zelt und gleich eine Woche lang.
Mein Noten-Durchschnitt genügte zum Übertritt in die Sekundar-Schule. Für die 1.5 Kilometer lange Strecke mit 60 Meter Höhenunterschied zum Berghalden-Schulhaus durfte ich das Fahrrad meiner Mutter benutzen. Öffentlicher Nahverkehr mit Bus war damals unbekannt. Im nächsten Winter nahmen mich die Eltern eines Schulkameraden an einem Sonntag mit zum Skifahren in Einsiedeln. Ich hatte nur ein altes Ski-Paar ohne Sicherheits-Bindungen und war noch nie Ski fahren. Prompt blieb ich am Hügel hinter dem Kloster mit einem Spiralbruch am rechten Unterschenkel im Schatten liegen. Mit dem Rettungs-Schlitten und Ambulanz zum Arzt vor Ort für einen provisorischen Gips. Mein Vater holte mich ab mit seinem Auto, da ich die ganze Rückbank für mein Bein benötigte. Am nächsten Tag wurde das Bein definitiv gerichtet und das Ganze von den Zehen bis und mit Oberschenkel eingegipst. Dann musste ich drei Monate im Bett liegen bleiben bis ich einen Gehgips am Unterschenkel erhielt. Eine Schul-Kollegin brachte mir den aktuellen Schulstoff jeweils nach Hause zum Lernen. Im nächsten Sommer im Pfadi-Lager am Aegerisee verfehlte ein Kamerad den Ball beim Fussball-Spiel mit Wander-Schuhen und traf exakt meinen geschwächten Unterschenkel. Der Knochen war zum Glück nur angerissen, aber weitere drei Monate Gehgips standen bevor. Seither habe ich bis zum heutigen Tag keinen Sport mehr betrieben mit Ausnahme einer Vita-Parcours-Phase anfangs der 90er-Jahre wegen einer Diskushernie am Lendenwirbel. Dem Knochengerüst mit seinen Gelenken hat die sportliche Inaktivität durchaus nicht geschadet, wenn ich heute mit anderen vergleiche.
Ein Projekt Schülerzeitung wurde gestartet und der Hauptlehrer berief mich zum Chef-Redaktor. Vermutlich weil ich im Deutsch schriftlich manche Bestnote hatte. Gleichwohl hat sich meine tiefe Abneigung damals gegen das Lernen von Grammatik erhalten. Ich muss noch heute erst nachschauen, was denn ein Plusquamperfekt sein soll. Weil mich das nie interessierte. Für mich zählt Schrift zum gestalterischen Element der Sprache und bedarf zum Ausdruck keiner vorgesetzten Zwänge. So wirkte denn auch später zum Beispiel der kategorische Imperativ von Kant auf mich wie eine Form von höherem Blödsinn (was nicht abwertend verstanden werden soll, sondern zeigt, dass meine Ablehnung von jenem, was bildungssprachlich und in Medien als die Kultur geführt wird, bereits in meinem angeborenen Sprachgefühl wurzelt). Wichtig ist mir, auch von Menschen ohne grösseren Wortschatz verstanden zu werden, indem ich bewusst möglichst wenige Fremd-Begriffe verwende, vor allem griechisch und lateinischer Herkunft, obschon ich diese, [die Synonyme], ebenfalls kenne und anwenden könnte. In dieser Zeit mit und beim selber Schreiben begann bei mir die Selbst-Betrachtung, wer bin ich und ihr Zusammenhang mit dem politischen und dem kulturell sozialen.

Die früheren kameradschaftlichen Zweier-Beziehungen haben sich in der 8. Klasse erweitert zu je für sich verschworenen Gruppen. Wir trafen uns in der Freizeit bei jenen, welche bereits einen Schallplatten-Spieler besassen und hörten die neu aufkommende Beat-Musik der Pop-Kultur, die bei manchen Eltern als unerträglicher Lärm verpönt war. Gemeinsam begann das Denken. Was denn nichts sein könnte wenn nichts ja nicht ist und dergleichen mehr. Bei Abwesenheit von Eltern wurde in der sturmfreien Wohnung im Halbdunkel am Boden sitzend oder liegend zu psychedelischer Musik geträumt, auch mal angeregt mit dem Duft vom Klebstoff aus Revell-Modellbausätzen. Alkohol liessen wir nach einer erstmaligen Untersuchung in Ruhe, die vielen verschieden Flaschen in der Hausbar führten rasch zum Abbruch der Übung. Geraucht hat niemand, während der gesamten Schulzeit und auch im ganzen Schulhaus nicht. Der Erstkontakt mit Tabak fand damals traditionsgemäss am Schul-Silvester bereits in der Primarschule statt, aber nur zur Befriedigung der Neugier wie das schmecken würde.
Nebst der Schule begannen im letzten 9. Schuljahr zusätzlich der Konfirmanden-Unterricht im Kirchgemeinde-Haus und der obligatorische Kirchenbesuch am Sonntag. In der Kirche waren die vordersten Reihen für die Konfirmanden reserviert und wurden während dem ganzen Gottesdienst vom streng auf Ruhe und Ordnung bedachten Kirchen-Sigrist überwacht. Diesem mussten wir jeweils einen Coupon mit Namen aus unserem Kontroll-Block abgeben. Die Vermittlung der reinen Lehre erzeugte bei mir einen Gegensatz zur tatsächlichen Information. In Vietnam bombardierten christliche Amerikaner eine unschuldige Zivil-Bevölkerung mit Napalm-Bomben. Da konnte etwas nicht stimmen. Zu Hause schrieb ich in meinem Zimmer gross das gelernte gemeinsame Gebet "Unser Vater" an die Wand und illustrierte die Satzteile mit entsprechenden Farb-Bildern vom Vietnam-Krieg aus Zeitschriften. Unser tägliches Brot gib uns heute - mit B-52 Bombern? Ich wollte aus diesem Verein aussteigen, konnte das aber erst nach der Konfirmation, weil damals die religiöse Selbst-Bestimmung erst ab 16 Jahren möglich war.
Während der Schulferien verdiente ich mit Hilfsarbeit mein erstes Geld bei einer der angebotenen Ferienstellen für Schüler in einer Buchbinderei in Zürich. Als die Frage aufkam, was ich nach der Schule einmal werden möchte, hatte ich irgendwie keine Ahnung davon, was mit dieser Frage überhaupt angesprochen würde. In meinem erwachsenen Umfeld überwog die Meinung, ich sollte Lehrer werden. Noch weiter in eine noch höhere Schule wollte ich aber nicht. Also Berufsberatung, wo meine Tests den Berater zum Ergebnis führten, der Beruf als Schriftsetzer wäre für mich geeignet. Zum Glück war mein Vater anderer Ansicht. Tatsächlich wurde das Buchdruck-Verfahren schon ein paar Jahre später vom Offset-Druck abgelöst und die Schriftsetzer dadurch überflüssig. Vater hat mir letztendlich eine kaufmännische Lehrstelle in einem Fachzeitschriften-Verlag in Zürich besorgt durch Vermittlung seines Bruders, welcher in Zürich den Dreispitz-Zeitung-Verlag gegründet hat und führte.

Bereits vor-pubertär haben wir Knaben in der Primarschule beim gemeinsam nackt duschen nach der Turnstunde bemerkt, zwei unserer Klassenkameraden hatten deutlich längere Schnäbeli als die anderen. In der Volksschule wurde damals überhaupt nicht aufgeklärt. Wir wussten nichts vom genetisch bedingten Unterschied zwischen Blut- und Fleischpenis in der Anatomie der Männer. Der in Europa überwiegend vorhandene Blutpenis ist in schlaffem Zustand kleiner als der seltenere Fleischpenis. Im erregten, versteiften Zustand werden aber beide ungefähr gleich gross. Die Natur hat, von Ausnahmen abgesehen, alle Männer gut bestückt und nicht bloss jene Minderheit, welche sichtbar mehr zu sein scheint. Eine Beule in der Hose macht noch keinen Adonis, im Gegenteil, denn die Abbildung zeigt den kleineren Blutpenis.

Im gleichen Jahr in einer Schul-Turnstunde machte ich die nächste Erfahrung. An der Kletterstange, zuoberst auf beinahe fünf Meter, musste ich mich verkrampfend festhalten, weil ein unbekanntes, aber wunderschönes Gefühl meinen Körper erfasst hatte. Wieder unten, blickte mein Lehrer einen kurzen Moment länger wie nötig auf meine Turnhose. Ich sah den Fleck auf meiner hellblauen Hose dann ebenfalls und errötete verlegen. Zu Hause ging ich dieser Sache auf den Grund indem ich an der Teppich-Klopf-Stange die Kletterstange nachahmte. Da wurde mir klar was da passiere und danach war dieses Gefühl auf Abruf bereit durch blosses Hand anlegen, machte aber vorerst mal öfters Pause, weil willentlich noch keinerlei Trieb im Geschlecht vorhanden war.
Sozusagen wachgeküsst wurde ich erst Jahre später an einem von Schülerinnen organisierten Treff (Party) in einem Klublokal. Während wir uns durcheinander zur Musik bewegten, löschte plötzlich das Licht und, vorher abgekartet und zugeteilt, erlebte ich meinen ersten Zungenkuss. Wieder Licht war dasselbe Durcheinander wie vorher und wir wussten nicht, welches Mädchen wen geküsst hatte. Auf den Geschmack gekommen wünschte ich mir eine Freundin und so fragte ich, meine Hemmungen überwindend, telefonisch eine mir passende Schulkollegin aus einer anderen Klasse an für ein Treffen, wo mich diese aber gleich nach der Begrüssung enttäuscht wieder nach Hause entliess, weil ich noch zu jung wäre für sie. Nach diesem Korb war mein Interesse generell dahin und ich vermied fortan jede weitere Ablehnung vom weiblichen Geschlecht.
Nebst Vietnam-Krieg und Welt-Hunger wurden die Studentenunruhen und 1968 die Jugend-Bewegung (Globus-Krawall in Zürich) zum Thema unserer Diskussionen. Warum ich von einigen scherzhaft mit Rudi Dutschke, einem deutschen Studentenführer, verglichen wurde entzieht sich meiner Kenntnis, hatte ich doch schon damals wie heute keinerlei Sendungs-Bewusstsein. Was mich stets voran trug war meine Neugier, die Dinge grundsätzlich verstehen zu wollen. Ich las die klassischen Sagen des Altertums von Schwab, den Abriss der Psycho-Analyse von Freud, die Psychologie der Massen von Le Bon, Nietzsche und dergleichen mehr. Mit dem modischen roten Büchlein vom chinesischen Mao oder dem Gehabe um den kubanischen Che Guevara konnte ich nichts anfangen.
Musikalisch geweckt wurde ich durch den Raumklang einer Stereo-Anlage in einer Bar, welche wir morgens an einem Schulsilvester durchquerten. Das nur kurze Mithören des Welt-Hits "Monday, Monday" (1966), dieses bisher unbekannte Fühlen von Musik hatte mich nachhaltig ergriffen. Bald hörte ich, wie andere Schulkameraden schon vor mir, Beat-Musik in meinem Zimmer von Schallplatten. Hauptsächlich jene der Rolling Stones, die Beatles mochte ich weniger. Zum Hören meiner bevorzugten Titel legte ich mich auf den Rücken, die Ohren zwischen die Lautsprecher und bewegte den Kopf im Takt von links nach rechts, oft bis fast zur Erschöpfung. Ich verstand nur Deutsch, die englisch gesungenen Texte waren ohne Bedeutung beim Musik hören.
Kurz nach meiner Konfirmation, zu welcher ich meinen ersten und letzten Mass-Anzug trug, mit Vater in Zürich ausgesucht in einem edlen Geschäft für Herren-Bekleidung, erreichte ich mit 16 Jahren die Religions-Mündigkeit und suchte das Gespräch mit meinem Pfarrer. Zur Schallplatten-Musik vom deutschen Liedermacher Reinhard Mey führten wir einen vertiefenden Austausch unserer Meinungen über Gott und die Welt. Dabei blieb ich so schlau wie vorher und erklärte danach schriftlich meinen Austritt aus der reformierten Landeskirche. Im Jahr 1969 ein ausserordentlicher Vorfall, gleich nach der Bestätigung auszutreten, zu dem ein Mitglied der Kirchenpflege eine Erklärung von mir verlangte. Die Fragen zielten dann aber offensichtlich dahin, dem bei seinen Schülern sehr beliebten jungen Pfarrer einen Strick drehen zu können mit meinem Austritt.
Mit der Lehre in Zürich als kaufmännischer Angestellter (KVZ) lernte ich auch eine andere Welt kennen, die Stadt. Mit der Bahn musste ich zum Bahnhof Enge fahren und von dort zu Fuss einen Kilometer zur Lehrstelle durch den 250 Meter langen Ulmberg-Personen-Tunnel mit seiner matten Beleuchtung. Zu Beginn kam ich zum Mittagessen nach Hause und fuhr die 20-minütige Bahn-Strecke viermal täglich. Schon bald reizte mich aber mehr, über Mittag in der Stadt herum zu streifen oder an der Riviera genannten flachen Steintreppe am Limmat-Ufer beim Bellevue zu sitzen, inmitten einer damals dort ansässigen Szene. Als regelmässiger Mitläufer kam ich als Bekannter auch in Kontakt mit den Haschisch-Joints, falls diese in einer Runde weiter gegeben wurden. Wenn die letzte Bahn nach Hause bereits weg war, machte ich stadtauswärts Autostopp. Dabei erfolgte auch mein allererster Kontakt, aber mit Männern, wenn beispielsweise beim Schalten so per excuse eine Hand an meinen Oberschenkel glitt. Das gleiche Geschlecht hat mich nie gereizt, aber gegen ein erregt passiv im Beifahrer-Sitz verharren hatte ich als stiller Geniesser keine Einwände.
Die nächsten Sommerferien trampte ich (Autostopp, per Anhalter reisen) allein und ohne etwas, unvorbereitet nach Frankfurt am Main zur Hasch-Wiese hinter dem Hotel Hilton, 1.5 Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt, um dort am Geheim-Tipp ein Stück gepresstes Haschisch zu kaufen. Bald hatte ich mein Ziel erreicht, schwarzen Afghan, war jetzt aber völlig mittellos. Durch Vermittlung der schweizerischen Botschaft, wo ich mich meldete, konnte ich auf dem Hauptpostamt eine postlagernde Geld-Überweisung von meinem Vater abholen und per Bahn zurückreisen. Zum kontrollierten Grenz-Übertritt versteckte ich die kostbare Fracht im WC-Abteil hinter einer Abdeckung damit ich im Fall der Fälle nichts damit zu tun hätte.
Das Bahn-Monat-Abonnement nach Zürich hatte ich nun 1. Klasse, fuhr mit meinen langen Haaren im gepolsterten Sessel der roten Raucher-Abteile, die missbilligenden Blicke der alten Geschäfts-Männer mit Zigarre geradezu provozierend. Meine Eltern machten sich offenbar zunehmend Sorgen wegen meiner Veränderungen. Abends war ich oft nicht mehr zu Hause, sporadisch gar die ganze Nacht über weg. Eines Tages nahm mich Vater mit nach Zürich ohne mir sagen zu wollen wohin dort. So sass ich ohne Vorbereitung plötzlich an einem Schreibtisch der Kriminalpolizei und Vater zeigte dem Beamten als Beweismittel die von ihm in meinem Zimmer gefundenen Krümel. Der Polizist schnupperte begutachtend und meinte, jawohl, das sei Haschisch, eine verbotene Droge. Dann wurde protokolliert, gefragt, von wem erhalten, wo und mit wem ich Kontakt hatte, als ob ich von jemandem mehr als den Vornamen gewusst hätte. Auf die Eröffnung eines Verfahrens wurde verzichtet, der Polizist verwarnte mich lediglich mündlich, wenn ich weiter mit Drogen zu tun hätte, gehe es das nächste Mal nicht mehr so glimpflich ab.
Ohnehin waren mir inzwischen Bier und Wein lieber. Dazu rauchte ich gewöhnliche Zigaretten, Française ohne Filter. Vor allem im altehrwürdigen Odeon am Bellevue mit den Sesseln in den Nischen liess sich bei einem Glas Wein trefflich über Sinn und Zweck vom eigenen Dasein sinnieren oder in einer der aufgelegten Zeitungen lesen. Interessiert suchte und las ich jeweils die neue Ausgabe der Untergrund-Zeitung Hotcha!, doch auch mit den surrealistischen Bildern von H.R. Giger dort konnte ich nicht weiterdenken. Durch meine freiwillige religiöse Exkommunikation mit dem Kirchen-Austritt aus dem Denkmuster der eingebildeten Dualität (im Namen des Allmächtigen, ja oder nein) verlor ich unbewusst auch die für mich notwendige Voraussetzung einer Grund-Annahme im Denken. Von diesem fortan zwingenden Sachverhalt, den Glauben durch Denken zu ersetzen, war ich aber erst mal vom Alter her überfordert, habe auch darüber nachgedacht, wie ich mich selber umbringen würde, wenn ich nicht mehr weiter wüsste. In einem Rausch-Zustand schrieb ich unter dem Titel „Nicht Gott erschuf den Menschen, der Mensch schuf Gott“, ich würde mich nicht gleich selber umbringen, sondern von nun an ganz, ganz langsam, jeden Tag ein kleines bisschen mit meinen Drogen. Damit war ich unbemerkt im richtigen Leben, welches ohnehin mit jedem kommenden Tag ein Stück näher zum unausweichlichen Tod hinführt.
Mein Selbst entdeckte ich durch einen vergessenen, unbemerkten LSD-Trip. Nach dem Schlucken eines mit der Substanz getropften Filzchens allein in meinem Zimmer wurde ich zur selben Zeit nach unten gerufen zum Abendessen und vergass die Einnahme. Erwacht bin ich fünf Stunden später um zwei Uhr morgens, weinend vor dem Spiegel an der Schranktüre stehend mit mir selber sprechend. Dieses Gefühl, aus dem Nichts plötzlich im Hier und Jetzt mich selber zu sein, diese Erfahrung blieb mir in der Erinnerung bis heute erhalten.
Ich mag keine Fragen mehr stellen,
seit 1970 wird auch ohne Tränen geweint,
endlos, stumm und unbemerkt.
Absolut nüchtern ein Gefühl von trunkenem Elend.
Die Scheibe aus lauterem Nichts.
Keinerlei Spiegelung.
Nur noch glauben, im Wissen zu meinen.
Denken müssen ohne Gedanken.
Scheusslich.
Allein,
Tränen und Verzweiflung vermögen kein Andenken der Besinnung.
Die strafbewehrten Verfehlungen und Vergehen während meiner Pubertät seien hier dem Vergessen anheimgestellt. Ich hatte stets, wie gesagt wird, ein Chrotten-Haar in der Tasche, wurde nicht gestellt und zur Verantwortung gezogen. So hat letztlich vermutlich auch eine grosse Portion vom Glück über meine weitere Entwicklung entschieden.
Unterwegs war ich fast immer alleine. So setzte ich mich an einem frühen Abend an einen kleinen Zweier-Tisch im hinteren Teil vom Restaurant Turm. Auch diese Kneipe wurde gerne von der Szene besucht. Da ich meinen ganzen Nachdenk-Abend hier verbringen wollte, bestellte ich für mich allein einen Liter offenen Weiss-Wein. Süss und nicht gekühlt wie ich diesen gerne mochte. Meine jungen siebzehn Jahre waren mir nicht mehr anzusehen, ich trug die Haare wie ein Hippie bis auf die Schultern fallend, die Augenlidschatten schwarz nachgezogen mit einem Stift der Schwester und wurde anstandslos bedient wie ein Erwachsener (das war damals noch 20-jährig). An diesem Abend genoss ich bereits die Wirkung eines guten halben Liters, als sich eine junge Frau ohne nachfragen zu mir an den Tisch setzte und mich ansprach. Sie sei die Maja und wie ich denn hiesse. Sie hätte mich beobachtet und wolle mit mir mit-trinken, sie finde, ein ganzer Liter Wein könnte ein wenig zu viel sein für mich alleine, wie jung ich eigentlich wäre, sie sei einundzwanzig. Wir redeten stundenlang, bestellten wieder Wein. Bis gegen Mitternacht hatte dann Maja viel getrunken und erschrak, weil keine Bahn mehr fuhr an ihren Wohnort im Zürcher Oberland. Sie könne bei mir schlafen, meinen Zug würden wir noch erreichen. Unterwegs, im fast leeren letzten Bahnwagen kuschelten wir im Abteil zusammen und küssten uns die ganze Reisestrecke von zwanzig Minuten. Zu Hause alles dunkel, wir möglichst ohne Geräusch nach zuoberst, auf den Holztreppen gar nicht so einfach. Wir zogen uns gleich beide aus und machten mit den Umarmungen im Bett weiter. Nachher fragte Maja:
„War es schön, Rolf? Gib zu, das war dein erstes Mal.“
„Ja das stimmt, warum weisst du das?“
„Weil ich dir am Anfang helfen konnte. Du bist so süss. Hast du schon eine Freundin?“
„Nein, ich hatte noch nie eine Freundin.“
„Ich bin so glücklich, deine erste Frau gewesen zu sein, ich liebe dich.“
Ich wurde verlegen und schwieg. Maja war mir sympathisch, ich mochte sie, ja, aber ich liebte sie nicht, warum auch. Frühmorgens konnten wir unbemerkt das Haus verlassen über die Treppe der Wohnungen nebenan. Ich brachte Maja zum Bahnhof und hatte Zeit, kurz nochmals zu Hause vorbei zuschauen, ehe ich wieder nach Zürich an meine Lehrstelle fuhr. Das nächste Wochenende verbrachte ich im Zimmer von Maja. Sie war unersättlich begierig, hat ihrem unerfahrenen Rolf beigebracht, was Spass an der Freude ist. Doch eine richtige, gegenseitige Liebe entstand nicht. Maja war eine Erwachsene, ein Schatz von einer Frau, lieb, herzlich, doch ich war noch kein Mann. Sie suchte eine dermassen Besitz ergreifende Anlehnung, die ich ihr gar nicht geben konnte und gleichzeitig übernahm sie zusehends das Kommando, etwa was meinen Alkoholkonsum betraf. Es ging nicht lange gut, als ich nicht mehr konnte und wollte, sagte ich ihr dies ehrlich. Ihre schluchzende Enttäuschung tat mir noch lange weh, vielleicht als sie ihre Tränen schon längst getrocknet hatte.
In den Sommerferien des gleichen Jahres traf ich mit Karin meine erste grosse Liebe. Zusammen mit zwei ehemaligen Schulkameraden waren wir zu dritt mit einem einfachen Giebel-Zelt ohne Boden auf einer noch zur Schulzeit vereinbarten Halbstarken-Tour. Meine langen Haare waren inzwischen einem üblichen Stufen-Schnitt gewichen. Auf dem Camping-Platz mitten in Genf an erhöhter Lage fanden wir einen uns zusagenden Ort, nicht weit von und zu den Bistros und Bars. Ein Nachbarzelt gehörte zu einer sechsköpfigen Familie aus Zürich, welche hier gestrandet war, weil ihr Auto auf dem Weg nach Spanien notfallmässig in die Werkstatt musste. Wir lagen vor unserem Zelt beim blödeln und Bier trinken, als sich drüben ein hübsches Mädchen vor dem grossen Hauszelt gemütlich einrichtete und in farbigen Illustrierten las. Über kurz oder lang tauchte die Frage auf, wer von uns wohl den Mut hätte, das schöne, stolze Mädchen, das manchmal verstohlen zu uns herüber blickte, anzusprechen und her zu holen. Irgendwann hatte ich genug vom schwafelnden Hin und Her, stand auf und ging hinüber, etwas unsicher, setzte mich neben sie ins Gras und begann mit ihr zu sprechen. Karin willigte ein, sich mit mir zu meinen beiden Kumpanen zu begeben. Aber ich hatte nicht nur eine Wette gewonnen. Am nächsten Tag mussten meine Kameraden ohne mich auskommen, ich wollte mit Karin im nahen Wald spazieren. Unvergessen, die zitternd bebende Annäherung zum ersten Kuss auf dem warmen Waldboden im Unterholz, dessen helles Grün, von einfallenden Sonnen-Strahlen durchdrungen, eine zarte Intimität schuf für ihren zierlichen Körper, dessen Anblick allein schon meinen Atem rauben konnte. Karin war fünfzehn. Eine wunderschöne Jugend-Liebe nahm ihren Anfang, sie dauerte, nach den Ferien und wieder in Zürich, fast vier Jahre lang. Wir sahen uns oft, das heisst, mein Heimweg führte nun zuerst über ihren Wohnort in Zürich. Karin ging noch zur Schule, war im Schutz-Alter und hatte abends keinen Ausgang. Nur am Samstag durfte ich mit ihr zum Tanz im Zürcher Jugendhaus, dem Drahtschmidli. Aber uns genügte die Zweisamkeit verbunden mit Zärtlichkeiten bis Karin nächstes Frühjahr sechzehn wurde und vom Frauenarzt die Antibaby-Pille bewilligt bekam.
Karin hatte eine Schwester und zwei Brüder. In ihrem grossen Wohnzimmer waren an der einen Wand zwei dreiplätzige Ledersofas nebeneinander mit einem Tischchen dazwischen. Die Haupt-Beschäftigung war Unterhaltung am Bildschirm. Bei einem Besuch fragte die Mutter, ob ich in ihrem Schlafzimmer gewesen sei, ihnen wäre das Feriengeld dort im Schrank abhanden gekommen. Erschreckend verneinte ich und beteuerte, noch nie hatte ich dieses Zimmer betreten. Ein paar Wochen später die erlösende Entwarnung. Die Polizei konnte einem gefassten Serien-Täter den Einsteige-Diebstahl zuordnen und nachweisen. Der Profi war durch das offene Fenster im Erdgeschoss gestiegen und hatte das Zimmer untersucht, während wir alle nebenan einen Strassenfeger-TV-Film von Durbridge schauten. Trotzdem, der Verdacht, allein schon der Gedanke, hatte mich verletzt.
Die Familie von Karin fuhr jeden Sommer mit dem Auto ans Mittelmeer zum Camping-Urlaub. Ihr Hauszelt wurde durch einen Wohnwagen ersetzt. Ich durfte meine Freundin begleiten und kaufte ein Zweier-Doppeldach-Giebel-Zelt mit angenähtem Boden. Wir fuhren mit der Bahn bis Venedig und wurden dort vom Vater mit dem Auto abgeholt. So kam ich mit siebzehn zum ersten Mal am Meer in Lido di Jesolo an den Sandstrand und lernte die mehrere Kilometer lange Ladenstrasse kennen. Im nächsten Jahr war Rovinj im ehemaligen Jugoslawien auf dem Programm, die Bahnreise ab Triest mit einer Dampf-Lokomotive, an der Grenze musste der Reisepass abgestempelt werden. Kein Sand, zerklüfteter spitzer Stein im Wasser und Quallen. Das Jahr darauf nach Castelldefels bei Barcelona fuhren wir dann mit meinem eigenen Auto, einem VW-Käfer, in die abgelegene Anlage El Toro Bravo. Wie immer kochte die Mutter das Abendessen mit der Camping-Ausrüstung, nach dem Essen regelmässig der Knatsch um den Abwasch in der sanitären Anlage und lautstarke Beschwerden der Mutter. Die beim Camping selber kochenden haben keine richtigen Ferien.
Die Arbeit an meiner Lehrstelle, einem Fachzeitschriften-Verlag, erforderte im Grunde genommen nur beschränkt kaufmännische Kenntnisse. Die für mich und einen weiteren Auszubildenden zuständige Lehrling-Beauftragte war ein lediges Fräulein jenseits der Menopause, welche mich keine Sympathie ihrerseits verspüren liess. Die zu bewältigenden Aufgaben in der Anzeigen-Disposition waren rasch erlernt, Gut-zum-Druck einholen, Beleg-Exemplar versenden, Rechnung nach Tarif und dergleichen mehr. Bald war der interessanteste Teil die Mithilfe in der Post-Spedition bei den Männern mit ihrem Witz und anzüglichen Bemerkungen den Frauen gegenüber. In der Druckerei, die wurde gerade auf Offset und Vierfarben-Druck umgestellt, war für mich nichts zu lernen. In der Buchhaltung, von meiner Bestnote im Zeugnis her eigentlich das ideale Einsatz-Gebiet, auch nicht, weil dort der Buchhalter noch mit grossen aufklappbaren Büchern im Handbetrieb arbeitete, während wir in der Handelsschule im Durchschreibe-Verfahren lernten. Das Manko im Betrieb wurde aufgewogen durch die wöchentlichen zwei Tage lehrreichen Schul-Besuch.
Im dritten Lehrjahr bekam ich einen eigenen Schreibtisch im Büro eines Aussendienst-Mitarbeiters der Inserate-Werbung, welcher mehrheitlich zwecks Kunden-Besuch unterwegs war. So war ich beinahe immer allein im Büro und hatte wenig bis nichts zu tun. Mein Entschluss, die Lehre drei Monate vor Abschluss abzubrechen, stiess rundum auf Unverständnis, jedoch alles gute Zureden war nutzlos, ich wollte einfach nicht mehr und stieg aus. Der aktuelle Spruch, "Wir leben nicht für die Arbeit, wir arbeiten zum leben", hatte seine Wirkung entfaltet. Die Arbeitslosigkeit lag anfangs Siebziger seit Jahren bei null, eine bezahlte Arbeit zu finden war kein Problem. Ich liess mich von der Manpower temporär vermitteln und habe dadurch verschiedene Branchen und unterschiedliche Betriebe kennen gelernt.

Mit welcher Einstellung bist du in die Rekrutenschule eingerückt?
Im August 1972 musste ich mich der militärischen Aushebung stellen und wurde als Minenwerfer-Kanonier der Gebirgs-Infanterie zugeteilt. Beginn der 4-monatigen Rekrutenschule (RS) war auf Februar nächsten Jahres (1973) angesetzt. Obschon mir die IdK, die Internationale der Kriegsdienstgegner, sympathisch war und ich schon mit dem Gedanken gespielt hatte, den Militärdienst zu verweigern, liess ich mich von meinem Vater an den Einrückungsort fahren, zur Kaserne Wil bei Stans in der Zentralschweiz.
Die Truppen-Unterkunft war ein Neubau, vor zwei Jahren 1971 erstmals bezogen. Als einziger Eingerückter mit kaufmännischer Ausbildung musste ich gleich nach dem Zimmer-Bezug für das Schulbüro an die Schreib-Maschine und die Kartei-Karten für die medizinische Eintritts-Musterung aller rund hundert Rekruten in meiner 4. Kompagnie erstellen. Von Beginn an wurde ich als einzige Büro-Ordonnanz dem Fourier im Kommando-Posten zugeteilt und musste nie an der Soldaten-Ausbildung teilnehmen, bis nach drei Monaten der Schulkommandant dem Fourier androhte, er werde mich als nicht aus-exerziert entlassen wenn ich nicht sofort auch mit den Anderen ausrücken und an der Ausbildung teilnehmen würde.
So lernte ich doch wenigstens noch die militärischen Umgangsformen kennen und konnte ein Sturmgewehr 57 zerlegen, putzen und wieder zusammen setzen. Im Hochgebirge konnte ich das Überleben im Schnee üben durch Bauen von Schnee-Biwak, erlebte die einsame Nacht-Wache zu Zweit mit Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt bei der Kontrolle der in den Biwak brennenden Kerze, womit der Sauerstoffgehalt der Luft überwacht wird.
Nach der RS arbeitete ich wieder temporär, diesmal als Sachbearbeiter in einer kleinen Zürcher Privatbank mit rund 22 Angestellten (inkl. 3 Lehrlingen). Aufgrund meiner guten Leistungen sollte ich bleiben, wurde für 800 Franken vom Vermittler Manpower ausgelöst und definitiv angestellt. Zuerst als Kassier und Stellvertreter des Leiters der Zahlungs-Abteilung, mit Einzel-Unterschrift-Berechtigung bis 25'000 Franken. Auf meinen Wunsch hin nach Erweiterung der praktischen Kenntnisse arbeitete ich später in der Dokumentar-Abteilung, zuständig für die Abwicklung vom Wechsel-Geschäft, der Import- und Export-Inkassi sowie die Eröffnung und Negoziierung von Dokumentar-Akkreditiven.
Anzug mit Krawatte war jetzt meine tägliche Arbeit-Kleidung. Am Kassa-Schalter der Privatbank war wenig Kundschaft, und wenn, dann oft englisch sprechende Männer mit Bar-Einzahlungen von Dollar auf ein anonymes Nummer-Konto. Eine Zählmaschine hatte ich keine, so musste ich von Hand die Noten zählen bis beinahe die Finger verkrampften. Wir arbeiteten in Gleit-Zeit, zwischen 9 und 16 Uhr war Pflicht bei einer Stunde Mittagessen ausserhalb und je eine Viertelstunde im Kaffee-Pausen-Raum vor- und nachmittags. Die Kontrolle der Soll-Zeit erfolgte elektronisch mit einem persönlichen Einsteck-Kärtchen. Die Büros befanden sich im 1. Obergeschoss. Der Schalter-Raum mit fünf Arbeitsplätzen, viele Fenster und helles Tageslicht, ein breiter und offener Edelholz-Korpus quer durch den ganzen Raum, innen auf der gesamten Länge versehen mit einer Fuss-Kontakt-Schiene für den stillen Überfall-Alarm, welcher im Nebenraum bei der Türe blinkend angezeigt wurde und dort bei Fehlalarm innert zehn Sekunden verhindert werden konnte. Hinter dem Kunden-Bereich die ganze linke Wand getäfert mit Holzelementen, darin verborgen zwei Türen in getrennte Neben-Räume und hinter einer nicht erkennbaren Doppel-Tür der mannshohe Tresor-Schrank. Nebenan die Dokumentar-Abteilung, der Telex und einem durch Glas-Scheiben abgetrennten Raum für den Prokuristen, fünf Arbeitsplätze. Rechts davon die Börsen-Abteilung mit Bildschirmen an der Decke, vier Arbeitsplätze. Geradeaus führte ein breiter Gang vorbei an rechts der Garderobe, dem Post-Büro hinter Glaswand mit Foto-Kopierer und Papier-Shredder, anschliessend ebenfalls einsehbar der nicht klimatisierte grosse EDV-Raum mit Lochkarten-Anlage. Die Buchungs-Belege wurden durch uns von Hand ausgefüllt und dort in Lochkarten umgewandelt, zwei Arbeitsplätze. Zuhinterst eine Wendeltreppe hoch zu den Büros der drei Direktoren mit ihren beiden Chef-Sekretärinnen im 2. Stockwerk. Den Gang zurück war rechts die Buchhaltung, zwei Personen, dann folgten ein Sitzungszimmer, die Telefon-Zentrale mit den Ablage-Schränken, die Kantine mit Kühlschrank und Koch-Möglichkeit, je eine Toilette für Frauen und Männer, der Zeit-Kontroll-Apparat bei der Personal-Eintrittstüre. Geraucht werden konnte während der Arbeit in allen Räumen, das Passivrauchen von Nichtrauchern war noch nirgends ein Thema. Alle Arbeitsplätze verfügten über eine elektrische IBM-Kugelkopf-Schreibmaschine, ein schwarzes PTT-Tisch-Telefon mit Wählscheibe, einige zusätzlich einen elektronischen Rechner mit Papier-Rolle. Die Geräte wurden regelmässig von den Herstellern vor Ort gewartet.
Gegen Ende 1973 wollte meine mit 18 damals noch nicht volljährige Freundin Karin, vom Aussehen her Typ Fotomodell, von zu Hause weg. Sie hatte schon früher eine private Laufsteg-Schule absolviert, dann aber nach der Schule eine Ausbildung zur Zeichnerin in einem Grafik-Kleinbetrieb begonnen und wieder abgebrochen. Wir beschlossen zusammen zu ziehen, ich mietete ein möbliertes Zimmer in der Stadt Zürich und zog ebenfalls erstmals von zu Hause weg. Völlig planlos und fahrlässig, wie sich herausstellte. Ich ging morgens bis abends zur Arbeit und sie war im Zimmer, sollte eine bezahlte Beschäftigung suchen und finden. Als ich, am Fenster wartend, zum wiederholten Mal morgens nach zwei Uhr sah, wie sie aus dem silbergrauen Wagen ausstieg und sie keine mir glaubhafte Schilderung ihrer letzten Stunden geben konnte oder wollte, rastete ich als ihr eifersüchtiger Freund aus und beendete die Beziehung mit einem Knall. Im März 1974 kehrte ich in mein Elternhaus zurück und überwältigte meinen Liebes-Kummer, still und leise jeweils im Bett vor dem Einschlafen. Das Miet-Zimmer wurde von meiner Mutter gereinigt zurück gegeben. Mein ehemaliges Zimmer zuoberst war jetzt von der Schwester besetzt, aber Vater räumte sein Handharmonika-Übungs-Zimmer für mich.



Trudi kam 1951 in der elterlichen Wohnung zur Welt, als 3. von fünf Kindern, am Zehntenhausplatz in Zürich, im Haus neben dem Restaurant Löwen im 2. Stockwerk. In der Dreizimmer-Wohnung lebten ihre Eltern, die Eltern (sie 75, er 79) ihrer Mutter, die 10 Jahre ältere Schwester sowie der 8 Jahre ältere Bruder. Die beiden Ehepaare belegten je ein Zimmer, die Schwester schlief in der Nachbarwohnung, für den Bruder war im Wohnzimmer eine ausziehbare Couch und Trudi kam ins Kinderbettchen im Eltern-Schlafzimmer. Im Erdgeschoss war ein Detailhandel-Ladengeschäft ohne Frischprodukte. Im Ersten Stockwerk wohnte die Gotte von Trudi.
Gekocht wurde mit Gas, die Küche noch ohne Kühlschrank. Zum Heizen mit Holz und Briketts stand ein Ofen im Wohnzimmer zur Verfügung. Die eigene Toilette war im Treppenhaus. Im Keller befand sich eine Waschküche mit Holzfeuer, in einem kleinen Nebenraum stand eine Badewanne mit Füssen.
Der Vater arbeitete als Lastwagenfahrer bei der Holz- und Kohle-Handlung Humm gleich nebenan, die Mutter hatte eine Zeitungs-Verteil-Tour frühmorgens. 1953 verstarb der Grossvater in der Wohnung an einem Herzschlag. Nach der Geburt einer weiteren Schwester erfolgte 1957 der Umzug in eine 4-Zimmerwohnung einer Baugenossenschaft in Zürich-Affoltern. Drei Jahre später kam noch eine dritte Schwester dazu. Die Grossmutter war inzwischen in der pflegenden Obhut einer anderen Tochter an der Limmatstrasse in Zürich, wo sie 1961 verstarb.
Nach der Schule begann Trudi eine Lehre als Damen-Schneiderin in einem Atelier für Haute Couture am Zeltweg in Zürich-Hottingen bei einer alleinstehenden älteren Frau, bis sie deren Willkür nicht mehr ertrug und der Ausbildung fernblieb. Durch eine Schulkollegin wurde sie in die Kinderabteilung vom Warenhaus Globus vermittelt und erhielt einen Vertrag. Dort, an der Bahnhofstrasse im Neubau am Löwenplatz konnte sie nebst dem Verkauf auch in der internen Schneiderei mitarbeiten.
Der 55-jährige Vater der 17-jährigen Trudi verstarb 1968 nach kurzem Spitalaufenthalt an einem Krebsleiden. Trudi, welche seit ihrer Kindheit für die Familie kochen musste, hatte schon früh die Pflichten einer Mutter für die beiden jüngeren Schwestern übernehmen müssen. Fünf Jahre später erlitt die Mutter während der Arbeit beim Putzen von Büros einen leichten Schlaganfall, wurde hospitalisiert an anschliessend zur Kur geschickt. Die beiden minderjährigen Schwestern kamen während dieser Zeit je zu den älteren Geschwistern, die bereits verheiratet und ausgezogen waren.
Weil Trudi anders wie im Verkauf am Samstag frei haben wollte, besuchte sie einen Schreibmaschinenkurs und kam 1970 durch eine Stellenvermittlung an eine Bürostelle in einer amerikanischen Firma, die aber ein Jahr später ihre Niederlassung schliessen liess. Von einer ehemaligen Arbeits-Kollegin wurde sie 1971 ohne Unterbruch nach Schlieren zur Helvetia-Unfall geholt als Sachbearbeiterin.
1972 heiratete Trudi ihren Schulfreund, wollte sich aber bereits nach einem Jahr wieder scheiden lassen, was dann 1975 auch der Fall war, kinderlos und in gegenseitigem Einvernehmen. Er arbeitete damals, bevor er später Taxihalter in der Stadt Zürich wurde, bei Autozubehör Derendinger als Chauffeur und vermittelte Trudi die selbständige Führung vom Rechnungsbüro dieses Betriebes in Zürich-Oerlikon. 1973 wurde sie von dort durch ihre Schwägerin zur Wirtschafts- und Privatbank beim Stauffacher in Zürich geholt, wo auch ich arbeitete und wir uns kennen lernten.


Mein Schwiegervater Fredel (Alfred) Jäger verstarb 1968 im Alter von 55 Jahren noch bevor ich meine Frau kennen lernte. Aus der Erinnerung heraus beschreibt meine Frau ihren Vater als geselligen Familienmenschen, zwar streng autoritär, aber stets im Guten. Er sei lebenslustig gewesen, habe es gern schön gehabt und Streit vermieden. Freude hatte er an gutem Essen und den traditionellen Feiern. Jeden Sonntag traf er sich im Restaurant Grünwald um 9 Uhr zum Bergpredigt genannten Jass-Treff mit drei Freunden. Zu Fuss, hin und zurück je 3 Kilometer mit 110 Metern Höhen-Unterschied.
Den Kontakt gepflegt habe er vor allem mit seiner Verwandtschaft und seinen Vereinen. Im Männerchor war er aktiv, passiv im Turnverein und der Feuerwehr. Stolz sei er auf den Händedruck mit General Guisan während dem Aktiv-Dienst gewesen, er war Pontonier-Wachtmeister. Gearbeitet habe er immer, war nie krank und machte nie Ferien.
Mit den Kindern spielte er Monopoly, würfelte Eile mit Weile oder jasste. Zu Hause sass er meistens am Küchentisch und las Wildwest-Hefte oder Krimi. Ein Fernsehgerät hatte die Familie nicht, weil er keinen Fernseher wollte. Die Mutter habe dann trotzdem im Versteckten einen kleinen tragbaren Apparat gemietet.
Politisch war er parteilos, ging aber immer wählen und abstimmen. Religion war in der ganzen Familie kein Thema, der Kirchbesuch beschränkte sich auf Beerdigungen, sie waren in der reformierten Landeskirche.
Er hatte 4 Brüder und 4 Schwestern, geboren zwischen 1903 und 1919. Fredel wurde 1913 in Hohentannen TG geboren als 7. von neun Kindern des Johann Jäger, 1881-1956, von Urnäsch AR und der Frieda Stäheli, 1877-1965, von Egnach TG.
Die Jäger-Familie kam 1929 aus der Nordost-Schweiz nach Zürich-Affoltern in das von ihr erworbene Wohnhaus an der Alten Mühlackerstrasse 30. In der Region Zürich war damals mächtig gebaut worden, und zwar vor allem Häuser. Hier bekamen die Zimmermänner Auftrag und Arbeit. Wegen einer Bürgschaft musste 1936 das Betreibungsamt ein Zwangsvollstreckungs-Verfahren durchführen und die Liegenschaft verwerten. Käufer war der damalige Verkäufer. Die Eltern zogen nach Urnäsch, Fredel blieb in Zürich-Affoltern und lernte hier meine Schwiegermutter kennen, eine Verkäuferin im Lebensmittel-Verein.

Meine Beziehung zur Schwiegermutter bestand im Wesentlichen aus einem Sali, wie geht es Dir und Tschüss. Sie wurde mir von meiner Frau beschrieben als böse Mutter, welche nebst ihr auch ihren lieben Vater geplagt habe. Erstmals traf ich sie, als ich während eines Militär-Dienstes meine zukünftige Frau besuchte und dort schlief, zusammen mit meiner Frau im Wohnzimmer am Boden. Sie wohnte bei meiner Abwesenheit bei ihren beiden noch minderjährigen Schwestern und der Mutter. Die Schwiegermutter war da bereits durch die Hirn-Streifung von 1973 auf einer Seite leicht behindert. Später wechselte sie auf dem gleichen Stockwerk von der Vier- in eine Drei-Zimmer-Wohnung zusammen mit der jüngsten Tochter. Nachdem wir 1982 im gleichen Haus im Erdgeschoss einzogen, wurde der bisherige Mahlzeiten-Dienst der Pro Senectute durch meine Frau ersetzt. Unsere Kinder spielten gerne oben bei der Grossmutter. Sie waren dort mehr oder weniger unbeaufsichtigt und haben prompt auch Nägel ins Parkett geschlagen beim Hütten bauen. Die Schwiegermutter sass immer links auf ihrem Diwan beim Stricken, Lesen oder Fernsehen.
Klara hatte 6 Schwestern und 2 Brüder. Sie wurde 1918 in Trogen AR geboren als 9. von neun Kindern des Eduard Klee, 1872-1953, von Reute AR und der Paula Schadegg, 1876-1961, von Hemmerswil TG. Ihr Vater war tätig als selbständiger Sammler von Heil-Kräutern, welche er Apotheken zum Kauf anbot. Als die Familie im Jahre 1930 mit den drei noch minderjährigen Töchtern von der Nordost-Schweiz nach Zürich-Affoltern umzog an die Wehntalerstrasse 469, lebten vier erwachsene Kinder bereits in Zürich. Um 1940 bewohnte die Familie ein kleines Einfamilienhaus neben der alten Krone beim Zehntenhausplatz zwischen der Schlosserei Ita und dem Park mit der Villa von Ita. Von dort zogen die Eltern nach der Heirat von Klara und Alfred Jäger mit deren zwei Klein-Kindern in eine Dreizimmer-Mietwohnung vis-a-vis an der Wehntalerstrasse 546.

Dieser Ehe entstammten fünf Kinder:
Maja 1941, Fredi 1943-2002, Trudi 1951 (meine Ehefrau), Vreni 1957, Ursi 1960

Per Du wurden wir anlässlich einer betrieblichen Plausch-Veranstaltung, von jüngeren Mitarbeiterinnen organisiert. Nach Feierabend gingen wir zu sechst im Raclette-Stübli essen und danach in der Kegelbahn im Untergeschoss vom Dancing Golden Gate an der Limmatstrasse zu unserem kleinen Kegel-Turnier. Oben wurde noch getanzt und wir beide verstanden uns dabei auf Anhieb. Sie bewegte sich federleicht mit ihren 43 Kilogramm bei 152 Zentimetern Grösse. Ein Traum, sich mit ihr beim geschlossenen Tanz zu bewegen. Ich begleitete Trudi noch auf ihren Bus und verlangte beim Abschied einen weiteren Tanz mit ihr. Sie liess mich Monate lang zappeln und vergeblich anklopfen, bis sie endlich einem Rendezvous zusagte. Ich besass wieder ein Auto, Ford Capri 1600, und konnte sie bei ihr zu Hause abholen. Wir fuhren zum Dancing Belmondo in Dübendorf, zu früh, der Diskjockey begann erst um 21 Uhr mit der Musik, an der langen Bar-Theke gleich nach dem Eingang sassen verloren ein paar Männer, die Tische rund um die Tanzfläche waren noch frei. Wir nahmen nebeneinander Platz auf einem Zweier-Sofa und bestellten eine Flasche St.-Saphorin-Weisswein, im Eiskübel. Das Lokal füllte sich langsam, ich legte irgendwann meinen Arm um ihre Schultern, wir sahen uns tief in die Augen und küssten uns gleichzeitig zum ersten Mal. Dann tanzten wir stundenlang Discofox, 4/4 Takt, lieber langsamer als schneller, mit Pause bei jenem Takt, welcher den Besuch einer Tanzschule voraussetzte. Beide tanzten wir gerne, harmonisch zusammen in einem uns eigenen Freistil, hatten auch keine Hemmung, als Erste eine leere Tanzfläche zu betreten. Zum Abschied im Auto erstmals geliebt, danach waren und blieben wir ein Paar, bis heute.
Am Arbeitsplatz blieb unser Verhältnis nicht lange verborgen, war doch ihr goldener Schlüsselchen-Anhänger an ihrem Hals durch mein kleines Herz aus Gold ersetzt worden, den Schlüssel trug nun ich, allerdings unter meinem Hemd. Da wir mittlerweile in zwei verschiedenen Abteilungen in anderen Räumen arbeiteten, entstanden durch unsere Beziehung keinerlei Probleme. Kurz danach wurde die Ehe von Trudi geschieden. Am Tag der Scheidung lud sie mich und ihren frisch geschiedenen Ex-Mann zusammen mit seinem besten Freund zum Abendessen bei sich zu Hause ein und bereitete ein köstliches Riz-Casimir. Die Trennung der beiden vollzog sich ohne jeden Streit in gegenseitigem Anstand und Respekt, richterlich abgesegnet. Trudi behielt die Wohnung, wo ich ein paar Wochen später bei ihr einzog nach dem Wegzug ihres Ex-Mannes. Zusammen fuhren wir nun morgens mit dem Auto zur Arbeit am gleichen Ort und abends wieder nach Hause, besuchten zum Mittagessen abwechselnd ein Restaurant im näheren Umfeld der Bank. Die Parkplätze in den Quartier-Strassen der Stadt Zürich waren gebührenfrei und zeitlich unbeschränkt.
Die Löhne wurden von der Direktion-Sekretärin mit Bargeld am Arbeitsplatz ausbezahlt. Von Anfang an machten wir gemeinsame Kasse, legten gleichberechtigt unser beider Lohn-Geld zusammen. Trudi war ausgesprochen kostenbewusst, sparsam und wurde automatisch zuständig für den Überblick und die privaten Einzahlungen mit dem gelben Post-Quittung-Büchlein.
Trudi bewohnte in Zürich-Nord eine Drei-Zimmer-Wohnung im 2. Obergeschoss in einem Altbau, für welchen bereits ein Neubau-Projekt bestand. Vor dem Haus hatte sie einen Auto-Parkplatz gemietet. Aufgewachsen war sie im etwa vier Kilometer entfernten Zürich-Affoltern in einer Vier-Zimmer-Wohnung einer Baugenossenschaft. Sie hatte einen Bruder und drei Schwestern, zwei davon mit 15 und 18 noch minderjährig. Wenn ich wegen Militärdienst abwesend war, wohnte Trudi an den Wochenenden bei der Mutter und den beiden Schwestern. Ihr Vater verstarb 1968 im Alter von 55 Jahren. Voriges Jahr erlitt die Mutter einen kleinen Hirnschlag, bis auf eine leichte Gehbehinderung ohne bleibende Schäden und musste nach dem Spital zur Kur ins Tessin. Beide Elternteile entstammten appenzell-ausserrhodischen Familien, welche anfangs 20. Jahrhundert vermutlich aus wirtschaftlichen Gründen nach Zürich auswanderten.
Unseren ersten gemeinsamen Urlaub verbrachten wir als Camping-Ferien am Meer. Mit dem Ford Capri nach Marina di Massa zwischen Genua und Pisa. Die Touristen-Sommer-Saison war schon längst zu Ende, Warm-Wasser in den Duschen abgestellt. Unser Zelt stand allein am Strand vor dem Pinienwald.

Am Genfersee heiratete meine ältere Schwester 1975 ihren Freund. An diesem Fest fragte ich Trudi, ob wir beide nächstes Jahr heiraten wollten. Sie hatte keine Einwände und wir haben uns im Februar 1976 auf dem Zivilstandsamt Zürich da Ja-Wort gegeben. Zu viert, nur wir beide und als Trauzeugen ihren Bruder mit seiner Ehefrau im Trau-Zimmer beim Standesbeamten. Danach zusammen im Zunfthaus zum Rüden ein feines Chateaubriand und gleich wieder heim. Meine (ab jetzt) Frau Trudi hatte bereits einmal kirchlich geheiratet, ganz in weiss mit Schleier und Braut-Strauss und danach gefeiert mit Reise-Car und Schiff zum Hotel am Ägeri-See, ein grosses Fest mit Musik-Kapelle und Polonaise durch das ganze Haus. Für diesmal entschlossen wir uns, eine abgelegene Wald-Hütte für Veranstaltungen in Spreitenbach zu mieten und unsere sechzehn Gäste zu einem selber gemachten Fondue Chinoise einzuladen.
Der Capri wurde nach einem Motorschaden ersetzt durch einen Plymouth Valiant. Für die nächsten beiden Monate war wieder Militärdienst angesagt in der Kaserne Stans, den Rest-Anteil vom höheren Unteroffizier abverdienen. Ab und zu besuchte ich über Nacht meine Frau in Zürich. Ohne Urlaub-Pass auch nicht bewilligt. Als Fourier hatte ich die ganze Nacht über Ausgang, musste einfach beim Morgenessen zurück sein. Bei einer solchen Fahrt in Richtung Zürich war ich einen Moment unaufmerksam und geriet in einer langen Links-Kurve bei Hünenberg in der Nähe von Zug auf die Grasnarbe neben der Fahrbahn. Mit der nicht regulierten, leichten Servo-Lenkung war keine Korrektur mehr möglich, der Wagen geriet auf das abfallende Bord, hängte ein an einem Verankerung-Seil einer Strassenlaterne, überschlug sich erst diagonal und dann noch quer hinunter ans Bahngleis. Als ich nach dem Schock wieder bei mir war, krabbelte ich unverletzt, der Wagen hatte keine Sicherheits-Gurten, durch die nun fehlende Windschutz-Scheibe ins Freie. Oben an der Strasse standen bereits Zuschauer, die Umgebung hatte Stromausfall. Die Polizei setzte mich zuerst in ihrem Streifenwagen auf die Rückbank und nach langem Warten ging die Fahrt nach Zug auf den Posten. Dort wurde mir nach der Einvernahme die Blutprobe abgenommen. Per Anhalter fand ich zurück nach Stans, rechtzeitig zum Frühstück. Danach verliess ich das Büro die nächsten Tage keine Minute zu viel und konnte die vom Kantonspolizisten angesagte Benachrichtigung über den Vorfall an meinen Kompagnie-Kommandanten in seinem Namen selber entgegen nehmen. So beendete ich zwei Wochen später unbehindert meinen Dienst und hatte der Militär-Justiz zusätzliche Arbeit erspart.

Unsere geplanten Flitter-Wochen mussten wir jetzt ohne Auto umdisponieren. Wir entschlossen uns für zwei Wochen Badeferien auf Mallorca mit dem Flugzeug. Mit dem Reiseveranstalter Universal-Reisen im Hotel La Perla in s'Illot. Weil unsere drei jüngsten Schwestern noch nie am Meer waren, hatten wir diese zur Mitreise eingeladen und mitgenommen. Meine Schwester war 21, jene von Trudi 19 und 16. Im Hotel erhielten wir zwei Zimmer mit Verbindungstüre und Meer-Blick. Das Essen in Voll-Pension war geniessbar, ein dunkler, muffiger Saal im Untergeschoss. Unsere Hauptbeschäftigung bestand im Sonnen-Baden und abends tanzen in der nahen Disco. Nebst Sangria schlürfen selbstredend für uns beide.
Noch bevor der wegen Neubau befristete Mietvertrag von Trudi auslief fanden wir eine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung in einer Wohn-Baugenossenschaft an der Stadtgrenze in Zürich-Affoltern und zogen um. In die sechste Etage eines Hochhauses, mit Sonne von morgens bis abends. Der Balkon in Richtung Süden. Das Kellerabteil war im 2. UG ohne Lift, mit Vorteil zu Zweit aufzusuchen, weil allein dort unten hätte niemand etwas hören können. In der Mitte des Hochhauses war die Waschküche mit Tumbler und Trocknung-Raum. Nachdem uns dort Bett-Wäsche gestohlen wurde, hatten wir uns eine eigene Wasch-Maschine in der Küche angeschafft. Eine grosse Tief-Garage mit Wasch-Platz für das Auto war in der Nähe.
Für das halbe Zimmer liessen wir uns von der Möbel-Schreinerei Schärer in Hirzel einen Schiefertisch, zweiseitig ausziehbar, anfertigen mit einer U-förmigen Sitzbank, genau passend in das Zimmer. Von meinem Vater hatte ich gelernt, Mittelpunkt einer Wohnung sollte ein richtiger Tisch sein und nicht die neumodische Polster-Gruppe mit dem kleinen Klubtisch. Meine Frau Trudi ist eine hervorragende Gastgeberin und eine Spitzen-Stern-Hobby-Köchin. Sie bewirtet und bekocht gerne Besuch, an Familien-Anlässen waren schon 18 Personen gleichzeitig bei uns zu Hause am Tisch beim Essen und Trinken. So haben wir lieber den Besuch bei uns als umgekehrt. Durch die neu importierte Mode, beim Betreten einer Wohnung die Schuhe ausziehen, wird besuchen ohnehin schwieriger. Ich ziehe meine Schuhe jedenfalls nirgends aus. Wer ein Problem hat mit der Hygiene vom Fussboden oder sich die Renovation der Wohnung nach meinem Besuch sparen will, braucht mich auch nicht einzuladen.
Irgendwann hatte ich Trudi gegenüber beiläufig erwähnt, jetzt wo wir verheiratet seien, müsste sie doch die Anti-Babypille bzw. 3-Monat-Spritze nicht mehr nehmen. Unerwartet, aber hoch erfreut nahmen wir das positive Resultat vom Schwangerschaft-Schnelltest zur Kenntnis: Trudi war guter Hoffnung mit unserem ersten Kind, Termin im Mai 1977.
Am Arbeitsplatz wurde an einem frühen Nachmittag die blinkende Überfall-Alarm-Anzeige nicht zurück gestellt. Meine schwangere Frau war nebenan im Schalterraum beim arbeiten. Sie sagte, sie habe nichts bemerkt, bis sie auf ein Psst hin aufblickte und über den offenen Korpus in den Schall-Dämpfer einer Pistole blickte. Der Überfall durch die zwei Männer dauerte nur wenige Sekunden bis sie das Bargeld, etwa dreissig tausend mit den Fremd-Währungen, aus der Kasse hatten und wieder verschwanden. Vom Tresor hinter der geschlossenen Holzwand wussten sie nichts, dort waren ausgerechnet an diesem Tag zwei Millionen Franken zur Abholung bereit gestellt worden. Die Täter waren Mitglieder der für Überfälle berüchtigten Alfa-Bande, welche auch schon geschossen und getötet hatte. Nachdem die Polizei wieder weg war wurde weiter gearbeitet als ob nichts passiert wäre. Nichts von neumodischen Care-Teams oder Seelsorge. Alle Mitarbeitenden mit Kontakt zum Schalter mussten später ihre Finger-Abdrücke abgeben bei der Kriminalpolizei. Angesichts meiner dem Vergessen anheimgestellten Vorgeschichte tat ich dies mit einem (unbegründet) mulmigen Gefühl.
Das Betriebsklima wurde zunehmend eingetrübt durch die fast täglichen Nachrichten von Massen-Entlassungen. Die von einer Ölpreis-Krise 1973 ausgelöste Welt-Wirtschaftskrise schlug in der Schweiz erst 1976 voll durch. Auch auf unserer Privat-Bank war weniger Arbeit. Nicht wie anderen war mir mit meiner speditiven Arbeitsweise zutiefst zuwider, so zu tun als würde ich arbeiten und dabei einfach Papiere auf dem Pult von einem Stapel zum nächsten zu verschieben.
Ein denkbar schlechter Moment für mich, der wegen Lohnaufbesserung infolge Vaterschaft vorsprach und keine erhielt. Nebst den Stellen-Anzeigen studierte ich nun auch die Geschäft-Verkäufe und sah einen zum Verkauf angebotenen Lebensmittel-Laden in Zürich. Das wäre doch etwas, fanden wir beide. Ich rief meinen Vater an, welcher vor kurzem die Erbteilung meines Grossvaters erhalten hatte und fragte nach seinem Einverständnis für ein Darlehen. Nach Schilderung der Sachlage sagte er zu und wir besichtigten den Tante-Emma-Laden nahe beim Goldbrunnen-Platz. Wir beide ohne jede Praxis auf diesem Gebiet konnten einen ganzen Samstag-Verkauf-Tag lang im Laden dabei sein, schnupperten und hatten uns danach zum Kauf entschieden mit Übergabe auf den 1. April 1977. Dass wir in dieser unsicheren Zeit, als nicht wenige in Sorge um ihren Arbeitsplatz waren, den unseren freiwillig hergaben und mit Schwangerschaft die Selbständigkeit wagten, wurde von einigen erstaunt bis verwundert zur Kenntnis genommen.



Für uns, gestern noch Sachbearbeitung in der Privat-Bank, war alles neu. Doch wir lernten rasch. Bereits beim gemeinsamen Inventar mit den Vorbesitzern lernten wir das gesamte Sortiment kennen wie auch die diversen Maschinen und Apparate. Das bestehende Bestellwesen mit den Lieferanten blieb vorerst unverändert. Verträge waren keine zu übernehmen, wir waren absolut frei im Einkauf. Alle Lieferungen erfolgten gegen Rechnung 30 Tage netto.
Am Nachmittag vom Vortag wurde telefonisch die tägliche Bestellung durchgegeben für Milch, Rahm, Jogurt, Butter, Käse. Die Anlieferung per Lastwagen erfolgte frühmorgens mit Schlüssel in das noch geschlossene Geschäft. Die Produkte wurden nach unserem Eintreffen kurz danach als Erstes in die acht Wand-Kühlschränke einsortiert. Im Keller ratterte jeweils nach Bedarf einer der beiden Kompressoren für die Kühlung der Schränke.
Die Spezialitäten brachte jede Woche ein Gross-Händler, der mit seinem gekühlten Verkaufs-Lastwagen vor unserem Laden parkte. Wir führten im offenen Anschnitt nebst Greyerzer, Emmentaler und Sbrinz vom Milchlieferanten noch Appenzeller, Tilsiter (rot und grün), Walliser Bergkäse, Saint Albray, Chaumes, Camembert, Taleggio, Parmesan, Mascarpone, Gorgonzola. Die Berkel-Schneidmaschine war für Salami (fein und grob), Mortadella, Parmaschinken, Bure-Speck, Press-Schinken ohne Phosphate, Fleischkäse.
Gemüse und Früchte wurden von uns täglich morgens in der Halle vom Gross-Markt eingekauft. Wir hatten uns ein Kombi-Fahrzeug mit Dachträger angeschafft für Einkauf und Hauslieferungen. Der Bierlieferant fuhr wöchentlich mit dem Hürlimann-Pferde-Gespann vor und tauschte selbständig die leeren gegen volle Flaschen-Harasse. Ein Eier-Händler glich einmal die Woche selbständig den Vorrat an Frisch-Eiern im Keller aus. Jede Woche fuhren wir zum Gross-Händler (Cash&Carry, Prodega und Angehrn) für den Einkauf der Kolonial-Waren, Zigaretten und übrigen Haushalt-Artikel. Bei Gelegenheit kauften wir auch Halb-Preis-Aktionen von Discountern. Mineralwasser und Limonade lieferte ein Getränke-Dienst nach Bedarf auf Bestellung, den Wein ebenso eine Weinkellerei und Frisco die Glace-Produkte. Für die Anlieferung befand sich beim Parkplatz eine Luke mit Eisendeckel und einer Rutsche zum Tisch-Sockel im Keller, wo die Waren mit Preis ausgezeichnet wurden mit einem Etikettier-Gerät.
Einige Kundinnen holten die Milch noch offen im Kessel ab. Der Verkauf von frischer Rohmilch brauchte eine Bewilligung. Dazu musste ich eine Prüfung bestehen beim Lebensmittel-Inspektor, welche nachwies, dass ich über den Fettanteil (Rahm) der Milch, deren korrektes Umrühren sowie die fachgerechte Reinigung der dazu benötigten Utensilien Bescheid wusste.
Die beiden geeichten Waagen wurden periodisch nachgeprüft vom Eichamt. Die Alkohol-Verwaltung schrieb die Führung eines Journals vor über den Einkauf von gebranntem Wasser. Unangemeldet kam die Lebensmittel-Kontrolle zu Besuch und prüfte Kühl-Temperaturen und Sauberkeit, immer ohne Beanstandungen.
Die Ladenöffnungszeiten setzten wir fest auf 7.30-12.30, 15.00-18.30, Mittwoch-Nachmittag geschlossen, Samstag 7.00-16.00 durchgehend. Sonntag geschlossen.
Im Laden war keine Selbst-Bedienung. Die Kundschaft wurde persönlich begrüsst, bedient und verabschiedet, möglichst mit Namen. Wir waren ohnehin beide von Haus auf anständig und freundlich, zusätzlich war meine Frau Trudi mit ihrer herzlichen, umgänglich einnehmenden Wesensart ein Sonnenschein. Viele Kunden kannten sich aus der Umgebung und nutzten die Begegnung bei uns zum Gespräch. So entstand auch bei Wartezeiten keine Unruhe oder Hektik.
Meine Frau arbeitete noch im 9. Monat bis zum letzten Tag vor der Geburt unseres ersten Sohnes. Mit ihrem Frauenarzt hatte sie vereinbart, dass an Auffahrt der Gebär-Vorgang eingeleitet werden soll, weil dann unser Geschäft geschlossen sei. Wir hatten schon frühzeitig eine Zusatz-Privat-Versicherung für Schwangere abgeschlossen. Trudi konnte als Privat-Patientin in der Klinik Hirslanden in Zürich entbinden. Dass sie mich nicht dabei haben wollte war mir noch so recht, nach meinen Gefühlen ist gebären eine reine Frauensache. (Ich war bei keinem meiner drei Kinder bei der Geburt vor Ort). Während ihrer Abwesenheit im Geschäft wurde sie von meiner jüngsten Schwester vertreten, einer gelernten Detailhandel-Verkäuferin, bis sie von sich aus die Mitarbeit wieder aufnehmen wollte.
Bald krabbelte unser Liebling als Jö-wie-herzig im Ladenlokal herum. Wir pflegten stets einen regen Kontakt mit unseren Verwandten und Bekannten, abwechselnd mehr oder weniger und erhielten immer, wenn nötig, deren unterstützende Hilfe. Damit wir am anstrengenden und umsatzstärksten Samstag unbelastet arbeiten konnten, holte meine Mutter unsere Kinder jeweils am Freitag-Nachmittag zu sich nach Horgen, wo wir sie samstags wieder abholten, verbunden mit einer Lebensmittel-Lieferung zu Gunsten Darlehen.
Nach dem Nothelferkurs und den Lernfahrt-Stunden bestand Trudi im Juni 1978 die Auto-Fahrprüfung im ersten Anlauf.
Damit wir das Geschäft nicht ferienhalber schliessen mussten, übernahmen meine Eltern jeweils für zwei Sommer-Wochen die Stellvertretung. 1978 Camping Riarena in Cugnasco im Tessin. Nachher nur noch Italien am Meer, die Hinfahrt stets nachts ohne Stau am Gotthard und am Zoll in Chiasso, die Rückfahrt dann tagsüber: 1979 Camping in Marina di Massa, danach in Cavallino bei Jesolo/Venedig im Mediterraneo oder Dei Fiori.

Wir kochten nie selber beim kampieren, lediglich morgens bereitete Trudi einen Filter-Kaffee zu mit einem kleinen Butan-Gas-Brenner und holte frische Brötchen im Camping-Laden während wir alle noch schliefen. Mittags und abends assen wir mit den Kindern im Restaurant.
Als Trudi 1979 mit dem zweiten Kind schwanger war entschlossen wir uns, die bisher als Lager dienenden, mit einem Durchgang dem Ladenlokal angeschlossenen Räume als Wohnung zu nutzen. Nebst einer geräumigen Wohnküche, getrenntem Bad und Toilette waren da noch zwei grosse Zimmer mit Einbau-Schränken. Gekocht wurde mit Erdgas. Für Warmwasser waren in Küche und Bad mit Gas betriebene Durchlauf-Erhitzer. Für alles zusammen zahlten wir eine Monat-Miete von 800 Franken, inklusive Ladenlokal. Wir liessen die Räume neu streichen und Spann-Teppiche verlegen. Für das Wohn-Zimmer kauften wir Occasion eine massive Wohn-Wand mit klappbarem Doppel-Bett für uns. Der zweite Sohn kam einen Monat vor dem Termin, nachdem Trudi am Vortag mithalf, eine schwere Glas-Platte zu verschieben und sie in der Nacht das Frucht-Wasser verlor. Nächsten Tag kam sie zum eingeleiteten gebären in die Klinik Hirslanden. Meine Mutter übernahm diesmal die Stellvertretung.
Auf Anfrage hin beteiligten wir uns an einem Wohnstrasse-Projekt von Nachbarn und stellten für ein Fest vor unserem Geschäft die Infrastruktur über den Getränke-Lieferanten inkl. Tischen und Bänken. Die Eingabe scheiterte schliesslich am Widerstand der Stadt. Ausser Spesen nix gewesen.
Nach der Eröffnung eines Supermarktes durch einen Gross-Verteiler (Coop) nur 200 Meter entfernt blieben uns die Stammkunden zwar erhalten, unter dem Strich hatten wir etwas weniger, aber noch immer genügend Umsatz. Bei jenen allerdings, die ihre volle Einkauf-Tasche abstellten und bloss noch je 50 Gramm Emmentaler- und Greyerzer-Käse zusammen gerieben haben wollten, war ich gnadenlos abweisend.
Wir belieferten mehrere Restaurants und Cafés mit unseren Produkten, darunter das junge Kollektiv Palme an der Bertastrasse. Vom schon länger vorhandenen Gedanken getragen, die Wirte-Fachschule zu absolvieren, fragte ich an und konnte dort jeweils von samstagabends bis Sonntag-Nacht ein bezahltes Schnupper-Praktikum machen mit Küche, Buffet und Bedienung.
Zwecks Erhöhung der Liquidität fuhr ich etwa ein Jahr mit meinem Wagen am Sonntag-Vormittag eine Sammel-Tour bis nach Vaduz im Fürstentum für die Trio-Wette der Landeslotterie.
Eine ältere Kundin erzählte beim Einkauf vom Auto-Unfall ihres Lebensgefährten, einem 72-jährigen Taxi-Halter. Dieser hatte beim wegfahren am Hauptbahnhof einen Totalschaden verursacht und sich gleich wieder einen neuen Taxi angeschafft. Nun hätten sie ihm den Ausweis entzogen, was sie auch machen solle mit dem Auto, ob wir einen Käufer wüssten. Als sie mir den Neuwagen mit einem Abschreiber von 50% anbot, kaufte ich den Datsun Bluebird sofort, (ich dachte zum weiter verkaufen). Meine Frau, ihr Ex-Mann war ebenfalls Taxi-Halter, hatte die Idee, ich sollte den Wagen doch behalten und die Taxi-Prüfung machen. Dann könnte ich, wenn im Laden der Umsatz noch weiter zurück gehen würde, mit Taxifahren genug Geld verdienen. Gesagt getan. Ich nahm den neuen Wagen auf Wechsel-Nummer, mietete einen Platz in einer Einstell-Halle in Schlieren (7 km entfernt), bestand die Zusatz-Prüfungen, für gewerbsmässigen Personen-Transport beim Strassen-Verkehrsamt, für den Taxi-Ausweis bei der Gewerbepolizei, unterschrieb einen Anschluss-Vertrag bei der Zentrale Taxiphon und erhielt 1980 eine B-Funk-Betrieb-Bewilligung als selbständiger Taxihalter der Stadt Zürich. 1982 wurden alle B- in A-Bewilligungen umgewandelt, welche die städtischen Standplätze benutzen durften. Je nach Lust und Laune konnte ich jetzt nach dem Abendessen noch ein paar Stunden als Taxi arbeiten. Den Rest-Schlaf holte ich mir über die Mittagspause, manchmal liess mich Trudi morgens auch länger schlafen.
Weil ich als Einzelfirma keine Kinderzulagen der Familien-Ausgleichskasse erhielt, wandelte ich 1982 das Darlehen von Vater um in eine Aktiengesellschaft und wechselte meinen Status von selbständig erwerbend auf angestellt in der eigenen Firma. So konnte ich pro Kind und Monat 100 Franken bei meinen AHV-Zahlungen in Abzug bringen. Die AG gründete ich ohne Hilfe mit Obligationen-Recht und einer Statuten-Vorlage von meinem Schwager aus dessen Arbeitgeber-Firma.
Bei der Wohn-Baugenossenschaft, wo Trudi aufwuchs, hatten wir uns auf der Warteliste angemeldet für ein Reihen-Einfamilien-Haus. Eines Tages stand der Obmann der Siedlung, welcher Trudi kannte, im Laden mit der freudigen Mitteilung, er hätte uns zwar kein Häuschen, aber eine Vier-Zimmer-Wohnung im Parterre mit Garten-Sitzplatz im gleichen Haus wie ihre Mutter. Wir sagten zu und zügelten im Herbst 1982 zurück nach Zürich-Affoltern.
Am nächsten Sylvester holte der Nachbar in der oberen Wohnung, wir kannten uns bisher per Sie bloss vom sehen her, uns und die schon betagte andere Nachbarin aus dem Erdgeschoss zu sich hinauf zum anstossen auf das neue Jahr. Seine Frau schöpfte Basler Mehlsuppe und reichte Würstchen. Er erzählte mir von einem Auto-Unfall mit Ausweis-Entzug für drei Monate und dass er selbständig Transporte ausführen würde. Er hätte von einem grossen Transport-Geschäft vertraglich eine feste Foto-Sammel-Tour nachts. Er würde diesen Auftrag verlieren wenn er nicht fahren kann und ob ich dies für ihn übernehmen könnte. Ich sagte zu, wir einigten uns auf 3000 Franken jeden Monat. Als die Zahlung fällig war, hielt er mich hin mit immer neuen Ausflüchten. Vom Betreibungsamt erfuhr ich auf meine Nachfrage hin von seiner Zahlungs-Unfähigkeit. Was sollte ich tun? Ich entschloss mich zum weiterfahren und hatte nach drei Monaten 9000 Franken zu gut, wofür er mir seinen VW-Transporter samt Chauffeur und Anschluss-Vertrag bei Welti-Furrer übertrug. Für ihn selber war vorgesehen, sich in meinem Lebensmittel-Geschäft einzuarbeiten, was sich aber nach kurzer Zeit als illusorisch herausstellte. Selbst den auf mich eingelösten Lada-Kombi, den er jetzt zu seiner alleinigen Verfügung hatte, musste ich ihm wieder wegnehmen, weil er trotz Ermahnung weiterhin damit nachts von seinen Stamm-Kneipen und Spiel-Automaten mehr oder weniger alkoholisiert nach Hause fuhr. Die für einige ruinösen Geld-Spiel-Automaten im Restaurant wurden anfangs der 90-er im Kanton Zürich verboten, später in der ganzen Schweiz. Der Nachbar arbeitete schliesslich wieder in seinem früheren Beruf als Verkäufer bei einem Gross-Verteiler.
Für die Kodak-Foto-Tour nachts suchte und fand ich einen Fahrer mit eigenem Auto. Dem Transport-Chauffeur kauften und abonnierten wir einen Ortsruf-Empfänger (Piepser) und erteilten die Aufträge beim Rückruf telefonisch. Sein Standort war die Transport-Taxi-Disposition bei Welti-Furrer mit Tischen und Kaffee-Automaten für deren Arbeiter. Private Transporte mussten bar bezahlt und vom Chauffeur bei uns im Laden abgerechnet werden. An einem Samstag-Nachmittag sahen wir vom Geschäft aus unseren Lieferwagen vorne an der Hauptstrasse vorbeifahren, er hatte am Vormittag einen Umzug in ein Altersheim. Als unser Chauffeur nur für anderthalb Stunden Bargeld ablieferte, wir haben ihn ja nachmittags gesehen, fragte ich bei der Kundin zurück und erfuhr, sie hätte ihm das Dreifache bezahlt plus ein grosszügiges Trinkgeld. Nach Ladenschluss meldeten wir uns bei ihm zu Hause, stellten ihn zur Rede, nahmen ihm die Autoschlüssel ab und entliessen ihn fristlos. Auf einen Rest-Lohn wurde verzichtet, den hatte der Chauffeur mit seinen Betrügereien bereits vor-bezogen. Für nächsten Montag hatten wir bereits eine uns zugeteilte Filial-Tour für Csuka-Schuhe, welche nun ich ohne Einarbeitung ausführen musste. So übten wir am Sonntag als Familien-Ausflug das Fahren mit dem drei Meter hohen Lieferwagen.
Trudi war inzwischen im 5. Monat mit ihrem 3. Kind, einer Tochter. Wir hatten jetzt monatliche Verpflichtungen für das Lebensmittel-Geschäft (800 Franken), den Anschluss Funk-Taxi (400) Franken) und den Anschluss Transport-Taxi (1200 Franken). Wir entschlossen uns, das Lebensmittel-Geschäft zu liquidieren, führten einen Ausverkauf durch und schlossen Ende November 1983 endgültig. Die gesamte Einrichtung wurde mit eigenem Lieferwagen entsorgt und die Lokalität besenrein leer zurück gegeben.
Von nun an blieb Trudi zu Hause und konnte sich als Mutter und Hausfrau (endlich) fast uneingeschränkt der Familie mit unseren drei Kindern widmen. Fast deshalb, weil sie wegen der Transport-Disposition dem Festnetz-Telefon verpflichtet blieb, Handys waren damals noch Zukunftsmusik. Und da war auch noch ihre nicht immer pflegeleichte Mutter im 1. Obergeschoss vom gleichen Haus.


Das eigentliche Familienleben mit unseren drei Wunschkindern begann 1982 mit dem Umzug nach Zürich-Affoltern in eine Vier-Zimmer-Parterre-Wohnung der Baugenossenschaft.1998 bezahlten wir als Miete monatlich 850 Franken inklusive Nebenkosten und einem reservierten Parkplatz im Freien. Im gleichen Haus ist meine Frau aufgewachsen, ihre Mutter wohnte noch immer dort mit der jüngsten Tochter, welche später zu ihrem Freund umzog. Die Mutter wurde von meiner Frau versorgt bis zu ihrem Wechsel 1990 ins Altersheim Rosengarten in Uster, wo sie 2001 im Alter von 82 verstarb.

Das Wohnhaus war Baujahr 1946 mit der damals üblichen Grösse der Wohnzimmer, die im Vergleich zu heute kleiner waren. Mit Zentralheizung und Warmwasser. Von der Haustüre führte die eine Treppe rechts hoch zu den Parterrewohnungen links und rechts, die andere hinunter zu den Keller-Räumen. Nach der Wohnungstüre folgte ein Gang mit Türen links und rechts zu den Zimmern. Auf der rechten Seite zwei Schlafzimmer. Links zuerst das Badezimmer mit Badewanne, Toilette, Lavabo mit Spiegelschrank. Danach die geräumige Küche, elektrisch, mit Backofen und Kühlschrank. Zusätzlich von uns Mikrowellen-Gerät, elektrischer König-Grill, Kaffee-Maschine, ab Jahr 2000 Abwasch-Maschine. Wir haben einen Tisch mit Eckbank gekauft und dadurch wurde die Küche zum gemütlichen und beliebten Treff auch der Jungen. Am Ende des Ganges geradeaus ein Schlafzimmer, rechts das Wohnzimmer mit Türe zum Gartensitzplatz. Im Wohnzimmer der Auszug-Schiefer-Tisch für 10 Personen mit einer Eckbank und eine Polstergruppe mit Salontisch zum Fernsehen.
1984 kam für die Kinder eine Hauskatze dazu, der Tigi. Weil die Katze nicht ins Freie durfte, hatte ich im Wohnzimmer an Türe und Fenster grossmaschige Gitter angebracht, damit diese trotzdem offen bleiben konnten. Das Katzen-Kistchen platzierten wir neben der Waschmaschine unter dem Lavabo im Badezimmer. Die Katze wurde 18 Jahre alt, bis sie eingeschläfert werden musste und nicht mehr ersetzt wurde.
Für die Wäsche hatte die Siedlung in einem der fünf Wohnblocks einen eigenen Waschsalon mit fünf Maschinen V-Zug, die im Vormonat am Einschreibetag reserviert werden konnten. Für den Transport der Wäsche stand ein Handwagen zur Verfügung. Wir hatten aber unsere eigene Waschmaschine im Badezimmer unter dem Lavabo, den Ausguss-Schlauch mit Bleigewicht in die Badewanne. Im Untergeschoss war noch der frühere Waschraum mit einer intakten Wäsche-Schleuder und zwei grossen Trögen für die Handwäsche. Dort stand auch der Warmwasser-Boiler. Im Raum daneben waren Wäscheleinen gespannt zum Aufhängen und Trocknen. Eine abgeschlossene Türe führte in den Velo-Raum oder zu den Keller-Abteilen mit Naturböden. Unter dem Giebel-Dach befanden sich die Estrich-Abteile sowie zwei weitere Möglichkeiten zur Wäsche-Trocknung an Wäscheleinen.
Das grössere Eltern-Schlafzimmer richteten wir für unsere beiden Söhne ein, durch den grossen Kleiderschrank in der Zimmermitte ohne Sicht-Kontakt der beiden Schlafplätze. Die Tochter hatte immer ihr eigenes Zimmer für sich allein. Zu unserem Ehe-Glück leisteten wir uns ein Schlafzimmer mit Himmel-Bett von Möbel-Pfister in Suhr.

Kindergarten und Schulhaus befanden sich in 4 Minuten Fuss-Distanz, ohne Überquerung einer Hauptstrasse. Allein in unserer Genossenschafts-Siedlung mit 96 Wohnungen lebten 75 Kinder im Alter unserer Eigenen mit Jahrgang zwischen 1975–1985.
Die Schulzeit der Kinder war mehr oder weniger problemlos. Wir erzogen unsere Kinder frei denkend, ohne Druck oder Zwang in irgendeine Richtung. Wichtig war uns Anstand, nicht lügen, nicht stehlen, Wort halten, verlässlich sein. Sie erhielten von uns jede notwendige Unterstützung, auch Privat-Stunden in französischer Sprache wurden bezahlt, damit ein Verbleiben in der Sekundarschule möglich war. Vom Besuch des christlichen Religions- und Konfirmanden-Unterrichtes hatten wir sie dispensieren lassen, meine Frau war zwischenzeitlich ebenfalls aus der evangelischen Landeskirche ausgetreten. Einzig die Tochter mussten wir im 9. Schuljahr von der Schule nehmen wegen ihrem Quer eingestiegenen Lehrer, einem ehemaligen Flug-Begleiter. Sie erhielt aber dennoch auf Anhieb eine passende Lehrstelle zur Weiterausbildung. Alle drei Kinder absolvierten erfolgreich ihre Berufs-Ausbildung, welche von meiner Frau gesucht und gefunden wurden.
Als Erwachsene erinnern sich unsere Kinder, sie seien aufgewachsen wie im Paradies. Zu Hause die immer präsente Mutter, die von 1983-2000 als Haus- und Ehefrau arbeitete und den Haushalt, ihre Familie zu jeder Zeit unter Kontrolle hatte, zur Zufriedenheit aller. In jeder meiner freien Zeit war ich zu Hause bei meinen Liebsten, ich suchte und hatte nie ein zweites Zuhause in der Gastronomie. Selbst nur kurze Kaffeepausen machte ich wann immer möglich bei meiner Frau.
Durch meine Berufung in die Siedlungs-Kommission, welche die verschiedenen Anlässe innerhalb der Genossenschaft organisierte, ergaben sich vielfältige soziale Kontakte mit Nachbarn. Nachdem ich den Männerchor Zürich-Affoltern verlassen hatte, organisierten wir einen privaten Singtreff. Bis zu 14 befreundete Personen trafen sich von 1993-2000 monatlich zum gemeinsamen Singen bei Speise und Trank, nachdem ich ein Volkslieder-Textbuch mit 148 Titeln erstellt hatte. Eine Freundin und begnadete Sängerin begleitete uns mit Gitarre. Alle durften singen, niemand musste zuhören. Gesungen wurde in einem Siedlungslokal oder in der Wohnung von Teilnehmenden.

Meine Frau wurde in einen Frauen-Treff jeden Donnerstag-Vormittag bei einer Nachbarin eingeladen und aufgenommen. Sie war die Jüngste. Der Höhepunkt von diesem Dunschtig-Club war alljährlich die Teilnahme an der Fasnacht als Gruppe im grossen Saal des benachbarten Zentrums St. Katharina. Dort wurde auch die jährliche Mieterversammlung abgehalten mit anschliessendem Essen, Tombola und Tanz-Musik bis 2 Uhr morgens.

Den schulfreien Mittwoch-Nachmittag der Kinder gestaltete meine Frau regelmässig zusammen mit ihren Schwestern. Je nach Wetter wurde in die Nähe gewandert, am Katzensee gebadet, auf der Hürst-Wiese eine Feuerstelle zum Cervelat braten genutzt oder zu Hause gespielt.
Alle zusammen besuchten wir jeweils zum Schwimmen am Samstag-Nachmittag das Hallenbad in Rümlang mit einem grossen Auto-Parkplatz. Zur körperlichen Ertüchtigung hatten wir den 2.3 km langen Vita-Parcours Käferberg mit den verschiedenen Übungen. Am Rand der Strecke war beim Tennisplatz Waidberg ein Parkplatz zum bequemen Umstieg.
Sport betrieben weder meine Frau noch ich. Nach meinen beiden Schienbein-Brüchen mit 13 Jahren mit Ski ohne Sicherheits-Bindung und Fussball mit Wanderschuhen war mir klar, der Schonung von Knochen und Gelenke war längerfristig durch nicht sportliche Tätigkeiten am besten gedient. Alle drei Kinder fuhren ihre eigenen Bike-Fahrräder. Je nach Mode-Strömung dazu Roll-Schuhe, Skateboard, Inline-Skates. Den Söhnen kauften wir ein Peugeot-Moped, sobald sie 14 Jahre alt wurden, Kosten damals 800 Franken.
Der alljährliche Familien-Höhepunkt waren die zwei Wochen Camping am Meer in Cavallino, Italien. Dies waren über all die Jahre hinweg jeweils die einzigen Ferien unserer Familie. Weitere besondere Ereignisse waren die kulturellen Taktgeber, welchen wir in ihrer ursprünglich keltischen Bedeutung unsere Beachtung schenkten. Den Halbzeit-Wechsel Winter/Sommer am 1. Mai begingen wir mit dem Osterfest. Am 1. August dekorierten wir Draussen zum Sommerfest. Halloween, der Wechsel Sommer/Winter am 1. November fand mit Wiënacht statt und die Lichtmess am 1. Februar war die Fasnacht. Dazu kamen unsere und die Geburtstage der Kinder.
Meine Frau war und ist eine grossartige Gastgeberin, verbunden mit ihrer grossen Leidenschaft, der Kochkunst. Sie kann Speisen auf Sterne-Niveau zubereiten und so erstaunt nicht, wenn ich lieber chez Trudi, also bei meiner Frau, essen darf als irgendwo sonst. Wir hatten und haben oft Besuch bei uns zum Essen, vorwiegend aus der Verwandtschaft.

Nach dem Auszug der beiden Söhne 1999 bezog auch die Tochter 2005 ihre eigene Wohnung, nur 350 Meter entfernt. Zum Schutz der Persönlichkeits-Rechte verzichtet diese Autobiographie auf weitere Angaben zu unseren drei Kindern nach deren Wegzug aus ihrem Elternhaus.

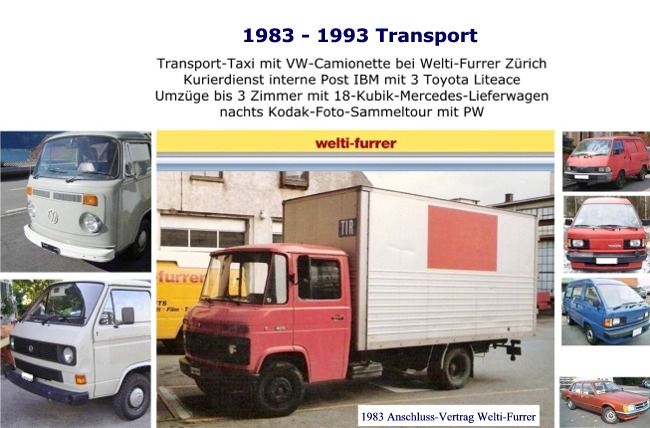
Nach unserem Wohnungswechsel 1982 hatte ich das frei gewordene Wohnzimmer im Lebensmittel-Geschäft in ein Arbeit-Zimmer mit Büro-Pult umgewandelt und wollte eigentlich mit Treuhand beginnen. Durch ein Inserat in einer Verein-Info im Zürcher Taxigewerbe hatte ich auch schon ein paar Kunden. Als 1983 der Transport hinzu kam, mietete ich in Zürich-Seebach ein Lokal mit zwei Schaufenstern und zwei Parkplätzen vor dem Haus als Büro und Raum für Einlagerungen. Für die 50 Quadratmeter wurden 500 Franken verlangt monatlich. Doch dann scheiterte die Zusammen-Arbeit mit unserem Wohnungs-Nachbarn und wir standen plötzlich allein da mit vier Geschäften und deren Verpflichtungen.
Was tun? Die Kombination von Transport-Taxi und Personen-Taxi war die rentabelste Variante und so konzentrierte ich mich nach der Liquidation vom Lebensmittel-Geschäft auf den Anschluss-Vertrag bei der Firma Welti-Furrer, Nr. 1 für Umzug und Transport auf dem Platz Zürich und behielt meine Taxi-Betrieb-Bewilligung und den Taxi als eiserne Reserve zur Existenz-Sicherung.
Die Welti-Furrer hatte damals nebst ihrem eigenen Fuhrpark ein internes Profit-Center für Kleintransporte mit sechs angeschlossenen selbständig Erwerbenden und deren Lieferwagen. Zugeteilt wurden die Aufträge zentral von zwei Mitarbeitern in der Disposition. Vorrang hatten ihre eigenen Fahrzeuge, wir angeschlossenen dienten zur Abdeckung von fehlenden Ressourcen. Mithilfe als Zügelmann oder zur Verfügung stellen mehrerer Zügelmänner, Lieferung von Packmaterial, Einpacken vor Umzügen, interne Umstellungen in Firmen, Klein-Transporte und kurzfristig eintreffende Transport-Aufträge (per Piepser mit Rückruf). Etwa ein Drittel unserer Einsätze bestand aus Daueraufträgen nur für uns, welche im Turnus zugeteilt wurden. Essentransporte für den SV-Service, Filial-Touren für Csuka-Schuhe und Pestalozzi-Bibliothek und dergleichen mehr. Am späteren Nachmittag vom Vortag waren die Aufträge für den nächsten Tag bekannt und wir wurden telefonisch nach Hause informiert (oder konnten selber nachfragen), ob und zu welcher Zeit wir diese auf der Disposition abholen konnten. Zwecks Abrechnung mussten die erledigten Aufträge im jeweils zuständigen Büro in eine Kredit-Lochkarte umgetauscht werden für die gesammelte Monats-Abrechnung. Eventuelle Bar-Einnahmen waren vorgängig auf dem Kassa-Büro abzuliefern.
Durch unseren Eintrag, kein Transport zu klein um ein Auftrag zu sein, im gelben Branchen-Verzeichnis erhielt meine Frau am Telefon zu Hause schon bald auch direkt Aufträge.
Den Lieferwagen von meinem Nachbarn übernahm ich in einem schlechten Zustand, er musste nach einem Jahr durch einen neuen ersetzt werden. Damit ich wie einige meiner Partner-Kollegen auch grössere Aufträge übernehmen könnte, kaufte ich zusätzlich von einer Auto-Verleih-Firma einen 18 Kubik Alu-Kasten-Lieferwagen und nahm diesen auf Wechsel-Nummer mit der 9 Kubik VW-Typ2-Camionnette. Die AVIS verkaufte ihren über vierzigtausend-fränkigen Mercedes-409-Lieferwagen einjährig für 18000 Franken. Besser neuwertig mit viel Kilometer als alt mit wenig, das stimmte. Ich hatte mit dem Wagen die nächsten zehn Jahre kein einziges Problem.
Mit Transport war viel Geld zu verdienen und ich kniete mich voll rein in dieses abwechslungsreiche Geschäft. Die Hilfskräfte, Gelegenheit-Arbeiter von der Brücke beim Güterbahnhof, kannten mich und wir konnten gegenseitig wählen, wer mit wem oder nicht. Jene mied ich eher, welchen ich vor der Arbeit zuerst in der nahen Schönau eine Flasche Bier bezahlen musste, damit ihre Hände aufhörten zu zittern und sie einsatzfähig waren. Der Tarif der Brücke war 20 Franken pro Stunde bar in die Hand. Verrechnen konnte ich 44 Franken pro Mann-Stunde. Das Transport-Gewerbe unterstand der obligatorischen Unfall-Versicherung SUVA, deren Inspektor, auch für die AHV zuständig, regelmässig bei mir zu Hause die Buchhaltung überprüfte. Ich sparte nie am falschen Ort und so hatte ich in meinen 40 Jahren Selbständigkeit kein einziges Problem, weder mit den Sozial-Versicherungen noch mit dem Steueramt.
Ein Limousinen-Service der Welti-Furrer vermittelte uns auch Gepäck-Transporte von arabischen Prinzen-Familien, da spielte Geld keine Rolle. Ich erhielt, zum Beispiel, eine Bestellung auf zehn Uhr vormittags ins Grand Hotel Dolder zum Gepäck-Verlad nach Genf in ein anderes Erste-Klasse-Hotel. Der Prinz schlief noch und durfte nicht geweckt werden. Also stundenlanges Warten zum regulären Transport-Stunden-Ansatz bis er dann um 14 Uhr wach war. Mit dem Gepäck und einem seiner Sklaven als Aufpasser neben mir in der Fahrerkabine nach Genf, (ich musste dann ja wieder zurück), der Prinz fuhr im Rolls Royce im Konvoi mit fünf weiteren Luxus-Limousinen, das Harem von zwölf jungen Frauen im Auto-Car und sein Jumbo-Jet flog leer von Kloten nach Genf.
Durch Vermittlung von Welti-Furrer erhielten wir ab und zu auch mehrtägige und mehrwöchige Aufträge für einen Lieferwagen mit Fahrer, wie Hauslieferdienst für Warenhaus Sankt Annahof oder UPS Paketdienst.
Durch meine Arbeit im Arbeit-Anzug der Welti-Furrer sah ich so beiläufig in manche Villa oder Wohnung von Super-Reichen in der Region Zürich, manchmal für mehrere Tage, etwa wenn wir zu zweit beim Erneuern der Spann-Teppiche für das verschieben der Möbel zuständig waren.
Mitte der 80-er kam bei multinationalen Firmen das Auslagern (Outsourcing) in Mode. Welti-Furrer erhielt einen solchen Auftrag und lagerte gleich weiter aus, fragte mich an, ob ich zwei Lieferwagen inkl. Fahrer für die interne Post der Firma IBM zur Verfügung stellen könnte. Ich unterschrieb den Vertrag, kaufte 1986 zwei fabrikneue Toyota Liteace und suchte zwei Chauffeure. Mit beidem hatte ich Glück. Die Autos liefen über Jahre kostengünstig und problemlos, die beiden Fahrer wurden zuverlässige und langjährige Mitarbeiter. 1988 kam noch ein dritter Neu-Wagen mit Fahrer dazu. Als letzter Sub-Unternehmer entschädigte ich die Angestellten immer 10% über dem gewerkschaftlichen Mindestlohn. Die Welti-Furrer übertrug den Vertrag später unverändert an die Luwa Engineering. Eine weitere neue Logistik-Firma übernahm den Auftrag ab Ende der 90-er mit eigenen Fahrzeugen.
Bei internen Umstellungen in Betrieben kam vor, dass uns zwei Haustechniker vom Betrieb in blauen Kitteln zusahen wie wir in wenigen Minuten ein paar leichte Büromöbel von einem Raum in einen anderen verschoben und ihrer Firma dafür mit Fahrtzeit neunzig Minuten Umzug-Tarif in Rechnung gestellt werden musste. Das war dann sozusagen die Auslagerung auf Stufe der Angestellten.
1985 kaufte ich meinen ersten Computer, einen Sanyo MBC, System DOS, noch ohne Festplatte mit zwei 360KB-Disketten-Laufwerken, eines für Programm, das andere für Daten-Speicherung. Dazu kaufte ich ein Buchhaltung- und ein Schreibprogramm. Am dunklen Bildschirm blinkte bloss ein grüner Cursor, ich hatte noch keine Ahnung und lernte mit dem Handbuch autodidaktisch, ständig unterbrochen vom nervigen Error-Piep, was ein Betrieb-System mit seinen DOS-Befehlen ist und wie das Gerät im Innern funktioniert. Danach folgten ein IBM-PC mit Windows 2.0, ein Fujitsu-PC mit Windows 3.11, ein HP-(Hewlett- Packard)-PC mit Windows 98 und Internet-Anschluss ab dann, ein HP-PC mit Windows XP und danach wiederum HP-PC mit Windows 7 und später 10. Die Geräte kaufte ich immer mit dem vorinstallierten neuen und daher passenden Betrieb-System. Bei Bekannten wurde ich in den 90-er Jahren zur helfenden Auskunft bei Fragen den Computer und Windows-System betreffend.
Mit Trag-Gurten bewegten wir auch mehrere hundert Kilo schwere Lasten zu zweit. Selber brachte ich rund hundert Kilo auf die Waage. In einer Wendeltreppe mit einem Klavier im Gurt spürte ich ein brennen im Kreuz, schenkte dem aber weiter keine Beachtung. Am nächsten Morgen konnte ich nur noch kriechen, mein rechtes Bein war lahm, erholte sich aber von selbst wieder. Schon Jahre zuvor bekam ich in Italien im Camping-Urlaub vom Arzt mal eine Aspirin-Spritze, nachdem ich mir beim aus dem Sand heraus stossen meines Autos den Rücken verknackt hatte und kaum mehr gehen konnte. Zum Arzt ging ich diesmal, als mir plötzlich der Nerv einklemmte. Diesen Schmerz, welcher dir sofort die Tränen fliessen lässt bis er beim wälzen auf dem Boden wieder nachlässt, wollte ich nicht nochmals erleben. Nach dem röntgen wurde eine Diskushernie zwischen Lenden-Wirbeln festgestellt und eine mehrmonatige Streck-Therapie (zwei Mal wöchentlich) angeordnet, welche tatsächlich Linderung brachte. Vom Militär wurde ich, mit 545 geleisteten Dienst-Tagen, für untauglich erklärt und entlassen. Leicht behindert arbeitete ich trotzdem weiter wie eh und je. Wie vom Hausarzt voraus gesagt, vertrocknete die Diskushernie und ich war nach ungefähr zehn Jahren wieder völlig Beschwerde frei.
Nach einer weiteren mehrere Monate dauernden Rücken-Streck-Therapie suchte ich für den Transport-Taxi-Anschluss bei Welti-Furrer einen Angestellten. Den geeigneten starken Mann für diese selbständige Arbeit zu finden war aber nicht einfach, ich hatte oft Wechsel und musste nach Einarbeitung ständig bereit sein einzuspringen bei Ausfall.
Weil unser Chauffeur bereits im Besitz eines Auftrages war, informierte eines Morgens die Kriminalpolizei uns als Arbeitgeber, sie hätten heute früh zwei unserer Fahrer verhaftet. Unseren Transport-Taxi-Fahrer und seinen ihm von früher her bekannten Kollegen, unseren Nacht-Kodak-Tour-Fahrer. Vor zehn Tagen erhielt meine Frau telefonisch den Auftrag, im Zollfreilager Zürich eine Sendung abzuholen und an die Rampe im Airgate-Haus in Zürich-Nord zu bringen, wo der Transport bezahlt würde. Der Chauffeur telefonierte dann, er bekäme die Ware nur gegen Bezahlung von 600 Franken, was wir ablehnten und den Auftrag als Fehlfahrt abschrieben. Obwohl er die Ware nicht entgegen nahm, wurden er und sein Kollege zehn Tage später verhaftet und gleichen Tages wieder entlassen? Ein ziviler Kripo-Beamter kam auch noch bei mir vorbei und nahm Tipp-Muster von meinen Schreibmaschinen zu Hause und im Büro in Seebach. Von diesem erfuhr ich, in der Sendung mit Bettwäsche aus Indien seien Haschisch-Platten versteckt gewesen und meine beiden Chauffeure wären vor Jahren schon einmal zusammen in eine Drogen-Sache mit Haschisch-Öl verwickelt gewesen. Mehr dazu erfuhren wir nicht.
Zu Hause war meine Frau Trudi, die perfekte Ehefrau, Mutter und Hausfrau. Sie lebte für ihre Familie, organisierte die Pflege der sozialen Kontakte und sorgte für das Wohl ergehen aller. Auch mir bereitete sie stets noch eine warme Mahlzeit bei meinem unregelmässigen Arbeitsende im Transport-Geschäft, manchmal erst spät nachts. Ab 1988 konnte ich Verspätungen wenigstens mit dem Mobil-Telefon melden. Für 2500 Franken hatte ich ein Mobiltelefon Motorola Natel C gekauft, jenes mit noch 3.5 Kilogramm Gewicht wegen der schweren Batterie, im Auto aufladbar. Trudi war auch die Schnitt-Stelle am Telefon für das Geschäft.
Im Wohn-Quartier war Trudi gut vernetzt, ist sie doch im gleichen Haus aufgewachsen, wo wir jetzt wieder wohnten. Regelmässig traf sie ihre drei Schwestern am Mittwoch-Nachmittag an unserem Küchen-Tisch. Der Donnerstag-Vormittag gehörte einem Dunschtig-Klub genannten Treff von acht Frauen bei immer derselben Nachbarin. Zur Fasnacht zogen diese jeweils verkleidet zum Anlass im nahe gelegenen Saal der katholischen Kirche.
Während acht Jahren war ich als Kassier ein Mitglied der vier-köpfigen, ehrenamtlichen Siedlungs-Kommission, welche die verschiedenen Anlässe durchführte: Die Mieter-Versammlung in einem Saal mit Tombola und Tanz-Musik bis zwei Uhr. Vor den Schul-Sommer-Ferien das Genossenschaft-Fest mit Festzelt, Wirte-Patent und Verlängerung der Polizeistunde samstags bis 2 Uhr. Ein grosses Feuer auf der Hürst-Wiese mit Samichlaus für die Kinder. Im Frühling eine Bluescht-Fahrt für die Pensionierten mit Privat-Autos. Trudi übernahm auch für vier Jahre die Führung und Reinigung vom zentralen Wasch-Salon der Siedlung gegen Entgelt.
Im Männerchor Zürich-Affoltern sang ich fünf Jahre lang mit als 2. Tenor Bariton mit wöchentlicher Probe am Donnertag-Abend. Eine Nachbarin begleitete ich auf Anfrage hin zwei Jahre zum Mitsingen im Gospelchor Dübendorf jeweils montagabends. Der polyphone (mehrstimmige) Gesang in der Gruppe ist ein ganz spezielles Gefühls-Erlebnis. Mit der meist möglichst anspruchsvollen und kompliziert hoch gegriffenen Lieder-Auswahl zum Vortrag und dem Vereins-Leben konnte ich mich aber nie anfreunden. Ich erstellte ein Volkslieder-Textbuch mit 148 Titeln und zusammen mit meiner Frau und einer Gitarre spielenden Freundin eröffneten wir 1993 einen privaten Sing-Treff. Bis zu 14 befreundete Personen trafen sich während sieben Jahren monatlich im Siedlungs-Lokal einer Baugenossenschaft zum Gesang mit anschliessendem Umtrunk samt Essen. Wir sangen nun vielstimmig, was aber nicht störte, weil niemand bloss kritisch zuhörte.
Anfangs der 90-er lernte ich autodidaktisch die Programmierung von Computer, zuerst die Sprache Basic und konnte später mit dem Programmier-Tool Clipper einem Männerchor-Kameraden ein funktionierendes DOS-Programm mit verbundenen Datenbanken für seinen Laptop erstellen.
Von wenigen Ausnahmen abgesehen fuhren wir jeden Sommer für zwei Wochen mit dem Auto nach Italien ans Mittelmeer. Ausser diesen zwei Wochen machten wir keine Ferien, sondern waren stets zu Hause.
Mehr per Zufall kam ich bei einem zwanglosen Gespräch mit dem für uns bei Welti-Furrer verantwortlichen Direktor auf meinen Taxi-Anschluss bei der Taxiphon zu sprechen, worauf mir dieser den Rat gab, ich sollte unbedingt zur Nr. 1 wechseln, der Taxi-Zentrale-Zürich. Die würden im Moment zwar keine Neuen mehr aufnehmen, aber er könne das vermitteln. Gesagt getan. Einen Monat später hatte ich den rio156 im offenen Sprech-Funk bei 449944 gegen den züri449 im modernen Daten-Funk bei 444441 ausgewechselt.
Ich fuhr nun vorwiegend Taxi, erfolgreich, oder arbeitete als Ferien-Ablösung meiner Kurier-Chauffeure mit fixen Touren. Als ich kaum noch Aufträge für leichtere, den Rücken schonende Tätigkeiten vermittelt bekam, kündigte ich meinen Transport-Anschluss bei Welti-Furrer.
Camping-Ferien Sommer 1988

Ein Reise-Bericht von damals:
Heute ist endlich Freitag, der 8. Juli 1988. Am Nachmittag steigert sich die Vorfreude der letzten Tage, nur noch drei, zwei, einmal schlafen, zum eigentlichen Ferien-Fieber. Ruedi und der Jüngere haben am Nachmittag schulfrei, Käthi muss noch für zwei Stunden in den Kindergarten. Im Laufe des späteren Nachmittags beginnen wir mit dem Verladen der Camping-Ausrüstung. Mami hat in den letzten Tagen alles Nötige bereit gestellt, kontrolliert und ergänzt. In unserem neuen Lieferwagen, einem blauen Toyota Liteace mit Seitenfenstern, hat alles schön Platz und bald sind wir mit aufladen fertig. Weil wir dieses Jahr auf gutes Glück ohne Reservierung reisen, hat Papi sich für diesen Wagen entschieden, damit wir nötigenfalls im Fahrzeug übernachten könnten. Schon sind wir zur Abreise bereit und beschliessen spontan, auf dem Weg nach Süden noch bei Verwandten in Zürich-Enge und in Horgen vorbei zu schauen um Abschied zu nehmen.
Um halb zehn, kurz vor dem Eindunkeln, ist der Start nach den Besuchen: Wir brechen auf und sind unterwegs nach Italien. Über den Hirzel gelangen wir nach Sihlbrugg zur Autobahn, welche durchgehend ausgebaut ist bis nach Italien. In Richtung Gotthard herrscht nur spärlicher Verkehr. Wir fahren gemütlich mit etwa 80 Stundenkilometern, weil mit dem neuen Wagen die ersten tausend Kilometer nicht schneller gefahren werden sollte. Ohne Halt sind wir kurz vor ein Uhr beim grossen Rastplatz Coldrerio vor Chiasso, wo wir noch vor der Grenze übernachten wollen. Wie wir aussteigen, merken wir an der Luft, dass wir im Süden sind. Sie ist wärmer und typisch anders. Wir laden unsere Klappstühle aus, um von unseren mitgebrachten Vorräten zu essen und zu trinken. Wie immer hat Mami an alles gedacht. Sandwich mit Fleischkäse oder Bündnerfleisch, Eistee und für Papi heissen Kaffee. Zum schlafen richten wir uns auf der Ladefläche über der Camper-Ausrüstung ein grosses Bett ein mit den Steppdecken als Polster. Der Rücksitz kann nach vorne gekippt werden, so dass wir eine Fläche von etwa 2x1.4 Meter zur Verfügung haben. Für unsere fünfköpfige Familie wird es aber etwas eng. Papi hat sich das Übernachten im Auto einfacher vorgestellt – es wird ein richtiges Gedränge. Geschlafen haben dann aber doch alle ein paar Stunden.
Wegen dem lauten kommen und gehen auf dem Rastplatz sind wir bereits um fünf Uhr morgens wieder wach. Rücksichtslos werden Autotüren zugeknallt als müsste sich die Karosserie verbiegen. Zum Frühstück essen wir Brötchen und trinken Kaffee. Dann richten wir das Auto wieder neu ein zum weiter fahren. Da wir noch in der Schweiz volltanken wollen, müssen wir uns vor der Tankstelle in eine lange Zweier-Kolonne einreihen. Papi hat Freude, wie wenig Benzin der neue Wagen mit Katalysator gebraucht hat. Wieder auf der Autobahn, befinden wir uns in einer stockenden Kolonne in Richtung Zoll. Dort müssen wir nicht anhalten, der italienische Zöllner winkt die Autos einfach durch. Jetzt sind wir in Italien. Nach dem Zoll löst sich der Stau sofort auf. Wir fahren gemütlich in die Morgendämmerung. Einige Minuten später sehen wir voraus etwas Ungewöhnliches. Beim näher kommen handelt es sich um einen kurz vorher passierten Unfall. Papi sagt, nicht hinschauen, das sieht schrecklich aus. Ein verstümmelter Mann liegt quer auf der Gegenfahrbahn, sein Fahrzeug hängt aufgespiesst in der Leitplanken-Gabelung der Ausfahrt. Ein tödlicher Selbstunfall, einer von jenen, welche die Regierung Ende Juli dazu veranlasst haben, die Höchst-Geschwindigkeit von 140 auf 110 zurück zu nehmen. Wir denken beim weiter fahren an Papis Schwester und ihren Mann, welche jetzt auf dem Rückweg in die Schweiz aus Lecce ganz im Süden sind. Vor Mailand fragt Papi, ob wir jetzt in Richtung Genua oder Venedig fahren wollen. Wir wollen nach Pisa, Ruedi nach Rom. Es ist jetzt schön und sehr heiss.
Die Sonne strahlt am wolkenlosen blauen Himmel und verwandelt unsere Blechkiste auf dem Asphalt zur Sauna. Ab und zu halten wir auf einem Rastplatz und kühlen uns ab im Schatten von Bäumen. Dazu trinken wir viel Wasser. Von Genua aus will Papi auf der Küstenstrasse weiterfahren, damit wir die sehenswerten Orte kennen lernen. Portofino, Cinque Terre, Lerici. Doch bereits in Portofino müssen wir den Plan ändern. Die Küstenstrasse ist hoffnungslos überlastet und Mami bekommt Angst, weil alles so eng ist. In den kleinen Häfen liegen die Boote derart dicht an, dass kein Wasser mehr zu sehen ist. Die Infrastruktur der Küste ertrinkt förmlich im Tourismus. Wir sind uns durchaus bewusst, auch wir leisten unseren Teil dazu bei. Wir kehren zurück auf die Autobahn und fahren direkt nach Carrara, von wo aus wir einen Campingplatz am Meer zu finden hoffen. Die berühmten Marmor-Steinbrüche in den Bergen über Carrara sehen von weitem aus wie Schneefelder. In Marina di Massa sehen wir, wo Mami und Papi früher einmal mit dem Zelt waren. Die Campingplätze am Meer gibt es aber alle nicht mehr. Die Gelände liegen unbenutzt und eingezäunt in der Sonne. Das gesamte Umfeld vermittelt einen ungepflegten, ja verfallenden Eindruck. Mami sagt, es sei alles noch so wie vor zehn Jahren, aber viel dreckiger. Wir sehen ein grosses Zirkus-Zelt, welches kaputt und verwahrlost als Kehricht-Deponie benutzt wird. Auffallend ist, fast ausnahmslos alle Autos haben italienische Kennzeichen. Entlang der Küstenstrasse folgt ein Bagno dem anderen. Von der Strasse her haben die Bäder zuerst Parkplätze mit Schatten spendenden Matten-Dächern, dann einen Torbogen mit bunter Bemalung und dahinter der Strand mit Liegestühlen und Sonnenschirmen. Bloss die Sonnen-Hungrigen fehlen weitgehend. Offensichtlich wird das existierende Angebot nicht gekauft. Bei einem der vielen leeren Strand-Restaurants halten wir an, weil wir Hunger und Durst haben. Ruedi und Mami essen Spaghetti pomodoro. Ruedi hat dermassen Hunger, dass ihn auch das ungewohnte Basilikum-Kraut nicht am Genuss hindert. Der Jüngere isst einen gemischten Salat, Käthi nur Pommes-Frites. Papi bekommt die erste seiner geliebten Pizza. Zum trinken für die Kinder Cola, für die Eltern Rotwein und Aqua minerale für alle.
Beim Essen beschliessen wir, nicht in dieser Region zu bleiben. Das Angebot für Camper ist hier völlig unbefriedigend, wir wollen darum zur Adria hinüber. Doch zuerst werden wir noch Pisa besuchen, wenn wir schon einmal hier sind. Ruedi würde zwar gerne nach Rom fahren, um Cäsar zu besuchen, doch Papi will nicht, weil das zu weit sei. In Pisa sehen wir, der berühmte Turm ist noch viel schiefer, als wir uns vorgestellt haben. Der Überhand beträgt nun 6 Meter von der Senkrechten. Alles wirkt aber wie zusammenhanglos hingestellt, inmitten gepflegter Rasenflächen gegen ein paar tausend Lire zu konsumieren. Wir bleiben nicht lange in Pisa. Weil wir für die Besichtigung des fünfschiffigen Doms bis zur Tür-Öffnung noch zwei Stunden warten müssten, gehen wir etwas trinken und fahren dann weiter. Auf der Autobahn kreuzen wir in der Nähe von Florenz einen riesigen Aquädukt, eine frühere römische Wasserleitung in fortlaufender monumentaler Bogen-Erstellung. Ein gewaltiger Anblick, leider können wir auf der Bahn nicht anhalten. Bei Bologna essen wir in einem schönen Pavesi. Mami und Papi nehmen Lasagne, Käthi und Ruedi Zucker-Melone und der Jüngere Wasser-Melone. Gegen acht Uhr abends erreichen wir Ravenna. Wir sind wieder am Meer, auf der anderen Seite vom Stiefel. Gleich beginnen wir, die Küste nach Camping-Plätzen abzufahren. Doch welche Enttäuschung – direkt am Meer sind hier die Hotels und Ferien-Wohnungen. Die Zeltplätze sind weiter entfernt, teilweise mehrere Kilometer. Wir wollen unbedingt direkt ans Meer und haben nun genug. Wir wissen ja aus früheren Jahren, wo es schöne Campingplätze am Meer hat. Am grossen Lido zwischen Jesolo und Punta Sabbioni. Papi sagt, er fahre jetzt direkt nach Cavallino und wir sollen versuchen zu schlafen.
Auf der Strada Romeo fahren wir in die Nacht, durch das Po-Delta in Richtung Venedig. In Venezia-Mestre erreichen wir die Autobahn nach Triest, welche wir um elf Uhr nachts bei der Ausfahrt Quarto-d’Altino wieder verlassen um dann kurz vor Jesolo in einem endlosen Stau stecken zu bleiben. Samstag-Nacht. Kilometer weit sind die roten Rücklichter der stehenden Fahrzeug-Kolonne zu sehen. Mami bekommt Wallungen und will aussteigen. Wir biegen deshalb ab nach Jesolo-Dorf und wollen dort in einer Garten-Wirtschaft etwas trinken. Käthi schläft tief zuhinterst mitten im Gepäck und bleibt im Auto liegen, welches wir darum in Sichtweite parkieren. Während Papi nachher für die letzten 17 Kilometer noch zweieinhalb Stunden im Stau braucht, schlafen die anderen im Auto. Um halb zwei Uhr parken wir vor dem geschlossenen Tor des Campingplatzes Mediterraneo. Da alle schlafen, versucht Papi zuerst sitzend hinter dem Steuer einzuschlafen. Dann muss er aber doch noch alle wecken, damit wir wieder ein Bett zubereiten können. Nach einem kurzen Ringen um jeden Zentimeter schlafen wir alle fest bis um sieben Uhr.
Die Sonne scheint bereits, als Papi mit den Ausweisen zur Anmeldung geht. Der Platz sei schon voll besetzt, es habe nur noch Stellplätze für kleine Zelte. Papi sagt einfach, wir hätten ein kleines Zelt. Es gibt ja auch noch grössere. Mami atmet tief durch, denn sie hat bis jetzt befürchtet, wir würden vielleicht gar nirgends Platz finden. Nach dem Einschreiben fährt uns ein Angestellter mit dem Moped voraus und zeigt uns den Ort, wo wir uns niederlassen dürfen. Obschon tatsächlich klein, nehmen wir den Platz sofort und beginnen auch gleich mit dem aufstellen des Zeltes. Die Sonne brennt nun wieder am wolkenlosen Himmel und Papi schwitzt Bäche beim einschlagen der Heringe. Bald ist das Zelt fertig verpflockt. Mami räumt die verschiedenen Sachen ein. Um uns herum stehen lauter kleinere Zwei-Personen-Zelte von Italienern aus der Region, wie uns die Kennzeichen der Fahrzeuge verraten. Wir haben fast zu wenig Platz und müssen zwei Klappstühle auf dem Strässchen aufstellen, damit wir alle um den Tisch sitzen können.
Aber wir sind froh, wir haben einen schön gelegenen Platz. Er liegt an einer grossen Kreuzung von mehreren Strässchen wie einer Lichtung im Wald, in der Mitte, vis-a-vis von unserem Zelt, befindet sich eine gepflegte Blumen-Rabatte mit roten Salvien, gelben Tagetes und orangen Margeriten. Dazu verschiedene grüne Sträucher und Steine. Unser Zeltplatz am Rande vom jungen, hellen Pinienwald. So haben wir je nach Sonnenstand Schatten oder pralle Sonne. Jetzt haben wir Hunger und bewegen uns in das nur etwa hundert Schritte entfernte Camping-Restaurant. Wir essen Spaghetti, Lasagne, Reissalat, Melone, Pommes-Frites, alle etwas anderes. Alles zusammen kostet 23400 Lire, beim Wechselkurs von -.115 Franken 27.- (Lasagne L 4200, Spaghetti pomodoro oder bolognese L 3600, Reissalat L 3300, Pommes-Frites L 2000, Cola 3dl L 1400, Vino rosso L 2500 mezzo litro). Über Mittag ist hier Selbstbedienung mit bedienter Theke der Küche. Viele kommen in den Badeanzügen zum Essen. Das Restaurant liegt gleich anschliessend an zwei grosse Schwimmbecken mit Süsswasser. Alles ist sauber und gepflegt. Das Personal aufmerksam und freundlich. Auch die Umgebung lädt mit vielen schönen Blumen- und Pflanzen-Anlagen zum verweilen ein. Nach dem Essen spüren wir die Ermüdung durch die lange Reise erst recht. Das waren gut 1000 Kilometer mit dem Auto. Beim Zelt schlafen wir im Schatten der Pinien den halben Nachmittag. Der Jüngere legt sich trotz Papis Warnung wegen der Hitze ins Zelt. Käthi hat während der Fahrt oft geschlafen und ist überhaupt nicht müde. Mami geht mit ihr ans Meer, damit sie die anderen nicht aufweckt.
Das faszinierende Meer mit seiner sich endlos verlierenden Weite. Für uns aus den Bergen jedes Mal ein Erlebnis. Dem Wasser entlang zieht sich ein etwa dreissig Meter breiter Sandstrand, soweit das Auge reicht. Der helle Sand ist ganz fein körnig und heiss. Trotz der vielen Menschen, die hier baden und an der Sonne liegen, ist noch viel freier Raum. Die Brandung ist seicht und ruhig, der Strand fällt bis weit ins Meer hinaus flach ab. Das Wasser ist lauwarm, aber nicht ganz so klar wie ein Bergsee. Das Meer liegt grünblau an der Sonne und glitzert bei der kleinsten Bewegung. In regelmässigen Abständen reichen die Wellen brechende Steinbuhnen ins Meer hinaus. Entlang dieser Steinhaufen schwappen teilweise grüne Algen. Hier leben auch Krebse mit der Rumpfgrösse einer Kaffeetasse. Am südwestlichen Horizont sind die Silhouetten von grossen Frachtschiffen zu erkennen, welche auf die Einfahrt in den Hafen von Venedig warten. Käthi ist das Meer noch nicht geheuer. Sie geht wohl bis zum Bauch ins Wasser, aber nur wenn Mami bei ihr ist. Anders dann im Schwimmbecken für die Kleineren. Dort ist eine Freude zuzusehen, wie sie mit dem Wasser spielt. In der Zwischenzeit ist Papi wieder wach, weil eine Kammer der Luftmatratze leer ist. Der Jüngere krabbelt völlig verschwitzt aus dem Zelt, weil er wie voraus gesagt keine Luft mehr bekommt. Einzig Ruedi schläft noch auf dem Liegebett am Wegrand. Weil er dazu deutlich schnarcht, bringt er vorbei gehende Camper zum stehen und grinsen. Mami bereitet einen Filterkaffee. Der Butan-Gaskocher, welcher sechs Jahre unbenutzt im Keller lagerte, brennt auf Anhieb. Nach und nach gehen wir alle duschen und kleiden uns an.
Die Sonne hängt mittlerweile als glutroter Ball tief über den Bäumen. Die Hitze des Nachmittags wechselt in eine erträgliche Wärme. Mit dem Auto fahren wir nach Jesolo-Lido. Die sechs Kilometer lange Ladenstrasse wartet wie jeden Saison-Tag auf den allabendlichen Ansturm der Gäste. Die ungezählten Ristorante, Pizzeria, Trattoria und Bars werden bald bis auf den letzten Platz besetzt sein. Um acht Uhr abends wird die Strasse für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Das allgemeine Motto heisst dann, sehen und gesehen werden. Wir kaufen Käthi einen neuen Schwimmring, Ruedi bekommt eine Taucherbrille und der Jüngere hat noch keine Schwimmflossen. Dann fahren wir zurück, um unterwegs in Cà-di-Valle zu essen (das ist beim Camping Europa wo wir schon waren) und anschliessend den dortigen kleinen Luna-Park zu besuchen. Da ist eine richtige Chilbi für Kinder. Die lachende Raupe als langsam fahrende Achterbahn, Sessel-Bahn, Karussell, Riesenrad, Schaukel, Trampolin. Dazwischen Stände, jeder gewinnt und Buden zum Ball und Ringe werfen. Als besondere Aktion ist heuer in einem Anhänger ein neun Meter langer, ausgestopfter Haifisch zu bestaunen. Mami und Papi haben bald genug, schon vor den Kindern, und wollen zurück auf den Campingplatz.

Während wir abwesend waren, wurden hinter unserem Zelt zwei der kleinen Zelte abgeräumt. Der Platz ist noch frei und Papi sagt sofort, jetzt stellen wir unser Zelt weiter vom Weg zurück. Mami blickt zuerst etwas ungläubig, sind doch erst ein paar Stunden vergangen, seit wir mit aufstellen fertig waren. Wir räumen das ganze Zelt wieder leer und lösen die Heringe. Zu viert heben wir das Zelt an jeder Ecke etwas an und gehen damit drei Meter zurück. Bis zum Eindunkeln steht alles wieder wie vorher. Jetzt haben wir einen schönen Vorplatz mit genügend Raum für unseren Tisch und die fünf Stühle rundum. Die Kinder ziehen sich von selbst in die ihre Schlaf-Kabine zurück und kuscheln sich in den Decken nach wenigen Minuten in tiefen Schlaf. Auch Käthi, die ja zu ersten Mal in einem Zelt schläft. Mami und Papi sitzen noch vor dem Zelt bei einem Glas Wein. Es ist windstill und warm. Ein Meer von Sternen funkelt am dunklen Himmel, das gedämpfte warme Licht der Petrol-Lampe auf dem Tisch, der Merlot del Veneto – ein wahr gewordenes Gefühl von Glück und Frieden.
Mami erwacht wie immer wieder zuerst. Von nebenan sind Geräusche zu hören, die nach einem Zelt-Abbruch klingen. Sie weckt Papi, damit wir den frei werdenden Platz gleich für unser zweites Zelt reservieren können. Wir haben nämlich noch ein kleineres Giebel-Zelt mitgenommen, damit die Kinder in ihrem eigenen wohnen können, wie sie sich das vor den Ferien gewünscht haben. Das Giebelzelt ist von Papi vor 17 Jahren gekauft worden und noch wie neu. Das Innenzelt hat einen angenähten, wasserdichten Boden und wird mit zwei Stangen aufgerichtet. Darüber kommen über den First eine Längsstange und darüber die grosse Aussen-Blache. Diese reicht beim Eingang einen Meter über das Innenzelt hinaus, wodurch ein kleines Vorzelt entsteht. Bevor wir mit dem Aufstellen beginnen, essen wir gemütlich z’Morge. Mami hat im Laden beim Eingang Brötchen und Käse geholt, für die Kinder dazu Schoko-Milch-Drink und Nutella-Brot-Aufstrich. Beim Frühstück sehen wir den beiden jungen Männern dabei zu, wie sie ihren Platz räumen und die Ausrüstung auf ihrem Motorrad befestigen. Eine Glanzleistung der Platz- und Gewicht-Aufteilung als die Laverda Trial schliesslich beladen da steht. Kaum sind die Beiden weg, kommen wir zum Zug. Gleich neben unserem Hauszelt stellen wir das Giebelzelt auf. Daneben zwischen den Bäumen haben wir jetzt auch einen Parkplatz für unser Auto. Ruedi und der Jüngere pumpen die Luftmatratzen auf. Zusammen mit Käthi richten sie dann ihr eigenes Nest ein.
Die Sonne steht auch heute wieder hoch am Himmel. Es wird heiss und wir gehen alle zum nahe gelegenen Schwimmbad, um uns abzukühlen. Während Mami und Papi einige Längen schwimmen, zeigen Ruedi und der Jüngere ihre Sprung- und Tauch-Künste. Mit den Taucher-Brillen und Flossen sehen die Beiden aus wie Springfrösche. Käthi ist ebenfalls stolz auf ihr Können. Im untiefen Kinder-Schwimmbecken liegt sie in ihrem neuen Schwimmring und zappelt mit Armen und Beinen. Um die Bassin herum stehen viele Liegestühle und Sonnenschirme zur freien Nutzung bereit. Wir haben aber unsere eigenen Liegen mitgebracht, weil die Liegestühle bereits früh am Morgen reserviert werden, indem Badetücher und anders darauf deponiert wird. Gleich neben uns werden drei solcher Art besetzte Liegen bis nach elf Uhr nicht benutzt. Wir sind einhellig der Meinung, dieses Verhalten gehört sich nicht. Das Schwimmbad wird vor allem von Familien mit Kindern besucht. Ein Schwimmlehrer erteilt jeden Vormittag kostenlos Unterricht für alle die teilnehmen wollen. Ein Bademeister überwacht den ganzen Betrieb und weist jene zurecht, welche zu wenig Rücksicht auf die anderen nehmen. Am Mittag essen wir wieder im Restaurant beim Schwimmbad. Den Nachmittag verbringen wir am Strand. Nur Papi bleibt allein beim Zelt und liest, weil ihm am Strand an der Sonne zu heiss ist. Wir verweilen uns beim Spielen im und mit dem Sand. Im Meer baden bloss Wenige, die Meisten liegen eingeölt an der Sonne zum braun werden. Manche Frauen mit ganz nacktem Oberkörper. Ab und zu durchstreifen rabenschwarze Strandverkäufer, vollgepackt mit Markt-Artikeln, die Menschenmenge und preisen ihre Ware zum Verkauf an mit – billiger Jakob – Neckermann macht‘s möglich – c’est Lacoste, Direktor. Gelegentlich verkaufen sie auch etwas. Gegen Abend gehen wir alle duschen und kleiden uns an. Zum Duschen jeweils möglichst früh, damit wir nicht anstehen müssen und noch warmes Wasser haben.
Heute Abend wollen wir im Camping-Restaurant essen. Wir haben gesehen, die tagsüber offene Gartenwirtschaft wird abends auf drei Seiten mit Storen geschlossen und die Tische werden schön gedeckt mit weissen und blauen Tüchern. Angenehm überrascht werden wir dann vom perfekten Service, alles Männer und dem hervorragend zubereiteten Essen. Wir beschliessen, wenn immer möglich hier zu essen. Ruedi erlebt zwar eine Riesen-Enttäuschung, als sein Essen gebracht wird. Wir haben für ihn und den Jüngeren das Kindermenü Schnitzel mit Pommes-Frites, Ketchup ja, bestellt und nicht wissen können, dass hier bereits in der Küche das Ketchup über die Pommes zugegeben wird. Ruedi jedenfalls weint dicke Tränen, er hat sich so auf sein Coteleta milanese gefreut. Schliesslich isst er doch wenigstens das Fleisch und jene Pommes-Frites, welche nicht vom Tomaten-Ketchup angesteckt worden sind. Nach dem Essen spazieren wir ziellos durch das Camping-Areal und begutachten die anderen Stellplätze. Im Laufe des Abends hat sich der Himmel zunehmend bewölkt. Die Luft ist kühler als gestern, aber warm genug, um später noch in leichter Kleidung vor dem Zelt zu sitzen. Während Mami und Papi ihren Merlot trinken, richten sich die Kinder in ihrem Zelt ein zum Schlafen, das erste Mal allein im eigenen Zelt.
Am Morgen hängen dichte Wolken über den Bäumen, kein Sonnenstrahl kann sie durchdringen. Es ist kühler geworden. Die Kinder schlafen noch, sie haben offenbar die erste Nacht durchgeschlafen. Mami und Papi trinken zu zweit einen Kaffee und kommen dabei auf die Idee, heute wäre das richtige Wetter dazu, um Venedig zu besuchen. Um möglichst früh aufbrechen zu können werden die Kinder geweckt. Als Ruedi Venedig hört, ist er auch schon hellwach und steht vor dem Zelt. Kurze Zeit später beginnt es auch noch leicht zu regnen. Wir räumen Tisch und Stühle ins grosse Zelt und essen dort unser Frühstück. Sobald alle fertig angezogen sind, fahren wir mit dem Auto nach Punta Sabbioni. Von dort fährt alle 30 Minuten ein Linienschiff direkt nach Venedig. Punta Sabbioni bildet mit seinem Leuchtturm den vordersten, Venedig am nächsten liegende Punkt der Landzunge. Die Landbesitzer entlang der einzigen Strasse zum Schiff haben durch die Venedig-Besuchenden ein einträgliches Geschäft. Sie stellen ihr Land als Parkplätze zur Verfügung und kassieren für jedes Auto 4000 Lire. Zum Teil sind die Plätze mit selbst gebauten Holzverschlägen unterteilt und mit Matten überdeckt. Die Vermieter, vielmehr meist deren Frauen, stehen auf der Strasse und versuchen jedes herannahende Auto in ihren Platz zu winken. Wir ignorieren die herumfuchtelnden Einweisungen einfach und parken auf dem vordersten Areal. Noch immer regnet es leicht. Das Schiff kostet für alle inklusive Rückfahrt 16000 Lire, Käthi kann noch gratis mitfahren. Zunächst müssen wir aber noch warten bis ein Schiff kommt. Da in der Wartehalle am Steg erst etwa ein Dutzend Passagiere warten, ist vermutlich vor kurzem ein Schiff gefahren. Ein Car nach dem anderen hält jetzt vor dem Schiffsteg. Als unser Schiff anlegt, wartet hinter uns eine riesige Menschenmenge. Weil wir bei den ersten sind, die das Schiff betreten, haben wir alle auf dem Oberdeck einen Sitzplatz auf der seitlichen Veranda. Der Zufall will, wir haben auf der linken Seite Platz genommen und bekommen dadurch während der Anfahrt freie Sicht auf die Stadt Venedig im Wasser.
Inzwischen hat der Regen aufgehört und die Sonne beginnt langsam die Wolken zu verbrennen. Vom Meer aus liegt der Markusplatz mit dem Dogenpalast in einem geheimnisvollen Dunst. Das Wasser entlang der Mole wird von vielen Booten und Schiffen aufgewühlt. Der breite Quai ist noch fast leer. Die Händler sind gerade dabei, ihre Souvenir-Stände einzurichten. Auch wir schlendern in Richtung San Marco und kommen zuerst am Gefängnisbau vorbei. Das Barockbauwerk aus dem frühen 17. Jh. war noch bis vor 60 Jahren als Gefängnis in Betrieb. Wir stehen nun auf der Brücke unten und sehen hinauf zur berühmten Seufzerbrücke, welche den Dogenpalast mit dem Gefängnis verbindet. Über jene Brücke führte man einst die Gefangenen zum Verhör oder zur Folter. Manche sahen von hier aus seufzend das Meer zum letzten Mal. Dank zweier getrennter Gänge kreuzten sie dabei nie ihre Schicksal-Gefährten, die von dort zurück kamen. Als wir später bei der Besichtigung des Dogenpalastes aus den Nischen in der Brücke einen Blick auf die Lagune werfen, seufzen wir ebenfalls angesichts der riesigen Menschenmenge, die unten steht und ihre Blicke nach oben richtet. Wir gehen weiter, dem Dogenpalast entlang zur Piazetta. Ruedi sieht zuerst, die beiden den Platz zum Meer abgrenzenden Säulen sind leer. Auf der linken Säule wäre der Platz des geflügelten Markus-Löwen, auf die rechte gehört eine Statue des griechischen Theodorus. Zwischen den beiden Säulen wurden früher die Todesstrafen vollstreckt.
Wir gehen nun vorbei am Campanile, der Turm sei fast 100 Meter hoch, zum eigentlichen Markus-Platz. Geradeaus ist der Glockenturm als Element der Fassade um den Platz. Oben auf dem Turm schlagen die berühmten Mori seit fast 500 Jahren jede Stunde auf ihrer grossen Glocke. Die Geschlechter der beiden bronzenen Muskel-Männer seien blank gestreichelt. Nach der Überlieferung erhalte die Berührung ein ganzes Jahr lang die Potenz der Venezianer. Anschliessend an den Dogenpalast ist die Basilika di San Marco zu bestaunen. Bereits die Aussen-Fassade ist in den Bögen mit farbigem Mosaik ausgeschmückt, ebenso die Vorhalle. Wir treten ein und werden erschlagen vom Eindruck einer anderen Welt. Diese Kombination von Raum, Licht und Hall. Der Boden aus Marmor-Mosaik, die riesigen Säulen, die goldbedeckten Bögen und Kuppeln, der Mosaik-Schmuck bedeckt den gesamten oberen Teil der Kirche. Einfach überwältigend grossartig. Das dämmrige Licht verwischt die Züge der einzelnen Personen. An verschiedenen Altären flackern hohe weisse Kerzen. Gegen Bezahlung von L 500 dürfen wir hinter den Hochaltar mit dem Sarkophag des Heiligen Markus und stehen vor einem, wenn nicht dem grössten Kirchen-Schatz der Welt – die Pala d’Oro, eine Gold-Schmied-Arbeit aus purem Gold, 3.5 x 1.5 Meter gross mit 80 Email-Arbeiten, 2486 Edelsteinen, davon 1300 Perlen, 300 Saphire und 300 Smaragde. Wir sind jetzt wieder beim Eingang und steigen noch die steile Treppe mit hohen Tritten hoch zur Galerie mit der Pferde-Quadriga, dem einzigen noch erhaltenen Vier-Gespann aus der Antike. Von hier aus sollen früher die Dogen den Anlässen auf dem Platz beigewohnt haben.
In der Zwischenzeit hat sich der Platz belebt. Unzählige Touristen, viele in Gruppen und Reiseleitung mit Schirm, verwandeln den Ort in einen Ameisen-Haufen. Wir verlassen die Kirche nun mit dem Eindruck, gewiss etwas Einmaliges gesehen zu haben. Alle haben nun schwere Füsse und Durst. In einer Seitengasse setzen wir uns vor einem Restaurant an einen freien Tisch und bestellen Getränke. Nach einer kurzen Rast wollen wir nun noch den Dogenpalast besichtigen. Hier kostet der Eintritt L 5000 pro Person und L 3000 für Kinder, obschon im Palast eifrig renoviert wird und deshalb viele Räume gesperrt sind. Was aber zu sehen ist, genügt für eine gute Vorstellung vom einstmaligen Reichtum dieser Stadt. Durch die prunkvollen Säle mit den grossen Gemälden der berühmten Maler an Decken und Wänden, die Arbeit-Zimmer und Gericht-Säle gelangen wir über die Seufzerbrücke zum Gefängnis. Auf dem Rückweg gehen wir durch den Innenhof wieder auf den Markusplatz. Wir spazieren nun der Mole entlang zu den Anlege-Stellen der Schiffe. Die Gondoliere stehen wartend beisammen, während die Gondeln im steten Auf und Ab des Wassers zwischen den Pfählen dümpeln. Uns ist die Gondelfahrt von 40 Minuten für L 80000 zu teuer. Wir nehmen ein Vaporetta, das öffentliche Verkehrsmittel für L 500 pro Person auf der Linie Due, welche an allen Stationen anlegt. So dauert die Fahrt länger, was wir geniessen, zudem wir Sitzplätze im Bug vorne haben.
Im Canale Grande herrscht ein reger Schiff-Verkehr. Das zerpflügte Wasser befindet sich in ständiger Unruhe. Doch die Venezianer steuern ihre Boote und Schiffe präzise und sicher durch die Strudel. Selbst die Gondoliere stecken mit ihren leichten Gondeln die Wellen der Motor-Schiffe weg, als ob sie gar nicht wären. Die Fahrt durch die breite Wasser-Strasse zwischen den aneinander gebauten Häusern ist ebenfalls ein eindrückliches Erlebnis. Die meisten Palazzo haben eigene Boot-Anlegestellen und direkten Zugang vom Wasser ins Haus. Die Seitenkanäle sind schmäler und werden von vielen Brücken überspannt, welche die Gassen verbinden. Vor allem nachts müssen die Gassen ein Labyrinth sein für Ortsunkundige. Die wichtigsten Verbindungen sind allerdings überall gut beschildert. Eine Haupt-Verbindung von San-Marco zur Rialto-Brücke ist eine einzige Ladenstrasse. Ein Geschäft und Ristorante folgt dem anderen. Während sich dort jetzt die Touristen-Ströme durchzwängen, erscheint der Vaporetta als wohltuende Abwechslung. Der Canale Grande windet sich als grosses S zur Rialto-Brücke hinauf. Erst nach der zweiten Kurve wird der Blick frei für dieses berühmte Meisterwerk der Brücken-Baukunst, 1591 fertig gestellt und bis heute voll funktionsfähig.
Durch das emsige Treiben hindurch erreichen wir über die Brücke jene Seite vom Kanal, wo wir mehrere Restaurants direkt am Wasser gesehen haben. Wir finden einen freien Tisch und essen hier zu Mittag. Mami und Papi bestellen ein Steak vom Grill mit Beilagen, dazu einen Flaschen-Rotwein und Mineral-Wasser, Ruedi und der Jüngere wollen das obligate Schnitzel mit Pommes-Frites, Käthi will nur einen Rüebli-Salat. Wir geniessen das Essen an diesem exklusiven Ort und stören uns dann auch nicht an der grossen Rechnung. Eine wandernde Sängergruppe in volkstümlicher Kleidung spielt beim vorbei ziehen Volkslieder. Ab und zu singt auf einer Gondel ein Caruso seine Lebensfreude o sole mio. Nach dem Essen gehen wir durch die Gassen zurück zum San Marco. An den engen Stellen herrscht ein grosses Gedränge in der Ladenstrasse. Hier sind einfach viel zu viele Leute, die alle das Gleiche tun wie wir auch. Mit dem nächsten Linienschiff fahren wir zurück nach Punta Sabbioni. Von dort sind wir bald wieder auf dem Camping-Platz. Den Rest des Nachmittags verbringen wir am und im Schwimmbad. Zum Abendessen sind wir wieder im Camping-Restaurant und beschliessen den Tag später mit Spielen und Gesprächen vor dem Zelt.
Die ersten beiden Ferien-Tage sind vorbei, wir haben schon viel erlebt und freuen uns auf die zwölf noch verbleibenden.


Begonnen hatte ich 1980 mit einem Sprech-Funk-Anschluss bei der Bestell-Vermittlungs-Zentrale Taxiphon in Zürich. Im Wagen ein tickender, mechanischer Kienzle-Taxameter, welcher im 20-Rappen-Intervall laut hörbar klackte. Dazu vorgeschrieben, nebst Taxi-Schild, ein Fahrtenschreiber, eine Überfall-Alarm-Anlage mit Zweiklang-Horn und ein Stadtplan. Der Funkverkehr auf den zwei Kanälen konnte von allen mitgehört werden, was automatisch zur gegenseitigen Information und Kontrolle führte mit Bezug auf Bestell-Vergabe und Standplatz-Reihenfolge. Per Funk wurde der Disposition das Fahrt-Ziel oder der Standort mitgeteilt und quittiert mit der Warte-Position für einen neuen Auftrag. Für die Funk-Taxis hatten die Bestell-Zentralen ihre eigenen Standplätze vor allem bei Hotels, Spitälern oder anderen Orten mit Fussgängern.
Schon nach wenigen Wochen verursachte ein das Rotlicht missachtender Fahrzeuglenker einen Totalschaden an meinem Neuwagen. Dank Augen-Zeugen wurde mir der Schaden komplett ersetzt durch ein gleiches Modell, ebenfalls neuwertig, die Farbe aber nicht mehr Bronze, sondern Dunkelblau. Bei dieser Gelegenheit wurde auch gleich ein neuer elektronischer Taxameter eingebaut an Stelle des tickenden Alten.
Von der Taxiphon wechselte ich zur TZZ, der Taxi-Zentrale-Zürich, Nr.1 auf dem Platz mit rund 350 Taxi. Mit dem Daten-Funk entfiel das für Fahrgäste eher belästigende Sprechen mit Knacken und Rauschen. Die Disposition erfolgte nun durch einen Computer mittels Eingabe von Sektoren-Nummern und einem Display-Gerät, welches die Bestellung schriftlich anzeigte.
In der Silvesternacht 1992 startete mit rund 200 angeschlossenen Taxi, welche die TZZ nach einer unfreundlichen Übernahme verlassen wollten, die neue Zentrale Taxi2000, später in Taxi444 umbenannt. Die Vermittlungs-Zentrale mit Datenfunk gehörte einer von uns gegründeten Genossenschaft, was jedoch nicht verhindern konnte, dass nach zwei Jahren die Anzahl der beteiligten Taxi massiv erhöht wurde zum Schaden aller Bisherigen. Als ich deswegen bloss noch etwa die Hälfte an Bestellungen erhielt wie vor der Aufstockung, kündigte ich 1995 und fuhr seither ohne Zentralen-Anschluss. Ich führte keine Taxi-Bestellungen mehr aus und arbeitete auf der Strasse mit Passanten.
Die selbständigen Taxis konnten ihre Arbeitszeit frei selber bestimmen. Ich fuhr mal früh, mittel oder späte Schichten. Ohne Funk arbeitete ich gezielt in den Zeiten mit der stärksten zu erwartenden Nachfrage am Abend und nachts. Die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Arbeits-Pausen verbrachte ich, wann immer möglich, zu Hause. Meine Ruhezeit-Kontrolle wurde in den 36 Jahren meiner Taxi-Tätigkeit lediglich drei Mal polizeilich überprüft, immer ohne Beanstandung.
Für mich, der ich schon jung das Autofahren als meine liebste Freizeit-Beschäftigung ausübte, war das Fahren kein arbeiten. Die Arbeit erledigte der Auto-Motor. Der Umgang mit Kundschaft war vor allem psychologisches Einfühlungs-Vermögen. Mit meinen feinen Antennen hatte ich damit kein Problem. In all den Jahren wurde ich nie überfallen oder ernsthaft bedroht. Vielleicht auch, weil ich nicht alle Fahrten bedenkenlos machte, sondern je nach Gefühl nicht anhielt oder nicht wegfuhr. Die Kundschaft der Strasse war anonym im Gegensatz zu bestellten Fahrten und erforderte von daher eine erhöhte Vorsicht.
Jede Taxifahrt ist ein einmaliges und einzigartiges Ereignis mit einem persönlichen zwischenmenschlichen Kontakt. Darin liegt auch der ganz besondere Reiz dieser Tätigkeit verborgen. Bei ungezählt vielen Fahrten war unterwegs meine Sicht der Dinge gefragt oder mein Rat gesucht. Grundsätzlich habe ich Fahrgäste während der Fahrt nicht angesprochen, sondern erst auf Fragen geantwortet. Ausser wenn ich ein Schluchzen hörte oder mein Gefühl ein "Alles gut?" verlangte. Wenn nötig war mit mir am Ziel auch ein Gespräch möglich bei angehaltenem Taxameter, also kostenlos.

- Verstecken zwecklos
- Seltsame Gesetze
- Erfolglose Flucht
- Wir Wiener lieben sie Züricher
- Selber schuld?
- Drogenstrich Zürich 1998
- Die endlose Gier
Verstecken zwecklos

In einem Aussen-Quartier wurde Rolf von einem Fussgänger mit Fahrrad auf dem Gehsteig angehalten. Es war morgens um halb drei Uhr, unter der Woche der letzte Termin der Polizeistunde in dieser Gegend. Der junge Mann fragte ihn, ob sein Taxi frei wäre, er müsste nach Hause, nach Nürensdorf. Er machte Rolf darauf aufmerksam, kein Geld mehr dabei zu haben, doch das sei kein Problem, er würde noch bei seiner Mutter wohnen, die das Taxi bezahlen werde. Rolf doppelte sicherheitshalber nach, er müsse aber ganz sicher sein, ob die Mutter wirklich bezahle, auf Kredit beziehungsweise Rechnung fahre er nicht. Hoch und heilig versprach der andere die hundertprozentige Bezahlung. Er müsse am Morgen wieder früh raus zur Arbeit und würde darum einen Taxi nehmen, mit dem Velo werde es zu spät. An sich machte der junge Mann einen sauber gepflegten und anständigen Eindruck. Als sie sich einig wurden, wollte Rolf aussteigen, um das Velo in den Kofferraum des Wagens zu verladen. Das Fahrrad lasse er hier, das sei nicht sein Eigentum. Der junge Mann liess den Draht-Esel einfach umkippen und auf dem Gehsteig liegen. Hoppla, dachte sich Rolf, das kann ja heiter werden.
Unterwegs hatte Rolf wie schon oft das Gefühl, den Fahrgast schon einmal gefahren zu haben. Er erinnerte sich, früher vom Letten aus der Drogenszene einen damals sehr jungen Burschen ohne Geld nach Nürensdorf gefahren zu haben. Dessen Vater deponierte ihm jeweils das Taxifahrgeld im Paketkasten neben dem Briefkasten bei der Haustüre eines Mehrfamilienhauses. Es könnte der gleiche gewesen sein, er würde das Haus wieder erkennen, wenn sie dort sind. Irgendwie kam das Gespräch während der Fahrt dann auf den Zusammenhang Alkohol, Autofahren und Sterben. Der Fahrgast erzählte von einer Episode seiner Mutter, die voll betrunken mit hoher Geschwindigkeit einen schweren Auffahrunfall mit Verletzten verursacht habe. Sein Vater habe dann aber eine Gefängnisstrafe von ihr abwenden können, indem sie für unzurechnungsfähig erklärt wurde. Sie sei eine Alkoholikerin. Leider sei der Vater, den er gut mochte, vor einem Jahr bei einem Flugzeugunglück verstorben.
In Nürensdorf hielten sie tatsächlich vor dem Haus, das Rolf von früher bekannt war. Eine jüngere Überbauung, vielleicht etwa zehn Jahre alt, die moderne Architektur mit dem vermeintlichen Dorfcharakter vergangener Zeiten. Die Abfallcontainer verstecken sich im Abteil von stehend im Boden eingelassenen Eisenbahnschwellen. Die oberirdischen Parkplätze mit Platten, die halb und halb aus Stein und Grün, umweltbewusst. Der junge Fahrgast wollte nun den Taxifahrer den Weg entlang des Hauses zur Türe schicken, er selbst würde durch die Tiefgarage ins Haus gehen und ihm dann dort öffnen, sein Schlüssel gebe nur auf diese Art und Weise Zutritt zum Haus. Solch einen Unsinn liess sich Rolf nicht bieten. Er hatte sich daran gewöhnt, mit den Fahrgästen ohne Geld immer bis vor die Wohnungstüre mitzugehen. Er stand nur ein einziges Mal, vor langer Zeit, nachts vor einem verschlossenen Mehrfamilienhaus und wartete vergebens auf die Rückkehr des Fahrgastes, von dem er nicht einmal den Namen kannte. Rolf nahm also routinemässig Wagenschlüssel und Geldbörse und ging zusammen mit dem Mann die Einfahrt zur unterirdischen Garage hinunter, quer durch die Einstellhalle zum Treppenhaus und dort wieder hinauf bis zu einer Wohnungstüre im Hochparterre. Wie immer blieb Rolf vor der Türe stehen, er betrat aus Gründen seiner Sicherheit keine fremden Fahrgastwohnungen. Normalerweise lassen die Leute die Türe einen Spalt offen, wenn sie das Geld holen. Dieser Mann machte die Türe ganz zu und schliesst sie sogar von innen mit dem Schlüssel. Rolf dachte, komisch, aber vielleicht eine Angewohnheit. Er ging schon mal die paar Stufen hinunter zur Haustüre, um nachzusehen, ob sich diese von innen öffnen liesse, was tatsächlich der Fall war. Er arretierte die Türe offen und trat ins Freie, sah, dass in einem Zimmer der Wohnung Licht durch die geschlossenen Jalousien schimmerte.
Irgendwann war die Zeit abgelaufen, welche man dazu benötigen würde, mit dem Geld zurück zu kommen. Rolf klingelte an der Haustüre, ging hinauf und klopfte energisch an die Wohnungstüre. Erst nach weiterem lauten Poltern drehte sich der Schlüssel. Eine etwa 50-jährige, bleiche Frau im Morgenmantel öffnete und fragte erstaunt, was denn los sei. Rolf erklärte, ihr Sohn sei vorhin in die Wohnung gegangen, um das Geld für den Taxi zu holen und nicht mehr zurückgekehrt. Das könne nicht sein, ihr Sohn sei ihres Wissens noch gar nicht zu Hause. Rolf erklärte ihr, er selber habe ihren Sohn bis hier an diese Türe begleitet und mit eigenen Augen gesehen, wie er in dieser Wohnung verschwunden sei, er müsse da sein, ob sie bitte nachsehen würde. Offenbar wurde er etwas laut, die Frau wollte jedenfalls aus Rücksicht mit den Nachbarn vom Treppenhaus in die Wohnung wechseln zum weiterreden und bat ihn einzutreten. Die kleine Dreizimmerwohnung roch stark nach ungesäubertem Katzenklo. Zusammen schauten sie in jedes Zimmer, auch Bad und WC, doch der Fahrgast blieb verschwunden. Die Tür zum Gartensitzplatz war von innen verschlossen, aber der Roll-Laden war hochgezogen, beim Fenster war er unten. Bei Rolf stieg der Verdacht auf, die alkoholkranke Frau könnte mit ihrem drogensüchtigen Sohn gemeinsame Sache machen, wenn es nun darum ging, seine fünfzigfränkige Taxifahrt zu bezahlen. Die Frau bestand weiterhin darauf, ihr Sohn sei noch gar nicht nach Hause gekommen und bestritt auch Rolf’s Behauptung, er habe ihn selber in diese Wohnung gehen sehen. Das sei gar nicht möglich von der geschlossenen Haustüre aus. Doch Rolf war ja nicht wie vom Fahrgast angewiesen zur Haustüre gegangen, sondern mit ihm bis vor die Wohnungstüre, was die Frau aber nicht wusste.
Rolf brachte es nicht fertig, die Frau direkt der Lüge zu bezichtigen, er hatte Bedenken, die Lage könnte ausser Kontrolle geraten, die spindeldürre Schnapsdrossel machte nämlich einen verzweifelten Eindruck, die Augen wohl hell und wach, aber leer und bar jeden Ausdrucks, in der Stirn tiefe senkrechte Furchen, die Unterlippe leicht gewölbt nach aussen gestülpt, die Mundwinkel wie die Wangen schlaff hängend. Sie setzte sich an den runden Tisch im halben Zimmer und zündete sich nervös mit zittrigen Fingern eine Zigarette an. Rolf fragte sie, ob sie das Taxi bezahlen würde, sonst müsse er die Polizei rufen. Sie bezahle sicher nichts, er solle ruhig telefonieren, der Apparat stünde im Wohnzimmer. Von der Notrufnummer wurde er zur Einsatzleitung der Kantonspolizei verbunden, es würde jemand vorbei kommen. In der Zwischenzeit unterhielt sich Rolf mit der Frau, welche wie ein Häufchen Elend am Tisch sass, erwähnte die Schilderungen ihres Sohnes während der Taxifahrt. Sie bezahle nichts mehr für den, der sei volljährig und müsse selber schauen. Er habe kein Geld, weil er keine Arbeit finde. Ob sie denn das gut finde, wenn es nun zu einer Anzeige wegen Taxiprellerei komme? Wenn sie bezahle, könne dies verhindert werden. Jetzt sei es schon zu spät, er habe ja die Polizei angerufen. Als es klingelte, ging Rolf die Türe öffnen, wie wenn er hier zu Hause wäre. Draussen standen zwei junge Polizisten in Zivil, denen man den Beruf überhaupt nicht ansehen würde. Nachdem Rolf den Vorfall kurz geschildert hatte, durchsuchten die beiden die Wohnung nach dem verschwundenen Fahrgast, schauten auch in alle Schränke, im Zimmer des Burschen fanden sie Utensilien, wie sie von Drogenabhängigen benutzt werden, sonst nichts, der Fahrgast blieb spurlos verschwunden. Zweifellos wurde er von der Mutter durch den Gartensitzplatz ins Freie gelassen. Sie befragten noch kurz die Mutter, was ihr Sohn arbeite, notierten die Personalien und belehrten dann Rolf, er könne morgen bei der Kantonspolizei eine Strafanzeige einreichen, gaben ihm eine Visitenkarte mit ihren Namen, er könne sich auf sie beziehen, sie würden einen Journaleintrag machen.
Der junge Mann hatte keine Chance, trotz der Hilfe seiner Mutter. Da für eine Strafanzeige eine gesetzliche Eingabefrist von drei Monaten bestand, tat Rolf erst einmal gar nichts, nach zwei Monaten schickte er gleich eingeschrieben eine letzte Mahnung über einen Gesamtbetrag von hundertzwanzig Franken, verbunden mit Androhung einer Strafanzeige bei Nichtbezahlung innert zehn Tagen. Nach einer Woche wurde der Betrag eingezahlt von einem Rechtsanwalt, der auch Beistand des Jungen war. Die ursprüngliche Taxifahrt hatte nun mehr als doppelt so viel gekostet.
Seltsame Gesetze

Gegen drei Uhr morgens steuerte Rolf sein Taxi in Richtung Langstrasse zurück. Als er in eine Querstrasse einbog und dazu den Gehsteig überqueren musste, sah er weiter vorne drei Männer, die eben aus einem Haus kamen, in welchem sich mehrere Sexsalons befanden. Der Kleinste winkte aufgeregt, Rolf blieb halb auf dem Gehsteig stehen und wartete, es waren zwei ältere kleine Männer, in der Mitte ein junger, grosser Hüne. Jener, der gewunken hatte, öffnete die hintere Türe und wollte einsteigen, als ein anderer laut etwas zu ihm sagte, Rolf verstand nicht was, die Sprache tönte wie serbokroatisch. Der Kleine schlug die Türe wieder zu, der Grosse öffnete die Beifahrertüre, bückte sich leicht und fragte:
„Warum du anhalten?“
Rolf neigte sich leicht hinüber, um ihn ansehen zu können und fragte zurück.
„Brauchen Sie kein Taxi?“
Dann realisierte er noch eine Bewegung und hörte ein schepperndes Geräusch bevor ihm schwarz wurde vor den Augen. Als er wieder zur Besinnung kam, war sein Wagen einige Meter weiter vorne an einem Strassenpfosten zum Stillstand gekommen. Rolf wusste zuerst gar nicht, was passiert war. Blut war auf seinem Hemd und er merkte, seine Brille fehlte. Er schaute sich im Rückspiegel an und sah die Haut an der Nasenwurzel blutend gerissen. Jetzt dämmerte ihm, der hatte ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Er stellte den Motor ab und stieg aus, um die Brille zu suchen, sie lag im Fonds auf dem Wagenboden und war zum Glück unbeschädigt. Er war fassungslos, konnte nicht glauben, was ihm da geschehen war. Dann zuckte ihm durch den Kopf, so was macht der nicht mit mir, den kauf ich mir, diesen Drecksack. Er fuhr rückwärts auf die Hauptstrasse und beim nahen Park entdeckte er im Licht des gegenüberliegenden Ausganges die Silhouetten der drei Männer.
Auf dem Weg dorthin kreuzte ihn zufällig ein Streifenwagen der Stadtpolizei. Rolf kehrte nochmals, fuhr ihm nach und brachte ihn durch Lichthupen zum Anhalten und meldete, was ihm eben widerfahren war. Sofort fuhren beide Wagen zum Ausgang des Parks, wo die drei eben in einer Querstrasse verschwanden. Der Grosse war es, sagte Rolf noch und die beiden Polizisten rannten los. Rolf parkierte erst seinen Wagen ordnungsgemäss und entfernte das Taxischild. In der Querstrasse hatten die Polizisten dem Hünen bereits Handschellen angelegt. Rolf musste sich beherrschen, am liebsten wäre er näher getreten und hätte diesem den Schlag gleich zurück gegeben. Während sie auf den Kastenwagen warteten, welcher den Schläger abführen würde, musste Rolf noch seine Personalien angeben, dann konnte er gehen.
Als ein paar Wochen später eine Mitteilung des Polizeirichteramtes eintraf, war die Empörung im Bekanntenkreis einhellig. Der Schläger, ein zwanzigjähriger Mann aus dem ehemaligen Jugoslawien, war mit einer Busse von hundert Franken bestraft worden und hatte gesamthaft mit Spruch- und Schreibgebühr 268 Franken zu bezahlen. Hundert Franken für diesen grundlosen Angriff auf die Gesundheit eines fremden Mitmenschen? Rolf hätte dabei sein Augenlicht verlieren können. Wenn sein Fuss aufs Gaspedal gerutscht wäre nach dem Schlag, sein Wagen hätte führerlos einen enormen Schaden verursacht.
Letzthin hatte Rolf nachts um zwei Uhr ausserorts auf einer menschenleeren, unbelebten Strasse im Dunkeln eine Tempo-Tafel übersehen und war von einem Radarautomaten mit zwanzig Stundenkilometern zu schnell geblitzt worden. Er war mit einem Fahrgast gemütlich unterwegs und fuhr den Stassen-Verhältnissen angepasst, hatte bloss die Signalisation nicht gesehen. Für diese Unaufmerksamkeit bei der Arbeit wurde Rolf mit fünfhundert Franken Busse bestraft und hatte gesamthaft mit der Androhung eines Führerausweisentzuges total 1'095 Franken zu bezahlen, mehr als viermal so viel wie dieser gemein gefährliche Schläger für den böswilligen Angriff auf Leib und Leben, welcher richterlich als blosse Tätlichkeit verharmlost wird.
Erfolglose Flucht

Frühmorgens um etwa halb Vier wurde Rolf an einer Hauptstrasse in Zürich-Nord nahe bei einem Nachtclub von zwei Pärchen angehalten. Hübsche Frauen, deutsche, beide in schwarzen Lederanzügen, ihre Begleiter ein Blonder und ein Schwarzafrikaner, ebenfalls modisch gekleidet. Eine der Frauen fragte, ob er sie für hundert Franken nach Dettinghofen fahren würde. Das kenne er nicht, wo das denn sei. In Deutschland, gleich nach Eglisau. Rolf wusste, bis Eglisau kostete etwa hundert Franken und offerierte, für hundertzwanzig würde er fahren. Einverstanden, abgemacht, sie stiegen ein.
Rolf hatte ein gutes Gefühl und verlangte keine Vorauszahlung, die vier Erwachsenen haben sicher genug Geld zum Bezahlen. Unterwegs überlegten sich die Fahrgäste tuschelnd, welchen Grenzübergang sie wählen sollten und entschlossen sich für Hüntwangen, dort sei fast nie eine Kontrolle. Der Nachtclub, wo sie herkamen, ist bekannt als Drogenhöhle der Technoszene. Wahrscheinlich hatten sie etwas gekauft und fürchteten jetzt eine Kontrolle am Zoll. Nach Eglisau dirigierten sie Rolf den Weg durch einen Wald. Der Schlagbaum am Zollhäuschen war oben und kein Mensch anwesend. Erleichterung machte sich breit. Nach ein paar Minuten erreichten sie Dettinghofen. Dort leiteten sie Rolf von der beleuchteten Hauptstrasse weg in den nachtschwarzen Dorfkern. Bei einem grossen Brunnen musste er anhalten. Der Schwarze neben ihm blieb sitzen und suchte sein Geld in der Hosentasche, die drei vom Rücksitz stiegen aus.
Draussen war es stockdunkel, Rolf hatte die Innenleuchte eingeschaltet und konnte nicht sehen, wie sich die drei leise entfernten. Nun stieg der Schwarze ebenfalls aus und blieb bei der geöffneten Türe noch einen Moment stehen, bevor er sie zuschlug. Erst jetzt realisierte Rolf, die wollten ihn nicht bezahlen. Er stellte den Motor ab und stieg aus. Die vier waren verschwunden, in der Dunkelheit wie vom Erdboden verschluckt. Rolf rannte zurück zur dunklen Strasse, wo sie herkamen. Weiter vorne sah er im Gegen-Licht der Hauptstrasse gerade noch eine der Frauen um die Ecke verschwinden. Er rannte ebenfalls dorthin und fand an der nächsten Ecke einen ganz frischen Fuss-Abdruck in der Erde einer Rabatte. Dadurch wusste er wenigstens die Fluchtrichtung. Ausser Atem kehrte er langsam zum Taxi zurück. Sein Herz schlug rasend schnell, er war eben das erste Mal seit vielen Monaten wieder gerannt.
Er setzte sich in den Wagen und ärgerte sich erst einmal masslos. Sollte er sich das einfach gefallen lassen? Nein, aber was tun? Zuerst fuhr er das Taxi zur beleuchteten Hauptstrasse und parkierte dort an der Bushaltestelle, dann zündete er sich eine Zigarette an und überlegte. Sein Mobiltelefon hatte keinen Empfang, für die Telefonkabine hatte er kein deutsches Geld. Inzwischen hatte ihn die Wut gepackt. Das machen die nicht mit ihm, nein, mit ihm nicht, und wenn er hier warten müsste, bis einer von denen auf den Bus muss. Dettinghofen war ein Weiler mit lediglich ein paar Dutzend Häusern. Rolf dachte sich, jetzt um vier Uhr früh, wo alles dunkel ist, sind seine geflohenen Fahrgäste vermutlich die Einzigen, die noch Licht haben könnten. Er stieg aus, ging spazieren und fand schon nach wenigen Minuten ein Mehrfamilienhaus, wo noch ein Licht brannte im ersten Stockwerk. Er schlich entlang der Mauer direkt unter das Fenster und horchte. Deutlich hörte er die Stimme des Schwarzen mit dem typisch afrikanischen Tonfall.
Volltreffer. Nun fuhr Rolf die 12 km zur besetzten Zollstation Jestetten und meldete dort sein Erlebnis. Der Zöllner telefonierte mit der Polizei und teilte ihm dann mit, er solle bei der Bushaltestelle in Dettinghofen warten, sie würden dahin kommen. Rolf fuhr zurück und wartete, bis nach etwa vierzig Minuten ein grün-weisser Einsatzwagen der deutschen Polizei mit vier Mann eintraf. Als er ihnen eine Täterbeschreibung gab, wusste einer sogar, um wen es sich handeln könnte. Rolf zeigte ihnen das Fenster, wo inzwischen das Licht erloschen war. Der Einsatzleiter bat Rolf in den Kastenwagen, der auch gleich als mobiles Büro verwendet wird und erstellte ein Einvernahme-Protokoll auf einem Diktiergerät.
Schon bald stand eines der beiden Pärchen fröstelnd, direkt aus dem kurzen Schlaf, vor dem Einsatzwagen. Rolf erkannte sie wieder. Das zweite Paar wohnte an einem anderen Ort und musste erst noch geholt werden. Als alle vier versammelt waren, gab ihnen der Einsatzleiter noch die Chance, das Taxi nun zu bezahlen, das wäre strafmildernd, doch sie hatten kein Geld. Rolf konnte nun gehen und fuhr beschwingt im Gefühl seines Triumphes nach Hause. Einfach herrlich, wie er diese Taxipreller erwischt hatte, die sollten lernen, so geht das nicht, das Taxi fahren.
Ein paar Tage später rief ihn eine der Frauen an, entschuldigte sich und verlangte seine Kontonummer, damit sie ihm ihren Anteil bezahlen könne. Durch diese Wiedergutmachung habe sie Strafmilderung. Dann, zum Schluss, sagte sie noch, es sei ihr schleierhaft und unerklärlich, wie er sie habe finden können. Es hörte sich so an, als wollte sie damit sagen, bisher habe das immer funktioniert. Er sagte ihr nicht, wie er sie gefunden hatte.
Wir Wiener lieben die Züricher


Ein heftiges Gewitter hatte am frühen Abend dieses Spätsommertages die stickige Luft über Zürich gereinigt. Ein paar Stunden später war alles wieder trocken und die nun klare Sicht verschaffte dieser Nacht ihre eigentümliche Note. Die Konturen waren viel deutlicher als sonst und die Distanzen schienen kürzer. Gegen ein Uhr früh steuerte Rolf sein Taxi nach einer Fahrt in eine Vorortgemeinde zurück Richtung Stadtzentrum. Dabei durchquerte er ein Industrie-, Gewerbe- und Kleingärtengebiet am Stadtrand, welches nachts in nahezu ungestörter Ruhe verharrte.
Auf der schnurgeraden Strasse stand, von weitem sichtbar, ein Mensch mitten in der beleuchteten Fahrbahn. Regungslos, gesenkten Hauptes schien die Person den herannahenden Wagen gar nicht zu bemerken. Es war eine junge Frau, fast noch ein Mädchen. Rolf hielt an und fragte, ob sie ein Taxi brauche. Sie kam langsam, wie von etwas Unsichtbarem gehindert, zum geöffneten Wagenfenster, kramte in ihren Hosentaschen und sagte, sie möchte an den Sihlquai zurück, aber sie habe kein Geld mehr. Dort am Sihlquai war der Drogenstrich. Rolf dachte, nicht mit mir, anschaffen und kein Geld für den Taxi und sagte nein, sie könne den Weg zu Fuss gehen, das wären etwa zwanzig Minuten, oder sonst solle sie Autostopp machen, es würde sicher ab und zu ein Fahrzeug vorbeifahren. Wortlos wendete sie sich ab und taumelte zum Gehsteig, wo sie sich abstützend an ein parkiertes Auto lehnte.
Ihr abwesender Gesichtsausdruck, eine den Tränen nahe Stimme, ihr seltsam verzögerter Gang, die zerzausten Haare, die unordentliche Bekleidung, keine Tasche, der Zeitpunkt mitten im abgelegenen Quartier, sein Gefühl hinderte Rolf daran, einfach weiter zu fahren, obwohl er jetzt in der Innenstadt gute Umsätze erzielen könnte. Er parkierte und stieg aus.
„Ist denn alles in Ordnung mit dir?“
Sie schluchzte, nur sehr kurz, vielleicht drei Sekunden.
„Ich bin überfallen worden von einem Freier. Er hat mir plötzlich etwas aufs Gesicht gedrückt. Dann weiss ich von nichts mehr.“
„Wann war denn das?“
„Wie spät ist jetzt?“
„Zehn vor eins.“
„Schon? Das muss kurz nach elf Uhr abends gewesen sein.“
„Weisst du noch die Autonummer?“
„Ja, ich habe sie aufgeschrieben, der Zettel ist in der Tasche. Oh nein, meine Tasche hat er auch noch im Auto. Es ist ein weisser Wagen gewesen, Marke Audi, mit einem Kontrollschild aus dem Kanton Schwyz.“
„Komm steig ein, ich bringe dich doch auch ohne Geld zurück.“
„Ich bin aber ganz nass da unten.“
Sie hatte Hemmungen, sich auf den sauberen hellgrauen Autositz zu setzen. Seltsam, es war wieder trocken draussen und Rolf sah auch keine Verschmutzung an ihr, abgesehen von den mit getrockneter Erde verschmutzten Knien ihrer schwarzen Satinhose. Die Knöpfe der weiten hellen Bluse waren bis zum Bauch hinunter geöffnet. Rolf starrte automatisch auf ihren kleinen weissen Hängebusen, worauf sie ihre Bekleidung zurecht rückte. Er holte eine Decke aus dem Kofferraum, legte sie auf den Beifahrersitz und hiess sie einsteigen. Unterwegs weinte sie manchmal kurz. Zeitweise schüttelte es sie aber auch richtig durch. Sie stützte sich mit beiden Händen auf, als ob ihr das Sitzen Schmerzen bereiten würde. Spontan entschied sich Rolf, die Frau zur Stadtpolizei auf die Kreis-Wache am Sihlquai zu bringen. Er bereitete sie darauf vor, indem er ihr sagte, wenn sie überfallen worden sei, müsse sie bei der Polizei eine Anzeige erstatten, sonst würde der Täter nie erwischt und mache das wieder. Sie wehrte ab, sie könne nicht zur Polizei, weil sie gar nicht in Zürich sein dürfte, sie möchte nur an den Sihlquai und dort weitermachen.
Gegen ihren Willen fuhr Rolf zur Stadtpolizei. Die Frau im Wagen lassend, meldete er sich auf dem Posten. Nach einer kurzen Schilderung meinte ein wachhabender Polizist, dies sei keine Angelegenheit für sie, er solle die Frau zur Kriminalpolizei an die Zeughausstrasse im Stadtzentrum bringen. Rolf verschlug es zuerst fast die Sprache. Dann bestand er aggressiv auf Hilfe, er hätte die Frau jetzt kostenlos bis hierher gefahren, das sei doch nicht seine Sache und er wolle nun weiter seiner Arbeit nachgehen. Er würde die Frau einfach vor der Polizeiwache absetzen, obschon sie vermutlich verletzt wäre. Auf seine Bitte hin, die Frau wenigstens anzuschauen, kamen dann doch endlich zwei Polizeibeamte nach draussen zum Taxi. Die Frau war im Auto geblieben und musste nun aussteigen. Als die Polizisten den Blutfleck auf der Wolldecke sahen, dort, wo sie gesessen hatte, beschlossen sie, die Frau zu behalten und die Sanität kommen zu lassen.
Am nächsten Morgen wurde Rolf, der normalerweise schlief bis er von selber wach wurde, von seiner Frau Trudi geweckt.
„Du Schatz, die Kriminalpolizei ist am Telefon.“
Rolf blickte in ihre weiten, etwas Schlimmes ahnenden Augen und lachte.
„Hoi Schätzli, es ist nichts passiert, das ist wegen gestern, ich erzähle das nachher.“
Ein Detektiv der Kriminalpolizei befragte ihn kurz telefonisch zur Sache. Die junge Frau sei noch vor dem Eintreffen der Ambulanz auf dem Polizeiposten bewusstlos geworden. Nach der Auskunft des Notarztes wäre sie in spätestens dreissig Minuten an ihren inneren Blutungen verstorben. Sie hatte schwerste Unterleibsverletzungen im Genitalbereich erlitten, die eine mehrstündige Notoperation erforderten, bei der auch ein künstlicher Darmausgang hätte angelegt werden müssen. Sie befinde sich zurzeit wegen dem nötigen Drogenentzug in einem künstlichen Koma. Am Nachmittag musste sich Rolf dann auch noch die Zeit nehmen zur schriftlich fixierten Befragung und Spurensicherung im Wagen.
Von der Frau, welcher allein der Zufall und sein Gefühl das Leben rettete, hat Rolf nie etwas gehört. Vielleicht wusste sie nach dem Tiefschlaf gar nicht mehr, was passiert war. Er aber weiss bis heute auch nicht, ob sie nicht lieber gestorben wäre, als verstümmelt noch weiter zu leben. Denn ohne seine Handlung als Taxifahrer gegen ihren Willen wäre sie vermutlich gestorben. Trudi meinte, das wäre ihr recht geschehen. Sie hat in dieser Beziehung eine knallharte Meinung. Das sei abscheulich, wie diese Frauen die Männer ausnehmen und dadurch Beziehungen zerstören. Die seien alle selber schuld. Er zweifelt.
Selber schuld, am Drogenstrich zu sein?

Die im vorherigen Kapitel „selber schuld“ geschilderte Erfahrung hatte den Taxifahrer Rolf nachhaltig sensibilisiert, auch im Zusammenhang mit der andauernden politischen Diskussion in den Medien um die kontrollierte Heroin-Abgabe an Süchtige. Seit Jahren lief nun ein kontrovers diskutierter Versuch nach der Schliessung der offenen Drogenszenen (Platzspitz 1992, Letten 1995). Rolf merkte plötzlich, über die Hintergründe der Sucht nach harten Drogen wusste er so gut wie gar nichts.
Selbst für ihn als Taxifahrer, der durch seine Tätigkeit zwangsläufig über ein weit geöffnetes Fenster zur Wirklichkeit hin verfügte, war der Drogenstrich während Jahren ein bekanntes Unbekanntes wie für die meisten auch. Man sieht zwar im Vorbeifahren die an der Strasse stehenden Mädchen und Frauen, sieht sie vielleicht kurz interessiert an und schon sind sie weg, nur noch verschwommen im Rückspiegel, die einsamen Geschöpfe, die so etwas tun, warum auch immer.
In der Stadt Zürich gab es im Jahre 1998 den zur verdeckten Drogenszene gehörenden Drogenstrich offiziell eigentlich gar nicht. Die Prostitution auf der Strasse war grundsätzlich verboten und wurde repressiv bekämpft, ausgenommen in den von der Stadtverwaltung im Strichplan festgelegten Zonen. Diese Strassen wiederum waren fest in der brutalen Gewalt der organisierten Zuhälterei aus dem Rotlicht-Milieu.
Der die Jahrzehnte überdauernde inoffizielle Mindestpreis für sexuelle Dienstleistungen lag damals bei hundert Franken, fünfzig Franken für orale Befriedigung. Das zunehmende Angebot von nach Geld suchenden Drogensüchtigen führte aber auch zu Tiefstpreisen. Im erweiterten Umfeld der Drogenszene war die Anwerbung von Männern durch süchtige Frauen allgegenwärtig:
An einem frühen Nachmittag, sonnig und warm. Die Fussgängerin spaziert am parkierten Taxi vorbei, kehrt weiter vorne wieder um und geht zurück. Rolf schaut sie an und die junge Frau kommt direkt zum offenen Wagenfenster.
„Warten Sie auf jemanden?“
Rolf antwortet amüsiert.
„Warum willst du das denn wissen?“
„Einfach so, ich habe kein Geld und dachte, wir könnten etwas machen.“
„Was meinst du mit etwas machen?“
„Ein wenig blasen oder so, möchtest du?“
„Du, eigentlich nicht. Ich bin jetzt bei der Arbeit zum Geld einnehmen und nicht beim Geld ausgeben.“
„Weisst du, ich brauche dringend ein bisschen Geld, möchtest nicht etwas machen für fünfzig.“
Rolf lacht.
„Nein, sowieso, ich bin doch kein Millionär.“
„Also gut, ich würde dir eins blasen für dreissig.“
Ihr flehender Blick will Rolf hypnotisieren. Er schaut in ihre Augen. Lange, wortlos. Sie flüstert.
„Zwanzig?“
Die spinnt doch, denkt sich Rolf. Zwanzig Franken, das kostet die durchschnittliche innerstädtische Taxifahrt von wenigen Minuten mit vier Kilometern.
„Wie alt bist du eigentlich?“
„Sechsundzwanzig,“
„Dann könnte ich vom Alter her dein Vater sein. Ich habe dich in Zürich noch nie gesehen?“
„Ich wohne in Uster. Schau, ich habe nur noch drei Franken bei mir, kannst du mir nicht etwas geben, vielleicht zehn Franken?“
Ein Geldstück fällt zu Boden, unters Auto. Rolf steigt aus zum suchen.
„Ich kann doch nicht einfach Geld verteilen. Hast du eine Ahnung davon, wie viele hier in der Gegend immer nichts haben und etwas von mir wollen?“
Rolf findet den Franken unter dem Auto.
„Ich möchte ja nur etwas kleines, bitte sei so gut.“
„Dann geh doch nach vorne zum Limmatplatz und suche gleich etwas rechtes. Das bringt dir ja nichts, wenn du so billig an mich verkaufst für zwanzig Franken.“
„Das mache ich nicht, ich gehe nicht auf den Strich.“
„Aber warum fragst du denn mich an, obschon ich nichts will?“
„Ich will nur für morgen etwas, weil ich eine wichtige Sache zu erledigen habe und mich zusammen nehmen können muss. Im Moment bin ich arbeitslos und erhalte Geld, wenn ich mich regelmässig bei der Arbeitsvermittlung melde. Ich mache das sonst nicht, aber dir vertraue ich auf Anhieb, du machst auf mich einen guten Eindruck.“
„Sicher, ich bin ein Familienvater der weiss was sich gehört und was nicht.“
„Ich wäre so froh, bitte, ist doch nichts dabei, komm, nur zwanzig Franken, ohne Gummi. Du musst keine Angst haben, es kann dir ja nichts geschehen.“
Sie schaut Rolf fast ununterbrochen in die Augen, flehend, bettelnd.
Immer wieder. Sie offeriert ungeschützt ohne Kondom. Unfassbar, dieser leichte Sinn, die Realität von übertragbaren Keimen ausser Kraft setzen zu wollen. Zum Erbarmen und zum Heulen.
Die drogensüchtigen Frauen und Mädchen waren stets an den gleichen Orten anzutreffen, allgemein bekannt und verboten, ausser während Polizeiaktionen, was kurz zu totaler Absenz und einer sofort regen Zunahme des vergeblich suchenden Verkehrs der Freier mit dem Auto führte. Diese inoffiziellen Plätze auf öffentlichem Grund befanden sich an den stark frequentierten Strassenzügen hinter dem zentral gelegenen Hauptbahnhof. Mit Ausläufern in Querstrassen und Hinterhöfe.
Zwischen etwa drei bis sechs Uhr morgens lag die Stadt unter der Woche während fünf aufeinander folgenden Nächten im Tiefschlaf, selbst wenn neuerdings vereinzelte Lokale bis vier Uhr geöffnet waren. Ausser den omnipräsenten Taxis und vereinzelten Privatfahrzeugen bewegte sich manchmal schon nach ein Uhr früh fast gar nichts mehr. Doch im Quartier um die obere und untere Langstrasse blieb es lebhaft. Die Drogenszene sowieso rund um die Uhr, zivile Polizeifahrzeuge, das Rotlichtmilieu, der Drogenstrich, Frauen, Mädchen. Freier, Gaffer und Betrunkene. Bei jedem Wetter, zu Fuss oder motorisiert.
Ein augenfälliger Unterschied im Vorgehen der Polizei konnte allerdings registriert werden: Gegen die vorwiegend aus Lateinamerika und Afrika stammenden illegal draussen wartenden Prostituierten an der oberen Langstrasse im Kreis 4 wurden die Gesetze rigoros meist täglich durchgesetzt, während der zur Drogenszene an der unteren Langstrasse gehörende Drogenstrich ein toleriertes Schattendasein zu fristen schien.
Wenn die Polizei wieder verdeckte Erhebungen für eine neue Aktion machte, blühte das verbotene Geschäft richtig auf. Um dann plötzlich wie auf einen Schlag still zu stehen. Mit der Zeit bemerkte Rolf auch die Unterschiede in der kriminalpolizeilichen Tätigkeit. Erkennbar durch die Konzentration personeller und logistischer Kräfte auf einen ganz bestimmten Punkt. Rolf konnte sich mit seinem Flair für Zahlen die Auto-Nummern der ständig kursierenden zivilen Kripo-Fahrzeuge mühelos einprägen. Je nachdem, ob Händler, Konsumenten, Freier oder Stricherinnen ins Visier genommen wurden, ergaben sich typische Bilder der Gesamtsituation.
Die Neugier, den Dingen auf den Grund zu gehen, war geweckt. Rolf änderte sein Verhalten gegenüber zufälliger Kundschaft aus der Drogenszene, er sprach sonst Fahrgäste grundsätzlich nicht von sich aus an, und begann zwanglos Gespräche zu führen während solcher Fahrten. Überrascht war Rolf, wie unbekümmert und offen Drogensüchtige ihm von ihren Erfahrungen, Sorgen und Nöten berichteten. Durch gelegentlich kostenloses mitfahren lassen war er bald mit vielen bekannt.

Wie schon oft, nachts um halb drei, wartete Rolf mit seinem Taxi an der Bushaltestelle Militär-Langstrasse vor dem Hotel Gregory auf Kundschaft. Die Haltestelle wurde nach Betriebs-Schluss der öffentlichen Verkehrsmittel inoffiziell als Taxistand benutzt. Von der oberen Langstrasse her eilte eine jüngere Frau über den Fussgänger-Streifen und begann, noch im Gehen, bei den um die Ecke biegenden Fahrzeugen Autostopp zu machen. Erfolglos. Sie führte Selbstgespräche, zwang manchmal vorbeifahrende Autos fast zum Anhalten, indem sie einen Schritt in deren Fahrbahn trat, rückwärtsgehend passierte sie die drei da stehenden Taxis, kehrte weiter vorne wieder um und lief aufgeregt auf dem Gehsteig, sprach Passanten an.
Die Frau trug kräftige Wanderschuhe, schwarze Trainerhose, am Unterschenkel graue, grob gestrickte Stülpen, das baumwollene Männerhemd über die Hosen getragen wie eine weite Bluse, von einem schwarzen Gurttäschchen geschnürt, darüber eine warme Stoffjacke mit Kapuze und dazu noch eine weite Regenjacke aus Nylon. Es war Oktober, nass und schon recht kühl. Sie hatte nackenlange braune Haare, leicht gewellt, im vordersten Drittel rötlich aufgehellt, ursprünglich von einem Friseur gestylt, jetzt aber eher in wilder Zigeunerart. Um den Hals trug sie locker einen Schal, mehrfach gewunden.
Rolf schaute ihr interessiert zu. Er wartete gerne an diesem belebten Platz auf Kundschaft. Aus dem Fahrzeug heraus hatte er hier einen Hauch von realer Fernsehwelt, rundum, hinter gläsernen Autoscheiben sitzend, samt Rückspiegel, entging fast keine Bewegung seinen aufmerksamen Blicken. Er bemerkte auch ihr auffällig hübsches Profil mit extrem sinnlicher Mundpartie.
Als sie wieder an seinem Taxi vorbei kam, liess er die elektrische Beifahrerscheibe hinunter und sprach sie an.
„Wo musst du denn hin?“
Sie kam zu ihm ans Fenster, duckte sich und schaute ihn an.
„Zum Goldbrunnenplatz, aber ich habe kein Geld für einen Taxi.“
„Aber ein anderes Mal, kannst du dann bezahlen?“
„Jäh, würdest du mir denn vertrauen?“
„Sicher, steig ein.“
Sofort entriegelte sie durchs offene Fenster selber die verschlossene Türe und setzte sich auf den Beifahrersitz.
„Das ist aber flott von dir.“
„Also zum Goldbrunnen?“
„Ja, an die Schaufelbergstrasse.“
Das war zwar nicht dasselbe, nämlich fast doppelt so weit, doch was soll’s. Er startete seinen Wagen und fuhr los. Die beiden Fahrer in den Taxis vor ihm drehten unwirsch ihre Köpfe. Sie wären vor ihm an der Reihe gewesen und könnten annehmen, der andere hätte ihnen einen rentablen Kunden weggeladen. Es war wieder so eine trostlose Sonntagnacht ohne zahlende Fahrgäste. Unterwegs versuchte Rolf ein Gespräch.
„Ich habe dich kürzlich gesehen in den Seitenstrassen um die Lugano-Bar.“
„Ja? Gut möglich, dort habe ich schon rausgelassen.“
„Rausgelassen? Verkaufst du Drogen?“
„Ich mischle eigentlich nur, wenn ich vier Portionen vermittelt habe, kriege ich eine für den Eigenbedarf. Dich habe ich aber noch nie gesehen.“
„Mein Taxi ist einer von vielen. Wie heisst du?“
„Trix.“
„Freut mich, ich bin der Rolf.“
Rolf zündete sich eine Zigarette an.
„Willst du auch eine?“
„Gerne.“
Nach ein paar Zügen bekam sie einen wüsten Hustenanfall. Sie öffnete das Fenster und drückte die Zigarette im Aschenbecher aus.
„Ich sollte nicht rauchen, ich habe Asthma und im Moment besteht dazu ein Verdacht auf Lungenentzündung.“
„Bist du bei einem Arzt gewesen, ein Schirmbild machen lassen?“
„Ja, ich war im USZ, im Universitätspital Zürich, eine Tomografie haben sie gemacht, ich soll wieder vorbei kommen.“
Schichtröntgen wird wohl kaum bei Verdacht auf Lungenentzündung veranlasst, da geht es vermutlich um etwas noch schlimmeres.
„Und, wie lief dein Geschäft?“
„Jetzt habe ich nur etwas für mich selber besorgt.“
„Was nimmst du denn?“
„Kokain.“
„Nur Kokain, kein Heroin?“
„Nein, nur Kokain, ich habe Methadon.“
„Das Methadon ist meistens die Endstation. Vielleicht sollte ich einmal, damit ich den Durchblick kriege, die ganze Palette einer Drogenlaufbahn rückwärts durchgehen, aber ohne von irgendetwas abhängig zu werden und am Schluss rauche ich nochmals einen Joint, wie vor dreissig Jahren.“
„Du bist ein seltsamer Vogel, das muss ich schon sagen, aber in einem irrst du dich, für Drogensüchtige ist nicht das Methadon die Endstation, sondern der Tod.“
„Gut, so gesehen ist er das für uns alle.“
Trix bedankte sich noch einmal dafür, wie er sie ohne Geld, auf Kredit, mit dem Taxi heimfahre. Sie gebe ihm das Fahrgeld ein anderes Mal, es wären etwa fünfzehn Franken. Rolf kannte solche Versprechungen zur Genüge.
„Nur keinen Stress, weisst du, ich kann das nur darum, weil nichts läuft, sonst hätte ich dazu gar keine Zeit.“
„Trotzdem, andere würden das nicht machen, ich kenne viele Taxifahrer, die haben nur Geld im Kopf, und zwar sofort.“
„Ich weiss eben, wie das läuft bei euch, ihr habt oft kein Geld, aber wenn ihr ausnahmsweise einmal zu viel davon habt, dann reut es euch auch nicht. Hab ich dir schon gesagt, dass ich Rolf heisse?“
„Ja, das hast du.“
Sie schaute ihn erstaunt und belustigt an, dann reichte sie ihm ihre Hand.
„Also noch einmal richtig, ich bin die Beatrice, aber du kannst mir Trix sagen.“
„Ich bin der Rolf.“
„Wau, du hast aber einen Händedruck.“
„Entschuldigung, habe ich zu stark zugepackt?“
„Nein, nein, schon gut.“
Rolf wusste, bei feingliedrigen Menschen könnte er ungewollt diesen ersten Eindruck erwecken. Unvergessen bleibt ihm eine für ihn peinliche Erinnerung, wie er als zwölfjähriger Bub einmal beim Händereichen von einem Onkel gezwungen wurde, diesem die Hand zu geben wie ein richtiger Mann, mit exakt so viel spontanem Gegendruck wie man selber spürt. Seither hatte Rolf einen kräftigen Händedruck.
„Bist du verheiratet?“
„Ja, ich bin 45 Jahre alt, verheiratet und habe drei Kinder, hier hast du meine Visitenkarte, willst du sonst noch etwas von mir wissen?“
„So gut, das glaube ich nicht.“
Sie fand offenbar Gefallen an seiner Absicht, sich als offenes Buch darzustellen. Inzwischen waren sie in der engen Einbahnstrasse vor ihrem Wohnort angekommen und hielten auf der Fahrbahn zwischen den beiden Reihen geparkter Autos. Sie zeigte keinerlei Anstalten, auszusteigen, fragte weiter.
„Bist du schon lange verheiratet?“
„Seit zweiundzwanzig Jahren.“
„Und, liebst du deine Frau immer noch?“
„Sicher, manchmal kommt es mir so vor, als hätten wir uns erst gestern kennengelernt, so schnell verging die Zeit.“
„Wirklich? Du liebst sie immer noch richtig, wie damals?“
„Genau gleich natürlich nicht, wir sind ja beide auch älter geworden, es ist aber nur anders, weisst du, im Laufe der Jahre wandelt sich die erste grosse Liebe in ein Gern haben, in ein gegenseitig Füreinander da sein und Verantwortung übernehmen.“
„Das ist schön, wie du das sagst, und du hast nie andere Frauen gewollt, hast deine Frau immer geliebt?“
„Ja, aber weisst du, ich bin doch auch nur ein Mann, besonders seit ein paar Jahren meine ich schon eine Veränderung an mir zu bemerken.“
„Aha, die bekannte Abänderung?“
„Nicht nur, es tauchen plötzlich neue Dimensionen auf, die früher, etwa um dreissig, überhaupt kein Thema waren, mein Gehör und meine Sehschärfe haben sich zum Beispiel verändert, Männer über vierzig haben wahrscheinlich ganz allgemein auch einen anderen Blick für jüngere Frauen.“
„Das finde ich jetzt aber interessant, was du da sagst.“
„Wie alt bist du denn?“
„Was meinst du, sage eine Zahl.“
Rolf musterte sie lange. Was sollte er sagen?
„Vielleicht siebenundzwanzig?“
„Danke, ich werde dreiunddreissig, jetzt dann Ende November.“
„Du siehst viel jünger aus.“
„Danke, das tut mir gut, das zu hören.“
„Und es stimmt auch, wenn ich es sage, ich mache keine Komplimente.“
Sie schaute Rolfs Visitenkarte an und verlangte ein Schreibzeug.
„Also, ich schreib mir den Fahrpreis auf, damit ich weiss, worum es geht, ich werde dich anrufen, wenn ich das Geld habe.“
„Nein, schreib das nicht zu meiner Nummer, sonst wirst du sie wegwerfen, mir ist es lieber, wenn du mich einmal anrufst.“
„Wenn du meinst.“
Sie versuchte zu gähnen.
„Jetzt könntest du mich eigentlich noch nach oben tragen, ich bin total schwach.“
Rolf lachte.
„Das würde ich mir zutrauen, für ein gutes Trinkgeld mache ich fast alles, aber du kannst mir ja gar kein Trinkgeld geben. Hättest du dann wenigstens etwas zu trinken, und überhaupt, lebst du allein?“
„Ich bin allein, von meinem Ex getrennt, aber ich habe zwei Hunde.“
„Was sind das für Hunde, weisst du, ich habe Angst vor grossen Hunden.“
„Nein, das glaube ich gerade dir.“
„Doch, es stimmt, ich habe den Umgang mit diesen Tieren nie gelernt, die so gross sind und spitzige Zähne haben, wie Schäfer, Doggen oder Bernhardiner.“
„Meine sind ganz klein, zurzeit sind sie sowieso fremd platziert, bei einer Freundin. Wenn du willst, kannst du schon mit hinauf kommen, aber nicht allzu lange, ich will unbedingt noch eine Arbeit fertig machen, die ich morgen abliefern muss.“
„Was ist das für eine Arbeit?“
„Für eine Werbeagentur kann ich frei arbeiten, auch zu Hause, und nur wegen dem Termin habe ich mir etwas besorgt vorhin, sonst werde ich nicht damit fertig, ich muss aber unbedingt abliefern.“
„Gut, ich komme mit hinauf, nur kurz.“
Ein paar Meter weiter war vorne eine Möglichkeit zum Parken auf dem Gehsteig, eigentlich verboten, aber während der Nacht gängige Praxis. Mit dem Lift liessen sich die beiden zum zweiten Stockwerk hochtragen. An der Aussenseite der Wohnungstüre begrüsst ein Farbbild eines Tigerkopfes die Hausbewohner und eventuelle Besucher. Trix wohnt in einer Einzimmerwohnung mit separater Küche. Sie blieb im kurzen Eingangsflur stehen und zog nicht nur ihre Jacken, sondern bis auf die Unterwäsche auch ihre übrige Bekleidung aus. Darunter trug sie ein schwarzes Ballettkleid an einem Stück, mit Reissverschluss, samt Fussbekleidung, und zog nun lediglich noch feine Geräteschuhe über. Sie forderte Rolf auf, mit der Hand an ihrer Hüfte zu fühlen, wie dünn sie geworden sei, sie habe in den letzten fünf Tagen acht Kilogramm abgenommen. Rolf meinte, dazu müsste er beide Hände nehmen, um sich einen Eindruck verschaffen zu können. Er tastete den Übergang von Bauch zu Rippen und erschrak, wie abgemagert sie war. Als Rolf den Teppich im Gang zum Zimmer hin verlassen wollte, zischte Trix herrisch knapp und unpersönlich, so als ob ihre Mutter spräche.
„Schuhe ausziehen!“
Rolf befolgte diese Aufforderung gehorsam und stand nun im Kittel, aber nur in den Socken, im Zimmer. Er fühlte sich ohne Schuhwerk ziemlich peinlich und unsicher.
„Du hast dich schön eingerichtet, wohnst du schon lange hier?“
„Seit fünf Jahren.“
Das Zimmer war sauber aufgeräumt, gemütlich und heimelig. Es wimmelte überall von unzähligen Kleinigkeiten. Das Doppelbett war ordentlich gemacht, nur der Platz war aufgedeckt, den Trix jeweils zum hinlegen benötigte. Die beiden Sessel beim kleinen runden Tischchen belegten sieben grosse Teddybären. Die Möbel waren alle aus nördlichem Naturkiefer, wie sie durch die global verkaufenden Handelshäuser angeboten werden. Mehrere Pflanzen strahlten ihr wohltuendes Grün in den Raum. An den Wänden hingen grosse Farbfotografien von Tierköpfen, Tiger und Hunde, aber keine Hauskatzen. Auch auf dem Büchergestell, das gleichzeitig als Wohnwand fungierte, waren geschnitzte und geformte Tierfiguren aufgestellt. Einzig über der Kopfseite des Bettes war kein Tierkopf, sondern ein übergrosser, aufgefalteter Fächer als Wandschmuck platziert. Die gesamte Kombination der Wohnungseinrichtung zeigte in Form und Farbe einen treffsicheren Sinn für kreative Gestaltung. Da in der Wohnwand eine kleine Nachbildung eines sitzenden Buddhas sichtbar war, fragte Rolf, ob sie sich für Buddhismus interessiere.
„Nicht nur, ich bin sogar richtig Buddhistin, dieser Buddha ist mein Tempel, den darf niemand berühren, er würde dadurch entweiht.“
„Welche Richtung bevorzugst du denn? Zen oder so?“
„Nein, Dalai-Lama.“
„Ist das nicht Tibet, wie kommst du denn darauf?“
„Ich war dort, nicht in Tibet, da kommst du gar nicht rein, aber in Indien, ich habe den Dalai-Lama bei einer halbstündigen Audienz persönlich kennen gelernt.“
„Nein, wirklich? Sag mal, du bist schon weiter herumgekommen als ich.“
„Ich glaube an die Reinkarnation, an die Wiedergeburt. Was denkst du darüber, kannst du dir vorstellen, schon einmal gelebt zu haben und nach deinem Tod wieder geboren zu werden?“
„Nein, ich denke zwar ähnlich, aber im Grundsatz doch wieder völlig anders, weil ich keine auf mich selber bezogene Wiedergeburt erkennen kann, wohl aber eine Teilnahme der Seele in einer gedanklichen Dimension. Im keltischen Druidentum, der ursprünglichen europäischen Kultur, wurde gelehrt, der Tod sei wie die Mitte eines langen Lebens, nach dem persönlichen Tod herrsche weiterhin der gleiche Gedanke, aber sowohl in einem anderen Körper als auch in einer anderen Welt, aber in dieser Welt. Das ist noch heute der springende Punkt, die andere Welt in dieser Welt.“
„Dass auch du dir darüber Gedanken machst, finde ich schön und wichtig.“
Sie hantierte in der Küche, füllte eine Schale mit Wasser und stellte sie auf das runde Tischchen neben dem Bett.
„Setz dich doch, du musst dir halt selber Platz schaffen.“
Rolf verlagerte die farbigen Plüschtiere auf einen Sessel, zog seinen Kittel aus und legte diesen ebenfalls auf den Haufen. Da nirgends ein Aschenbecher zu sehen war und Trix wegen ihrem Asthma nicht rauchen sollte, zündete er keine Zigarette an, sondern fragte sie, ob sie im Zimmer nicht rauchen würde.
„Nein, da drin wird nicht geraucht.“
Trix war in der Küche vor dem geöffneten Kühlschrank.
„Magst du Fruchtsäfte, ich habe einen Birnensaft da?“
Sie stellte ein Tetra-Pak auf die Ablage der Küchenkombination und machte weiter mit ihren seltsamen Vorbereitungen, offenbar für ihre Spritze. Für jeden einzelnen Gegenstand ging sie extra, einen grossen Esslöffel aus der Küche, eine Rolle Papier aus dem Klo, eine Schere aus der Kommode. Sie setzte sich auf die Bettkante ans Tischchen und öffnete eine Flash-Box aus einem der städtischen Spritzenautomaten, wo die Drogenabhängigen für drei Franken und fünfzig Rappen zwei neue Bestecke beziehen konnten.
„Du kannst dir selber ein Glas holen und etwas zu Trinken einschenken.“
Die Küche ist blank sauber, wie nie gebraucht.
„Wo sind die Gläser?“
„Du musst halt suchen, aber mach keine Unordnung.“
Rolf öffnete zuerst die Küchenschranktüre über dem Abwaschgitter und wurde gleich fündig. Er nahm zwei Gläser mit.
„Willst du auch etwas trinken?“
„Gerne.“
Trix hatte mit einer Gratiszeitung, dem Tagblatt der Stadt Zürich, den Boden zwischen ihrem Bett, wo sie auf der Kante sass, und dem Tischchen abgedeckt.
„Manchmal finde ich beim Spritzen die Vene nicht und so habe ich keine Sauerei am Boden, wenn es blutet.“
„Hast du denn bereits Verhärtungen am Arm vom Stechen?“
„Nein, aber ich habe immer mehr Mühe mit treffen, da, schau her, ich habe an beiden Unterarmen Reissverschlüsse.“
Sie streifte die Ärmel zurück und zeigte Rolf ihre Unterarme. An beiden Innenseiten waren entlang der Venen Einstiche zu sehen, Fixerstrassen, in regelmässigem Abstand von einigen Millimetern.
„Soll ich dir spritzen? Ich hab das zwar noch nie gemacht, aber ich habe sicher eine ruhige Hand.“
„Spinnst du eigentlich, ich lass mir doch nicht einfach von jemandem eine Spritze machen. Würdest du das wirklich tun?“
„Warum nicht, war ja nur ein Vorschlag in der Not.“
Plötzlich Hektik, sie suchte ihre beiden Minigrips, kleine Plastik-Säckchen, in denen die Händler das sehr heikle, Feuchtigkeit empfindliche Kokain verkauften.
„Nein, wo habe ich die jetzt verlegt? Komm, hilf mir doch beim suchen.“
„Die hast du doch vorhin noch in der Hand gehabt.“
In der Küche fand sie, was sie suchte. Rolf wollte die Minigrips von nahe ansehen, sie gab sie aber nicht aus der Hand, streckte sie ihm nur hin.
„Dieses weisse Pulver ist also Kokain. Wie viel ist denn da drin?“
„Nicht viel, in jedem vielleicht um 0,8 Gramm.“
„Und was hat das gekostet?“
„Je hundert Franken.“
Mit der Fernbedienung stellte sie den Fernseher ein und reichte sie Rolf.
„Halte diese bitte, sie irritiert mich, wenn sie auf dem Tisch liegt. Wenn ich spritze, musst du den Ton abschalten, damit ich ein gutes Flash habe, brauche ich absolute Ruhe, ich sage dir dann, wenn es soweit ist.“
„Was ist, wenn du wegkippst, was soll ich dann tun?“
„Dann gehst du, lässt mich einfach liegen, aber beatmen könntest du mich schon noch, bevor du gehst, falls es nötig wäre. Das würdest du doch tun, oder?“
Trix hatte sich eine dunkle Hornbrille aufgesetzt und sah Rolf an wie im Film eine Oberlehrerin in einem Internat ihren Schüler. Im Esslöffel löste sie den Inhalt eines Minigrips in Wasser auf und stampfte mit dem Filter aus der Flashbox darin herum. Sie verlangte von Rolf zwei Zigaretten und schnitt von einer ein Stück vom Filter ab. Mit der Spritze ohne Nadel zog sie die Flüssigkeit durch den Filter auf, bis der Löffel restlos sauber war.
„Diese Filter sind immer noch die besten.“
Rolf scherzte, „den kannst du mir jetzt ja als Kaugummi geben.“
„Sicher nicht, davon hast du nichts, das macht dir bloss die Zähne kaputt.“
„War auch nicht ernst gemeint.“
„Das habe ich schon gemerkt, du hast einen auffällig sarkastischen Humor.“
Zuletzt steckte sie die etwa zwei Zentimeter kurze Nadel auf und band sich mit einem Stoffbändel den rechten Oberarm ab.
„Jetzt musst du wegsehen, ich werde sonst nervös und treffe erst recht nicht.“
„Sowieso, mir wird schon beim Anblick der Nadel schwindlig.“
„Du, das erging mir früher auch so, bevor ich selber angefangen habe.“
Rolf drehte sich zum Fernseher um.
„Du schaust ganz bestimmt nicht?“
„Versprochen, du kannst mir vertrauen, und jetzt sage ich auch nichts mehr, bis du wieder mit mir sprichst.“
Ohne Ton mitten in einen Spielfilm hinein zu schauen war auch mal etwas Neues. Rolf zählte darum die deutlich hörbaren Blutstropfen, die schon bald auf dem Zeitungspapier am Boden ankamen. Zuerst ab und zu einer, dann ein kurzes Staccato, manchmal durch ein Rinnsal unterbrochen, begleitet von einem fast wie wohltuend klingenden Stöhnen von Trix. Rolf verkrampfte sich ein wenig, weil er sich vorstellte, was er nicht mit ansehen durfte, wie sie mit der Nadel unter der Haut, die durch das Kokain örtlich betäubt wird, langsam stechend eine Vene suchte. Zwischendurch sagte sie einmal, ruhig und konzentriert, sie treffe nicht. Dann ging das blutige Hörspiel weiter, bis sie sagte, sie glaube, jetzt habe es geklappt, ob er ihr im Badezimmer den grünen Lappen holen würde. Als Rolf damit zurückkam, der Lappen hing noch recht feucht, wie kürzlich gebraucht, über dem Badewannenrand, sah er den malträtierten Arm. An der Aussenseite des vorderen Unterarmes waren als Tupfer schneeweisse Klopapierfetzen, blutrot angeklebt. Etwas weiter den Arm rauf hing auf der Innenseite die Spritze, schon rot gefüllt mit Blut, das sie während dem Suchen aufgesogen hatte. Trix brauchte beide Hände zum Putzen und liess dazu die Spritze einfach in der Vene baumeln. Sie hatte eine taugliche Ader gefunden und reinigte sich vor dem entscheidenden Flash? Erst als ihr der Arm sauber genug schien, löste sie die Abschnürung und drückte die Spritze langsam und gleichmässig durch. Sie verharrte leise ausatmend mit geschlossenen Augen. Dann zog sie die Nadel halb zurück, füllte sie durch Zurückziehen des Kolbens erneut mit Blut und drückte auch dieses wieder langsam in die Vene, darauf bewegte sie die Nadel in der Vene, saugte die Pumpe nochmals voll Blut und versenkte dann die Kanüle bis zum Anschlag im Arm. Die ganze Handlung ging in einer endlosen Zeitlupe vor sich. Dabei bewegte sich ihr Unterkiefer quer hin und her, als ob sie mit den Zähnen knirschen würde. Jetzt pumpte sie den Inhalt der Spritze etappenweise hinein und wieder zurück, wobei sie jedes Mal etwas mehr spritzte als ansaugte, bis der Kolben leer war. Nun zog sie die Nadel raus und legte die Spritze auf den Tisch, nahm ihre Brille ab und sank mit geschlossenen Augen und durchgestreckten Beinen rücklings aufs Bett. Nach vielleicht etwa zehn Sekunden setzte sie sich bereits wieder auf und begann, ihre Utensilien wegzuräumen. Das Kokain wirke besser, wenn sie sich bewegen würde. Rolf musste ihr die Nadel von der Spritze abnehmen, weil sie diese zu stark aufgesteckt hatte und nicht mehr wegbrachte. Anstatt zuerst die Schutzhülle überzuziehen, wie sie es sicher gelernt hatte, warnte sie ihn lediglich, er solle aber aufpassen mit der spitzigen Nadel, das sei gefährlich.
„Wozu pumpst du noch das Blut mehrmals hin und her?“
„So hast du jedes Mal erneut ein kleines Flash, das erste explodiert richtig im Kopf und dann kann ich nicht mehr aufhören, ich liebe diese Ekstase und will sie wieder, wieder und immer wieder.“
Rolf war halb schlecht vom Zusehen. Er stand nun auf und zog seinen Kittel wieder an, auch, weil sie ja gesagt hatte, er könne nur kurz mit hinaufkommen. Trix schaute ihm erstaunt zu und fragte, ob er schon gehen wolle.
„Ich sollte noch etwas Umsatz machen, sonst ist meine Frau nicht mit mir zufrieden, wenn sie am Morgen meine Einnahmen ausrechnet.“
„Schade, ich hätte jetzt gerne noch ein wenig mit dir geplaudert.“
„Dann bleibe ich, soviel Zeit habe ich schon, aber du willst doch noch arbeiten.“
„Das schaffe ich jetzt locker.“
Dabei wölbte sie den halbrunden Deckel eines kleinen Pultes zu, als ob es sich dabei um ihren Arbeitsplatz handeln würde. Rolf war irritiert, weil dort keinerlei Hinweise auf ein angefangenes Werk hindeuteten, vielmehr liegen bloss einige frisch gefaltete Wäschestücke auf der nun nicht mehr einsehbaren Arbeitsfläche. Ob sich wohl Trix etwas vormachte, das es gar nicht gab? Wohl kaum, eher machte sie Rolf etwas vor, war dabei, ihm ihre Masche, ihr perfektes Schauspiel, vorzutragen. Diesmal nahm sie ihm den Kittel ab und hängte ihn mit einem Kleiderbügel gegenüber der überfüllten Garderobe an den Schlüssel eines Wandschrankes. Sie nahmen wieder Platz, er im Sessel und sie mit angezogenen Beinen auf dem Bett, die Arme um die Knie geschlungen.
„Was spürst du jetzt?“, fragte Rolf neugierig.
„Es geht mir einfach gut.“
„Seit wann nimmst du denn Drogen?“
„Erst wieder seit kurzem, aber angefangen hat das schon vor bald zwanzig Jahren, als ich noch zur Schule ging. Nachdem wir von Oberengstringen nach Schlieren umgezogen sind, kam ich mit den falschen Kollegen zusammen. Ich bin mir fast sicher, dass ich sonst nicht da rein geraten wäre. Ich kam damals übrigens einmal in der Zeitung als jüngste Drogenabhängige, die von der Polizei aufgegriffen wurde.“
„War das nicht die Manuela auf dem Platzspitz?“
„Die kam erst später, ich war schon vor ihr die erste Minderjährige, nachher wurden sie dann sowieso immer jünger.“
„Warst du auch auf dem Drogenstrich?“
„Nein, nur einmal, es ekelte mich mit fremden Männern, ich habe mir mein Geld lieber mit Drogenhandel beschafft.“
„Hast du den Zeitungsartikel noch.“
„Nein, aber meine Mutter hat ihn für mich aufbewahrt.“
„Magst du deine Eltern, hast du noch Kontakt zu ihnen?“
„Mein Vater, das war ein ganz lieber Mann, den ich gut mochte. Leider ist er viel zu früh gestorben, als ich mit neunzehn in einer Entzugs-Therapie war. Meine Mutter hatte es nicht einfach, sie war nur die Freundin meines Vaters, der war schon verheiratet. Sie war oft unzufrieden, machte mir stets alles kaputt, vielleicht nicht einmal mit Absicht, sie hat mich oft verprügelt, mit einem Teppichklopfer oder mit dem Rohr des Staubsaugers. Ich durfte nie raus oder eine Kollegin nach Hause nehmen, musste immer putzen und aufräumen.“
„Wie kamst du zu Drogen?“
„Mein erster richtiger Freund, Remo, war schon fast einundzwanzig Jahre alt und ohne mein Wissen abhängig. Erst als ich die Einstiche sah und ihn zur Rede stellte, hat er es zugegeben. Später, als meine Mutter von jemandem davon erfahren hatte, gab es dann ein riesiges Theater, ich sollte gezwungen werden, meinen Freund einfach zu vergessen. Da habe ich in der Verzweiflung, als ich trotz Verbot bei ihm war, seine Fixerutensilien gestohlen und dann, ganz allein bei mir zu Hause, eine erste Spritze gemacht.“
„Bist du verrückt, das hätte dich umbringen können.“
„Ich war auch lange bewusstlos, als ich wieder zu mir kam, lag ich auf dem Rücken im Bett und die Nadel steckte noch in der Armbeuge. Die Trennung von meinem Freund wurde dann dennoch erzwungen und ich wurde trotzdem drogenabhängig.“
„Wahnsinn, du bist aus Stolz und zum Trotz für deine Jugendliebe an die Nadel?“
„Es hat mir niemand helfen können. Mein lieber Vater wollte zwar, aber er war ein einfacher Arbeiter, der das alles vermutlich gar nicht so richtig begreifen konnte, was da vor sich ging.“
„Das hätte er damals und noch heute auch als Studierter nicht begriffen.“
Zwischendurch schwiegen manchmal beide und blickten sich stumm in die Augen, die wie von selbst aneinander hängen zu bleiben schienen.
„Und du hast auch schon rausgelassen, hast mit den Drogen gehandelt?“
„Früher war ich sogar einmal eine wichtige Figur in der Zürcher Szene, ich war eine richtige Grosshändlerin.“
„Damals auf dem Platzspitz?“
„Da war ich nur noch ganz am Anfang dabei, nein, ich war schon im Autonomen Jugendzentrum, dem AJZ, ich habe dort gelebt, wir hatten ein Zimmer, bis sie alles abgebrochen und kaputt gemacht haben, ich war auch bei den Krawallen dabei.“
Im Mai 1980 erschreckten die Opernhaus-Krawallnächte die Zürcher Bevölkerung. Vor dem Hintergrund einer politischen Abstimmungsvorlage, dem Umbau des Opernhauses für 60 Mio. Franken, und einer seit den Jugendunruhen von 1968 pendenten Forderung aus der Zürcher Bewegung nach einem Jugendhaus eskalierte eine gewaltsame Auseinandersetzung. Ende Juni erfüllte der Stadtrat von Zürich ein Ultimatum der Bewegung und übergab eine leer stehende Fabrikhalle samt Nebengebäude unter die Trägerschaft der Sozialdemokratischen Partei der Stadt Zürich. Das Autonome Jugendzentrum (AJZ) hinter dem Hauptbahnhof zwischen Sihlquai und Limmatstrasse war gegründet. In der ehemaligen Fabrikliegenschaft entwickelte sich in der Folge aber auch eine massive Drogenszene. Im AJZ befand sich der erste illegale Fixerraum der Stadt. Vor allem wegen diesem rechtlosen Raum und den unhaltbaren hygienischen Verhältnissen wurde das AJZ im Frühjahr 1982 endgültig mit polizeilicher Gewalt geräumt und gleich anschliessend abgebrochen. Die freie Ebene wurde umgeplant und in einen Carparkplatz verwandelt.
Auch Rolf war sporadisch im AJZ, er besuchte vor allem die politischen Vollversammlungen der Autonomen, nahm als Beobachter an Demonstrationsumzügen teil und sass, bald dreissigjährig und Familienvater, mal wieder auf Tramgeleisen beim Bellevue, allerdings mit einem unguten Gefühl, fast wie mit einem schlechten Gewissen. Für die mehrheitlich über zehn Jahre jüngeren Demonstranten sah er aus wie ein Polizeispitzel und für die älteren Zuschauer oder Polizisten gehörte er vom Aussehen her ebenfalls nicht hierher. Irgendwie berührte es Rolf eigenartig, heute, fast zwanzig Jahre später, jemanden zu treffen, der damals auch dabei war.
„Vielleicht sind wir uns im AJZ schon begegnet, ich war oft dort, aber du warst doch kaum fünfzehn, musstest du nicht zur Schule?“
„Wegen den Drogen bin ich von der Schule geflogen und dann hat mich auch noch meine Mutter rausgeworfen.“
„Und dein Freund Remo, was ist mit dem?“
„Mit ihm hatte ich nach der AJZ-Zeit schon bald keinen Kontakt mehr, später habe ich dann einmal vernommen, dass er an den Drogen gestorben sei, andere behaupten, er habe sich aufgehängt, was soll’s, tot ist tot.“
Tot sei tot, vor einer halben Stunde nannte sie sich Buddhistin?
„Magst du dich an eine junge Frau erinnern, die sich damals auf dem Bellevueplatz selbst verbrannt hat?“
„Ja, das war Silvia, die lebte auch im AJZ.“
Sie habe Silvia gut gekannt, auch deren Freund, der habe Mike geheissen. Es sei schlimm gewesen. Als Silvia brannte und Helfer löschen wollten, sei sie diesen davongerannt. Es habe ausgesehen, als ob sie mit ihnen fang mich spielen würde, wie spielerisch erhaschte sie den eigenen Tod. Sie sei dann aber erst eine Woche später im Spital gestorben und ohne Todesanzeige auf dem Manegg-Friedhof begraben worden.
„Furchtbar, oder sonderbar?“
Silvia war dreiundzwanzig Jahre alt, als sie am 12.12.1980 öffentlich manifestiert hat, was sie zuvor in einer Szenenzeitung, dem Eisbrecher Nr. 9, angekündigt hatte: Wenn ich’s nicht mehr checke, wenn’s für mich nicht mehr weitergeht, dann bring ich mich um. Ich zünde mich an, mit Benzin - auf dem Bellevue, damit alle sehen, wie beschissen es einem Menschen in dieser Gesellschaft gehen kann. Ich mach es wirklich - ich bin ehrlich . . .
Ich weine. Die anderen lachen.
Ich schreie. Die anderen flüstern.
Ich friere. Die anderen haben warm.
Ich bin allein. Die anderen sind zusammen.
Aber ich bin ehrlich, und die anderen sind feige.
Ich sei krank und die anderen seien gesund,
behaupten die anderen.
Sie sassen einfach da und schwiegen, bis Rolf weiter fragte.
„Und heute? Wie stellst du dir das vor, wie es mit deinem Kokain weitergeht?“
„Ich nehme nur etwas, wenn es mir schlecht geht, ich habe Krebs. Und vor anderthalb Jahren hatte ich einen leichten Schlaganfall mit Lähmungserscheinungen. Ich musste mühsam wieder gehen und sprechen lernen.“
„Das hast du aber super geschafft, davon habe ich überhaupt nichts bemerkt.“
„Ich habe auch fest daran gearbeitet und zudem Glück gehabt.“
„Aber trotzdem, ich verstehe nicht, wenn du aufhören konntest, warum fängst du denn wieder damit an? Du weisst doch genau aus eigener Erfahrung, wie das weitergeht, du kannst dir das teure Kokain gar nicht leisten.“
„Schon, aber im Moment ist mir das alles völlig egal. Ich war viele Jahre drogenfrei. Zehn Jahre ist es her, seit ich in der Klinik Hard in Embrach den Entzug und dann im Aebi-Hus in Leubringen bei Magglingen eine mehrjährige Therapie abgeschlossen habe. Wieder abgestürzt bin ich vor etwa einem Monat, wegen meinem Ex-Freund, einem Tibeter, er arbeitete als Koch im Hotel. Ich kannte ihn schon länger, war total verknallt in ihn, wir waren aber erst seit einem halben Jahr richtig zusammen. Ich liebte ihn sehr intensiv, letztes Jahr waren wir zusammen in Indien. Als es einmal brannte in seinem Zimmer, der Fernseher, zog er zu mir. Er hat angefangen, Kokain zu schnupfen, obwohl er wusste, was früher mit mir los war. Das brachte mich wieder auf den Geschmack. Bald kam es dann auch zu Streit, vor allem, weil er auf einmal nur noch immer Anal mit mir wollte, bis ich einfach nicht mehr konnte, da es jedes Mal mehr weh tat.“
Rolf erstarrte schockiert ob der tabulosen Offenheit ihrer Redensart.
„Aber der ist doch nicht normal, immer nur von hinten, und ohne Erholungsphasen für dich? Warum tut der das?“
„Weil es der Frau weh tut, es ist die Verbindung von Liebe, Schmerz und Geilheit, das macht es aus. Jedenfalls hat er mich fallengelassen. Als er auch noch begann, mich zu schlagen, war es ganz fertig, ich lasse mich nicht schlagen und habe ihn rausgeworfen. Ich war völlig am Boden zerstört, habe dann auf der Bank meine Ersparnisse, dreitausend Franken, abgehoben, damit fünfzehn Gramm nicht gestrecktes Kokain gekauft und wieder mit Fixen angefangen, nach zehn Jahren, stell dir das vor. Nun bin ich krank und allein, es geht mir überhaupt nicht gut.“
„Und deine Mutter? Schaut sie manchmal nach dir?“
„In letzter Zeit kümmert sie sich nicht gross um mich. Sie hat jetzt einen anderen Namen und wohnt auch in Zürich, im Rütihof. Sie hat nach dem Tod meines Vaters den Richtigen gefunden und ist nun schon seit dreizehn Jahre verheiratet. Mein Ex-Freund hat sie aber ein paar Mal angerufen, um mich schlecht zu machen. Sie selber ist sehr instabil. Wenn sie mich früher besuchte, versteckte ich jeweils mein Methadon, weil sie es einmal probieren wollte, als sie es im Kühlschrank bemerkte. Es interessiert sie schon, was ich mache, aber sie muss auf Distanz bleiben und wird damit nicht fertig.“
„Wann nimmst du denn das zweite Mini-Grip, das noch dort auf dem Tisch liegt?“
„Das weiss ich jetzt noch nicht, ob ich es brauche.“
„Irgendwie verstehe ich dich, Trix, doch es tut mir auch weh. Wenn es dir nichts ausmacht, möchte ich nun gehen, ich muss unbedingt wieder eins rauchen.“
Der Kettenraucher Rolf meinte eine Zigarette.
„Du willst eins rauchen, warum sagst du denn nichts? Da fällt mir ein, nein, ich bin so vergesslich, schau hier, ich habe ja noch etwas da zum rauchen.“
Sie zeigte Rolf eine Zündholzschachtel, in der sie ein Stückchen gepresstes Haschisch aufbewahrte, gerade genug für einen guten Joint.
„Das habe ich eigentlich behütet für einen speziellen Anlass, wollen wir nicht zusammen noch eins rauchen, ich hätte jetzt Lust dazu.“
Rolf hatte schon seit bald dreissig Jahren keinen Joint mehr geraucht. Ohne seine Antwort abzuwarten, hatte Trix bereits den Inhalt einer Zigarette auf ein Papier ausgedreht und erwärmte das Haschisch mit einem Feuerzeug. Dann zermürbte sie ihn, mischte die Krümel unter den Tabak und füllte die Mischung in die leere Zigarettenhülse zurück, die sie dann vorne zudrehte. Mit einem Biss riss sie den Filter heraus und ersetzte ihn durch ein eingerolltes Stücklein Halbkarton, das sie mit der Schere zurecht geschnitten hatte. Fertig, sie reichte den Joint Rolf und meinte, der sei allein für ihn, sie möge doch nicht rauchen. Ob er schon ihre Tätowierung gesehen habe, die sie selber entworfen habe? Sie schlüpfte links aus dem Oberteil und zeigte ihm ihren nackten Oberarm. An der Achsel trug sie ein Tattoo, das ein grünes siebenblättriges Hanfblatt vor einem Gebirgszug und orangeroter Sonne darstellte, darunter die Jahreszahl 1984. Etwas weiter unten war ein chinesisches Schriftzeichen in schwarz tätowiert, das sei ein Om, sagte sie. Rolf zündete den Joint an, steckte ihn zwischen Zeig- und Mittelfinger, ballte die Hand zur Faust und deckte mit der anderen Handfläche die Finger ab. Dann sog er durch die beiden Hände den Rauch direkt in seine Lungenflügel, worauf ihn ein Hustenanfall daran erinnerte, dass er sich das nicht mehr gewohnt war. Langsam rauchte er den Joint und versuchte dabei, an früher zu denken, was ihm aber nicht gelang. Einzig der leicht beissende Geruch des verbrannten Haschisch schien ihm eine behagliche Erinnerung zu wecken. Vor allem aber wurde Rolf müde, er begann zu gähnen und musste sich ständig durchstrecken. Trix fragte interessiert, ob er etwas spüre. Nein, er bekomme nur Lust zu schlafen, sonst merke er gar nichts, er wolle nun nach Hause gehen und sich hinlegen.
„Ich schreib dir noch meine Telefonnummer auf, falls du mich einmal anrufen möchtest, es würde mich freuen.“
Sie gab Rolf einen Zettel mit Adresse und Telefonnummer.
„Trix, danke, dass du mich an dem hast teilhaben lassen, was du tust.“
„Tschau Rolf, sag deiner Frau einen Gruss von mir.“
„Das kann ich doch nicht.“
„War auch nicht ernst gemeint.“
Sie blinzelte vergnügt. Ironie, Sarkasmus und Zynismus im Sinne von anzüglichem, aber humorvollem Spott schienen ihr ebenfalls zu liegen.
„Ich komme noch mit runter, falls die Türe geschlossen wäre.“
„Nicht nötig, dann komme ich nochmals rauf, tschau Trix.“
Es war inzwischen einiges später als sonst, als sich Rolf auf den Nachhauseweg machte. Die starken Eindrücke der letzten Stunden, die er mit Trix erlebt hatte, nahmen ihn vollständig gefangen. Vor allem auch wegen den emotionalen Parallelen zu anderen Kokainabhängigen, die er schon kannte. Es war schlicht phänomenal. Viele waren vergleichbar im stolzen, herrschenden Typus eines nahezu absoluten, königlichen Egoismus anzusiedeln und praktizierten fast eins zu eins diese schmerzvolle, zudem auf nicht praktizierbare Reinlichkeit bedachte Praxis der langwierigen Stecherei und blutigem pumpen.
Am nächsten Nachmittag, als Rolf wieder ausgeschlafen war, fand er auf seinem Handy die Nachricht von vier unbeantworteten Anrufen vor, alle von Trix. Rolf rief zurück und erreichte sie zu Hause. Sie wollte gleich etwas mit ihm abmachen für diesen Nachmittag, sie wäre so alleine und möchte mit ihm etwas trinken gehen. Rolf erklärte ihr, dass für ihn jetzt erst früher Morgen wäre und er frühestens gegen acht Uhr abends wieder von zu Hause weggehen würde.
Rolf war froh, dem voraussehbaren, für ihn erfahrungsgemäss recht anstrengenden Kontragespräch, warum er ihr kein Geld für Drogen geben würde, vorerst entgangen zu sein. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Zehn Tage später, Rolf war kurz vor zwanzig Uhr gerade in seinen Taxi gestiegen, um mit der Arbeit zu beginnen, rief Trix ihn an, lud ihn auf einen Tee zu sich nach Hause ein und bat um den kleinen Gefallen, Zigaretten, Marlboro Gold, mitzubringen. Für Rolf war klar, nun war es so weit, sie wollte Geld von ihm, bloss weil er sie gutmütig von sich aus auf Kredit nach Hause fuhr, sollte er nun auch noch gleich als mitleidiger Trottel herhalten. An einer Tankstelle mit Kiosk kaufte er unterwegs zwei Packungen Zigaretten und noch einen Schokoladenriegel. Er läutete bei ihr und sie warf ihm vom Treppenhausfenster aus dem zweiten Stock ihren Schlüsselbund auf den Rasen hinunter. Oben empfingen Rolf im Treppenhaus zwei herzige Hunde, nur wenig grösser wie Hauskatzen, ähnlich Pekinesen, aber wie mit einem leichten Boxereinschlag, es seien Tibetaner. Trix öffnete die angelehnte Wohnungstüre und bat Rolf hinein. Dieser wusste nicht recht, ob er den Hunden den Vortritt lassen müsste, womöglich würde ihn einer von hinten in die Wade beissen? Trix merkte, wie er zögerte und rief ihre beiden Lieblinge, Dibi und Gismo, hinein. Dann begrüsste sie Rolf mit einem gehauchten Küsschen links und einem rechts, das dritte verharrte im Zaudern.
„Du siehst gut aus, Rolf.“
„Danke, und du, Trix, geht es dir gut?“
„Jetzt geht es mir wieder besser, ich lag nun eine Woche lang im Bett, es ging mir total schlecht, aber im Moment geht es wieder.“
Rolf trat ins Zimmer, in seinen Schuhen, es schien sie diesmal nicht zu stören.
„Willst du den Kittel nicht ausziehen?“
„Danke, im Moment nicht, mir ist etwas kalt.“
Sie räumte die Stofftiere vom Sessel, damit Rolf Platz nehmen konnte. Auf dem sauber abgeräumten Tischchen lag allein ein Faltblatt. Rolf hob es auf und las laut vor.
„HIV- und Aidsprävention, bist du positiv?“
„Nein, ich habe immer aufgepasst, schon damals, bevor man von Aids wusste, wegen der Hepatitis. Das war in meinem Briefkasten. Ich habe dort angerufen, damit sie mir jemanden schicken würden zur Hilfe im Haushalt, ich bin so schwach, ich kann fast nichts mehr selber machen. Die haben aber gesagt, dafür wären sie nicht zuständig, da müsste ich mich an die Spitex wenden. Ich habe nun zwei Wochen nicht arbeiten können und wollte dich fragen, ob du mir aushelfen könntest mit hundertfünfzig Franken, ich habe überhaupt keinen Rappen mehr und bekomme erst nächsten Montag wieder Geld, dann würde ich es dir auch zurückgeben.“
Obschon Rolf darauf vorbereitet war, verschlug ihm ihr Ansinnen zuerst einmal die Sprache, wie immer, wenn er so brandschwarz angeschwindelt wurde. Trix gewährte ihm seine Denkpause. Sie ging in die Küche und fragte von dort, ob er auch einen Tee oder lieber einen Orangensaft nähme.
„Ich nehme das gleiche wie du auch.“
Sie brachte zwei Tassen mit Teebeutel, das heisse Wasser goss sie dann direkt aus der Pfanne auf. Als sie einmal aus der Küche zurückkam, hatte Rolf den Eindruck, sie würde sich leicht zusammenkrümmen beim Gehen.
„Hast du Schmerzen?“
„Bauchkrämpfe, darum will ich auch einen Tee trinken.“
„Hast du Schmerzmittel im Haus?“
„Ja, ich habe Medikamente, Methadon und anderes.“
„Bist du denn im städtischen Methadonprogramm für Abhängige?“
„Nein, das verschreibt mir mein Arzt, als Schmerzmittel, wegen dem Krebs.“
„Ah ja? Das habe ich jetzt aber noch nie gehört. Und seit wann nimmst du das?“
„Schon viele Jahre.“
Sie holte noch Aschenbecher und Zigaretten, vor zehn Tagen hatte sie gesagt, in ihrem Zimmer würde nicht geraucht, doch nun zündete sie sich eine an. Zwischendurch musste sie aufs Klo, ein extrem fauliger Gestank breitete sich bis ins Zimmer aus, sie entschuldigte sich dafür, als sie zurückkam.
„Was meinst du, könntest du mir aushelfen, ich wäre so froh, wenn ich nur etwas Geld für Haushalteinkäufe hätte.“
„Schau Trix, du weisst doch so gut wie ich, dass ich dir kein Geld für Kokain geben darf, oder nicht?“
„Du bekommst es ja schon am Montag wieder zurück.“
„Ich weiss doch so gut wie du, wie das läuft, klar, du willst es zurückgeben, jetzt, aber wenn du es dann solltest, hast du gar nicht genug Geld, um all deine ehrlich gemeinten Versprechen einzulösen.“
„Aber was soll ich denn machen?“
„Hier bleiben und kein Kokain holen, oder darf ich dich zum Essen einladen?“
„Ich möchte unbedingt etwas einkaufen gehen.“
„Wir können auch mit den Hunden spazieren gehen, zwei Stunden lang, da kommst du auf andere Gedanken?“
Sie lachte Rolf aus, wie seine fünfzehnjährige Tochter ihre Mutter, wenn diese ihr an einem schulfreien Nachmittag einen solchen Vorschlag machen würde.
„Zwei Stunden laufen, nein, so etwas.“
„War auch nicht mein Ernst, ich fahre selber auch lieber mit dem Auto.“
Trix machte jetzt einen müden und niedergeschlagenen Eindruck, Rolf hatte soeben eine ihrer Hoffnungen zerstört. Mit einem trotzigen Unterton sagte sie, dann müsse sie eben an die Langstrasse, Umschau halten, vielleicht treffe sie jemanden, den sie kenne und von dem sie etwas kriege oder sonst müsse sie einen Freier suchen, ob er sie wenigstens hinfahren würde. Rolf wechselte seinen Sitzplatz zu ihr auf die Bettkante und nahm ihre Hand.
„Letztes Mal hast du mir doch gesagt, du würdest nicht anschaffen gehen?“
„Schon, aber was soll ich denn machen, wenn du mir nicht aushilfst?“
Rolf liess sich nicht einfach unter Druck setzen. Was würde sie denn tun, wenn jetzt nicht zufällig er da wäre? Sonst kam sie doch auch ohne ihn zu ihrem Geld.
„Auf das Kokain verzichten, lass es einfach bleiben.“
„Das kann ich nicht, ich will mein Leben jetzt noch ein wenig geniessen.“
Das war nun ein Argument, mit dem Rolf nicht klar kam. Falls sie wirklich unheilbar Krebs hatte, wer wollte ihr das Kokain verargen, ihr als einer todgeweihten Frau? Nach Rolfs eigener Weltanschauung begann das normale Sterben bereits mit der Geburt, er selber verkündete bei Gelegenheit, Geburt und Tod bedingten sich gegenseitig, seien bloss zwei verschiedene Ausdrücke eines einzigen Impulses, sonst wäre, folgerichtig, aber unvorstellbar, das Leben dazwischen die tödlichste aller Krankheiten. Wo sollte er jetzt seine Grenze setzen zwischen normal und ihrem wie einem letzten Wunsch klingenden Anliegen?
„Also gut, Trix, damit du mich nicht umsonst angerufen und eingeladen hast, gebe ich dir ein klein wenig, aber nur ausnahmsweise.“
Kaum ausgesprochen, war Trix wie verwandelt. Gerade noch niedergeschlagen traurig, mit erschlaffenden Augenliedern, die manchmal halb geschlossen waren, und dann, schlagartig überglücklich, mit funkelnden und wieder Lebenslust versprühenden Augen.
„Ehrlich, du gibst mir etwas?“
„Nur ausnahmsweise und einmalig, wie viel müsstest du denn zumindest haben?“
„Dreissig Franken, mit vierzig hätte ich aber schon mehr davon.“
„Abgemacht, ich gebe dir vierzig. Trix, du solltest dich sehen können, wie du jetzt zu neuem Leben erwacht bist.“
„Das ist die Gier, jetzt hast du mich gierig gemacht, nun geht es mir wieder gut, ich ziehe mich gleich um, damit wir gehen können.“
Sie erinnerte Rolf an frühere Erlebnisse mit seinen Kindern, als diese noch klein waren und sich zwängend selber ins Elend steigern konnten, bis vom Vater, der Mutter oder sonst eben von anderen die Erlösung kam. Drogenabhängige verhalten sich manchmal, wenn sie Geld wollen, ähnlich wie kleine Kinder, die trotzen und zwängen.
Kurz bevor sie gingen, nahm Trix aus dem Kleinmöbel neben ihrem Bett noch Tabletten, welche sie trocken schluckte. Rolf sah, nebst anderen, eine Grosspackung des Barbiturats Revonal, einem starken Betäubungsmittel.
„Wozu nimmst du denn diese Medikamente?“
„Ich habe Krebs, aber das habe ich dir doch gesagt, dass ich Blutkrebs hätte?“
„Mag sein. Hat man Leukämie nicht jünger als du bist?“
„Auch Erwachsene können das, wie ich, plötzlich bekommen.“
„Seit wann hast du das denn schon?“
„Ich weiss es seit acht Jahren, aber erst seit kurzem wird es immer schlimmer.“
„Ich bewundere dich, wie locker du damit umgehen kannst, wo du diese Kraft her hast, bist du in Behandlung?“
„Ja, ich bin manchmal im Light House, danach geht es mir jeweils wieder besser, letzte Woche hätte ich wieder hin sollen, zu meinem Arzt, Ruedi Lüthy, aber ich mochte nicht. Ich bin vielleicht ein bisschen stärker als viele andere, aber mehrheitlich geht es mir schon schlecht. Oft, wenn ich spüre, wie mich der Krebs auffrisst, dann möchte ich einfach nicht mehr leben.“
Rolf wollte ihre Vorfreude über den Kokainkonsum nicht noch mehr stören und verzichtete darauf, sie jetzt in eine Diskussion über Aids und Sterben zu verwickeln. Das Light House, welches sie erwähnte, war eine private Trägerschaft, die an der Carmenstrasse sechzehn Einzelzimmer für kranke Aidsinfizierte, aber auch für Krebskranke, anbot. Es war eigentlich kein Spital, sondern ein Sterbehospiz. Bis im Jahre 1986, als der Kanton Zürich das Spritzenabgabeverbot aufhob, waren die Nadeln in der Szene Mangelware und wurden unter den Fixern getauscht, beste Voraussetzungen, um durch den direkten Blutkontakt nebst anderem auch das Aids-Virus zu übertragen. Auf der Gasse selbst wurde Aids erst ab 1987 zum Thema, für viele Drogenabhängige, aber auch für viele Freier, zu spät.
Trix nahm ihre beiden Lieblinge mit. Rolf fuhr sie an die Langstrasse und parkierte an der Neugasse, wo er zusammen mit ihren Hunden auf ihre Rückkehr warten sollte.
„Schön brav warten, Schätzeli“, sagte sie ihnen zum Abschied
„Sicher. Aha, du meinst gar nicht mich?“, scherzte Rolf.
„Aber du wartest ganz sicher?“
„Muss ja wohl, mit deinen Hunden, oder meinst du, ich würde sie da vorne im chinesischen Restaurant verkaufen, die Chinesen essen doch Hunde, oder?“
„Du bist aber gemein“.
Sie lachte trotzdem. Da sass nun Rolf, der von Hunden keine Ahnung hatte, mit den beiden im Auto und musste warten. Die Tibetaner verhielten sich zum Glück für ihn aber eher wie Hauskatzen. Einer krüllte sich am Boden zu einem Knäuel zusammen, der andere platzierte sich auf der Ablage hinter dem Rücksitz. Gismo kam einmal zu seinem Oberschenkel und wollte zwischen diesem und dem Steuerrad auf seinen Schoss klettern, was er aber ablehnte, indem er seinen Arm dazwischen hielt. Er überlegte sich, ob er wohl mit den Tierchen sprechen sollte. Aber was denn? Die hatten ihm ja scheinbar auch nichts zu sagen, und so liess er das bleiben. Nach vielleicht zehn Minuten kam Trix mit einem Mini-Grip zurück. Weil sie gerannt war, kriegte sie nun fast keine Luft mehr zum Atmen, wegen ihrem Asthma. Auf dem Rückweg nach Hause sah sie das Plastik-Säckchen mit dem weissen Pulver mehrmals an, schüttelte es dabei durch und sinnierte, hoffentlich sei das gute Ware, sie habe den Verkäufer nicht gekannt. Rolf durfte diesmal von nahe, neben ihr auf dem Bettrand sitzend, zusehen, wie sie sich die Spritze machte. Es war das gleiche Ritual wie letztes Mal. Wie er erwartet hatte, verspürte sie von der geringen Menge kein richtiges Flash, sie sagte, es wirke zu wenig, aber immerhin, nun könne sie in Ruhe weiter schauen, sie werde telefonieren, ob sie irgendjemanden erreichen könnte, der ihr helfen würde. Es war inzwischen bald zehn Uhr geworden und Rolf verabschiedete sich, um endlich mit seiner Arbeit als Taxifahrer beginnen zu können.
In der gleichen Nacht rief Trix ihn um vier Uhr morgens wieder an und fragte, ob er vorbeikommen könnte. Sie müsse nochmals hinaus, sie brauche noch etwas, ob er sie zur Langstrasse bringen könnte. Ihre beiden Hündchen liess sie in der Wohnung, die würden jetzt schlafen. Hinter dem Hotel Gregory, an der Neufrankengasse, liess sie Rolf warten, sie gehe sich nur schnell umschauen, ob jemand da wäre, den sie kennen würde, wenn nicht, käme sie gleich wieder. Ihm war nie ganz wohl in dieser Umgebung des Drogenhandels, er vermutete überall versteckte Überwachungs-Kameras der Polizei. Das Taxischild hatte er im Kofferraum deponiert, und trotzdem, immerhin fuhr er hier mit einer Drogenabhängigen vor und wartete auf ihre Rückkehr. Ein paar Minuten später kam sie auch schon zurück und setzte sich zu ihm ins Auto, ganz aufgeregt, als ob sie gute Neuigkeiten hätte, sie erzählte, da vorne habe einer ein selten gutes Super-Kola, ob er ihr nicht rasch fünfzig Franken ausleihen könnte, damit sie diesen Gelegenheitskauf nicht verpassen würde. Rolf sagte nichts, bewegte nur seinen Kopf verneinend langsam hin und her.
„Bitte, bitte, bitte, nur fünfzig, bitte, bitte, bitte.“
Bettelte sie und unterstrich ihre Dankbarkeit durch ein, mit einem spitzigen Mündchen angedeuteten, Küsschen aus der Ferne. Sie kann das überwältigend gut, Mimik und Gestik stimmten perfekt überein.
„Hör doch auf, Trix, warum sollte ich dir einfach so Geld geben?“
Sie zögerte einen Moment, und dann, ganz leise flüsternd, bot sie sich ihm an.
„Ich kann dir dafür schon etwas machen, wenn du willst.“
„Du hast doch gesagt, es würde dich ekeln mit fremden Männern?“
„Schon, aber dich kenne ich nun, mit dir würde es mir nichts ausmachen.“
Rolf wollte sie nicht verletzen durch seine Ablehnung.
„Mir auch nicht, glaub mir, aber ich bin kein Freier.“
„Dann muss ich eben schauen, ob ich sonst jemanden finde.“
„Schon, es tut mir leid, Trix, ich kann das nicht, komm, ich fahr dich nach Hause, das ist doch viel gescheiter.“
„Nein, das kann ich nicht, ich brauche jetzt etwas, kannst du mir wirklich nichts geben? Du hast doch genug und ich habe nichts.“
„Nein Trix, wenn ich irgendetwas Kluges für dich tun kann, sofort, aber einfach nur Geld für Drogen, das mache ich nicht.“
„Dann muss ich eben doch anschaffen gehen.“
„Wirklich? Hast du keine Bedenken, wegen ansteckenden Krankheiten und so?“
„Ich mache keinen Verkehr, nur französisch und nur mit Gummi, für hundert Franken.“
Das kann sie vergessen, dachte Rolf für sich, er kannte den Drogenstrich, dort kommt zu ihrer eigenen Gier noch die andere Gier der Männer dazu. Sie weinte inzwischen leise in sich hinein. Rolf legte seine Hand auf die ihre, ertastete ihre Finger und sie hielten sich gegenseitig, fest.
„Ich kann dir nicht helfen, soll ich dich noch nach vorne zum Limmatplatz fahren?“
Sie nickte bloss und schluchzte nun wirklich. Rolf fuhr mit ihr an den Limmatplatz. Es war schon so, in ihrer endlosen Gier wollte sie nun anschaffen gehen, einen Freier suchen, krank und schwach, wie sie war. Sie stieg aus, die Enttäuschung war ihr anzusehen, und doch, sie sagte zu Rolf, ihre Tränen abwischend, er solle sie mal anrufen, das würde sie freuen. Und dann winkte sie ihm auch noch, als er wegfuhr. Rolf hat sie nie angerufen und auf seinem Handy ihre Nummer blockiert.
Trix war in der Folge ab und zu auf dem Drogenstrich zu sehen, aber eher selten, nur sporadisch. Rolf sah sie manchmal im Vorbeifahren, ohne dass sie ihn bemerkte, und registrierte, wie sie anfänglich gegen zwei Stunden unterwegs war, bis sie Erfolg hatte, was nur mit einem hohen Preis erklärbar ist, da sie für einen älteren Mann ohnehin eine attraktive junge Frau darstellte. Doch auch Trix passte sich rasch an. Eines Nachts kam sie überraschend um eine Hausecke und setzte sich, vor Freude strahlend, zu Rolf in den wartenden Taxi, um ihm zu erzählen, jetzt hätte sie in einer Stunde hundertfünfzig Franken gemacht, das sei doch gut, oder? Was sie denn dafür gemacht habe, wollte Rolf wissen. Alles, das könne er sich doch denken. Nein, sie solle etwas deutlicher werden. Sie schilderte Rolf freizügig, zuerst habe sie einen jüngeren Freak gehabt, der kiffte, bei lauter Musik im Auto für fünfzig Franken oral. Sie mache das jetzt nur noch ohne Gummi, weil sie vom Geschmack der Präservative so etwas wie eine Schlucksperre bekomme. Dann habe sie mit einem sehr gepflegten Herrn, René heisse er, für hundert Franken Verkehr gehabt im Auto. Der habe ihr seine Visitenkarte gegeben und möchte mit ihr zusammen die kommenden Festtage verbringen, er wäre auch allein wie sie, den werde sie bei Gelegenheit von zu Hause aus anrufen.
Das hörte sich nun schon nach dem vermeintlich grossen Geschäft an, das zur Finanzierung einer Kokain-Abhängigkeit aber unabdingbar von Nöten ist. Als ob Rolf ihr Vater wäre, fragte ihn Trix, allerdings sein gar nicht erforderliches Einverständnis in der Tonlage bereits berücksichtigend, nun dürfe sie doch schon Kokain kaufen für hundert Franken, fünfzig werde sie aber behalten für Haushalteinkäufe. Rolf musterte sie lange von der Seite, weil er den Eindruck hatte, sie wäre jetzt, zehn Minuten nach dem Kontakt mit einem Freier, wie verwandelt. Sie wirkte zufrieden, ein bisschen selbstgefällig verträumt und strahlte eine anziehend feminine Aura aus, die ihr sonst eher fehlte. Geld haben oder nicht – das macht hier den Unterschied.

Mit den Angaben aus dem Staatsarchiv Zürich, welches ich mehrmals besuchte und den Rückmeldungen der von mir angeschriebenen Verwandtschaft erstellte ich eine Genealogie der Familien von mir und meiner Frau. Dazu kam später noch meine Webseite, seit 2020 auf rolfpfischter.ch.
Mit Büchern aus der Pestalozzi-Leih-Bibliothek, nebst den in Buchhandlungen gekauften, erweiterte ich mein Wissen über die verschiedenen alten Kultur-Geschichten. Sumerer, Phönizier, Ägypter, Griechen, Goten, Römer, Germanen, Kelten und so weiter, und so fort. Vergleichende Religions-Wissenschaft kam hinzu, die Bibel wurde am Computer nach Stichworten durchforstet.

Inspiriert durch ein Bild meines Onkels Eugen Gideon Roth, 1898-1965, Kunstmaler in Einsiedeln, verfasste ich in einem ersten Schritt bis 1997 meine persönliche, nur für mich gültige Moral und Ethik.
Durch das selbständige Studium der keltischen Kultur fand ich die Logik der Dreieinigkeit (Polarität, im Zentrum steht die Sache zwischen zwei sich gegenseitig bedingenden Polen). Dadurch konnte ich endlich das akademisch gelehrte, duale Denkschema des ausgeschlossenen Dritten überwinden (entweder-oder, ja-nein, 0-1 der Computer-Sprachen) und selber denken ohne Bezug auf irgendeine philosophische, religiöse oder ideologische Einbildung nehmen zu müssen.
Danach kribbelte das Raum-Zeit-Kontinuum von Albert Einstein wie ein Gedankenblitz durch den Kopf: Der Raum, das ist der nicht mehr messbare Moment von zeitloser Gegenwart, mein Dasein, verbunden mit der messbaren Zeit als Vergangenheit und Zukunft.
So einfach ist das Verständnis der Welt, ohne Philosophie und ohne Religion, wäre ich nicht als junger Mensch in meiner Zeit der obligatorischen Volksschule falsch oder unvollständig informiert und gelehrt worden. Bis heute befasse ich mich mit Sprachkritik auf meiner Webseite rolfpfischter.ch nebst der keltischen Kultur. Letztes Jahr (2019) wurden bei 114'721 Zugriffen 55'672 Seiten besucht.
Vieles, was sich über die Jahrzehnte hinweg schemenhaft abzeichnete, wurde altershalber unausweichlich deutlich. Auch ich war jetzt seit einigen Jahren ein Mann über Vierzig, der mit erschreckender Ohnmacht akzeptieren musste, wie sich seine einst selbstverständliche Männerwelt veränderte. Vielleicht haben einige etwas mehr, andere etwas weniger Mühe damit, ich gehörte gewiss zu den Ersteren. Nicht genug damit, wenn jüngere Mitmenschen noch Geräusche wahrnahmen, welche ich nicht mehr hören konnte. Immer öfter verlangte ich die Wiederholung von bereits Gesagtem, weil meine Ohren schlicht nicht verstanden hatten. Ein Hörgerät war zwar noch lange nicht nötig, aber die Sinnesorgane vermittelten, anfänglich kaum wahrnehmbar, ein von Jahr zu Jahr unschärferes Bild der Umwelt. Beim Lesen zog ich irgendwann zum ersten Mal die seit fünfundzwanzig Jahren, mehrmals angepasst, für die Ferne geschliffene Sehbrille ab, damit meine müden Augen auch den klein gedruckten Text deutlich sahen. Trinken und Essen wollten bewusst an das Stoffwechselsystem des Körpers angepasst werden. Vielleicht eine letzte Gelegenheit, dem über die Zeiten langsam, aber sicher, angestiegenen Übergewicht obere Grenzwerte zu setzen. Hoher Blutdruck und erste Herzrhythmus-Störungen blieben durch Mistel-Tee und Maiglöckchen-Tropfen vorerst erträglich, selbst bei weiterhin anhaltend hohem Nikotinkonsum.
Die Kinder wurden volljährig, waren dazu schon teilweise erwachsen. Vater zu werden war nicht schwer, schwanger wurde die Mutter, kaum hatte sie dem beider Wunsch nach Kindern entsprechend, die Antibabypille abgesetzt. Vater sein war dann eigentlich auch nicht schwer. Mit seiner starken Frau bei den Kindern im gemeinsamen Haushalt rückblickend fast keine Probleme. Immer war irgendetwas, ist ja klar, aber Probleme? Nein. Für meine Ehefrau war die Anforderung an Mutter, Hausfrau und Geliebte über all die Jahre eine Vollzeitarbeit, die keine Möglichkeiten zum Geld verdienen offen liess. Und für mich war es immer eine Ehrensache, mindestens so viel Geld nach Hause zu bringen, damit alles Notwendige und auch Überflüssiges bezahlt werden konnte.
Autonom hatte die Frau den Haushalt geregelt, auch die Finanzen verwaltet. Nach einundzwanzig Jahren Selbständigkeit und Unabhängigkeit hatte die Familie keinen Franken Schuld offenstehend. Die traditionellen Rollen von Vater und Mutter einfach gelebt, Tag für Tag. Nicht hinterfragend gespielt oder spielerisch geplant, sondern sich gegenseitig als Frau und Mann zusammen weiter entwickelt. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, mit Höhepunkten und Rückschlägen. Für meine teilweise ergrauten Haare brauchte ich jedenfalls keine Sündenböcke, die daran schuld sein könnten. Zum Spass meinte ich höchstens manchmal, nach bald dreissig Jahren Geld verdienen hätte ich noch immer gleich viel, nämlich fast nichts.
Als meine beiden Söhne, 1999 waren sie 20 und 22 Jahre, nebst der Bedienung durch meine Frau zunehmend mir gegenüber respektlos wurden, führte ein Streit am Küchentisch wegen ihrem Umgang mit Freundinnen zum Eklat. Im sicheren Empfinden, für die beiden nur noch ein störender Faktor im Zusammenleben mit ihrer Mutter zu sein, erzwang ich ihren Umzug in eine eigene Wohnung, welche sie dann zusammen in der Nähe auch bezogen. Die Tochter mussten wir im 9. Schuljahr von der Schule nehmen wegen einer persönlichen Differenz mit ihrem Hauptlehrer, einem Quer eingestiegenen ehemaligen Flugbegleiter. Sie erhielt trotzdem problemlos eine Lehrstelle bei der Swisscom.
Mit zunehmendem Alter bemerkte ich dann gelegentlich, wie Andere begannen, sich mir gegenüber anders zu verhalten. Parallel zu meinem körperlichen Alterungsprozess schien ich auch anders auf andere zu wirken. Zuerst fiel mir auf, wie ich von jüngeren Erwachsenen immer seltener einfach geduzt wurde. Dann musste ich auch Blicke, Augenblicke, von Frauen erwidern und verarbeiten, die mir bislang fremd waren. Es waren nicht einfach die anzüglichen Blicke wie die von etwa gleichaltrigen oder älteren Frauen, die mir auch schon schöne Augen machten. Nein, die kannte ich und wusste als treuer Ehemann gut damit umzugehen.
Nun war es ein kurzes Aufblitzen. Sekundenbruchteile, aber wie verschmelzend eingebrannt, lange anhaltend. Sonderbar, so wie ein Hauch von Sehnsucht. Faszinierend und ergreifend. Eine unsichtbare Verbindung, sogar Pupillen-Grösse für einen Moment beeinflussend. Ich führte Versuche durch, um abzuklären, ob ich mir das alles nur einbildete. Doch ich konnte schauen wie ich wollte, nichts war mehr wie früher. Aber was genau war das denn? Wird die Lebenserfahrung irgendwann für andere spürbar durch die zwanzig und mehr Jahre Unterschied? In jungen Jahren konnte ich am Arbeitsplatz neidisch beobachten, wie der ältere, grau melierte Herr locker und ungezwungen den Umgang mit jüngeren Kolleginnen findet, als wären da Signale zwischen dem gesetzteren Herrn und der jungen Frau, die bei jüngeren Männern aber als billige Anmache ablehnt wurden.
Das für mich als Mann unbekannte Wesen der Frau. Erst selber damit konfrontiert, von jüngeren Frauen als offenbar väterlicher Typ beachtet zu werden, wurde ich mir 45-jährig auch dessen bewusst. Bloss, was wollen mit achtzehn Jahren volljährige Mädchen, nun Frauen, noch mit einem Vater? Wozu taugt ältere Mann noch, wann ist Mann überhaupt alt? Vielleicht verleitet die Standard-Floskel zu trügerischem Wahnwitz, man sei stets so alt, wie man sich fühlt. Früher hiess es, was einer bis Dreissig nicht kann, lernt er nimmermehr. Trau keinem über Dreissig, war dann ein Spruch der 68er-Bewegung vor dreissig Jahren. Und jetzt sind diese Jahrgänge für die Jüngeren selber zu Alten geworden.
Ältere Männer und jüngere Frauen, ungezählt als Kundschaft im Taxi miterlebt, jedoch gar nie so richtig wahrgenommen. Die Realitätswahrnehmung. In dieser Kultur konnte eine professionelle Szene die Generationen der älteren Männer gnadenlos abkassieren. Nicht gleichbleibend oder abnehmend, sondern zunehmend. Früher, als Mann in den besten Jahren, meinte auch ich, das hätte bloss mit Charakter und Persönlichkeit zu tun. Doch das ist scheinbar nur die eine Seite. Klar brauchte es im Rotlicht-Milieu ebenso wie am Drogenstrich schliesslich dann noch den Idioten zum geschädigten Freier oder zumindest gewisse Ansätze dazu, doch die Triebfeder schien mir etwas Angeborenes zu sein. Und tabu. Vor allem die Prostitution junger Frauen war ein ganz spezielles Tabu, weil es sich dabei teilweise auch um eine unverdächtige Schnittstelle zwischen Kultur und Subkultur handelte. Und diese wiederum wurde für mich als Taxifahrer durch die Tätigkeit bedingt ein Fenster in zwei verschiedene Welten. Tabu ist nicht einfach alles, worüber allgemein nicht gesprochen wird, sondern setzt die persönliche Betroffenheit in einem sozialen Umfeld voraus. Es sind sozusagen die Urgesetze der Menschen, die so genannten ungeschriebenen Gesetze. Für deren Verletzung bestraft kein Richter, sondern die Handlung selbst. Mit Leid und Elend. Selbsttötung. Krankheiten. Gedanklichem Unvermögen. Verlust von geschätzten und geliebten Werten.
Mein Kontakt als nur an Information interessierter Nicht-Freier wandelte sich unmerklich zum Möchtegern-Freier. Schon seit Wochen aufgefallen war mir am Drogenstrich eine junge Frau um zwanzig durch ihren stolzen Gang. Sie war gross und sehr schlank, trug stets enge, hellblaue Jeans, weisse Raver-Turnschuhe mit dicken Sohlen und ging damit in dem für die Technoszene der Neunzigerjahre typischen, rhythmisch eleganten Takt. Die Haare kurz und hell gebleicht, oft mit einem modischen Stirnband verziert. Fast jede Nacht wartete sie an der gleichen Ecke auf Kundschaft, ruhig lehnte sie mit abwesend traurigem Gesichtsausdruck an der Mauer und rauchte Zigaretten. Ich musste wegen der Verkehrsführung um den gesperrten Limmatplatz oft um diese Ecke kurven.
Die Frau zog mich magisch an. Mehrfach spielte ich mit dem Gedanken, bei ihr anzuhalten und sie anzusprechen. Einfach so, um mal zu erleben, was sowieso alle älteren Männer täten oder doch nicht. Selber jenes zu tun, was angeblich nur die anderen machen. Die Ehefrauen oder Partnerinnen wollen nicht wissen. Nein, meiner sicher nicht. Vor zehn Jahren war ich als eines der jüngsten Mitglieder im Männerchor und hatte miterlebt, wie einige der älteren Sänger ab und zu erst nach der Gesangprobe zu uns stiessen beim gemütlichen Teil im Restaurant, damit sie noch schnell auf dem Weg nach Hause ein Alibi hatten. Mich hatte das wie die anderen nicht gestört, Männer lassen sich leben, das muss jeder für sich selber wissen, was er tut oder nicht. Frauen, wird gesagt, neigen eher dazu, sich selber zu fragen, was sie wohl falsch machen würden oder was andere besser können als sie selber.
Bei mir ging es aber nie um Beziehung. Meine Frau und ich hatten uns nach 22 Ehejahren nicht bloss gern, nein, wir liebten uns noch immer, pflegten einen anständigen und respektvollen Umgang, was sich bereits in der gegenseitigen Wortwahl ausdrückte und praktizierten einen schönen Körper-Kontakt, bei dem beide voll auf ihren Genuss kamen. Es bestand für mich überhaupt kein ersichtlicher Anlass, warum ich nun plötzlich von diesem eigenartigen Trieb befallen wurde, der sich von Tag zu Tag mehr zu einer treibenden Kraft entwickelte. Sollte ich mich auch einmal als Freier versuchen oder nicht? Wenn es wirklich alle Männer tun, wie man angeblich sagt, wäre ich der einzige, der das nicht macht. Doch ich liebte meine Frau, wir vertrauten uns und ich wollte ihr keinesfalls untreu werden. Würde ich überhaupt untreu, wenn ich dafür bezahle? Ich wurde hin und her gerissen zwischen meinem Gewissen und dem Reiz.
Notizen zum Drogen-Selbstversuch

Drogensucht war in den 90er-Jahren für die Allermeisten ein stellvertretendes Thema. Man redete mit und mischte sich ein, auch wenn man fast überhaupt nichts wusste und bildete sich darauf womöglich noch viel ein. Man hatte ja so keine Ahnung. Heroinsucht ist, im Gegensatz etwa zum Alkoholismus, der mit einem Toleranzbruch endet, keine Krankheit und schon gar keine Geisteskrankheit, sondern lediglich die durch Süchtige nicht mehr wahrnehmbare körperliche Abhängigkeit. Diese Sucht wäre strikt zu trennen von den vorher oder nachher möglicherweise bestehenden Mängel oder Defekten sozialer oder psychischer Art.
Vielleicht schon der Erstkontakt mit Heroin, also auch ein neugieriges probieren, kann den Körper verändern, unwiderruflich. Die nicht mehr wahrnehmbare Abhängigkeit setzt bei dieser Substanz unmittelbar ein und verlangt nach erneutem Konsum. Mit Heroin entsteht ein Gefühl von gleichzeitigem Schlaf- und Wach-Zustand. Eine Reise ins unendlich Endlose, verbunden mit einem sich selber auflösen durch ein seliges wegdösen, wie man das beim Einschlafen einen Sekunden-Bruchteil vor dem Schlaf erahnen könnte. Beim Kokain macht, nebst der entrückenden Ekstase, ein unwiderstehlich geiler Geschmack gierig und will unbedingt nochmals geküsst werden. Wieder und immer wieder, man kann damit gar nicht mehr aufhören, bis man keines mehr hat davon. Dabei entsteht aber keine körperliche Abhängigkeit.
Als Taxifahrer hatte Rolf kein Problem, für seinen Selbst-Versuch an den Stoff zu kommen, den Drogenhändlern war noch so recht, eine Taxifahrt statt mit Geld durch Ware bezahlen zu können. Rolf schnupfte nur, hatte nie gespritzt. Es gibt wohl nichts Ekelhafteres als Heroin, das ist zum Kotzen grausig, das ist Sterben pur, mindestens der Anfang davon. Die erstmaligen Abwehrreflexe des Körpers, der sich schwallartig erbrechend verweigert, die hat man später nicht mehr, selbst wenn man zeitliche Abstände von mehreren Wochen einhält und dadurch nach jedem Konsum auf den Entzug kommt. Aber jedes Mal beginnt nach ungefähr acht Stunden das schiere Elend, zuerst hört man bloss Flüssigkeiten in sich glucksen und strömen, dann rumort der Magen, die Nieren ziehen am Rücken, die Muskulatur ist ein wenig verspannt. Es sind Schmerzen, die nicht eigentlich weh tun, ausser den Krämpfen, aber sie sind äusserst unangenehm. Zu diesen Leiden gesellt sich ein anhaltendes Schwindelgefühl ohne Gleichgewichts-Störungen, welches für die nächsten paar Stunden wiederholt zum Hinlegen zwingt. Danach bleibt ein Befinden wie bei einem Kater nach einem Alkoholexzess. Doch schon ein paar Stunden später, der Ekel des Elends ist noch frisch präsent, meldet sich im Speichel ein Geschmack der Erinnerung. Man merkt dies immer wieder, während mehrerer Tage, braucht bloss seine Lippen zu lecken, um erneut vom Geschmack dieser quälenden Sehnsucht geküsst zu werden.
Dann hat man Angst und Lust zugleich. Diese Gewissheit, auf der einen Seite der Horror danach, auf der anderen Seite die Gefühle hier und jetzt, lässt keine Wahl offen, ob man schöngeistig wie in einem Balanceakt in der Mitte bleiben wolle. Im selben Moment, in dem der Körper erstmals vom Heroin durchgeschüttelt wird, ist alles lediglich noch eine Frage der zeitlichen Abstände. Man kennt die Gratwanderung mit der Zeit blindlings, sowohl festen als auch taumelnden Schrittes. Hat schon Glück gehabt, sogar Abstürze unbeschadet zu überleben, die man als unbewusste Selbsttötungs-Versuche bezeichnen könnte.
Auch bei Rolf hatte die Kokain-Heroin-Kombination, welche er auf seine Bitte hin von Susanne erhalten hatte, eine verheerende Wirkung. Bereits wenige Sekunden nach dem hoch ziehen in die oberen Nasenhöhlen kräuselten sich beiderseits der Schläfen zu den Ohren hin elektrisierende Impulse, lähmend, aber äusserst angenehm, welche sich bis zur Mitte der Schädeldecke zu einem lieblich kitzelnden Flirren verstärkten, wodurch das Bewusstsein entrückt wird, man befindet sich mit offenen Augen in einem absoluten Nichts, welches gleichzeitig allumfassend ist, bis dann von den kribbelnden Fingerspitzen eine wohlige Wärme ausgeht und bald sanfte Wellen den Körper pulsierend durchströmen, warm erglühend, unendlich anhaltend, konstant beglückend, ähnlich einem Orgasmus, aber wieder und immer wieder, fluten diese aufwallenden Wogen unaufhaltsam dahin.
Danach kommt die Versuchung der Wiederholung. Schliesslich gibt man sich endlich auch mit weniger zufrieden, die Abhängigkeit ist da und einfach von selber aufhören geht nicht mehr. Alle Drogenkonsumenten behaupten zwar, kein Problem, ich habe das unter Kontrolle, ich könnte jederzeit damit aufhören. Und das ist nicht mal gelogen, man meint das wirklich, weil die Abhängigkeit nicht wahrnehmbar ist.
So hat Rolf mit seinem Selbst-Versuch noch weiter gemacht, als der Punkt zum Abbruch längst überschritten war. Schon vom ersten Moment an kann man auch nicht mehr zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden, wahr ist nur noch das, was man selber denkt und sagt, und sei dies noch so an den Haaren herbeigezogen. Man behauptet, nichts genommen zu haben, als ob man einem das nicht ansehen würde. Die Bewegungen, die Redensart, der Tonfall, die Pupillen bei Kokain tellergross, bei Heroin stecknadelklein, man bräuchte gar nichts mehr zu sagen. Ein auswegloser Kampf beginnt mit Ausreden und Versprechen, endlos, es wiederholt sich immer wieder, bis sich die Belogenen schliesslich enttäuscht abwenden. Auch Trudi hatte anfangs noch oft mit Rolf geredet, ihm gedroht, sie würde ihn anzeigen, die Scheidung einreichen, liess sich hoch und heilig versprechen, er würde nun nie mehr etwas nehmen.
Wer will behaupten, Heroinkonsum sei bloss ein Vergnügen von jenen mit einem schwachen Willen? Sicher nicht, man sagt das allen, die es wissen wollen, man schreit das aus sich heraus, wie einen das ekelt, schon der blosse Gedanke an das danach, was man ersehnte, schüttelt einen durch. Dann kommt zum schlechten Gewissen die Angst. Manchmal, spürt man den Gedanken, der einen fast zerreisst, irgendwo versteckt in der Sehnsucht, so unheimlich gewiss, den rationalen Kampf gegen die Drogen mit der Selbstaufgabe und dem Tod, schlussendlich doch, todsicher, zu verlieren. Das Sterben ist ja so gewiss, das glaubt gar niemand. Es ist alles lediglich eine Frage der Zeit, der zeitlichen Abstände, wieweit ein Raum bleibt, nicht schon morgen, sondern erst übermorgen zu sterben. Heute noch nicht, das ist der Raum.
Im Januar 2000 nahm Rolf im Alter von 47 Jahren nach einem erneuten Exzess, wodurch er einmal mehr gegen seine Abmachung mit seiner Frau verstiess, eine tödliche Überdosis Heroin und schlief zu Hause in seinem Bett friedlich ein, er wollte schlafen, einfach nur noch für immer schlafen.

So eindrücklich und nachhaltig dieses Erlebnis auch wirkt, eine Einbildung in Form von Halluzination kann ich dennoch nicht ausschliessen.
Was war geschehen? Zufällig besuchte an jenem Abend mein ältester Sohn mit Freundin seine Mutter. Meine Frau liess mich gewöhnlich liegen bis ich von selbst erwachte, sie sagt, sie hätte mich liegen lassen. Als ich aber mehrere Stunden überfällig war, schaute die Bekannte nach, sah den Speichel-Ausfluss und erkannte die Bewusstlosigkeit. Die Sanität wurde gerufen, ein Notfallarzt kam dazu, zuletzt noch ein dritter Krankenwagen mit einem Beatmungs-Gerät. Nach anderthalb Stunden Reanimation war ich zum Transport fähig und kam bewusstlos in die Klinik, wo ich noch eine Woche lang in einem künstlichen Koma gehalten wurde. Ich hätte nur Dank einem extrem starken Herz überlebt, so die Auskunft vom behandelnden Arzt. Nach weiteren drei Wochen wurde ich in die Psychiatrische Universität-Klinik verlegt. Erst dort begann mit hoch dosiertem Vitamin B die Wiederherstellung meiner geschädigten Nervenbahnen. Mir waren elementarste Eigenschaften abhanden gekommen wie Durst- und Hunger-Gefühl, Kleider anziehen, eigenen Schlafplatz im Zimmer finden, schreiben und dergleichen mehr.
Zu Hause erhielten meine Frau mit der Tochter vielfältigen Beistand, vor allem durch einen Schwager, welcher ihr ehemaliger Schulfreund war. Von meinem jüngeren Sohn wurde zusammen mit einem Kollegen das Passwort geknackt zu meinen Notizen im Computer. Ich hatte viel geschrieben, manches auch schon literarisch ausgearbeitet. Diese Aufzeichnungen waren für Unbefugte weder gedacht noch verständlich und wurden prompt als reales persönliches Tagebuch missverstanden. Meine Frau reichte die Ehe-Scheidung ein, zog diese aber, mir zum Glück, wieder zurück nachdem ich zur gerichtlichen Vorladung vom Oberarzt als verhandlungsunfähig erklärt worden bin.
Meine Genesung schritt rasch voran. Ohne Teilnahme an einer Therapie in der geschlossenen Abteilung verbrachte ich meine Zeit vorwiegend mit Lesen, an den Sportgeräten und mit anderen im Gemeinschaftsraum. Dazu hatte ich oft Besuch, abwechselnd meine Frau oder meine Mutter. Nach zwei Monaten meinte der Oberarzt bei einem Beurteilungs-Gespräch, ich wäre für sie ein Mysterium. Den Austritts-Test bei einem externen Professor hätte ich, sagte dieser, besser bestanden als manche Gesunde die zu ihm kämen. Mitte April, drei Monate nach der Überdosis, war ich wieder vollständig gesund, wurde von meiner Frau abgeholt und zusammen kehrten wir in unsere Wohnung zurück.
Die anschliessend beidseits gewollte, liebvolle Vereinigung war der Beginn für meinen zweiten Frühling zusammen mit der Ehefrau, vorerst aber schliefen wir in getrennten Schlafzimmern. Unser Neustart begann sozusagen wieder bei null. Meine Frau hatte schon während meinem Aufenthalt in der Klinik eine Anstellung gefunden als Degustantin in der Globus-Gourmessa. Dieser Wiedereinstieg ins Berufsleben führte sie später zum Globus-Kundendienst, wo sie bis zur Pensionierung eine langjährige Mitarbeiterin wurde.
Ich war zwar noch Taxihalter mit den Bewilligungen für zwei selbständige Mitarbeiter, meine eigenen Autos aber waren verkauft. Ich hatte bloss noch meinen Führerschein, welcher mir vom Oberarzt bewusst belassen worden war. Nach 23-jähriger Selbständigkeit musste ich nun eine bezahlte Arbeit suchen. Dank Beziehung, der Direktor einer Taxizentrale war mein früherer Direktor beim Transport-Taxi, konnte ich schon zwei Monate später eine Stelle antreten in der Disposition bei der Rufnummer Taxi444. Mit unserem Einkommen als Doppel-Verdiener war die Welt rasch wieder in Ordnung.
Nach einem Jahr fragte meine Frau, ob ich nicht wieder Taxi fahren wolle, sie hätte den Eindruck, ich wäre todunglücklich in meiner Tätigkeit. Noch so gerne rüstete ich einen neuen Toyota Camry zum Taxi aus, änderte den Vollzeit-Arbeitsvertrag zur Teilzeit auf Abruf und begann wieder selbständig mit Taxi ohne Funk-Anschluss. Ich arbeitete nachts, meine Frau tagsüber.
Aus Gesprächen an Taxi-Standplätzen mit Kollegen entwickelte sich zu Dritt die Gründung vom Taxiverband Zürich. Ich übernahm den Aktuar für alles Administrative und erstellte eine Webseite für den Verein, nachdem ich mir autodidaktisch die Programmierung mit HTML angeeignet hatte. Dazu übernahm ich später während vier Jahren den Präsidenten vom Verband unabhängiger Taxihalter. In dieser Funktion war ich auch Mitglied im Dachverband Stadtzürcher Taxigewerbe sowie in der städtischen Taxikommission vom Zürcher Stadtrat.
Mein Interesse galt nun vor allem dem Internet mit seinen Möglichkeiten und meiner informativen Webseite www.rolfpfischter.ch. Falls die Webseite einst nicht mehr aktiv ist, sie wurde archiviert bei https://archive.org/web/


Die Baugenossenschaft ersetzte ihre Siedlung Zürich-Affoltern durch einen kompletten Neubau mit Minergie-Standard. Da unsere Wohnung in der 2. Etappe war, konnten wir 2010 direkt in eine 120 Meter entfernte neue Wohnung umziehen und unsere alten Räume ohne Reinigung verlassen. Wir mieteten 2½-Zimmer im Hochparterre mit Abendsonne, Wohnfläche 70² für monatlich 1160 Franken inklusive Nebenkosten, Bodenheizung und Glasfaser-Anschluss EWZ. Küche mit Glaskeramik-Kochfeld, Backofen, Kühlschrank, Tiefkühler, Abwaschmaschine, zusätzlich von uns Einbau-Steamer, Kaffeemaschine. Grosse Terrasse (24²) mit Zugang aus Wohnzimmer und Küche, Kellerabteil, Velo-Raum, Benutzung von Waschküche mit 2 Maschinen mit Tumbler sowie einem belüfteten Trocknungsraum. Wir kauften aber eine eigene Waschmaschine und Tumbler für den vorhandenen Anschluss im Badezimmer. Der Auto-Abstellplatz in der Tiefgarage kostete monatlich 145 Franken. Unser Anteilschein an der Genossenschaft, ein Wertpapier, musste nachzahlend erhöht werden auf neu 8000 Franken.
Getragen von unserer Absicht, zusammen alt zu werden, mieteten wir mit 2½ Zimmern die kleinste der möglichen Einheiten, barrierefrei, damit nach den Vermietungs-Bedingungen auch eine Person allein in der Wohnung verbleiben kann und nicht im Alter noch einmal umsiedeln muss wegen Unterbesetzung.
Durch ihre Tätigkeit im Globus-Kundendienst verlor meine Frau die Abneigung vor Computer-Bildschirm und Tastatur und konnte sich nun zu Hause selbständig im Internet bewegen. Von unseren Kindern erhielten wir deren ältere I-Phone-Modelle, wenn sie für sich ein neues Mobil-Telefon kauften. Ab 2008 waren wir beide Social-Media tauglich, mit eigenem Profil präsent auf Facebook, dazu später auch WhatsApp. Für Handy, Computer und Bancomat verwenden wir beide dasselbe Passwort. Wir nutzten auch die fortschreitende Online-Digitalisierung, wenn möglich, nach unserem Bedarf.
Nachdem 2015 meine Frau mit 64 pensioniert worden war, liess ich mich 2017 mit 64 vorzeitig ebenfalls pensionieren. Die von uns schon lange vertretene Meinung, bei gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsmitteln müssten AHV-Rentner nicht mehr zwingend Auto fahren, setzten wir in Tat um und verzichteten fortan auf den Besitz eines eigenen Fahrzeugs.
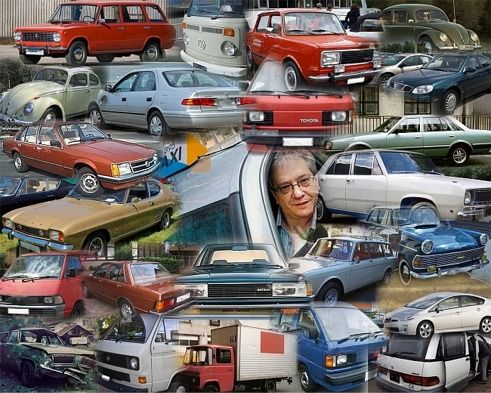
Als Kind etwa in der 4. Schulklasse begann ich mit dem Sammeln von Schweizer Briefmarken und behielt das bei bis heute mit einem PTT-Abonnement. Das Einordnen im selber erstellten Album verschob ich dann aber schon früh auf die Zeit nach meiner Pensionierung. Bloss, jetzt im Ruhestand habe ich irgendwie momentan kein Interesse mehr an meinen gelagerten Briefmarken.
Bereits die letzten drei gemeinsamen Ferien mit unseren Kindern verbrachten wir nicht mehr mit Zelt auf dem Campingplatz, sondern in einem Hotel in Lido di Jesolo. Seither buchen wir zu Zweit immer im gleichen Hotel Cambridge, direkt am Strand. Haupt-Kriterium unserer Wahl ist, nebst dem guten Essen in Halb-Pension, der grosse Pool mit Liegen, die fest reserviert werden können und mit 3 Euro pro Tag bezahlt werden müssen. Der Badebereich ist zum Strand mit Gitterstäben abgegrenzt und die Türe verschlossen. Am Strand sind die Liegen des Hotels kostenlos zur freien Verfügung, dort werden die vordersten Plätze ab 6 Uhr früh mit Tüchern besetzt. Zum Frühstück und Mittagessen sind wir im Freien am Pool. Abendessen im klimatisierten Speisesaal mit Bedienung, das Menü wird am Vortag aus einer reichen Auswahl von uns vorbestellt.
Ohne Auto reisen wir jetzt mit dem Flugzeug, SWISS Economy, Zürich - Venedig 60 Minuten Flug, retour mit Gepäck 150 Franken/Person und von dort mit dem Shuttle-Bus, 40 Minuten Fahrt für 6.70 Euro/Person mit Gepäck, nach Lido di Jesolo. Die Fahrt mit zwei Koffern zum Flughafen und zum Hotel im Taxi, in Zürich 50 Franken, in Jesolo 20 Euro pro Fahrt.
Wir reisen und reisten selten, auch jetzt im Ruhestand bleiben wir meistens in unserer Umgebung, also im Raum Zürich. Mehrmals waren wir jeweils 2 Nächte in Venedig, das Hotel möglichst nahe beim Markusplatz oder in Flims im Wellness-Hotel Adula. Einerseits mag meine Frau nicht lange am gleichen Platz sitzen, ich bin ohnehin am liebsten zu Hause und andererseits stören wir uns zunehmend an der multikulturellen Zusammensetzung und dem von uns als Belästigung empfundenen Geschwätz, oft fremdsprachig, mit oder ohne Handy, von Mitreisenden so nahe im gleichen Raum des öffentlichen Verkehrs. Nach Möglichkeit lösen wir darum einen 1. Klasse-Wechsel in der Bahn und meiden die städtischen Verkehrsbetriebe im Hochbetrieb.
Während der Sommer-Monate sind wir bei schönem Wetter fast täglich im öffentlichen Freibad am Katzensee zum Mittagessen am Kiosk und anschliessendem Schwimmen. Ausser an Wochenenden, da platzt der beliebte Ort aus allen Nähten durch zuviele Besucher. Die drei Kilometer Fussweg zurück dienen ebenfalls unserer körperlichen Ertüchtigung. Auf dem Hinweg nehmen wir den Bus, von der Endhaltestelle Mühlacker sind noch 800 Meter zu gehen.

Meine Frau und ich werden zusammen älter und haben beide kein Problem damit. Noch küssen und streicheln wir uns gerne. Jeden Morgen, wenn der oder die Zweite ebenfalls aufsteht, umarmen wir uns und bestätigen, dass wir uns lieb haben. Wir leben jetzt seit 44 Jahren zusammen und kennen einander in- und auswendig. Unsere sexuelle Partner-Aktivität ist schon seit Jahren sanft entschlafen. Als meine Frau keine Lust mehr hatte, meine Nähe zu suchen und mich nicht mehr kraulte im Schritt, liess ich sie einfach in Ruhe. Wenn sich beide Körper durch altern verändern, ist irgendwann auch mal gut in einer Ehe mit bis heute rund sechzehntausend gemeinsamen Nächten im gleichen Bett.
Bis heute ohne gesundheitliche Einschränkungen gehen wir auf die Siebzig zu. Meine Frau geht auch nach der Entfernung ihrer Gebärmutter, 2010 mit 59 wegen einem Myom, zur jährlichen frauenärztlichen Kontroll-Untersuchung und regelmässig zum Hausarzt für ihre Medikamente zur Regulierung des Blutdruckes. Ich nehme überhaupt keine Medikamente und gehe schon immer nie zum Arzt. Meine Frau setzt für meinen Blutdruck jeden Abend kalt eine Tasse Mistel-Tee an für den nächsten Morgen. Seit nunmehr 50 Jahren ziehe ich täglich den Nikotin-Rauch von bis zu zwei Packungen Zigaretten à zwanzig Stück in meine Lungenflügel und lese einigermassen amüsiert die neumodisch gesetzlich vorgeschriebene Warnung auf der Schachtel, das sei tödlich. Dem Alkohol sind wir beide nicht abgeneigt, wobei mir auch nichts fehlt, wenn ich diesen zeitweise nur jeden Sonntag oder gar nicht konsumiere.
Zurzeit sind wir beide gegen ein Leben im Altersheim, wir werden noch so lange wie möglich zusammen am jetzigen Ort verbleiben. Meine Frau wollte schon Mitglied werden bei der Sterbe-Organisation Exit, ich meinte, das wäre gar nicht nötig und erkundete mit Suchmaschinen im Internet die schmerzlosen Möglichkeiten zum selbst bestimmten Abgang ohne Bevormundung durch Ärzte, wie mit Kohlenmonoxid und dergleichen mehr. Nachdem meine Mutter mit 93, bereits bettlägerig, nach einem leichten Schlaganfall 2020 den Freitod mit der Sterbehilfe-Organisation Exit verlangte und dafür als neues Mitglied 3'700 Franken bezahlen musste, haben wir uns beide bei Exit angemeldet, weil deren Dienstleistung nach seit drei Jahren bestehender Mitgliedschaft kostenlos wird. Der jährliche Beitrag beträgt 45 Franken inklusive Online-Zugang zur Patientenverfügung.
Die Kinder wissen, wo unsere Patienten-Verfügungen, Vorsorge-Aufträge und alle notwendigen Passwörter aufbewahrt sind, für den Fall der Fälle.

Gegen eine Massenpsychose ist kein Kraut gewachsen. Mit unzähligen Pressekonferenzen, nebst den täglichen Meldungen von Zahlen, wurde die Angst vor Ansteckung weiterverbreitet durch die Massen-Medien. Das Gewinn versprechende, weltweit ins Unermessliche gehende grosse Geschäft der Medizin und Pharma war eröffnet und nicht mehr zu stoppen. Grundrechte der Verfassung wurden zum beliebig veränderbaren Bühnenbild in einem real gespielten Theater samt Masken, Trennwänden, Abstandbalken und dergleichen mehr. Mit einem religiösen Totschlag-Argument (Solidarität) wurde ein ideologisches Trittbrett verankert. Als ob ein Füreinander irgendetwas ändern würde an ernsthaften Vorerkrankungen oder bestehender Immunschwäche. Die Mikroorganismen (Viren und Bakterien) gehören zum Grundgerüst der Biologie. Nahezu die Hälfte des menschlichen Genoms sei identisch mit Viren-Sequenzen. Das bedeutet, Viren sind keine Feinde der Menschen, sondern regulieren in der Natur ein Gleichgewicht. Davon ausgehend, dass alle heute lebenden Menschen zwecks Erneuerung in naher oder ferner Zukunft sowieso naturgemäss sterben werden müssen, scheint eine Fixierung auf mögliche Todesfälle unsinnig. Die medizinische Lebensverlängerung von Menschen in der Nähe der durchschnittlichen Lebenserwartung steht ohnehin im Widerspruch zu den weltweiten Problemen, welche durch die schiere Anzahl von Menschen verursacht sind und mit zunehmender Überbevölkerung und Überalterung verstärkt werden. Dazu, unabhängig der bekannten oder aktuellen Epidemien, niemand kann wissen, ob nicht auch die Population der Menschen durch ihr Verhalten selber teilweise zum Ziel wird im ständig stattfindenden Artensterben.
Die weitgehend eigenmächtige politische Organisation der Weltgesundheit (WHO, aktuell zu 80% mit zweckgebundenen privaten Spenden finanziert) erklärte im März 2020 eine neue Infektionskrankheit (Covid-19) offiziell zu einer weltweiten Pandemie. Noch vor dieser Ausrufung hatte ich bereits im Januar 2020 nach einer Flugreise die typischen Anzeichen von Corona (Fieber, hartnäckig trockener Husten, Verlust von Geruch und Geschmack, Rötung an Zehen). Mein gefühlter Zustand liess mich wegen einem unheimlichen rasseln und röcheln vor dem Einschlafen eine kalte Lungenentzündung im linken Flügel vermuten, weil ich Corona noch nicht kannte. Mit der Anwendung von verfügbaren Hausmitteln (Sirup, Tee und Dämpfe) wurde nach einer Woche alles wieder gut ohne ärztliche Unterstützung. Wegen Kleinigkeiten gehe ich schon immer grundsätzlich nicht zum Arzt. Seit einer Diskushernie in der Lendenwirbelsäule vor gut 30 Jahren, nach dem Tragen von einem schweren Flügelklavier, habe ich keinen Doktor mehr aufgesucht. Als Kind wurde ich geimpft gegen Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, Kinderlähmung (Polio), Wundstarrkrampf (Tetanus). Das sind wichtige Abwehr-Massnahmen, aber gegen Grippe-Viren liess ich mich noch nie impfen, ohne ein Impfgegner zu sein. Seit mir mit Zehn die Mandeln entfernt wurden, damit auf die wiederholte Abgabe von Penicillin verzichtet werden konnte, ist mein Körper robust und bis heute fast nie mehr erkrankt.
Obschon ich also vermutlich über ein intaktes Immunsystem verfüge, sollte ich mich 2021 auf Empfehlung vom Bundesamt für Gesundheit hin freiwillig zu einer für mich nicht notwendigen Impfung gegen Covid-19 verführen lassen, zumindest damit ich eine mögliche Ungleichbehandlung oder Benachteiligung vermeiden könnte. So wird durch die Massenpsychose der in einer Demokratie selbstverständliche Schutz von Minderheit demokratisch ausgehebelt und eine indirekte Fremdbestimmung irgendwelcher Gesinnung installiert. Das ursächliche Virus wäre und ist nach wie vor mehr oder weniger ungefährlich für ein gesundes Immunsystem, eine Ansteckung meist harmlos und unbedenklich. Das Sterben der älteren oder kranken Menschen lässt sich sowieso nicht verhindern, das ist Natur, ob mit oder ohne Viren. Woher also kommt die gegenteilige ideelle Übereinstimmung im Beweggrund (keine Toten) der eigentlich akademisch bewanderten und verantwortlich Handelnden? Vermutlich aus einer Handlungsunfähigkeit infolge der kulturell bedingten Verdrängung des natürlichen Todes.
Der alle Menschen umgreifende gnadenlose Tod kann mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung erfasst werden. In dieser Todeszone befinden sich aktuell ungefähr die 1940 und früher geborenen Menschen. Während der letzten Jahrzehnte wurde das Sterben vom Zuhause in den Familienwohnungen zu den Einrichtungen der Pflege oder Klinik verlagert. Fremdbetreut im Einzelzimmer auf den Tod warten ist heute normal, bis bei fehlender Patientenverfügung letztlich die dem Schutz von Leben verpflichteten Personen entscheiden müssen über eine weitere Verlängerung der zu Ende gehenden Lebenszeit. Ein Widerspruch in sich. Im Alter von 68 habe ich für mich jede Verlängerung ausdrücklich verboten und ausgeschlossen mit einer bei der Sterbehilfe-Organisation Exit hinterlegten Patientenverfügung - samt NO CPR (keine Reanimation) auf dem mitgeführten Ausweis. Das erklärte Ziel der Regierung, (Schutz von Leben, keine Toten), ist aus meiner Sicht purer Unsinn mit Bezug auf die von der Pandemie betroffenen Menschen. Die Corona-Viren sind seit Jahrzehnten da und bleiben auch nach der Pandemie als wiederholt auftretende Endemie. Sie werden mutieren und passen sich an.
Mit Blick auf die sicher noch kommenden Herausforderungen an die Eliten dieser Gesellschaft erscheint mir die eher an Dekadenz mahnende gläubige Fahrlässigkeit bedenklich, mit welcher sich die Panik einer Massenpsychose global ausbreiten konnte ohne gestoppt zu werden, obschon die Immunologie (z.B. Prof. Dr. Beda M. Stadler, Fachwissen der Biologie) schon früh Entwarnung gab und die notwendigen Massnahmen aufzeigte zum Schutz der Gefährdeten. Vergeblich, das grosse Geschäft war bereits eingefädelt mit dem Verkauf von Masken, Desinfektion, Trennwände, Handy-Tracking, Antigen-Schnelltest, PCR-Test und einer faktisch unnötigen Impfung aller Menschen. Alles rund um die Uhr begleitet von der Medienzunft, welche die ganze Suppe am köcheln hielt mit den täglichen Meldungen. Das Bundesamt Gesundheit (BAG) sorgte mit Bekanntgabe von positiv Getesteten, an sich harmlos, als Neu-Ansteckungen sowie weiteren Toten für Angst und Schrecken. Wie nach dem Motto: Wenn Zwei sich gut verstehen, haben sie gegenseitig immer genug zu tun.
Als Rentner war ich, anders wie die erwerbstätige Bevölkerung und die Jugend, von den durch die Behörden verordneten Massnahmen und Einschränkungen nur am Rande betroffen. So konnte ich nach Möglichkeit jene Örtlichkeiten mit Maskenpflicht umgehen oder meiden. Die Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske wurde verordnet nach der ersten Hysterie mit der geschürten Angst vor Ansteckung und dann auch nicht mehr zurückgenommen, als sie infolge besserem Wissen überflüssig war. Die häufigste Übertragung der Viren erfolgt im Innenraum durch die Aerosole im Atem von Infizierten. Diese Atemluft verlässt den Körper mit einer Temperatur von ungefähr 36 Grad und steigt in der kälteren Aussenluft sofort zuerst nach oben und verteilt sich im Raum. Da sind Stoff-Fetzen vor dem Gesicht und Trennwände nutzlos. Nur Frischluft oder deren Zufuhr kann eine gefährliche Konzentration der Viren und Ansteckung verhindern. Gegen Tröpfchen-Infektionen genüge der sozial angeborene Abstand, nebst Vermeidung von Kontakt der Finger mit dem Gesicht und gründlichem Hände waschen. Die Maskenpflicht wurde (wahlweise) zur empfundenen Schikane oder zum gelebten Glaubensbekenntnis, überwacht durch die Polizei.
Damit kein Missverständnis entsteht: Unbestritten können Viren gefährlich werden. Die Impfung gegen Infektion ist sinnvoll und empfehlenswert für jene, welche gefährdet sind. Dazu ist aber weder eine globale Massen-Psychose nötig noch die Beförderung einer eingebildeten, sich selber beobachtenden Hypochondrie. Die Wahrscheinlichkeit (lässt sich berechnen) ist vernachlässigbar gering, dass ich (keine Reisen, keine öffentlichen Verkehrsmittel, keine Innenräume) auch nur einem einzigen mit dem Virus infizierten Menschen zu nahe kommen könnte. Und ja, alle Spezialisten und alle Experten haben selbstverständlich ihre besondere Meinung zum Thema, warum auch immer.
Gut, vielleicht nehme ich mich einfach selber nicht für so wichtig wie dies andere tun und lebe deshalb bloss vorsichtig, aber von jeder Angst befreit mit der natürlich angeborenen sozialen Distanz (also möglichst keine Umarmungen, keine überfüllten öffentlichen Verkehrsmittel und dergleichen). Frei nach einem Zitat von Nietzsche (1844-1900) in Götzen-Dämmerung: "Aus der Kriegsschule des Lebens - Was mich nicht umbringt, macht mich stärker." Diese zwar auf Gedanken bezogene Aussage ist für mich stimmig mit dem Zusatz: ohne Übermut, mit Demut!

IV. Religiöse Erziehung
Praktizierst du eine Religion und wie? Falls nicht, weshalb nicht?
1969 verliess ich, kurz nach meiner Konfirmation, mit 16 Jahren die Glaubens-Gemeinschaft, in welche ich hinein geboren wurde, die Evangelisch-Reformierte Landeskirche. Die Vermittlung der reinen Lehre im Unterricht hatte bei mir einen Gegensatz zur tatsächlichen Information erzeugt. In Vietnam bombardierten christliche Amerikaner eine unschuldige Zivil-Bevölkerung mit Napalm-Bomben. Konfessionslose 25 Jahre später konnte ich, für mich, mit Sprach-Kritik auch die Deutungshoheit der Universität aufheben, indem ich den kulturell vorherrschenden Syllogismus [Art der Schlussfolgerung] des ausgeschlossenen Dritten gedanklich erweitert habe mit der dreieinigen Polarität. Das heisst, nicht entweder oder, sondern jenes die Vorgaben zwingend gegenseitig Bedingende steht im Zentrum.
Meiner Kenntnis entzieht sich, warum noch heute im Jahr 2019, unter dem Titel der gesetzlich garantierten Glaubensfreiheit trotzdem viele Menschen nicht vom Glauben frei werden können durch selber Denken, sondern sich weiterhin in einem beliebig vorgegebenen Glaubens-Bekenntnis zusammen finden und sich dann bemüssigt fühlen, ihre privaten Einbildungen im Verein als sogenannte Religion öffentlich zu machen, dazu womöglich noch spezielle Symbole tragend. Religion und deren organisierte Zugehörigkeit hat aus meiner Sicht im öffentlichen Raum nichts verloren und nichts zu suchen. Das sei Privatsache. Punkt.
Meine eigene ungläubige und spirituelle Religiosität gründet auf der strikten Beachtung des noch Unbekannten. Ausgehend vom dreieinigen Grundprinzip aller Biologie, jeder lebenden Zelle : Erkennen, Unterscheiden, Auswählen. Mein Nicht-Wissen vom Unbekannten ist für mich meine gedanklich ungläubige Triebfeder. Ein Denkfehler mit Unsinn beginnt für mich dort, wo Unbekanntes durch Benennung als etwas Bekanntes eingebildet und behauptet wird.
Als einen der wesentlichen Denkfehler nebst Religion erkannte ich den unbewussten gedanklichen Umgang mit dem Zeitbegriff. Weil der Mensch kein Sinnesorgan hat für die Zeit als 4. Koordinate im Raum, wird lediglich die Zeit-Messung wahrgenommen. Tag-Nacht-Wechsel, Sonnenstand bis hin zur definierten Sekunde der Uhren. Jener Moment aber, in welchem die Gegenwart stattfindet, der ist so unvorstellbar viel kürzer als eine Sekunde, dass eine Messung ausgeschlossen und schlussendlich dort auch keine Zeit mehr ist. Die Gegenwart ist, so gesehen, zeitlos.
Bereits 1905 hat der Physiker Albert Einstein, 1879-1955, die Relativität von Raum und Zeit nachgewiesen. Das heisst in diesem Zusammenhang, was sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, ist ebenfalls zeitlos. Damit wird das Raum-Zeit-Kontinuum vom Entdecker der Formel E=mc² für mich verständlich, mit Bezug auf meine menschliche Ebene in einem übertragenen Sinn:
Der Raum, das ist der nicht mehr messbare Moment von zeitloser Gegenwart, mein Dasein - verbunden mit der messbaren Zeit als Vergangenheit und Zukunft. Zeitlose Gegenwart bedeutet auch ewig; ohne Anfang und ohne Ende.

Ich glaube ohnehin nicht, sondern denke selber auf der Basis von mir zugänglichem Wissen, erkunde die Zusammenhänge und bilde die eigene Meinung. Neugierig und offen für erweiternde Erkenntnis.
Glaubst du an Gott?
Die Frage setzt suggestiv voraus, da wäre etwas vorhanden zum Glauben oder nicht.
Gott? Was soll das sein?
In Nachschlagewerken lese ich, das sei ein übernatürliches Wesen. Die Annahme einer behaupteten Existenz von Übernatürlichem ist mit meinem Verständnis der unteilbaren Natur und ihrer Natur-Wissenschaft nicht vereinbar.
Warum wird die Einbildung oder Wahn-Vorstellung als Gott bezeichnet?
Der Wortstamm von Gott (guð, goð, got) sei nur im germanischen Sprachraum anzutreffen und ausserhalb unbekannt. Das Wort könne geradezu als Kennzeichen der germanischen Sprachen angesehen werden. Nebenbei wird damit auch klar, eine germanische Götterdämmerung konnte schon von der Etymologie her vom Rest der Welt gar nicht verstanden werden.
Die Geschichte des germanischen Neutrums (*guða-), aus welchem das Wort Gott entstand, zeige einen Zusammenhang mit dem Zauber und könne das durch Zauberwort angerufene oder berufene Wesen bedeuten.
Nun können die Fakten gedreht und gewendet werden wie man will, die Erfindung vom übernatürlichen Wesen war und ist ein abstraktes Konstrukt. Die Wahrheit sei für den Menschen die Naturgewalt von Himmel und Erde, der Rest reine Logik und Psychologie.
Der mit dem Wort Gott stattfindende Anruf vom Ganzen als vermeintliches Wesen verursacht aber einen Zirkelschluss in der gedanklichen Folgerichtigkeit, denn auch das geschlossene Ganze ist nämlich eine Polarität, der Gegenpol vom offenen Chaos.
Der Volksmund hat das Ganze schon längst einfach verbunden mit der Redensart: Alles Gute kommt von oben. Wie der Sonnenschein und der Regen.

Geist wurde als Wort-Begriff ein zentrales Thema der Meta-Physik einer vermeintlichen oder angeblichen Über-Natur, ein aus historischen Gründen uneinheitlich verwendeter Begriff der Philosophie, Theologie, Psychologie und der Alltagssprache.
Im Schweizer-Deutsch wird gheis noch immer gesprochen und bedeutet benennen oder heissen; wië gheist säb det? ist Deutsch-Deutsch wie heisst jenes dort? Gheist wäre demnach die fragende Benennung von etwas Unbekanntem. Die Erfassung vom Gespenst wie etwa früher die Natur-Gewalt in der Erscheinung vom Polar-Licht oder ähnlichem. So wird denn im Schweizer-Deutsch ein Schrei in höchster Erregung als Ghöis bezeichnet = erschaudern, ergriffen und aufgebracht sein.
Der Begriff entstand vermutlich einst als eine Schnittstelle zwischen der mit unbekannt, magisch, zu bezeichnenden direkten Betroffenheit und der aus dem Chaos herausgelösten bekannten, als bewusst wahrgenommenen menschlichen Wirklichkeit [war-nemen, waren bedeutet ursprünglich sehen].
Geistlich oder geistig, die Mär vom Geist ist für mich eine versteckte Ideologie in der deutschen Sprache. In der Tradition des deutschen Idealismus im 18. /19. Jahrhundert beziehe sich der Begriff Geist auf über-individuelle Strukturen, auf meta-physische Einbildungen. Die Geschichte des deutschen Eigenschafts-Wortes geistig sei ziemlich merkwürdig, namentlich in seinem Verhältnis zu geistlich, durch welches es lange mit vertreten wurde; es habe zweimal angesetzt, im 14. und 17. Jahrhundert, ohne durchzudringen, erst im 18. Jahrhundert setze es sich allmählich durch. Mittelhochdeutsch erscheine geistig in geistlich philosophischem Gebrauch im 13. Jahrhundert bei Eckhart von Hochheim, von ihm wie es scheine auch gebildet sei, aber nur als Abwechslung mit dem längst bestehenden geistlich.
Der deutsche Duden mit seiner Deutungs-Hoheit beschreibt im Jahr 2019 den Geist als denkendes Bewusstsein des Menschen. Richtig wäre für mich die Annahme, denken erfolgt immer bewusst und erzeugt Gedanken. Denken und Wissen ergibt mir jenes was IST. Das deutsche Sein oder gar Bewusst-Sein als Hauptwort ist hingegen eine meta-physische Einbildung und führt in Verbindung mit dem deutschen Geist fast zwangsläufig in eine Falle. Mit dem naheliegenden Resultat von etwas übersinnlichem in irgendeiner Form, jedenfalls germanisch mit der sprachlichen Wurzel *guda- [der Anruf vom Ganzen als Wesen in irgendeiner Form], womit die versteckte Ideologie in der deutschen Sprache wirken kann: Mit der allgemein üblichen Form der gelehrten Geistes-Wissenschaft wird unbemerkt der ursprüngliche Gheis als Gespenst [Geist] mit-gedacht und behauptet sowie in der Folge als Wesen denkend angesprochen auch geglaubt. Gefangen in mehrfach verbundenen Dualismen können nun endlos, einem Hamster-Rad gleich, trefflich von vermeintlichen Seins-Wesen ganze Bibliotheken zum Thema von vorgeblichen Geistes-Wissenschaften gefüllt werden ohne jede Möglichkeit zum Verlassen der Umdrehung vor Ort und einer gedanklichen Ohnmacht mit nicht bemerkbarer Denk-Selbst-Aufgabe solange nicht die Grund-Annahmen durch erneuern verändert werden mit Sprach-Kritik.
Geist ist bei mir wie Gott dem Glauben von Anderen anheimgestellt. Zum präzisen Ausdruck genügt mir die Formulierung durch die Begriffe denken, Gedanken und gedanklich. Geist, geistig und geistlich können problemlos vermieden werden.
Alle Philosophie sei Sprachkritik,
von Ludwig Wittgenstein (*1889 in Wien; †1951 in Cambridge)
Mit anderen Worten: Die eigene Bildung kann Sinn-Bilder und Wort-Hülsen (Ober-Begriffe) jeweils umgehend abgleichen mit dem aktuellen Stand von Erkenntnis der exakten Wissenschaften.

Bei meinem gedanklichen Kontakt mit früheren Philosophen räumen dieselben vermutlich unumwunden ein, sie würden auf dem Stand von Wissenschaft heute mit den zwischenzeitlich erfolgten Paradigma-Wechsel [Materie = Energiebindung; Zeitbegriff als 4. Koordinate im Raum; Unschärfe-Relation von Position und Geschwindigkeit usw.] vielleicht anders denken wie zu Lebzeiten.
Lebewesen, genauer Säugetiere in der Fauna auf der Erde, mussten schon von jeher zwingend das lebensnotwendige Wasser trinken. Völlig natürlich wurde deshalb irgendwann erkannt, das Bild im Wasser beim Trinken spiegelt die Trinkenden selber, das selbst wurde zum ich. Selbst-Erkenntnis ist, so gesehen, die Ich-Erkenntnis wie mit einem Spiegel.
Das ICH selber als menschliche Person entsteht aus der Polarität von weiblicher Eizelle und männlicher Samenzelle, also zweier sich zwingend gegenseitig bedingender Tatsachen. Dieses ICH begründet mir fortan eine grundsätzliche Annahme: die EINS als Gegensatz zur NULL.
Von der logischen Eins als ICH getrennt zu erfassen wäre nun das Verb sein [ich bin], welches seiner Herkunft nach einer alt-indoeuropäischen Wurzel és- zugeordnet werde. Wer bin ICH kann ich aus dem deutschen Konstrukt vom SEIN als Behauptung eines Zustandes heraus nicht folgerichtig beantworten. Ich sehe keine Veranlassung dazu, die Eigenschaften lebendig und leblos umzudeuten auf die Oberbegriffe Sein oder Nicht-Sein.
„Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage“ (to be, or not to be, that is the question) ist ein Zitat aus der Tragödie Hamlet von William Shakespeare, 1564-1616. In dem Stück beginnt Hamlet mit diesem Satz einen Monolog, in dem er darüber nachdenkt, dass er entschlossenes Handeln scheut wegen seiner Angst vor dem Tod trotz Todes-Sehnsucht und Weltschmerz.

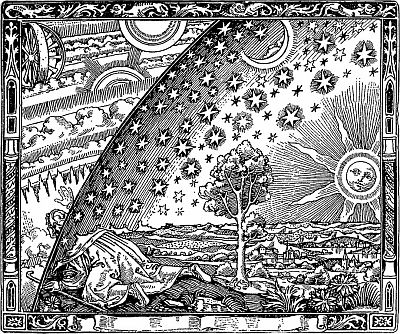
Das oben stehende Bild, erstmals erschienen 1888 in L’atmosphère, welches ich etwa 14-jährig in einem Naturkunde-Buch meines Vaters sah, weckte mein Interesse und war für mich sinnlicher Anreiz, die Welt verstehen zu wollen. Sich die Welt so vorzustellen wie sie gemäss aktueller Erkenntnis der exakten Wissenschaften tatsächlich ist, setzt von mir ein unangenehm anstrengendes Mit-Denken voraus. Das Jetzt ist der Zeit-Messung entzogen, also zeitlos: Die exakte Gegenwart ist der Beobachtung nicht zugänglich [Heisenbergsche Unschärferelation] und von daher bezüglich Zeit kein Gegenstand der Physik. Wenn aber jene von Menschen die Welt genannte Wirklichkeit tatsächlich zeitlos-gegenwärtig ist, dann kann jeder Bezug auf diese Zeit ohne Zeitmessung mit Vergangenheit oder Zukunft nur ein menschliches Konstrukt sein, so paradox dies klingen möge.
Mein modernes Weltbild setzt voraus, sich allgemein nicht von irgendetwas ausserhalb der exakten Wissenschaften zuerst angesprochen zu wissen zu meinen zu glauben, sondern die Information kennen zu können und mittels dieser Kenntnis zur Erkenntnis gelangen. Mit anderen Worten, nicht zu glauben sondern mit wissen selber immer weiter zu denken. Ohne dabei das ebenfalls vorhandene Nicht-Wissen zu vergessen: Die Gewissheit, normale Wirklichkeit der menschlichen Sinnesorgane sei lediglich ein als Menschenwelt entstandener Teil der Realität.
Im Anfang und Hintergrund jeder persönlichen und damit auch gesellschaftlichen Entwicklung stehen irgendwelche Erkenntnisse, bei mir verbunden mit der Einsicht, wonach neben und mit der bekannten Welt der harten Zahlen und Fakten eine solche von Gedanken als Gefühl vorhanden sei, zusammenfassend für alles was sich dem normal menschlich Wirklichen entziehe wie beispielsweise Bedeutung von Sinn der Gedanken und Seele.
Die gedankliche Vorstellung, das Bild von der Welt, entsteht im Kopf als Buchstaben-Bild durch die beschreibende Sprache und deshalb ist darauf zu achten, im selber denken den Einfluss von sprachlich gläubigen Sammel-Begriffen zu vermeiden. Die Schrift-Sprache Deutsch beinhaltet Ober-Begriffe zu Sachverhalten, welche, wenn überhaupt, lediglich als Eigenschaft oder Tätigkeit ohne Hauptwort fassbar wären.
Ein modernes Weltbild erfasst die Denk-Konstante namens Zeit als 4. Koordinate im Raum, im Gegensatz zur absoluten Zeit in der früheren Physik. Der Grundlagen-Irrtum von eigenständiger Zeit in der Physik von Isaac Newton [1643-1727] wirkt bis heute im Denken. Selbstverständlich kann eine Zeit-Dauer durch Zeit-Messung anhand einer vorher bestimmten physikalischen Grösse fixiert werden, aber diese Zeitmessung hat in meinem Weltbild mit Raum-Zeit-Kontinuum keine Bedeutung. Ein gedankliches Problem besteht darin, dass der vom Menschen gelebte scheinbare Zeit-Verlauf auch unbewusst mitgedacht wird, entweder als endloser Kreislauf oder linear mit Anfang, obwohl tatsächlich ausschliesslich Gegenwart stattfindet. Das den Menschen angeborene waren, das frühere Wort für sehen, führt mit deutscher Grammatik, welche gewesen mit war ersetzte, über wa(h)r-nehmen zur vermeintlichen Wahrnehmung und vernebelt die Sinne durch angebliche Wahrheit.
Ein Weltbild als eigenständiger Begriff ist nur im Deutschen vorhanden. Andere Sprachen haben kein Weltbild, sondern ein Bild von der Welt [image du monde, image of the world]. Mit dem deutschen Weltbild hingegen wird die ebenfalls deutsche Welt vor das Bild gesetzt. Der Erstbeleg für den deutschen Ausdruck uuerlt-pilde = Weltbild als Übersetzung von lateinisch forma ideaque mundi = Gestalt und Idee von Allem, stammt von Notker III. [950-1022], ein Benediktiner-Mönch der Kloster-Schule St. Gallen in der Deutsch-Schweiz.
Von Bedeutung scheint mir die gegenseitige Wechsel-Wirkung von Bild und Welt. Die Welt-Ansicht führt zu einem Weltbild und umgekehrt. Das kulturell vorbestehende Bild [= Weltbild als Resultat einer früheren Weltanschauung] prägt die Denkart, Denkweise, Gedanken, Ideologie, Philosophie etc. und ermöglicht die gegenwärtige Weltauffassung, Weltsicht usw.
Die Weltanschauung formt also zusammen mit Bildung das Weltbild. Mit einem menschlich bedingten nicht-erkennen und nicht-wissen kann eine gefühlte Einbildung entstehen. Die Wahrnehmung von Realität wird dann ersetzt, beispielsweise durch den Gegensatz von weltlich und nicht-weltlich, meist göttlich im Sinn des angeblich Gesamten, welches das vermeintliche Ganze, die Welt, beinhalten soll; der Trugschluss wirkt nun gedanklich als Paradoxon und Zirkel-Schluss. Der tatsächlich vorhandene Gegenpol zum geschlossenen Ganzen, das offene Chaos, wird gedanklich klar falsch nicht erfasst und statt dessen verankert sich eine gläubige Behauptung, da wäre wirklich tatsächlich etwas wie die Welt als Gesamtes.
Ein modernes Weltbild als Vorstellung eines nicht als Ganzes erfassbaren IST-Zustandes im JETZT, ohne vorher und ohne nachher, ohne Anfang und ohne Ende entzieht sich noch weitgehend meinem Verstand auf dem gegenwärtigen Standard der allgemeinen Bildung, welche nach wie vor geprägt wird von Lehren vergangener Jahrhunderte, obschon diese zwischenzeitlich schon längst durch besseres Wissen ersetzt worden sind. [Zeit-Begriff, Raumzeit-Kontinuum, Unschärfe-Relation].
Erkenntnis aus der Quantenphysik führt in der Physik zu einem Paradigma-Wechsel. Möglicherweise handelt es sich bei jenem Ganzen, welches bisher als die Welt bezeichnet wird, um Information als gedankliches Universum, bestehend aus der kleinsten Einheit, dem Bit. Eine der Folgen aus der Quantenunschärfe ist, dass Materie spontan aus dem Nichts auftauchen kann und sogleich wieder verschwindet [Vakuum-Fluktuation]. Demnach könnte Alles bestehen aus dem Nichts [und umgekehrt], einem wabernden Meer von virtuellen Teilchen. Ebenso kann das drei-dimensionale wa(h)r-nehmen von Realität durch den Menschen eine Einbildung sein, eine Illusion, vergleichbar einer holografischen zwei-dimensionalen Konstruktion. Das heisst, mit anderen Worten, da wäre nur Energie und-oder Masse, zeitgleich beides gleichzeitig in Form von jenem was IST; da wäre gar keine Welt, kein Universum oder wie die althergebracht üblichen 3-D-Vorstellungen alle benannt werden mögen. Erst durch das Quanten-Bit werde aus dem Atom menschliche Erkenntnis, denn, was sind Gedanken?
Die empirisch verifizierte Unschärfe-Relation, also dass nur entweder die Position oder dann die Geschwindigkeit exakt erfassbar sind im vier-dimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum, sich gegenseitig bedingenden Raum und Zeit, darf nicht ausgeklammert, verneint oder verleugnet werden im virtuell gedanklichen, also dem ideellen, philosophischen oder religiösen.
Für mich ist die Bezeichnung Welt deckungsgleich mit dem natur-wissenschaftlichen Erkenntnis-Horizont, der bekannte Kosmos und alle seine Bestandteile, dazu aber auch die noch kommenden neuen Erkenntnisse in der Zukunft.

Gedanken sind eine Voraussetzung für mein Denken zwecks Verständnis. Die Gedanken seien frei. Aber was sind Gedanken?
Der Gedanke als Oberbegriff zum Vorgang des denken beinhaltet die Zusammenhänge. Die Bedeutung wäre demnach zu erfassen über jenes, was mit denken gemeint wird. Das Wort sei einem verlorenen Stamm *danc- zugeordnet, zu welchem nebst denken auch die Verben danken, dünken gehören, welche eine bewusste Empfindung ausdrücken im Gegensatz zu einer unwillkürlichen. Ein Satz wie die Gedanken sind frei meint demnach, genauer, denken ist frei und aber abhängig von einem sich dessen bewusst zu sein.
Sich von etwas bewusst sein wiederum bedingt die Information, ein Wissen durch Vermittlung von Unterschied und die Erinnerung an bereits geschaffenes vorhandenes Wissen. Die exakte Wissenschaft der Physik hat jetzt die Schwelle zum Informations-Zeitalter überschritten. Dieser eigentliche Paradigma-Wechsel kann den Zugang zu einer gedanklichen Ebene erschweren, weil das naturwissenschaftliche Verständnis im Widerspruch steht zum bisherigen Begriff der Information, soweit dieser von Geistes-Wissenschaften her kommend den alltäglichen Sprachgebrauch dominiert.
Alle empirischen Beweise in der Wissenschaft seien letztlich nur über die Sinne gegeben. Die physikalische Welt ist dadurch grundlegend mit dem Menschen verknüpft. Doch wie gelangt der Mensch von hier nach dort? Woher stammt denn die Überzeugung, Menschen könnten ihre Welt wie die Tiere im Zoo von aussen betrachten? Mit einem festen Gitter dazwischen, welches den Eindruck erweckt, das Reich der Beobachtenden und der Beobachteten sei getrennt und unabhängig? Die moderne Quantenphysik führt zur Einsicht, absolute Objektivität dürfte eine Illusion sein. Es besteht immer auch eine Wechselwirkung zwischen Beobachtenden und Beobachtetem [Unschärfe-Relation]. Die normale Wirklichkeit der Sinnesorgane sei lediglich ein als Menschen-Welt entstandener Teil der Realität. Von der unbekannten Realität her betrachtet lebe ich als Mensch in einer anderen Welt mit meiner Wirklichkeit.
Ausgehend von einer soweit objektiven Realität aus Atomen und dem Leeren, was die Physiker glauben verstanden zu haben, tasten sie nun in Richtung der Sinn-Wahrnehmung und dem Bewusst-Werden vor, die noch immer etwas Geheimnisvolles darstellen. Die Anderswelt besteht aktuell aus den kleinsten Einheiten der Quantenphysik, den Quantenbits [Qubits] der Information. Erst damit würden aus Atomen menschliche Erkenntnisse. Ein Qubit habe das Quantum als Grundlage. Demnach arbeitet die Natur am Grunde nicht mit Kontinuitäten. Im Gegensatz zu den Bits, die nur genau 2 Zustände kennen, können Qubits auch jeden beliebigen Zwischenzustand einnehmen.
Information müsse einen Unterschied vermitteln, sonst liege keine vor. Daher ist vermutlich auch jenes, was von Menschen als Singularität bezeichnet wird, tatsächlich bloss eine Behauptung. Mit anderen Worten, ob Urknall oder Schöpfung, beide sind gleichermassen ein gedankliches Konstrukt. In jedem Fall entscheiden die Grundannahmen in der Folgerichtigkeit über die möglichen Zusammenhänge von richtig oder falsch.
Die Aufhebung von Dualismus, jener als typisch abendländisch bezeichneten Denkart mit dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten, durch Erweiterung mit der dreieinigen Polarität ist auch schon meine ganze Kunst, die Welt verstehen zu können.

Nach meiner Ablehnung des Allmächtigen mit Kirchen-Austritt 1969 im Alter von 16 Jahren, im Zusammenhang mit einer Warum- und Sinnfrage, war für meine Gedanken erst einmal die Endstation erreicht bei einer grossen Leere.
Als ich mir irgendwann später überlegte, welche Farbe eigentlich meine Gedanken hätten und ich im Dunkeln mit geschlossenen Augen in mich selber hinein schaute, stellte ich fest, die Aktivität innerhalb meines eigenen Kopfes hat weder Farbe noch Kontrast. In einem Bild der Erinnerung kann ich mir eine Farbe wohl denken, aber sehen kann ich sie nicht. Mein Interesse war geweckt für das gedankliche Betrieb-System, das Gehirn.

Das Grosshirn spiegle eine subjektive, stark vergrösserte Wirklichkeit anhand von wenigen herausgefilterten, aber objektiven Informationen, in einen aus Milliarden von Nervenzellen bestehenden, leeren Vorstellungs-Raum. Die vom Menschen als Licht wahrgenommenen Wellen mit einer Länge zwischen 400 und 700 Millionstel Millimetern aus dem elektromagnetischen Spektrum würden als die Komplementärfarben Grün und Rot vom Vorstellungs-Vermögen im Grosshirn wie auf eine riesige Leinwand vergrössert und ergäben das Bild einer farbigen Menschen-Welt, die zwar auch bestehe, in dieser Form aber nicht vorhanden sei.
Die Sinne seien Gegenstand laufender wissenschaftlicher Untersuchungen und keine festen Grössen mit Bezug auf Sinnlichkeit, Wahrnehmung und Sinnesreizen. Momentan werde, je nachdem wie gezählt wird, zwischen 8 bis 13 verschiedenen Sinnen unterschieden. In der Psychologie und der Physiologie seien nicht alle Sinnesreize auch Wahrnehmungen, sondern nur diejenigen, die bewusst verarbeitet werden und der Orientierung eines Subjekts dienen.
Andererseits, wenn Gesehenes oder Gehörtes sogar krank machen kann, dann könnte das Gehirn beim Menschen, von einem psycho-physischen Niveau her betrachtet, selber ein Sinn sein, welcher mit Gedanken-Frequenzen gereizt werde und ohne Reiz die bekannte psychologische Leere zur Folge haben kann.
Ohne Sinnes-Reiz wäre das Vorstellungs-Vermögen ein gedankliches Nichts. Folglich ist die psychologisch erfassbare grosse Leere das Fehlen von Sinnesreizen in Form von Gedanken.
Die frühere Sinnfrage konnte ich jetzt über die Herkunft der Wörter auflösen. Das Hauptwort Sinn komme vom Tätigkeitswort sinnen, was nach-denken bedeute. Was Sinn macht, ist demnach abhängig vom Denken in Zusammenhängen, dem Ziel. Ein für sich allein stehender Sinn wäre eine Behauptung. Der Sinn meines Lebens ist darum fortan die Gegenwart als einziger Möglichkeit, Vergangenheit und Zukunft so miteinander zu verbinden, wie ich das für richtig erachte und entsprechend gestalte.
Auch eine behauptete Transzendenz kann ich nun mit sinnen ausschliessen. Die natürliche Hauptaufgabe der Wahrnehmung durch den Menschen bestehe darin, paradox, all jenes nicht wahrzunehmen, was als Realität ständig präsent sei. Weil die Sinnesorgane der Menschen vor allem Veränderungen wahrnehmen könnten: entweder bewege sich das Sinnesorgan, wie die Augenbewegung beim führenden Lichtsinn oder das abzubildende Objekt. Der die Wahrnehmung verlassende Bereich, die Transzendenz, ist folglich in der absoluten Normalität der menschlichen Gegenwart verkörpert. Transzendenz wäre, so gesehen, ein Wahn der Sinne, eine Einbildung.
Den Zustand einer Reiz-Überflutung, Gegenteil der Leere, mit Verlust der Orientierung, kann ich bereits im Ansatz vermeiden. Die dem Menschen angeborene, nicht bewusste Mimik kann umgekehrt auch bewusst verwendet werden. Zwinge ich für mich allein die Muskulatur im Gesicht zu einem grundlosen Lächeln, so hat dies eine Auswirkung auf mein Gemüt und meine Gedanken.
Die Natur mit ihrer Gewalt von Erde und Himmel bildet und begründet mir die unteilbare Wahrheit, monistisch und unabänderlich.

Ein Knackpunkt war für mich, mir meine eigene Mitte als Seele denken zu können. Manche behaupten, eine Seele zu haben, andere sehen darin einen naiven Glauben.
Gemäss Erkenntnis der Kernphysik bestehe mein Körper, wie alles Irdische, aus jenen Atomen, welche einst durch Supernovae von, an ihrem Ende, explodierten Sonnen als Sternenstaub entstanden seien. Das Wissen um die unvorstellbaren Grössen im Raum mit Lichtjahren und -geschwindigkeit verbietet mir, eine über das biologische und kulturelle Leben auf Erden hinaus gehende Bedeutung meiner Person als Individuum auch nur ansatzweise zu denken. Generell sind mir demnach Überlegungen zu meiner Seele als eigene Mitte nur begründet in gedanklichen Zusammenhängen möglich.
Zu meiner eigenen inneren Mitte wurde die Beobachtung und Kontrolle meines Zustandes hinsichtlich der Psychosen, namentlich Schizophrenie, Paranoia und Depression sowie deren Vermeidung durch eine Balance im Gleichgewicht. Im Kapitel 18 ist beschrieben, wer ICH bin. Wenn ich nun dieses Befinden als Seele benenne, dann habe ich dadurch keine, sondern ich bin die Seele.
Gedanken-Gänge sind denkbar oder nicht. Die Information, welche durch Unterschied ein bio-chemisches Denken ermöglicht, entstehe durch Quanten-Bits aus den Atomen. Gegenwart sei zeitlos, weil sie mit jeder Zeit-Messung bereits Vergangenheit wäre. Zeitlos bedeutet auch immer oder ewig. Im übertragenen Sinn kann ich die zeitlose Gegenwart deshalb als Ewigkeit denken.
Davon ausgehend, Natur sei ausschliesslich gegenwärtig aktiv, wäre auch die Vorstellung von Wiedergeburt und dergleichen in diesem ständig stattfindenden Jetzt zu vermuten, ohne vorher und ohne nachher. Denkbar ist für mich, so gesehen, eine gedankliche Wiedergeburt durch die gelebte Gegenwart als Ewigkeit.
Die naiv-gläubige Annahme oder Nicht-Annahme, Seele sei etwas im Besitz von Menschen, also die Vorstellung, Menschen könnten eine Seele haben oder nicht ist zu unterscheiden von einer dreieinig gedachten Seele als etwas gegenwärtiges was ist. So gesehen hat ein Mensch keine Seele, sondern der Mensch ist eine Seele [zeitlos gegenwärtig].
Mein Nach-Denken wird mir ermöglicht durch ungezählte kluge Köpfe, welche teilweise ihre gesamte Lebenszeit der wissenschaftlichen Forschung widmen. Erst durch deren Erkenntnis und Information können auch autodidaktisch gebildete Laien wie ich versuchen zu verstehen.

Wenn du auf dein Leben zurückblickst, worauf bist du besonders stolz?
Bevor ich stolz bin, will ich bescheiden bleiben. Ich bin mir bewusst, schon ein einziges unvorhersehbares Ereignis kann einen Lebenslauf unabänderlich knicken oder unwiederbringlich zerstören. Das Schicksal hat mich vor Tiefschlägen bewahrt, ich bin jetzt mit 66 noch immer gesund und frei von jeden Beschwerden. Ohne Zweifel kann ich mich rückblickend zu jenen zählen, welche stets ein Chrotten-Haar in der Tasche hatten, wie der Volksmund besagt für Glück haben. Aber nicht Glück im Spiel, Glückspiel ist mir zuwider, sondern einfach zufällig, oft noch Glück im Unglück.
Stolz bin ich in erster Linie auf meine Ehefrau Trudi, welche mir Partnerin, Freundin und Geliebte in einer Person war und ist. Eine dermassen bezaubernd liebe, lebensfrohe und einzigartige Frau nunmehr 44 Jahre an meiner Seite zu wissen, erfüllt mich mit dankbarem Stolz. Sie hat mir zwei Söhne und eine Tochter geschenkt, welche uns drei gesunde Enkelkinder bescherten, eines weiblich und zwei männlich.
Auf unsere drei Wunsch-Kinder bin ich besonders stolz, wurden doch alle zu vollwertigen Mitgliedern der sozialen Gesellschaft und sind zur selbstverantwortlichen Existenz-Sicherung befähigt. Dafür, dass alle drei gesund geboren wurden, bin ich dankbar, aber nicht einer beliebigen Einbildung, sondern der biologischen Natur mit ihrer Genetik.
Einigermassen stolz bin ich auf meine 40 Jahre selbständiger Erwerbstätigkeit ab Alter 24 bis zum vorzeitigen Ruhestand mit 64. Mit mir als Alleinverdiener der 5-köpfigen Familie haben unsere Kinder eine Vollzeit-Mutter zu Hause gehabt.
Obschon, wie mich das erlebte Allein lehrte, sich ausser mir niemand dafür zu interessieren scheint, bin ich stolz darauf, autodidaktisch den Wechsel vom gelehrten dualen zum dreieinigen Denkschema geschafft zu haben. Dabei geholfen hat mir mein selbständiges Studium der untergegangenen keltischen Kultur. So ist beispielsweise das Ursache-Wirkung-Prinzip für mich nicht mehr generell, sondern nur noch innerhalb von vorher fixierten Grund-Annahmen gültig. Ermöglicht wird durch die dreieinige Polarität einerseits ein klar sachbezogenes Denkvermögen, andererseits die Offenheit für eine Realität fernab jeglicher menschlicher Wirklichkeit und Vorstellungsvermögen.

Meinem Rückblick auf die bisher gelebten 66 Jahre steht nicht zu, im Nachhinein eine Bewertung vorzunehmen von zufälligen Begebenheiten oder vorgegebenen Rahmenbedingungen.
Nebst dem allgemein Üblichen wurde mein Leben mit Geburt-Jahrgang 1953 kulturell beeinflusst durch die 68er und die Hippie-Bewegung. Diese einst verspürten Gefühle der Zuversicht für noch kommende Erfahrung blieben erhalten und wirken bis heute in mir fort; ein kleiner Trost für die vielen Enttäuschungen damals mit menschlich allzu menschlich zwischen-menschlichem im Bereich von Kommune als Zusammen-Wirken in Kooperation. Der Ausstieg mit Arbeit-Verweigerung und Drogen-Konsum korrigierte sich später von selbst durch bessere Möglichkeiten. Für Absicht und Zweck anderer war ich nie nutzbar, weder ideologisch noch partei-politisch.
Meine Ziele, nachdem ich mich vorgängig im Alter um 18 durch ein zufällig entdecktes Fachbuch für autogenes Training erst zu deren Erfassung befähigt hatte, entstanden stets spontan und befristet aus einer tatsächlich vorhandenen Situation heraus. Das heisst, ich habe nie eine langfristige Planung auf etwas Bestimmtes hin verfolgt wie Karriere oder ähnliches.
Bist du jemals für etwas Wichtiges eingetreten?
Das eigene Seelen-Heil in der Gemeinschaft war und ist mir wichtiger als der wirtschaftliche Erfolg in Form von Geld und Reichtum. Für die mir ebenfalls wichtigen Anliegen bin ich bereit zur ehrenamtlichen Mitarbeit, vorausgesetzt, diese werde mir nicht vereinsintern durch kleinkariertes Erbsen zählen oder Wortklauberei verunmöglicht.
Bedingt durch meine selbständige Erwerbstätigkeit mit dem Grundsatz der Nicht-Verschuldung waren wirtschaftlich die Ausgaben stets von den Einnahmen abhängig. Zusammen mit meiner sparsamen und der Kosten bewussten Ehefrau problemlos machbar ohne jedes Gefühl von Verzicht. Wir hatten und wollten nie mehr als wir auch brauchten zum gut und schön Leben in unserer selbständig und frei bestimmten Lebens-Zeit. Dazu hielten wir immer den Grundbedarf in Reserve für mindestens ein halbes Jahr ohne Einnahmen. Als die Kinder nach der Berufs-Lehre ihr eigenes Geld verdienen konnten, habe ich mein Transport-Geschäft wieder zurück gebaut und ohne Angestellte allein mit Taxi weiter gemacht, was jederzeit weitere zusätzliche Tätigkeit ermöglicht hätte, falls nötig.
Zurück blickend habe ich innerhalb meines Lebens mehrere Leben gelebt. Nicht bloss Phasen, sondern klar voneinander unterscheidbare Abschnitte, die im Voraus nicht ansatzweise vorstellbar sind. Amüsiert nehme ich darum heute die pauschal formulierten Meinungen von Jüngeren in den Medien zur Kenntnis zu den vom Alter abhängigen Fragen. So haben etwa die sexuell aktiven Menschen zwischen Pubertät und Wechseljahren noch keine Ahnung davon, wie sie während dem Rückgang und nach dem Wegfall des hormonellen Triebes fühlen und handeln werden. Oder mit Bezug auf das Rentenalter können sich die politisch die Entscheidung tragenden Personen unter 65, wenn sie über das Alter von anderen debattieren, schlicht noch gar nicht vorstellen, wie rasch sich auch ihr körperliches Gesamt-Befinden bald verändern wird. Der Aufschub von etwas noch erleben wollen auf später ist darum vermutlich ein unbewusster Selbst-Betrug, weil das erlebbare Spektrum der Sinne und Gefühle dann nicht mehr das Gleiche sein wird wie früher.
Als Erwachsener, nach dem Militärdienst, habe ich sämtliche gesetzlichen Pflichten erfüllt und darüber hinaus auch die ungeschriebenen Gesetze im Sozialen möglichst beachtet. Vor dem Anspruch auf ein Recht sehe ich im Natur-Gesetz die Pflicht.
Von mir gemachte Fehler gehören zu meinem Lern-Prozess. Zu bereuen habe ich darum nichts und bleibe, Miss-Verständnis vorbehalten, niemandem etwas schuldig. Dankbar bin ich all jenen, welche meine Wesensart angenommen, mich lieb oder wenigstens ertragen haben. Ich weiss, durch meine kopflastig empfindlichen Sinne, die feinen Antennen, habe ich eine Tendenz zur unerwarteten oder unverständlichen Reaktion.
Gibt es Rat und Erfahrung, die du gerne an junge Menschen weitergeben würdest?
Ja, indem ich schwierige Fragen meiner eigenen Jugendzeit kurz beantworte:
Hat mein Leben einen Sinn?
Ja. Was Sinn ergibt ist stets vom Ziel abhängig. Das biologisch organische Leben selber will leben, ohne Wenn und ohne Aber, ob mit oder ohne Sinn hat darauf keinen Einfluss.
Der Sinn meines Lebens verbirgt sich darum in meiner zeitlosen Gegenwart als einziger Möglichkeit, Vergangenheit und Zukunft so miteinander zu verbinden, wie ich das für richtig erachte und entsprechend gestalte.
Durch den sicheren Tod ist sowieso alles sinnlos?
Gibt es ein Leben nach dem Tod?
Ja, selbstverständlich, aber anders. Die Bausteine meiner Person sind auch vor und nach meinen Umwandlungen mit Geburt und Tod vorhanden, in einem übertragenen Verständnis nachher leblos „lebendig“ in einer anderen Form.
Die Umwelt wird zerstört, ich habe ja sowieso keine Zukunft?
Meine Gegenwart ist die Verbindung zur Zukunft. Wenn ich an mir selber arbeite, gestalte ich damit von selbst auch die Zukunft! Unbedingt braucht der Mensch von seiner natürlichen Umwelt drei lebenswichtige Grundlagen: Sauerstoff aus der Luft zum Atmen, Trink-Wasser und Nahrung zum Essen. Ist das alles vorhanden, können Menschen in einer Umwelt leben. Probleme mit der Umwelt waren schon immer vorhanden und die werden auch stets wieder gelöst, sobald sie als gemeinsame Aufgabe erkannt sind.
Was ist das überhaupt, die Welt, das Universum?
Die Vorstellung der Welt als Universum kann nicht mehr mit etwas anderem verglichen werden und wird darum als bestehend, als existent vorausgesetzt als Gesamtes. Dieses Ganze besteht einerseits aus dem Gegensatz von Alles und Nichts sowie andererseits aus Bekanntem und Unbekanntem. Logisch bildet aber auch das geordnete Ganze einen Gegensatz zum ungeordneten Chaos.
Gibt es einen Weltuntergang?
Nein. In einer Ewigkeit von zeitloser Gegenwart sind Fragen nach einem Vorher oder nach einem Nachher lediglich auf den Menschen bezogene psychologische Aspekte; geprägt durch die Zeit-Messung mit der Vorstellung von Anfang und Ende.
Keiner versteht mich, niemand hat mich gern?
Dieses Gefühl des Alleinseins kann überwunden werden, indem versucht wird, sich selber so anzunehmen, wie man ist. Alle Menschen sind am Grunde irgendwie allein in ihrer eigenen Welt und können durch ausgewogenes Geben und Nehmen einen Weg miteinander versuchen. Im Leben brauche der Mensch längerfristig mindestens drei engere Bezugs-Personen. Diese Beziehungen in gegenseitigem Respekt zu pflegen ist wichtiger als vieles andere.
Ich habe einfach Angst?
Hab' Geduld, nimm dir Zeit und nicht dein Leben!
Hilfreich ist bereits die dem Menschen nicht bewusste angeborene Mimik, welche auch bewusst verwendet werden kann: Zwinge ich für mich allein die Muskulatur im Gesicht zu einem grundlosen Lächeln, so hat dies eine Auswirkung auf Gemüt und Gedanken.

Die Endlichkeit der Lebewesen erschloss sich mir seit früher Kindheit von selbst durch gelebte Erfahrung. Zum Beispiel wurde den Mäusen im Haus und auf dem Feld mit Tod bringenden Fallen nachgestellt. Im Wasch-Haus sah ich den Grossvater bei der Tötung von Hühnern und Kaninchen zwecks Verarbeitung zur Nahrung. Die Anzahl der Katzen auf dem Hof musste reguliert werden. Erstmals einen richtigen Menschen als Leiche sah ich erst mit 18, als mein Grossvater wie schlafend in seinem Bett gefunden wurde.
Durch Schul-Bildung lernte ich, auch der Mensch gehöre zur Biologie auf der Erde mit ihrer Pflanzen- und Tierwelt. Das biologische Funktions-Prinzip sei Selbststeuerung durch Rückkopplung der Erneuerung mit Mutation und Selektion. Mein Anfang und mein Ende mit Geburt und Tod als Person sind demzufolge lediglich Umwandlungen von leblos zu lebendig und umgekehrt. Soweit alles klar, wäre mir da nicht als Jugendlicher ein kulturell transportierter Denkfehler in die Quere gekommen. Nämlich die Behauptung, alles würde oder müsste einen Anfang haben. Die eine Seite redet von Schöpfung, die andere Seite von Urknall. Beides halte ich für gleichermassen falsch, weil zeitlose Gegenwart weder einen Anfang noch ein Ende haben kann. Sie ist, ganz einfach, schon immer für ewig. Was beständig stattfindet, ist die physikalische Umwandlung.
Alte westeuropäische Sterbe- und Begräbnisrituale stützen die Annahme eines einst unkomplizierten Umganges mit der Umwandlung von lebendig zu leblos:
In einigen Gegenden Englands hing ein heiliger Hammer, der holy mawle, hinter der Kirchentür, und es wird erzählt, dass der Sohn, dessen Vater älter als 70 Jahre war, das Recht hatte, ihn damit zu töten. Es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass solche Bräuche wirklich praktiziert worden sind, vor allem in Gesellschaften, in denen man sich keine überflüssigen Mäuler leisten konnte. (Quelle: Jean Markale – Die Druiden, 2.2.D. Der Allvater, Seite 54).
Mein Vater wusste und erzählte noch von der Sitte der Bauern bis in jüngerer Zeit auf abgelegenen Einzel-Höfen, den dauerhaft bettlägerigen Alten im Stöckli, dem allein stehenden Auszugshaus, im kalten Winter mit Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt eines Nachts bei offenen Fenstern das wärmende Feuer ausgehen zu lassen, damit diese sanft entschlafen konnten.
Unter dem Oberbegriff der Humanität figuriert heute das Leben an sich wie etwas unantastbar Heiliges. Das unvermeidliche Sterben selber rückte dadurch in den Hintergrund. Ganze Generationen haben versäumt, kulturell verursacht, sich rechtzeitig mit ihrer eigenen Endlichkeit zu befassen und werden einfach älter, bis sie wehrlos und fremdbestimmt sind. Leben retten um jeden Preis ist die Losung, meist zu Lasten der Allgemeinheit. Eine vorzügliche Geschäfts-Grundlage für religiöse und Nichtregierungs-Organisationen (NGO) einerseits und andererseits ein Selbstläufer für den Betrieb von Pflege und Betreuung mit steigenden Kosten der obligatorischen Krankenkasse. Als ob älter werden mit krank gleich zu setzen wäre.
Ich habe diese Zusammenhänge jetzt erlebt mit meinem Vater, welcher nach einer sich langsam entwickelnden, vom Alter bedingten Demenz 90-jährig mit der Diagnose Alzheimer 2010 in ein Pflegeheim eingewiesen wurde. Für diese Pflege wurden bis zu seinem Tod 2017 für 82 Monate total 1‘083‘220 Franken in Rechnung gestellt. Mit seiner Rente konnte er davon 21% selber bezahlen, weitere 22% übernahm die Krankenkasse und für 620‘166 Franken (57%) musste die Gemeinde, die Allgemeinheit aufkommen.
Klar ist jede verstorbene Person ein Verlust für die Kosten-Erfolg-Rechnung anderer, aber was da nebst der unstrittig wichtigen und wertvollen Pflege und Betreuung praktiziert wird am Lebensende von nicht mehr urteilsfähigen alten Menschen, das hat mit meiner Vorstellung von einer Würde nichts mehr zu tun.
Das Pflege-Personal, ausgebildet und kompetent, leistet in gutem Glauben das Beste. In Team-Sitzungen wird gefeilt an Konzepten für ein (vermeintlich) möglichst menschenwürdiges Dasein ihrer Patienten. Alles gut, zweifellos, jedoch bin ich mir sicher, mein wehrloser Vater, bis vor kurzem ein stolzer Mann, zwar nicht entmündigt, aber auch nicht mehr urteilsfähig, wollte weder gewickelt noch geschöppelt werden. Nachdem er mich nicht mehr als seinen Sohn erkannte und auch nicht mehr wusste, wer er selber ist, habe ich ihn im Elend nie mehr besucht und halte ihn dafür in bester Erinnerung. Als den Mann, welcher mich zeugte. Mein Dank gebührt aber vor Allen meiner Mutter, die mich austrug, nebst all den ungezählten Millionen von Vorfahren in deren sozialen Gemeinschaften, welche mein Dasein im Hier und Jetzt erst ermöglicht haben. Früher landete ich manchmal im trunkenen Elend, wenn ich diese ungeheuerliche Bürde als Last fühlen konnte.
Was sind deine konkreten Vorkehrungen mit Blick auf dein Lebensende?
Wir haben unsere Patienten-Verfügungen (nach Vorlage aus dem Internet) mit dem Verzicht auf lebensverlängernde Massnahmen bei bestmöglicher palliativer Behandlung ergänzt mit dem Zusatz:
Für den Fall einer fortgeschrittenen Demenz verlange ich, dass mir keine Nahrung und Flüssigkeit mehr eingegeben wird, sobald ich mir diese nicht mehr selbst zuführen kann. Ab dann verlange ich eine ausreichende Sedierung. Das alles gilt auch dann, wenn reflexartiges Verhalten von mir als Ausdruck von Hunger oder Durst gedeutet werden könnte.
Ich werde einfach einschlafen und für immer schlafen, bloss umgewandelt von lebendig zu leblos im Wissen: in der physikalischen Wirklichkeit kann nichts verloren gehen.

Wie im Vorwort beschrieben gehöre ich zur Minderheit jener etwa 6% aller Menschen, welche von Geburt an unbemerkt doppelt sehen ohne zu schielen und dadurch ihre Umwelt anders sehen müssen wie die normale Mehrheit. Durch das selber nicht bemerkbare und auch nicht störende Fehlen vom unmittelbar wirkenden, dreidimensionalen Raum-Bild entsteht im Kopf eine andere Gefühls- und Gedanken-Welt ohne Ablenkung.
Wenn auch in jungen Jahren Freitod oder psychiatrische Klinik lauerten im Hintergrund, mit Glück konnte ich die mir nicht bewusste Abweichung von der Norm beim führenden Lichtsinn und den vermutlich dadurch entstehenden Zwang zum lebenslänglich selber-denken meistern. Anstrengend und mühsam zwar, sich die Welt selber erklären zu müssen, aber letztlich dennoch befriedigend, hinterher betrachtet.
Vielleicht kann mein gedankliches aus mir herauskommen, (engl. coming out), verbunden mit meiner Lebensgeschichte dazu beitragen, Verständnis für Minderheit von anders Sehenden und selber Denkenden zu fördern und aktuell Betroffene mit eigener Gedankenwelt in ihrem Alleingang stützen.
Als gesund gilt in dieser Kultur der Wertvermehrung vor Allen, wer durch reibungsloses Funktionieren in den vorhandenen Strukturen zu Geld und Kapital kommt, was unabhängig der Menge als persönlicher Erfolg verstanden wird, der wiederum verpflichtet. Zum guten Ton gehört deshalb, möglichst keine Gewissens- und Glaubensfragen zu stellen. Das zeitaufwändige Nachdenken über Zusammenhänge in weitestem Sinne hat, so gesehen, etwas anrüchiges, ja fast unmoralisches.
Die Menschen existieren eben, ja und. Leben und leben lassen und sterben, was soll‘s. Bis ins hohe Alter von hundert und mehr Jahren darf mit wachem Geist, was immer das sein mag, am täglichen Geschehen teilgehabt werden, gegen Bezahlung selbstverständlich. Abweichungen von einem demokratischen Idealzustand bilden die Inhalte, was zum unbegründeten Glauben verleiten kann, es komme, was auch kommen möge, schon richtig? Richtig: Fragezeichen.
Darum: Geduld, nimm dir Zeit und nicht dein Leben!

Einfach und verbindlich die Vorstellung der Kelten
***
Nach der Eroberung und Besetzung der keltischen Gebiete durch römische Truppen wurden die Druiden-Schulen vom römischen Kaiser verboten. Die keltische Kultur verlor dadurch ihre Weiter-Bildung und war dem Untergang geweiht. Durchgesetzt hat sich schliesslich eine vom Klerus gnadenlos und gewaltsam durchgesetzte Moral-Lehre im Namen des in Worte gefassten Herrn, welcher vermutlich beim altägyptischen Pharao Echnaton mit der vermenschlichten Sonne (Aton) als Gebieter entstanden sei und dann über Palästina die unbesiegte Sonne (Sol invictus) in Rom ersetzte.
Der nunmehr zum Vater gewordene Glaube an einen einzigen Herr-Gott eignete sich vorzüglich zur vermeintlichen Legitimation und Rechtfertigung von Herrschaft über die Anderen. Die angebliche All-Macht, das zuerst angesprochene unbekannte Wesen als Geist-Gespenst in Form von Gott, bezweckt allein die Herrschaft über Untertanen, welchen das Dogma als Religion zum Glauben gelehrt wird.
Die Verbindung der klassischen Logik mit einer monotheistischen Religion ersetzte die Dreieinigkeit der gedanklichen Polarität, das war der angeboren gesunde Menschen-Verstand der Zusammenhänge, in der keltischen Kultur vermutlich noch folgerichtig vorhanden. Nach dem weitgehenden Wegfall der Religion als Institution durch die Aufklärung und den Kultur-Riss der beiden Weltkriege innerhalb gleicher Generationen bleibt bei der kulturell transportierten Gesinnung mit zweiteilender Denkweise heute den Einzelnen nur noch die Flucht in beliebige Ersatz-Religion wie Ideologie, Politik, Rechte ohne Pflichten, Esoterik, Sport und dergleichen mehr unter Beibehaltung der klassischen Logik, das sei die Ja-oder-Nein-Roboter-Logik der Computer-Maschinen-Sprache mit 0-oder-1.
Resultat wäre aktuell ein Schwarz-Weiss-Denken mit Wortklauberei und Rechthaberei auf allen Ebenen bis hin zu Anfeindung und Übergriff.

Eine Dreieinigkeit vielleicht noch echt keltischen Ursprungs fand ich bei Hildegard von Bingen [1098-1179] im Buch Scivias - Wisse die Wege (2. Teil, 2. Vision). Die Visionsgabe der Leiterin der Bendiktiner-Frauenklause Disibodenberg in der Nähe von Mainz, ein Ort, wo sich bereits um 640 der irische Mönch Disibodus auf der vormals keltischen und später römischen Kultstätte angesiedelt hatte, wurde im Jahre 1147 von Papst Eugen III. autorisiert [nachstehender Auszug ohne den Bezug zur Bibel im Original]:
Es gibt drei Kräfte im Stein, drei in der Flamme und drei im Wort.
2. Die drei in sich abgeschlossenen Entwicklungsstufen des Denkvermögens mit Stammhirn, Zwischenhirn und Grosshirnrinde [Ahnung-Glauben-Denken].
3. Die dreistufige angeborene Denk-Funktion [Erkennen-Unterscheiden-Auswählen], welche bereits für die ersten lebenden Urzellen zwingend war.
Damit ich überhaupt irgendetwas denken (erkennen) kann, muss zwingend eine Unterscheidung und ein Vergleich stattfinden können. Diese Denk-Struktur ist angeboren bereits im Stoffwechsel von organischen Zellen vorgegeben mit Abgrenzung und Durchlässigkeit: erkennen, unterscheiden, auswählen.
Dreieinigkeit ergibt sich von selbst durch die Vermeidung und Aufhebung der Dualität (Zweiteilung) bei zwei sich zwingend bedingenden Tatsachen mit dem Inhalt dazwischen (Geburt/Tod usw.). Aus einer solchen natürlichen Polarität, nämlich der sich gegenseitig zwingend bedingenden weiblichen Eizelle und der männlichen Samenzelle entsteht auch die logische Eins, der Gegensatz zur Null, in Form der Einzel-Person.
Gefühl und Glauben und Denken bewirken in mir vereint einen persönlichen Zustand der Trinität, die Seele. Diese Ausführungen sollen keinen Glauben darstellen, ich glaube sowieso und ohnehin nicht, sondern ich beschreibe hier meine die von mir denkbaren, mehr oder weniger fundierten Vorstellungen der Zusammenhänge.
~ zeitlos gegenwärtig ~







