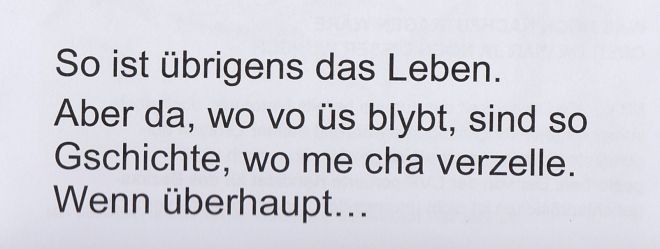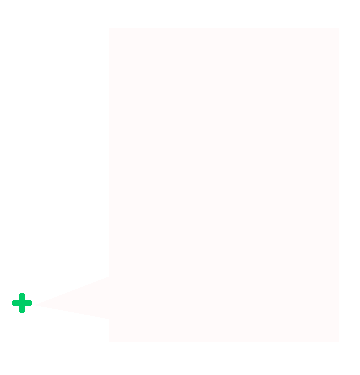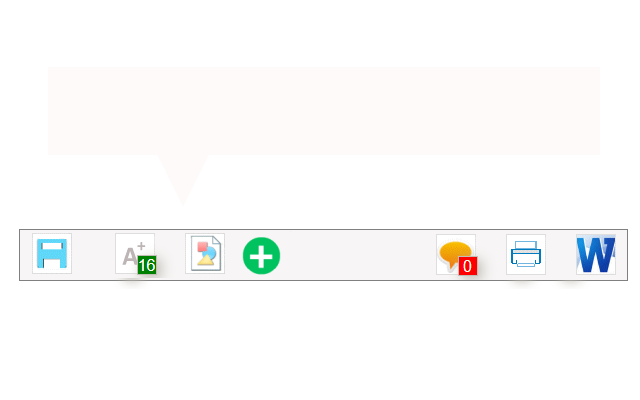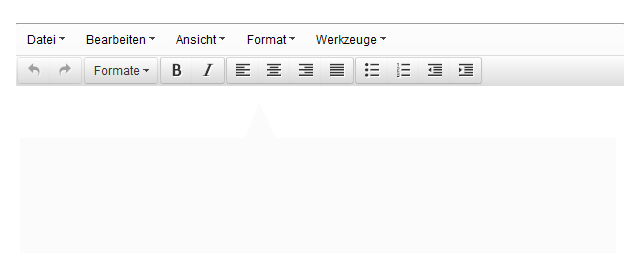Zurzeit sind 519 Biographien in Arbeit und davon 290 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 176

Zu dieser Zeit ein Dörfchen in einer verschwiegenen Ecke der Ostschweiz, im Schatten der Fürstenländer Metropole Gossau, zu der es gebietsmässig gehört, ohne Kirche und Schule, aber mit eigenem SBB-Bahnhof, vier Restaurants, einer USEGO-Kolonialwaren-Handlung, vielen Bauernhöfen, ein paar Gewerbebetrieben und einer Fabrik mit einem kauzigen Patron, der mit seiner ledigen Tochter die das Dorf beherrschende Fabrikantenvilla bewohnt – trotz Anklängen an Güllen in Friedrich Dürrenmatts «Besuch der alten Dame» kein Krimi, sondern eine Ostschweizer Familiengeschichte aus der zu Ende gehenden Stickereizeit bis zu den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts.

Mir selber über den Berg helfen – jo weleweg!

(1) DAS GESCHLECHT DER HELFENBERGER
«Dieses erscheint bereits im 14. Jahrhundert als in die Stadt (St. Gallen) Eingewanderte, auf Gossauer Boden im Jahre 1395. Die ersten Generationen treten als Schmiede auf, spätere als Müller, Tischmacher, Glaser, Schneider, Schuhmacher, Kupferschmiede und Zinngiesser. Mehrere walteten als Dorfvögte. » (Paul Staerkle, Geschichte von Gossau, 373)
Mehr über Geschlecht und Wappen: https://issuu.com/piushelfenberger/docs/woher_kommt_der_name_helfenberger_l
SZENEN AUS DEM LANDLEBEN IM FÜRSTENLAND*) DER VIERZIGER- UND FÜNFZIGER JAHRE DES VERGANGENEN JAHRHUNDERTS
ARNEGG Zu meiner Jugendzeit ein Dörfchen in einer verschwiegenen Ecke der Ostschweiz, völlig im Schatten der Fürstenländer Metropole Gossau, zu der es gebietsmässig gehört, ohne Kirche und Schule, aber mit ein paar Gewerbebetrieben und einer Fabrik mit einem kauzigen Patron, der mit seiner ledigen Tochter die das Dorf beherrschende Fabrikantenvilla bewohnt – trotz Anklängen an Güllen in Friedrich Dürrenmatts «Besuch der alten Dame» kein Krimi, sondern eine Ostschweizer Familiengeschichte aus der zu Ende gehenden Stickereizeit bis zu den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts.*) FÜRSTENLAND Die Schweiz hat zwar keine Fürsten, aber ein Fürstenland. Dieses erstreckt sich etwa von Wil über die Hügellandschaft nördlich von St. Gallen bis nach Rorschach. Und wie kam das Fürstenland zu seinem Namen? – Bis 1798 war das Gebiet Teil des Herrschaftsgebietes der sogenannten Fürstabtei St. Gallen, und die hiess so, weil der Abt gleichzeitig weltlicher Fürst war. [Wandern mit Heinz Staffelbach: Berg und Burg. (NZZ am Sonntag, 01.05.2016)]
KRIEG, KRIEGSENDE UND BESEITIGUNG DER RELIKTE
Mitten im Krieg, am 24. September 1942 war mein Bruder Othmar Ulrich zur Welt gekommen. Wegen eines Herzfehlers hatte er sich nur ungenügend entwickelt, kränkelte und verstarb am 14. Februar 1943, keine fünf Monate nach seiner Geburt, auf den Tag genau acht Monate vor meiner Geburt. Als ich am Donnerstag, 14. Oktober 1943 als zweites Kind der ehrbaren Eheleute Alfons und Marie Helfenberger-Güntensperger das Licht der Welt erblickte, stand diese Welt noch immer im Krieg.
Kein Zweifel, die Schweiz war vom Weltenbrand betroffen, auch wenn man sich an Überflüge und damit an Neutralitätsverletzungen offenbar gewöhnt hatte. Während der deutschen Offensive gegen Frankreich und den damit verbundenen Grenzverletzungen deutscher Flugzeuge war es im Juni 1940 zu Luftkämpfen über Schweizer Hoheitsgebiet gekommen. Die harten Fakten: 70 Mal wurden Bomben auf die Schweiz abgeworfen. Dabei wurden 84 Personen getötet, 260 verletzt. 105 Militärflugzeuge (in der Mehrzahl von der deutschen Luftabwehr getroffene alliierte Maschinen) landeten in der Schweiz und deren Besatzungen wurden bis zum Kriegsende interniert.
Einige der in der Schweiz zwischen 1939 und 1945 7’379 ausgelösten Fliegeralarme dürften auch meinen Eltern den Schlaf geraubt haben. Doch auch bei ihnen macht sich Ende 1942 eine gewisse Hoffnung breit, als sich im Kriegsgeschehen die Wende abzeichnet. Gleichzeitig wird der Krieg, gerade in den grenznahen Gebieten, zu denen auch die Ostschweiz und damit der Kanton St. Gallen gehören, für die Bevölkerung spürbarer und bedrohlicher. Als die Stadt Schaffhausen bombardiert wird, 371 Brand- und Sprengbomben auf die Munoth-Stadt niedergehen, 65 Grossbrände auslösen und 40 Menschen töten, bin ich noch kein halbes Jahr alt. Auch wenn die Schweiz von kriegerischen Handlungen weitgehend verschont bleibt: Ungewissheit und Entbehrungen prägen den Schweizer Alltag. Auch in unserer Familie ist der Krieg hautnah spürbar. Seit November 1940 sind auch im Elternhaus die Fenster nachts mit dunklen Tüchern verhüllt. Die Schweizer Regierung hat, wohl auch auf Druck der Deutschen, die Verdunkelung angeordnet, um die Orientierung der Alliierten an der beleuchteten Schweiz zu verhindern.
Das Haus meiner Eltern ist zentral gelegen und hat zu dieser Zeit für die Arneggerinnen und Arnegger gewissermassen überlebenswichtige Bedeutung. In den Büroräumlichkeiten im Parterre werden nämlich die Rationierungskarten und -marken ausgegeben. Im Dezember 1942 bestehen die Monatsrationen für einen Erwachsenen aus 500 g Zucker, Konfitüre, Honig oder Kompott; für die Marke 500 g Konfitüre konnte man wahlweise 2 kg Kompott bekommen − beides brauchte man als «Gschwellti»-Aufstrich, denn Brot ist ja rar. Zur Monatsration gehören auch je 250 g Reis und Teigwaren, 500g Hülsenfrüchte, 400 g Mehl, Gries, Mais oder Getreideflocken. Mit Fettstoffen kann man nicht schlemmen, denn man hat Anrecht auf 250 g Speisefett, 3 dl Speiseöl, 100 g Butter und 200 g Bratbutter oder Speisefett. Zu zwei Eiern kommen 50 g Trockenpulver, immerhin 400 g Vollfettkäse oder andere Käsesorten. An Brot- und Backwaren dürfen im Tag 225 g verzehrt werden, die 1000 Punkte für Fleisch, Fleischwaren und Fleischkonserven pro Monat reichten auch nicht weit.

In meinen ersten Lebensjahren bin ich so etwas wie das Maskottchen der Rationierungs-Leute aus Gossau. Sobald ich selbständig Treppen steigen kann, suche ich in den Büroräumlichkeiten im Parterre immer wieder deren Nähe. Wohl weniger weil dort Betrieb herrscht, sondern weil die Beamten mich mögen und bisweilen auch etwas Süsses für mich bereithalten. Ohne es zu merken, bin ich bereits in zarter Jugend in die Fänge der Administration geraten. Diese Bindung sollte mein ganzes späteres Berufsleben andauern.
Während des Krieges ist mein Vater als Hilfsdienstpflichtiger in der Ortswehr eingeteilt. Als Kind hatte ich nie richtig kapiert, welches genau sein Auftrag war. Ich wusste nur, dass mein Vater kein Gewehr getragen hatte und mit Sicherungsaufgaben betraut und hin und wieder aufgeboten wurde. Zur Zeit meiner Geburt steht er im St. Galler Rheintal, in Sevelen, als «Telephon-Ordonnanz» an der Grenze.
Meine Mutter bringt mich – wie auch meine beiden jüngeren Geschwister – zu Hause mit Hilfe einer Hebamme zur Welt. Zu jener Zeit sind Hausgeburten der Normalfall. Es ist belegt, dass bereits im Appenzellerland der 1840er Jahre Geburten nach Möglichkeit daheim in der biedermeierlich ausgestatteten Kindbettkammer und auf dem familieneigenen Gebärstuhl stattfanden – also weitgehend in Eigenverantwortung der mündigen Bürgerin. Nur wer ledig war oder armengenössig, suchte Zuflucht im Spital (also beim Staat).
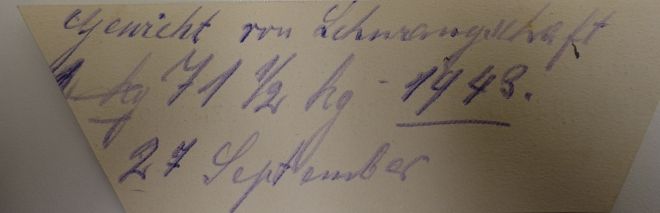
Meine Geburt wird Vater am Morgen des 15. Oktober gemeldet. Er kann die Meldung persönlich am Telefon entgegennehmen. Ob er deswegen gleich Urlaub bekommen hat? Getauft werde ich am Sonntag, 17. Oktober 1943, nur drei Tage nach meiner Geburt, in der Pfarrkirche St. Othmar in Andwil. Taufpaten sind Onkel Johann und die erst 18jährige Tante Klara aus Weinfelden. Ein Taufbild gibt es nicht. Fotoapparate sind zu dieser Zeit selten und Fotografieren den Professionellen vorbehalten. Mamas Liebe zu Bild und Ton kommt erst später zum Tragen.
Die Brutalität des Krieges, von der die Schweizer sonst nur indirekt betroffen waren, manifestiert sich in meiner engeren Heimat ganz besonders in den schweren Luftangriffen auf das am Nordufer des Bodensees gelegene Friedrichshafen. In diesem Zusammenhang war es zur Bruchlandung von gleich 16 US-Bombern auf Schweizer Boden gekommen. Exakt am 14. Oktober 1943, dem Tag meiner Geburt, erfolgt die Notlandung einer fliegenden US-Festung in Aesch/BL, unweit von Münchenstein, meiner zweiten Heimat.

(4) Inschrift am Denkmal, das an die Notlandung des amerikanischen B-17-Bombers «Lazy Baby» erinnert, nahe beim Schlatthof zwischen Aesch und Ettingen
Kommentare:
Maria von Däniken (16.04.2016): «Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie Fakten des Krieges hier so genau beschreiben. Ich hatte bisher nie gehört, wie stark die Schweiz in gewissen Gebieten von Bombern und Bomben betroffen war. Auch wie die Rationierung aussah, die Sie so genau beschreiben, wusste ich nicht.»
Kommentar meines etwas älteren Ostschweizer Kollegen Bruno Krähenbühl (11.01.2016): «Auch meine Kindheit fällt in die Zeit des 2. Weltkriegs. Die Fliegerangriffe auf Friedrichshafen habe ich am Südufer des Bodensees in Uttwil erlebt. Die Schilderungen der damaligen Ereignisse (Fliegerangriffe, Rationierung) hat der Autor sehr realistisch dargestellt. Dafür verdient er Dank und Anerkennung. Mein Vater war damals Grenzwächter. Unsere Familie wohnte im Zollamt Uttwil. Immer wieder waren wir dort auch mit Flüchtlingsdramen konfrontiert. Es war eine interessante aber auch bedrückende Zeit. Auch meine Kindheit fällt in die Zeit des 2. Weltkriegs. Die Fliegerangriffe auf Friedrichshafen habe ich am Südufer des Bodensees in Uttwil erlebt. Die Schilderungen der damaligen Ereignisse (Fliegerangriffe, Rationierung) hat der Autor sehr realistisch dargestellt. Dafür verdient er Dank und Anerkennung. Mein Vater war damals Grenzwächter. Unsere Familie wohnte im Zollamt Uttwil. Immer wieder waren wir dort auch mit Flüchtlingsdramen konfrontiert.»
Sehr dankbar bin ich auch für den Kommentar meines um ein Jahr älteren Schulfreundes Otmar Angehrn (11.01.2016) Er hat seine frühe Kindheit in Moulen/SG verbracht und auf meine Ausführungen wie folgt reagiert:
«Einiges deckt sich mit meinen Erinnerungen, so die Bombardierungen auf Friedrichshafen. Muolen war in der Anflugschneise der alliierten Bomber. Noch Jahre später rannte ich ins Haus, wenn ich ein Flugzeuggeräusch hörte. Hunger hatte ich nie. Im Bauerndorf Muolen bekam man immer wieder "schwarz" Nahrungsmittel. Zu den ersten Wörtern, die ich sagte, gehörte "Eier swaz".»
EINE BEDRÜCKENDE ZEIT Als die deutsche Stadt Friedrichshafen in der Nacht vom 20. auf 21.Juni 1943 bombardiert wird, sind die furchtbaren Detonationen und der infernalische Feuerschein von unserem Haus in Arnegg aus gut zu sehen. Bis im Juni 1944 folgen insgesamt 11 Luftangriffen der Alliierten auf die Zeppelin-Fertigungshallen. Obwohl ich einen Teil davon nur im Mutterleib erlebe, müssen diese Bombardements auch bei mir traumatische Eindrücke hinterlassen haben. Auch bilden sie immer wieder Gegenstand von Erzählungen im Familienkreis. Schon als kleines Kind bin ich ängstlich und suche dem Vernehmen nach mit Vorliebe unter Grossmutters und Mutters Rockstössen Zuflucht. Noch in der Primarschulzeit ängstigen mich feurig-rote Gewitterstimmungen am Himmel.
WER NIE AUF DEM BLECHTOPF SASS Es scheint, als hätte man im elterlichen Hause dem Frieden nicht so recht vertraut, denn sowohl die Verdunklungsvorhänge als auch die metallummantelten blauen Verdunklungslampen fristeten in den Lagerräumlichkeiten noch verlängerte Zeit ein Dasein. Während der Kriegszeit hatten sie auch bei uns nachts ihr fahles dunkelviolettes Licht ausgestrahlt, allerdings nur nach vorne. Zusammen mit den Verdunkelungsvorhängen sollten Häuser bei Nacht für Flugzeuge weniger erkennbar sein und deren Besatzung Orientierung und das Auffinden von Ziele erschwert werden. Erstaunlich ist, dass Verdunkelungsmassnahmen in der Schweiz bereits 1938 geprobt wurden.
Für meinen Bruder und mich war es das Höchste, uns beim Versteckspiel zuoberst auf den Lagergestellen zwischen den angestaubten Verdunklungsvorhängen zu verbergen. Schon früh hatte ich hinter den Vorhängen ein seltsames Gebilde aus Draht und weissen Perlen entdeckt. Zwar hatten mir meine Eltern ausdrücklich verboten, damit zu spielen. Wie wir erst später erfuhren, handelte es sich dabei um einen «Chrällelichranz», einen recht dauerhaften Grabschmuck, der noch vom Grab meines verstorbenen Bruders Othmar stammte. Später entfalteten wir die Vorhänge ganz, hüllten uns darin ein, bis sie vollständig zerrissen waren und entsorgt wurden. Still und leise war eines Tages auch der Grabschmuck verschwunden. In meinem Erwachsenenleben bin ich auf einem Flohmarkt noch auf einen «Chrällelichranz» gestossen. Als «Pièce de résistance» sind dort bisweilen auch noch jene multifunktionalen Gebilde aus Holz mit Rädchen und Zählrahmen zu finden, in die man mich und meine Geschwister als Kleinkinder gesetzt hatte, auch zu Tisch. Der Clou des Ganzen war das Loch im Sitz. Darunter konnte ein Blechtöpfchen befestigt werden, in welchem sich die Ausscheidungen sammeln konnten – alles äusserst praktisch, vor allem in der warmen Jahreszeit; dank des blechernen Untersatzes mussten weniger Windeln gewaschen werden.

(5) Kindersitz aus der Zeit, äusserst polyvalent, hier als Hochsitz - ganz ohne Blechtopf
Im Übrigen war meine frühe Kindheit unbelastet. Das sagt sich leicht, aber es war tatsächlich so − zumindest bis zur Geburt meines jüngeren Bruders Gallus im Jahre 1946! Jedenfalls ist über frühe ernsthafte Erkrankungen nichts bekannt. Ursachen meiner starken Furchtsamkeit dürften zum einen gewisse frühkindliche Erlebnisse während der letzten Kriegsjahre, zum anderen die Angst meiner Eltern nach dem Verlust ihres Erstgeborenen gewesen sein.
Wegwerfwindeln existierten zu dieser Zeit in Arnegg ebenso wenig wie eine Kehrichtabfuhr. Nicht nur in unserem Haushalt fielen kaum Haushaltsabfälle an. Weggeworfen wurde fast gar nichts; alles konnte für irgendeinen Zweck noch gebraucht werden. So hatte Vater stets gebrauchte Kuverts aufgeschnitten und als Notizpapier verwendet. Die «nassen Haushaltsabfälle», also Essensreste, Rüst- und Gartenabfälle wurden im Garten kompostiert. Kleinstabfälle aus der Küchenabfälle wie ein Teebeutel verschwanden schon mal durchs offene Küchenfenster Richtung Bach – eine Art Express-Entsorgung. Alles Brennbare wurde im Ofen oder im Herd verbrannt, Ende der vierziger Jahre wurden wohl auch die zerfetzten Verdunklungsvorhänge. Der unbrennbare Kehricht, wie Büchsen, Scherben, Steine und Metall, wurde dann und wann in einer Deponie entsorgt. Zu diesem Zweck lud Vater den Tieflader-Veloanhänger mit Unrat und fuhr damit zur einzigen Arnegger Kehrichtdeponie. Das kleine Tobel, in das der Müll gekippt wurde, befand sich an abgelegener, recht romantischer Lage in Nähe der Grenze zur Gemeinde Hauptwil bzw. zum Kanton Thurgau. Als ich später als Ältester diese Entsorgungsaufgabe zu übernehmen hatte, kam mir dies nicht einmal so ungelegen, denn die Kehrichtgrube war für Entdeckungen und Überraschungen immer gut. Unvergesslich bleibt mir, wie dort, am Rande der Deponie, ein Mann während mehr als eines Sommers campierte. Ich erinnere mich sehr wohl an sein kleines Zelt, nicht aber an ein Gespräch mit ihm. Wir Kinder mieden den hochdeutsch sprechenden Naturfreund und fragten uns, was diesen etwas seltsamen Mann wohl veranlassen konnte, die Sommerfrische bei der Deponie zu geniessen. Hatte er nach wiederverwertbaren Altmetallen gesucht oder war er ein Vorläufer von Gossau Tourismus?

(6) Mama mit ihren beiden Söhnen Pius (l) und Gallus (um 1948)
Zu dieser Zeit wurde nachhaltig gelebt. Strümpfe und Strumpfhosen wurden von Tante Klara gestrickt und nötigenfalls gestopft, an Pullover längere Bündchen angestrickt, Hosen mit Borten verlängert. Zum Einkaufen und zur Schule wurde zu Fuss gegangen, Einkäufe meist in einem Netz transportiert und die Milch mit dem «Milchchesseli» in der Dorfkäserei geholt. Von den ausgedienten Kleidern wurden alle noch verwertbaren Dinge, wie Knöpfe oder Reissverschlüsse, abgetrennt, der Rest zum Flicken oder als Putzlappen genutzt. Geschenkpapier wurde vorsichtig geöffnet, um dieses wieder zu verwenden. Altpapier und Flaschen wurden durch Schulkindern gesammelt. Wir waren noch Lichtjahre entfernt von Handys, elektronischen Spielen und Apps. WhatsApp von damals waren unter der Schulbank herumgereichte Zettel. Man verabredete sich mündlich, telefonisch nur in Ausnahme- oder Notfällen.
.
Was weisst du über deine Geburt?

Namen als Programm

Namen als Programm
Aus einer guten Familie zu kommen, bedeutet nicht, Geld zu haben. Aus einer guten Familie zu kommen bedeutet, Respekt, Anstand und Werte kennengelernt zu haben. So betrachtet, ist bereits die Namensgebung prägend. Onkel Johann dürfte nicht nur in meinem, sondern auch im Falle meiner Geschwister ein gewichtiges Wort mitgesprochen haben.
Pius und Gallus - zwei lateinische Namen, aber auch zwei Programme. Unsere Schwester erhielt einen biblischen Namen mit hebräischer Herkunft.
- Pius, der Gottesfürchtige; du ruhst in dir, bist immer friedlich, schlichtest jeden Streit noch gütlich. So schaffst du, was sonst keiner schafft – in deiner Ruhe liegt die Kraft!
- Gallus, übersetzt «der Hahn», erster Heiliger der Schweiz, der vor 1400 Jahren den Grundstein für die Stadt St. Gallen gelegt haben soll.
- Elisabeth, übersetzt „mein Gott ist Fülle" und „Gott ist vollkommen".
Was meinen eigenen Vornamen anbetrifft, war ich zu lange zu sehr auf Pius X. und Pius XII. fokussiert. Erst nach meiner Immatrikulation an der Juristischen Fakultät der Universität Basel bin ich auf Papst Pius II. aufmerksam geworden (1458 bis 1464), bedeutender Humanist, Schriftsteller, Historiker, lateinischer Poet und Gelehrter, Verehrer Boccaccios und begeistert von den Klassikern. Von ihm hatte im November 1459 der Rat der Stadt Basel eine Stiftungsurkunde für die neue Universität erhalten. Dessen Namen trage ich inzwischen mit einigem Stolz, vor allem seit ich weiss, dass er als Enea Silvio Piccolomini auch am Konzil von Basel massgeblich mitgewirkt und sich später sehr mit der Niederschrift seiner Autobiografie beschäftigt hat, den «Commentarii», der einzigen Papst-Autobiografie überhaupt.
«Am Anfang war das Wort», besagt die Schöpfungsgeschichte von Matthäus, und die Paläobiologen bestätigen, dass der Homo sapiens nach geraumer Zeit erkannte, dass sich die flüchtigen Laute, zu Worten gefasst, auch bildlich mit gegenständlichen oder abstrakten Zeichen festhalten liessen. Daraus ergeben sich für mich die folgenden Erkenntnisse:
- Das Verfassen einer Lebensgeschichte gehört nach meinem Verständnis gewissermassen zum Fussabdruck, den ich auf dieser Welt hinterlassen möchte, im Sinne von Open History.
Dagegen könnte man anführen, dass (auch) Schreiben Ausdruck von HABEN - und nicht von SEIN ist. - Vielleicht macht Schreiben sogar glücklich. [Louis Begley]
- Aber muss es denn ausgerechnet die eigene Vergangenheit sein? – Familiengeschichte, Herkunftsgeschichte, das ist ein steter Kreislauf. [Agnès Jaoui, Schauspielerin, Regisseurin und Autorin]
Die Sache hat diesen oder jenen Haken. So sollen dazu neigen, unsere Jugendzeit zu verklären.
Ich bin jedenfalls gewarnt.
Ein Wunsch
Verrückt, wie schnell Dinge vergehen – und vor allem wie rasant schnell in Vergessenheit geraten. Wie wertvoll wären für mich Aufzeichnungen meines Vaters oder gar meines Grossvaters! – In meinen Augen hat dies keiner so trefflich formuliert wie Ulrich Bräker, der arme Kleinbauer und Garnhausierer im Toggenburg in «Lebensgeschichte und natürliche Ebentheuer des Armen Mannes im Tockenburg»*). Nur wenige Wochen hatte Bräker eine kümmerliche Dorfschule besucht, doch sein Herz stand für alles Schöne und Gute weit offen. Dies adelte ihn und vergoldete ihm viele der düsteren Abende, die er bei schwacher Lampe mit «Kritzeleien und Hirngeburten» zubrachte, während denen er die Geschichte seiner Jugend- und Mannesjahre beschrieb und es damit zum ersten plebejischen Schriftsteller in der Literatur des 18. Jahrh. Deutschlands brachte (Hans Mayer). Im Verlaufe meiner familiengeschichtlichen Recherchen hatte auch ich diesen ungeheuer starken Wunsch nach Aufzeichnungen meiner Vorfahren verspürt und mir geschworen, diesbezüglich meinen Teil zu leisten.
*) «Ist's Hochmuth, Eigenliebe? Freylich! Und doch müsst' ich mich sehr misskennen, wenn ich nicht auch andere Gründe hätte. Erstlich das Lob meines guten Gottes, meines liebreichen Schöpfers, meines bessten Vaters, dessen Kind und Geschöpf ich eben so wohl bin als Salomon und Alexander. Zweytens meiner Kinder wegen. Ich hätte schon oft weiß nicht was darum gegeben, wenn ich so eine Historie meines sel. Vaters, eine Geschichte seines Herzens und seines Lebens gehabt hätte. Nun, vielleicht kann's meinen Kindern auch so gehen, und dieses Büchlein ihnen so viel nützen, als wenn ich die wenige daran verwandte Zeit mit meiner gewohnten Arbeit zugebracht hätte. Und wenn auch nicht, so macht's doch mir eine unschuldige Freude, und ausserordentliche Lust, so wieder einmal mein Leben zu durchgehen. Nicht daß ich denke, daß mein Schicksal für andre etwas seltenes und wunderbares enthalte, oder ich gar ein besondrer Liebling des Himmels sey. Doch wenn ich auch das glaubte - wär's Sünde? Ich denke wieder Nein! Mir ist freylich meine Geschichte sonderbar genug; und vortrefflich zufrieden bin ich, wie mich die ewig weise Vorsehung bis auf diese Stunde zu leiten für gut fand. Mit welcher Wonne kehr' ich besonders in die Tage meiner Jugend zurück, und betrachte jeden Schritt, den ich damals und seither in der Welt gethan. Freylich, wo ich stolperte - bey meinen mannigfachen Vergebungen - o da schauert's mir - und vielleicht nur allzugeschwind werd' ich über diese wegeilen. Doch, wem wurd's frommen, wenn ich alle meine Schulden herzählen wollte - da ich hoffe, mein barmherziger Vater und mein göttlicher Erlöser haben sie, meiner ernstlichen Reue wegen, huldreich durchgestrichen. O mein Herz brennt schon zum Voraus in inniger Anbetung, wenn ich mich gewisser Standpunkte erinnere, wo ich vormals die Hand von oben nicht sah, die ich nachwärts so deutlich erkannte und fühlte. Nun, Kinder! Freunde! Geliebte! Prüfet alles, und das Gute behaltet.»
[Bräker: Lebensgeschichte und natürliche Ebentheur des Armen Mannes im Tockenburg, S. 6. Digitale Bibliothek Band 1: Deutsche Literatur, S. 13859 (vgl. Bräker-S Bd. 1, S. 72)]
Welche andern frühen Ereignisse hast du nicht vergessen?

Einer der aufregendsten Tage
Aufregendes ereignete sich am 8. Juli 1949 zur Mittagszeit im Hause Helfenberger-Güntensperger in Arnegg. Es war ein heisser Sommertag, bestimmt ein Freitag, denn aufgetischt waren Dorschfilets mit Salzkartoffeln und Salat. Zu Tisch sassen meine Mutter, hochschwanger, ein deswegen etwas unruhiger Vater, mein Götti Johann, eine greise Grossmutter sowie mein Bruder Gallus und ich. Plötzlich spürte ich, wie mir eine Fischgräte im Hals stecken blieb, ein Gefühl, das ich so noch nie erlebt hatte. Dieses Ding in meinem Hals wollte ich so schnell wie möglich loswerden. Ich begann, mich laut zu räuspern, doch die Gräte schien festzustecken. «Einfach ruhig bleiben, zusammen mit Kartoffeln geht das schon wieder runter». Trotz dieser gut gemeinten Ratschläge begann ich laut zu schluchzen. Hektik kam auf, denn bei mir ging auch beim besten Willen nichts mehr – im Gegenteil. Plötzlich war sie da, diese Angst, zu ersticken. Vater machte sich im Laufschritt auf zum Samariter-Posten, damals in der Garage Pfister, während sich mein Götti und meine Patin rührend um mich kümmerten. Und siehe da: plötzlich liess der Druck nach und die Gräte bewegte sich, langsam zwar, nach unten. Gosse Erleichterung – der Himmel hatte die Stossgebete erhört!
Vater war derweil wieder zurückgekehrt und begab sich erleichtert zur Mutter ins Schlafzimmer, um kurz danach völlig verdutzt die Küche wieder zu betreten und zu verkünden: «Das Kind ist schon da!» Es war bereits nach der ersten Wehe zur Welt gekommen, eine klassische Sturzgeburt also. Während die Hebamme gerufen wurde, hiess es für meinen Bruder und mich mit Götti zusammen «Ab in den Wald». Nach all dem Schrecken sollten wir Kinder etwas Lustiges erleben. Als wir am späteren Nachmittag wieder nach Hause zurückkehrten, lag zur grossen und freudigen Überraschung unser Schwesterchen Anna Maria Elisabeth in ihrem Stubenwagen. Was für ein Happyend nach einem der verrücktesten Tage unserer Familiengeschichte!

(1) Pius, Schwesterchen Elisabeth und Bruder Gallus, 1950
Welche Rolle spielten in deinem Leben deine Patin und dein Pate für dich?


(1) Johann Helfenberger (1896 – 1983) Lehrer in Meistersrüte-Appenzell
Er war in der Wohnstube stets präsent, dieser mahnende Pädagogen-Blick meines Götti-Onkels.
Hier mehr: www.schule-meistersruete.ch/wp-content/uploads/2018/08/Helfenberger-Johann.pdf">www.schule-meistersruete.ch/wp-content/uploads/2018/08/Helfenberger-Johann.pdf

(2) Eines der seltenen Bilder aus gesunden Tagen: Taufpatin Klara mit ihrem Gottenkind im Garten

(3) Sommer 1945, ein Jährchen später: Götti Johann mit Pius im Garten
Ein Sommertag in der Familie Helfenberger um die Mitte des letzten Jahrhunderts
Liebe Klara
Pius musste vom Montag bis am Samstag im Bette sein. Er hatte immer etwas Fieber und Husten. Als dann am Samstag die Fahrer von „La Tour de Suisse“ in Arnegg vorbeikamen, durfte er aufstehen und von da an ging es wieder besser. Pius muss schon etwas in den „Senkel“ gestellt werden. Beim Spiel regiert er alles, zerrt alles hervor und versorgt es nicht, hat gern das letzte Wort und glaubt, man müsse immer nur tun, was er wolle.
Am 1. August habe ich beiden ein Lampion gekauft und ein paar Sternenregen. Wir feierten dann Augustfeier vor dem Haus. Mit den brennenden Lampions durften sie dann ums Haus marschieren, und die Sternenregen wurden abgelassen. Im Scheine der brennenden Lampions haben dann die beiden Buben in der Kammer das Nachtgebet gebetet.
Marie (Mutter) geht es ganz gut. Sie arbeitet vom Morgen früh bis am Abend spät. Jetzt hat sie ja erst recht alle Hände voll zu tun, drinnen und draussen.
Alfons (Vater) ist immer der gleiche. Er ist nicht immer beim Bettzeitläuten zu Hause. Das Kindchen trägt er noch gern herum, es sieht zwar oft etwas gstabig aus, wenn das kleine Geschöpf auf seinem Arme ruht.
Der Grosi (Grossmutter väterlicherseits) geht es ordentlich. Sie hat fast jeden Tag „Modeschau“, Sommer- und Winterkleider übereinander, Rock und Schoss in die Hosen gestopft. Letzthin hat sie die Eier droben auf dem Estrich im Kindshafen versorgt. Natürlich steht sie immer am Waschtrog und reibt am Geschirr, am Tisch und Trog.
Als ich in Arnegg weilte, kam Fredli (Alfred, Onkel mütterlicherseits) zweimal kurz auf Besuch. Mit dem Töff ist er ja schnell in Arnegg. Beim ersten Mal war Lina (seine Frau) dabei und letzten Sonntag die Schwester von Lina, Heidi.
Leo (Onkel väterlicherseits) war auch letzten Sonntag zu Hause, um sein „Gotteli“ (Gottenkind) zu besichtigen. Pius und Gallus hatten natürlich wieder Hochbetrieb und liessen ihm wenig Ruhe.
Und wer kommt jetzt noch dran, die Kätzchen. Alle drei sind noch am Leben und drohlen sich hinter dem Haus herum, also eine ganz lebhafte Gesellschaft. Pius, als Regent, dann seine Trabanten Gallus und Kurt Hefti, Vreneli und Noldi Forster und zwischen hinein und zwischendrin die jungen Katzen.
Und wie geht es Dir? Du hast schon prächtiges Kurwetter erraten. Du wirst auch wieder viel gesehen und gehört haben und allerlei zu erzählen wissen. Freust Dich auf die Heimkehr? Denk ja!
Die Küche meiner Kindheit

FEINES AUS DEM KACHELOFEN. Anfangs der fünfziger Jahre gab es sie bei uns zu Hause noch dieses wohlvertraute Essen mit der vom grosselterlichen Haushalt herrührenden, ursprünglich bäuerlichen oder häuslichen Dörrkultur, die einst vielen Familien das Überleben gesichert hatte. Im Herbst wurden die mit Obst belegten Gitterroste in den Ofen geschoben. Der traditionelle Obstbau war primär auf die Selbstversorgung ausgerichtet. Die getrockneten Früchte bedeuteten im Winter eine wertvolle Ergänzung zu einer eher einseitigen Ernährung mit Milchprodukten, Brot und Fleisch - eine Kreislaufkultur, in welcher Birnen, Äpfel, Zwetschgen die Hauptrolle spielten. Gedörrtes Obst bildete eine wichtige Ernährungsgrundlage. Im Vorratszimmer lagerten die gedörrten Birnen- und Apfelschnitze sowie Zwetschgen gleich kesselweise. Dort pflegte ich mich heimlich zu bedienen, wenn ich wieder mal ohne Znacht ins Bett musste.
EINMACHZEIT. Ein Bild, das in meiner Erinnerung haftet: «Man kann aus allem Konfitüre machen. Es ist nur eine Frage der Phantasie». So viel Phantasie brauchten Mutter und Klara gar nicht, denn Himbeeren, rote und schwarze Johannisbeeren, Stachelbeeren, auch Früchte wie Zwetschgen und Pflaumen, aber auch Rhabarber, alles frisch und meist in Unmengen, standen zur Verarbeitung bereit. Kein Wunder also, dass auf dem Tisch unseres Elternhauses kaum gekaufte Konfitüre zu sehen war. Im Keller standen die Gläser mit Konfitüre und Kompott in Reih und Glied. Und wenn mal ein Glas nicht mehr so ganz «comme-il-faut» war, wurde es nicht gleich weggeschmissen, sondern die oberste Schicht sorgfältig abgeschöpft.
NICHTS FÜR VEGETARIER! Weniger appetitlich – zumindest aus heutiger Sicht – und nicht abhängig vom Wochentag war «Gestell», also Ragoutstücke von Kalbsherz, Lunge und Nieren. Gestell war beliebt und wurde damals in der Ostschweiz ab und zu noch aufgetragen. Wochentags dominierten bedeutend weniger edle Fleischstücke, eben auch Innereien, niemals aber am Freitag. Das galt rigoros. Der Freitag war oft Fischtag. Dumpfe Schwaden im Treppenhaus haben die in der schwarzen Bratpfanne im Öl ausgebacken Kabeljau-Schnitten jeweils schon angekündigt. Es waren diese Fischdüfte, die wohl noch am Nachmittag in den Kleidern hockten, denn gegessen wurde in der Küche. Später kamen auch bei uns die als fingergrosse Portionen panierten Fischstäbchen in Mode. Mit Petersilienkartoffeln und Mayonnaise haben alle am Freitag wieder mit Freude Fisch gegessen, abwechslungsweise mit «Flade».
Süssspeisen waren häufig auf dem Tisch, auch am Mittag, entweder in Form von Mais- oder Griessschnitten oder Brotrösti, zusammen mit Kompott, einfache und währschafte Mahlzeiten, wohl mehr auf uns Kinder zugeschnitten als auf die Erwachsenen. Vater hielt sich dann mit einem Zvieri schadlos, mit etwas Käse oder Wurst. Besonders angetan war er von Ölsardinen, direkt aus der Dose genossen – zu einem Glas Most notabene – oder auch von einem frisch aufgeschlagenen Ei, das er mit hörbarem und sichtlichem Genuss schlürfte. Mutter wachte peinlich darüber, dass keine alkoholischen Getränke ins Haus kamen. Gewisse Ausnahmen gab es nur bei Besuchen. Vater war wohl oder übel gezwungen, sein Glas Wein auswärts zu trinken. Als Essensbegleiter für Kinder gab es auf Tee, ab und zu Süssmost Beliebt waren abends Mehlspeisen mit Früchten oder ein «Baibrot» (mit etwas Butter im Ofen oder in der Bratpfanne getoastete Schwarzbrotscheiben), dazu Tee. Für die Erwachsenen gab es oft Café complet, ein einfaches Schweizer Gericht, bestehend aus Milch, Kaffee, Brot, Butter und Konfitüre.
Omeletten, meist begleitet von einem Früchtekompott, schätzten wir auch Mittags sehr. Im Sommer war Götterspeise immer ein Hit. Früchte aus dem Garten waren beliebt, Gemüse weniger. Mutter zog so ziemlich alles en masse, von den Tomaten und Stangenbohnen bis hin zu Kohlrabi und Kartoffeln. Ich erinnere mich an Mutters grosse, lange und kiloschwere Zucchetti. Dieses Gemüse war damals bei uns gerade so richtig in Mode gekommen. Jeder wollte die grössten haben. Und Mutter verarbeitete die schweren Dinger entweder (mit Tomaten, Zwiebeln, Kartoffeln und Bohnen) zu einer Art Ratatouille. Oder es gab gefüllte Zucchetti. Ganz speziell à la Mama war die Dessert-Variante, nämlich eine Verbindung von Zucchetti und Ananas!
Mutter hatte sie sich noch kaum den Kopf über raffinierte Zubereitungsarten zerbrechen müssen. Zutaten und Mengenangaben waren relativ, verwendet wurde, wie und was in die Finger kam, abgewogen wurde selten − ein bisschen wie bei einer italienischen Nonna. Mama war vor allen Dingen wichtig, dass die Fünfziger-Note, die Vater jeweils in die aus Draht gefertigte Haushaltkasse zu legen pflegte, für die ganze Woche reichte − nicht mehr und nicht weniger.
Überfluss hingegen im Sommer beim Gemüse. Tomaten, Stangenbohnen und «Höckerli» (niedrige Buschbohnen), Chefen und Rüebli gediehen im Garten hinter dem Haus prächtig. Auch Beeren und Früchte gab es zeitweise in Hülle und Fülle: Himbeeren, Johannisbeeren, Aprikosen, Zwetschgen, Birnen und Äpfel. Besonders in Erinnerung geblieben sind mir die saftigen Aprikosen. Nicht nur deshalb, weil sie am Spalierbaum auf der Südseite ausgezeichnet gediehen, auch wegen ihres doppelten Nutzens. Eine Zeitlang labten wir uns auch an den heimlich am Bächlein geknackten Aprikosenkernen, deren Schalen wir dann den Bach hinunter zu schicken pflegten. Heute weiss ich, dass wir uns damit einiges an lebensgefährlicher Blausäure einverleibten. Wir haben's zumindest überlebt!
Süsses gab es hauptsächlich Ende Jahr, während der Weihnachtszeit, um Neujahr und zur Fasnachtszeit. Die letzten Weihnachtsguetzli waren noch nicht gegessen, der letzte Neujahrs-Birewegge noch nicht verspeist, war schon wieder Zeit für die ersten Fasnachtschüechli. Diese warteten gleich zainenweise*) im abgeschlossenen Vorratszimmer, neben den Fasnachtsschenkeli. Und Mutter glaubte jeweils, den Zimmerschlüssel gut versteckt zu haben. Doch wegen der strategisch ausgezeichneten Lage – mein Schlafzimmer befand sich gleich neben dem Vorratszimmer – hatte ich jedes neue Schlüsselversteck rasch wieder ausfindig gemacht.
*) Zaine: (grosser Korb mit zwei Griffen, z.B. für Wäsche)
In weniger guter Erinnerung ist mir das Knollengemüse, das im Keller runzelnd lagerte und den Speisezettel zum Überdruss dominierte. Es gab Zeiten, da provozierte bei mir bereits das Wort 'Gulasch' Brechreize. Die paar Fleischkrümelchen waren immer im Nu weg, und zurück blieb das grosse Würgen vor dem nur noch mit einer dünnen Bratensauce befeuchteten Kartoffelberg. Doch der Teller musste leer gegessen werden, da gab es überhaupt kein Pardon! Besonders suspekt waren gelbe Rüben und faserige Kohlrabi, Knollen, die heute wohl nur noch an Schweine verfüttert würden. Allein der Geruch konnte einem schon den Magen kehren. Gegessen habe ich mit Todesverachtung, in extremen Fällen nur unter Androhung von Körperstrafen, z.B. auf den Knien und mit ausgebreiteten Armen vor dem Hausaltärchen zu verharren. Zum Glück verhalfen da die eingeschlagenen Kabis- und Kohlköpfe den Winter einigermassen «grün» zu gestalten: Irgendwann meldet sich die Lust auf die ersten knackigen Salätchen, auf junges Gemüse und frische Kräuter. Früher erklärte man diesen Sturm auf das zarte Grünzeug mit den erschöpften Vitaminen und andern fehlenden Aufbaustoffen. Heute, wo selbst Bio-Freunde sich mit Broccoliröschen, Artischocken und Fenchel über die kalte Jahreszeit halten können, wirken derlei Gründe nur mehr fadenscheinig. Folglich muss es einfach am Frühling liegen.
Vater hätte kein Tier töten können. War ein Kaninchen angesagt, war Onkel August zur Stelle, der Mann fürs Grobe. Da verzogen wir uns dann nach der Begrüssung lieber wieder. Ich hatte nie Skrupel, eigene Tiere zu essen. Verspeist wurden ja nicht junge, herzige Tierchen, sondern die sich wegen der damals üblichen zu engen Haltung meist aggressiv oder apathisch gewordenen älteren Exemplare. Obwohl sämtliche Teile davon, auch der Kopf, zubereitet wurden, ass ich Kaninchenfleisch ausgesprochen gern – und tue es immer noch, ganz wie mein Grossvater. Wenn ich da an die Kaninchenzünglein denke... Einmal hatte ich die Mutter zu assistieren, als sie ein Huhn enthauptete. Das Huhn – wohl auch nicht mehr das jüngste – tat mir wirklich leid!
Wie war es draussen? Gab es einen Hof oder einen Garten?


(1) Arnegg, ca. 1952 (Foto Gross AG)
EIN WAHRES ELDORADO FÜR KINDER
Unser Elternhaus befand sich in Arnegg an der Hauptstrasse im Ortszentrum, schräg gegenüber dem Restaurant 'Ilge', dem wohl bekanntesten Gebäude mit markantem Giebeldach, Glockentürmchen und roter Schindelfassade (etwas unterhalb der Bildmitte Rtg. rechts im Bild). Hinter dem Elternhaus war damals mit vielen, vielen Obstbäumen besetztes Wiesland, das bis zum Bahngeleise (am linken unteren Rand) reichte, auf der andern Seite klar begrenzt durch das Areal der Kartoffeltrocknungsanlage (mit Kamin) und der Weberei Saladin.


Meine Mutter Marie Helfenberger-Güntensperger
Als älteste von drei Geschwistern kam meine Mutter am 26. September 1914, also zu Beginn des 1. Weltkriegs in einer Bauernfamilie in Weinfelden/TG zur Welt. Noch heute befindet sich der Bauernhof Eierlen im Familienbesitz. Als meine Mutter zur Welt kam, war ihr Vater bereits 42.
Marie besuchte die Schulen in Weinfelden. Sie muss eine gute Schülerin gewesen sein. Mir unvergesslich bleibt, dass sie vierzig Jahre später noch aus dem in der Schule gelernten französischen Gedicht «Voici le printemps» rezitieren konnte. Nach der Schule half sie zu Hause aus und diente, wie das damals hiess, bei verschiedenen Herrschaften, so u.a. in derjenigen eines Müllereibesitzers in Wigoltingen/TG. Zwischendurch muss Marie immer wieder bei ihren Eltern zu Hause aushelfen, weil ihr Bruder Alfred als Dragoner Aktivdienst zu leisten hatte. Später arbeitete sie im Service, in Müllheim, dann im Restaurant «Sternen» in Arnegg/SG. Dort lernte sie ihren Zukünftigen kennen und es entstand die schicksalhafte Beziehung, aus der meine beiden Geschwister und ich hervorgehen sollten.

(1) Einen Jux wollten sie sich machen, die beiden Schwestern Klara (l) und Marie
Ansonsten waren die Zeiten alles andere als lustig: Bruder Alfred als Dragoner im Aktivdienst und alle übrigen gleichermassen gefordert: auch der kranke Vater, die Mutter und die beiden Töchter.
PIONIERHAFTE GESCHÄFTSFRAU
Dörren war einmal, Einmachen zunehmend als zu aufwändig empfunden. Nachdem die Tiefkühl-Welle von den USA hinüber nach Europa hinweg geschwappt war, hat Mama hat in Arnegg ein Stück lokale TK-Geschichte geschrieben. Doch schön der Reihe nach: Begonnen hatte die Vermarktung von Tiefkühlkost in den Dreissigerjahren in Amerika, wo der Biologe Clarence auf einer Reise beobachtete hatte, wie die Inuit bei über minus 40 Grad Celsius Fische angelten. Die Fische gefroren, kaum waren sie aus dem Wasser gezogen. Als er den Fisch später verspeiste, schmeckte er zu seiner Freude wie frisch aus dem Wasser. Aus dieser schmackhaften Erfahrung entwickelte Clarence Birdseye eine neue Geschäftsidee und brachte 1930 unter dem Namen "Birdseye" die erste Tiefkühlkost in die Läden. Die Erfolgsgeschichte setzte sich Mitte der Fünfzigerjahre über Deutschland auch in der Schweiz fort, bis nach Arnegg, wo sich Mama ebenfalls begeistern liess. In Zusammenarbeit mit der Gossauer Firma Schwizer ermöglichte sie, dass auf dem freien Grundstück neben unserm Elternhaus ein kleines Kühlhaus entstand, wo Interessierte ein kleines oder grösseres TK-Fach mieten konnten. Mama hattr gleich für die nötige Mund-zu-Mund-Propaganda gesorgt und den Betrieb überwacht. Damit konnte sie mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zum einen hatte sie genügend Platz für all ihre Früchte, ihr Gemüse und ihr Fleisch, zum anderen – gut sichtbar – etwas Eigenes, das ihr dies und jenen zusätzlichen sozialen Kontakt verschaffte.
ZU VIEL FREUNDLICHKEIT KANN GEFÄHRLICH SEIN Mutter hatte sich um (fast) alles zu kümmern: um Haushalt, Kinder, Haustiere und bei Vaters Abwesenheit auch ums Geschäft. Hinzu kam der grosse Gemüse- und Beerengarten. Zu einem guten Teil waren wir Selbstversorger. Für Mutter war der Garten aber nicht nur harte Arbeit, sondern immer auch Ort der Abwechslung und Freude. Auch der Ziergarten lag ihr am Herzen und wollte gepflegt sein. Es versteht sich von selbst, dass diese Pflege nicht so intensiv sein konnte wie zu den grosselterlichen Zeiten, als der Garten als einer der schönsten in Arnegg galt. In den sechziger Jahren wurde wieder einmal sichtbar, wie sehr der Zahn der Zeit am Eisengestell des alt-ehrwürdigen Gartenpavillons genagt hatte. Deshalb war Mama entschlossen, diese zugänglichen Stellen vor dem Austrieb des den Pavillon einhüllenden Geissbarts neu zu streichen, und zwar eigenhändig, wie sie das auch im Haus immer wieder getan hatte. Doch in den oberen Partien hätte sie dies nicht allein schaffen können – zu riskant das Ganze. Deshalb wurde sie beim Anstrich der rostigen Stellen mit einer Rostschutzfarbe durch Bruder Gallus tatkräftig unterstützt. Er stand mit dem Pinsel zuoberst auf der Leiter, während ihm Mutter unter der Leiter den Farbkübel entgegenhielt. Und während die beiden so beschäftigt waren, spazierten auf der Strasse Bekannte vorbei. Mutter grüsste sie freundlich. Dabei muss sie ihre Konzentration für einen Moment nachgelassen haben, worauf sich ein Teil des Kübel- Inhalts – eine giftige und äusserst hartnäckige rote Menninge – über ihren Kopf ergoss. Ihre verzweifelten Versuche, das rote Zeug wieder aus ihren Haaren zu bekommen, waren leider nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Selbst die Coiffeuse konnte das Ganze nicht mehr ungeschehen machen. Mama hatte den Schaden, nämlich während längerer Zeit höchst auffällig rot gefärbte Haare, und wohl auch ein bisschen den Spott, denn die Geschichte hatte in der Nachbarschaft schnell die Runde gemacht.

Mein Vater Josef Alfons Helfenberger (1905 - 1990)
Ein Glückspilz trotz allem
FREUDE HERRSCHT In der Stickereifabrikantenfamilie Johann Gottlieb (J.G.) Helfenberger in Arnegg machte es bereits am 5. Januar 1905, am Vortag zum Dreikönigsfest, den Anschein, als hätten sich die Glückwünsche zum Jahreswechsel bereits erfüllt. In ihrem eben bezogenen neuen Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstrasse hat Ehefrau Bertha Helfenberger-Hafner einem weiteren Sohn das Leben geschenkt. Mutter und Kind sind wohlauf – wäre da nicht ein Wermutstropfen: Mutter Berta, eben 39 Jahre alt geworden, kann den Neugeborenen nicht stillen. Doch daran scheint man sich gewöhnt zu haben, denn auch bei der erstgeborenen und kurz nach der Geburt verstorbenen Tochter sowie bei den Söhnen Paul, Johann, Leo und August verhielt es nicht anders. Man hatte sich eben behelfen müssen, hat den Säuglingen mit Getreide- und Traubenzucker aufbereitete Kuhmilch verabreicht. Und diese, inzwischen 11-, 9-, 6- und 3-jährig, haben sich trotz mangelnder Muttermilch gut entwickelt. Ein Unterschied allerdings besteht: Die älteren Geschwister kamen allesamt nicht zur tiefster Winterzeit zur Welt, sondern in den Monaten März, April und Juli. In der «schönen Stube», wie der repräsentativste Raum des Hauses genannt wird, klingt die Taufe aus.
Doch schon kurz danach machen dunkle Schicksalswolken Freude und Glück vergessen. Dem kleinen Alfons geht es von Tag zu Tag schlechter. Er schreit und krümmt sich in seinem Bettchen, dass es Gott erbarm. Säuglinge können bisweilen unter heftigen Koliken leiden, aber das sieht nicht danach aus. Die Ursache der gesundheitlichen Probleme scheint nicht allein ernährungs- oder saisonbedingt zu sein. Die Hebamme ist ratlos, der Hausarzt muss her. Die Diagnose von Dr. Krähenmann: Gichter. Unter dieser Diagnose kann man sich heute weniger vorstellen als unter der mittelalterlichen Bezeichnungen «Gücht» oder «Kindliweh». Der kleine Alfons leidet unter epileptischen Anfällen, insbesondere unter Fieberkrämpfen. Fiebersenkende Mittel werden eingesetzt. In ihrer Not – sie haben ein todkrankes Kind zu Hause – suchen die Eltern überall Zuflucht, auch bei Naturheilmitteln. Eingesetzt werden u.a. tägliche Wickel mit Moos aus dem Wald. Nach fünf Wochen steht fest: Der kleine Alfons ist halbseitig gelähmt. Glück im Unglück, denn in anderen Fällen sind Gehirnschäden geblieben. Doch wegen dieser im frühsten Kindesalter erlittenen schweren Krankheit sollte Vater Zeit seines Lebens behindert bleiben. Beim Gehen zog er sein linkes Bein stets etwas nach, und seine linke Hand konnte er nicht drehen.
Zur grossen Freude seiner Eltern und Geschwister entwickelt sich der Benjamin der Familie zusehends, nimmt nicht nur an Alter, sondern auch Gewicht und Grösse zu. Einiges deutet darauf hin, dass er Liebling seiner Mutter und der treuen Magd Elise ist. Auch sein sonst so gestrenger Vater dürfte ihm wegen seiner Behinderung dieses und jenes durchgelassen haben. Jedenfalls besucht er – trotz seiner körperlichen Behinderung – die Primarschule in Andwil und anschliessend die Sekundarschule in Gossau.
Der nach dem ersten Weltkrieg eingetretene und bis in die zwanziger Jahre anhaltende einschneidende Rückgang in der Stickereibranche zwang J.G. schliesslich zur Geschäftsaufgabe. Dutzende für ihn arbeitende Heim-Handsticker im Fürstenland, im Toggenburg und im benachbarten Thurgau verloren Arbeit und Nebeneinkommen. Ausserdem waren ihre schweren, sperrigen und ehemals teuren Stickmaschinen nach Jahren der Hoffnung und Enttäuschung wertlos geworden, wurden schliesslich zerstört und als Altmetall entsorgt. Der Zusammenbruch der Handstickerei zwang J.G, nach Alternativen zu suchen; er wollte aus der Not eine Tugend machen. So stieg in den Handel mit bäuerlichen Liegenschaften ein. Auf diese Weise konnte er auch seinen zweitjüngsten Sohn August in der Liegenschaft zur 'Traube' in Gabris-Heiligkreuz/TG zum Einsatz bringen, denn August hatte sich als einziger der Familie zur Landwirtschaft, insbesondere zur Pferdezucht hingezogen gefühlt. Durch Zufall habe ich erst vor kurzem erfahren, dass Grossvater eine grosse Kinderschar einer angesehenen Arnegger Bauernfamilie als Vormund betreute, nachdem deren Vater mit nur 46 Jahren an Krebs verstorben war. Er muss in solcherlei Dingen sehr diskret gewesen sein, denn diese Tatsache war später weder in der betreffenden Bauernfamilie noch in der Familie meines Grossvaters jemals ein Thema gewesen.
Seine älteren Brüder waren bereits ausgeflogen, während Alfons, der jüngste Helfenberger-Spross, noch immer zu Hause lebte. Wegen der immer stärker werdenden Arbeitslosigkeit und auch wegen seiner körperlichen Behinderung war es für ihn äusserst schwierig, eine passende Tätigkeit zu finden. Er sah keine wirkliche Perspektive, empfand sich nach eigenen Worten als «ausrangierter Stickereigummi» und «als grösstes Sorgenkind der Familie». Auf Anraten seines Vaters absolvierte Alfons zunächst eine kaufmännische Stage in Wängi bei Wil. Derweil durchforstete sein Vater Zeitungen nach Annoncen. Er wäre wohl auch bereit gewesen, sich für seinen Jüngsten an einer Firma zu beteiligen oder dafür Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Er riet Alfons, eine Existenz im Verkauf ins Auge zu fassen. Auf ein Inserat eines Händlers für Überkleider, Käsereischürzen und dergleichen meldete sich sein Vater, weil er glaubte, dies könnte ein Betätigungsfeld für seinen Jüngsten sein. Doch J.G. hatte eine Marktlücke gefunden und machte daraus gleich eine Geschäftsidee: Anstatt nur Berufskleider zu verkaufen, sollte er sich des Käsereibetriebs als Ganzem annehmen und jene Artikel anbieten, die tagein und tagaus für die Milchverarbeitung und die Butter- und Käseherstellung nötig sind: nebst Schürzen auch Bürsten, Putzmittel und Chemikalien, Kalbermagen und Lab für die Milchgerinnung, Käsetücher und Käsebretter und dergleichen mehr. Als gewiefter Geschäftsmann hielt J.G. die Milchwirtschaft nicht zu Unrecht für weniger krisenanfällig als die Stickerei. «Milch wird immer getrunken, Käse immer gegessen», so seine Begründung. Unter Beizug des Dorfkäsers wurde ein erstes Käsereibedarfsartikel-Sortiment erstellt, wurden Lieferanten ausfindig gemacht und darauf beim Bezirksamt Gossau eine Handelsreisenden-Bewilligung gelöst. Und so startete Alfons 1925, zunächst noch zusammen mit seinem Vater J.G. den Handel, klopfte in der engeren Umgebung Käsereibetrieb um Käsereibetrieb ab.
Der völlig unerwartete, plötzliche Tod seines Vaters J.G. am 9. September 1929 musste den 24-jährigen Alfons besonders getroffen haben, denn er hatte er nicht nur seinen Vater, sondern auch seinen Mentor und Geschäftspartner verloren. Ausserdem musste er sich zusammen mit seinen Brüdern jetzt vermehrt um seine Mutter, aber auch um das Elternhaus kümmern. Hinzu kam, dass sich kurz nach Grossvaters Tod die wirtschaftliche und weltpolitische Lage verschlechterte. Auf den Schwarzen Donnerstag vom 24. Oktober 1929 folgte der schwerwiegendste Börsenkrach der Geschichte. 1931 wurde zum Schlüsseljahr und gilt als eigentlicher Beginn und Ursache der Grossen Depression der 1930-er Jahre. Banken gerieten ins Wanken, die Finanzwelt in Panik und die Wirtschaftswelt ins Trudeln, besonders jene unseres Nachbarlandes Deutschland (Tobias Straumann: 1931 – Debt, Crisis, and the Rise of Hitler)
Aus nachvollziehbaren Gründen – auch ich bin ein Freund des Rebensafts – hatte Vater stets auch mit dem Weinhandel geliebäugelt – wohl zum Missfallen der übrigen Familienmitglieder mehr als dies. Zu jener Zeit war das Südtirol daran, sich die Schweiz als Absatzmarkt für Rotweine zu erschliessen: Kalterer, Magdalener und wie sie alle heissen. Die Sorte, die wie der Ötzi zum Südtirol gehört, ist der Vernatsch. Er wächst zusammen mit einzelnen Lagreinpflanzen in den Pergeln, deren Höhe vor Jahren wohl noch für Menschen von geringerer Körpergrösse konzipiert wurde. Die Trauben werden zusammen geerntet und zusammen gekeltert. Die wenigen Prozente Lagrein – gesetzlich erlaubte Maximalmenge sind 10 Prozent – schenken dem hellfarbenen, sanften, milden Vernatsch Farb- und Strukturzuwachs. Vernatsch ist eine dankbare Sorte. Unser Land war für Magdalener-Traube von Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die Achtzigerjahre der fast einzige Absatzmarkt. Zunächst fass-, dann tankweise orderten die hiesigen Weinhändler den süffigen Saft und verschoben ihn in die Wirtshäuser. Das hatte Vater mehr oder weniger erfolgreich getan und Restaurants besucht. Für seine Verlobte, damals als Serviertochter im Restaurant «Sternen» in Arnegg tätig, hatte in Sachen Getränke, insbesondere Wein, ein Wörtchen mitzureden. Für sie stand im Nachhinein fest: Vater war einem «Bschisslig», einem Betrüger auf den Leim gekrochen. Gut möglich, dass er sich von einem Südtiroler Weinhändler namens Tratter über den Tisch hatte ziehen lassen.

(1) Vater (3.v.l.) auf Einkaufstour im Südtirol

(2) Eltern z. Zt. ihrer Verlobung (um 1938)
Ob Vater aus beruflichen oder privaten Gründen erstmals mit meiner Mutter in Kontakt gekommen ist? Wie lange war Marie in Arnegg tätig? Wie lange hatten sich die beiden gekannt, wann hatten sie sich verlobt? – Einen gewissen Aufschluss gibt die an seine zukünftigen Schwiegereltern adressierte Ansichtskarte meines Vaters vom 8. Mai 1938 mit dem folgenden Inhalt:
Meine Lieben
Ich habe den doppelten Auftrag von Marie sowie von meiner lb. Mutter, ein Grüsschen von uns zu Euch fliegen zu lassen. Sehr wahrscheinlich werde ich am kommenden Mittwoch mit Marie den Markt [in Weinfelden] besuchen. Meine Mutter verdankt den freundl. Kartengruss, der ihr Freude bereitete. Wir sind immer genügend mit Beschäftigung versehen. Gestern haben wir eine Autofahrt über Wuppenau nach Gabris ausgeführt.
Mit allseitig besten Grüssen
Alfons & Marie

(3) Als Frischvermählte grüssten anfangs November 1942 Alfons und Marie aus dem tiefverschneiten Wallfahrtsort Einsiedeln
DIE HOCHZEIT MEINER ELTERN «Kriegsmässig» auch die Trauung meiner Eltern, zunächst im Zivilstandsamt Gossau am 31. Oktober 1941. Danach die kirchliche Trauung, nicht etwa in der Pfarrkirche Andwil, sondern im wichtigsten Wallfahrtsort der Schweiz, in Einsiedeln im November 1941. Anstatt der vertrauten Pfarrkirche zu St. Othmar Andwil die Anonymität einer Wallfahrtskirche in der winterlichen Zentralschweiz, anstelle einer fröhlichen Ostschweizer Hochzeitsfeier in einer der Arnegger Wirtschaft ein Zusammensein im engsten Familienkreis, nur mit Trauzeugen sowie Vaters Brüdern Paul und Leo. Das offizielle Hochzeitsfoto zeigt denn auch ein eher ernst dreinblickendes Paar mit Lippen wie Minuszeichen. Ansonsten alles sehr konventionell, Mutter ganz in weissem, fünfsechstel-langen Brautkleid, mit ihrem, zu einem Diadem drapierten strahlendweissen Schleier, wohl beste St. Galler Spitzen. Der Aufbau lässt sie grösser als Vater erscheinen, sie – nicht nur für diesen Tag – ganz Königin. Neben ihr Vater mit Frack, seine Linke hält etwas verkrampft ein Paar Glacé-Handschuh, doch es glänzt der Ehering. Es macht nicht den Anschein, als würden die beiden diesen Augenblick sehr geniessen. Irgendwie verständlich, denn es war Winter, es war kalt und es herrschte Krieg.
Zu gewissen Zeiten hätte ich es attraktiver gefunden, anstatt eines Käserei-Bedarfsartikel-Händlers einen Weinhändler zum Vater zu haben. Im persönlichen Gespräch war Vater dem leidigen Thema stets ausgewichen, so wie er auch seine «wilden Jahre» nach Möglichkeit ausgeblendet hat. Doch ich fand das Thema immer wieder interessant und habe ihn deswegen gerne etwas provoziert, insbesondere nachdem ich bei meinen Erkundungsaktionen im Lager auf eine alte Auto-Windschutzscheibe und im Büro auf eine Feuerversicherungs-Police der Helvetia St. Gallen gestossen war. Gemäss diesem Dokument besass mein Vater ab 1938 das zur Windschutzscheibe gehörende Personenautomobil der Marke Opel, Modell 1934, Versicherungssumme Fr. 2’000.-, Jahresprämie Fr. 30.-. Der Versicherungsschutz dieser Police endigte am 1. September 1943, also anderthalb Monate vor meiner Geburt. Bei meinen frühen Recherchen während der Schulzeit war ich in der hintersten Ecke eines grossen Büroschranks sogar auf ein stimmungsvolles Foto gestossen. Darauf war das Rebgebiet von Lana-Meran zur Zeit der Weinlese abgebildet. Diesem Bild verhalf ich zu einem prominenten Platz im Treppenhaus. Zu meinem grössten Erstaunen blieb es dort sogar hängen!
Geschäftliche Enttäuschungen, der aufsteigende Weltkrieg und wohl auch der Einfluss seiner Verlobten Marie dürften der Grund dafür gewesen sein, dass sich Vater nun gänzlich dem Käsereiartikelhandel zuwandte. Schliesslich gab es in der Ostschweiz Weinhändler zu Hauf, jedoch nur eine Einzelfirma Alphons Helfenberger, Käsereiartikel, Arnegg.
Vater, stets mit Krawatte, liebte den Kontakt zu seiner Käser-Kundschaft, mit der er sich jede Woche an den Käser-Börsen von St. Gallen, Wil und Weinfelden getroffen hat. Gelegentlich war er danach deprimiert, vor allem wenn er nur kleine Bestellungen heimbringen konnte. Auch machte ihm seine körperliche Behinderung immer wieder zu schaffen, körperlich wie auch seelisch. «Es ist ein Brauch von alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör!» Dieser Spruch aus der «Frommen Helene» von Wilhelm Busch bringt es auf den Punkt. Mehr als mir lieb war, hatte ich Vater während meiner Jugendzeit in den Fängen seiner Sucht erlebt, wenn er bereits angesäuselt von der Börse zurückgekehrt war, um dann noch am Abend in der «Ilge» einzukehren, wo seine Jass-Kollegen bereits auf ihn warteten, etwa sein Schulkamerad und Arnegger Baumeister Toni Gerevini. Da konnten die Frauen-Proteste noch so laut sein – die Sucht war stärker. Zu dieser Zeit wurde dem Jassen als Freizeitvergnügen ausgiebig gefrönt und dabei oft und gern über den Durst getrunken, was in vielen Familien zum Problem wurde. Deshalb gab es damals noch die Möglichkeit, ein behördliches Alkohol- und Wirtshausverbot auszusprechen. Eine solche Massnahme hätte zwar einige Probleme gelöst, doch für Vater wären die Nebenfolgen verheerend gewesen. Damit wäre nicht nur sein Selbstwertgefühl, sondern auch seine berufliche Existenz zerstört worden. Erfreulicherweise ist es Vater nach und nach gelungen, diese Abhängigkeitsprobleme von Alkohol und Nikotin in den Griff zu bekommen.
Auch in der Käsereiartikelbranche herrschte nicht immer eitel Freude, besonders nachdem auch Vater zunehmend gegen Konkurrenz zu kämpfen hatte. An eine Expansion war bei ohnehin schmaler Marge nicht zu denken. Die Idee, ein Geschäftsauto anzuschaffen, um damit die Belieferung der Kundschaft zu beschleunigen, hatte er angesichts seiner körperlichen Behinderung und wohl auch wegen seiner Suchtproblematik nicht ernsthaft in Erwägung gezogen und deshalb stets auf den Warenversand per Post und Bahn gesetzt. Bauern aus der Umgebung decken sich mit Gebrauchsgegenständen, wie Melkfett oder Viehzeichnungsstiften auf dem Weg zur Käserei ein. Wenn es wirklich eilte, kamen Mutter oder wir Kinder zum Einsatz: Express-Zustelldienst per Motorroller oder per Velo. Eine Zeitlang liebäugelte Vater mit einem Nebenerwerb, wie der in den fünfziger Jahren aufgekommenen Pilzzucht. Auch den Eintritt ins Krankenkassengeschäft wurde erwogen und wieder verworfen; er hatte wenig Flair für eine wohlgeordnete Administration. Vater tat sich bereits mit der Geschäftsbuchhaltung schwer, wo jeweils seine Brüder Johann und Leo als Retter in der Not einspringen: Leo als Buchhalter eher mit Rat, Johann während seiner langen Sommerferien und seiner Erfahrung auch als Hilfsbuchhalter mit Tat. Innerhalb unserer Familie ist er zum Glück immer wieder zum Tragen gekommen, dieser im wahrsten Wortsinn Helfenberger’sche Familiensinn! Wären da nicht nächste Verwandte, wie Tante Klara, meine Patin, und Onkel Johann, mein Pate, gewesen, die uns durch ihre aktive Präsenz im Elternhause geschützt, gefördert und uns ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermittelten, hätten wir Kinder unter der häufigen Abwesenheit unseres Vaters und der geschäftlichen Inanspruchnahme unserer Mutter gelitten und wohl Schaden genommen.

(4) Vater (1968)
Erst 1978, im Alter von 73 Jahren, gab Alfons seine Einzelfirma vollständig auf, nachdem diese 53 Jahre existiert hatte. Bis ins hohe Alter konnte er sich guter Gesundheit erfreuen, lebte ohne Pension und ohne jemals Ferien gemacht zu haben dank der AHV mit seiner Frau glücklich und zufrieden. Niemals hatte er zu hohe Ansprüche gestellt, war zeitlebens bei seinen Leisten und damit stets auf dem Boden geblieben und deswegen zusammen mit Mutter, deren Einfluss nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, recht viel erreicht. Bisweilen konnte er sogar einen gewissen Stolz über das in seinem Leben Erreichte zeigen. Zwar hätte er es gerne gesehen, wenn eines seiner Kinder Geschäft und Liegenschaft übernommen hätte, doch konnte er sich auch über deren Erfolge freuen. Mit zunehmendem Alter waren eine grosse Zufriedenheit und Dankbarkeit für all das, was er in seinem Leben trotz der ihm auferlegten Einschränkungen geschaffen hatte und auch darüber, was ihm zugefallen war, spürbar. Anlässlich seines 80. Geburtstags hatte er dies auch so zum Ausdruck gebracht: Aus dem «grössten Sorgenkind der Familie», als das er sich einmal sah, wurde ein Glückskind! Eben diese mit einer grossen Güte gepaarte Zufriedenheit und Dankbarkeit haben wir Kinder an unserem Vater besonders geschätzt. Nicht zu vergessen sein feiner Humor, den er selbst nach der Einlieferung ins Kantonsspital St. Gallen noch auf dem Sterbebett nicht verlor, als er sich seinem Arzt als ‚Alfons «Hälfderselber»‘ vorstellte. So sehr hat mir dieser verballhornende Ausdruck unseres Familiennamens gefallen, dass ich ihn im Titel meiner «Erinnerungen» einbauen musste – als kleine Hommage an Vater, und auch als Dank an meine Mutter, die ihn nicht mit der ihr eigenen Beharrlichkeit vom Weinhandel abgedrängt, sondern ihn auch immer wieder aufgerichtet und äusserst tatkräftig unterstützt hatte. Vater verstarb an einem Aneurysma, nicht so plötzlich wie sein eigener Vater, sondern nachdem er sich vorher während ungefähr zwei Wochen nicht mehr wohlgefühlt hatte und das Bett hüten musste. Wie seine Vorfahren wurde auch Vater und später auch Mutter auf dem Friedhof in Andwil bestattet, neben der Pfarrkirche St. Othmar, in welcher er während 42 Jahren im Kirchchor mitgesungen hatte. Der Gesang war zeitlebens eines seiner wenigen Hobbies gewesen.

DER SPEZIELLE GERUCH IM PARTERRE UNSERES ELTERNHAUSES Völlig überrascht und erfreut war ich, hier vor nicht allzu langer Zeit den Kommentar eines besonderen Kunden zu lesen, nämlich jenen von Pater Linus Columban Züger OSB. In ihm hatte ich bisher den ehemaligen älteren Schulkollegen aus der Primarschulzeit gesehen. Er war aber auch einer der Söhne einer berühmten Andwiler Käserfamilie. Er schreibt u.a.: «Wie oft war ich bei euch im Haus Kunde für Käsereiartikel. Und von diesen Produkten her gab es in eurem Haus einen andern Geruch als bei uns. Die Freundlichkeit Deines Vaters und Deiner Mutter schätzte ich sehr. Da war ich immer willkommen».
Zunächst würde ich behaupten, Pater Columban verfüge über einen ausgeprägten Geruchssinn. Duftreize sind im Gehirn ganz besonders gespeichert, ganz nahe bei den Emotionen. Düfte sind als Bilder von Orten oder Menschen verankert, als Erinnerungen, die sich nicht mehr verändern lassen. Unter diesem Aspekt ist der Geruchssinn der unmittelbarste unserer Sinne. Anders als visuelle oder akustische Impulse wirken direkt auf das limbische System im Gehirn, wo die Emotionen verarbeitet werden. Und Pater Columban hat vollkommen recht: Obwohl bei uns eine Vielzahl von Produkten, die auch in der elterlichen Käserei verwendet wurden, war bei uns ein ganz anderes «Gschmäggli» vorherrschend als in einer Käserei. Dazu beigetragen haben die unterschiedlichsten Dinge, etwa Kalbermagen, die damals ungekühlt in grossen Kartonschachteln aufbewahrt wurden – anfällig für allerlei Schädlinge. Für die Käseproduktion werden in den Käsereien nur geringe Mengen davon benötigt. Ich denke auch an Säcke mit Spezialreinigungsmitteln sowie an die grossen Salzsäure-Korbflaschen. Für Endverbraucher wurden kleinere Mengen davon abgefüllt. Bisweilen ging beim Abfüllen auch etwas daneben. Auch mir war später beim Betreten des Elternhauses dieser strenge Geruch aufgefallen.
PIONIERHAFTE GESCHÄFTSFRAU Dörren war einmal, Einmachen zunehmend als zu aufwändig empfunden. Nachdem die Tiefkühl-Welle von den USA hinüber nach Europa hinweg geschwappt war, hat Mama hat in Arnegg ein Stück lokale TK-Geschichte geschrieben. Doch schön der Reihe nach: Begonnen hatte die Vermarktung von Tiefkühlkost in den Dreissigerjahren in Amerika, wo der Biologe Clarence auf einer Reise beobachtete hatte, wie die Inuit bei über minus 40 Grad Celsius Fische angelten. Die Fische gefroren, kaum waren sie aus dem Wasser gezogen. Als er den Fisch später verspeiste, schmeckte er zu seiner Freude wie frisch aus dem Wasser. Aus dieser schmackhaften Erfahrung entwickelte Clarence Birdseye eine neue Geschäftsidee und brachte 1930 unter dem Namen "Birdseye" die erste Tiefkühlkost in die Läden. Die Erfolgsgeschichte setzte sich Mitte der Fünfzigerjahre über Deutschland auch in der Schweiz fort, bis nach Arnegg, wo sich Mama ebenfalls begeistern liess. In Zusammenarbeit mit der Gossauer Firma Schwizer ermöglichte sie, dass auf dem freien Grundstück neben unserm Elternhaus ein Kühlhäuschen entstand, wo Interessierte ein kleines oder grösseres TK-Fach mieten konnten. Mama hat den Betrieb überwacht und auch gleich für die nötige Mund-zu-Mund-Propaganda gesorgt. Damit konnte sie mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zum einen hatte sie genügend Platz für all ihre Früchte, ihr Gemüse und ihr Fleisch, zum andern – gut sichtbar – etwas Eigenes, das ihr dies und jenen zusätzlichen sozialen Kontakt verschaffte.
Ein Denkmal für Tante Klara, unsere Helfmutter
Klara, das Nesthäkchen oder „die Kleine“, wie sie von Eltern und Geschwistern genannt wurde, erblickte am 15. Juli 1925 das Licht der Welt. Interessant eigentlich, dass sie nicht den Namen der Mutter, sondern jenen der früheren Lebens- und Geschäftspartnerin erhielt. Als Marie, das älteste der drei Geschwister von zu Hause Richtung Müllheim wegzog, war Klara gerade erst schulpflichtig geworden. Auch sie ging nach Weinfelden zur Schule. Den weiten Schulweg durch den Wald hat sie als junges Mädchen nicht immer als so romantisch empfunden. Aber sie war schnell und aufgeweckt, und hat so manche Gefahren gemeistert. Schon früh war auch Klara in Haus und Hof eingespannt. Immerhin war im Falle der Jüngsten schon einiges selbstverständlich, wofür ihre beiden älteren Geschwister noch kämpfen mussten.
Nach dem Besuch der obligatorischen Schulen und hauswirtschaftlicher Fortbildung arbeitet auch Klara tatkräftig im Betrieb ihres älteren Bruders Alfred mit. Im Oktober 1943 – sie ist im Sommer achtzehn geworden – fährt sie nach Arnegg zu meiner Taufe. Nur wenig spätere ereilt sie eine schwere Krankheit, die Kinderlähmung. Diese schreckliche Krankheit sollte ihr weiteres Leben grundlegend verändern. Nach verschiedenen Spitalaufenthalten wird Klara vollständig gelähmt in die Klinik Balgrist in Zürich eingeliefert, wo ein für die Schweiz modernes klinisches Gerät eingesetzt wird, die Eiserne Lunge. Dieses bereits 1920 in den USA entwickelte Gerät ermöglicht eine maschinelle Beatmung von Polio-Patienten. Klaras Körper kommt bis zum Hals komplett ins Innere eines Hohlzylinders zu liegen; nur der Kopf ist draussen. Das Gerät schliesst am Hals luftdicht ab und erzeugt einen Unterdruck. Dadurch drückt der Umgebungsdruck Aussenluft durch Nase und Mund des Patienten in die Lungen. Entsprechend geschieht die Ausatmung durch den Aufbau eines Überdrucks in der Kammer. Diese Eiserne Lunge und ihr eiserner Wille bei Therapie und Rehabilitation haben ihr wohl das Leben gerettet und es ihr schliesslich möglich gemacht, wieder zu sitzen und Arme und Hände gebrauchen zu können. Mit Hilfe von zwei langen, bis unter die Schultern reichenden Holzkrücken sowie eines um das rechte Bein gelegten orthopädischen Stützapparats lernt sie wieder etwas zu gehen, sehr langsam und mühevoll, Schrittchen für Schrittchen. Diese Fähigkeit kommt ihr allerdings nach ein paar Jahren wieder abhanden.
In den schwierigen Phasen ihrer Krankheit konnte mich meine Gotte nicht sehen. Während ihrer Reha erklären sich meine Eltern bereit, sie bei sich aufzunehmen, ein Entschluss, der ihnen wohl einiges abgefordert haben dürfte. Doch die Tatsache, dass ein Familienzuwachs bevorstand, wird ihnen den Entscheid etwas erleichtert haben. Beim letzten Klinikbesuch vor ihrer Entlassung nahmen mich meine Eltern mit nach Zürich. An diese erste bewusste Begegnung mit meiner Gotte vermag ich mich noch schwach zu erinnern.

(1) Klara Güntensperger: Aktiv gelebtes Leben im Rollstuhl
Für Klara waren die Verhältnisse in unserem Elternhaus denkbar schlecht. Die im oberen Stock gelegenen Wohnräume waren alles andere als behindertengerecht. Unterhalb jeder Türe fand sich eine Schwelle. Um diese mit dem Fahrstuhl zu überwinden, musste jemand vorher einen Holzkeil unterlegen. Ein Badezimmer war ebenso wenig existent wie die Versorgung mit warmem Wasser. Für Klara am allerschlimmsten war jedoch, dass sich beide Klosetts auf einem Zwischenstock befanden und damit für sie absolut unbenutzbar waren. Tante Klara war auf einen Topf und viele Helferinnen und Helfer angewiesen. Auch stand ihr kein eigenes Zimmer zur Verfügung. Zunächst teilten mein Bruder und ich mit ihr das Zimmer, später meine Schwester. Körperhygiene (Klara trug lange Haare) nur mit Waschbecken und auf dem Herd erwärmten Wasser, ohne Fön, Tampons, Wegwerfbinden und allem, was heute dazugehört. Zu dieser Zeit kam Blut noch in normaler und natürlicher Weise zum Vorschein, während es heute unsichtbar gemacht wird. Monatsbinden erscheinen in der Werbung stets blütenweiss.
In der Waschküche stand eine uralte Blechbadewanne, doch gebadet wurde darin nur noch selten. Es muss jeweils sehr mühsam gewesen sein, das Badewasser im Kessi des Holzherds zu erwärmen. Da hatten wir Kinder es tatsächlich besser. Am Wochenende wurde ein Waschzuber auf die Küchenbank gestellt und mit warmem Wasser gefüllt. Darin wurden wir Kinder der Reihe nach von Mutter oder Klara gebadet. Ob dabei das Badewasser jedes Mal gewechselt wurde oder ob es 'japanisch' zu und her ging? Wenn ich bedenke, dass es in unserem Haushalt eigentlich nur zwei nutzbare Wasserzapfstellen gegeben hat, eine in der Waschküche, die andere in der Küche, wird klar, wie ausserordentlich mühsam die Einhaltung einer gewissen Körperhygiene damals war. Morgens und abends wusch man sich mit kaltem Wasser das Gesicht – am Küchenwaschtrog. Wo sich vorher noch das Abwaschgeschirr gestaut hatte, wurden dann auch die Zähne geputzt. Vielleicht lässt sich meine heutige Hemmung gegenüber zu häufiger Nutzung der Badewanne mit diesen Entbehrungen während der Kindheit erklären. Die sanitären Verhältnisse war alles andere als luxuriös, aber noch immer besser als früher, etwa im Mittelalter oder heute in Teilen der Dritten Welt: Sauberes Wasser war damals im Überfluss vorhanden. So wurde unsere erste Waschmaschine und die Wäscheschleuder mittels Wasserdruck direkt angetrieben – welche Trinkwasser-Verschwendung aus heutiger Sicht!
Geheizt wurde zur Hauptsache mit Holz, ergänzt durch Kohle und Torf. Torf hatte in unserer Gegend als Brennstoff eine lange Tradition. Als gegen Ende des 18. Jahrhunderts das Holz knapp und der Energiebedarf einer wachsenden Bevölkerung grösser wurde, entdeckte man den Torf als Brennmaterial. Auch im nahen „Andwiler Moos“ (geol. Eisrandlandschaft; glazial überprägte Hochfläche mit aufgefächerten Wallmoränenbögen zwischen Andwiler Moos und Gerstenmoos; Staulagen und –rückzugssequenzen des Rheingletschers im Raum Hinterberg) wurden während der Wintermonate von Hand Torfquader (Schollen) gestochenen und zu Schollenbeigen aufgestapelt, so dass die Schollen in nassem Zustand durchfroren, sich auflockerten und in den Sommermonaten zu beinharten Briketts austrockneten. Im Frühjahr wurde hin und wieder eine ganze Wagenladung Torfmull angekarrt und im Garten ausgebracht. Auf diese Weise wurden in den letzten 200 Jahren 90% der Moore in der Schweiz zerstört. Insbesondere der WWF hat sich für den Schutz der verbleibenden Flächen eingesetzt. Im Verlaufe der Zeit wurden die Torfbriketts durch die schweren Briquettes aus Steinkohle ersetzt. Sie haben wohl einen höheren Heizwert, mussten nicht mühsam per Wagen abgeholt werden sondern wurden per Lastwagen in ganzen Bündeln durch die Firma Rufer, Gossau, angeliefert.
Im Winter war im Elternhaus einzig das Stübli wirklich geheizt. Vaters Laden- und Büroräumlichkeiten wurden mit einem Ölofen temperiert. Wenn es richtig kalt war, kamen auch dort wie in den übrigen Räumen Heizstrahler zum Einsatz. In den Schlafzimmer, insbesondere jenen im oberen Stock, war es zeitweise bitter kalt und die Fenster waren mit einer dicken Eisblumenschicht bedeckt. Das Licht des neuen Tages drang dann nur schlecht ins Hausinnere, weshalb es in gewissen Zimmern morgens düster blieb, bis die Mittagssonne die Eisschicht an den Fenstern schmelzen liess. Während der strengen Winterzeit froren die Wasserleitungen regelmässig ein. Dann musste Spenglermeister Ludin mit der Lötlampe her und die Leitungen auftauen, was dauern konnte, denn wir waren nicht die einzigen mit diesem Problem. Erst dann gab es in der Küche wieder laufendes Wasser.
Während der oft bitterkalten Winterzeit hatten wir Kinder unter Frostbeulen an den Zehen zu leiden, denn die Winterschuhe von damals vermochten trotz Pflege mit Juchtenmark die Nässe nicht gänzlich abzuhalten. Für unsere Klara müssen die Peinigungen durch die fast allgegenwärtige Kälte besonders schlimm gewesen sein, weil sie sich nicht richtig bewegen und den ganzen Tag sitzend zubringen musste. Regelmässig erhielt sie Besuch des Physiotherapeuten Kurt Basler, dessen Behandlungen überaus wichtig für sie waren. Für die ihr vom Physiotherapeuten auferlegten Körperübungen musste sie abends zu Boden gelassen und – was schwieriger war – wieder vom Boden aufgenommen werden. Verschiebungen innerhalb des Stockwerkes erfolgten am Boden mit Hilfe einer Wolldecke, auch über Türschwellen. Zu den Frostbeulen hat sich bisweilen auch diese und jene Prellung gesellt.
Wie mir Herr Basler erst Jahrzehnte später erzählt hat, war er zu Beginn, also anfangs der fünfziger Jahre noch mit dem Zug vom Appenzellerland nach Arnegg gereist. Noch heute, mehr als ein halbes Jahrhundert danach, erinnert er sich an folgende Begebenheit: Anlässlich seines ersten Hausbesuchs in Arnegg, sei er am Bahnhof von einem Jungen empfangen und von diesem ins Elternhaus und zu seiner Patientin Klara geführt worden. Immerhin sei der kleine Bub recht gesprächig gewesen, denn unterwegs, als die beiden Vater begegneten, habe der Junge dem Besucher erklärt, «dieser Mann» würde auch zur Familie gehören. Es stimmt: bei «diesem Mann» handelte es sich um meinen Vater, und beim kleinen Jungen um mich!
Mein körperlich behinderter Vater konnte Klara nicht allein nach unten oder oben tragen. Bevor wir Söhne kräftig genug waren, musste jeweils ein starker Nachbar, wie Bäckermeister Ledergerber oder der Webereiangestellte Kurt Hefti, für den Tragdienst gerufen werden. In den ersten Jahren ihrer Zeit in Arnegg war es Klara noch möglich, mit Hilfe von zwei Krücken während ungefähr einer Stunde einige Schritte entlang der Hauptstrasse − damals noch ohne Trottoir – zu tun, im Schneckentempo, immer das Gleichgewicht suchend, während Autos an ihr vorbeibrausten. Zu jener Zeit gab es noch kein Tempo 50.
Für begrenzte Platzverhältnisse, wie sie bei uns herrschten, gab es anfangs der fünfziger Jahre keinen brauchbaren Rollstuhl für den Innenbereich; alle waren sie ungeeignet oder zu teuer. Zu Hause wurde Klara erst etwas mobiler, nachdem Onkel Albert, ein begnadeter Ingenieur, für sie eine ebenso einfache wie geniale Idee verwirklicht und an die Beine eines massiven Stuhls vier «Wisa-Gloria» Kinderwagenräder angebracht hatte, wobei das rechte Vorderrad mit einer beweglichen Achse ausgestattet war. Dies ermöglichte Klara, ihr Gefährt mit der linken Hand mittels einer Art Mini-Lenker mit feinen Bewegungen zu steuern. Zur Fortbewgung musste sie mit der rechten Hand eine kleine Kurbel drehen, die eine Kette über ein Zahnrad laufen liess, wodurch das Gefährt in Bewegung gesetzen wurde. So konnte sich Klara eigenständig vorwärts und rückwärts manövrieren. Später erhielt sie von der Invalidenversicherung einen veritablen Rollstuhl zur Verfügung gestellt, zuletzt sogar einen mit einem Elektromotor angetriebenen. Doch zu jener Zeit waren alle überglücklich über Alberts Erfindung. Klaras Gefährt war nicht nur sehr leicht und äussert platzsparend. Wichtig war, dass auch wir Kinder das Gefährt die Treppen hoch und hinunter tragen konnten. Dank ihres fahrbaren Untersatzes wurde Klara auch ausser Haus zusehends mobiler. Als bescheidene Gegenleistung für Ihre Ersatzmutterdienste hatten wir sie in ihrem Fahrstuhl an Sonn- und Feiertagen regelmässig ins höher gelegene Andwil zum Besuch der für sie heiligen Messe geschoben, eine Dienstleistung, die sie uns sehr dankte. Ihr «Vergelt's Gott» kam jeweils aus tiefster Seele.
Auch Klara hatte das natürliche Bedürfnis, sich zumindest während der warmen Jahreszeit etwas draussen aufzuhalten. Sie konnte Vater schliesslich davon überzeugen, dass der Anbau eines Balkons auf der Westseite eine gute Lösung wäre. Nachdem sie dafür noch einen eigenen Beitrag zu leisten versprach, wurde das Projekt eines eigenen Balkons realisiert. Dort konnte sie sich zumindest während der warmen Jahreszeit ohne allzu grosse Hilfe Dritter vom Schlafzimmer direkt nach draussen begeben.
Was Klara all die Jahre für uns Kinder und auch für meine Eltern getan hat, lässt sich nur andeuten. Praktisch täglich war sie ab dem späteren Vormittag präsent, rüstete Gemüse, kochte oft und gut, wusch das Geschirr, während eines der Kinder Abtrocknungsdienst hatte, flickte Kleider, strickte von Hand, später mit einer Strickmaschine Pullover und vieles mehr, half uns bei den Aufgaben, bastelte mit uns, schlichtete Streit, lachte mit uns und betrieb moralische Aufrüstung, wenn wir niedergeschlagen waren, und betete vor dem Schlafengehen mit uns.
Für uns Kinder war die Klara alles: Ersatzmutter und Hausangestellte, Fürsprecherin bei den Eltern, Coach und Seelentrösterin − die gute Seele eben. Als Gallus mit dem Klarinetten-Spiel begann, hat die Klara sein Instrument mitfinanziert, und als er sich für einen Sprachaufenthalt ins französische Caen begab, unterstützte sie sein Vorhaben auch tatkräftig. Überhaupt besass Klara ein durchaus gesundes Verhältnis zum Geld: sparsam mit sich selbst, äusserst grosszügig gegenüber anderen. An einem kleinen Luxus, etwa einem guten Essen oder einem kleinen Schmuckstück fand sie durchaus Gefallen, denn im Grunde war sie das, was man als eine «Bonvivante» bezeichen könnte.
Im Nachhinein bewundere ich vor allem ihre Lernfähigkeit und ihren ungeheuren Willen. Trotz – oder vielleicht gerade wegen – ihrer Behinderung hat sich Klara stets weiter entwickelt, hat gelesen, geschrieben und gezeichnet und sich zur gelehrigen Köchin und Gesellschafterin entwickelt. Sicher war sie auch ein wenig stolz darüber, bei einem Projekt mit Behinderten auf dem Twannberg mitzutun. Darüber war sogar ein Bericht im Schweizer Fernsehen erschienen, in welchem Klara prominent mitwirkte.
Trotz ihrer schweren körperlichen Behinderung wirkte Klara niemals unglücklich oder unzufrieden – ganz im Gegenteil. Durch die Erkrankung und die Abhängigkeit von anderen hatte sich ihr Weltbild grundlegend verändert: Sie war demütiger und mit weniger zufrieden, aber nicht zerknirscht. Ihre Energie und ihren unerschütterlichen Optimismus hat sie einerseits durch Kontakte mit Mitmenschen, die ihr liebevoll begegnet sind, andererseits aus ihrem gelebten Glauben erhalten.
1967 fand Klara nicht nur ferienhalber, sondern glücklicherweise ganzjährig ein neues Zuhause bei ihren Verwandten im aargauischen Künten, und zwar in einem schönen, rollstuhlgängigen Einfamilienhaus mit grossem Garten. Damit Klara in Genuss eines eigenen Badezimmers kam, hatten die beiden einen Anbau gemacht. Zumindest jetzt war es ihr vergönnt, eine gute Zeit, ohne die früheren Einschränkungen und Entbehrungen, mit vielfältigen sozialen Kontakten, Ferienaufenthalten und Reisen zu verleben. Waren ihre Verwandten abwesend, sah Klara zum Rechten, denn sie konnte sich zu Hause ohne fremde Hilfe behaupten. Dank eines Elektro-Fahrstuhls war es ihr sogar möglich, sich auch ausser Haus zu bewegen, allein zur Kirche und wieder zurück zu fahren. Klara verstarb am 24.07.1998 nach längerem Spitalaufenthalt.
Kommentar einer seinerzeitigen Küntener Nachbarin:
Es hat mich sehr gefreut, in den mir weitgehend unbekannten Lebenslauf von Klara Einblick zu erhalten. Sehr bedenklich, was sie alles durchmachen musste! Von der riesigen Menge an Fakten und Episoden kann ich aber einen winzigen Teil davon gerne bestätigen, welcher Klaras Leben bei Onkel Albert und Tante Päuly betrifft. Der besagte Ingenieur war mein Onkel und alle drei hatten 1971 an unserem Hochzeitsfest teilgenommen. Ein herzliches Dankeschön für Ihre Publikation der Biografien.
An was für Erziehungsmethoden, allenfalls auch Bestrafungsmethoden, erinnerst du dich?

VOR LAUTER NEUGIERDE REIF FÜR DIE ARRESTZELLE Vater war – gelinde gesagt – alles andere als ein Ordnungsfanatiker. Sein Bürotisch war stets mit Drucksachen bedeckt, wobei sich Wichtiges und weniger Wichtiges überlagerten – ähnlich wie bei mir heutzutage! Also: Chaot zu sein, sei eine hohe Berufung, hat mir ein Freund ins Ohr geflüstert, ohne Chaos kein Urknall und keine Schöpfung! Auch im Verkaufsraum herrschte ein buntes Durcheinander von vielfältigen Drucksachen, Prospekten, Flyern, die überall und nirgendwo aufzufinden waren. Daher habe ich es immer wieder als so etwas wie meine Sohnes-Pflicht erachtet, Vater beim Papierkrieg tatkräftig an die Hand zu gehen und für mehr Übersichtlichkeit und Ordnung zu sorgen. Natürlich war es deswegen auch zu Auseinandersetzungen mit Vater gekommen, doch ich glaubte auch zu spüren, dass er mich, wenn auch nur knurrend, gewähren liess. Inzwischen weiss ich auch sehr wohl, dass in der Theorie und bei andern alles sehr viel einfacher zu bewerkstelligen ist. Vielleicht wäre ich tatsächlich ein erfolgreicher Organisationsberater geworden. Doch das Schicksal wollte es anders.
Auch im Innern erwies sich unser Elternhaus vom Keller bis zum Estrich immer wieder alswahre Fundgbrube. So waren etwa auf dem Estrich mehrere grosse Überseekoffer meiner Onkel gestrandet. Onkel Leo hatte zeitlebens möbliert gewohnt, so auch Onkel Paul bis zu seiner späten Einfahrt in den Hafen der Ehe im 63. Altersjahr – für jene Zeit recht aussergewöhnlich. Jedenfalls fanden beide Zürcher Onkel bei sich keinen Platz für diese Riesendinger, weshalb sie in ihrem Elternhaus abgestellt blieben. Deren Inhalt hatte seit jeher meine Neugierde gereizt. Es gelang mir schliesslich, die Behältnisse insgeheim zu öffnen. Das Ding von Paul, dem Vielgereisten, erwies sich als besonders ergiebig und spannend: Alte Dokumente, fremde Währungen, wie Millionen von Reichsmark samt Wehropferanleihen, Atlanten, Rasiermesser, steife Hemdenkragen und vieles andere mehr. Zum Glück hatte Onkel Paul bei seinen spärlichen und kurzen Besuchen nie Zeit für einen Kontrollgang auf dem Estrich gefunden. Er wirkte im Gegensatz zu den anderen Onkeln immer etwas müde, weshalb er den Übernamen «Onkel Pfus»*) trug. Sensationell war ein noch von meinen Grosseltern stammendes riesiges Album mit Ansichtskarten aus der Zeit der Jahrhundertwende bis zu den Zwanzigerjahren. Auch dieses Album haben wir leider sukzessive geplündert, denn in einem gewissen Alter hatten wir es nur noch auf alte Briefmarken abgesehen. Sie wurden erbarmungslos ausgeschnitten, ins Wasserbad gelegt, abgelöst und in Briefmarkenalben gesteckt.
*Pfus = Schlaf (schweizerdeutsch)
Nebst dem Estrich war für mich das so genannte Vorratszimmer von Interesse, ein etwas zur Gerümpelkammer verkommenener, direkt neben meinem Schlafzimmer gelegener Raum. Darin befand sich nebst Kinderwagen, Kinderbettchen, einem riesigen alten Küchenbuffet als einzig sehenswertes Stück ein noch aus grosselterlicher Zeit stammender alter Sekretär mit einem veritablen Geheimfach. Darin ruhten die ersten Fotoalben mit alten Familienfotos, allesamt nicht beschriftet und daher für uns schwer zu verstehen. Doch meine Neugierde beschränkte sich zu jener Zeit weniger darauf.
Bei meinen ersten Streifzügen im Vorratszimmer war ich eines Nachmittags zu einem neben dem alten Küchenkasten erhöht angebrachten kleinen Gestell vorgestossen, wo ganz zuhinterst eine grosse Zigarrenschachtel versteckt war. Diese machte mich besonders neugierig, weshalb ich sie behändigte und untersuchte. Darin befand sich ein geheimnisvoller Gegenstand, an dem mich vor allem dessen poliertes Holz und das dunkle Metall faszinierten. Die Nieten im Holz erinnerten mich an den Griff eines Küchenmessers. Vorne war aber eindeutig etwas anderes als ein Messer. Voller Stolz präsentierte ich den Fund meiner Mutter. Doch beim Anblick des Buben mit einem Revolver amerikanischer Bauart in den Händen, erlitt sie beinahe einen Schock. Vor Entsetzen stiess sie einen derartigen Schrei aus, dass ich wohl vor lauter Schreck die Waffe fallen liess. Vater sorgte umgehend dafür, dass der noch aus Grossvaters Zeiten stammende Revolver entsorgt wurde.
Nach dem Vorfall sperrte mich Mama unverzüglich in das enge, stockdunkle Gartengerätekämmerchen im Keller. Eingezwängt zwischen Gartenkräuel und Spaten verblieb ich dort wohl bis zu Vaters Rückkehr am Abend. Bei dieser Gelegenheit dürfte es wohl noch einiges an Schlägen abgesetzt haben. Die Haftstrafe ist mir jedenfalls in bleibender Erinnerung. Hatte sie mich traumatisiert? Interessanterweise sollte ich mich ein paar Jahrzehnte später nicht nur beruflich intensiv mit Fragen des Strafvollzugs auseinandersetzen, sondern auch in einer Kommission mitwirken, die den Bau eines neuen Basler Untersuchungsgefängnisses mit einer für die Schweiz neuartigen Haftform, dem sog. Gruppenvollzug geplant hat.
Mussten du und deine Geschwister Arbeiten verrichten? Welcher Art und in welchem Alter?

Velos waren bei uns immer wichtig, geschäftlich wie privat. Ich war vielleicht zehn, als sich Vater ein neues Velo und später ein Velo mit Hilfsmotor, einen schwarzen Velo-Solex leistete. Auch Mama fuhr zunächst mit diesem "Zuckerwassermotörli". Doch zuvor hatte sie in der Nähe von St. Gallen eine veritable Töff-Prüfung abzulegen. Vater blieb wegen der seinerzeit abgelegten Autoprüfung davon befreit. Später fuhr sie stärkere Mofas. Vater hat sie immer wieder als Mofa-Kurierin eingesetzt, vor allem dann, wenn es presssierte. Einerseits war dieser Service bei der Kundschaft beliebt, andererseits genoss es Mama, wenn ihr der Wind der grossen weiten Ostschweiz um die Nase wehte. Töfffahren war so etwas wie ihre grosse Leidenschaft. In späteren Jahren hatte sie immer wieder betont, ein Auto kategorisch abgelehnt zu haben, weil sie Vater sonst noch mehr eingespannt hätte. In ihrem Lebensrückblick war sie sich jedoch immer eher als Gejagte vorgekommen. Auch ich und mein Bruder standen immer wieder Mal im Einsatz, vor allem während unserer Ferien und wenn Mutter wegen anderweitiger Verpflichtung nicht zur Verfügung stand.
Mama, dem Technischen weit besser zugewandt als Vater, muss schon recht früh ein Grammophon mit ein paar Platten besessen haben, die ihr grosses Vergnügen bereiteten. An einem verregneten Sonntagnachmittag wurde dann schon mal der schwarzen Koffer samt ein paar Schellackplatten hervorgeholt und dem schwerfälligen Grammophonkopf eine Stahlnadel eingesetzt. Doch bevor es so richtig losging, musste der Plattenspieler mittels einer Handkurbel aufgezogen werden. Wenn der Walzer dann immer langsamer wurde, durfte ich wieder die Kurbel drehen, und Mama hat sich im Rhythmus der Musik bewegt. Sie hätte wohl gerne mehr getanzt, aber fürs Tankparkett war ihr Alfons mit seiner Behinderung nicht gerade der ideale Partner. So tanzte man eben mit Freundinnen oder hörte sich mit Vorliebe Platten wie «Am Himmel stoht es Stärnli znacht», diesen «himmlischen» Kitsch an. Dieses unvergängliche Stück, damals von den Geschwistern Schmid gesungen, feierte im neuen Jahrtausend ein Comeback und lässt mich heute nostalgisches erschaudern.
Mama hat auch fotografiert, zuerst mit einer urtümlichen Blackbox. In den fünfziger Jahren erstand sie sich eine Kleinbildkamera. Sie hatte immer wieder das Bedürfnis, Momente aufs Zelluloid zu bannen – doch bis es so weit war, bis sie tatsächlich abdrückte, das war immer eine mütterliche Extra-Showeinlage.
Mit zunehmendem Alter traten Plattenspieler und Fotoapparat zugunsten des Tonbandkassettengeräts in den Hintergrund. Was andern ihre Bibliothek ist, war Mama ihre Kassettensammlung. Sie wurde stets umfangreicher. Nach Vaters Tod war es Mama ein Bedürfnis, ihren Lebenslauf auf Band festzuhalten, nicht für den Pfarrer, damit er bei ihrer Abdankung etwas zu sagen hat. Es entstanden aufschlussreiche Toncollagen, eine Art «work in progress», ähnlich wie meine Jungenderinnerungen. Mag sein, dass auch sie einmal so seltsam berühren. Mamas gesprochene Sätze scheinen bisweilen wenig konzis. Trotzdem springt etwas hinüber, das bewegt. Ähnlich verhielt es sich mit ihrem schriftlichen Ausdruck, wo ihre mit allerhand Bögen verzierte Schrift mit dem aus eher gehackten, teils unvollständigen Sätzen bestehenden Inhalt auf seltsame Weise kontrastierte.
Vergnügen und Abwechslung bedeuteten Vater und Mutter Ausfahrten mit dem Car, mit dem Kirchenchor, später dem Jahrgängerverein, dann wohl häufiger irgendwelche Werbefahrten, bei denen nicht nur Thermosflaschen, Matratzen und Rheumadecken angeboten wurden, sondern auch die Geselligkeit ihren Platz fand.
Wie waren deine Eltern religiös eingestellt?

Wie wir es mit der Religion hatten
VOM HEIMATLICHEN, TIEFEN GEFÜHL DER LATEINISCHEN GESÄNGE. Ungefähr mit neun Jahren wurde mir ein Büchlein in der Grösse eines Reclam-Bändchens in die Hand gedrückt. Es enthielt die Teile der Hl. Messe: Introitus, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. Die für einen Dritt- oder Viertklässler nicht einfachen lateinischen Messtexte hatte ich unter Anleitung von Klara auswendig zu lernen. Früh-Latein anstatt Früh-Englisch – ich hatte nichts dagegen. Natürlich verstand ich von diesen Texten damals so gut wie nichts. Trotzdem gefielen sie mir damals, so wie sie mir noch heute gefallen, auch wenn ich Katholiken verstehe, die sich nach dem Vatikanischen Konzil darüber beklagen, weil sie sich ausgeschlossen fühlen, wenn lateinisch gebetet oder gesungen wird. Trotzdem möchte ich ihnen widersprechen und vom heimatlichen, tiefen Gefühl der lateinischen Gesänge berichten, denn möglicherweise umschliesst gerade das Nichtverstehen das Geheimnis.
Darauf folgte eine Prüfung beim gestrengen Herrn Kaplan Pfau, eine praktische Einweisung durch Messmer Künzli sowie durch ältere Ministranten-Kollegen – und schon gehörte auch ich dazu. Ich diente beim Altar, zunächst in der Frühmesse um sechs, mit Eintreffen eine Viertelstunde früher. Im Frühmess-Gottesdienst spielte es kaum eine Rolle, wenn man als Neuling noch etwas mehr Mühe mit dem Entzünden der Sanctus-Kerze hatte. In Gottesdiensten mit mehr (jugendlichen) Besuchern war dies anders, dann wurde aus der sakralen Handlung eine Art Geschicklichkeits-Wettbewerb: Wie viel Zeit braucht er, bis er mit dem Docht am langen Stock die Kerze zum Brennen bringt? Hatte der Kollege im letzten Gottesdienst beim Ablöschen den Docht zu stark gestaucht, konnte es vorkommen, dass man unverrichteter Dinge wieder an seinen angestammten Platz zurückkehren musste und coram publico als Verlierer dastand.
Dieses Jahr mussten wir Kinder lange warten, bis es Schnee gab. Aber auch die grossen Leute warteten sehnsüchtig, bis sie in die Skiferien reisen konnten. Der erste Schnee kam wie ein Geschenk zum neuen Jahr. Letzten Sonntag schneite es ununterbrochen. Aber als es zu grosse Haufen schneite, wurde meine Freude immer kleiner, denn es ging wir ein Lichtlein auf: Du musst ja noch dienen. Endlich wurde es Abend. Die Mutter sprach: Du musst bald ins Bett, wenn du um ein Viertel vor fünf Uhr schon wieder aufstehen musst. Und so machte ich, was jeden Abend zu besorgen ist. Nach dem Abendgebet schlief ich ruhig ein. Auf einmal hörte ich einen Windsstoss. Ich erwachte. Auf den Stromleitungen erblickte ich Neuschnee. Ich hörte die Mutter kommen. Leise öffnete sie die Zimmertüre. Ich wünschte ihr einen guten Tag. Und sie tat es ebenso. Sie sprach: Stehe auf, es ist Zeit. Aber ich war mich so ans warme Bett gewöhnt. Ich sagte: Ich zahle lieber zwanzig Rappen, als dass ich dienen gehe. Aber das nützte nichts. Ich musste doch gehen. Ich wusch mich, kämmte mich, betete und ass das Morgenessen. Nachher machte ich mich auf den Kirchweg. Der Schnee reichte über meine Knie. Der Schneepflug war noch nicht gefahren, darum musste ich gehörig waten.

(1) Andwil, Fronleichnamsprozession 1955, als Lampenträger (ganz r.)
Als Ministrant roch ich in der Morgenfrühe die pfeffrigen oder erdigen oder fruchtigen Aromen, wenn ich den Messwein einschenkte, dem fast immer gut aufgelegten Pfarrer Buschor, dem gestrengen Kaplan Pfau oder dem altersmilden Pfarr-Resignaten Ebneter, und sie alle tranken Christi Blut auf nüchternen Magen. Den Dienst in der Kirche hatte ich all die Jahre alles andere als ungern versehen, auch wenn er mit vielen Mühen und Entbehrungen verbunden war. Alle paar Wochen Frühmess-Dienst um sechs Uhr, mit Tagwache schon um fünf, abends noch Andachten. Ganz schön happig konnte es an Sonntagen werden, mit dem ganzen Programm von Frühmesse, Hochamt, nachmittäglicher Christenlehre und abendlicher Maiandacht. Kein Wunder also, dass ich in Bezug auf den Kirchenbesuch in meinen späteren Jahren mit jenem während meiner Jugendzeit erfüllt habe.
Abgesehen davon war das kleinbürgerlich-katholische Milieu erdrückend. Der Pfarrer amtete als Schulratspräsident, der dafür sorgte, dass Religion und biblische Geschichte als erste Fächer im Zeugnis aufgeführt blieben. Das familiäre Milieu war, wie die ganze Umgebung, streng, fordernd und unzärtlich. Wenn ich mich erinnere, wie wir mit unseren Kindern umgegangen sind, und wenn ich heute sehe, wie meine Tochter mit ihren Töchtern umgeht, stelle ich eine total veränderte Grundstimmung fest. Kinder werden zuerst einmal mit Freude betrachtet und gefördert, während wir vor allem erzogen wurden. Aus uns Kindern sollten brave, gottesfürchtige Erwachsene werden. Wir rebellierten nicht, freuten uns, auch über religiös angehauchte Geschenke, beispielsweise über ein Portrait eines Negerbübchens. Götti hatte mit einer grösseren Spende ermöglicht, dass ein Junge im fernen Afrika auf meinen Vornamen 'Pius Alfons' getauft wurde. Meine Rebellion sollte später erfolgen, nach meinem Wegzug aus der Ostschweiz. Wenn ich mich an diese Zeit zurück erinnere, an meine Eltern, insbesondere meine Mutter, requiescat in pace, wie sie mittels der Religion herrschte und beherrschte, auch meinen Vater, ein Leben lang mit ihrem Herrgott gesprochen hat, dieser rigide Katholizismus, der sie verkrümmt hatte, die Welt zu einem Jammertal machte und ihr gleichzeitig half, dieses Jammertal zu überstehen.

(2) Hing zeitlebens über dem Ehebett meiner Eltern 'Die heilige Familie' - wohl ein Hochzeitsgeschenk
Religion sei Opium für das Volk, meinte Lenin. Ich halte mich lieber an den Wein. Mit der Religion verhält es sich wie mit dem Wein beim Kochen: Richtig dosiert, trägt er zur raffinierten Verfeinerung der Kochkunst bei, überdosiert kann er ein Gericht völlig verderben. Vieles von dem, was uns während der Jugendzeit eingetrichtert worden ist, hat sich im Verlaufe des späteren Lebens gleichsam verflüchtigt. Einiges jedoch ist geblieben: die Substanz, wie beim Kochen mit Wein. Wie die grosse Mehrheit der Protestanten und auch Muslime praktizieren auch Katholiken ihren Katholizismus nicht mehr wirklich. Trotzdem bleiben die meisten ihren Vereinen treu, obwohl sie die Welt, in die ihre Vorfahren hineingeboren wurden, längst verlassen haben. Schlicht und einfach weil bei Geburt, Heirat und Tod der religiöse Service Public dank Ritualen die Dinge vereinfacht.
Was für andere Objekte, wie Möbel Geschirr, usw. hast du von ihnen geerbt und behalten?

VATERS BÜROSTUHL
Als wir im Frühjahr 2001 das Elternhaus räumen mussten, hatte ich es einfach nicht übers Herz gebracht, Vaters Bürostuhl in die Mulde zu kippen. Ich musste ihn retten. Eine ganze Weile stand er dann als einziges persönliches Erinnerungsstück in einer Ecke meines Arbeitszimmers, samt Patina, die er vor allem seitlich an der Lehne, dort, wo sich Vater tagtäglich beim Hinsetzen und Aufstehen festhielt, angesetzt hatte. Nachdem auch ich weg war von meinem eigenen Bürostuhl, fand ich endlich Musse, mich eingehender mit diesem Objekt zu beschäftigen.
Vater sass hart, sehr hart sogar. Unter dem Leder war überhaupt keine Polsterung mehr zu entdecken, nur ein von Hand zugeschnittener Schachtelkarton, darauf eine Speditionsetikette aus dem Jahre 1924, der eindeutige Beweis dafür, dass Vaters Bürostuhl bereits seinem Vater als Bürostuhl gedient hatte.
Als Kind war mir Vaters Bürostuhl furchtbar gross und schwer erschienen. Durch meine kindlichen Augen betrachtet, thronte Vater geradezu auf seinem Sessel. Besonders gut erinnere ich mich, wie ich jeweils gespannt hinter ihm stand, während er sich anschickte, mein Schulzeugnis zu unterschreiben. Er tat dies nicht mit dem Kugelschreiber, der eben erst erfunden worden war, also nicht mit seinem «Paper Mate», dem wohl einzigen Markenartikel, den er sich leistete. Wichtige Dokumente pflegte Vater noch mit der guten alten Stahlfeder zu unterzeichnen, nachdem er diese zuvor in das stets etwas verstaubte Tintenfass gesteckt hatte. Spannend für mich, ihm dabei zuzusehen, denn manchmal kratzte seine Feder beim schwungvollen Bogen, mit dem Vater seine Unterschrift zu verzieren pflegte. Was dieses Geräusch ausgelöst hat? Bisweilen höre ich dieses Kratzen noch zu deutlich, sehe Vater noch vor mir, wie er sich vor dem Unterschreiben konzentriert, als gälte es, seine Unterschrift unter ein Urteil zu setzen. Der gravitätische Eindruck wurde noch dadurch verstärkt, dass sich sein Bürostuhl gerade neben dem kolossalen Kassenschrank befand, auch dies ein Relikt aus Grossvaters Zeit. Wenn er die Bündel von Fünfzigernoten, auf denen zu jener Zeit Hodlers Holzfäller abgebildet waren, im Kassenschrank versorgte, kam mir Vater mächtig und reich vor. Hin und wieder pflegte er besonders gute schulische Leistungen mit klingender Münze zu belohnen.
Manchmal in unserer Jugendzeit, wenn Vater ausser Haus war, machten mein Bruder und ich Vaters Drehstuhl zum Karussell. Einer sass auf den Stuhl, während der andere diesen drehte bis es dem darauf Sitzenden schwindelig wurde. Dabei kam es bisweilen vor, dass das Gewinde überdrehte, worauf der ganze obere Teil des Stuhls mit Getöse zu Boden donnerte. Mit vereinten Kräften galt es dann, den Stuhl wieder zusammenzusetzen. Das dürfte nicht immer so ganz leicht gewesen sein, wie ich bei der Zerlegung des Stuhls feststellen musste. Mit meiner Enkelin Milena hat sich die Geschichte wiederholt. Sie liebte es, darauf höher und höher geschraubt zu werden – eben bis zum Umfallen.

(1) Enkelin Milena auf dem Generationenstuhl
Wie ich inzwischen aus eigener Erfahrung weiss, war Vaters Bürostuhl mehr Folterinstrument als Sitzgelegenheit. Trotzdem bin ich sicher: Vater hat dieses alte, unbequeme Eichenmöbel behalten, weil bereits sein Vater darauf gesessen hatte. Bei meinem Spontanentscheid für Vaters Bürosessel nicht bedacht hatte ich allerdings, wie viel Schleifstaub mir bei der Arbeit an diesem Objekt in die Nase geraten würde. Und wie viele Gedanken mir bei der Arbeit an einem solchen Stück Familiengeschichte durch den Kopf gehen sollten! Doch inzwischen ist nicht nur der Stuhl eine Antiquität. Auch mein Kopf will sich nicht mehr an all das neumodische Zeug gewöhnen. Nur hat mein Kopf ein bedeutend schlechteres Alter als der gute alte Bürostuhl. Und ich muss ihm zu Gute halten, dass er wendig geblieben ist. Doch der Clou der Sache ist, dass das Möbel vielleicht war gar kein richtiger Bürostuhl war, sondern ein Coiffeurstuhl. Ein Coiffeurstuhl für einen Vollglatzenträger – Nostalgie pur.
Aus Platzgründen stand der Stuhl 2009 zur Disposition. Behalten wollte ich ihn nicht länger, denn er gehörte eindeutig zur Vergangenheit und sollte daher nicht Teil meiner Zukunft sein. Ihn einfach wegzugeben, kam für mich nicht in Frage. So kam ich auf die Idee, das Möbelstück dem Theater Basel anzubieten. Und zu unserer grossen und freudigen Überraschung hatte es schnell geklappt. Unter Regisseur Elias Perrig wurde Vaters Stuhl zum Theaterrequisit im Stück «Eine Familie» von Tracy Lett. So waren wir am 2. November 2009 vom Theater Basel zur Schweizer Première geladen.

(2) Vaters Bürostuhl als Requisit auf der Bühne des Theater Basel
Autor Tracy Lett hat mit seinen Stücken grossen Erfolg; die Dramaturgen reissen sich nachgerade um seine Stücke. «Eine Familie» wurde auch noch am Wiener Burgtheater aufgeführt. Und Hollywood ist auch schon mit von der Partie. Inzwischen dürfte es eine Kinofassung dieses Stücks geben – wohl ohne Vaters Bürostuhl.

FAMILIÄRE URSUPPE ODER LOSE-ZIEHEN FÜR DAS GLÜCKSSPIEL, DAS LEBEN HEISST
Es ist eine Plattitüde: Seine Eltern und den familiären Teig, in den wir hineingeboren werden, kann man sich nicht aussuchen. Das Lose-Ziehen für das Glücksspiel, das Leben heisst, beginnt zwar mit der Geburt. Doch auch das vorbestehende familiäre Umfeld ist prägende für das spätere Leben. Bereits aufgrund ihres Herkommens besitzen nicht alle Mitglieder unserer Gesellschaft die gleichen Erfolgschancen. Auf die familiäre Ursuppe können wir keinen Einfluss nehmen. Es ist jedoch von Vorteil, sie zu kennen. Deshalb wage ich den Versuch, mit Familienerinnerungen zu beginnen, mich meinen direkten Vorfahren und deren familiärem Umfeld zu nähern, ein vergangenes Jahrhundert etwas auszuleuchten, das Jahrhundert meiner Grosseltern und jenes meiner Eltern.

Johann Gottlieb Helfenberger, mein Grossvater väterlicherseits
ALS GROSSVATERLOSER GESELLE AUFGEWACHSEN – GOTT SEI’S GEKLAGT Als ich zur Welt kam, ruhte mein Grossvater väterlicherseits bereits seit 14 Jahren auf dem Andwiler Friedhof. Dort überragte das schwarze Marmorkreuz mit der Inschrift 'JOHANN GOTTLIEB HELFENBERGER, FABRIKANT 1866 - 1929' alle übrigen Grabmäler – gleichsam einer Festung wider alle Schicksalsstürme. Zusammen mit meinen Eltern und Onkeln habe auch ich regelmässig nach dem sonntäglichen Kirchgang etwas in stillem Gedenken verweilt. Vielleicht auch deswegen hatte ich schon in früher Jugend viel Wertschätzung vor diesem Mann verspürt.
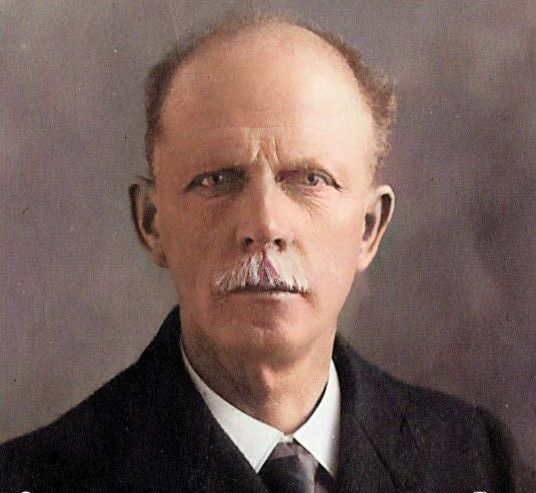
(1) Johann Gottlieb Helfenberger (1866 - 1929)
Zunächst ein Wort zu seinen Eltern: Sein Vater, also mein Urgrossvater Jakob Anton Helfenberger-Künzle hatte zunächst in Matten bei Andwil ein kleines Bauerngut bewirtschaftet. Später lebte er im Dorf Andwil, und zwar in jener Liegenschaft, die später von Maler Juchli übernommen wurde.
Von meinen Urgrosseltern sind mir leider nur Äusserlichkeiten bekannt. Mein Urgrossvater sei von grosser, hagerer Gestalt gewesen, habe ein Lincoln-Bärtchen getragen und regelmässig Kautabak konsumiet, also «geschiggt» haben. Meine Urgrossmutter ist als überaus tatkräftige Frau in Erinnerung geblieben. Nach Urgrossvaters Tod im Jahre 1912 lebte sie im grosselterlichen Haushalt in Arnegg. In ihren letzten Lebensjahren war sie dement.Sie verstarb 1920.
Grossvater wuchs mit zwei Geschwistern, einer Schwester und einem Bruder in Arnegg, auf einem Bauernhof im «Dörfli» auf. Als einziges Kind der Familie durfte er die Realschule in Gossau besuchen. Nach einer kaufmännischen Ausbildung im Stickereigewerbe hatte er sich breits in jungen Jahren als Fergger selbständig gemacht und war mit der Firma Blank & Beglinger (ev. Berlinger?) in Gallen-Bruggen assoziiert.
Die Stadt St. Gallen und ihr Umland waren damals ein Weltzentrum der aufblühenden Textilindustrie. In St. Gallen entstand die erste Maschinenfabrik. Hier liefen die ersten mechanischen Webstühle, fuhr das erste Tram. Es gab den ersten Fussballverein des Landes, den ersten englisch-sprachigen Businessklub, das erste Stadttheater mit festem Ensemble, das erste Schwimmbad für Frauen, das erste öffentliche Hallenbad, die älteste Privatbank der Schweiz, die erste Wirtschaftshochschule. Ein weltoffenes Bürgertum, das über den Tellerrand hinausschaute. St. Gallen war der stärkste Exportkanton, so etwas wie der Motor des Landes. Dann kam die Textilkrise. Aber dies ist fast hundert Jahre her. (Fred David, St. Gallen, Ideenfreies St. Gallen NZZ 11.05.2011)
Am 29. Januar 1893 ehelichte Johann Gottlieb Helfenberger die Bauerntochter Maria Hafner aus Gossau-Anschwilen.

(2) Arnegg, Hauptstrasse um Ende 1930. Grossvaters erster Geschäftssitz (3. Haus v.r.)
Grossvaters Geschäftssitz befand sich zunächst an der Hauptstrasse in Arnegg, in einem neben der Dorfschmiede gelegenen grossen Haus schräg gegenüber dem Restaurant ‚Ilge‘. Im Erdgeschoss waren fünf Stickmaschinen sowie drei bis vier Nachsticker untergebracht. Im ersten Obergeschoss befand sich das Büro, im zweiten wohnten bis ungefähr 1904 die Grosseltern, mit ihren Söhnen Paul, Johann, Leo und August sowie die Dienstmagd Elise.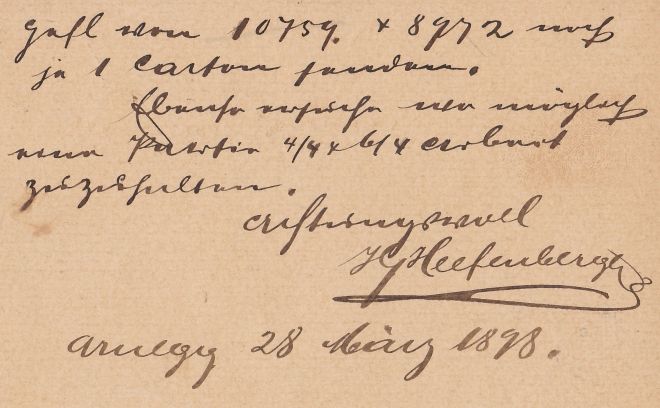
(3) Bestellkarte J.G.H. 28.03.1898 an Hrn. Bächtold Lützers, Herisau
Tagg, tagg, tagg, tönte es nicht nur aus den Räumlichkeiten in Arnegg, sondern auch aus dem zu Stickereilokalen umgestalteten Kellern so vieler Bauernhöfe. Die Stickerei hatte überall Platz. Sechs Meter mass die Stofflage, 312 Nadeln wurden hin- und hergefahren. Vier bis fünf Stiche schafft ein geschickter Handsticker pro Minute, in einer Stunde brachte er es auf hundert Stiche. Immer wieder musste er Fäden schneiden, Fäden und Nadeln wechseln. Moderne automatische Maschinen schaffen bis zu 300 Stiche − pro Minute.
Für das Abschneiden der Fäden und das Auswechseln der Nadeln waren feine Hände nötig. Je kleiner die Finger, desto besser lief die Arbeit. Stickerei war zu einem nicht unwesentlichen Teil Kinderarbeit, bei den Heimstickern und auch in der grossväterlichen Handstickerei. Nicht nur die Bauernkinder, auch meine Onkel waren eingespannt, mussten als Laufburschen den im Umkreis von Niederbüren, Mogelsberg, Kaltbrunn, St. Bernhardzell, Sommeri wohnhaften Handstickern und -stickerinnen Ware mit Handwagen oder Velo zu liefern und diese nach getaner Stickarbeit wieder abholen und zum Nachsticken nach Arnegg bringen.
Am 19. Juli 1902 erwarb Grossvater von Albert Hangartner, dem Wirt des auf gegenüberliegenden Seite der Hauptstrasse gelegenen Restaurants „Ilge“, einen rund 2’000 m2 grossen Bauplatz zum Preis von Fr. 6'153.30.
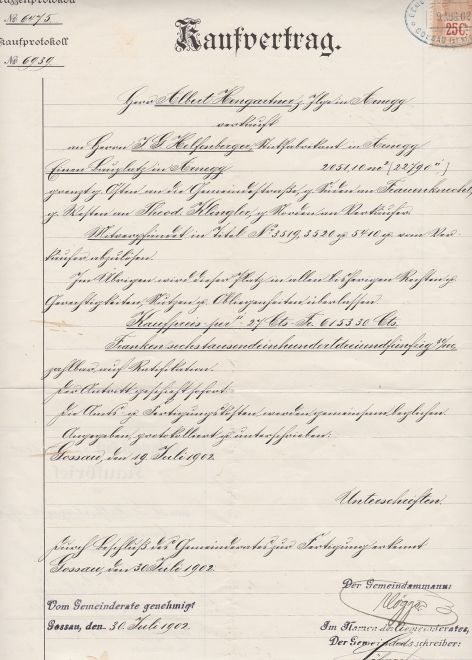
Auf diesem Grundstück liess er 1904 ein neues Geschäfts- und Wohnhaus bauen, ein vom Jugendstil geprägtes, vorwiegend in Holz gehaltenes, schindelbewehrtes Haus mit einer markanten Veranda zur Strasse hin, das noch heute den gutern Geschmack des Bauherrn verrät. Auf dem Foto der Hauptstrasse um 1930 (oben) ist das neue Gebäude in der Bildmitte gut zu erkennen. Über eine für die damalige Zeit wohl grosszügige Natursteintreppe gelangte der Besucher zunächst in einen langen, in Jugendstilmanier mosaikartig ausgelegten Gang, an den sämtliche Geschäftsräumlichkeiten anschlossen. Die beiden oberen Geschosse dienten Wohnzwecken, wobei sich auch im obersten Stock nebst drei Zimmern eine Küche befand. Im mittleren Stock war eine grosse Küche, zwei Stuben, wovon die eine repräsentativ ausgestaltet, sowie zwei Schlafzimmer. Grossvater war Geschäftsmann und als solcher war er sich gewohnt, vorauszuschauen. Auf dem angrenzenden Grundstück sollte dereinst eine Erweiterung des Geschäfts möglich sein.

(5) Arnegg, Bischofszellerstr. 327, von Grossvaters 1905 erbautes Geschäfts- und Wohnhaus, später mein Elternhaus
Grossvater muss ein Willensmensch gewesen sein, der von seiner Umgebung als eher gestrenger Mann wahrgenommen wurde. Streng war er auch gegen sich selbst, und ständig in Bewegung, auch körperlich, mit Vorliebe zu Fuss, und zwar nicht nur in Arnegg und rund um Arnegg. Wenn er verreiste, zog er es vor, den Zug jeweils erst in Gossau zu besteigen. Selbst die Stadt St. Gallen, Hin- und Rückweg gesamthaft immerhin 25 km, war ihm zu Fuss nicht zu weit. Zweimal die Woche, Mittwoch und Samstag, besuchte er dort regelmässig die Stickereibörse. Dort erfuhr er am eigenen Leibe die Krisenzeiten und Modewechsel im Stickereigewerbe und als Folge ein ständiges wirtschaftliches Auf und Ab. Daran schien sich auch Grossvater gewöhnt zu haben. Er dürfte die langen Marschzeiten auch zum Nachdenken gebraucht haben, immer öfter auch zum Verarbeiten, wenn der Stickereimarkt flau war und die von der Stickerei abhängige Wirtschaftslage in der Ostschweiz wieder einmal lahmte. Trotzdem wollte er seinen Stickereibetrieb mit Hilfe seiner Söhne ausbauen und erweitern. Der einschneidende Rückgang nach dem ersten Weltkrieg zwang ihn jedoch, seine Pläne – trotz guter räumlicher und personeller Voraussetzungen – schweren Herzens fallen zu lassen. Die Umstellung von der Hand- auf die Schifflistickmaschine schien Grossvater zu risikoreich, weshalb er darauf verzichtete und schliesslich resigniert aufhören musste. Er begann in Grundstücke zu investieren und kaufte dieses und jenes Bauerngüetli auf. Dabei dürfen ihm seine persönlichen Beziehungen zu den Heimstickern von Nutzen gewesen sein. Erholung fand Grossvater bei Familienspaziergängen, bei denen er sich gerne auch einmal dem Gesang hingab. Er soll vor allem laut gesungen haben. In den Schilderungen meines Vaters und meiner Onkel habe ich ihn als impulsiven Mann kennen gelernt, der auch mal Freude an einem derben Spässchen haben konnte. So hat er aus Jux beim Heuen eine Mitheuerin zwecks Abkühlung in den Brunnen gestellt. Auch seine Frau Gemahlin wurde ab und zu Opfer seiner gelegentlichen Kapriolen, wenn er im Familienkreis, in der Küche nach dem Essen mit ihr Freiübungen machte. Darob war sie überhaupt nicht amüsiert, ja sie soll sich gegen dieses Getue jeweils mit den letzten, ihr zur Verfügung stehenden verbalen Mitteln «Hör uf, sösch speuz i di a!» zur Wehr gesetzt haben.
Sein Garten lag ihm sehr am Herzen. Auch hier besass er Ehrgeiz, wollte à-tout-prix den schönsten Garten haben. Schon in aller Herrgottsfrühe beschäftigte er sich mit den Blumen und dem Gemüse. Doch wer so früh aufsteht und so viel marschiert, braucht ein währschaftes Morgenessen. Das soll er sich auch gegönnt haben, in Form einer grossen Schüssel Habermus mit Milch. Überaus geliebt habe er jedoch das Kaninchenfleisch – wohl aus eigener Zucht.

(6) Helfenberger-Hafner, Familienfoto (1920) (v.l.n.r.) Johann (24), Leo (21), Mutter (54), Alfons (15) Vater J.G. (54), August (18), Paul (26)
Nicht nur den schönsten Garten wollte Grossvater haben, sondern auch tüchtige Söhne. Ein Söhnchen sowie ein Töchterchen waren bei oder kurz nach ihrer Geburt gestorben. Grossvater war ein Bubenvater, stets daran, seine fünf Söhne zu fordern und anzuspornen, um aus ihnen sparsame und ehrbare Bürger zu machen. Nicht einen Fünfer hätten sie von Vater als Taschengeld erhalten, wird berichtet. Da liess er sie schon lieber vor einem Geschäftsreisenden einen Zweikampf austragen, worauf der Sieger einen Batzen erhielt. Das wenige Geld, das sie sich auf diese Weise oder etwa mit Sammeln von Rossmist für den väterlichen Garten verdienten, durften sie nicht etwa für Süssigkeiten ausgeben, sondern mussten es in die Sparkasse legen. Wenn es um Ehr und Redlichkeit ging, hörte bei J.G.H. der Spass auf und er kannte kein Pardon: Auf Lügen und Diebstahl standen Körperstrafen.
Nebst dem Garten hat J.G.H. den Wald sehr geliebt, besass er doch schon recht früh in der Arnegger ‚Witi‘ grössere Waldparzellen. Wald muss für ihn wohl etwas Mystisches bedeutet haben. Bei der Waldarbeit wurde er von seinem Vater tatkräftig unterstützt, während ihm seine Enkel das Mittagessen zu bringen hatten. Nach dem Tod meines Grossvaters gingen die Waldstücke auf seine Söhne, also auch auf meinen Vater über. Während meiner Jugendzeit wurde Vaters Waldparzelle abgeholzt und neu bestockt. Die Parzellen gingen schliesslich an Werner, einen Verwandten und Zimmermann von Beruf. Diese Waldstücke dürften sich heute wohl noch etwa gleich präsentieren wie damals. Wo anders ist dies heute noch der Fall? Dem Schweizer Forstgesetz sei Dank!
Am Nachmittag des 9. September 1929 unternahmen mein Grossvater und sein im Betrieb beschäftigter Sohn Leo einen Sonntagsspaziergang zum Restaurant 'Henessenmühle'. Dort befindet sich ein Weiher, in welchen auch der am grossväterlichen Haus vorbeifliessnde Bädlibach mündet. Einst hatte das Wasser ein Wasserrad angetrieben, mit dessen Kraft in der Henessen eine Mühle betrieben wurde. Das Wasserrad blieb erhalten. Die beiden kehrten im Restaurant ein und tranken einen halben Liter Wein. Dann nahmen sie den Heimweg unter die Füsse. Unterwegs klagte Grossvater urplötzlich über ganz fürchterliche Bauchschmerzen. Weitergehen war unmöglich; er musste sich hinlegen. Der sofort avisierte Arzt fuhr ihn zunächst zur Untersuchung in seine Praxis, dann geradewegs ins «Notkerianum» in St. Gallen, wo Grossvater kurz darauf verstarb, mit nur 63 Jahren. Vorher soll er nie ernsthaft krank gewesen sein. Als Todesursache wurde ein Magendurchbruch angegeben. Ja, Grossvater hätte vielleicht schon etwas (zu) schnell und bisweilen zu kalt oder zu heiss gegessen, wurde berichtet. Die Rede war auch von «einem gewissen Druck» auf der linken Seite, den er bisweilen verspürt haben soll. Doch an der Diagnose 'Magendurchbruch' habe ich so meine Zweifel, würde eher auf einen Riss der Aorta tippen. Immerhin ist mein Vater 61 Jahre später (auch) an den Folgen eines Aorta-Risses gestorben.
J.G. Helfenberger, Arnegg - Hommage an meinen Grosssvater als Unternehmer der ersten Stunde

DER MILLIONÄR ODER GÜLLEN LÄSST GRÜSSEN
Hommage an meinen viel zu früh verstorbenen Grossvater J.G.H.
Da war endlich einer, der klotzen und nicht nur klimpern konnte. Einer der bereit war, in Arnegg gross einzusteigen. Otto Marbach war sein Name, genannt der Millionär. Mit ihm sollte alles anders werden, besser eben und viel schöner. Er hatte sich anheischig gemacht, Arbeit und Wohlstand nach Arnegg zu bringen. Schon damals interessierte sich kaum jemand dafür, woher er kam und wie er zu seinem vielen Geld gekommen war. Weshalb also sollten die Arneggerinnen und Arnegger kritischer sein? Sie waren von Otto Marbach, seiner neuen Fabrik und seiner gleich auf dem Hügel nebenan errichteten schneeweissen Villa geblendet und betrachteten ihn als Heilsbringer. Als solchen wählten sie den Fabrikherrn sogar in den Gossauer Gemeinderat, denn – so die gängige Meinung – erfolgreiche Geschäftsmänner sind auch gute Politiker. Doch Politik funktioniert nur, weil Politiker an die Scheinwelt, die sie immer wieder aufs Neue aufbauen, selbst glauben, schlicht und ergreifend, damals wie heute.

ARNEGGS ERSTE UNTERNEHMER. Als Persönlichkeiten wie auch als Unternehmertyp hätten mein Grossvater und Marbach gegensätzlicher nicht sein können. Beide dem merkantilistischen System verpflichtete Kaufleute, sparsam halt und keine Wohltäter. Doch dann ist es schon vorbei mit der Gemeinsamkeit. Hier J.G. Helfenberger, der noch ganz der bäuerlichen Tradition verpflichtete Fabrikant der ersten Stunde, der einem Familienbetrieb mit hauptsächlich auf Heimarbeit abgestützter dezentraler Struktur vorsteht, da Otto Marbach, Urtypus des Fabrikherrn, der die sich ihm in unmittelbarer Nähe von Bahnhof und Post bietenden Möglichkeiten knallhart erkennt und packt, auf der grünen Wiese eine Weberei aus dem Boden stampft, auch in Arnegg Arbeitsplätze schafft, ein Kontrollfreak, der seine Untergebenen auch ausnützt, alle manipuliert. Unzimperlich bis skrupellos in der Auswahl seiner Mittel, schikaniert seine Widersacher, ein regelrechter Dorf-Tyrann, der dann, bei Kriegsende 1944, die Fabrik an den Gossauer Robert Saladin verkauft, dabei kräftig absahnt und sich dann mit seinen Millionen ins steuerfreie Fürstentum Liechtenstein abmeldet – oder vielleicht doch nicht ganz, wie die Geschichte mit dem Arnegger Posthalter zeigt.
Marbach und Posthalter Rechsteiner waren sich gram, weil der Millionär nicht mehr in das alte Postgebäude investieren wollte. Darin war nicht nur das Postlokal untergebracht, sondern im oberen Stockwerk wohnten der Posthalter, dessen Frau und die beiden Söhne. Marbach liess das Haus verlottern, worauf Rechsteiner, sich umzusehen begann, zumal sich schräg vis-à-vis ein idealer Bauplatz für ein neues Postgebäude anbot. Rechsteiner stand deshalb mit den Eigentümerinnen dieser Parzelle, Luzia und Paula Hungerbühler, in Kontakt. Als dies ruchbar wurde, versuchte Marbach, dies zu verhindern. Er wollte „seine“ Post nicht verlieren und auch nicht, dass sein Schlosshügel durch eine Überbauung angeschnitten würde. Deshalb versprach er den Geschwistern Hungerbühler, jeden Preis für das Land zu bezahlen. Doch die beiden verkauften nicht an ihn, sondern an den Posthalter, der damit nicht nur zu einer neuen Post kam, sondern darüber hinaus zu einem grossen Sieg über den Millionär. Doch Marbach wäre nicht Marbach gewesen, hätte er diese Niederlage hingenommen. Nun standen die beiden Nachbarn auf Kriegsfuss zueinander. Von da an schikanierte Marbach den Posthalter wann und wo er nur konnte. Doch der kleine Appenzeller wusste sich auf seine Weise zu wehren. So pflichtbewusst und genau, wie dies eben nur ein Schweizer Postangestellter tun kann, hielt Rechsteiner kalendarisch fest, wie oft Marbach in seinem Schloss weilte, obwohl er seine Papiere längst ins Steuerparadies Fürstentum Liechtenstein verlegt hatte. Die Sache sollte Marbach schliesslich finanziell teuer zu stehen kommen, denn er musste einiges an Steuern nachzahlen, worauf die Situation gänzlich eskalierte und die Rechsteiners es vorzogen, die Posthalberstelle in der Nachbargemeinde Hauptwil zu übernehmen. Dort konnten sie endlich glücklich und im Frieden weiterleben.
Die Geschichte wäre nicht vollständig ohne Schilderung der privaten Seite des Millionärs, etwa seiner Vorliebe für alte Autos, von denen er zwei in einer Remise abgestellt hatte und die er gelegentlich bewegen musste. Zu diesem Zweck pflegte er hin und wieder Gäste mit seinem alterwürdigen dunkelblauen Peugeot auszuführen. So erinnere ich mich, wie er unsere Familie einmal in sein geliebtes Bauerndorf Berg im Kanton Thurgau führte, eine Gunstbezeugung des Millionärs, die in der Frühzeit auch die Familie Rechsteiner erfahren hatte.
Erwähnenswert die Freude von Otto Marbach an handwerklicher Tätigkeit, wie dem Holzhacken, das er wohl als eine Art Krafttraining zu betreiben pflegte. Es war 1954, als er hinter unserem Haus eine grössere Anzahl Trämel entdeckt hatte. Er hatte Vater anerboten, dieses Holz zu spalten. Und ich erinnere mich, wie ich dem die Axt schwingenden Millionär im Hemd ganz verstohlen vom Küchenfenster aus bei der Arbeit zugesehen habe, wie er sich konzentriert und im Schweisse seines Angesichts abmühte, ein Bild, das sich mir eingeprägt hat, wohl wegen der Ähnlichkeit zu dem Bild auf der Fünfzigernote in Vaters Kassenschrank. Und noch so eine Erinnerung, wie er zu Vaters Fünfzigsten völlig überraschend mit einer guten Flasche Weins erschien und Vater zu seinem Geburtstag gratulierte.
Bereits angetönt, seine sympathische Verbundenheit mit der Gemeinde Berg/TG, wohl weil er dort aufgewachsen war. Und da war auch noch Hedy, seine bedauernswerte Tochter, die es mit ihm wahrhaftig nicht leicht hatte, weil ihr Vater darüber bestimmte, mit wem sie Kontakt haben durfte und vor allem mit wem nicht! Hedy war es, die in ihrem Testament der Sparkasse der Administration des katholischen Konfessionsteils des Kantons St. Gallen (einen noch komplizierteren Namen für eine Bank gab es wohl kaum!) den ansehnlichen Betrag von 5 Millionen Franken für schulische Zwecke vermacht hat, was als letztes Zeichen der Verbundenheit mit der Ostschweiz und als eine Art Versuch einer Wiedergutmachung über das Grab hinaus gedeutet werden kann.
Diese Geschichte hat mich gegenüber Heilsversprechern jeglicher Couleur misstrauisch gemacht. Vielleicht lässt sich daraus auch erklären, weshalb ich in meinem späteren Leben immer eher Mitte-links, Richtung soziale Gerechtigkeit getickt habe, ohne dabei meine Sympathien für wahrhaft grosse Unternehmer, wie etwa Gottlieb Duttweiler, zu verbergen. Zu ihnen zähle ich auch meinen Grossvater. Leider war es mir nicht vergönnt, ihn persönlich kennen zu lernen. Aber so, wie während meiner Jugendzeit über ihn berichtet wurde, und so wie ich ihn im Verlauf meiner Recherchen kennen gelernt habe, ist er für mich so etwas wie ein Vorbild. Ich denke, er hat diese späte Hommage verdient.


Berta Helfenberger geboren Hafner, meine Grossmutter väterlicherseits (1866 - 1950)

(1) Grossmutter Berta Helfenberger (um 1920)
Meine Grossmutter war eine zarte, feingliedrige Frau. Geboren wurde sie anno 1866, im selben Jahr wie mein Grossvater, sie am 3. Januar, er am 5. August. Die Bauerntochter aus Anschwilen bei Gossau war ihren fünf Söhnen zeitlebens eine gute, verständnisvolle Mutter. Ihr zur Seite stand Elise, eine Seele von Dienstmagd. Grossmutter soll zeitlebens eine gute Sängerin gewesen sein. Als Gattin eines Stickereifabrikanten hatte sie Freude an schönen Stoffen und eleganten Kleidern. Überliefert ist, wie sie einen zuvor in der Stadt neu erworbenen Hut vorführte. Dieser musste Grossvater jedoch so sehr missfallen haben, dass er ihr die Neuerwerbung, wohl bei der Präsentation am Familientisch, vom Kopf gerissen und zu Boden geschmissen hat. Danach war Grosi wohl nicht mehr ums Singen zu Mute. Nicht überliefert ist, wie lange es gedauert hat, bis sie mit Grossvater wieder ihr Lieblingslied „Im schönsten Wiesengrunde“ im Duett gesungen hat. Nach der Heirat meines Vaters zog sie in den oberen Stock und unterstützte die junge Familie in Haus und Garten nach Kräften. Ihre letzten Jahre waren überschattet von ihrer Krankheit. Ich erinnere mich an die letzten, nicht immer einfachen Jahre, insbesondere an ihre Beerdigung. Sie verstarb am 7.Oktober 1950 im 85. Altersjahr im Kantonsspital St. Gallen an den Folgen eines Beckenbruchs. Grossmutter wurde im Elternhaus aufgebahrt. Die Totenwache, die feierliche Überführung des Leichnams mit Pferdefuhrwerk zum Beerdigungsgottesdienst in der Pfarrkirche Andwil und der feierliche Beerdigungsgottesdienst hatten mich stark beeindruckt und noch während Jahren beschäftigt, war es für mich doch die erste direkte Begegnung mit Abschiednehmenmüssen und Tod.

Alfred Güntensperger-Weber, mein Grossvater mütterlicherseits, wurde am 27.April 1872 geboren. Er war somit 6 Jahre jünger als mein anderer Grossvater. Ledigerweise hat er während 24 Jahren zusammen mit seiner Haushälterin Klärli in Wuppenau/TG das Restaurant „Bären“ geführt. Trotz der langjährigen Zusammenarbeit war es zwischen den beiden nicht zur Heirat gekommen, weil sie entfernt miteinander verwandt waren. Später lernte Alfred die aus dem Aargauischen stammende Karolina Weber kennen. Sie wollte ihn partout nur dann heiraten, wenn er das Metzgen und Wirten an den Nagel hängen würde. Wohl aus diesem Grund hat er dann den Betrieb in Wuppenau aufgegeben und ist nach Weinfelden übersiedelt. Auch dort soll Alfred zunächst noch gewirtet und gemetzget haben. Doch dann ergab sich die Gelegenheit, den Hof in den «Eierlen» käuflich zu erwerben. Alfred schlug zu und Karoline sagte ja. Beide wurden ein Paar und führten mit Hilfe von Vinzenz, Alfreds jüngerem Bruder, der mit seinen Bienenvölkern von Wuppenau ebenfalls nach Weinfelden übersiedelt war, den Hof, unter tatkräftiger Mithilfe seiner Kinder Marie, Alfred und Klara.

(1) Grossvater Alfred Güntensperger (1872 - 1944)
Mit seinem Husarenschnurrbart war Vater Güntensperger ein gestrenger und sparsamer Vater, auch von Nachbarn als tüchtiger, erfahrener Mann mit grosser Liebe zur Natur geschätzt. Er war hilfsbereit, hatte ein offenes Ohr und einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Sein Rat war gefragt, und er hat Bekannte bei privaten Schwierigkeiten oder Problemen mit Behörden und Ämtern beraten. Grossvater war ein gläubiger Mensch. Sein Glaube an die Macht des Gebets war unerschütterlich. Wenn ein schweres Gewitter mit Blitz, Donner und bisweilen mit Hagelschlag über die Gegend hinzog, zündete er die Sturmlaterne an und versammelte die Familie in der Stube zum Rosenkranzgebet. Er hat dem Schutz des Herrn mehr vertraut als dem Blitzableiter.
Mit zunehmendem Alter machte Grossvater bei der schweren Arbeit auf dem Hof das Herz zu schaffen. Er litt wohl an zu hohem Blutdruck und hatte Herzprobleme, die zu jener Zeit nicht oder nur unzureichend behandelt wurden. Doch angesichts der prekären Personalsituation blieb ihm keine andere Wahl, als auch noch als Siebzigjähriger Hand anzulegen, zu ackern und mit der grossen Walze zu fahren. Dabei scheute ein entlehntes Pferd und ging durch, ein Ereignis, das ihn zusätzlich belastete. Am Morgen des 30. September 1944 musste sich Grossvater wieder einmal unwohl gefühlt haben. Zum Glück hatte sein Sohn Alfred Urlaub und war auf dem Hof anwesend. Auf dem Weg vom im oberen Stock gelegenen Schlafzimmer hinunter zur Stube muss Grossvater wohl ein Unwohlsein erlitten haben und er stürzte. Der herbeigerufene Arzt erkannte die schwierige gesundheitliche Situation und riet ihm, den Hof, umfassend Wohnhaus und zwei Ökonomiegebäude sowie 366 Aren Land unverzüglich auf seinen Sohn zu übertragen. Eilends wurde der Notar gerufen und alles Notwendige in die Wege geleitet. Kurz nachdem alles geregelt war, verstarb mein Grossvater ganz plötzlich, nachdem er noch ein paar Mal leer geschluckt hatte, wahrscheinlich an einem Herzversagen, wohl versehen mit dem Hl. Sterbesakrament, noch in Anwesenheit des Notars.
Als mein Grossvater mütterlicherseits überraschend verstarb, war ich kaum ein Jahr alt. Gewiss hatten meine Eltern mit mir als Säugling meine Grosseltern besucht. Seit 1938 nannte mein Vater ein Personenautomobil der Marke Opel, Modell 1934 sein eigen. Dies ist durch eine Versicherungs-Police der Helvetia St. Gallen (Versicherungssumme Fr. 2’000.-, Jahresprämie Fr. 30.-) belegt. Die Police endigt jedoch am 1. September 1943, also anderthalb Monate vor meiner Geburt. Vater dürfte Mama und mich also nicht eigenhändig in seinem Wagen nach Weinfelden chauffiert haben. Gereist wurde klugerweise mit dem Zuge, mit dem "Sulgerli".


(1) Grossmutter Karoline Güntensperger-Weber (1886 - 1968)
Grossmutter war eine beherzte Frau, was auch folgende Begebenheit zeigt: Als sie einmal, begleitet von ihrem Enkel Kurt, mit dem Zug in Arnegg ankam, hatte sich dieser bereits wieder in Bewegung gesetzt als sie noch am Aussteigen war. Es gelang ihr in letzter Sekunde, dem bereits wieder anfahrenden «Sulgerli» noch zu entsteigen. Sie kam dabei jedoch zu Fall und zog sich einige Schürfungen zu. Zum Glück hatte der kleine Kurt, der Grossmutter erstmals begleiten durfte, die Geistesgegenwart, ihr nicht auch noch zu folgen, sondern im Zug nach Gossau weiterzufahren. Partout hätte sie nicht den Umweg über Gossau machen um dort auf den nächsten Retourzug warten wollen. Lieber wollte sie ihre Zeit lieber mit ihren beiden Töchtern und ihren Enkelkindern verbringen.
Nach einem äusserst arbeitsreichen Leben verstarb Grossmutter am 20. Mai 1968 in ihrem 83. in Weinfelden. Wenn ich heute an Grosi denke, sehe ich sie vor dem Stall mit ihren 'verwerchten' Händen beim Holzherd hantieren. Sie liebte ihre Enkelkinder und verwöhnte sie, aber auch ihre Ferkel waren ihr eine Herzensangelegenheit. Und was für Grosi ihr Holzherd war, ist für mich heute vielleicht mein Heisskomposter im Garten!
Erinnerst du dich an Personen, die im Leben deiner Grossmutter eine wichtige Rolle, positiv oder negativ, gespielt haben?


EHER EIN «UNFALLTYP»

(1) 1952 VOM UMFALL- ZUM UNFALLGELÄNDER. Spontan, von einem ambulanten Fotografen aufgenommen, der mir irgendein Erwachsenen-Velo (mit Kindersitz!) unterschob, derweil ich in diesem Alter noch gar nicht Velo fahren konnte. Völlih authentisch hingegen der hölzerne Dolch. So wurde ich geknipst , ausgerechnet vor dem ehemaligen Geschäftsliegenschaft meines Grossvaters. Einfach genial und damit das Bild meiner frühen Jugend.
Unendlich die Zahl der Verletzungen, die ich mir im Verlaufe der Jugendjahre beim Velofahren zugezogen habe. Doch bereits im zartesten Vorschulalter (vom Kindergartenalter zu sprechen, wäre unzutreffend, denn eine derartige Institution war damals in Arnegg noch unbekannt) rannte ich völlig kopflos vom Haus auf die Strasse – geradewegs vor das schwere, schwarze Velo des Dorfschmied-Gesellen. Dieser stürzte, unglücklicherweise auf meine Seite. Dabei wurde ich durch den Bremshebel an meiner rechten Schläfe ziemlich stark verletzt. Zunächst soll ich den Fahrer wegen dessen mangelnder Vorsicht noch beschimpft haben, worauf Vater aus seinem Büro angerannt kam. Als ich bemerkte, wie Blut zu Boden tropfte und von meiner Mutter wegen meiner Unvorsichtigkeit auch noch lauthals ausgschimpft worden war, begann ich zu weinen. Doch als Mutter die Blutspur auf meinem ‚Tessinerli‘ (so hiessen die farbig gestreiften Sommerleibchen damals) erblickte, schlug ihre Stimmung um. «Der arme Bub!» Das hätte - im wahrsten Wortsinn - ins Auge gehen können! Meine Eltern brachten mich rasch zum Gartenhahn hinters Haus. Dort waren wir aus dem Blickfeld und es entstand keine «Sauerei». Die Wunde wurde ausgewaschen und ich behelfsmässig am Kopf verbunden. Für die weitere Wundversorgung dürfte wohl Klara gesorgt haben. Sie war in derartigen Dingen mitfühlender und geduldiger. Noch heute zeugt die Narbe von den intakten Selbstheilungskräften. Später dürfte der eine oder andere meine Narbe als «Schmiss» (studentische Mensur) interpretiert haben.
SCHWEIN GEHABT! Es war im Winter 1952 oder 1953 und in Andwil lag wieder einmal viel Schnee. Im Rahmen einer Sportstunde zog Lehrer Staub mit uns 2.- und 3. Klässlern hinauf zum Kirchbühl. Wer Skier besass und sich einigermassen darauf halten konnte, hatte sie mitnehmen dürfen. Ich besass nichts dergleichen. Um einen Zaun für Skifahrer überwindbar zu machen, waren wir Nicht-Skifahrer zusammen mit dem Lehrer damit beschäftigt, den Schnee anzuhäufen. So entstand eine Art Sprungschanze, auf der die Mutigsten ihr skifahrerisches Können beweisen sollten. Als mein Klassenkamerad Emil Koller - wohl als Vorfahrer - über die Schanze geflogen kam, touchierte er mich mit seinen Skiern am Kopf. Ich verspürte einen heftigen Schlag, dann Blut im Mund – und Zahnsplitter – eine eher unangenehme Situation, auch für Lehrer Staub. Er musste wohl einen Rapport für die Schulunfallversicherung schreiben. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn es mich voll im Gesicht erwischt hätte und meine Vorderzähne ausgeschlagen worden wären. Noch heute zeugt ein Hick an meinem linken Schaufelzahn von dieser Begegnung der besonderen Art mit einem Skiflieger-Schulkollegen.
EIN EREIGNIS MIT LANG ANHALTENDER WIRKUNG
Es war während der Sommerferien 1954. Da ich noch kein eigenes Velo besass, hatte mir Mama erlaubt, für messdienstliche Zwecke ihr Velo zu benutzen. An jenem schicksalshaften Tag hatte ich in der Frühmesse ministriert und befand mich so um halb sieben wieder auf dem Heimweg - für meine damaligen Fahrkünste eine Spur zu schnell, denn ich kollidierte mit einem Zaun, kam zu Fall und blieb liegen. Nachdem ich das Bewusstsein wieder erlangt hatte, kam mir das Ganze zunächst wie ein böser Traum vor, denn ich hatte die Erinnerung an das, was unmittelbar vor dem Unfall war, komplett verloren. Um zu begreifen, was tatsächlich passiert war, musste ich das zu einer veritablen Acht verformte Vorderrad mehrmals mit eigenen Händen greifen. Darauf lud ich mir das demolierte Vorderrad auf die Schultern und zog das Velo bis nach Hause hinter mir her. Dort angekommen, begab ich mich geradewegs in mein Zimmer, legte mich mit starken Kopfschmerzen ins Bett, wo ich den ganzen Tag wortkarg verblieb. Mutter kam und dunkelte das Zimmer ab. Mir war einfach peinlich, ihr Velo zu Schrott gefahren zu haben – unsäglich schlechte Voraussetzungen für ein eigenes Velo! Ich hatte eine Gehirnerschütterung. Nach dem Unfall bin ich jedenfalls nicht behandelt und schon gar nicht nachuntersucht worden. Auch diesmal wurde eher Gott und Mutter Natur vertraut als ärztlicher Kunst.
Um ein Haar wäre dieses Ereignis fatal ausgegangen. Heute ist erwiesen, dass selbst leichte Kopfverletzungen, wie beispielsweise eine gewöhnliche Gehirnerschütterung, bei Kindern langfristige Schäden anrichten können. Konzentrationsschwächen, Wutausbrüche bis hin zu Persönlichkeitsveränderungen können Spätfolgen einer solchen Verletzung sein. Eine 2004 veröffentlichte britische Studie bei 5- bis 15-jährigen Kindern hat gezeigt, dass 43 Prozent der nur leicht verletzten Kinder später beachtliche Lernschwierigkeiten entwickelten. Auch ihr Sozialverhalten änderte sich. Zudem litt eines von fünf Kindern mit leichten Verletzungen an Persönlichkeitsveränderungen. Die Kinder hatten auch zum Teil beträchtliche Probleme, dem normalen Klassenunterricht zu folgen. Wenn man der Studie glauben kann, hat sich in den vergangenen 50 Jahren nicht allzu viel geändert − zumindest nicht in England. Dort blieben zwei Drittel der betroffenen Kinder ohne ärztliche Betreuung. Fachleute meinen, die hiesige Situation sei mit jener in England vergleichbar (Sonntagszeitung 30.05.04).
Auch wenn in neun von zehn Fällen Hirnerschütterungen glimpflich ausgehen: Für mich blieb diese leichte bis mittelschwere Hirn-Schädel-Verletzung nicht folgenlos. Ab diesem Zeitpunkt litt ich während ungefähr fünf Jahren unter häufigen und starken migräneartigen Kopfschmerzen, besonders dann, wenn ich mich längere Zeit konzentrieren musste.
EINE ÄUSSERST QUALVOLLE ERFAHRUNG
Das Wetter an jenem Sonntag war unfreundlich, neblig und kalt. Bereits auf dem Weg zum Gottesdienst hatte ich ein Stechen im Bauch verspürt. Es war nicht das Seitenstechen, das ich hin und wieder vom Schnelllauf her kannte. Während des Messfeier wurden die Bauchschmerzen stärker. Bestimmt würden sie wieder vorübergehen, redete ich mir ein. Also nur nicht auffallen, mir nur nichts anmerken lassen! Noch nie hatte ich die Kirche während eines Gottesdienstes verlassen. Alles in mir sträubte sich dagegen, Schwäche zu zeigen. Als das Sitzen und Knien in der Kirchenbank nicht mehr aushielt, zwängte ich mich an meinen Kameraden vorbei nach draussen, doch war es zu kalt, um auf der Kirchtreppe das Ende der Messe abzuwarten. Wohin sollte ich in meinem Schmerz gehen, an wen mich wenden? Eine Telefonkabine, in der ich mich meine Eltern hätte verständigen können, gab es nicht. In der Kirche war zumindest noch Leben gewesen, doch hier draussen wirkte alles wie ausgestorben und ich fühlte ich mich hilflos und allein. Und ich die Schmerzen wurden immer stärker und liessen dann wieder nach; sie hinderten mich nicht nur beim Gehen, sondern auch beim Nachdenken. Intuitiv schleppte ich mich zum nächsten mir vertrauten Gebäude, dem nur etwa hundert Meter entfernten Mittelstufen-Schulhaus Ebnet, welches ich zu dieser Zeit besuchte. Im Parterre dieses Schulhauses wohnte Frau Agnes Huber, meine über alles geliebte Primarlehrerin. Sie würde mir bestimmt helfen. Doch fand ich ihre Wohnungstür verschlossen. Also hob Ich meine Augen auf zur Pfarrkirche St. Othmar. Auch von sollte mir keine Hilfe zukommen nachdem, ich diese ja gerade verlassen hatte. Es blieb mir nichts anderes übrig, als auf Hilfe vom Herrn zu hoffen, der Himmel und Erden gemacht hat, auf dass er mich behüten und vor einem geplatzten Blinddarm verschonen möge.
Neben dem Schulhaus waren grosse Betonröhren gelagert. Gottergeben verkroch ich mich in eine dieser Röhren, in der Meinung, darin kauernd dem Schmerz und der Kälte zumindest einigermassen trotzen und mich zwischen den elenden Krampfanfällen und der damit verbundenen Angst wieder etwas entspannen zu können. Durch meine Kauerhaltung hatte ich spontan das richtige getan; die Bauchdecke konnte sich entspannen und es kam zu einer Schmerzlinderung. Schliesslich war ich in der Lage, mich zu Fuss auf den Heimweg zu machen. Zuhause hatte ich meinen Eltern beim Mittagessen von meinem Erlebnis erzählt. Da ich wieder Appetit hatte, war für sie das Thema erledigt. Zum Glück ist dieser Kolik-Anfall der einzige geblieben.
«EIN RICHTIGER MANN GEHT ERST ZUM ARZT WENN ER TOT IST» In diese Richtung ging die Devise im Hause Helfenberger. Ärzte wurden in zwei Situationen benötigt: für Impfungen und bei unmittelbarer Todesgefahr.
Unverzichtbar war der Besuch eines Arztes beim schweren Unfall meines Bruders Gallus. Es war einer der dramatischeren Abende in unserer Familie. Gallus hatte zu Weihnachten Skier erhalten, keine neuen, versteht sich. Mit diesen begab er sich an einem schulfreien Mittwoch-Nachmittag zum wohl einzigen richtigen Übungshang, einem gut eine halbe Stunde von zu Hause entfernten Hügel, «Schöpfers Böhl» genannt. Gallus war mutterseelenallein unterwegs. Bei einer Abfahrt brach er sich das Bein. Als mein Bruder gegen Abend noch immer nicht zu Hause war, machten sich meine Eltern auf die Suche und fanden ihn verletzt und entkräftet. Mit Hilfe eines motorisierten Nachbarn wurde Gallus am frühen Abend in einer Gossauer Arztpraxis ärztliche Hilfe zuteil.
An Arztbesuche vermag ich mich kaum erinnern, an Zahnarztbesuche bei Dr. Dillier in Gossau hingegen schon. Götti hatte sich dafür geopfert, wer denn sonst! Bei kleineren Zwischenfällen wie dem folgenden wurde auf ärztlichen Beistand verzichtet.
D BUEBE GÖND ID HAASELNUSS Im Herbst, wenn die Haselnüsse reif waren, kletterten mein Bruder und ich gerne in den mächtigen Haselnuss- und Holunderbüschen hinter dem Haus herum, um es Nüsse regnen zu lassen. Dabei glitt ich aus, rutschte nach unten, wobei unglücklicherweise eine in die Höhe strebende Rute von unten durch das Hosenbein meiner Turnhose eindrang und mich am Hodensack verletzte. Die Sache war im Moment äusserst schmerzhaft, die anschliessende mütterliche Wunduntersuchung und -pflege mit Schnaps, dem in unserem Haushalt obligaten Desinfektionsmittel, überdies hochnotpeinlich. Ein solches Malheur konnte in einem Dorf wie Arnegg nicht geheim bleiben. Jedenfalls erinnere ich mich an die mitleidvolle Bemerkung eines Schulkameraden, der mein künftiges Familienglück bereits als zerstört glaubte.
NATUR PUR Nach Familientradition und ländlicher Gepflogenheit wurden bei uns Hühner und Kaninchen gehalten. Futter war auf der Wiese neben dem elterlichen Anwesen zur Genüge vorhanden. Mutter besorgte die Hühner, wir Kinder waren für das Füttern der Kaninchen und Ausmisten der Ställe zuständig, eine nicht immer so sehr beliebte Aufgabe. So war ich froh, eines Tages im Keller eine nicht ganz stumpfe Sichel zu entdecken. Anstatt Löwenzahn und Bärentatzen einfach von Hand abzureissen, konnte ich das Gras von nun an schwungvoll mit der Sichel schneiden. Allerdings nur für kurze Zeit, denn schon kurz danach schnitt ich mir beim Grasen mit der Sichel ganz tüchtig in den linken Vorderarm. Zum Glück hatte ich nicht gleich die Pulsader erwischt! Wie in solchen Fällen üblich, wurde ein Druckverband angelegt und auf den Beizug eines Arztes verzichtet. Der tiefe Schnitt verheilte gut; doch geblieben ist als weiteres besonderes Kennzeichen – nebst nebst der um ein paar Jahre älteren Narbe an der rechten Schläfe – eine gut sichtbare Narbe am linken Unterarm.
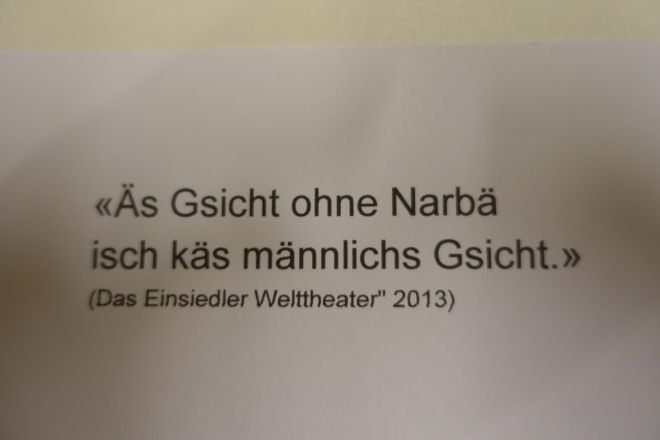
Seither begleiten mich meine Narben – weder schön noch nötig. Sie gehören zu mir, so wie heute Piercings dazu gehören und sogar ziemlich Mainstream geworden sind. Nie hätte ich auch nur mit dem Gedanken gespielt, mir meine Narben schönheitschirurgisch entfernen zu lassen. Sie sind genauso Teil meiner Persönlichkeit wie meine Glatze, zu der ich stehe, wie andere auf ihr Tatoo.

DIE STUBE UNSERER KINDHEIT
Innert weniger Jahre war der Haushalt zum 'Ménage-à-sept' angewachsen: Vater, Mutter, drei quicklebendige Kinder, Grossmutter und Klara, abgesehen von den drei Katzen. Grossmutter war in den letzten Lebensjahren wegen ihrer Demenz eher Belastung als Hilfe. Es war riskant geworden, sie mit den Kindern allein zu lassen. Ich erinnere mich daran, wie sie in einer Anwandlung abends wieder einmal fortgehen und mich mitnehmen wollte. Tante Klara, in ihrer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt, hatte wohl Ängste ausgestanden, bis Grossmutter von ihrer fixen Idee abliess. Wenn ich mich richtig entsinne, musste sie sogar zu einer List Zuflucht nehmen bis es ihr gelang, Grossmutter bis zur Rückkehr meiner Eltern wegzusperren.

(1) Pius (l), Elisabeth und Gallus (r) 1950
EIN EREIGNIS BLEIBT HAFTEN.«STALIN TOT» Ich sehe sie noch so genau, die fetten Lettern in der «Fürstenländer»-Ausgabe vom 5. März 1953. Stalin war überraschend in seiner Datscha bei Moskau gestorben. Wer Stalin war, das haben mir meine Eltern abends in der Stube wohl zu erklären versucht. Ein böser Kommunist und – was wohl für sie das Schlimmste war – ein ehemaliger Zögling eines orthodoxen Priesterseminars – unter dem so viele Menschen wegen ihres Glaubens zu leiden hatten. Nach dem Tod Stalins und der Geheimrede seines Nachfolgers Chruschtschow sah es im Osten Europas zunächst nach Tauwetter aus. Doch es kam anders: Die Reformbewegungen in Polen und Ungarn weiteten sich zu Aufständen aus, die 1956 blutig niedergeschlagen wurden. In der Folge flüchteten 2000'000 Ungarn in den Westen, viele davon in die Schweiz, die den Flüchtlingen eine beispielhafte Solidarität entgegen brachte.
1954, als Viertklässler, habe ich den Feierabend in einem Schulaufsatz reichlich romantisierend beschrieben:
Wie herrlich ist es, an einem Winterabend in der Stube zu sitzen. Vater liest die Zeitung oder sonst etwas Interessantes. Wir Kinder sind mit den Hausaufgaben beschäftigt. Mutter siedet Milch und Kaffee. Klara strickt an einer Jacke. Bald ist es Zeit fürs Abendessen. Da ruft die Mutter: 'De Znacht wär’ parat!' Alle verlassen ihre Arbeit und gehen in die Küche und setzten sich an den Tisch. Doch plötzlich überrascht uns das Telefon. Vater steht auf und läuft in die Stube. Man hört ihn sprechen: «Salü Fritz, was musst du haben? Eine Weile ist es still. Dann höre ich Vater wieder sprechen: Ich will dir’s heute Abend noch schicken. Tschau Fritz. Danke.» Und schon ist der Hörer weg von Vaters Ohr. Unterdessen sind alle mit Essen fertig und beginnen die Arbeit von neuem.
Die Schilderung macht eines klar: Wenn Vater las oder Radio hörte, Klara strickte und wir Kinder bei unseren Aufgaben sassen, war es etwas eng und wohl auch etwas stickig. Dank des kleinen Holzofens war dieses Stübchen während der kalten Jahreszeit der einzig warme Ort im Haus. Die schöne Stube nebenan hatte zwar einen Kachelofen, doch dieser blieb bis auf ein paar wenige Gelegenheiten, beispielsweise Weihnachten, unbeheizt. Bei grosser Kälte wurde mit kleinen Elektrostrahlern versucht, das Schlimmste, etwa das Einfrieren der Wasserleitung, zu vermeiden.
Abends zu Hause Aufgaben machen oder nur etwas Anspruchsvolles lesen war nicht immer einfach. Zumindest im Sommer bestanden noch gewisse Ausweichmöglichkeiten, etwa auf dem Balkon oder draussen im Garten. Beengend war es im Winter, wenn abends die ganze Familie um das Öfeli versammelt war, in dessen Kamin dann und wann Äpfel prasselten und einen süsslichen Duft verbreiteten. Äpfel waren bis in den Frühling hinein willkommene Zwischenverpflegung. Die im Herbst gleich kistenweise in Holzwolle eingeschlagen Glockenäpfel warteten nur darauf, verspeist zu werden.
Vater nahm ab und zu ein Buch zur Hand. Eine Zeitlang war er sogar Mitglied eines katholischen Buchclubs. Da stapelten sich Bücher von Louis de Wohl (1903 – 1961). Dieser katholische Autor schrieb vor allem über Heilige. In ihnen sah er nicht etwa religiöse Fanatiker, mittelalterliche Phänomene oder Personen, die nichts anderes taten als beten. Louis de Wohl war überzeugt davon, dass Heilige Vorbilder sind, denen man folgen soll. Heilige waren für ihn die spannendsten, interessantesten, mutigsten und bezauberndsten Menschen. Er entdeckte, dass die Probleme der Heiligen – und alle um sie herum – die Probleme unserer eigenen Zeit sind, und dass die Heiligen – und nur sie – fähig waren, diese Probleme zu lösen. So schrieb er die Bücher „Der kaiserliche Abtrünnige“ (St. Athanasius), „Weltenthron“ (Papst Leo I.), „Das ruhige Licht“ (Thomas von Aquin), “Lebendiges Holz“ (St. Helena). Louis de Wohl holte sich die Inspiration für seine letzten Bücher beim Papst. Dieser soll ihm geraten haben, über die Geschichte und die Mission der Kirche in der Welt zu schreiben.
In Vaters Pult befanden sich auch eine stattliche Anzahl brauner Hefte im A4-Format über Persönlichkeitsbildung, privaten und geschäftlichen Erfolg. Es waren vervielfältigte Studienhefte, verfasst von Martin Meister und durch dessen «Institut für praktische Erfolgspsychologie» vertrieben. Ein Vertreter dieses Instituts musste Vater zu einem Fernkurs für die Studiengemeinschaft für überredet haben. Das Ganze wirkte geheimnisvoll, eine bunte Mischung von Volkspsychologie, Physiognomik, Graphologie und Arbeitstechnik. Jedem Band lagen Prüfungsbögen mit höchst aufschlussreichen Fragen bei, z.B. nach Kurslektion Nr. 2 des Fernkurses „Die schriftliche Sprechstunde der Frau“ mussten so tiefgründige Fragen wie jene nach dem Lebenszweck beantwortet werden. Gefragt wurde auch nach Möglichkeit, wie die Antwort auf diese fundamentale Frage zu überprüfen wäre, nach dem stärksten menschlichen Trieb, nach der Bedeutung menschlicher Entwicklung, den Anforderungen der richtigen „Art und Weise“ der Formel der Gerechtigkeit, danach, wer wirklich lebt, nach den Klassen von Mensch in der Wirtschaft, nach den Früchten, nach dem Gesetz des Ausgleichs und dessen Auswirkungen, nach der Definition von Erfolg. Und: Was ist die Grund-Idee der Welt? Ich vermag nicht zu sagen, ob Vater diese Unterlagen wirklich durchgearbeitet hat, und wenn ja, ob er daraus Vorteile verzeichnen konnte, und ob er den Fernkurs weiterempfohlen hat. Auch danach war gefragt. Und ob Kursteilnehmer zu ihren Äusserungen stehen und diese ev. namentlich als Referenz verwendet werden könnten. Wie ich mich erinnere, hatte das Lehrmaterial wenig Gebrauchsspuren aufgewiesen. Immerhin interessant, dass Vater um Weiterbildung bemüht war.
Auch Mutter hat hin und wieder Zeit gefunden, eine Zeitschrift zur Hand zu nehmen, etwa den in vielen katholische Haushaltungen beheimateten „Der Sonntag“, oder lieber noch ein Marienzeitschrift. Mama war glühende Marienverehrerin, eines ihrer Lieblingsthemen das „Ave verum“. Mir gefielen vor allem die Heftumschläge, auf denen Mariendarstellungen aus den verschiedensten Epochen prangten. Diese waren diese zu jener Zeit auch etwas meine Kunstbetrachtungen.
Götti war ein recht belesener Mann. Seine Bücher waren vorwiegend religiösen Charakters und hätten allesamt einer Pfarrbibliothek nicht schlecht angestanden. Sein Bestreben war es, uns auch literarisch schon früh den richtigen Weg aufzuzeigen. Zu Weihnachten schenkte er mir regelmässig Nonni-Bücher. Sie hiessen etwa „Nonni und Manni - Die Jungen von der Feuerinsel“ oder „Wie Nonni das Glück fand“. Geschrieben hatte sie Jón Svensson (1857 – 1944), Jesuit, Lehrer und Missionar, der Jungenschriftsteller geworden war, nachdem er aus Krankheitsgründen nicht mehr unterrichten konnte.
Im Elternhaus hatte alles Kulturelle im Religiösen verwurzelt zu sein, musste streng katholisch, unten und oben geschlossen, daherkommen. Unvergesslich bleibt mir die Bilderbuchdarstellung einer nur mit einem Tricot bekleideten Tänzerin. So sehr musste das bisschen nackte Haut Göttis Missfallen erregt haben, dass er kurzerhand zu einem schwarzen Farbstift griff und der Tänzerin ein Baströcklein verpasste. Doch das Bild des prüden, eher etwas verklemmten Schullehrers ist nur die eine Seite der Medaille. Derselbe Götti hat sich als Einziger in meiner Umgebung der darstellenden Kunst gegenüber aufgeschlossen gezeigt, hat Maler wie Carl August Liner verehrt, nicht nur aus lokalpatriotischen Gründen. Vom damals wegen seiner Modernität verfemten (Kirchen-)Maler Ferdinand Gehr besass er mehr als nur ein Werk. Auch mein Vater hat die Stadt St. Gallen gekannt, sich jede Woche dort geschäftshalber aufgehalten. Doch nicht er war es, der mir das Museum näher gebracht, das Stadttheater (wenn auch nur von aussen) gezeigt hat, sondern Götti.
SPIEL, SPASS UND SPORT
Sportliche Förderung und Ertüchtigung erfuhren wir einzig durch die Schule, so ab der 4. Klasse. Vater förderte unsere velofahrerischen Fähigkeiten, indem er uns oft und gern als Velokuriere einsetzte. Als solcher war ich nicht selten und in einem Umkreis zwischen 10 - 20 km im Einsatz – mit bisweilen beträchtlicher Last auf der Hinfahrt, versteht sich. So waren mein Bruder und ich wenigstens zeitweise voneinander getrennt.
In einem grossen Haus wie dem unsrigen mit einem noch grösseren Umschwung befand sich unsere Spielstube nirgendwo und überall. Lange Zeit waren wir einfach damit beschäftigt, tiefe Löcher ins Erdreich unseres Gartens zu graben. Im Sommer bauten wir Hütten mit Brettern aus Verpackungsmaterial und Holzpaletten. Später nähten wir Zelte aus Leintüchern, was Mutter – aus für uns völlig unverständlichen Gründen – ganz und gar nicht zu schätzen schien.
Eine besondere Anziehung hatte der entlang des elterlichen Grundstücks frei fliessende Bädlibach. Während der warmen Jahreszeit brachten wir Tage am Bach, stauten ihn bauten Wasserräder ein. Besonderen Mut brauchte es, in das kanalisierte obere Stück vorzudringen. Dort war’s in heissen Sommertagen immer angenehm kühl. Bei starken Regenfällen wurde das Bächlein jedoch zum reissenden Gewässer. In späteren Jahren hat der Bach regelmässig Wohngebiete überschwemmt, weshalb er dann viel, viel später ausgebaut worden ist. Bei einem Sturz in den Bach hätte es kein Entrinnen gegeben, denn schon kurz danach war er eingedohlt. Das wussten auch meine Eltern, doch es machte für uns nicht den Anschein, als hätten sie sich deswegen besonders geängstigt.
Auch die nähere Umgebung war verlockend. Es galt, die zwei angrenzenden Betriebe, eine Mosterei und eine Gras- bzw. Kartoffeltrockungs-Anlage mit den entsprechenden riesigen Vorratslagern zu erkunden, was vor allem während der arbeitsfreien Zeit, also nach Feierabend und an Wochenenden erfolgen musste.
STÄNDIG LEER. Wenn es um das Glück aus der Dose ging, waren Gallus und ich ein Traumgeschwisterpaar. Auch in unserem Elternhaus war in den 50er Jahren Fortschritt angesagt. Als äusseres Zeichen dafür wurde auf die Kondensmilchtube gedrückt. Erstmals war Milch ohne Kühlung haltbar, jederzeit verfügbar, wohl hauptsächlich zum schwarzen Kaffee der Erwachsenen.Die Tube mit der Kondensmilch, die mich immer wieder heiss machte, lag in der zweiten Schublade von oben. Die Schublade steckte im eierschalenfarbigen Küchenkasten Ich saugte, bis die Tube laubblattflach und mir kotzübel war. Dann blies ich die Backen auf, versuchte der Tube durch den feinen Verschlusshals Luft einzuhauchen, damit sie wieder etwas Bauch bekam.
Eines Tages muss Mutter wohl dahinter gekommen sein. Jedenfalls wollte sie wohl auf Nummer sicher gehen und schaffte sich anstatt Tuben gleich mehrere Dosen „Bärenmarke“- Kondensmilch an. Um ganz sicher zu sein, verwahrte sie diese nicht in der Küche, sondern – vermeintlich sicher – in einem Kasten im Keller, zuoberst und erst noch zuhinterst. Doch auch da war der begehrte Stoff nicht sicher. Ich weihte Gallus in meinen Plan ein. Gemeinsam wollten wir die "Bärenmarke"-Kondensmilch knacken. Ihn machte ich zum Komplizen, denn, so sagte ich ihm, "Bärenmarke" würde auch ihn bärenstark machen, worauf sein Unrechtsbewusstsein so schnell wie der Inhalt der Milchdosen schwand. Wie Ferkel an den Zitzen der Muttersau nuckelten wir abwechslungsweise an der Dose, schlossen verzückt die Augen und genossen die süsse, klebrige Masse mit dem einzigartigen Zuckergeschmack. Gemeinsam und versteckt taten wir uns im Dunkel des Kellers immer wieder an einer neuen Büchsen gütlich, so lange bis die Sache aufflog, wohl weil uns eine leere Dose verraten hatte. Da war Ende der Fahnenstange. Zum Einsatz kam Vaters strafende Hand – wohl nur bei mir, dem Älteren und Anstifter, denn in meinem Kopf hatte die kriminelle Energie gesteckt.
Die Rivalität zwischen mir und meinem um drei Jahre jüngeren Bruder wurde für mich zum Problem, als ich spürte, wie ich meinen natürlichen Vorsprung als Älterer und zunächst physisch Stärkerer immer mehr einbüsste. Eines Tages konnte Gallus nicht nur ebenso schnell rennen wie ich, sondern noch schneller. Auch Im Zweikampf begann er mich immer häufiger zu schlagen. Wegen seiner Sparsamkeit besass er mehr Taschengeld als ich, hatte das schönere und grössere Zimmer. Nicht eben selten pflegten wir daher unsere physischen Kräfte zu messen, zum Leidwesen der übrigen Familienmitglieder. Dabei erschreckten mich seine heftigen Reaktionen immer mehr. Bei unseren Rivalenkämpfen haben wir uns nichts geschenkt und uns dabei so manche blutige Nase geholt – zum grossen Leidwesen unserer Eltern. Und einiges hätte damals – im wahrsten Sinne des Wortes – ins Auge gehen können. Wir hatten einfach gute Schutzengel, und für unsere Blessuren genügten die Selbstheilungskräfte.
Arnegg erschien uns Kindern zeitweise schon etwas zu eng. Andwil war wenigstens ein richtiges Dorf mit Schule und Kirche. Irgendwie hat Andwil Arnegg lebensfähig gemacht. Wenn nichts lief, sorgten wir dafür, dass etwas Schwung in die Arnegger Landschaft kam, z.B. durch Zirkusvorführungen, zu denen sämtliche Nachbarskinder eingeladen waren. Geradezu legendär waren unsere Militärspiele. Offensichtlich hatte ich es immer wieder fertig gebracht, mit Zuzug aus Andwil eine stattliche Schar Spielkameraden für das gemeinsame "Militärlen" zu begeistern. Nebst selbstgefertigten Waffen aus Holz kam da auch Onkel Pauls ausrangierter Karabiner zum Einsatz, und Vaters Tischwagen wurde in mühevoller Arbeit zur Panzerlafette. Als Kanone diente ein Ofenrohr, in welchem eine Karbidbüchse steckte. Wurde ein brennendes Zündholz an das Loch in der Büchse gehalten, gab es einen Riesenknall. Geübt wurde meist an den freien Mittwochnachmittagen. Schliesslich waren wir so weit, mit vereinten Kräfte und Sack und Pack in die grossen Wälder der Arnegger Weite ins Gefecht zu ziehen. Nicht weiter verwunderlich, dass es dort wegen der Frage des Oberkommandos zwischen meinem Bruder und mir zum Streit und anschliessendem Showdown kam, der in einer Meuterei mit ungeordnetem Rückzug endete. Es scheint, als hätte ich meine militärischen Ambitionen bereits sehr früh und sehr gründlich ausgelebt.

In die Primarschule ging ich zu einer Zeit, in welcher der Lehrer bisweilen noch so etwas wie der natürliche Feind des Schülers war. Körperstrafen waren durchaus normal. So soll Schulmeister Schirmer, der in den Dreissigerjahren in Gossau gewirkt hat, wegen seines «Helfenbergers» berüchtigt gewesen sein. So nannte er sein massives Lineal aus Holz, mit dem er unfolgsamen Schülern Tatzen zu applizieren pflegte. Weshalb dieses Züchtigungsinstrument gerade diesen Namen trug? Das Holz dürfte von einer im Gebiet der Ruine Helfenberg gewachsen Tanne gestammt haben, einer Anhöhe mit Ruine hoch über der Glatt, die längst nicht alle Gossauer kennen.
Doch für mich war (Primar-)Schule irgendwie das Grösste. Dabei gab es damals noch keinen schulfreien Samstag - wer könnte sich das heute noch vorstellen!
Nur schöne Erinnerungen an das erste Primarschuljahr im St. Othmar-Schulhaus in Andwil bei Fräulein Agnes Huber – trotz oder vielleicht gerade wegen des langen Schulwegs. Unbeschwerte Schulzeit. Ich war der einzige Knabe meines Jahrgangs aus Arnegg. Zum Glück gab es in der Umgebung noch ein paar gleichaltrige Mädchen, mit denen ich mich recht gut verstand. Zu Beginn meiner Schulzeit hatte es mir vor allem Birgit, Müllermeister Ledergerbers Tochter angetan. Schon etwas Kavalier, begleitete ich sie eines schönen Nachmittags auf dem Heimweg von der Schule bis nach Hause zurück zur Erlenmühle, eine gute Stunde hin, eine halbe wieder zurück. Meine Eltern, in Sorge ob meiner langen Abwesenheit, verboten mir darauf diese Umwege. Es hat mich sehr geschmerzt, als Birgit aus gesundheitlichen Gründen nicht weiter in der Klasse bleiben konnte. Von da an hängte ich mein ganzes Herz an meine Lehrerin. Der Klassenwechsel zu Lehrer Staub (2. und 3. Klasse) war für mich zunächst wie ein Albtraum. Beim Schönschreiben mit Tinte gab mir Staub einmal einen tüchtigen Puff – und ich glaubte, die unbeschwerte Schulzeit wäre für mich für immer verloren.

(1) 2 Klasse (1951) bei Lehrer Viktor Staub
Zum Glück hatte sich dieser Zustand mit dem Eintritt in die Mittelstufe (4. Klassse) und dem damit verbundenen Schulhaus- und Lehrerwechsel schlagartig verändert. Es folgte eine überaus gute und glückliche Primarschulzeit bei Lehrer Alois Brülisauer, einem noch jungen Schulmeister. Lehrer Brülisauer konnte mich nicht nur für Gesang und Flötenspiel, sondern auch für Sport begeistern! Waldläufe mit ihm waren Spitze. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Eigenmann hatte er es auch nicht nötig, zu Körperstrafen zu greifen. Ich erinnere mich an eine einzige Strafaufgabe. Während der Pause war ich im Klassenzimmer auf das bereits etwas altersschwache Klavier gestiegen, wohl um etwas darüber zu behändigen. Ich wurde auf frischer Tat ertappt und darauf stand mein Name in Stenografie an der Wandtafel. Dies bedeutete, dass bei Schulschluss eine Strafaufgabe zu fassen war.
Ein begnadeter Lehrer war auch Hans Ruckstuhl (5. & 6. Klasse). Er verstand es ausgezeichnet, meine Neugierde an der Natur zu wecken. Mit den Primzahlen allerdings hatte ich meine liebe Mühe – erster Hinweis darauf, dass Mathematik und Geometrie nicht meine Fächer sein sollten. Lehrer Ruckstuhl war bestes schulmeisterliches Urgestein. Renitenten konnte er schon mal körperlich mit dem Stock drohen. Ruckstuhl freute sich über meine Extraleistungen, etwa in Form von Sommerferientagebüchern. Er dankte es mir gelegentlich mit Spezialaufträgen, einem Botengang, allein oder in Begleitung mit einem Schulkameraden, zu einem Lehrerkollegen in einem Nachbardorf. Für meine Arnegger Schulkameraden war ich wohl nur ein Streber – und als solcher wurde ich auf dem Schulweg gehänselt und bisweilen auch drangsaliert. Vor allem der Heimweg konnte sehr langwierig werden, wenn wir den Umweg über den Wald nahmen.
IM TURNEN DIE GRÖSSTE PFEIFE
Ich war ein ausgezeichneter Schüler, vor allem in den Fächern zuoberst im Zeugnis (gedruckt 1938 bei der Buchdruckerei U. Cavelti & Co., Gossau), nämlich in Religionslehre und biblische Geschichte. Gut war ich in Deutsch (Lesen, schriftlicher Ausdruck, Rechtschreiben), Geschichte, Geografie, Naturkunde. In den Fächern Schreiben und Rechnen war ich mit Note 1-2 nur mittelprächtig. In den Fächern am Schluss war ich eine Null-Nummer. Wenn es ums Vorsingen ging, hatte ich mich aus falscher Scham immer geziert. Ich getraute mich nicht, allein (vor Mädchen?) zu singen und nahm deswegen eine Zwei im Zeugnis in Kauf. Im Turnen war ich schlecht, ausser im Kilometerlauf, wo als Arnegger offenbar im Vorteil war. Vier Mal täglich gegen zwei Kilometer zu Fuss zu gehen, wenn es eilte zu laufen – ça use, ça use les souliers – und trug bestimmt dazu bei, dass ich zumindest bei Ausdauersportarten matt glänzen konnte, während ich an der Barre oder am Reck wegen meiner nicht eben kräftigen Arme regelmässig versagte und deshalb von Schulkollegen, ein paar davon kräftige Bauernbuben und künftige Kranzturner, schon mal als Memme oder als Streber gescholten wurde.
SCHON ETWAS ABARTIG
Als Messdiener und Flötenspieler befand ich mich nicht immer zur selben Zeit wie meine Kameraden auf dem Schulweg. Weil mir jegliches Ballgefühl abging, begehrten mich meine männlichen Klassenkameraden im Turnunterricht weder im Völker- noch im Fussball. Dadurch bin ich wohl etwas zum Aussenseiter geworden. Dies hätte ich ja noch verschmerzt. Schlimmer für mich war, dass auch meine Klassenkameradinnen wenig Interesse an mir zeigten, weil sie allesamt überzeugt waren, ich würde Pfarrer studieren. Mir blieb deshalb nichts anderes übrig, als nach Höherem zu streben. Ich tat dies indem ich fleissig Juwo-Punkte sammelte. Solche fanden sich in gewissen Markenprodukten, die wir dann natürlich heiss begehrten. 500 solcher Juwo-Punkten berechtigten zu einem Rundflug. Wie stolz ich war, als ich an einem Samstagnachmittag mit dem Velo zum Flugplatz Breitfeld bei St. Gallen fahren und hinter dem Piloten in einem Piper-Sportflugzeug Platz nehmen durfte. Der Flug über die Stadt und die Hügel rund um die Stadt St. Gallen war für mich ein Höhepunkt. Ich hatte dieses Gefühl nochmals erleben dürfen, in einer grösseren Maschine im Flughafen Kloten bei einem dieser seltenen Familienausflüge.
Gegen Ende der ordentlichen Primarschulzeit waren meine beruflichen Vorstellungen diffus. Meine handwerklichen Fähigkeiten und Interessen waren dermassen bescheiden, dass ich mir beim besten Willen nicht hätte vorstellen können, einen handwerklichen Beruf zu ergreifen. Und da waren auch kaum Klassenkameraden mit ähnlicher Wellenlänge, mit denen es mir wirklich Spass gemacht hätte, mit ihnen gemeinsam in der Realschule Gossau die Schulbank zu drücken. Deshalb hatte ich mich immer mehr mit dem Gedanken angefreundet, das Gymnasium Friedberg in Gossau als externer Schüler zu besuchen, zumal ein älterer Schulkollege diesen Schritt bereits getan, und einer meiner Klassenkameraden sich ebenfalls für diesen Weg entschieden hatte.
Was weisst du noch über deinen Schulweg?

Welches sind deine Erinnerungen an Schulferien, Ferienlager, Schulreisen?

SCHULFERIEN
Unsere Herbstferien durften wir regelmässig bei Onkel Johann im Schulhaus im innerrhodischen Meistersrüte verbringen. Wie ich mich noch gut erinnere, waren meine allerersten Ferien im Appenzellerland nicht unbelastet, denn ich litt anfänglich an schrecklichem Heimweh. Vermutlich vermisste ich meinen Bruder. Ich hatte keine andere Wahl, als mich mit meinem Kinderwerkzeug im weiss eingezäunten Schulgärtchen abzureagieren, wo – wie ich später erfuhr – auch ein Blindgänger seine letzte Ruhe gefunden hatte. Auch wenn es nur eine mehr oder weniger harmlose Granate gewesen sein durfte, hatte ich doch stets grössten Respekt vor dem Ding. Onkel Johann hatte nach Kräften versucht, meine durch das Heimweh verursachte Pein durch Ablenkung zu lindern. Des Öfteren ist er mit mir zu einem Bauernhof in der Nähe spaziert. Jedenfalls erinnere ich mich an die 'Zötteli' der weissen Ziegen der Familie Ruosch und an Göttis Bonbons mit echter Fruchtfüllung, mit denen er mir die Spaziergänge zu versüssen suchte, die mir damals so unendlich lange vorgekommenen sind.
(1) Schulhaus Meistersrüte/AI mit Schulmeister
MEINE LIEBLINGSTIERE. Seit meinen ersten Ferien im Appenzellerland liebe ich sie, diese mit dem Steinbock verwandten faszinierenden Wesen, die zu den ältesten Haustieren des Menschen zählen. So haben bereits die Römer die Figur des Ziegenbocks verwendet, insbesondere als Begleittier von Merkur. Interessanterweise kam bei Ausgrabungen in Kaiseraugst um die Jahrtausendwende ein schönes Exemplar aus Bronzeguss aus dem 2. Jahrhundert zum Vorschein. Die ausserordentliche Applike befindet sich nun im Depot des Römermuseums.
Die Ziege gilt als höchst eigenwilliges Tier. Sie kann manchmal stur oder boshaft erscheinen und sie meckert häufig. Und noch eines haben wir gemeinsam, die Geiss und ich. Dort, wo sie nicht hin kann, dort will sie grasen – genau wie ich. Bin ich im Elsass, fühle ich mich als Elsässer, im Jura als Jurassier, möchte am liebsten dort sein und bleiben. Wenn ich da bin, lobe ich die Menschen von dort – und umgekehrt.
Die Mär von den dummen Ziegen war mir stets suspekt. Im Rahmen eines Forschungsprojektes am deutschen Forschungsinstitut für Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere (FBN) mussten Zwergziegen lernen, den Schalter neben dem richtigen Symbol zu drücken, damit sie zu ihrer Portion Wasser kamen (von Stärkerem ist nicht die Rede!). Dabei hat sich das, was ich immer vermutet hatte, bewahrheitet. Der Versuch hat gezeigt, dass die Tiere sehr gut unterschiedliche Figuren unterscheiden können und schnell auf neue Muster umlernen. Stellt man allerdings neue Lernaufgaben, ist der Erfolg zuerst gering und die Herzschlagmessungen deuten auf eine gewisse Frustration der Tiere hin – was uns Menschen ja nicht so völlig unbekannt ist. Kennen die Ziegen allerdings die Lernaufgabe bereits, dann sind sie ganz eifrig beim Lernen und haben bald hohen Erfolg, was das Herz wiederum beruhigt und zu einem Zustand der Entspannung führt, berichtet das FBN. Die erfolgreiche Bewältigung solcher Herausforderungen stellt für die Tiere nicht nur keine Belastung dar, sondern gibt ihnen aktive Sicherheit und reduziert die Langeweile. (BaZ 09.01.04 fbn-dummersdorf.de">fbn-dummersdorf.de ) Doch warum heisst der Ort, wo die klugen Ziegen lernen, ausgerechnet Dummerstorf?
Ziegen gelten als ausgesprochene Feinschmecker. Ihr Atem lässt Blattläuse vor Schreck erstarren: Weil sie nicht gefressen werden wollen, lassen sie sich in Massen von Pflanzen fallen, sobald sie die Atemluft einer Ziege spüren. Und was mir Ziegen ganz besonders sympathisch macht: der aus Ziegenmilch hergestellte Käse. Im Verlaufe meiner reiferen Jahre ist Ziegenkäse für mich immer mehr zum wahren Genussmittel geworden.
Die Herbstwochen droben im Appenzellerland zwischen Appenzell und Gais waren für mich jeweils so etwas wie der Höhepunkt des Jahres, nicht nur der Ziegen wegen. Trotz Plumpsklo ging es im grossen Appenzellerhaus mit der Inschrift ‚Der Jugend‘ vornehmer zu als im Elternhaus. Die lichte Stube mit ihrem wundervollem Blick auf die Bergketten des Alpsteins war für mich der Inbegriff von Wohnlichkeit: Weiche Teppiche, ein schönes Buffet, darauf eine reich verzierte Standuhr, ein Prachtsexemplar der Uhrmacherkunst, daneben ein Marienbild in Form eines Faltaltars. Dort verrichtete Onkel Johann mit uns zusammen kniend das Morgen- und Abendgebet. Am grossen, mit einem reich verzierten Leinentischtuch bedeckten Stubentisch pflegte der Schulmeister seine Präparationen für den nächsten Tag vorzunehmen, derweil wir uns still beschäftigten. Stühle und Eckbank, alles aus massivem Holz, waren mit weichen Polstern belegt, alles fein und sehr wohnlich. Respektabel auch Göttis Bibliothek und seine Langspielplatten-Sammlung. Nebst den Klassikern liebte Götti die Symphonien von Bruckner und Choraufnahmen, nicht nur religiöse sondern auch weltliche Werke, wie jene von den Donkosaken. Beeindruckend auch seine Zimmerpflanzen: kräftige Aloe und verschiedene grosse Kakteen. An den Wänden hingen ausgesuchte Originalbilder, nicht alle mit religiösen Motiven. Heiligenbilder sowie Statuen befanden sich hauptsächlich in den Schlafzimmern.
Der gute Geist in Onkel Johanns Haushalt hatte einen Namen: Albertina, eine gebürtige Rheintalerin, für ihr Alter ausserordentlich gut zu Fuss und sehr religiös. Tagtäglich besuchte sie die Frühmesse, abwechslungsweise in Appenzell oder Gais. Ich denke, sie hat sich wohl auch etwas auf die Zeit mit uns Buben gefreut. Noch meine ich das Leuchten in ihren Augen zu sehen, wenn sie uns wieder eine Spezialität aus ihrer Heimat, den «Törggeribel» auftischen konnte. Dazu verwendete sie einen aussergewöhnlichen Mais, der nur im feuchtwarmen Klima des Sankt Galler Rheintals gedeiht. Seiner traditionellen Zubereitung wegen sagt man ihm einfach «Ribelmais»: Ähnlich wie für die Polenta der Bündner wird der dick gekochte Brei mit der Raffel fein gerieben und bröselig-knusprig gebraten. Anders als jeder andere Mais ist der Rheintaler Ribel fast weiss. Man könnte ihn mit Weizengriess verwechseln. Dank der Initiative einiger Bauern blieb die seltsame Sorte erhalten. Und ja, sie wurde sogar in das heute begehrte Register der AOC − der gesetzlich geschützten Ursprungs-bezeichnungen – aufgenommen. Bei Onkel Johann mit Silberbesteck, Porzellan, Stofftischtuch und Stoffserviette zu Tisch zu sitzen, war für mich etwas Besonderes. Da fühlte ich mich in einer anderen Liga als zu Hause, wo wochentags Stammoid-Tischtücher und rot getupftes Geschirr vorherrschten.
Gelegentlich sass auch die junge Kollegin von Onkel Johann, die Unterstufen-Lehrerin Therese Dörig mit am Tisch. Ihr Charme und ihr feines Lächeln hatten mich von Anfang an beeindruckt. Manchmal durfte ich bei ihr einen Schulbesuch abstatten. Doch meistens sassen mein Bruder und ich tagsüber in der grossen Schulstube von Lehrer Helfenberger, wo Viert-, Fünft- und Sechstklässler schrieben, lasen, rechneten und vor allem sangen. Göttis Geografie-Stunden bleiben mir unvergesslich, weil ich erstmals nicht nur von St. Gallischen Flüssen und Seen hörte, sondern von Simme, Saane und Rhone. Gesungen wurde klassenübergreifend. Wenn es aus rund fünfzig Innerrhödler Kehlen tönte «Es isch mer alles ei Ding» und Götti am Harmonium begleitete, dann klirrten die Fensterscheiben. In der Pause ging es rund um die beiden Schulhäuser viel lebhafter zu als zu Hause. Bei diesen wilden Spielen, bin ich mir unter all diesen Bauernbuben manchmal als ‚Föchbotz‘, appenzellerisch für Angsthase, vorgekommen.
Etwas wärmer ums Herz wurde mir in der Gegenwart meiner Lieblingsschülerin mit den langen blonden Zöpfen. Sie war Tochter des Käsers, der eine Zeitlang als Schulpflegepräsident amtete. Es schien mir fast, als hätten Götti und er das Heu nicht immer auf der gleichen Bühne gehabt. Erst begnügte ich mich mit Esthers Aufsatzheften. Ich glaubte, ihre Hefte allein schon wegen ihres ganz besonderen Geruchs zu erkennen. Später gelang es mir, ihre Aufmerksamkeit oder sogar ein Lächeln zu erhaschen, mit ihr in der Pause ein paar Worte zu wechseln.
Esther war über Jahre mein erster wahrer Schulschatz. Dies konnte den übrigen Schülern nicht entgehen, trotz meiner grössten Diskretion. Götti hat allerdings sehr darüber gewacht, dass ich mich abends nicht zu oft und zu lange vom Schulhaus entfernte. Vermutlich waren es meine letzten Ferien im Appenzellerland, als der leider allzu früh verstorbene Roman Fässler, eine originelle Führerfigur, ganz in der Pose eines Landammanns, beim gemeinsamen Spiel in einem Wäldchen beim Sammelplatz Esther und mich zusammengab, indem er – ausgestattet mit einem Holzstock – uns beide für ‚geheiraspelt‘ erklärte. Ganz sicher stieg mir da die Schamröte ins Gesicht. Und erst recht später, als mich Götti nach dem Kirchbesuch in Appenzell einem seiner Lehrerkollegen als «mein Neffe» vorstellte. Esthers Nachname war Neff!
Ausgerechnet im Appenzellerland hat sich bei mir zu jener Zeit auch ein anderes Phänomen bemerkbar gemacht. Zwecks körperlicher Ertüchtigung und wohl auch damit sie nicht zu sehr auf dumme Gedanken kämen, hatten die Gymnasiasten des Kollegiums Appenzell im flotten Tempo von Appenzell über Meistersrüte und wieder zurück zu joggen, gut und gern so sechs bis sieben Kilometer. Mehr als einmal habe ich mich den Studenten angeschlossen und bin mit ihnen Richtung Appenzell gelaufen. Damals wurde wohl meine Karriere als Ab-und-zu-Jogger begründet. An diese Zeit muss ich noch heute ab und zu denken, wenn ich mit heutigen Laufschuhen meine Runden drehe. Und dann sehe ich mich wieder mit meinen blauen Turnschuhen von damals – eine dünne Gummisohle mit einem Oberteil aus Segeltuch und schwarzer Gummikappe über den Zehen, und sonst gar nichts, ein wenig wie barfuss eben. Damals muss wohl mein (sportlicher) Ehrgeiz erwacht sein, der mich immer wieder angetrieben hat.
Wie hätten sie reagiert, wenn du einen ausgefallenen Berufswunsch geäussert hättest? Oder ist das sogar geschehen?


(1) Eltern, vor dem Restaurant z. Ilge (um 1970)
Falls du das Gymnasium besucht hast, was war deine Motivation?

Meine Zeit am Gymnasium Friedberg (1956 – 1959)
Der Weg zum Gymnasium war mir keinesfalls vorgezeichnet. Zugute kam mir zunächst die Tatsache, dass ich meine Rolle als Ministrant beinahe zu perfekt gespielt hatte. Es wurde gesagt, ich hätte nach der Firmung am 4. Mai 1953 zu Hause bisweilen aus dem Messbuch vorgelesen. Nicht nur meine Mutter hoffte insgeheim, ich könnte Priester werden. Der Gedanke, dereinst als Priester oder Missionar zu wirken, war für mich zu dieser Zeit durchaus angenehm. Unter dem Einfluss der beiden weiss gewandeten Dominikaner-Patres, die in der Zeit vom 15.2. bis 4.3.1956 in Andwil mit der Mission des Volkes betraut waren, hatte sich diese Vorstellung wohl noch verstärkt. Eine Rolle gespielt haben dürften in diesem Zusammenhang auch, dass Bekannte mit dem Theologiestudium begonnen oder es gerade abgeschlossen hatten und die Priesterweihe empfangen hatten. Götti und Gotte haben mich in meinen Bestrebungen nach Kräften unterstützt. Davon zeugen ein Missale, Geschenk meines Göttis, und das Gebetbuch „Jugend vor Gott“, das mir meine Taufpatin zu Weihnachten 1957 geschenkt hatte. Zu jener Zeit gab es wohl kaum sinnvollere Geschenke als Gebetbücher. Darüber hinaus bedurfte es noch der Überzeugungskraft verschiedener Respektspersonen, bis sich meine Eltern bereit fanden, mich für den Vorkurs im Friedberg anzumelden. Dabei dürfte es für mich von Vorteil gewesen sein, dass ein älterer Schulkollege aus Andwil bereits ein erstes Jahr im Gymnasium Friedberg absolviert hatte und dass sich auch einer meiner Klassenkameraden für diesen Weg entschieden hatte. Mit dem Übertritt in eine privat geführte Schule entstanden den Eltern erhebliche Mehrkosten. Nebst den Schulkosten von Fr. 300.- pro Trimester kamen noch Ausgaben für Schulmaterial und Bücher.
Wie ich mich doch auf den Schulbeginn am Gymnasium Friedberg gefreut hatte! Alles sah so viel versprechend aus: Moderne, helle Schulräume, freundliche Patres und auch Lehrer, die nicht Ordensleute waren, Mitschüler fast aus der ganzen (Deutsch-)Schweiz. Als externer Schüler spürte ich zwar eine gewisse Distanz seitens meiner internen Klassenkameraden. Zum Glück waren mein Primarschulkollege und ich nicht die einzigen Externen. Externe gehörten dazu – und doch gehörten wir nicht ganz richtig dazu, denn was da im Internat über Mittag, abends und an Wochenenden alles abging, davon bekamen wir Externe herzlich wenig mit.
BITTERE FRON. Agricola arat. Der Bauer ackert. So einfach ist das am Anfang mit dem Latein. Aber schon bald war es nicht mehr der Bauer, sondern ich, der im Schweisse seines Angesichts ackerte, kulturelles Saatgut vom Typus Ablativus absolutus in die arme Hirnscholle einzupflügen versuchte. Und wozu das alles? Ist es wirklich zu rechtfertigen, dass Adam und Eva kurz nach der Ausschaffung aus dem Paradies von ihren ehrgeizigen Eltern auch noch gezwungen wurden, den Lateinkurs zu belegen? Weil sie so besser denken lernen würden? Weil sie es dann leichter hätten mit all den anderen Fremdsprachen? Und weil eben eine richtige Bildung nötig sei?

(1) Gymnasium Friedberg, Studenten und Lehrkörper (1958)
Im Vorkurs überzeugten meine Leistungen − wen wundert´s – in Religionslehre, Geschichte und Gesang (sic). Schlecht blieb ich im Turnen – Pfeife bleibt Pfeife. In der 1. Klasse. betrug meine Gesamtdurchschnitt 4.4, wobei ich in Latein und Mathematik hin und wieder unter 4 notierte. Meine Leistungen waren unterschiedlich, ebenso meine Moral, himmelhoch jauchzend, wenn ich gut war, zu Tode betrübt, wenn ich versagt hatte. Doch ich begnügte mich damit, einfach zu lernen; das Büffeln überliess ich gerne den Ochsen.
An dieser Schule war Sport, insbesondere Fussball, sehr wichtig. Ausgerechnet hier hatte ich nichts vorzuweisen; ich konnte weder Schwimmen noch Skifahren, schon gar nicht Schlittschuhlaufen oder Tennis spielen. Noch am ehesten etwas abgewinnen konnte ich dem Handballspiel. Doch hier traf schon bald ein Bombenschuss nicht das Tor, sondern mich voll ins Gesicht. Ich ging zu Boden und danach auf Distanz zu allen Ballsportarten. Selbst der Cortège an der Basler Fasnacht sollte mir deswegen später stets etwas ungeheuerlich bleiben.
Wenn ich nach dem langen Schulweg mit dem Velo je nach Wetterlage verschwitzt oder regennass im Klassenzimmer eintraf, war ich in den Augen meiner dem Internat und mithin meist besseren Häusern entstammenden Mitschüler einfach nur das einfältige «Landei», weder körperlich noch intellektuell fähig und in der Lage, im Klassenverband vorne mitzuhalten − der klassische Underdog eben. Daher wohl auch mein Übername «Pudel». Die Assoziation zu folgendem alten Ostschweizer Kindervers liegt nahe:
De Pfarrer vo Sangalle
isch i d’Stande*) abefalle
Wo n er wieder ufe chunt,
stinkt er wie en Pudelhund.
*) Gülleloch
All die Jahre am Gymnasium hatte ich extrem unter meinen Schulkollegen und deren Aggressionen im Klassenzimmer zu leiden. Einmal hatte ein vor mir sitzender Walliser Mitschüler vor einer Geografie-Stunde kurz vor Eintritt des Lehrers mir seinen unheimlich dicken Weltatlas auf den Kopf geschlagen. Ich hatte kurz nur noch Sternchen gesehen und meine Kopfwehattacken verschlimmerten sich. Ein andermal wurde ich, ebenfalls unmittelbar vor Eintritt des Lehrers ins Klassenzimmer, vom bärenstarken Mitschüler Ebnöther in den Papierkorb gesteckt und damit auf den Wandkasten gehievt. Eine ungeschickte Bewegung meinerseits hätte genügt und ich wäre zum allgemeinen Gaudi der Klasse samt Papierkorb heruntergefallen.
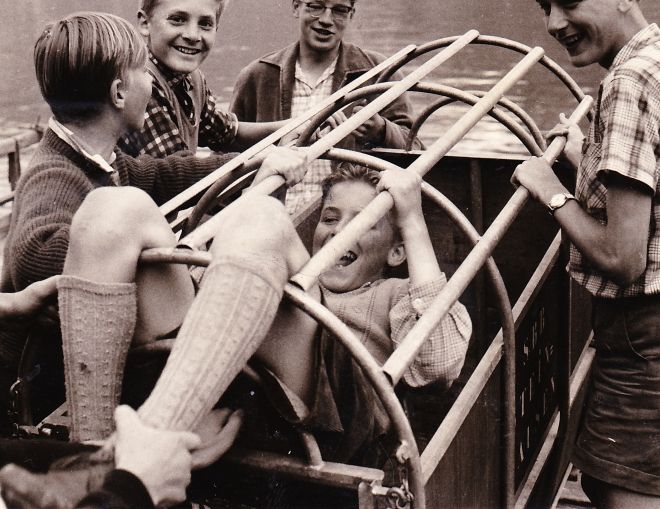
(2) Auf dem Schiffssteg in Bauen/UR: Pudel soll ersäuft werden
Dieses Bild bleibt in meinem Kopf haften. Es stammt aus einem Ferienlager in Bauen am Urnersee. Dort hatten mich ein paar Kameraden in ein bereitstehendes Kälbergatter gesperrt und sich angeschickt, mich über den Schiffssteg in den See zu kippen. Plötzlich überkam mich eine panische Angst, in meinem Käfig in die Tiefe des Urnersees zu stürzen und elendiglich zu ertrinken. Todesängste auch bei meinem ersten Besuch der Badanstalt in Gossau. Ein paar meiner Klassenkameraden packten mich als bekennenden Nichtschwimmer gleich nach dem Eintritt ins Bad und beförderten mich kurzerhand ins Schwimmerabteil. Ein Rettungsschwimmer brachte mich völlig erledigt in Sicherheit. Während Jahren hatte ich einen Schock und mied alles, was nach Badanstalt roch.
Für mich war im Gymnasium „Friedberg“ die später als «Mobbing» bezeichnete real existierende Schulzimmer-Gewalt absolut und allgegenwärtig. Sicher wirkte ich nicht besonders männlich auf meine Umwelt, war alles andere als ein Draufgänger, doch ein Schosshündchen war ich beileibe nicht! Mit ein paar Klassenkameraden, die mein Schicksal als externer Schüler teilten, verstand ich mich recht gut, doch das reichte nicht aus. Ich hätte stärkerer Unterstützung durch das soziale Umfeld bedurft. Zwei meiner damaligen Lehrer, Karl Landolt (1925 - 2009), Zeichnungs-, Mathe- und und Astronomielehrer, und der in Bezug auf seine Körpergrösse kleinste Mitglied des gesamten gymnasialen Lehrkörpers, Kurt Klöpsch, Gesangs- und Musiklehrer, brachten mir am meisten menschliches Verständnis entgegen. Er neckte mich jeweils mit der Abkürzung PP «Pius Pudel», deutete diese aber als offizielle postalische Abkürzung „Port Payé“. Diese war auf Massensendungen, wie Todesanzeigen, anzutreffen und daher etwas maliziös als «Plötzlich Putzt» umgedeutet. Ironie des Schicksals: Der Tod von Pater Kurt kam sehr plötzlich und unerwartet. Er hatte beim Schwimmen im Bodensee einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten.
Pater Karl Landolt (1925 – 2009), ein hoch sensibler, künstlerisch begabter, überaus liebenswürdiger Mensch. Er hat später die Konsequenzen gezogen, sich in den Laienstand versetzen und an der Schule für Gestaltung in Basel zum Zeichnungslehrer ausbilden lassen. Es war für mich immer ein besonderes Gefühl, ihm später in Basel wieder zu begegnen. Er hatte wohl immer an mich geglaubt sich an meinen Erfolgen gefreut. Für mich unvergesslich, auf dem Hintersitz seines Motorrollers durch die Basler Strassen zu fahren.
Es scheint, als hätte ich mich als Opfer immer geradezu angeboten. Später hatte ich bisweilen den Eindruck, als würden meine Widersacher und Intimfeinde meinen Opfer-Geruch wittern, so wie Jagdhunde den Schweiss (Blut-)Geruch des Wildes.
PUDEL AOC. Pudel sind keine Jagdhunde. Für mich war ein Pudel zu dieser Zeit nur ein partiell geschorenes Schosshündchen. Erst in reiferen Jahren habe ich erfahren, dass Pudeln ein Teil des Fells geschoren wurde, weil sie ursprünglich der Entenjagd dienten. Geschoren hatten sie weniger Wasserwiderstand. Die langen Haare an Brust, Kopf und Pfoten hingegen gaben ihnen Auftrieb und hielten sie warm. In der Stadt Paris wurden Pudel bis in die fünfziger Jahre zur Kanalreinigung durch die Röhren der Kanalisation getrieben. Seit 1936 geniesst Frankreich das Recht, sich als Ursprungsland des Pudels zu bezeichnen – allerdings nur, weil Deutschland offiziell auf den Titel verzichtet hat. Noch grössere Achtung hat mir diese Rasse abverlangt, als ich erfahren habe, dass der Lagotto Romagno, eine ursprüngliche Pudelart, in Italien zur Trüffelsuche eingesetzt wird. Seit ich aber weiss, dass Königspudel zu den ersten Blindenführhunden gehören, halte ich Pudel für alles andere als dumm. Leider war mein Klassenkamerad aus der Primarschulzeit bereits vorher ausgeschieden; danach fühlte ich mich im Klassenverband noch einsamer. Zudem litt ich seit meiner Hirnerschütterung immer wieder unter starken migräneartigen Kopfschmerzen, die besonders bei Anstrengungen auftraten.
Um mir etwas Taschengeld zu verdienen, war ich während der Schulferien immer wieder tätig, als Bürogehilfe des Verwalters im Gymnasium Friedberg, als Fensterreinigungsgehilfe in der Firma Weibel und in der Ausrüsterei der Buchdruckerei U. Cavelti & Co., Gossau. Ich war fasziniert vom äusserst lebehaften Gossauer Druckereibetrieb. Hier entstanden gleich mehrere katholisch-konservative Tageszeitungen, u.a. der «Der Fürstenländer», seit jeher das Leibblatt im Hause Helfenberger. Zu dieser Zeit befand sich der konventionelle Buchdruck mit der riesigen Rotationsmaschine (Heureka) auf seinem Höhepunkt. Überall roch es nach Druckerschwärze und Papier. Die grossen technischen Umstellungen vom Buchdruck auf den Offsetdruck und vom Bleisatz zum Filmsatz standen erst bevor. Mit dem verdienten Geld kaufte ich mir meine ersten Jeans und einen Kittel. Verblüffend, wie das neue Outfit auch mein Selbstwert- und Lebensgefühl veränderte.
Zu Beginn der 2. Klasse attestierte mir der Rektor Fleiss und Ängstlichkeit, ein Trimester später Zuwachs an Männlichkeit - allerdings bei einem geringfügig tieferen Gesamtnotendurchschnitt! Das Fach Mathematik drohte, für mich zum «Killerfach» zu werden. In der 3. Klasse kam Griechisch hinzu (Durchschnitt 3). Zudem sackten meine Werte auch in Französisch und Geschichte unter 4 ab. Damit war ich – trotz belobigtem Fleiss und Pflichtbewusstsein – mit meinem Notendurchschnitt erstmals unter 4 gerutscht. Damit erfolgte zwangsläufig die Zeugnisbemerkung «Ein Berufswechsel ist zu empfehlen.» Mit diesem «Consilium abeundi» war meine Gym-Zeit besiegelt. Doch das machte mich zunöchst nicht bange – im Gegenteil.
Während meiner Zeit am Gymnasium waren Begegnungen mit aussenstehenden Personen, die mich verstanden, gefördert und meinen Blick erweitert haben, selten. Meine Probleme hatte ich für mich behalten; selbst die Nächsten wussten nicht wirklich um meine Schwierigkeiten. Eine Ausnahme war Herr Fürer aus Gossau, ein Bekannter meiner Eltern, beruflich im Aussendienst der Maschinenfabrik Högger tätig und deshalb ständig mit dem Auto unterwegs. Ihn durfte ich ihn auf einer seiner Geschäftsreisen ins St. Galler Oberland und in den Kanton Graubünden während ein paar Tagen begleiten. Zum ersten Mal gelangte ich nach Chur, wo wir im Hotel übernachteten – meine erste Nacht in einem Hotel! Ganz offensichtlich hatte Herr Fürer den Knigge intus. Jedenfalls hatte ich dank ihm während kurzer Zeit nicht nur für mich unbekannte Gegenden kennen gelernt, sondern auch von ihm so ganz nebenbei einiges über richtiges Benehmen erfahren.Lichtblicke waren für mich in jener Zeit vor allem die Kontakte zu Josef Koller, dem älteren Bruder meines Klassenkameraden Emil. Mit ihm hatte ich die Begegnung der besonderen Art beim Schanzentisch in der 3. Primarklasse. Josef hatte 1958 in Immensee die Matura gemacht. Er war für mich mehr als ein Genie − ein Genie mit Vespa! Josef unternahm nicht nur den heroischen Versuch, mich in Mathe und Geometrie auf Vordermann zu bringen. Nicht weniger verdienstvoll: Josef hat mir bisher unbekannte Teile der Schweiz näher gebracht. Auf dem Hintersitz von Josefs Vespa gelangte ich an die lieblichen Gestade des Zugersees, nach Immensee. Zum ersten Mal in meinem Leben kam ich nach Basel, wo Josef einen Klassenkameraden besuchte. Basel im Sommer − damals viel zu gross und die Luft zu stickig für mich.
Im August 1960 fuhren Josef und ich zusammen auf seiner Vespa ins St. Galler Oberland, in die Gegend der Churfirsten. Bei einem anschliessenden Besuch des Thermalbads in Bad Ragaz wollte mir Josef wohl das Schwimmen beibringen. Jedenfalls liess ich mich zum Besuch des Thermalbads überreden. Nach einigen Versuchen, mich ans Wasser zu gewöhnen, war ich mit dem Kopf einige Male unter Wasser geraten, worauf ich eine äusserst heftige Kopfwehattacke erlitt. Wie durch ein Wunder blieb ich in der Folge von Kopfweh weitgehend verschont.
Weiter zur Schule gehen oder einen Beruf erlernen?
Wie hatte ich mir mit fünfzehn meine Zukunft vorgestellt? −Zu dieser Zeit hatte die Option «Weiterer Schulbesuch» überhaupt nicht mehr zur Diskussion gestanden. Aus heutiger Sicht ist mir dies unverständlich. Schliesslich gab es in St. Gallen zwei Schulen, die Katholische Kantonsrealschule, die «Flade», Nachfahrin der berühmten Klosterschule, und die «Kanti», die offizielle Kantonsschule. Und St. Gallen war nicht auf dem Mond! Doch niemand wurde deswegen angegangen, kein Bekannter und auch kein Erziehungsberater. Diese hätten mich ja noch darin bestärken können, dass ich im Innersten ein Gymi machen wollte, vielleicht nicht mit altsprachlichen Fächern wie im Friedberg.
Alternativen, wie etwa ein Übertritt in die als freisinnig-liberal geltende Kanti, waren im Hause Helfenberger schlichtweg tabu. Deshalb hatte ich mich hinter Vaters Rücken bei der Ciba in Basel nach den Möglichkeiten einer Laborantenausbildung erkundigt − zugegebenermassen eine etwas verwegene Idee. Am Gym hatten wir zwar Latein und Griechisch gehabt, aber keine einzige Stunde Chemie und Physik! Als ich eine Einladung nach Basel erhielt, waren meine Eltern darüber alles andere als erfreut. Die Arbeit in einem Labor wäre ausgesprochen ungesund, meinte Vater. In Tat und Wahrheit wollte er − eingeschriebenes Mitglied der Katholisch-Konservativen oder zumindest Sympathisant dieser Partei − mich nie und nimmer in eine rote Stadt ziehen lassen. Auch mit einer Ausbildung im Werbebereich hatte ich geliebäugelt. Zwar war ich kein besonders talentierter Zeichner, aber ich stellte mir vor, mich eher aufs Texten verlegen zu können. Hier ortete ich bei mir ein gewisses Talent, nachdem ich bei der Firma Borgward – damals Deutschlands viertgrösster Autohersteller – mit einer Arbeit über das neuste Modell ‚Isabella‘, einen Hauptpreis, nämlich einen einwöchigen Aufenthalt in Hamburg gewonnen hatte. Meine Eltern waren jedoch dezidiert der Meinung, es wäre für mich besser, den Auslandaufenthalt fahren zu lassen, wohl angesichts meiner schlechten schulischen Leistungen (oder vielleicht nur, weil sie in der Hafenstadt Hamburg Angst um mein Seelenheil hatten). Von der Firma Borgward erhielt ich schliesslich einen Reiseradio als Trostpreis. Diese Geräte, mit Röhren und grossen, sensationell teuren Batterien bestückt. waren eben neu auf den Markt gekommen. Endlich besass ich ein eigenes Radio, konnte meine eigene Musik hören.
GEFÄLLIGST EINEN ANSTÄNDIGEN BERUF ERLERNEN. Mir war unterdessen klar geworden, dass ich mit meinen für sie offensichtlich exotischen Berufsideen bei meinen Eltern immer und ewig auf Granit beissen würde. Aus diesem Grund bewarb ich mich auf Anraten meines Vaters auf die ausgeschriebenen Verwaltungslehrstelle in der Gemeindeverwaltung Gossau. Wie sich doch die (Familien-)Geschichte wiederholt: Sein Vater hatte ihm den Weg ins Käsereibedarfsartikel-Fach vorgezeichnet, während mir mein Vater den Weg in den Verwaltungsdschungel wies.
Im Falle meines Bruders hat sich das Problem des Übertritts drei Jahre später gestellt. Auch er entschied sich – wenig überraschend – für das Gymnasium Friedberg. Nach meinen Abgang war die finanzielle Belastung für meine Eltern jedenfalls geringer. Ihre Hoffnungen ruhten nun ganz auf «Shooting Star» Gallus. Würde er es schaffen und Priester werden?

Meine Freizeit
MEINE HOBBIES
BERGWANDERN Bereits während meiner Jugendzeit war ich es mir gewohnt, mittlere Distanzen mit dem Velo zurückzulegen, etwa an die Ausgangspunkte für Bergtouren im Appenzellerland, Urnäsch oder Brülisau. Es war dies eine der wenigen Möglichkeiten, über das Wochenende zusammen mit Kollegen und Freunden etwas gemeinsam zu unternehmen. Während der Lehrzeit war ich so richtig auf den Geschmack gekommen, hatte so manche Bergtour im Alpstein unternommen. Startpunkt war meist Wasserauen, erstes Ziel die Meglisalp, ein Hirtenweiler, zu dem – Appenzeller lieben es gesellig – auch eine Wirtschaft gehört. Anmarschiert wurde entweder in der Normalvariante via Seealpsee oder auf dem exklusiveren Schrennenweg hoch über dem See. Eine Basisration Kaltblütigkeit muss man dafür freilich mitbringen, denn rechts fällt der Hang fast senkrecht ab; es schaffen die Route zur Alp und zurück im Frühling und im Herbst auch die Kühe.
JUGENDARBEIT Glücklicherweise verfügte ich als Lehrling wieder über mehr Freizeit. Diese nutzte ich hauptsächlich für Jugendarbeit. In der Kath. Jungmannschaft Andwil hatte ich offiziell für die Finanzen zu sorgen, doch machten mir Dinge wie Unterhaltung, Programmgestaltung und insbesondere die Herausgabe eines Vereinsorgans mehr Spass. Im September 1960 spielte ich im Theaterstück «Das entweihte Haus» die Rolle des Gemeindesekretärs, wohl hauptsächlich aus Sympathie zur Regisseurin, der hübschen neuen Lehrerin in Andwil. Gleichzeitig absolvierte ich mit ein paar Kollegen einen Ausbildungsgang zum Jungwachtführer. Zusammen gründeten wir Andwil die erste Jungwacht-Schar. In Andwil und darum herum war ständig etwas los, Gruppen- und Scharnachmittage, Gottesdienste, Bergtouren, Velofahrten und daneben viele Sitzungen. Die Kameradschaft unter den Gruppenführern war prima und es gefiel mir sehr. Als Gruppenführer war ich für etwa ein halbes Dutzend Buben verantwortlich. An jene Zeit erinnern Fotos und ein Don Bosco-Bildchen. Dieses trägt auf der Rückseite eine Widmung samt Unterschrift von Kaplan Franz Xaver Mäder, dem damaligen Präses von Jungmannschaft und Jungwacht: «In dankbarer Erinnerung an Deine treue Pionier-Jungwacht-Arbeit 1960 – 1962». «Pioniere» − war dies nicht die Jugendorganisation des Klassenfeinds im Osten Deutschlands?
VELOFAHREN Während meiner Aus- und Weiterbildungszeit lagen Hobbies weder zeitlich noch finanziell drin. Später brachten Ausflüge und Wanderungen mit den Kindern Abwechslung in den Arbeitsalltag. Im Verlaufe der Jahre wurde das Velofahren, insbesondere mit dem Rennrad, mein eigentliches Hobby. Eine Wende brachte erst das Jahr 1995.
LEIDENSCHAFTLICHER SKIPPER TRIFFT AUF EINGEFLEISCHTE LANDRATTE Eine Wende brachte erst das Jahr 1995, als mich Matthias, ein junger Kollege vom Spanischkurs, fragte, ob ich Interesse hätte, bei einem Sardinien-Segeltörn mit von der Partie zu sein. Diese Anfrage erschien mir angesichts meines doch eher komplizierten Verhältnisses zum Element Wasser, doch eher aussergewöhnlich. Lange dürfte ich mir die Sache allerdings doch nicht überlegt haben. Bereits das Ziel schien mir verlockend genug, denn ausser Elba und Mallorca kannte ich damals überhaupt keine Mittelmeerinsel. Schon bald traf man sich mit den übrigen vier Crewmitgliedern, die auch ein Wörtchen mitzureden hatten, wenn es um einen Neuen ging. Und so kam, dass wir uns gegenseitig von Anfang an sympathisch waren. Zum Glück kannte damals noch keiner meine Vorgeschichte! Schliesslich konnte ich inzwischen auch etwas Schwimmen – so für alle Fälle. Aber würde mich nicht die Seekrankheit plagen und dann das Ganze für mich zum Alptraum werden?
Im Frühsommer 1996 wagten wir es gemeinsam. Ausgangshafen war Olbia. Welch erhabenes Gefühl, als sich nach dem Hissen der Segel das Boot allein mit der Kraft des Windes bewegte, etwas ächzend zwar, aber immerhin. Ich war fasziniert wie ein kleines Kind. Doch schnell wurde mir klar, dass Segeln eine Kunst ist und das Richten der Segel nach dem Wind von allen Crewmitgliedern einiges abverlangt, in manueller als auch in taktischer Hinsicht. Der Wind ist eben nie stabil. Es gilt, den Kurs laufend anzupassen. Als Steuermann hatte ich bei rauem Seegang nicht viel anzubieten. Zudem beherrschte ich weniger Knoten als noch zur Jungwachtzeit. So versuchte ich, mich in der Kombüse anzudienen und nahm mich der Getränke an. Apropos Kombüse: Selbst die Kommunikation war komplizierter als an Land, denn auf dem Wasser benutzt man ganz bestimmte, etwas seltsam anmutende Begriffe. Was für mich bisher ein Seil war, wurde zum Schot oder zur Leine, Bändel zu Bändseln. Es wurde nicht nur gewendet sondern auch gehalst und gerefft was das Zeug hielt. Oder hätten Sie gewusst, was ein Niederholer, was ein Schäkel ist? Weshalb dies so ist, wurde mir bald klar. Bei gewissen Manöver muss es einfach schnell gehen; dann muss absolute Klarheit über die Begrifflichkeiten herrschen, insbesondere darüber, welcher Leine zu welcher Zeit gezogen werden muss. Selbst an Land einfache Dinge wie links und rechts mutieren auf See zu steuerbord und backbord. Zum Glück bleibt der Motor Motor – oder ist dies die Maschine? Und am Anfang galt es für mich als Anfänger aufzupassen, beim Wendemanöver ja nicht vom Baum am Kopf getroffen zu werden. In diesem Zusammenhang folgende Geschichte: Am Ende eines Segeltags beim Befehl „Bereit zum Anlegen“ soll ich mich in meine Kabine begeben haben, um mich für den Ausgang bereitzumachen - se non è vero è ben trovato. Worauf hatte ich mich da nur eingelassen – oder umgekehrt!
(1)
KOMPLIZIERTE LIEBSCHAFT Im Verlaufe des ersten Sardinien-Törns war ich so richtig auf den Geschmack gekommen, genoss die manchmal recht anstrengende Tätigkeit an Bord, immer wieder abgelöst durch ein bisschen süsses Nichtstun, die Ankunft im Hafen oder das Ankern und Übernachten irgendwo vor einem Inselchen. Und dazwischen immer wieder einfach aufs Meer hinausschauen und den Wind und die Wellen beobachten, blödeln, dann wieder etwas politisieren oder auch philosophieren, getreu dem alten Seemanns-Sprichwort „Den Segler erkennt man am Wimpel, am Geschwätz den Gimpel.“ (Dompfaff).
Die Verhältnisse auf See können sehr schnell wechseln. Ist ein Sturm aufgezogen, wird das Boot nach friedlicher Fahrt unkoordiniert durchgeschleudert, Wellen stossen das Schiffsheck herunter und zerren gleichzeitig an den Planken nach steuerbord, während die Besatzung in Stiefeln und im Wachszeug, mit Südwester auf dem Kopf versucht, sich diesem ungleichen Kampf wie ein Mann zu stellen. Doch trotz allem: Das Wasser hatte mich angezogen, und Segeln war für mich zu einer der schönsten Tätigkeiten geworden. Deshalb war ich in den folgenden Jahren wieder auf See, d.h. an Bord mit dabei, so an der Costa del sol/Strasse von Gibraltar (wo wir in Sichtweite zum havarierten britischen Atom-U-Boot nächtigten (2000); Umrundung der dänischen Insel Fünen (Fyn) (Juni 2001); Côte d’Azur (April 2002), in der griechischen Ägäis/Kykladen (2003); entlang der Insel Mallorca (Frühjahr 2005); Holland (2006); Schweden, Schäreninseln (Ende Mai 2008); Sardinien (Südküste) Auffahrtswoche 2010; Kroatien (Sept 2011); Kanalfahrt auf der Saône (2013), Holland (Marker- und Ijsselmeer, Anf. Sept 2014).
(2) Pius, der Schönwettersegler, Sardinien 2007
Im Verlaufe dieser Jahre ist aus der anfänglichen Sympathie eine Freundschaft entstanden. Wie stark diese auf verschiedenen Meeren erprobte Verbundenheit war, spürten wir 2012 beim Tod unseres Navigators Walter.

(3) Walter im Hafen, Sardinien, 2007
Walter, Ostschweizer aus dem Rheintal, eine Seele von Mensch, auch kulturell vielseitig interessiert (Musik, Kalligrafie, Sprachen), war uns stets Stütze. Nach seinem Weggang hatte ich mich bemüssigt gefühlt, meine Gedanken in Spanisch zu formulieren.
Estimado Walter
Hace unos meses, nos despedimos de tí con mucho dolor, querido Walter, y eso para siempre.
Te echamos mucho de menos, y está claro que sin tí nada más es igual.
A pesar de eso toda la tripulación desea que tú te sientas feliz en tu nuevo lugar, que no tengas dolor, que ahora todo esté bien: el mar, el sol y sobre todo los vientos.
¡Nos alegramos de que estés totalmente libre y sin dolor!
Ahora tememos que navegar si tí sea peligroso o casi imposible.
Pero es un alivio saber que ahora podemos entrar fácilmente en contacto contigo y visitarte cuando queramos, en cualquier momento.
(Übersetzung) Lieber Walter: mit Schmerzen haben wir vor drei Monaten von Dir Abschied genommen.
Du fehlst uns, und die Zeit ohne ist nicht mehr dieselbe. Doch spüren wir, dass es Dir an Deinem neuen Ort gut geht, dass alles gut ist: das Meer, die Sonne und vor allem der Wind. Wir sind froh, dass Du jetzt völlig frei und ohne Schmerzen bist.
Aber wir befürchten, dass das Segeln ohne Dich schwierig bis unmöglich ist.
Es erleichtert, dass wir jetzt einfacher mit Dir in Kontakt treten können, Dich einfacher besuchen können.
Von unseren Törns gibt es haufenweise Fotos, die sie sich alle in irgendeiner Weise ähneln: Küstenlandschaften, alte, z.T. historische Segelboote wechseln mit modernen Jachten, dazwischen etwas grün-braunes Wasser, viel blauer Himmel und bisweilen schöne Wolken und weisse Segelflächen. Imposant, wie in Dänemark ein Nato-Flottenverband an uns vorbeizog.
Negativer Höhepunkt des Holland-Törns 2006 war ein Riss des Vorsegels. Wir mussten notfallmässig im Hafen von Volendam einlaufen, wo bereits der Segelmacher auf uns wartete. Dieser Zwangsaufenthalt ermöglichten uns, das ehemalige Fischerdorf, das heute fast ganz von den amerikanischen, japanischen und anderen Holland-Besuchern lebt, etwas kennenzulernen. Aber in Volendam gibt es auch noch einige Fisch verarbeitende Fabriken. So benütze ich den Zwangsaufenthalt, mir eine geräucherte Makrele zu kaufen. Diese hatte ich während der Abwesenheit meiner Segelkollegen an Bord zwar heimlich, aber mit viel Genuss verdrückt. Zu bemerken ist, dass praktisch alle übrigen Kollegen Fisch und Fischgeruch nicht ausstehen können, weshalb ich als bekennender Fischliebhaber zur Selbsthilfe gegriffen hatte. Doch danach stand ich während Stunden in der Kritik der übrigen Crewmitglieder, weil sie überall noch Fischspuren witterten, sogar an der Seekarte! Da wäre mir ein veritabler Sturm auf dem Meer lieber gewesen als dieser Theaterdonner im Hafen von Volendam.
Hast du dich gegen deine Eltern und überhaupt Autorität aufgelehnt?

Auf und davon
1960, vor meinen Sommerferien, hielt ich den Zeitpunkt für gekommen, zum Sprung in die grosse, weite Welt anzusetzen. Zu Hause hatte ich angegeben, meine beiden Onkel in Zürich besuchen zu wollen, doch auf meinem Rader hatte ich die französische Kapitale Paris. Mit meinen bescheidenen Ersparnissen und einer zusätzlichen nicht ganz und gar unproblematischen Anleihe machte ich mich per Autostopp auf den Weg, zunächst nach Bern. Dort lernte ich am Abend in der Jugendherberge einen um ein paar Jahre älteren amerikanischen Studenten kennen. Er war mit seinem Auto unterwegs auf einer Europareise. Mit meinen bescheidenen Englischkenntnissen bat ich ihn, mich nach Paris, seiner nächsten Station, mitzunehmen. Er war einverstanden. So fuhren wir los und erreichten in den ersten Morgenstunden des nächsten Tages das Gebiet des Flughafen Orly, wo wir uns etwas ausruhten bevor wir uns ein Hotel in der Stadt suchten. Ich genoss erstmals das Leben einer Grossstadt mit allen Sinnen, allerdings aus finanziellen Gründen nur kurz, denn eine längere Beteiligung am Hotelzimmer hätte mich rasch finanziell ruiniert. Ich war zur Weiterreise gezwungen. Erfolgsverwöhnt wie ich war, sollte diese nicht wieder zurück Richtung Schweiz führen, sondern ans Meer, Richtung Süden. Zuvor schickte ich meinen Eltern noch eine Ansichtskarte aus Paris.
MÜHSAMER ALS ERWARTET. Mittags gab es eine Baguette und eine Packung Milch, abends eine Flasche Wein und eine Baguette, dazwischen etwas Früchte. Der Not gehorchend, hatte ich mich schnell daran gewöhnt, mit sehr wenig Geld auszukommen. Je nachdem gab es Bekanntschaften mit andern Autostopperinnen und –stoppern; doch die Chance, mitgenommen zu werden, war bedeutend grösser, wenn man allein am Strassenrand stand. Ganz klar, auch die Angst reiste mit: die Angst, nicht mehr weiterzukommen, die Angst vor Flics, Homosexuellen, Légion-Anwerbern und Dieben. Auch wenn ich nicht gerade Flöhe und Wanzen einfing – es war eine entbehrungsreiche, aber interessante Zeit mit unvergesslichen Erlebnissen.
UND DANN PLÖTZLICH DER FREIE BLICK AUFS MITTELMEER. Der Weg von Frankreichs Kapitale bis zum Meer war viel, viel länger als ich angenommen hatte. Doch nach Tagen dieser plötzliche Wandel: Nachdem es schien, die Voralpen würden ins Wasser stürzen, erblickte ich zum ersten Mal das Meer – und war überwältigt und für alle Unbill entschädigt. Da war doch tatsächlich das Blau des Himmels aufs Meer herabgestürzt. Das Licht, die Farben, der Mistral. Jetzt verstand ich van Goghs Wahnsinn. Die Symbole des Midi: Lavendel, Pastis, Oliven, Zikaden – einfach «wahnsinnig» schön und erhebend. Auch die lang ersehnte Ankunft in Marseille, dieser geheimnisvollen Stadt an traumhafter Lage. Marseille ist anders als Paris oder Lyon, wenn nicht bereits ein wenig in Afrika, so doch sicher am Mittelmeer. Unvergesslich, dieser Ausblick vom Hügel der Kathedrale Notre-Dame-de-la-Garde. Von hier aus scheint Frankreich weit, und Paris sehr, sehr fern. Ganz schnell hinunter zum Hafen mit seinen undurchdringlichen Mastenwald, einst von wagemutigen griechischen Seefahrern gegründeter «erster Hafen Kontinental-Europas». Er hatte diese Stadt reich und stolz gemacht. Marseilles Blick war stets auf fernerliegende Horizonte gerichtet: Afrika, Indochina, die Südseeinseln.
Überwältigt, wenn nicht trunken vom Anblick des Meeres, zog es mich gleich nach der Ankunft in der Jugendherberge hinunter zum Meer, nicht etwa ans flache Ufer, wie es Nichtschwimmer mit Vorteil tun, sondern an einem wunderschönen Plätzchen in den Felsen. Wie in den Bergen würde ich mich daran schon irgendwie festhalten können. Aus meiner einfältigen Euphorie erwachte ich erst, als mich eine grössere Welle an den zerklüfteten Fels gedrückt hatte. Dem Salzwasser entstieg ich zwar mit zerkratzten Oberschenkeln, aber immerhin um eine grundlegende Erfahrung reicher. Anderntags, es war ein Sonntag, begab ich mich mit einem deutschen Autostopper-Kollegen an den Strand, lernte dort ein Mädchen mit schwarzem Haar und dunkeln Augen kennen, eine exotische Schönheit, wohl indonesischer Abstammung. Wir amüsierten uns und spielten mit dem Ball. Doch irgendwann schlief ich – übernächtigt wie ich war – an der prallen Sonne ein. Die grosse Schöne zeigte uns dann noch, wo sie wohnte: in einem von Le Corbusier geplanten riesigen Komplex. Ich war davon gleichermassen fasziniert wie abgestossen. Noch nie zuvor hatte ich derartige Wohnmaschinen gesehen.
Reisen per Autostopp sind schlecht planbar. Dies hatte ich erfahren, und zwar mehr als mir lieb war. Nebst Geldsorgen plagte mich nur eine Frage: Würde ich es schaffen, rechtzeitig wieder zu Hause zu sein? Deshalb hatte ich genügend Zeit für die Heimfahrt eingerechnet. Bei der Fahrt über schlechte und kurvenreiche Strassen schmerzt mich mein sonnenverbrannter Rücken. Zu allem Überdruss befinde ich mich im Auto eines immer zudringlicher werdenden Fahrers, der sich anerbietet, mich extra bis Genf zu führen. Doch ich will nur eines: ihn so rasch als möglich loswerden. Mit einer List gelang es mir, ihn unterwegs abzuschütteln. Nach diesem Intermezzo ging es wieder flott vorwärts. Ausgangs von Lausanne erbarmte sich eine Dame meiner. Sie war Neulenkerin, wie sie mir im Verlaufe unserer Reise gestand – befand sich also mit ihrem «Renault Dauphine» auf ihrer ersten grossen Fahrt Richtung italienische Riviera, Rimini oder so. «Du könntest mir auf der Reise Gesellschaft leisten», meinte sie. «Und dabei mein französisch aufbessern», sagte ich mir. "Und nochmals das Meer sehen", dachte ich mir insgeheim; und so fuhren wir los Richtung Wallis. Zum ersten Mal erblicke ich diese steilen Rebberge und bin – einmal mehr – überwältigt. Meine welsche Chauffeuse nimmt es eher gemächlich, und die Fahrt über den Simplon dauert länger als vorgesehen. In Mailand angekommen, verlässt mich spätabends die Courage – ich habe keine einzige Lira in der Tasche – weshalb ich auf dem Absatz wende, weiter stoppe, jetzt endgültig Richtung Schweiz. Wieder zurück in der Heimat gab es mir gegenüber nur zwei Haltungen. Für die einen war ich ein Hasardeur, für die andern ein Held. Jedenfalls fühlte ich mich nicht mehr als Schosshündchen. Jetzt konnte ich es ganz deutlich spüren: Wenn ich nur wollte, würde mir die Welt, Länder und Meere offen stehen.
Wohl weil die Welt damals in Rorschach und Zürich bereits zu enden schien, hatte ich diesen Drang, aus dem gewohnten Trott auszubrechen, die Lebenssituation zu verändern. schon sehr früh und stark verspürt. Noch heute überkommt mich ab und zu ein Anflug von Fernweh, doch jetzt weiss ich um die Bedingtheit solcher Fantasien.

Das Betreibungsamt befand sich damals nicht im Gemeinde-, sondern im Amthaus, wo nebst dem Posten der Kantonspolizei auch das Bezirksamt untergebracht war. Auf dem gleichen Stock befand sich auch der Gerichtssaal. Büronachbar war Bezirksammann Jakob Oberholzer. Wir grüssten wir uns freundlich, auch wenn wir so etwas in der Verwaltungs-Hierarchie so etwas wie wie Antipoden waren: hier der Herr Bezirksammann als Repräsentant der Kantonsregierung, da der unscheinbare Gemeinde-Verwaltungsstift. Ich schätze den Herrn Bezirksammann als überaus feinen Menschen und erblickte in ihm so etwas wie den Ideal-Typus eines guten Staatsdieners. Sein Bild hat meinen späteren Werdegang jedenfalls mehr geprägt als dasjenige von Dorfkönig Jacques Bossart. Der direkte Amtsvorgänger von Bezirksammann Oberholzer war übrigens Benedikt Helfenberger, ein Namensvetter. Dessen damaliges Wahlkampfmotto «Helft ihm über den Berg» stand bei der Wahl meines AB-Titels Gevatter.
Es war die Neugierde, die mich hin und wieder in den leeren Gerichtssaal getrieben hatte, um in den dort aufgereihten, dunkel gebundenen Folianten «Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts» zu stöbern. Darin fanden sich beileibe nicht nur Entscheidungen in Betreibungs- und Konkurssachen; da war auch über Ehescheidungen, Mord, Totschlag und vieles mehr zu lesen, vom prallvollen Leben eben. Während meiner Zeit auf dem Betreibungsamt faszinierten mich diese Bücher weit mehr als es die etwas bunteren Bände von Karl May während meiner «Friedberg»-Bibliothek je getan hätten. Ich begriff, dass die von mir getippten Betreibungsurkunden so etwas die die Rädchen waren eines nationalen Rechtssystems.
Dann und wann war im Amtshaus Gerichtstag, mit Richtern und Parteien, diese oft in Begleitung leibhaftiger Anwälte. Die Rolle eines Platzhalters des Betreibungsbeamten füllte ich ja bereits aus, Richter oder Anwalt zu werden, dies hatte ich mir damals insgeheim gewünscht. Meine hochfliegenden Pläne dürften nicht zuletzt dem Genius loci im Amtshaus geschuldet gewesen sein, der ein anderer war als jener im alten Gemeindehaus. Doch zunächst folgten Aufenthalte beim Zivilstandsamt, der Einwohnerkontrolle, der Gemeindekrankenkasse und der Arbeitslosenversicherungskasse sowie dem Fürsorgesamt.
STADT GOSSAU. Wahrhaft Grosses ereignete sich während meiner Zeit in der Einwohnerkontrolle: Gossau wurde (wohl anno 1961) rein bevölkerungsmässig zur Stadt.

(1) Gossau 1961, Apéro auf Schloss Oberberg (mit HH. E. Bernhardsgrütter, P. Meier, P. Helfenberger, H. Derungs und H.P. Faganini (v.l.n.r.)
Doch das Malheur folgte auf dem Fuss. Nach Schluss der Veranstaltung hatte ich in einem Anflug jugendlichen Übermuts anstatt des offiziellen Schlossabgangs eine Abkürzung über eine Wiese benützt, die sich im Nachhinein als frisch gedüngt erwies, glitt aus und landete mit dem Hintern geradewegs in der Jauche. Der danach an mir haftende Gestank war bestialisch und liess auch nach einem verzweifelten Reinigungsversuch an einem Brunnen nicht nach. Der weitere Abend wurde für mich als stinkendes Elend zur Qual. Selbst Tage danach war ich das Gespött meiner Kollegen. Abgesehen davon war das Verhältnis unter den Lehrlingen (Lehrtöchter gab es damals noch keine), jenes zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zu den Chefs stets sehr angenehm. Absolute Respektsperson war und blieb Gemeindeammann Bossart. Ihn bekam man als Lehrling eher in seinem grünen Mercedes als in seinem Büro zu Gesicht, ausser bei der Aushändigung des Berufsschulzeugnisses, also mindestens zweimal jährlich.
Englandaufenthalt (1962)
LONDON RETOUR?
AUSBRUCH AUS DER KÄSEGLOCKE. Nach dem 23. März 1962 lautete meine offizielle Berufsbezeichnung «Kanzlist» bzw. kaufmännischer Angestellter. Doch was/wie weiter damit?
Zu jener Zeit existierten im Wesentlichen nur zwei eidg. anerkannte Weiterbildungsmöglichkeiten: das Buchhalter- und das Korrespondentendiplom. Ersteres kam für mich nicht in Frage, denn zum einen sind Zahlen meine Stärke nicht. Weil aus damaliger Sicht nicht eben kreativ, war mir das Buchhaltungswesen bereits während der Lehrzeit zuwider. So blieb im Grunde nur der Bereich Korrespondenz. In den Fremdsprachen Französisch und Englisch wollte ich mich weiterbilden, Sprachschulen besuchen, zunächst in London. Vater war glücklicherweise einverstanden und sorgte auch für die Überweisung des Schulgeldes an die «Swiss Mercantile Society, Ltd.» sowie für Unterkunft und Verpflegung in einer irisch-stämmigen und damit katholischen Gastfamilie. Der Aufenthalt belief sich beim damaligen Kurs auf immerhin rund 3'500 Franken – ein Betrag, den Vater nicht aus dem Portokässeli begleichen konnte. Mit tatkräftiger Unterstützung meiner Patin Klara packe ich im Sommer 1962 meinen Koffer. Ausgerechnet sie hatte in Sachen Reisen einschlägige Erfahrungen, wohl von ihren Pilgerreisen für Invalide nach Lourdes. Treffpunkt war der SNCF-Bahnhof in Basel.
Zum ersten Mal verbrachte ich eine ganze Nacht in einem (meist) fahrenden Zug. Die City of London empfand ich als überwältigend, die nähere Umgebung, den an der Themse gelegenen Stadtteil Putney, ein paar U-Bahnstationen vor Wimbledon, als eher gemütlich. 
(2) Putney in den sechziger Jahren
Schon ein zwei Tage nachdem ich bei der Familie Rogers in Putney mein Zimmer in einem jener typischen Vorstadt-Reihenhäuschen bezogen hatte, zog es mich abends ins nächstgelegene Pub. Dabei waren mir meine Kenntnisse aus der Heimat gleich zweifach zu Nutzen. Zunächst jene sprachlicher Art, knapp ausreichend, um mich vom ein paar netten Gästen über die Wahl der passenden Biersorte beraten zu lassen. Dann die klettertechnischen Kenntnisse, selbst noch nach reichlichem Biergenuss! Nach meiner Rückkehr musste ich nämlich mit Schrecken feststellen, dass es mit dem Schlüsselversteck nicht geklappt hatte. Um niemanden in seiner Nachtruhe zu stören, sah ich bei meiner Rückkehr zu später Stunde keine andere Möglichkeit, als mir Zutritt durch ein Kippfenster zu verschaffen. Als ich meiner Landlady am folgenden Morgen beim Breakfast die Story brühwarm auftischte, zeigte sie sich überhaupt nicht «amused». Ich musste mich als böser Einbrecher fühlen, denn für meine Landlady konnte nicht sein, was nicht sein durfte!
Normalerweise war ich tagsüber in der Schule, beschäftigte mit Comprehension, Dictation und – was mich besonders fasziniert – mit Englischer Literatur bei Professor ... (Wie schade, dass mir der Name dieser überragenden Figur nicht mehr einfallen will.) Unvergesslich bleibt mir folgende Episode: Während er uns mit grösstem Enthusiasmus in schönstem Oxford-Englisch Schriftsteller wie Sir Walter Scott oder Lord Byron näher zu bringen versuchte, dröhnte ein tief fliegendes Flugzeug über dem Fitzroy-Square hinweg, worauf unser guter Professor den Faden total verlor und völlig aus dem Zusammenhang gerissen immer wieder das Wort 'plane' wiederholte. Wie wir erst später erfuhren, hatte er früher an der Universität von Budapest gelehrt. Diese Stadt konnte er 1956 nach dem Einmarsch der Russen nur dank Schweizer Hilfe völlig traumatisiert verlassen. Seine Tätigkeit an der « Swiss Mercantile» war Ausdruck von Dankbarkeit gegenüber der Schweiz und deren Bevölkerung. Ob auch Adolf Ogi von ihm beeindruckt war? Jedenfalls hat der spätere Bundesrat nach der École supérieure de commerce in La Neuville ebenfalls die »Swiss Mercantile School« besucht, bevor er in einer Textilfirma in Liverpool ein Praktikum absolvierte. Schade, dass sich auch der Herrn Alt-Bundesrat nicht mehr an seinen Namen erinnert.
Die Abende verbrachte ich meistens im Familienkreis der Rogers, wo ich morgens und abends auch verpflegt wurde, very english indeed, sonntags meist gebratenes Lamm an Pfefferminzsauce oder Rindsbraten mit Yorkshire Pudding. Stoisch ass ich alles, getreu dem Motto »Was mich nicht umbringt, macht mich stark». Einzig der ölige Fisch auf nüchternen Magen hatte mir zu Beginn Brechreiz beitetet.

(3) London, Swiss Mercantile, Abschlussklassenfoto 1962
SHARP ODER HOT? In Erinnerung bleibt mir ein Mittagessen gleich zu Beginn meines Aufenthalts. Es war an einem Sonntag in einem kleinen Anglo-Indian-Restaurant in Putney-Bridge. Mir war nach Curry zumute, und so orderte ich ein Calcutta Chicken. Seit meinen Besuchen im St. Galler «Isebähnli», wo wir mit Vorliebe scharfe ungarische Gulaschsuppe gelöffelt und dazu eine Stange kühles Schützengarten-Bier geschlürft und ein dunkles Bürli verspeist hatten, glaubte ich, «an Scharfes» einigermassen gewohnt zu sein. Und ausserdem war ich jetzt ein Mann, will heissen über alles Tabasco schütten, und man muss es schütten nennen, kippen, leeren. «Da schreiben die ‚scharf‘ und dann so was! Mir konnte nichts scharf genug sein. Dies versuchte ich dem netten Pakistani-Waiter auch unmissverständlich zu verstehen zu geben: So richtig «sharp» sollte mein Curry sein. Der Pakistani lächelt verständnisvoll. Nach einiger Zeit erhielt ich eine gehörige Portion und kostete. Doch schon nach dem ersten Bissen stelle ich fest: «Das ist scharf. Tammischarf. Tammi.» Und das Schlimmste war, dass mich der Kellner beobachte, von seinem Versteck aus zusah, wie ich mit dem Hühnchen rang. Vergeblich versuche ich, die beissende Schärfe im Mund mit viel Bier hinunterzuspülen. «Hot enough, Sir?» Mein Kopf musste glühen, doch ich versuchte, mich durchzukämpfen. Nach einer Weile sass ich einfach nur noch da, schweissgebadet und mit Tränen in den Augen und wohl auch mit hochrotem Kopf. Und der freundliche Kellner: «Noch ein Bier?» «Yes please». Der Mann mit dem Turban brachte es mir, hob die Schultern und bemerkte im besten Pidgin-Englisch: «Hot. It burns when it gets in, it burns when it gets out.» Mein Gott, wie recht er hatte! Unter Schmerzen musste das Calcutta-Chicken später wieder raus. Eines glaube ich seither zu kennen, nämlich die korrekte Übersetzung des Adjektivs 'scharf' in Bezug auf Speisen.
Mrs. Rogers war eine englische Hausfrau durch und durch. Bei der Farbe ‚erbsengrün‘ denke ich noch immer noch an sie. Und an ihre Tomatenspaghetti – nicht wirklich italienisch – mit denen sie mir eine Freude bereiten wollte. Doch konnte ich es einfach nicht fassen, die Spaghetti-Resten am nächsten Morgen gehackt auf meinem Toast wiederzufinden – Restenverwertung der besonderen englischen Art eben!
Wenn man dem Sprichwort «Was sich liebt, neckt sich» glauben will, schienen mich die beiden um ein paar Jährchen jüngeren Rogers-Töchter Hillary und Jane zu mögen. Doch ich war nebst Vater Norman nicht das einzige männliche Wesen im Haus. Ein etwas älterer thailändischer Mitbewohner mit dem unaussprechlichen Namen «Yuus» oder so ähnlich, Spross einer der grössten und einflussreichsten Importeure amerikanischer Autos in Bangkok, hatte sein Zimmer gleich nebenan. Wir verstanden uns auch sprachlich nicht besonders gut und gingen möglichst getrennte Wege.
In London, wohl beim «Swiss Club» oder wie die kirchlich geprägte Organisation damals hiess, lernte ich eine Menge junger Schweizerinnen und Schweizer kennen, auch Heidi aus Riehen. Doch zu dieser Zeit schlug mein Herz allein für Susy. Ostschweizerin auch sie, Fürstenländerin gar, allerdings aus Wil, und Au-pair in einer Familie in einem Villenvorort ausserhalb der City. Nach Kräften hatte ich versucht, Susys Sympathie zu erringen. Try and Try! Und zwar mit den absonderlichsten Dingen, wie dem Besuch eines klassischen Konzerts in der Royal Festival Hall. Dafür hatte ich mich eigens in die lange Schlange vor der Konzertkasse gestellt. Auf dem Programm stand zum Schluss Tschaikowskys Ouvertüre 1812. Ich war überwältigt ob all der Eindrücke baulicher, musikalischer und anderer Art. In der Folge hatte mich die klassische Musik immer mehr interessiert. In meinem Zimmer gab es sogar ein Radio, und ich hörte mir darauf hin und wieder Übertragungen von klassischen Konzerten auf BBC Classic an. Da war es schon mal passiert, dass ich mit feuchten Augen auf meinem Bett lag – kaum wegen Heimweh! Nicht dass ich allen den Verlockungen der Grossstadt widerstanden und jede freie Minute Musik hörend in meinem Zimmer zugebracht hätte! Im nahen Kino sah ich eine ganze Reihe von Filmen des Regisseurs Ingmar Bergmann. «Viridiana» von Luis Buñuel hatte mich so sehr gepackt, dass ich mir den Film gleich mehrmals ansah. Als am 9. Mai 1962 im Empire Stadium Wembley die Schweiz gegen England spielte, besuche ich sogar einen Fussballmatch – den bisher einzigen in meinem Leben! Und am Schweizerischen Nationalfeiertag sangen wir bei einem Empfang in der Schweizer Botschaft ein englisches Volkslied unter der Leitung von Mr. Boswell, einem sehr sensiblen Lehrer an der SMS, Stimmlage Tenor, ganz wie mein Vater, aber nicht das «Ännnchen von Tharau», sondern «Men of Harlec»
Men of Harlec! In the Hollow,
Do ye hear like rushing billow
Wave on wave that surging follow
Battle's distant sound?
Nicht nur die Reize des gleichaltrigen Schweizer Au-pair-Mädchens, auch Pferdewetten zogen mich in Bann, und zwar in einem Ausmass, wie ich dies niemals für möglich gehalten hätte. Plötzlich interessierte mich der Sportteil der Zeitungen – jene Seiten also, über die ich in meinem späteren Leben regelmässig hinweg blättern werde. Während der Pausen frequentierte ich zusammen mit ein paar Klassenkameraden regelmässig das gleich neben der Schule gelegene «Betting Office», um dort die direkt übertragenen Pferderennen zu verfolgen. Anfänglich nur zögerlich setze auch ich harte Pfund auf einen Favoriten − und verlor prompt. Später versuchte ich es mit vielen kleineren Einsätzen auf Aussenseitern. Nach einem Gewinn im «Grand National» wurde Mr. Halfenbauer, wie ich hier genannt wurde, euphorisch. Am liebsten gar nicht mehr in die Schweiz zurückkehren, in London bleiben und als Spieler das schnelle Geld machen! Schöne (Gedanken-)Spielereien!
ERSTMALS SO RICHTIG ERWACHSEN
Sommer 1962. Zusammen mit drei Schulkollegen machten wir uns während der Schulferien in einem gemieteten «Austin» auf nach Schottland. Als Benjamin der Gruppe besass ich als einziger keinen Führerschein. Doch Dany, gut aussehender Berner Patriziersohn, unbestrittener Leader des Quartetts, fuhr nicht nur ausgezeichnett Auto, sondern er begeistert abends mit seinem exzellenten Klavierspiel in Hotel-Lounges nicht nur die weiblichen Gäste. «Smoke Gets In Your Eyes». Einzige kritische Situation allerdings ausserhalb des Barbereichs in der Nähe Balmoral Castle, nachdem Kollege André erstmals das Steuer übernommen hatte: Wegen des für ihn ungewohnten Linksverkehrs 'küssten' wir schon nach kurzer Zeit die Steinmauer einer Brücken in unmittelbarer Nähe des berühmten Castle. «We were not amused», denn wir verloren deswegen das beim Autoverleiher hinterlegte Depot.

ACHTUNG – STEHT!
HELFENBERGER SIND KEINE DRÜCKEBERGER Einen Monat nach Ende meiner Lehrzeit hatte ich mich zusammen mit meinen Altersgenossen in Wil zur militärischen Aushebung einzufinden. Mich vor dem Militärdienst zu drücken, wäre für mich damals absolut keine Option gewesen. Obwohl mir der Besuch eines Kindergartens abgegangen war, fühlte ich mich gut sozialisiert und war willens, meine Pflichten gegenüber dem Vaterland ohne Wenn und Aber zu erfüllen. Oder vielleicht lag es nur daran, dass ich in den fünfziger Jahren als «Landei» schlicht keinen Kontakt zu Kreisen hatte, in denen es als chic galt, sich als dienstuntauglich erklären zu lassen, Umgang mit einer ordentlichen Portion Alkohol, möglichst in Verbindung mit Cannabis oder überdosierten Medikamenten zu haben, oder als Homosexueller zu gelten. So war es für mich einfach selbstverständlich, mich am 30. April 1962 in Wil/SG zu stellen.
Zunächst wurden wir alle vermessen und auf Herz und Nieren geprüft. Bei der Turnprüfung hatte ich mich, der «Sporthasser», sogar richtig angestrengt, erzielte ich doch beim Klettern die Bestnote. Ein gewisser Druck meiner Ostschweizer Kameraden mag da auch mitgespielt haben. Ich schaffte es, wurde als militärdiensttauglich erklärt und auf meinen Wunsch hin zur Festungsartillerie eingeteilt. Das Gegenteil wäre gleichbedeutend gewesen mit «wurmstichig».
VATERSTOLZ. Als ich Vater am Abend mein Dienstbüchlein zeigte, meinte ich, bei ihm einen gewissen Stolz zu verspüren. Und auch ich fühlte mich ein wenig stolz auf meinen Vater, der seinerzeit als körperlich Behinderter Aktivdienst geleistet und zur Zeit meiner Geburt an der Grenze gestanden hatte. Vielleicht wollte ich auch ihm zuliebe meinen Dienst am Vaterland leisten. Und ich muss gestehen: Darüber, dass unser Sohn später etwa mit denselben Gefühlen die Rekrutenschule und sämtliche Wiederholungskurse absolviert hat, darüber war ich meinerseits auch wieder etwas stolz.
FEST ART RS 229 AIROLO – ENNET DES GOTTHARDS, zusammen mit einigen hundert Altersgenossen aus allen Teilen der Schweiz, fand ich mich am 22. Juli 1963 zur Festungsartillerie-Rekrutenschule im Tessin ein. Die Übermittler, denen ich zugeteilt war, waren in der Kaserne "Motto Bartola", einer hoch oben an der Gotthardstrasse gelegenen veralteten Infanterie-Festung untergebracht. Es sollten 17 (siebzehn!) nicht ganz einfache Wochen werden.
Eingerückt war ich mit durchaus positiven Gefühlen, zurück kam ich als Militärdienstgegner. Von Beginn an schien mir militärischen Propaganda-Abteilung «Heer und Haus» suspekt. Etwa deren Filmchen, mit dem uns weisgemacht werden sollte, dass Brecht ein drittrangiger Schreiberling sei, der uns brave Schweizer Knaben mit nacktem Hurenfleisch und Gossenmusik zum teuflischen Kommunismus verführen wollte. Auch wenn dem Schweizervolk und Europa dies erspart geblieben ist, schien mir die plumpe politische Indoktrination unerträglich und ich habe mich dagegen – so gut es eben ging – aufgelehnt. Das lag auch an mir und meiner privaten Agenda. Eine militärische Weiterbildung hätte meine Pläne durchkreuzt. Ich zeigte wenig Begeisterung, wollte die Sache so einfach und so schnell wie möglich hinter mich bringen. Das hatte mein Korporal gespürt und mich nach Strich und Faden geschunden und sich so manchen Spezialjob für mich ausgedacht. Und für Instruktionsoffizier Bucher war ich bisweilen so etwas wie ein abschreckendes Beispiel und damit eines seiner Lieblingsopfer.

(1) Festungsartillerie-Übermittler, allesamt Deutschschweizer, machen mal Pause, 3.v.l. P.H.
Unser Leutnant war ganz in Ordnung – zum Glück. Nur standen er und auch weitere Offiziere oft im Clinch mit dem Kompaniekommandanten. Dieser, ein biederer Volksschullehrer aus dem Aargau, war das Problem, denn er hatte überhaupt kein Flair für die doch sehr unterschiedlichen Mentalitäten, denn nicht nur die Stabskompanie, sondern auch die Züge waren gemischt aus Deutschschweizern, Romands und Ticinesi. Intellektuell ständig etwas überfordert, zeigte er sich immer eher militärisch-kämpferisch, möglichst mit Stahlhelm, was ihm den nicht gerade schmeichelhaften Übernahmen «Kröte» eingetragen hatte. Gegen Schluss der RS hingen in der Kaserne Plakate mit der Aufforderung: «Zerstampft die Kröte!» Vor der Entlassung drohte die Stimmung gar in Richtung Meuterei zu kippen. Es war durchgesickert, dass er am Schluss zwei seiner Leutnants wegen Insubordination (Ungehorsam im Dienst) zu einen Arrest verknurrt hatte. Betroffen war auch unser Leutnant. Darob war ich völlig verstört. Niemals hätte ich dies alles für möglich gehalten. Nach diesen Vorfällen hatte die Armee für mich auch noch ihren letzten Funken an Glaubwürdigkeit verloren.
Trotz heftigen Schneetreibens ausgelassene Stimmung rund um die Kaserne von Moto Bartolo am Vorabend unserer Entlassung: Zum einen war es der sich bis zuletzt angesammelte Frust, zum andern die Freude über die bevorstehende Entlassung. Wie die meisten Kameraden wankte auch ich angemessen alkoholisiert in Richtung Kaserne zurück. Und als ob es um Sein oder Nichtsein ginge, machte die «Kröte» in selbiger Nacht zusammen mit ein paar seiner Getreuen beim Zimmerverlesen in den Schlafsälen Razzien, sammelte Betrunkene ein, angeblich für einen Spezialeinsatz ins tiefer gelegenen Fort Airolo – bei schwerem Schneegestöber! Trotz meiner Promille hatte ich realisiert, dass ein derartiger Einsatz für mich katastrophal enden würde. Deshalb hielt ich mich auf dem WC versteckt. Erst als die Gefahr gebannt schien, schlich ich zurück ins Bett. Doch dieses begann sich sogleich so gewaltig zu drehen, dass ich mich gleich wieder aufs WC begeben musste. Auf dem Weg dorthin musste ich mich noch im Schlafsaal übergeben, wovon auch das zuvor blitzblank gereinigte Kantonnement noch einiges abbekommen hatte. So steht denn dieses Ereignis auf der Liste der peinlichsten Momente meines Lebens auf Platz 19.
In der Folge war ich bestrebt, meine Wiederholungs- und Ergänzungskurse in Würde hinter mich zu bringen, u.a. als Vollzeit-Wachsoldat, Vollzeit-Tellerwäscher, später als Vollzeit-Ordonnanz auf dem Kommandoposten eines Ostschweizer Festungsregiments. Auch Jahrzehnte nach meinem regulären Ausscheiden aus der Armee schien der Spuk von damals bei mir seine Spuren hinterlassen zu haben. Noch immer hatte ich nachts von militärischem Ungemach geträumt. Inzwischen hat die Altersmilde meine abgrundtiefe Aversion von damals etwas eingenebelt. Höchste Zeit, am Beispiel unseres Regimentsstabs darzustellen, wie sich die personellen Verhältnisse in der (Festungs-)Artillerie auf Regiments-Stufe damals präsentierten.
GFR HELFENBERGER Die beide Festungsartillerie-Obersten, unter denen ich Dienst geleistet hatte, waren bereits ältere, mehr oder weniger unverdächtige «Papa»-Figuren. Da war zunächst dieser St. Galler Aristokrat und Advokat. Irgendwie mochte ich ihn, wie auch seinen Nachfolger, einen etwas biederen ehemaligen Lehrer aus dem St. Galler Rheintal. Die Vorteile der militärischen Karriere nutzend, hatte er bei der Eidg. Zollverwaltung parallel eine steile zivile Laufbahn hingelegt. Der Herr Oberst war umgeben von einem hochkarätigen Stab von Hauptleuten, die hauptsächlich dem Ostschweizer und Zürcher Finanz- und Wirtschaftskreisen entstammten. Da war ein CEO bei der Schweiz. Kreditanstalt (heute CS). Bank-Topmanager war auch der Quartiermeister, allerdings bei der Konkurrenz und in Basel, beim Schweiz. Bankverein (heute UBS). Der sogenannte militärisch-industrielle Komplex war gleich mehrfach und namhaft vertreten, so der Bereich Übermittlungstechnik (Ascom) durch den Übermittlungs-Of, die Industrie durch den Cousin des Industriellen Stephan Schmidheiny. Nachdem sein Schwiegervater Besitzer der Nobelherberge Quellenhof in Bad Ragaz geworden war, hatte er die Möglichkeit, dort hin und wieder für ein standesgemässes Ambiente zu sorgen. Nur dumm, dass diese herbstliche Artillerie-Knallerei aus allen Festungslöchern bzw. -kanonen die Gäste störte. Die Hotellerie des Fremdenorts Bad Ragaz hatte sich immer wieder mal darüber beschwert. Der Regiments-KP befand sich im militärfreundlichen Mels unweit der Kaserne, ganz in der Nähe von Kalberers Restaurant «Schlüssel», einer der ersten Adressen in der Region. Den Tross der Bosse rundeten ein promovierten Mittellehrer für Mathematik aus Winterthur als Munitions-Offizier, ein Historiker und ein Journalist als Nachrichten-, bzw. AC-Offizier sowie zwei gediegene Feldprediger. Einzig der MotOf roch nach niedrigerem (KMU-)Adel. Der Regimentsstabs war parteipolitisch etwa so einheitlich zusammengesetzt wie der Bundesrats nach Begründung des Bundesstaates: aus lauter FDP-Mitgliedern.
Mein direkter militärischer Vorgesetzter war der Regimentsadjutant, ein schneidiger praktizierender Zürcher Rechtsanwalt. Noch deutlich erinnere ich mich an seinen heftigsten «Anschiss» in der Morgenfrühe beim Betreten des Regiments-Kommandopostens. Ich lag bei Arbeitsantritt noch in meinem Schlafsack auf dem KP-Boden, quasi zu seinen Füssen, und rieb mir den Schlaf aus den Augen – eine kapitale Peinlichkeit! Im Städtchen Sargans befand sich nämlich der Kommandoposten unseres Regiments in einem Wirtshaus, direkt über der Wirtsstube. Dies hatte den Vorteil, dass der KP auch zu vorgerückter Stunde ausreichend mit Getränkenachschub versorgt war, mit ein Grund für meine morgendliche Müdigkeit! Immerhin stand dieses Vorkommnis meiner Beförderung zum Gefreiten nicht im Weg.
ICH WAR HAUTNAH DABEI Am 14. Oktober 1968, meinem 25. Geburtstag, ereignete sich im Festungsgebiet Sargans Aufregendes. Dort absolvierte ich gerade meinen 3. Wiederholungskurs (WK) und sass als Übermittlungssoldat in der Schiesszentrale jenes Festungswerks, aus welchem versehentlich fünf Übungsgranaten in Richtung Liechtenstein abgegangen und irrtümlich auf der Alp Malbun explodiert waren. Als Folge dieses schwerwiegenden Zwischenfalls bestand in der Schweiz für Armee und die Politik Alarmstufe 1, auch wenn keine Personenschäden zu beklagen waren. Innert kürzester Zeit war auf kleinstem Raum so viel militärisches Gold versammelt, wie sich dies mein einfaches Soldatenhirn nie hätte vorstellen können! Und mittendrin als kleine Würstchen die Zentralisten an ihren Pültchen in der Festungs-Schiesszentrale, darunter auch ich, völlig vergelstert, und harrten dem, was die Untersuchung ergeben würde. In meinem Kopf kreiste die bange Frage, ob das Ganze am Ende wegen der Fehlleistung eines «Umsprechers», also eines Übermittlungssoldaten, vielleicht sogar meinetwegen, passiert war. Und was, wenn durch diese meine Fehlleistung das Fürstentum mit Gegenbeschuss antworten und daraus eine kriegerische Auseinandersetzung ausbrechen würde, ähnlich wie in Mani Matters „Ds Zündhölzli“ besungen? Wie sich später herausstellte, war weder ein Navigations- noch ein Übermittlungsfehler Grund für den Beschuss fremden Staatsgebiets, sondern ein sogenannter Seitenfehler des Geschützrohres. Doch ich kann sagen, ich war hautnah mit dabei, als die Schweiz letztmals am Rande eines Krieges mit dem Fürstentum stand.

Entwicklungs- und Wanderjahre: Ein Lattenzaun mit Zwischenraum, hindurchzuschaun
Der Lattenzaun
Es war einmal ein Lattenzaun,
mit Zwischenraum, hindurchzuschaun.
Ein Architekt, der dieses sah,
stand eines Abends plötzlich da -
und nahm den Zwischenraum heraus
und baute draus ein großes Haus.
Der Zaun indessen stand ganz dumm
mit Latten ohne was herum,
ein Anblick grässlich und gemein.
Drum zog ihn der Senat auch ein.
Der Architekt jedoch entfloh
nach Afri - od - Ameriko.
Christian Morgenstern / Galgendichtung (1905)
Wie ein Lattenzaun muss auch der folgende Text Lücken enthalten. Deshalb muten meine Ausführungen stellenweise wie ein Lückentext an. Solche Texte kennen die meisten noch aus ihrer Schulzeit. Bewusst offen gelassene Stellen sind mit eigenen Worten zu vervollständigen. Auch wenn also nach der Lektüre meiner Schilderung bei der bildhübschen Leserin, beim geneigten Leser, ein anderer Eindruck entstehen sollte: Während meiner Entwicklungs- und Wanderjahre gab es für mich mehr als nur Arbeit, Studium, Beruf und Karriere. Ebenso wichtig waren für mich Familie und Freunde. Auf meine Vaterrolle hatte ich mich sehr gefreut, sie ernst genommen und deshalb eine akademische Laufbahn gar nie wirklich in Erwägung gezogen. Später war ich stets bestrebt, meinen beiden Kindern ein guter Vater zu sein, leider nicht immer mit gleich viel Erfolg. Es war mir ausserordentlich wichtig, für meine Familie genügend Zeit zu haben, auch mittags gemeinsam zu Tisch zu sitzen und zu plaudern, gemeinsam etwas zu unternehmen, nicht nur während der Ferien. Diese bleiben unvergesslich, immer wieder im Tessin, immer wieder Carona oder das Val Morobbia. Als wir in der Stadt, ganz nahe an der Grenze zu Allschwil lebten, war allen unser Familiengarten wichtig. Er hat uns sehr viel gegeben, auch wenn ich zu dieser Zeit als Familiengärtner ein blutiger Anfänger war. Nicht nur im Garten, auch in der Familie ist mir nicht immer alles gleich gut gelungen. Besonders während meiner schwierigen Jahre habe ich unseren beiden Kindern oft zu wenig Zuwendung schenken können, was ich heute sehr bedaure. Fast alles hing damals an meiner Frau. Und so konnte sich auch meine zweite grosse Liebe leider viel zu spät entwickeln, jene zur Küche und zu allem, was damit zusammenhängt. Doch ich habe mächtig Gas gegeben und im Verlaufe der späteren Jahre versucht, einiges nachzuholen.
4051 bzw. 4058 Basel
ALLES NUR ZUFALL? Ist der wirkliche Regisseur unseres Lebens der Zufall – ein Regisseur voller Grausamkeit, der Barmherzigkeit und des bestrickenden Charmes, wie Pascal Mercier in seinem Roman «Nachtzug nach Lissabon» schreibt»? Hatte also der Zufall den kleinen Elefanten aus dem Fürstenland in die Humanistenstadt Basel geführt? Per Zufall kannte der kleine Elefant die Stadt am Rheinknie auch nicht ansatzweise, im Gegensatz zu Zürich, wo er Verwandte hatte. Er entschied sich für das Unbekannte und damit für den Zufall. Und so manches ist ihm hier in der Folge – im besten Wortsinn – zugefallen.
Sein erstes Zuhause fand der kleine Elefant gegen Ende 1962 zunächst für kurze Zeit am St. Gallerring, darauf in einem älteren Gebäude bei der Heuwaage, am Rümelinbachweg, recht zentral gelegen, in nur ein paar hundert Meter Entfernung vom berühmten Basler Zoologischen Garten, dem Zolli, wie er hier liebevoll genannt wird. Längst ist das Haus von damals einer grosszügigen Überbauung gewichen. Doch wenn es damals spätnachts oder in der Morgenfrühe ganz still war in der Stadt, konnte der junge Elefant in seinem neuen Zuhause das lustvolle Posaunen der grossen Zolli-Elefanten deutlich vernehmen. Unter ihnen war auch die Elefantendame Ruaha, eine Berühmtheit. Jung in Afrika ihrer Mutter und der Wildnis entrissen, war sie bereits zehn Jahre früher als ich nach Basel gekommen, wo sie in ihrem viel zu engen Gehege als Publikumsmagnet gedient hatte. Mag sein, dass gerade die Nähe zum Zolli Ausschlag für die Wohnungswahl gegeben hatte. Nichts als logisch also, dass der kleine Elefant der berühmten Ruaha im Zolli schon bald einen ersten Besuch abstattete und sich die beiden lange und tief in ihre blauen Augen schauten. Glücklicherweise blieb Ruaha dem Zolli noch bis ins Jahr 2010 erhalten.
Anders als die vom Zolli rundum versorgte Ruaha musste der kleine Elefant, wollte er nicht hungers sterben, einer Beschäftigung nachgehen. Doch Basel ist nicht nur für seinen Zolli, sondern auch für seine chemische und pharmazeutische Industrie, (damals noch) für seine Banken und für seine Versicherungen berühmt. So findet sich der kleine Elefant erst in der Firma Pentapharm AG an der Engelgasse 109 (1962 – 1964), dann in der Schweizerischen Kreditanstalt (SKA) am Bankenplatz (1964) und schliesslich in Coop Lebensversicherung am Aeschenplatz (1965 – 1967), wo er auf seinem erlernten kaufmännischen Beruf arbeitet.
Die Stadt Basel erlebte ich zunächst alles andere als spannend. Morgens, beim Verlassen meines Zimmers, war es draussen noch nicht richtig hell. Und abends, bei der Heimkehr, war es bereits wieder dunkel. Ich musste mich damit begnügen, die Stadt über Mittag etwas zu erkunden. Über das Wochenende fuhr ich recht häufig zurück in die Ostschweiz, besonders nachdem meine Mutter nach Ostern 1964 mit Ihrem Mofa direkt vor dem Arnegger Elternhaus einen Unfall erlitten und mit schweren Schädelverletzungen während längerer Zeit im Koma lag.
HAARIGER HUMOR Aus aktuellem Anlass – in London hatte ich Gefallen am britischen Humor gefunden − ein paar Gedanken über mein Verhältnis zum Humor. Als Spassmacher oder gar «Kompaniekalb» war ich nie aufgefallen. Um niemandem auf den Schlips zu treten, hielt mich mit Sprüchen lieber zurück. Müsste ich also eher von einem Nicht-Verhältnis sprechen?
«Humor ist einfach eine komische Art ernst zu sein». Dieser witzige Satz stammt vom britischen Schauspieler Peter Ustinov. Sir Peter galt als Meister bissiger Bonmots und geistreicher Aphorismen. Noch immer erscheint mir diese Aussage zum Thema Humor schlichtweg genial. Als Sohn eines deutschen Journalisten und einer französischen Malerin besass Peter Ustinov eben geradezu ideale genetische Voraussetzungen, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass seine Eltern bereits teils russischer, teils italienischer Herkunft waren und in England lebten, wo Peter aufgewachsen ist. Grossbritannien ist eben ein ganz besonderer Nährboden für jene Art des Humors, wie ich ihn liebe und bewundere. Auf dem Kontinent trifft man etwas Vergleichbares noch am ehesten in Wien. Aber auch in Basel wird er noch gepflegt, vor allem an der Fasnacht, dieser spitzig-witzige-bissige Humor, der niemals billige Lacher, höchstens ein verständnisvolles Lächeln hervorruft. Sir Peter war nie ein Spassmacher um des Klamauks willen, er wusste, dass Komik er zeugen ein nobles Handwerk ist. «Das Lachen ist die zivilisierteste Musik der Welt.» Wie recht er damit hatte. Und mir wurde bewusst, wie wenig Sinn für Humor ich bisher entwickelt und wie wenig Zeit ich mir für das Lachen genommen hatte. Meine Heimat, das Fürstenland, war bestenfalls so etwas wie «das Land des Lächelns»“. Richtig zu Lachen hatte bereits etwas Anstössiges. In der Stadt Basel sollten sich die Zeiten diesbezüglich ändern – so hoffte ich zumindest, und natürlich auch, dass mehr zu lachen geben würde hätte als früher.
Es wäre übertrieben zu sagen, ich wäre 1962 quasi «humoris causa» nach Basel gekommen. Von der berühmten Basler Fasnacht kannte ich nur die «Schnitzelbängg», von denen einzelne in meiner Jugendzeit dank Radio Beromünster sogar in unsere Ostschweizer Stube gedrungen waren. Bis ich mich an den speziellen Basler Humor (bei dem es sich im Grunde keineswegs um Humor handelt, sondern um Witz) gewöhnt hatte, blieben für mich London und Wien die Welthauptstädte des Humors. Schnell durfte ich feststellen, dass die Basler Fasnacht anders ist, nicht nur später im Jahr und viel kürzer – nicht lang und langweilig wie früher zu Hause, sondern voller Esprit, Witz und Schalk. Davon zeugen nebst den geistreichen Schnitzelbänken immer kunstvoller gestaltete Laternen, Kostüme, Larven. Schnitzelbänggler bedienen sich in Basel zwar der Anonymität, geistreich-humorvolle Journalisten wie -sten und -minu eines Kürzels, doch sie alle gehören zu den angesehenen Baslern.
Parallel zum sprichwörtlichen Knopf, der mir in London aufgegangen war, zeigten sich bei mir bereits zu jener Zeit am Kopf erste deutliche Zeichen von Ausfallserscheinungen − glücklicherweise nur beim Haupthaar. Vorher war der Haarausfall schleichend. Bereits in London hatte ich mich deshalb an einen Apotheker meines Vertrauens gewandt. Er meinte, die Luftverschmutzung würde meinem Haar zu sehr zusetzten, weshalb er mir zu einem konzentrischen Angriff riet, äusserlich mit einem Spezialshampoo, innerlich mit Limettensaft. Doch meine Haarfülle nahm weiter ab, vielleicht gerade wegen des vielen Limettensafts, den ich unverdünnt auf nüchternen Magen trank. Das Thema «Haare» sollte mich all die Jahre noch verschiedentlich beschäftigen, allerdings nur bis zu meinem 50. Geburtstag. «Wären doch alle Probleme nur so gut ausgegangen wie meine Haare!» sollte ich dereinst an diesem denkwürdigen Tag zu mir selbst sprechen – und meinen Haarersatz für immer entsorgen! Auf die Idee, diesen orange zu färben und daraus ein Markenzeichen zu machen, wie dies der genialste aller amerikanischer Präsident fünfzehn Jahre später tun soll, darauf bin ich damals allerdings nicht gekommen!

(1) Heiter, humorvoll und mit viel Profil: Status 1993
EINE GRATWANDERUNG – HART UND ENTBEHRUNGSREICH 1963 begann ich also, abends noch einmal die Schulbank zu drücken. Mein Ziel war ganz klar die Maturität. Doch zunächst galt es, der Doppelbelastung von Beruf und Schule standzuhalten. Von Montag bis Freitag ging nach einem fast neunstündigen Arbeitstag in der Nähe des Bahnhof Basel SBB, in den Räumen des Realgymnasiums oder des De Wette-Schulhauses, während drei Abendstunden bei Latein, Französisch, Englisch, Deutsch und Geschichte die Post ab. Die naturwissenschaftlichen Fächer wurden separat vermittelt, was bedeutete, dass man sich je nach Präferenz vorgängig für die sprachlich-historischen oder für die mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse entscheiden musste. Dies hatte zur Folge, dass das Maturzeugnis je nach gewählter Richtung nur zum Studium an der Universität Basel berechtigte, und zwar an der juristischen sowie der philosophischen Fakultät mit den Studienrichtungen Jurisprudenz, Nationalökonomie, Philosophie, Sprachen und Geschichte. Nach Ablegung einer ergänzenden Prüfungen in Griechisch und Hebräisch wäre auch ein Studium an der theologischen Fakultät möglich gewesen. Absolventen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse erhielten Unterricht in den Fächern Deutsch, Französisch, Mathematik, Biologie und Physik-Chemie und das Reifezeugnis berechtigte, an der Universität Basel Astronomie, Chemie, Botanik, Mathematik, Physik und Zoologie zu studieren. Grundidee dieser staatlichen Kurse war es, «befähigten Personen, deren soziale oder gesundheitliche Verhältnisse es seinerzeit nicht erlaubten, ein Gymnasium zu besuchen» den Zugang zur Universität zu öffnen. Im Übrigen waren die Kursteilnehmer verpflichtet, im Sinne eines normalen Arbeitsvertrages in einem Berufe tätig zu sein. Die Bewährung im Berufsleben war der Grund für die Entlastung bei der Anzahl der Maturfächer.
Nach Schulschluss um 22 Uhr traf man sich ab und zu spontan mit Schulkollegen noch zu einem Bier oder ass schnell noch etwas, doch in der Regel schaute man sich noch den Stoff für den nächsten Schultag an. Der Selektionsdruck war stark. Wer den geforderten Notendurchschnitt nicht erreichte, war draussen. Das Privatleben blieb an einem ganz kleinen Ort, und ein Leben mit wenig Schlaf ist nicht eben gesund.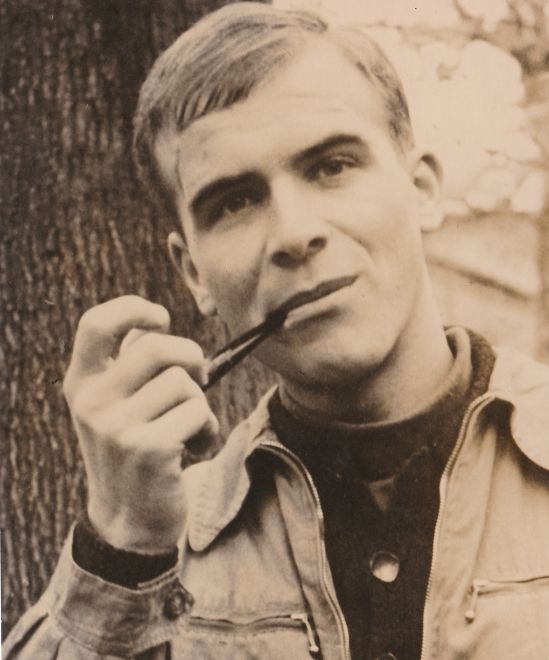
(2) Beim Spaziergang im nahen Nachtigallenwäldchen...

(3) ... und wieder zurück in meiner Küche am Basler Rümelinbachweg
ZUFÄLLE VOLLER ZAUBER
Der Zufall war’s, der uns am Fasnachtsmittwoch 1965, so zwischen 22 und 23 h in der Basler Innerstadt zusammenführte. Noch tobte die Fasnacht als gäbe es kein Ende. Noch einmal hatte dieses schier unbeschreibliche Treiben das gesamte Leben ergriffen, die Innerstadt brummte, wie dies nur gegen Ende der Fastnacht zu erleben ist, kein Platz, keine Strasse ohne das Schränzen der Guggen, ohne das Pfeifen und Ruessen der Cliquen. Da, auf dem Heimweg, beim Barfüsserplatz begegneten mir urplötzlich zwei schalkhafte Augen. Ich wendete meinen Blick − und schwupps war meine Tabakpfeife mit Räppli (Konfetti) gestopft. Ich war perplex und vernahm ein schallendes Lachen, darauf ein kurzer Wortwechsel. Mein Gegenüber hatte nicht nur meinen Schifflistickerdialekt verstanden, sondern sprach diesen selbst, wie ich sogleich feststellte. Ausgerechnet eine freche Ostschweizerin hatte sich also erdreistet, dem nicht sonderlich fasnächtlich gestimmten Mit-Ostschweizer und angehenden Basler Iurastudenten die Tabakpfeife so richtig zu stopfen! Dieser versuchte, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und begleitete die sympathische Dame gar noch zum Aeschenplatz, wo sie die Birseckbahn bestieg. Alles, was ich über sie wusste, war ihr Name und ihr Wohnort.
Am Samstag nach der Fasnacht, vielleicht auch eine Woche später, hatten wir uns am Aeschenplatz verabredet, also dort wo wir uns an der Fasnacht verabschiedet hatten. Offenbar hatte ich meiner Freundin davon erzählt haben. Sonst wäre sie niemals gegen Abend völlig überraschend in meiner Wohnung aufgetaucht, als ich mich gerade für den Ausgang bereitmachte. Sie versuchte, mich von meinem Vorhaben abzubringen. Als ich keine Anstalten dazu traf, packte sie kurzerhand meinen Wohnungsschlüssel und schloss mich von aussen in meine Wohnung ein. Da ich kein Telefon besass, war es nicht so ganz einfach, den Abwart zu avisieren. Mit einem verschmitzten Lächeln hatte mich dieser glücklicherweise aus meiner misslichen Situation befreit. Weil ich wegen dieses Vorfalls verspätet war, bestieg ich an der Heuwaage ein Taxi. Doch meine Freundin hatte mich beobachtet und nahm ihrerseits ein Taxi, worauf es zu einer veritablen Taxi-Verfolgungsjagd kam. Mit List gelang es meinem Chauffeur schliesslich, die Verfolger abzuhängen. So erwies sich auch der letzte Versuch meiner Freundin, die Sache nochmals einzurenken, definitiv als Schlag ins Wasser. Als ich ein paar Tage später nach Hause kam, waren sämtliche Gegenstände, wie Briefe, Fotos, die mich noch an sie hätten erinnern können, verschwunden.Das dramatische Ende dieser Beziehung schien geradezu nach einem spannenden Neubeginn zu rufen. Tatsächlich war mir das grosse Glück widerfahren, in der Person von Edith eine eigenständige, sehr selbstbewusste, couragierte, überaus liebenswerte Frau kennenzulernen. Vom ersten Augenblick unserer Begegnung an hatten wir uns bestens verstanden und uns seelisch verbunden gefühlt. Tönt sehr nach Floskel, aber da war nichts, auch gar nichts, das uns gegenseitig gestört hätte. Wir waren glücklich verliebt. Unvergesslich die gemeinsamen Wanderungen im frühlingshaften Dorneck, die Abende in Ediths originell eingerichteter Dornacher Wohnung mit prächtiger Sicht auf die Hügel mit der Ruinenanlage Dorneck, geradezu das Kontrastprogramm zu meiner kärglichen Behausung in der Stadt. Wie Edith an ihre Mutter berichtete, musste es auch bei ihr gefunkt haben. «Von Pius Helfenberger aus Gossau bin ich in die ‘Komödie’ eingeladen worden. Wir trafen uns dieses Wochenende wieder. Es ist die grosse Liebe meines Lebens und Du gewöhnst Dich am besten schon jetzt an den Namen.»
Dieses Gefühlshoch sollte sich als nicht sehr stabil erweisen, denn Edith hatte ihre Stelle bereits gekündigt und ihre Wohnung untervermermietet, um sich nach Brasilien zu begeben. Der Grund dafür war eine Studienkollegin, mit der sie im Kindergärtnerinnen-Seminar das Zimmer geteilt hatte. Trix war in Brasilien aufgewachsen. Vor ihrer Heirat wollte sie nochmals für ein Jahr zurück in «ihr» Recife und dort für Edith eine Stelle finden. Da damals in Lehrberufen nur auf Ende des Schuljahres d.h. auf Frühling gekündigt werden konnte, beschloss Edith, die Zeit dazwischen zusammen für eine kunsthandwerkliche Weiterbildung in Schweden zu nutzen.
Und dann war da ein weiterer Zufall am Werk. Einige Zeit vorher war Edith, wohl von Trix, einem interessanten Mann aus Saõ Paolo vorgestellt worden, der den halbadeligen Namen Dionysio von K. trug und als Professor für Biochemie eine internationale Kapazität in Fragen der Gewinnung von Blutgerinnungsmitteln aus Schlangengift war. Zwischen dem Professor und Edith musste es damals wohl etwas gefunkt haben. Deshalb hatte er sie gebeten, ihn nach Saõ Paolo zu begleiten, um dann weiter nach Recife zu reisen. Edith schien das Ganze sehr abenteuerlich – ein wenig wie im Film. Und wie Zufälle nun mal so spielen können, war mir besagter Professor aus meiner früheren Tätigkeit in einem kleineren pharmazeutischen Unternehmen in Basel bekannt. Dadurch war mir meine Beziehung zu Edith plötzlich in einem etwas anderen Licht erschienen. Damit sie die Zeitspanne bis zu ihrer Abreise nach Schweden überbrücken konnte, hatte ich ihr Unterschlupf in meiner kleinen, alten 1-Zimmerwohnung am Rümelinbachweg angeboten, ausgerechnet ich, der bisher nie mit einer Frau zusammengelebt hatte. Und zu meiner grossen Überraschung hatte Edith mein Angebot angenommen!
Mein Leben als Werkstudent war ebenso unspektakulär wie meine Behausung und meine Zeit für gemeinsame Aktivitäten beschränkt. Deshalb gibt es nur spärliche Erinnerungen, an einen Theaterbesuch, an Spaziergänge entlang des Birsig, derweil mich Edith Lateinwörter abfragte. Besonders in Erinnerung meine Gegendienste: Sie in der Badewanne mit viel Schaum, während ich sie mit Mandarinenschnitzen füttere. Trotzdem war die kurze gemeinsame Spanne für uns beide eine besondere Zeit. Kaum hatte ich so richtig realisiert, welch glückliches Schicksal mich ereilt hatte, waren wir wieder auseinandergerissen. Edith reiste tatsächlich nach Schweden, dann aber nicht nach Brasilien. Die junge Kindergärtnerin aus der Ostschweiz hatte den armen Dionysio wie eine heisse Kartoffel.fallen gelassen. Dies war mir damals jedoch gar nicht richtig bewusst geworden. Dionysio soll grossherzig gewesen sein und Edith noch nach Japan geschrieben haben.
In einer für uns beide wichtigen Lebensphase hatte das Schicksal etwas anders mit uns vor. Nach einem kurzen Flash von höchster Glückseligkeit sind wir physisch zwar auseinandergedriftet, doch die zarte Beziehung hat Grenzen und Jahrzehnte überdauert %u0336 etwas, das wir uns beide damals beim besten Willen nicht hätten vorstellen können.
GESCHAFFT - ENDLICH
Am 21. März 1967 war es endlich so weit: Zusammen mit ein paar Dutzend Kolleginnen und Kollegen konnte ich das Reife-Zeugnis in Empfang nehmen. Und im Sommer 1968, nach zweijähriger Bekanntschaft mit Christa, verlobten wir uns in der Morgenfrühe auf dem Gempen, dem mit seinen 756 m ü.M. höchsten Punkt des Birseck, zuoberst auf dem Aussichtsturm. Wie es dazu kam? – Ein Jahr zuvor, während einer Pause, kam plötzlich diese Frage eines Schulkollegen, ob ich Lust hätte, Trauzeuge bei seiner bevorstehenden Hochzeit zu sein. Spontan sage ich zu, worauf ein erstes Treffen im Hause seiner Braut arrangiert wurde, wo wir uns als zukünftige Brautführerin und als Brautführer zum ersten Mal begegneten. Uns verband nun eine gemeinsame Aufgabe, die wir bestmöglich zu erfüllen trachteten. Doch je länger die Hochzeitsfeier dauerte, desto pflichtvergessener wurden wir. Kurz nach der Hochzeit waren wir beim frischgebackenen Ehepaar eingeladen, doch ich liess alle sitzen. Zu unserem ersten Rendez-vous erschien ich unpünktlich, da ich vorher noch Wichtiges zu erledigen hatte. Es galt – in vorauseilendem Gehorsam? – die Beziehung zu meiner früheren Freundin zu kappen. Danach schien das Terrain einigermassen bereinigt, sodass ich es wagen konnte, die Brautführerin in meine Wohnung einzuladen. Doch vom Augenschein zeigte sie sich wenig begeistert, fand alles etwas düster und «Brecht-isch», wie sie sich ausdrückte. Besonders missfallen hatten ihr wohl die von meinem betagten Vorgänger stammende Einrichtung und meine in der Badewanne eingeweichten bereits etwas vergilbten weissen Nylon-Hemden, damals in Büros obligat. Einzig meine «Selbsttäuschungsanlage» schien sie zu amüsieren. Über eine ausrangierte Elektroschaltuhr hatte ich mein Radio und mein Tonbandgerät so programmiert, dass mir beim Betreten meiner Wohnung Musik entgegentönte – nachts beim Nachhausekommen, um mich weniger allein zu fühlen, und am Morgen, um mich zu wecken. Dabei schloss ich in indizierten Fällen vor dem Zubettgehen vorsorglicherweise anstatt des Radios den Staubsauger an die Schaltuhr an, ein durchaus probates Mittel, war ich so doch gezwungen, blitzartig aufzustehen, um den lärmigen ‚Electrolux‘-Uralt-Staubsauger in der Zimmerecke eigenhändig abzustellen. Wirklich punkten konnte ich bei diesem ersten Besuch nur mit dem zum Tee gereichten «Florentinerli». Und doch schien es mir, sie würde sich für mich interessieren, was mich natürlich freute. So überraschte sie mich während eines Spitalaufenthalts mit einem Strauss Kornblumen – unvergesslich! Sogar mein schulisches Schicksal schien ihr nicht egal zu sein. An Wochenenden war ich ab und zu Gast in ihrem Elternhaus, denn sie war nach Kräften bemüht, meine Defizite im Französisch zu beheben. Dort drohte mir wegen mangelhafter Leistungen ein Scheitern.
Mit dem Maturzeugnis im Sack ging es im Herbst 1967 zur Einschreibung an die Uni. Eigentlich war mir bezüglich Studienrichtung alles klar. Doch beim Anblick des altehrwürdigen Matrikelbuchs der Theologischen Fakultät überkamen mich plötzlich Zweifel und ich begann, etwas zu zögern. Der Grund dafür waren Gespräch mit Dr. Rolf Hartmann, unserem letzten Deutschlehrer. Er war überzeugt, ich hätte eher das Zeug zum Theologen als zum Juristen. Und da gab es in Basel St. Johannes einen Kirchenmann mit demselben Namen und einem ähnlichem Vornamen: Pfarrer Paul Helfenberger. Auch er hatte zunächst als kaufmännischer Angestellter gearbeitet und hatte anschliessend in Basel Theologie studiert. 1974 bis 1989 hat Paul Helfenberger als Pfarrer und einfühlsamer Seelsorger in Biel-Benken gewirkt; danach war er in Biel-Benken bis 1991 Verweser. Wegen seines starken Engagements und wegen seiner grossen Offenheit für die Ökumene war er in weiten Kreisen sehr geschätzt. Mein Namensvetter muss ein sorgfältiger Prediger gewesen sein, denn nach seinen Radiopredigten landeten immer wieder Telefonanrufe von Leuten aus der ganzen Schweiz, die sich bei Pfarrer Helfenberger bedanken oder Fragen stellen wollten, irrtümlicherweise auf meinem Anschluss.
Nur zwei meiner Klassenkameraden schlugen dieselbe Studienrichtung ein. Deshalb hatte ich mich in den Hallen der Alma Mater zunächst etwas verlassener gefühlt als meine um Jahre jüngeren Mitstudenten, die zumeist auf dem ordentlichen Weg an die Uni gelangt waren und bereits bei Studienbeginn über einen grossen Kollegenkreis verfügten. Auch gehörte ich keiner Studentenverbindung an. Aus diesem Grund schätze ich zunächst die guten Dienste meiner Tutorin Magdalena Rutz sehr. In der Folge orientierte mich eher an gleichaltrigen Kommilitonen, die jedoch bereits schon einige Semester hinter sich hatten. Im Nachhinein ist mir schleierhaft, wie ich mich im ersten Studienjahr in ein rechtsgeschichtliches Seminar verirren konnte, in welchem nur wenige und dafür honorige, vor dem Studienabschluss stehende Kommilitonen, wie Bernhard Christ und Rainer Schweizer, sassen. Prof. Hagemann hatte mir zu meiner grossen Überraschung nicht gleich zu Beginn die Türe jenes kleinen Hörsaals gewiesen, sondern mich zum Bleiben animiert, was ich dann auch wirklich tat. In der Folge durfte ich auf seine Unterstützung beim Amt für Studienbeiträge zählen. Ohne ihn wäre für mich manches schwieriger gewesen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Rudolf_Hagemann
Aus dieser ersten Studienzeit ebenfalls dauerhaft in Erinnerung geblieben sind mir die Staatsrechts-Vorlesungen bei Prof. Max Imboden. Er war ein wirklich herausragender Lehrer und stand auch als Politiker mit beiden Beinen in der Praxis. So bedeute sein früher Tod im Jahre 1969 auch für mich ein einschneidendes Ereignis. www.meet-my-life.net/de/143/autobiographien-lesen/375/%3Ca%20href=">www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D6393.php">www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D6393.php">www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D6393.php
Im Studium fühlte ich mich überall dort pudelwohl, wo ich Verbindungen zu meiner früheren Ausbildung in der Kommunalverwaltung oder meiner späteren kaufmännischen Tätigkeit herstellen konnte. Dies war in den meisten Bereichen der Fall. Hier konnte ich als «Spätberufener» mit meinen praktischen Erfahrungen punkten. Nur mässig begeistern konnte ich mich für das Strafrecht; dies obwohl ich Prof. Günther Stratenwerth als ausgezeichneten Dozenten für Strafrecht sehr schätzte.
Studieren war das eine, (Weiter-)Arbeiten das andere, denn auch bei bescheidensten Ansprüchen liess sich einzig von Studienbeiträgen nicht leben. Durch Zufall wurde ich auf die Handelsschule Huber & Co. an der Freien Strasse aufmerksam. Diese schloss sich Mitte der sechziger Jahre mit der Schule Widemann AG unter Direktor Rémy Meyer zur Huber Widemann Schule zusammen. Ab diesem Zeitpunkt erfolgte der Unterricht in den Räumlichkeiten am Kohlenberg 13/15. Der Lehrkörper bestand in hohem Mass aus Studenten, weshalb die Schule regelmässig Bedarf an Lehrkräften hatte. An der HWS unterrichtete ich während dreier Jahre hauptsächlich junge Erwachsene in den Fächern Handelsrecht und Betriebswirtschaftslehre sowie Korrespondenz. Zuletzt gehörten auch angehende Arztgehilfinnen zu meinen Schülerinnen. An der Schule galt ich als das Verständnis fördernde, eher «liebe» Lehrkraft. Nur ein einziges Mal wurde ich von Direktor Meyer zurückgepfiffen – Privatschule eben!
1967 hatte ich dank tatkräftiger Unterstützung meiner Freundin und ihrer Eltern im Kleinbasel ein neues Zuhause bezogen, ausgerechnet in einem Hinterhaus an der Webergasse, eine überaus gemütliche Bude! Sie kostete mich ganze 70 (in Worten: siebzig) Franken. Dank billiger Behausung und geringer Ansprüche kam ich mit meinem Nebeneinkommen und den baselstädtischen Studienbeiträgen wirtschaftlich einigermassen über die Runden.
(4) Webergasse 28, WC-Turm Hinterhaus, Blick vom Teichgässlein
Im privaten Bereich stieg mit der Zeit der Drang, das etwas komplizierte Hin und Her zwischen meiner Studentenbude im Kleinbasel und dem Haushalt von Christas Eltern in Münchenstein zu beenden. 1969, zu einer Zeit, in der die Jugend- und Studentenunruhen auch in Basel spürbar waren, mieteten wir uns an der Allschwilerstrasse in Münchenstein ein 3-Zimmer-Logis, das wir sukzessive als zukünftige gemeinsame Wohnung einrichteten. Dank des Flairs meiner Verlobten für Inneneinrichtungen und ein bisschen auch wegen meiner Liebe zur Technik war ein kleines Bijou entstanden. Unter diesen Vorzeichen war mir der Wechsel von der Kleinbasler Webergasse nach Münchenstein nicht mehr ganz so schwer gefallen. Am 26. Juni 1969 gaben wir uns vor dem Münchensteiner Zivilstandsbeamten und am 29. Juni im «diefschte Glaibasel» in der Lindenberg-Kapelle das Ja-Wort.

(5) Ohne Worte
UFF, WAR DAS KNAPP! Als aufmerksame Leserinnen und Leser meiner Erinnerungen kennen Sie bereits die eine und andere meiner Untugenden, wie jene, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Diese Schwäche mag daher rühren, dass ich nicht selten Dinge aufgeschoben habe, deswegen in Eile und suboptimal orientiert war. Ausgerechnet an unserem Hochzeitstag wäre mir meine chronische Unpünktlichkeit fast zum Verhängnis geworden. Ich schaffte es gerade in letzter Minute per Taxi zum Elternhaus meiner Braut in Münchenstein! Doch im Gegensatz zu Hugh Grant als Charles in «Vier Hochzeiten und ein Todesfall» hatte ich mich zumindest auf der Hochzeitsfeier klaglos benommen und mich nicht Hals über Kopf in eine andere Frau verliebt.

(6) VAL FEX / FEXTAL
SCHON DAMALS GRÜN. Bereits anderntags verreisten wir ins Oberengadin. Zuhinterst im Val Fex (heute als «Krafttal» angepriesen), in Fex-Curtins, haben wir während sechs Wochen unsere Kleinst-Bleibe in einem umgebauten Kiosk: eine Mini-Küche ohne fliessendes Wasser und ein etwas grösseres Schlafzimmer. 
(7)
Unser «Hüttli» im Fextal
Zum «Hüttli» gehörte ein über der Strasse gelegenes Plumps-Klo – nature pur eben. Unter diesen Umständen gestaltete sich der Haushalt, insbesondere Kochen, Einkaufen, nicht ganz so einfach. Doch wir genossen die neue Zweisamkeit in der hehren Engadiner Bergwelt in vollen Zügen. Und es locken gefährliche Pfade, etwa hinten beim Gletscher auf der Suche nach Edelweiss. Und nicht zu vergessen das Hotel Fex. In den 1850er Jahren gebaut, stand es ursprünglich im Kurkomplex von St. Moritz Bad. Um 1900 wurde es in seine Einzelteile zerlegt und mit Pferdefuhrwerken ins Fextal transportiert. 2010 übernahm ein Zürcher Tierarzt das Hotel. In den nächsten Jahren soll das traditionsreiche Haus sanft erneuert werden und seinen alten Glanz zurückerhalten. www.hotelfex.ch">www.hotelfex.ch
Die Welt bewegt dieser Tage derweil etwas ganz Grandioses: Am 20. Juli 1969, um 3.56 Uhr MEZ setzt der Amerikaner Neil Armstrong seine klobigen Treter erstmals auf den Mond, einen Abdruck im Mondstaub hinterlassend wie im kollektiven Bewusstsein der Menschen, die an den Fernsehapparaten 400’000 Kilometer entfernt wie gebannt zuschauten, und verkündend: «Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein grosser Sprung für die Menschheit.» Ein Satz wie fürs Schulbuch! Von diesem unwirklichen Geschehen vernehmen wir im engen Fextal nur über unser kleines Transistorradio, hören Präsident Nixon, als er sich mit feierlicher, unbewegter Stimme zu der absurden Behauptung versteigt und die Mondlandung «als das grösste Ereignis seit der Erschaffung der Menschen» bezeichnet. Kein Wunder, dass uns andere Ereignisse, wie eine Vollmondnacht droben im Fextal oder ein Schneefall mitten im Sommer viel stärker eingefahren sind als die Mondlandung.Nach unserem Bergsommer wussten wir Behaglichkeit und Komfort unseres neuen Münchensteiner Zuhauses so richtig zu schätzen und freuten uns darüber, unsere Arbeit wieder aufnehmen zu können, Christa als Primarlehrerin und ich als Jus-Student. Nach zwei Jahren bestand ich an der Uni das Vor-Lizentiat als erste akademische Prüfung. Innerhalb der Kath. Studentenschaft wurde ich Verantwortlicher für den «Juristenzirkel», hatte Themen und Referenten zu suchen und vorzustellen, Diskussionen anzukicken oder zu leiten, mit dem Risiko, mich dabei dann und wann etwas zu exponieren. Ein ganz besonderer Glücksfall, als es mir gelungen war, Luzius Wildhaber (1937 – 2020) als einen der Referenten zu verpflichten. Wildhaber war zu dieser Zeit im Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten in Bern tätig und hatte sich an der Universität Basel gerade habilitiert. 1971, nur zwei Jahre danach, erschien seine wohl prägendste Publikation «The Treaty Making Power And The Constitution». Die Begegnung mit diesem herausragenden Juristen, dem späteren Professor und Richter und Präsident des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Strassburg bleibt mir in allerbester Erinnerung.
In unserer Wohngemeinde Münchenstein war ich zufälligerweise in eine Versammlung der Ortsgruppe Münchenstein des «Landesring der Unabhängigen» geraten, worauf es mir «den Ärmel reinnzog». In der Folge rührten wir kräftig die Werbetrommel für die neue Gemeindeordnung, mobilisierten sogar mit einem Megaphon und erreichten entgegen aller Erwartungen unser Ziel, nämlich den Wechsel zur ausserordentlichen Gemeindeorganisation. In den darauffolgenden Einwohnerratswahlen erreichte der LdU gleich Fraktionsstärke – eine Sensation. Als Parteiloser gehörte ich ab 1972 der Fraktion «LdU und Parteilose» dem ersten Einwohnerrat an und nahm Einsitz in die Geschäftsprüfungskommission. Von Beginn an mit dem «Revoluzzer»-Image behaftet und ohne Vertretung im Gemeinderat bildeten wir so etwas wie eine parlamentarische Opposition, waren fleissige Leserbriefschreiber und machten uns durch zahlreiche par lamentarische Vorstösse bemerkbar. Nicht weiter verwunderlich, dass ich bei so viel politischer Aktivität auch auf einer Landratsliste landete. Kurz vor unserem Wegzug nach Klosters war ich noch als Mitglied der Prospektivkommission für eine neue Basellandschaftliche Verfassung ernannt worden. Wer weiss, welch steile Polit-Karriere mir bei einem weiteren Verbleib im Kanton Basel-Landschaft beschieden gewesen wäre...
Nach erfolgreich bestandenem Lizentiat bot sich die Möglichkeit, im Sommer 1971 im solothurnischen Dornach eine Rechtspraktikantenstelle zu besetzen. Ich griff zu, denn anders als im Kanton Basel-Stadt waren dort die Plätze äusserst begehrt und man erhielt nicht nur ein Trinkgeld, sondern einen Praktikumslohn. Dafür wurde vollwertige Arbeit erwartet. Jetzt radelte ich während eines Jahres täglich der Birs entlang von Münchenstein nach Dornach und wieder zurück, eine gute Zeit, zunächst in der Amtsgerichtsschreiberei Dorneck-Thierstein, darauf in der Amtschreiberei Dorneck. 
(8) Kurz nach Praktikumsantritt gab Fürsprech Ernst von Arx, der Doyen der Dornacher Anwaltschaft und früher grösster Rebbesitzer des Kantons (Bildmitte) in seinem legendären Rebhäuschen im Dornacher Rebberg eine Abendeinladung. Mit von der Partie waren der neue Gerichtsschreiber Hans Walter (2. v.l.), Rechtspraktikanten-Vorgänger Christoph Meier (2. v.r.), und Patrick Gassmann (1.v.r) sowie meine Wenigkeit (1.v.l.)
Gerichtspräsident Dr. Theo Schaffter, Gerichtsschreiber Walter Walliser sowie dessen Nachfolger Hans Walter schätzen die Ernsthaftigkeit, mit der ich von Beginn an das juristische Handwerk betrieb. Besonders beeindruckte meine juristische Kartothek. Bereits während des Studiums hatte ich damit begonnen, mir juristische Begriffe fein säuberlich mit Schreibmaschine auf A6-Registerkarten zu notieren. In der Folge erschloss ich darin auch wichtige Urteile von Gerichts- und Verwaltungsbehörden – eine ungeheure Fleissarbeit, an der ich bis fast zum Ende meiner gesamten beruflichen Tätigkeit weitergearbeitet habe.
Die Zeit in der Amtschreiberei war eine ganz besondere, wohl weil die Räumlichkeiten im Parterre des Amthauses für mich stets etwas Verliesartiges hatten und mir alles etwas kafkaesk vorkam. Dies mag auch an der Amtsleitung gelegen haben. Amtschreiber Erwin Studer wirkte grau und eher spröde, ein Beamter, wie er im Buche steht. Zum Glück war dessen Stellvertreter Max Stampfli offener. Er kam jeden Tag mit dem Zug von seinem Wohnort Olten angereist und in verschiedener Beziehung ein gewisser Ausgleich. Farbiger wirkten die übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, rund ein Dutzend an der Zahl. Den intensivsten Publikumskontakt hatten die Mitarbeiter des Betreibungs- und Konkursamtes mit dem leutseligen, aus Gempen stammenden, landwirtschaftlich geprägten Geni (Eugen) Meier, dem stets frohgemuten Peter Linz und dem tiefgründigen Hanspeter Wagner. In einem der Büros nebenan sass mit Herrn Kundert ein in die Wolle gefärbter Basler, ein etwas phlegmatisch wirkender Zigarrenraucher und Mercedesfahrer, von vielen, auch von Mitarbeitern „ Dr. Schuldbrief“ genannt. Als Leiter der Kaufsabteilung amtete der wohlbeleibte, damals im Leimental wohnhafte Peter Christen, ein blendender Witzeerzähler und den schönen Dingen des Lebens stets wohlgesinnt. Die Aufzählung wäre unvollständig ohne Grundbuchamt, in dem Hans Schwyzer und Frau Kaspar wirkten. Kenner und Könner im Erbschaftsamt war der sportlich wirkende Otto Eberle, mit seinem ausgeprägten Ostschweizer Dialekt auch sprachlich ein gewisser Ausgleich. Augenfällig die Unterschiede auch bei den Damen: Im Vergleich zur Nichte von Bischof Hänggi nahm sich die elegante Claire Sorg schon fast als Kontrastprogramm aus.
Nächste Klippe war das Solothurnische Fürsprech- und Notariatsexamen. Wie ein Kloss lag mir insbesondere die schriftliche Notariatsprüfung auf dem Magen. Etwas Ablenkung brachte die Lehrtätigkeit am Bethesda-Spital und im Frühjahr 1973 ein Vikariat an der Realschule Basel-Stadt, im Thiersteinerschulhaus. Dieser völlig überraschende Einsatz in den Fächern Deutsch und Geschichte bedeutete Knochenarbeit für mich, da jede Lektion von Grund auf vorbereitet sein wollte. Mein Stil unterschied sich sehr von jenem des plötzlich erkrankten Stadthistorikers Dr. phil. Markus Fürstenberger. Trotzdem oder deswegen schien ich bei der Klasse gut anzukommen. Jedenfalls hatte ich sogar ein paar (weibliche) Fans – und gleichzeitig gewisse Zweifel: Wäre ich mit der doch eher trockenen Juristerei auf lange Sicht auf dem richtigen Dampfer?
10 METER, DIE ENTSCHEIDEN. Man schrieb den 10. April 1973, etwas nach acht Uhr morgens. Überpünktlich hatte mein Hotelzimmer in Solothurn geräumt – es hatte über Nacht tüchtig geschneit – und ich fand mich im Regierungsgebäude zur achtsündigen schriftlichen Prüfung ein, hinter Schloss und Riegel. Das Thema «Widerruf begünstigender Verwaltungsakte», erschien mir zum Glück vom einigermasssen vertraut.
Eben hatte ich mit meiner Arbeit begonnen, als im englischen Bristol die viermotorige Turboprop «Vickers Vanguard» der Chartergesellschaft «Invicta International Airways» mit 145 Passagieren, wovon 6 Besatzungsmitglieder, zu einem Flug in die Schweiz startete. Nach einem Flug von 1 Std. 45 Min. meldete sich der Pilot um 0949 Uhr beim Flugsicherungsdienst Basel-Mülhausen zur Landung an. Wegen des schlechten Wetters (dicker Nebel und starker Schneefall) wurde ein Instrumentenanflug angeordnet. Das von Norden kommende Flugzeug setzte nach dem Funkfeuer Basel Nord zur Landung an, der Pilot meldet, dass er mangels Sicht durchstarte, eine Schleife fliege und wieder über Basel Nord hereinkomme. Der Pilot flog zu wenig weit zurück. Der Fluglotse meldete dies dem Piloten, worauf er die Maschine hochzieht – zu spät. Durch den extremen Steigflug und das Berühren der Baumkronen wird die Maschine stark abgebremst, bevor sie um 10.14 Uhr aufschlägt. Dabei wird das Heck abgerissen und in einen Jungwuchs geschleudert. Alle 37 Überlebenden befinden sich im Heck, kopfüber hängend, bei eisiger Kälte in den Sicherheitsgurten. Die Bewohner der 200 Meter entfernten Herrenmatt konnten zwar ein Motorengetöse hören, aber keinen Aufschlag, weil der dicke Nebel und der Schneefall den Aufprall und den Lärm schluckten. Erst um 11.15 Uhr, eine Stunde nach dem Absturz, alarmierte der Flughafen die Einwohner der Herrenmatt über das vermisste Flugzeug, das man dann um 11.20 Uhr auffand, worauf Grossalarm ausgelöst wurde. In der Zwischenzeit waren 40 cm nasser Neuschnee gefallen; die bereits grünen Laubbäume brachen zusammen und blockieren Strassen und Stromleitungen. Die unterkühlten Überlebenden wurden in den Häusern der Herrenmatt untergebracht. Wäre die Maschine 10 Meter höher geflogen, wäre nichts passiert. Der bisher folgenschwerste Flugzeugabsturz war ein gewaltiger Schock für die Schweiz, insbesondere die Nordwestschweiz. Auch bei mir war der Schrecken darüber noch Jahre spürbar. Später, während meiner Zeit im Basler Polizei- und Militärdepartment, bot sich Gelegenheit, mich mit Feuerwehrkommandant Allemann, der zusammen mit einem Arzt und zwei Sanitätern als erster in den Flugzeugrumpf steigen konnte, über den schwierigsten Einsatz seines Lebens auszutauschen und die Ereignisse rund um diese Katastrophe aufleben zu lassen.
Am Mittag informierte mich Staatschreiber Egger kurz über das Drama im Bezirk Dorneck-Thierstein mit 108 Toten. Ich war zutiefst schockiert und mir war jeglicher Appetit vergangen. Meine Gedanken und Gefühle waren bei meinen bis aufs Letzte geforderten früheren Arbeitskollegen in Dornach. Und gleichzeitig empfand ich eine tiefe Dankbarkeit darüber, nicht mehr am Amtsgericht Dornach und nicht mehr mit dem Anblick der in der Turnhalle aufgebahrten Särge konfrontiert zu sein. Nur mit grösster Mühe schaffte ich es, mich bis zum Schluss vollständig auf meine Arbeit zu konzentrieren. Zum Glück gelang es mir an diesem schicksalsschweren Tag, dem völlig unerwarteten zusätzlichen Druck standzuhalten, meine Gedanken zu ordnen, zu Papier zu bringen, einigermassen ordentlich in die Maschine zu tippen und meine Arbeit schliesslich am Abend gerade noch rechtzeitig abzuliefern.
JUHUI E FAMILIE. WIRKLICH? Die Schwangerschaft meiner Frau verlief gut. Am 9. August 1973 kam unsere Tochter Bettina, ein gesundes und munteres Kind, in der St. Josefsklinik in Basel zur Welt. In der Folge lief leider nicht alles wie erhofft. Ich war bemüht trotz gesundheitlicher Probleme meiner Frau die Stellung zumindest einigermassen zu halten. Nicht weiter verwunderlich, dass unter diesen Vorzeichen meine öffentliche mündliche Prüfung – im Regierungsratssaal sassen gegen ein Dutzend Zuhörer, denen das gleiche (Prüfungs-)Schicksal bevorstand – kein Ruhmesblatt für mich wurde. Immerhin hatte ich zuvor alle schriftlichen Prüfungen auf Anhieb bestanden und war stolz, am 18. September 1973 das Patent als Solothurnischer Fürsprech und Notar in Empfang zu nehmen.
Basel – Klosters hin und zurück
Es macht den Anschein, als wären wir anfang der siebziger Jahre der Zeit etwas voraus gewesen. Wir hatten kurze Wege zwischen Arbeit und Wohnen, saubere Luft, reines Wasser und raschen Zugang zur Natur als den wahren Luxus definiert. Wohl deshalb war mir das Stelleninserat der Gemeinde Klosters-Serneus in der «Schweizerischen Juristenzeitung» in Auge gestochen. Ein Wohnsitz im Prättigau schien unseren Vorstellungen zu entsprechen. Auch hoffte ich, als Ostschweizer auch mentalitätsmässig einen etwas einfacheren Zugang zu finden. Vor allem angetan hatte es mir der vielseitige und interessante Aufgabenbereich. Gegen Ende der sechziger Jahre waren die Aufgaben der Tourismusgemeinden sprunghaft angestiegen. Viele und grosse Probleme harrten einer Lösung. So waren wegen der raschen Entwicklung beim Gemeindepräsidium immer mehr Planungs- und Verwaltungsaufgaben angefallen. Auch die Belastung des Gemeindeschreibers hatte ständig zugenommen. Auf die Dauer wäre der Zustand wohl untragbar geworden. Deshalb war in Klosters die neue Stelle eines Gemeindesekretärs geschaffen worden. Dieser sollte vor allem juristischen Sachverstand einbringen und als Sekretär des Gemeindepräsidenten fungieren.
Die erste Begegnung mit Gemeindepräsident Georg Brosi erfolgte nicht in Klosters, sondern im Bahnhofbuffet Olten. In seiner Funktion als Nationalrat kam er von Bern angereist. Er erschien mir als freundlich, ruhig und sehr besonnenen. Über ihn wusste ich nicht viel, ausser dass er von Haus aus Lehrer und bereits von 1947 – 1956 ein erstes Mal Gemeindepräsident gewesen war, dann im Regierungsrat gesessen hatte und seit 1967 wiederum als Gemeindepräsident amtete. www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D5332.php">www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D5332.php
Der erste Eindruck muss beiderseits positiv gewesen sein. In der Folge konnte Brosi den Gemeindevorstand fürs erste überzeugen, ich meinerseits versuchte meine Frau definitiv für das Projekt Klosters zu erwärmen. Nach einem weiteren gemeinsamen Gespräch in Klosters stand unser Entschluss fest: Anstatt in der Agglomeration Basel sollten unsere Kinder im Bündnerland aufwachsen. Am liebsten hätten wir sie im rätoromanischen Sprachraum aufwachsen sehen. Bettina, der Name unserer Tochter, sollte bereits etwas dieses lateinische Element verkörpern. Doch wirklich weit vom (Unter-)Engadin entfernt liegt Klosters ja nicht, wenn man bedenkt, dass während unserer Klosterser Zeit Nägel für den Vereina-Tunnel als wintersichere Verbindung zwischen dem Engadin und dem Prättigau eingeschlagen werden sollten. Ich erinnere mich noch gut daran, wie überrascht ich war, als das Riesenpaket mit den ersten Bauplänen im Rathaus eintraf.
In einem Ferienort eine passende und zahlbare Wohnung zu finden, erwies sich als nicht eben einfach, zumal die Auswahl bescheiden war. Im Haus ‚Galtür’ am Kippweg fanden wir 800 Franken feine nicht eben billige, aber grosszügige, romantische 3-Zimmer-Dachwohnung. Ein gutes, beinahe erhebendes Gefühl, als der vollgepackte Zügelwagen gegen Ende September Münchenstein in Richtung Prättigau verliess, gefolgt von dem von einem der Zügelmänner chauffieren dunkelblauen Volvo meines Schwiegervaters, mit Ehefrau und Baby, meiner Wenigkeit und dem Siamkater im Katzenkorb.
Die Gemeinde Klosters-Serneus war zu dieser Zeit noch stark landwirtschaftlich geprägt. Dies war nicht zuletzt das Verdienst von Gemeindepräsident Brosi, dessen Geschick und dessen weitsichtiger Politik. Dass die Auseinandersetzung mit dem immer stärker und immer wichtiger werdenden Tourismus-Sektor nicht vollends zur Zerreissprobe wurden, dafür sorgte der auf Ausgleich bedachte, mit der Landwirtschaft verwurzelte Georg Brosi mit einer Bodenpolitik, die er rechtzeitig und zielstrebig in die Tat umzusetzen vermochte. In seiner Persönlichkeit steckte etwas Bedächtiges und Väterliches. Dank der Klosterser Bauordnung und der durch den Churer Ingenieur Andrea Tuffli und den Churer Rechtsanwalt H.F. Jossi gemeinsam erarbeiteten richtungsweisenden Planungsinstrumente konnten schlimme Auswüchse verhindern werden. Meine erste grosse Aufgabe war die Ausarbeitung eines Entwurfs für ein neues Abwasserreglement. In der Folge konnte ich mich auf dem Gebiet des Bau- und Planungsrechts weiterbilden und die Gemeinde in einer Vielzahl von Baupolizeistreitsachen vertreten, mit sehr gutem Erfolg, wie es im Arbeitszeugnis heisst. Ferner befasste ich mich mit Personal- und Verwaltungsorganisationsfragen und war auch Sekretär der Schlichtungsstelle für Mietverhältnisse für die Kreise, Klosters, Küblis und Luzein
In der Retrospektive erscheinen die Klosterser Jahre etwas entrückt. Irgendwie hatten wir uns selbst genügt: Privat als junge Familie in der grosszügigen und gemütlichen Wohnung im Haus ‚Galtür’, ich beruflich in meinem neu eingerichteten Büro im 2. Stock des Klosterser Rathauses mit wunderschöner Bergsicht. Doch unsere Selbstgenügsamkeit wurde nicht von allen geschätzt. Brosi war einer der Architekten der Fusion von BGB und Bündner Demokraten zur SVP. Mit ihm zusammen hatte ich auch mehrmals Veranstaltungen der neu gegründeten SVP besucht. Mit ihrem Programm konnte ich mich zu dieser Zeit zumindest teilweise identifizieren, da die durch Blocher und den sog. Zürcher Flügel eingeleitete verhängnisvolle Entwicklung der Schweiz erst bevorstand. Blocher, der ursprünglich bei der FDP Meilen schnurstracks als Präsident der Ortspartei einsteigen wollte und mit seinem Vorhaben abgeblitzt war und sich deswegen Rache geschworen hatte, befand sich ante portas, und war willens, sich die damals artige frühere BGB und dann Volkspartei anzueignen und sie zu einem Sammelbecken vor allem für Protestwähler zu machen. In dieser Zeit begegnete ich an einem Parteianlass auch der jungen Eveline Schlumpf, der nachmaligen Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf. Einige hätten gerne gesehen, wenn wir uns auch in Vereinen oder gar in der Politik engagiert hätten und ich mich bereit gezeigt hätte, ein politisches Amt zu übernehmen. Doch wir zogen es vor, abends und über das Wochenende unser Zuhause und die Freizeit zu geniessen, während der kurzen, warmen Jahreszeit auf dem grossen Balkon oder auf Wanderungen, im Winter auf der Langlaufloipe ins Garfiuntal. Auf den Abfahrtsskiern standen wir äusserst selten. Das frühe Anstehen an den Bergbahn-Talstationen an Wochenende war unsere Sache nicht.
Im Winter 1976 erblickt Sohn Daniel im Spital Davos das Licht der Welt – ein wunderschönes Ereignis. Allerdings hatte ich noch kein Haus gebaut, keinen Baum gepflanzt und auch noch kein Buch geschrieben. Zu viert zu sein, bedeutete eine neue und grosse Herausforderung. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir aus innerer Überzeugung auf ein eigenes Auto verzichtet. Doch plötzlich fand ich mich als Fahrschüler wieder, ausgerechnet auf der kurvenreiche Strecke vom Klosterser Rathaus nach Saas, ganz nahe am Blutschwitzen. Fahrlehrer Jost hatte alles daran gesetzt, aus mir schliesslich noch einen ganz akzeptablen Autofahrer zu machen.
Die Küche war damals noch nicht mein Ding. Als unsere Kinder noch klein waren, blieben sie von meinen Versuchen am Herd verschont. Dann nach Jahren wieder Gefühle von Sehnsucht, ein Gericht selbst herzustellen - dem Cheminée im Wohnzimmer sei Dank! Doch die offene Feuerstelle brachte nicht nur Glück. Als unser grosser Christbaum dürr geworden war, hatte ich ihn zum Anfeuern des Cheminées benutzt damit beinahe einen Kaminbrand provoziert. Ansonsten tat ich, was Männer so tun: sie leisten sich eine Grill-Ausrüstung, um im Sommer dann und wann Fleisch am Grill zuzubereiten. Bei mir geschah dies eher selten und eher während der langen Winterzeit. In Erinnerung geblieben ist mir eine Einladung. Da der Rest der Familie im Unterland weilte, hatte ich den Davoser Landschreiber und den Rechtskonsulenten an einem Freitagabend zu einem gemütliches Arbeitswochen-Ausklang bei einem Stück Fleisch und einem guten Glas Wein eingeladen. Alles war vorbereitet, als das Telefon klingelte und mir mein Davoser Kollege mitteilte, er könnte nicht fahren, der Wolfgangpass sei infolge Schneefalls geschlossen. So sass ich denn plötzlich auf ziemlich viel Fleisch, neben mir die Glut. Zum Glück liessen sich dann noch kurzfristig ein paar Gäste finden, die bereit waren, mir aus der Patsche zu helfen.
Bei jedem unserer Besuche in der Nordwestecke der Schweiz wurde uns bewusst, wie viele Takte wir verpassten – höchste Zeit für uns ist, den Anschluss wieder herzustellen. Die Tatsache, dass mein Projekt einer Umstellung der Klosterser Gemeindeverwaltung auf EDV an der Urne Schiffbruch erlitten hatte, erleichterte den Entscheid, nach Basel zurückzukehren, nachdem ich vom Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt zum Vorsteher der Administrativen Dienste des Polizei- und Militärdepartments (PMD) gewählt worden war. Wehmut und Vorfreude ergaben eine seltsame Stimmung, berauschend und anstrengend zugleich, eine Gemütsverfassung, welche die kleine Bettina weder verstehen und noch teilen konnte. Was sie wohl wahrgenommen hatte, war die Anspannung der Gemüter ihrer Eltern, die im Chaos eines langsam in Kisten verschwendenden Lebens den Überblick zu bewahren versuchen. Als «Mann aus den Bergen» und damit in Basel in (fast) jeder Beziehung unbeschriebenes Blatt durfte ich von Anfang an auf das Wohlwollen und die volle Unterstützung meines direkten Vorgesetzten, Regierungsrat Karl Schnyder, zählen. Noch vor meinem Amtsantritt hatte er im Rahmen einer Abteilungsleiterkonferenz mit anschliessender Ausfahrt für einen guten Amtseinstieg gesorgt.

(9) (8) Hoch auf dem Mannschaftstransporter der Basler Polizei (noch heute im Gebrauch) (von li.) 1. R. Regierungsrat Karl Schnyder und Polizeikommandant Fritz Meyer, 3. R.. P.H.; 6. R. Pol Hptm Robert Heuss
Anfangs Juli 1977 bezog ich mein Büro im Spiegelhof und machte mich mit jugendlichem Elan an die Arbeit. Apropos Büro: Bei einem Besuch an meinem Arbeitplatz hatte ein Kollege, seines Zeichens Solothurner Kantonsrat, bemerkt, in seinem Kanton wären derartige Büros Regierungsräten vorbehalten. Erst mit der Zeit wurde mir so richtig bewusst, welch vielfältigen und komplexe Problemkreise und Aufgaben in diesem mit seinen rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern grössten «Gemischtwarenladen des Kantons» meiner harrten. Schwerpunkte bildeten die Bereiche Lohnhofgefängnis, Gastwirtschaftswesen und Basler Herbstmesse. Diese jeweils im Oktober stattfindende Vergnügungsveranstaltung ist mit ihrem Gründungsjahr 1471 die älteste und mit ihren Hunderten von Bahnen, Verpflegungs- und Verkaufsständen auch die grösste ihrer Art – nicht nur der Basler Innenstadt sondern auch schweizweit.

(10)

(11) Auszug aus pibs (Personal-Info Basel-Stadt, Feb. 1981, Nr. 31
In der Folge galt, manche personellen und organisatorischen Änderungen in Richtung interner Strukturbereinigung vorzunehmen, Probleme mit grauen Eminenzen zu lösen, von denen sich einige erst zurückziehen mussten, bevor sich etwas Neues durchsetzen konnte. Im Gegensatz zu meinem Amtsvorgänger war ich nämlich der festen Überzeugung, dass auch in einem Untersuchungsgefängnis die Zeiten von Einzelhaft der Vergangenheit angehören würden. Aus diesem Grund setzte ich mich in der interdepartementalen Kommission vehement für die Einführung des Gruppenvollzugs ein, wie dieser bereits in Holland praktiziert wurde. In diesen Bereich sind die Zellentüren tagsüber geöffnet. Es gibt einen Aufenthaltsraum und eine Waschküche. U-Häftlinge können nach einer ersten Haftphase wechseln und sich dort frei bewegen. Zum grossen Glück gehörte Wilfried Steib als Architekt dieser Kommission an. Er verstand es bestens, diese Vorstellungen planerisch umzusetzen. Allerdings brauchte es dann doch noch einiges an interner und externer Überzeugungsarbeit, um auch die Vertreter der Staatsanwaltschaft mit ins Boot zu holen und das grosse Projekt eines Neubaus für Staatsanwaltschaft und Untersuchungsgefängnis an der Heuwaage einen wichtigen Schritt weiter zu bringen.

(12) "Startschuss" der Veranstaltungsreihe "Mit der Basler Verwaltig kasch rede" anfangs Juni 1978 mit dem Polizeidepartement im Grossen Festsaal der Mustermesse
Karl Schnyder hatte es wie kein anderer Regierungsrat vor ihm verstanden, immer wieder sein Amt als Polizeidirektor und mithin auch seine Person öffentlichkeitswirksam in Szene zu setzen. Es war denn auch er, der im Juni 1978 den «Probegalopp» für die im Rahmen der Zielvorstellungen «Basel 75» bzw. «Basel 76» angekündigten Begegnungen mit der Öffentlichkeit wagte. Nachdem er im Hinblick auf sein Amt als Regierungspräsident im Vorjahr nach nur zwei Jahren völlig überraschend seinen Rücktritt aus dem Nationalrat erklärt hatte, befand sich Schnyder in einem Popularitäts-Hoch. Kein Wunder, dass er mit einer grossen Präsentation «seines PMD» den Grossen Festsaal der Mustermesse anfangs Sommer zu füllen vermochte und zum Schluss für die gelungene Präsentation viel Beifall erntete. Bei dieser Gelegenheit hatte ich Wert auf die öffentliche Feststellung gelegt, innerhalb unserer Abteilung beschäftige man sich nicht nur mit publikumswirksamen Themen wie «Stützlisex» oder Ausverkäufen, sondern auch mit weit weniger im Interesse der Meden stehenden, wie etwa dem Gefängniswesen. Dies klarzustellen schien mir wichtig, nachdem uns zuvor Schnyders Reise ins Zürcher Milieu in die Schlagzeilen des Boulevard gebracht hatte. Sogar in der Ostschweiz hatte man Wind vom «Ausflug» zum Zürcher Sexodrom bekommen und sich vielleicht Sorgen um mein Seelenheil gemacht! Da auch in Basel Gesuche für Guckloch-Sex sowie Boxkampf «oben ohne» hängig waren, hatte Schnyder Wert daraufgelegt, vor einem Entscheid für Basel in einem Etablissement in der Stadt Zürich einen Augenschein nehmen – im wahrsten Wortsinn!
Auch in der Stadt Basel kam es Ende der siebziger- und anfangs der achtziger Jahre zwischen linken Kreisen, die sich gegen den Strafvollzug auflehnten, und der Polizei zu massiven Auseinandersetzungen, die sich des Öfteren für den als «Ausbrecherkönig» bekannten Walter Stürm www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4k8uZyPfVAhVDnRQKHT-iCQ8QFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FWalter_St%25C3%25BCrm&usg=AFQjCNFe8iyPRfhUkceHHUbKGwildBsW6w">Walter Stürm – Wikipedia/ bzw. gegen die ihrer Ansicht nach zu harte Einsatzdoktrin von Polizeidirektor Schnyder gegenüber Demonstranten und Hausbesetzern richtete. Das Polizeidepartement antwortete u.a. mit einer Informationsveranstaltung im «Volkshaus»-Saal. In diesem Rahmen hatte auch ich als für diesen Bereich zuständiger Abteilungsleiter ein Referat zu halten. Die Stimmung war hoch explosiv, denn im Publikum sassen auch militante Radaubrüder. Der Anlass war durch Polizisten gesichert, weswegen ich im Vorfeld kaum Bedenken hatte. Aber im Verlaufe des Anlasses, insbesondere bei meinem Referat, war mir mulmig zu Mute. Bei dieser Gelegenheit fühlte ich mich weit stärker bedroht als bei meinen regelmässigen Visiten in den Zellen der Insassinnen und -insassen des Lohnhofgefängnisses.
1982 waren gewisse Unstimmigkeiten mit Kommissionen bezüglich Personaldotation entstanden. Umstritten war, ob die in meiner Abteilung neu geschaffene Stelle mit einem kaufmännisch-administrativen Mitarbeiter oder mit einem Juristen zu besetzen sei. Ich hatte letzteres gefordert, weil gemäss Pflichtenheft die juristischen Aufgaben dominierten. Ausserdem war ich von den Qualitäten meines juristischen Praktikanten überzeugt; ihn wollte ich dem PMD erhalten. Zehn Jahre später sollte dieser tatsächlich mein Nach-Nachfolger werden. In dieser Auseinandersetzung hatte ich – mit Seitenblick auf die Option, Verwalter der Gemeinde Münchenstein zu werden – eine Alles-oder Nichts-Strategie verfolgt. Aus diesem Grund war für mich der Bericht Nr. 15/13 der regierungsrätlichen Stellenbegutachtungskommission vom 19.04.82 nicht nur sachlich unbefriedigend. Ich empfand ihn geradezu als persönliche Niederlage. Unter diesem Eindruck sehnte ich mich wieder nach einfacheren, überschaubaren Verhältnissen mit kürzeren Entscheidungswegen, wie sie in kleineren Verwaltungen üblich sind. Auch hoffte ich, mein früheres Beziehungsnetz würde mir beim Aufbau einer modernen, bürgernahen Verwaltung in Münchenstein hilfreich sein. Hinzu kam, dass wir 1981 unsere Wohnung an Weiherhofstrasse 34 aufgegeben hatten und in das Elternhaus meiner Frau in Münchenstein gezogen waren. Für diese Wohnsitzverlegung in einen anderen Kanton hatte es damals noch einer Ausnahmebewilligung bedurft. Eine Zusammenführung von Arbeits- und Wohnort erschien mir erstrebenswert. Kurz: ich war zuversichtlich, meine Vorstellungen in meiner neuen Tätigkeit auf Stufe Gemeinde besser verwirklichen zu können als auf Stufe Kanton. Die Kunde von meinem doch eher überraschenden Wechsel war selbst hinauf ins Prättigau gedrungen, von wo mir Georg Brosi seine Glückwünsche zukommen liess, begleitet von der lapidaren Bemerkung: "Die Gemeinde hat dich wieder".
Im Rückblick zählen die fünfeinhalb Jahre im Basler Polizei- und Militärdepartement zu den anspruchsvollsten und interessantesten meines Berufslebens. Mit einer einmalig heterogenen Abteilung, zu der auch Korpsangehörige beiderlei Geschlechts gehörten, war ich als «Zivilist» gut eingebunden und genoss das Vertrauen und die Unterstützung von Regierungsrat Karl Schnyder. Dies machte es möglich, in relativ kurzer Zeit nicht nur abteilungsintern, sondern auch und darüber hinaus einiges in die Wege leiten, sowohl im Gefängnis-, als auch im Gastwirtschaftsbereich (Vorarbeiten für ein neues Gastwirtschaftsgesetz).

Ecuador
Ecuador, sagt man, wäre Südamerika in Miniausgabe: Amazonasurwald, weisse Andengipfel, Gletscher, wabernde Vulkane, fruchtbare Ebenen und karibische Sandstrände, Grossstädte am Meer wie auch in hohen Lagen, alles vergleichsweise nahe beisammen, quasi zum Anfassen. Ein bisschen wie die Schweiz mit Alpen und Jura, Mittelland und Seen und einer Alpensüdseite als Gegenstück.
Ins Land mit dieser enormen Vielfalt war ich Ende Oktober 1993 gekommen, um mein Spanisch zu perfektionieren. Mein erster Tag an der Akademie war der 2. November, ein Feiertag und damit ein Tag ohne Lektionen. An diesem Tag ehrt die indigene Bevölkerung der Stadt ihre Verstorbenen mit verschiedenen Ritualen und bunten Festen. Per Bus ging es von Quito zum Friedhof des der für seinen „Día de los muertos“ bekannten Dorfes Caldéron. Schon früh hatten sich dort Hunderte von Indigenos eingefunden und zu Ehren ihrer Verstorbenen kleine Altäre errichtet, Blumen niedergelegt und handbemalte Kreuze aufgestellt und um sich auf den Grabstätten gemeinsam mit traditionellen Speisen, Gebeten und Liedern an die Verstorbenen zu erinnern. Gemeinsam mit Familie und Freunden werden die Lieblingsgerichte der Dahingegangen genossen. Für Fremde ist dieser aus uralten Ritualen und katholischer Traditionen bestehende Totenkult sehr eindrücklich und zieht immer wieder zahlreiche Besucher an, was der Feierstimmung der Pilger keinen Abbruch zu tun scheint. Als eben erst in diesem Land Angekommener hatte ich mehr Mühe und fühlte mich als Zuschauer zunächst eher deplatziert."
Ecuador hat ausser den Indigenos noch zahlreiche weitere Ethnien mit eigenen Festen und Gebräuchen. Dem Vernehmen nach ist die Art "El dìa de los muertos"zu begehen, heute fast verschwunden. Die Ecuadorianer habe ich als äusserst freundliches Volk kennengelernt. Preisabmachungen werden eingehalten und das Herausgeld stimmt auch meistens. Vor allem in der Hauptstadt wird ein schönes, gut verständliches Spanisch gesprochen. Man sagt Ecuadorianerinnen und Ecuadorianern nach, so offen und hilfsbereit wie die Peruaner, aber so unaufdringlich wie die Bolivianer zu sein, eine echt gute Mischung. Für Fremde war angenehm zu erfahren, dass sich die Kriminalität auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau bewegte. Mehr als einmal wurde ich durch Einheimische vor Gefahren gewarnt.
MANGLARALTO Beeindruckend die Reise von Quito in die Provinz Santa Helena, die mich zunächst nach Guayaquil führte. Dann ging es per Bus in das zu jener Zeit unscheinbare Dorf Manglaralto mit wenigen Hotels und einigen Crevetten-Zuchtbetrieben. Ich fand ein bescheidenes Zimmer bei Privaten, direkt beim Strand. Abends nach meiner Ankunft wollte ich bei Sonnenuntergang meine erste Begegnung mit dem Pazifischen Ozean begehen. Ein erhebendes Gefühl, mausbein allein entlang des wundervollen Sandstrands zu gehen und das Wasser zu geniessen, bis mich eine Welle so unsanft erfasste und kopfüber in Sand steckte. Ich verlor fast die Besinnung. Der Pazifik ist eben nicht das Mittelmeer – also noch einmal Glück gehabt, vermeintlicher Gringo!
Anderntags erfolgte der Besuch des Werks von Padre Othmar Stäheli (1934 – 2020) in Manglaralto. Ihn, den gebürtigen Ostschweizer, hatte ich noch als Seelsorger in Münchenstein kennengelernt. Er bot mir spontan den Aufenthalt in der Finca an. Absolut beeindruckend, an Ort und Stelle mit eigenen Augen zu sehen und zu erleben, was Padre Othmar seit Februar 1972 in der Mission Manglaralto zusammen mit seinen Helferinnen und Helfern aufgebaut hat, um das Leben dieser in Armut lebenden Bevölkerung etwas erträglicher und lebenswerter zu machen! Ich weilte nicht nur auf der Finca, sondern auch in den Schulen und Werkstätten und war mit der Krankenschwester unterwegs in den Dörfern. Manche dieser eindrücklichen Begegnungen mit Land und Leuten sind mir richtig unter die Haut gegangen. Unvergesslich diese Herzlichkeit, diese Dankbarkeit und dieses Strahlen in den Augen, trotz Armut und beschwerlichem Leben.
VALVIDIA Bei meinen Streifzügen in der Gegend von Manglaralto bin ich eher zufällig auf Valvidia-Kultur gestossen. Diese gehört zu den ältesten Kulturen Südamerikas, die ca. 4000 v.Chr. an den Flüssen des Guayas-Becken im heutigen Ecuador blühten. Teile dieses kulturellen Vermächtnisses finden sich im Museum im Dorf Valdivia. Dort werden noch heute Keramikfiguren und Tonscherben beim Pflügen auf den Äckern gefunden. Die gefundenen Artefakte weisen auffallende Ähnlichkeiten zur japanischen Kultur auf.
(1) Erinnert mich seither an die unvergessliche Zeit in Ecuador: Artefakt aus Valvidia (H 10 cm)
GALAPAGOS Dieses Inselparadies liegt rund 1000 km vor dem Festland entfernt. Genug weit, dass sich darauf in den Jahrtausenden eine eigene Fauna und Flora entwickeln konnte. Berühmt sind vor allem die Darwin-Finken, benannt nach Charles Darwin, dem Gründer der Evolutionstheorie, der die unterschiedlichen Schnabelformen mit der Art der Nahrungsaufnahme in Verbindung brachte. Daraus schloss er, dass sich verschiedene Finkenarten aus einer Finkenart heraus entwickelt hatten.
Es ist absolut einzigartig, dass fast alle Tierarten keine Furcht vor dem Menschen zeigen und aus nächster Nähe beobachtet werden können. Man muss schon fast aufpassen, nicht über eine der urtümlich anmutenden Meeres- oder Landechsen zu stolpern. Seelöwenbabies spielen in den haisicheren Buchten, Blaufusstölpel, Rotfusstölpel und Maskentölpel lümmeln herum, Fregattvögel kreisen und, und, und. Eben ein Paradies.
Ecuador, dieses ganz besondere südamerikanische Land, hat mich vom ersten bis zum letzten Tag begeistert, nicht nur wegen seiner landschaftlichen Schönheiten und wegen seiner Mannigfaltigkeit, sondern auch wegen seinen Bewohnern. Die sieben Wochen, die ich in diesem Land und seine Inseln kennenlernen durfte, waren für mich etwas vom Eindrücklichsten. Sie haben mir, dem biederen Schweizer, etwas die Augen für eine bisher unbekannte Welt geöffnet und meine Optik verändert. Glücklicherweise ich war nicht nur als Tourist unterwegs. Gerade das Leben in Familien und in der Finca hätte ich nicht missen wollen.
DIE DÄRME VON QUITO Noch immer überkommt mich ein leises Schaudern, wenn ich mich, was selten vorkommt, an jenen Besuch in Quitos Unterwelt erinnere. Er bildet gewissermassen den Kontrapunkt zu all dem Schönen, das ich in diesem Land erleben durfte.
Quasi als Belohnung dafür, dass ich mich bei den mir so verhassten unregelmässigen Verben redlich abgemüht hatte, versprach mir eine Professora an der Academia Latinoamericana de Espanol eine Exkursion, wörtlich «etwas echt Starkes». Weil sie so streng zu ihren Schülern zu sein pflegte wie zu sich selbst trug sie bei der Studentenschaft den Übernamen »la indulgente». An einen ganz besonderen Ort der Hauptstadt wolle sie mich führen, an einen Ort, den Fremde kaum zu Gesicht bekämen. Ich war erwartungsvoll gespannt, als wir von der Eloy Alfaro Richtung Stadtrand fuhren, um dort zu Fuss in eine Art Unterwelt abzutauchen. Als ehemaliger Schweizer Festungssoldat glaubte ich bezüglich Kavernen und dergleichen an einiges gewöhnt zu sein. Doch was mir da bereits auf den Stufen zur Unterwelt, in diesen spärlich beleuchteten Gängen, auf diesen glitschigen Wegen und Stufen begegnete, überstieg alles bisher Gesehene bei weitem: allerhand trübe, neben uns mäandernde Abwässer, unzählige Tische, auf denen die sonderbarsten Materialien aufgeschichtet waren, muffig, alles gräulich in bläulich, eine begehbare gigantische Grisaille mit rötlichem Schimmer. Vorherrschend waren ein dumpfes Stimmengewirr und ein lärmiges, emsiges Treiben der an den Tischen hantierenden Männer. Der strenge Geruch verriet sogleich, wo ich gelandet war. Es konnte sich nur um eine Kuttlerei handeln. Hier wurden die in den Schlachthöfen anfallenden Innereien, wie Därme, Herzen, Lungen, nach Verwertbarem sortiert und gereinigt und wohl auch aufbereitet, um dann verkauft, um wieder verwendet zu werden. Erstaunlich nur, wie schnell man sich nach kurzer Zeit an diesen Unterwelt gewöhnt, die eigentlich einem Fellini-Film hätte entstanden sein können.
Als ich anderntags beim Morgenessen dem Ingenéro und seiner stets liebenswürdigen und verständnisvollen Teresa von meiner Spezialexkursion erzählte, geriet sie ausser sich und empörte sich echt und wortreich. Wie mir diese Frau so etwas Scheussliches hätte zeigen können, wo es in dieser Stadt doch wirkliche Sehenswürdigkeiten zuhauf gebe! Teresa hatte wohl irgendwie recht gehabt; es war gewagt, sich hier als Ausländer zu bewegen. Doch auch unter dem Äquator muss mich ein sehr starker Schutzengel begleitet und stets gut auf mich aufgepasst haben.

Das zähe Leben als Münchensteiner Gemeindeverwalter
(1983 – 2000)
SCHWIERIG, HIER KEINEN LOBSPRUCH AUF MÜNCHENSTEIN ZU SCHREIBEN
Münchenstein, Kanton Basel-Landschaft, Bezirk Arlesheim, ca. 12‘000 Einwohner, beste Lage in unmittelbarer Nähe zur Stadt Basel, mit altem Dorfteil und verschiedenartigen, attraktiven Quartieren, mit zwei Tramlinien (10 und 11) und mit einem Autobahn- und SBB-Anschluss verkehrsmässig hervorragend erschlossen, dank Bruderholz, Park im Grünen (ehemals Grün 80) und gutem Freizeitangebot in der Natur. In Münchenstein hatte ich meine spätere Frau Christa kennengelernt und hier hatten wir unsere erste gemeinsame Wohnung. Hier wurde ich 1970 erstmals politisch aktiv. Ich forderte einen gefahrenlosen Übergang der Reinacherstrasse, einer sehr stark befahrenen Ausfallstrasse und deponierte diese beim einflussreichen Baudirektor Manz in Liestal. Ein Jahr später doppelte ich mit einem offenen Brief nach und fragte ihn, was er zu tun gedenke. «Hier in Münchenstein hätte man von Ihnen in dieser Angelegenheit mehr erwartet, besonders wenn man daran denkt, wie speditiv der Autobahnzubringer behandelt wurde.» Natürlich war es verwegen, diese beiden Dinge miteinander zu verquicken. 1971 war ich am Kampf um die Einführung eines Einwohnerrats anstelle der Gemeindeversammlung massgeblich beteiligt, auch mit für die damalige Zeit unkonventionellen Mitteln, wie einem Megafon. 1972/73 war ich Mitglied des ersten Münchensteiner Einwohnerrats.
In Münchenstein hatte für uns (fast) alles gestimmt. Und es machte den Anschein, dies würde dauern, weshalb wir im Oktober 1981 nach Münchenstein zurückgekehrt und das Häuschen meiner Schwiegereltern bezogen hatten. Da benötigte ich keine lange Bedenkzeit, mich um die ausgeschrieben Stelle als Münchensteiner Gemeindeverwalter zu bewerben. Gemeinderat und Gemeindekommission konnten aus einem 16-köpfigen Bewerberkreis auswählen. Dass ich die Gemeindebelange in Theorie und Praxis kannte und in Münchenstein kein Unbekannter war, dürfte den Ausschlag gegeben haben. Meine Ostschweizer Herkunft, katholische Konfession, Parteilosigkeit sowie ein gewisser Hang zum Einzelgängertum schienen in den Hintergrund getreten zu sein, als man mich am 9. Juli 1982 einstimmig zur Volkswahl1) vorschlug, die in Wirklichkeit eine stille Wahl war. 1989 wurden wir in das Bürgerrecht der Gemeinde Münchenstein aufgenommen, für mich der anschauliche Beweis, in der Mönchsgemeinde angekommen zu sein, um zu bleiben.
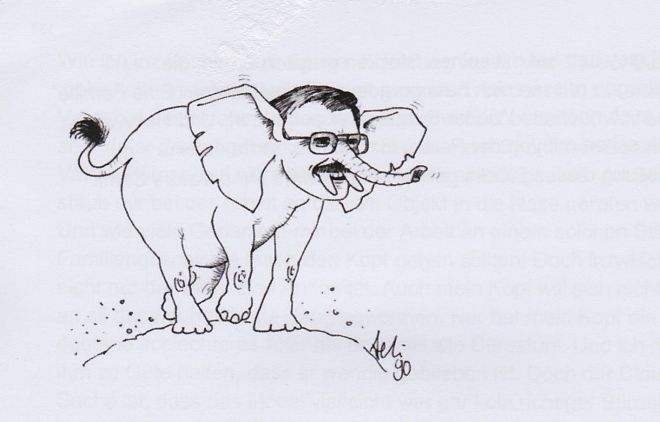
(1) HERZENSANGELEGENHEIT MÜNCHENSTEIN: Der kleine Elefant voller Tatendrang
WAS MACHT EIN GEMEINDEVERWALTER?
Was ein Gemeindeverwalter ist und was er zu tun hat, konnte ich unseren beiden Kindern Bettina und Daniel damals nur schlecht erklären. Viel besser hatten sie verstanden, womit ich mich in meiner früheren Tätigkeit als Abteilungsleiter im Basler Polizei- und Militärdepartement beschäftigt hatte. Dass ich dort als einziger einen Schlüssel besass, um während der Basler Herbstmesse für gutes Wetter zu sorgen, hatten mir die Kinder allerdings nie so richtig abgenommen. Mit einem Hinweis auf das Dienst- und Besoldungsreglement (§ 2 Abs. 2), wonach dem Gemeindeverwalter gemäss Stellenbeschrieb aus dem Jahre 1982 und Organigramm aus dem Jahre 1983 die Führung der Gemeindeverwaltung mit allen Abteilungen obliege und er Personalchef des gesamten Gemeindepersonals sei, wäre die Frage meiner Kinder nicht befriedigend beantwortet gewesen.
In den Baselbieter Gemeinden ist der Gemeinderat die oberste vollziehende Behörde, fünf oder sieben noch anderweitig berufstätige Gemeinderäte haben das Sagen. Oberhaupt der Gemeinde ist der/die Gemeindepräsident. Sie/er ist zugleich oberste/r Vorgesetzte/r der Bediensteten einer Gemeinde. Doch Gemeinden sind unterschiedlich gross und auch unterschiedlich organisiert. So verfügen alle grossen Baselbieter Gemeinden über eine bzw. einen vollamtlichen Gemeindeverwalter_in als eine Art Scharnierstelle zwischen Behörden und Verwaltung. Zunehmend ins Zentrum dieser Funktion getreten ist die Vermittlerrolle zur Öffentlichkeit (Informationstätigkeit).
In den grösseren Baselbieter Gemeinden sind die Gemeindeverwalter quasi die Chefs, jedoch mit sehr weitgehender Abhängigkeit von der Gemeindepräsidentin bzw. -präsidenten. Je nach Qualität und Temperament der Gemeindepräsidentin bzw. des -präsidenten führen diese ihre Verwaltungschef_innen an einer kürzeren oder längeren Leine. In analoger Anwendung von privatrechtlichen Regeln auf das s Verwaltungsrecht steht das Gemeindepräsidium gegenüber dem Gemeindeverwalter/der Gemeindeverwalterin in der Stellung des Arbeitgebers, weshalb für Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten auch in diesem Verhältnis die arbeitsrechtliche Treuepflicht gemäss Art. 328 Abs. 1 OR gilt.
Die Stellung des Gemeindeverwalters/der Gemeindeverwalterin zwischen Politik und Verwaltung ist nicht einfach. Daraus können sich zuweilen Zuständigkeitsfragen ergeben, die zu eigenartigen Strukturen jenseits der Organisationslehre führen und für Konfliktpotential sorgen. Damit ist der Konflikt bereits in der der bestehenden Struktur und der sich daraus ergebenden Aufgabenvermischung vorprogrammiert, d.h. die für den/die Gemeindeverwalter_in unbefriedigende Situation ist primär dem Gesetzgeber anzulasten, und zwar dem kantonalen wie auch dem kommunalen. Besonders kompliziert wird die ohnehin schwierige Situation in Gemeinden mit einem Bauverwalter als weiterem, für das Bauwesen zuständigen Chefbeamten, insbesondere wenn der Bauverwalter dem Gemeinderat direkt unterstellt ist. Da kann es schon mal vorkommen, dass der Gemeindeverwalter auch noch nach der Geige des Bauverwalters zu tanzen hat.
Beide, Gemeinde- wie auch Bauverwalter, gehören zum gemeinderätlichen Hilfspersonal (sic). Dieser Ausdruck entstammt der Amtssprache und besagt, dass es Aufgabe dieser beiden ist, dem Gemeinderat, insbesondere dem Gemeindepräsidenten, in dessen Schatten sie sich stets bewegen, zuzudienen. Beide Chefbeamten haben die Aufgabe, dem ausschliesslich aus Milizpolitikerinnen und -politikern bestehenden Gemeinderat als vorgesetzte Behörde bei der Amtsausübung zu helfen, ihn manchmal auch etwas mahnen, doch niemals zu sehr! Mit bloss beratenden Stimme im Gemeinderat sind sie bisweilen dazu verdammt, sich mit der Rolle des Bremsers oder des Rufers in der Wüste zu begnügen.
«BAMBI»-TYP
Ob, und wenn ja, welche Gedanken sich der Münchensteiner Gemeinderat damals über das künftige Zusammenspiel von Gemeinde- und Bauverwalter als den beiden ungefähr gleichaltrigen Chefbeamten gemacht hat, bleibt dessen Geheimnis. Sollte der Gemeindeverwalter als Newcomer die Kreise des Bauverwalters nur ein wenig stören – wenn überhaupt? – Offenbar schien ich für den Gemeinderat als Person einigermassen einschätzbar, zumal Grund zur Annahme bestand, ich wäre in der Zwischenzeit etwas ruhiger geworden. Dieses Gremium wollte weder einen ausgesprochenen «Macher», noch einen «Paragraphenreiter», sondern einen loyalen Schreiber und fleissigen Schaffer, der sein Licht lieber etwas unter dem Scheffel behält. Dies hatte ich in der Folge meist auch getan, weniger aus Bescheidenheit, sondern weil mir keine andere Wahl blieb als dieser «Bambi»- Wackeltier-Spielzeugfigur, die sich mit leichtem Druck bewegen und führen lässt, möglichst zu entsprechen.
(2) BAMBI. Zwei Dinge sollte ich 1993 zu meinem 50. Geburtstag vom Gemeinderat
erhalten: einen Waterman-Füllhalter als reales und eine «Bambi»-Spielfigur als symbolisches Geschenk.
Die Nachfolge auf den wegen seiner Kompetenz, seiner Gradlinigkeit und seiner Weitsicht über die Parteigrenzen hinaus anerkannten und geschätzten Amtsvorgänger Walter Ramseier (bürgerlich, parteilos) anzutreten, erwies sich als nicht eben einfach. Die Schwierigkeiten, in derart grosse Fussstapfen zu treten, unterschätzte ich etwas. Nach meiner Wahl gratulierte mir auch der Basler Architekt Wilfrid Steib2) und bemerkte, er hätte mir eine «richtige» Gemeinde gewünscht! Als ehemaliger Münchensteiner und als Architekt, u.a. des Gymnasiums Münchenstein, war er ein profunder Kenner der Gemeinde, deren Behörden und der in Münchenstein herrschenden Sitten und Gebräuche. Auch wenn ich mit seiner sibyllinischen Bemerkung damals nicht viel anfangen konnte, ist sie mir doch in Erinnerung geblieben.
(3) MUSEUM PANTHEON MUTTENZ. Ungefähr so sollte sich der neue Gemeindewerkhof in Münchenstein präsentieren, wenn es nach dem Projekt gegangen wäre, das anfangs der siebziger Jahre geplant war. Das Vorhaben fand jedoch ein jähes Ende, nachdem sich der neu eingeführte Einwohnerrat dagegen ausgesprochen hatte.
Dem langjährigen Münchensteiner Bauverwalter dürfte meine Wahl in den Einwohnerrat nicht gefallen haben. Für ihn hatte ich als Angehöriger der Fraktion LdU/Parteilose so etwas wie ein «Gschmäggle», war es doch diese Fraktion, die mit ihrem geschlossenen Widerstand das «Pantheon»-Werkhof-Projekt zu Fall gebracht hatte. Im Sommer 1982, also noch vor meinem Amtsantritt, waren wir uns anlässlich eines Empfangs im Stadttheater Basel begegnet, bei einem Empfang, den der bekannte Münchensteiner Unternehmer Walter Spengler aus Anlass seines 65. Geburtstags gegeben hatte. Ich kann mich noch deutlich erinnern, wie unterkühlt dieses Zusammentreffen mit dem Bauverwalter war..
GLEICHSAM RÜCKEN AN RÜCKEN. Anfangs 1983 sind wir beide pfeifenrauchende Verwalter. Im Übrigen hätten aber die Unterschiede grösser nicht sein können. Der Bauverwalter, seines Zeichens Bauingenieur ETH und Hauptmann der Genietruppen, hatte fast alle Trümpfe in seiner Hand: Als Amtsälterer hatte er seine Stellung unter meinem Vorgänger nachhaltig ausbauen können. Hinzu kommt, dass er von Amtes wegen mit vier der sieben Gemeinderäte (Departementschefs) mehr oder weniger eng zusammenarbeiten muss, während nur deren drei stärker auf den Gemeindeverwalter ausgerichtet sind. Jeder Departementschef ist darauf bedacht, mit seinem Chefbeamten, auf den er ja angewiesen ist, ein gutes Verhältnis zu haben. Damit ist eine unterschiedliche Haltung der einzelnen Gemeinderäte in Spannungssituationen vorprogrammiert. Schliesslich ist der Bauverwalter ein in der Wolle gefärbter Baselbieter, Mitglied der SP, jener Partei, die lange Zeit über eine Mehrheit im Gemeinderat verfügte, kompetent, eloquent, charmant, aber auch angriffig und mit einem grossen Ego ausgestattet.
SEIT JEHER EIN STRUKTURPROBLEM
Schon in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts war es in Münchenstein wegen der unklaren Aufgabenverteilung zu schweren Konflikten zwischen dem damaligen Bauverwalter und meinem Vorgänger gekommen. Mit meiner Wahl zum Gemeindeverwalter und damit zum Leiter der Gesamtverwaltung entspann sich dieser Konflikt aufs Neue, nachdem der Bauverwalter gleich zu Beginn erklärt hatte, sich dem Gemeinderat direkt unterstellt zu erachten. Punktum. Warum hatte er sich dann nicht als Gemeindeverwalter gemeldet? – Nicht weiter verwunderlich also, dass vom ersten Tag an eine latente Auseinandersetzung um Macht und Einfluss zwischen uns spürbar war. Doch ich war nicht als Einziger der Überzeugung, dass im Verlaufe der Zeit eine Lösung dieses Grundkonflikts möglich sein würde, getreu meinem nach den Erfahrungen in Klosters und Basel zurechtgelegten Lebensmotto: Und bist du nicht willig, so brauch ich Geduld.

(4) REFORMSTAU: Telefonzentrale, bei meinem Amtsantritt in meinem Büro noch in Betrieb
Die Ausgangslage, wie ich sie bei Amtsantritt am 1. Februar 1983 vorfand, forderte zu einer exakten Bestimmung der Leistungsfähigkeit der damaligen Verwaltung heraus. Die Situation war unbefriedigend, da die bestehenden Einrichtungen den gewachsenen Bedürfnissen der Verwaltung nicht mehr gerecht wurden. Da wurde beispielsweise die Einwohnerkontrolle noch immer mit einer Sichtkartei aus dem Jahre 1935 geführt; und da war auch eine störungsanfällige Adressiermaschine. Für die Gemeindebuchhaltung und das Rechnungswesen standen zwei kurz vor der Funktionsuntüchtigkeit stehende sechs bzw. neun Jahre alte Magnetkontencomputer zur Verfügung, mit denen die für die Beurteilung laufender Geschäfte notwendige Führungs- und Finanzkontrollunterlagen nicht zeitgerecht zur Verfügung gestellt werden konnten. Deshalb hatte ich mir von allem Anfang an eine fundamentale Reorganisation der internen Arbeitsabläufe zum Ziel gesetzt, einerseits wegen des bestehenden Reformstaus, zum anderen um den ständig steigenden Arbeitsanfall innerhalb der Verwaltung zu begegnen.
Mit einem Tempo, über das ich noch immer erstaunt bin, konnten wir zur Tat schreiten. Eine Fachkommission mit externen Fachberatern wurde bestellt, ein Pflichtenheft erstellt, Offerten eingeholt und, bevor man mit den Anbietern Kontakt aufgenommen hatte, eine sehr detaillierte Nutzwertanalyse ausgearbeitet. Nach den leidvollen Erfahrungen in Klosters wollte ich absolut keine Risiken eingehen. Noch im selben Jahr, in dem ich das Amt angetreten hatte, bewilligte die Gemeindeversammlung einstimmig einen Gesamtkredit von Fr. 600 000.- für die Anschaffung einer EDV-Anlage. Die Projektleitung konnte ich dem jungen Gemeindemitarbeiter Thomas Schaub übertragen. Als Nicht-Computerfachmann entwickelte er sich rasch zu einem echten Profi und führte das Computersystem in rekordverdächtigen neun Monaten praktisch ohne Schwierigkeiten ein und hat dieses auch anschliessend betreut.
Der «Neue-Besen-Effekt» erwies sich als vermeintliche Hilfe und der Vorrat an Gemeinsamkeiten mit Kollege Bauverwalter war schnell aufgebraucht. So fanden wir uns leider mit dem Rücken gegeneinander in einem quasi durch Normen vorgegebenen männlichen Konkurrenzdenken. Zwischen uns stand als unverrückbare Grösse der langjährige Gemeindepräsident im Nebenamt, nicht nur Inbegriff eines «Gmeini»-Vaters, sondern als Advokat juristisch bestens bewandert und auf meinen juristischen Rat nicht wirklich angewiesen. Zwei Juristen haben drei Meinungen, besagt ein Sprichwort. Auch wenn wir nicht immer gleicher Meinung waren, schätzte ich sein politisches Gespür, er meine Stellungnahmen. Ein sicherer Machtinstinkt ermöglichte ihm, bei verwaltungsinternen Auseinandersetzungen als Ringrichter nach der altrömischen Devise «divide et impera» (teile und herrsche) tätig zu werden.
Von Beginn an machte mir die dominierende Haltung des Bauverwalters zu schaffen. Hinzu kam, dass wir beide das «Chefsein» unterschiedlich lebten. Er führte eher autoritär, während ich dem Grundsatz nachgelebt habe, so zu führen, wie ich selbst gerne geführt werden möchte. Ich war stets bestrebt, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern relativ viel Frei- und Handlungsspielraum zu geben und von Ihnen im Gegenzug zu erwarten, dass sie diesen nutzen und mein Vertrauen nicht missbrauchen. Als Folge davon entwickelten sich auf den beiden Stockwerken der Verwaltung unterschiedliche Kulturen, immer wieder neue Schlaglöcher taten sich auf und es bildeten sich fragwürdige «Seilschaften», alles wie bereits Ende der sechziger Jahre gehabt. Doch Gemeinderat und Gemeindepräsident schienen das sich hieraus ergebende Konfliktpotential zu unterschätzen. Ich sah es als meine Pflicht, nicht auszuweichen und mich nicht permanent dominiert und blockiert zu fühlen, sondern zu reagieren, im positiven und konstruktiven Sinne etwas zu verändern, um die drohende Spaltung zu überwinden. Von mir in die Wege geleitete Projekte zur Konfliktbewältigung, wie Gesprächsgruppen unter psychologischer Leitung sowie Führungsseminare zeitigten keinen nachhaltigen Erfolg, weil Personen rund um den Bauverwalter auf meine Vorschläge im Nachhinein stets skeptisch bis ablehnend reagierten. Die verwaltungsinternen Konflikte und Kämpfe erinnerten zeitweise etwas an die US-TV-Serie «Dallas, damals ein «Strassenfeger».
Es war ein verdeckter, aber ungleicher Kampf, denn im Gemeinderat verfügte der parteimässig gebundene langjährige Bauverwalter über die bessere Lobby als der parteilose Newcomer.
1989 war es so weit: Der Bauverwalter erhielt volle Selbstständigkeit für seinen Bereich. Nach sechs Jahren wurde eine formelle Strukturbereinigung in die Wege geleitet, allerdings ohne entsprechende Bereinigung der Stellenbeschriebe! Weiterhin wurde personalisiert, instrumentalisiert und beiderseits viel Prestige in die Waagschale geworfen. An einem internen Mitarbeitenden-Seminar wurde von Teilnehmerseite als erstes das angeblich viel zu hohe Tageshonorar des Leiters beanstandet – ein wohl einmaliger Vorgang, der nur mit einer Amtsgeheimnisverletzung möglich geworden war. Bei der Präsentation eines einheitlichen Erscheinungsbildes für alle Dienstleistungen, Einrichtungen und Objekte der Gemeinde (Corporate Identity) diffamierte mich die Sekretärin des Bauverwalters in aller Öffentlichkeit, indem sie die geleistete Arbeit und mich persönlich angriff. Reine Sachfragen, wie der Ersatz der völlig veralteten Stempeluhr, das Aus- und Weiterbildungskonzept, die Einführung von Mitarbeitergesprächen, oder sogar die Darstellung von Finanzplan und Amtsbericht wurden zu Glaubensfragen emporstilisiert und entwickelten sich zu Dauerbrennern. So brauchte es beispielsweise mehrere Anläufe und fast zehn (sic) Jahre, bis ein allerseits genehmer Ersatz für die uralte Stechuhr gefunden werden konnte.
(5) Aufspiessen oder aufgespiesst werden - das ist die Frage.
Es war nicht so, dass ich bei den Auseinandersetzungen mit dem Bauverwalter stets bereits im Voraus als Verlierer festgestanden hätte. So hatte der Gemeinderat im Herbst 1986 die Weiterführung der von mir ins Leben gerufenen Gesprächsgruppe mit externer Moderation zur Klärung und Förderung der zwischenmenschlichen Beziehungen am Arbeitsplatz aufgrund einer Eingabe des Personals der Bauverwaltung mit der Begründung gestoppt, dadurch würde «unnötig Geschirr zerschlagen». Grund für die allgemeine Aufregung war ein Gerücht gewesen, der Bauverwalter hätte sich in einer anderen Gemeinde beworben. Darauf tat der Gemeinderat alles, um den Bauverwalter bei der Stange zu halten und der Machtkampf ging weiter.
LA PETITE FUGUE Nachdem ich immer und immer wieder erfolglos versucht hatte, die Basis für ein erspriessliches Zusammenwirken aller Verwaltungseinheiten zu verbessern, wagte ich im Frühjahr 1989 einen Versuch. Es ging um die Neubesetzung des Bezirksgerichtspräsidiums in Arlesheim. Anzumerken ist, dass zu dieser Zeit Richterwahlen fast ausnahmslos stille Wahlen waren, also ohne Volksabstimmung und damit Teil von Parteien-«Päckli». «Danach kann nur Richter werden, wer ein Parteibuch im Sack hat. Tatsächlich gewählt wird dann aber nicht der fähigste und geeignetste der Kandidierenden, sondern einer, der das richtige Parteibuch hat und bereit ist, seiner Partei einen jährlichen Obolus für das Amt zu entrichten. Dass eine solche Bestellung des höchsten Gerichts eines Rechtsstaats nicht ganz würdig ist, liegt auf der Hand, und Alternativen wären denkbar.»3)
Ein Komitee aus «Grünen» und «Landesring der Unabhängigen» war willens, gegen ein bürgerliches Parteien-«Päckli» und einen aus den Reihen der CVP stammenden, nicht unumstrittenen Kandidaten anzutreten und stellte mich als Gegenkandidaten auf. Ich war 46, hatte die Dreistigkeit der Jugend bereits hinter mir, war aber noch immer begeisterungsfähig, auch wenn das bereits während meiner Lehrzeit aufgekeimte Verlangen nach einer richterlichen Tätigkeit zwar etwas getrübt, aber noch nicht gestorben war. Als Parteiloser gegen ein Machtkartell anzutreten - damals ein äusserst schwieriges Unterfangen, das bei den politischen Parteien starke Reaktionen auslöste. Pikant, dass mit dem in Münchenstein wohnhaften Arnold «Schnitzge» Schneider ausgerechnet ein baselstädtischer FDP-Alt-Erziehungsdirektor und Regierungsrat in meinem Unterstützungskomitee sass.
Aus naheliegenden Gründen hatte ich den Gemeinderat nicht vorgängig über meine Absicht orientiert. Ein Fehler, weswegen sich der Gemeindepräsident im Wahlkampf veranlasst sah, sich öffentlich für meinen Gegenkandidaten auszusprechen – für mich eine schwere Demütigung und der absolute Tiefpunkt in unseren gegenseitigen Beziehungen. Doch der Wahlkampf mit all den Zeitungsartikeln, Podien und Aktionen hatte mich beflügelt: «Bambi» war dann mal weg und ich fühlte mich von meinem Komitee getragen und unabhängig. Trotz vollen Einsatzes gewann mein Kontrahent das Duell mit etwa 60 % der Stimmen, während ich als Herausforderer aus dem Stand immerhin einen Achtungserfolg erzielen konnte.
Über meine Nicht-Wahl dürfte mein Vater unglücklicher gewesen sein als ich selbst. Bestimmt nicht deswegen ist er kurz danach gestorben. Immerhin hatte ich mit dieser Aktion ein deutliches Zeichen gesetzt. Und ich war willens, meinen Misserfolg bei der Wahl in einen Erfolg in meinem Verwalter-Job umzuwandeln. Ob man bereit wäre, mir diesen zu gönnen, trotz meines «ungehörigen» Verhaltens? – Offensichtlich war ich dem Gemeindepräsidenten im Vorfeld der Wahl zu eigenmächtig erschienen. Meine Kampfkandidatur bedeutete denn auch eine Wende. Ab diesem Zeitpunkt erschien mir der Gemeindepräsident als Ringrichter voreingenommen. Die Konsequenzen meines Fluchtversuchs sollten mich in einem ohnehin schwierigen Umfeld – trotz Elefantenhaut – unverhältnismässig hart und nachhaltig treffen, doch fürs erste ging der Verwaltungsalltag weiter wie zuvor: Leiden ohne zu klagen; stattdessen alles in mich hineinfressen, um dann meine Aggressionen nach Feierabend und über das Wochenende in die Rennvelo-Pedale zu pressen.
In der Folge muss ich im Vergleich zum Bauverwalter zunehmend verkrampft, verwundbar, freudlos, manchmal sogar wie gelähmt gewirkt haben, und es traten psychosomatische Beschwerden auf. Burnout! Nur meine Frau wusste um meine Schwierigkeiten und war stets bemüht, mich jeweils wieder aufzumuntern und zu stärken. Sie war es auch, die mir trotz massenhafter Abendsitzungen ermöglichte, immer wieder Zeit für einen sportlichen Ausgleich zu finden. So richtig aufgeschreckt wurde mein engstes Umfeld, Familie, Freunde und Nachbarschaft erst durch gewisse Presseberichte. Während ich zu beschwichtigen versuchte, nahm das Unheil seinen Lauf.
Inzwischen war mein Vertrauen in die Konflikt-, Kommunikations- und Motivationsfähigkeit des Gemeinderats als oberstem Führungsorgan nachhaltig erschüttert. Deshalb hatte ich mich nach externer Hilfe umgesehen. Mein Antrag auf ein externes Coaching wurde zunächst schubladisiert, dann erhielt ich seitens des Gemeinderats den Bescheid, ein Coaching hätte durch meinen direkten Vorgesetzten, also durch den Gemeindepräsidenten (sic), zu erfolgen. Dabei wurde geflissentlich übersehen, dass der "Preesi" Teil des Problems war, insbesondere seine abnehmende Bereitschaft, den gestörten labilen Gleichgewichtszustand wiederherzustellen. Von da an zog ich bei Auseinandersetzungen regelmässig den Kürzeren und diente für gewisse Kreise immer wieder als Sündenbock. In der Folge verstärkten sich meine depressiven Zustände, ich begann, mich mehr und mehr einzumauern, meine Überstunden wurden zahlreicher und zahlreicher. An gewissen Tagen sass ich vom Morgen bis Mitternacht im Büro. Ich erinnere mich an einen Geburtstag. Niemand schien Notiz davon genommen zu haben, ein normaler Arbeitstag eben, mit abendlicher Gemeinderats- und einer zusätzlichen, demütigenden Anschluss-Sitzung. Für Verwandte, Freunde und Bekannte verstummte ich zusehends, wurde immer (schreib-)fauler, zumindest was mein Privatleben anbetraf – wahrscheinlich als Reaktion auf meine berufliche Vielschreiberei. Im Büro verbrachte ich Stunden vor dem Bildschirm, stumm wie ein Fisch, derweil meine Sekretärin kommunizierte – der perfekte Rollentausch! Frauen sind erwiesenermassen kommunikativer. Derweil hatte man im oberen Stock das Kartenspiel am PC-Bildschirm entdeckt. Mein Privatleben wie auch meine Gesundheit verschlechterten sich zusehends. Ständig mit angezogener Handbremse gefahren zu sein, rächte sich auf die Dauer. Ein Sprachaufenthalt in Quito/Ecuador Ende 1993 aus Anlass meines Fünfzigsten mit einem Besuch der Missionsstation des früher in Münchenstein tätigen Padre Othmar Stäheli in Manglaralto führte zwar subjektiv zu einer gewissen Beruhigung. Doch derweil hatte der Bauverwalter seinen Einflussbereich weiter gestärkt und ausgeweitet.
Nicht unwichtig zu wissen: Zu dieser Zeit gehörten Vormundschaftswesen, Arbeitslosen- und Zivilstandsamt noch zum Aufgabenbereich der Gemeindeverwaltungen und in Münchenstein Stabsstellen fehlten. Aus diesem Grund hatte ich beim Gemeinderat um Entlastung in den Bereichen Personal und Öffentlichkeitsarbeit nachgesucht – vergeblich. Immerhin kam mir der Ruf nach Durchführung einer Struktur- und Leistungsanalyse von Haupt und Gliedern gelegen, weil ich darin die Möglichkeit eines reformerischen Befreiungsschlags erblickte. Doch der Bauverwalter sowie ein Teil des Gemeinderates hatten das Ganze bereits im Vorfeld als unnütz oder kontraproduktiv abgetan, worauf die Gemeindeversammlung den dafür beantragten Kredit zweimal verweigerte. Darauf erhöhte die Presse den Druck auf den mir unterstellten Verwaltungsteil und nahm mich offen ins Visier.
«DEM GEMEINDEVERWALTER SCHLÄGT DIE STUNDE X / DER BAUVERWALTER GILT ALLES, ER GILT NIX.» Im Vorwahlkampf zu den Gemeindewahlen, insbesondere im Hinblick auf die Wahl eines neuen Gemeindepräsidenten, machte Martin Brodbeck4) von der «Basler Zeitung» mächtig Druck. Er stellte in der Ausgabe vom 27.01.1996 die rhetorische Frage, ob der Neue nicht «möglicherweise zu lieb wäre», den «Stall auszumisten», d.h. in der Verwaltung «für die längst fällige Remedur zu sorgen», will heissen den Gemeindeverwalter aus seinem Amt zu entfernen. Dies grenzt an Rufmord und ist für jeden Amtsträger eine berufliche und persönliche Katastrophe. Mit viel Gift und ohne mit mir vorher gesprochen zu haben, wurde damit nach aussen der Schlussstrich gesetzt. Anfangs 1997 wurden mit der Bildung einer Kommission zur Revision des Dienst- und Besoldungsreglements die politischen und rechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Nach dem Ausscheiden des noch auf einen gewissen Ausgleich bedachten Gemeindepräsidenten und «Übervaters» übernahm per 1. Oktober 1998 der neue Gemeindepräsident (ebenfalls FDP). Bereits unter seinem Vorgänger war die Zahl der «Eistage», jener Tage, an denen die emotionale Lufttemperatur stets unter 0 °C bleibt, gegen Ende für mich unerträglich hoch gewesen. Nachdem sich der neue «Preesi», vom ersten Tag an vorbehaltlos hinter den Bauverwalter gestellt hatte, wurde das Ganze für mich zu einer Art Überlebensübung im Dauerfrost.
KEIN MOBBING? – Endlich nahm die vorgesetzte Behörde das Heft in die Hand und entschloss sich, eine eigene «Analyse» durchzuführen. Projekt- und Teilprojektgruppen wurden eingesetzt, von denen einzelne eine ungeheure Eigendynamik entwickelten, derweil meine Anträge fast durchwegs auf der Strecke blieben. Der Zustand meines Verantwortungsbereichs wie auch meine Gesundheit verschlechterten sich zusehends und es kam zu krankheitsbedingten Abwesenheiten. In der Folge berichtete die BaZ von «unhaltbaren Zuständen» in der Verwaltung und zitiert Interna. Mitte 1999 fühlte ich mich dem Druck nicht mehr gewachsen, war in jeder Beziehung am Ende und suchte das Gespräch mit einer Mobbingpräventions-Spezialistin. Sie kam zum Schluss, dass klares Mobbing gegen mich vorliege und ich mich in der letzten Phase befinden würde, jener der Ausgrenzung. Und diese ist innerhalb eines halben Jahres denn auch mit letzter Konsequenz erfolgt. Was einst als Traumjob begonnen hatte, war zum Albtraumjob geworden.
AUSLAUFMODELL UND EINE ART BAUERNOPFER Im August 1999 eröffnete mir der Gemeinderat per Einschreibebrief mein Ausscheiden aus dem Gemeindedienst infolge Kündigung bzw. Ablauf der Amtsdauer per 30. Juni 2000. Ein revidiertes, in aller Eile durchgepeitschtes Dienst- und Besoldungsreglement hatte die Volkswahl des Gemeindeverwalters im Vorbeigehen abgeschafft. Und das Pikante daran war, dass mir am Ende meiner Tätigkeit das zweifelhafte Vergnügen zuteil geworden war, dazu einen ersten Reglements-Entwurf auszuarbeiten. Dieser hatte noch an der Volkswahl des Gemeindeverwalters festgehalten.
VIELLEICHT DOCH EINE SINNVOLLE LÖSUNG Mit der Abschaffung der Volkswahl des Gemeindeverwalters verschwand eine Münchensteiner Spezialität sang- und klanglos. In einem Leserbrief im «Wochenblatt» hatte ich in Übereinstimmung mit meinem Vorgänger noch einmal dagegen zur Wehr gesetzt, nicht im eigenen, sondern im öffentlichen Interesse. Hintergedanke der Volkswahl dürfte ursprünglich der Wohnsitz des Amtsinhabers bzw. der Amtsinhaberin gewesen sein. Dass Mitglieder von Gemeinderat und -kommission in der jeweiligen Gemeinde stimmberechtigt sein müssen und für diese Amtsträger die Residenzpflicht gilt, scheint unbestritten. Dies sollte aber auch für den/die Gemeindeverwalter_in gelten. Als Gemeindeeinwohner_in sind ihm/ihr die spezifischen Anliegen und Sorgen der Bevölkerung näher. Daher macht es durchaus Sinn, zu verlangen, dass für diese Funktion Lebensmittelpunkt und Wirkungsort zusammenfallen und der/die Gemeindeverwalter_in auf Vorschlag des Gemeinderats durch das Volk gewählt und bestätigt werden sollte. Je nach Zusammensetzung des Gemeinderats trifft das Volk wahrscheinlich sogar die bessere Wahl.
Anfangs November 1999 wurde ich vom Gemeinderat freigestellt. Damit wurde ich als Allein-Schuldiger dafür gebrandmarkt, dass sich zwei Verwalter während langer Jahre aus ihrer Umklammerung nicht lösen konnten. Was in einem solchen Fall angesagt gewesen wäre, nämlich ein Neuanfang mit zwei neuen Kräften, egal welche brillanten Qualitäten die beiden haben, egal wieviel Prozent Fehler wer gemacht hatte, war für den Gemeinderat kein Thema. Nicht weiter erstaunlich, denn wie das Exempel zeigt, ist politisches Konfliktmanagement in Gemeinden landauf landab so gut wie nicht vorhanden. Hinzu kam, dass der nicht eben einfühlsame neue Gemeindepräsident von Anfang an unter Druck stand und einen raschen und sichtbaren Erfolg brauchte. Aus diesem Grund hatte er bereits von Anfang an voll und ganz auf den Bauverwalter gesetzt - arbeitsrechtliche Treuepflicht hin oder her. Der Paukenschlag erfolgte – ausgerechnet im Theoriesaal der Feuerwehr – am 8. November 1999, wo das neue Gemeindeoberhaupt und ein (fast) vollzählig anwesender Gemeinderat der als Interims-Verwalterin vorgesehenen Dame ihren ersten öffentlichen Auftritt ermöglichten. Bei dieser Gelegenheit hatte man auch mir fünf Sätze zugestanden. Danach war ich auf einen Schlag von sämtlichen Kontakten zu Arbeitskolleginnen und -kollegen und Kunden abgeschnitten. Kurz darauf lieferte mir die Gemeindepolizei meine im Büro verbliebenen persönlichen Gegenstände aus, während ich im Gegenzug die Schlüssel abzugeben hatte. Im «Wochenblatt», dem amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde, erschien eine dürre, ganze 80 Wörter umfassende amtliche Mitteilung mit folgendem Schluss: «Der zurücktretende Gemeindeverwalter Pius Helfenberger hat an vorderster Front die gedeihliche Entwicklung von Münchenstein miterlebt und seinen Beitrag zur Schaffung einer zeitgemässen und bürgernahen Verwaltung geleistet. Für seine Tätigkeit im Dienste aller danken wir ihm an dieser Stelle bereits heute.» Kurz danach erfolgte eine Medienmitteilung der FDP Münchenstein. Darin begrüsste die Partei den einstimmigen Entscheid des Gemeinderates, das Arbeitsverhältnis mit dem Gemeindeverwalter nach Ablauf der Amtsperiode im gegenseitigen Einvernehmen nicht zu erneuern und ihn krankheitsbedingt sofort freizustellen. Die FDP erkannte darin «eine offene und ehrliche Information der Bevölkerung» durch den Gemeinderat» und einen «mutigen Schritt» in die richtige Richtung, nämlich hin zu einer «Modernisierung der öffentlichen Verwaltung zu einem Dienstleistungsbetrieb». Der Wind hatte vollständig gedreht. Mit Wehmut erinnerte ich mich an den Satz, den der seinerzeitigen FDP-Präsidenten Dr. Bruno Hofer zehn Jahre zuvor im Zusammenhang mit meiner Gerichtspräsidenten-Kandidatur geschrieben hatte: «Allerdings muss ich hinzufügen, dass es nicht leicht fallen kann, beizutragen, dass unsere Gemeinde einen fähigen Gemeindeverwalter verliert! Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihren weiteren beruflichen Weg, sei es in der angestrebten neuen oder in der vertrauten derzeitigen Funktion».
Hier endet also die Geschichte des 5. Münchensteiner Gemeindeverwalters ziemlich abrupt und als Auslaufmodell.
Die Volkswahl war für mich etwas anderes als eine «normale» öffentliche Anstellung gewesen. Sie war schon gar kein Tauschgeschäft, bei dem man meine Leistung gegen einen Preis verkauft, der sich nach Angebot und Nachfrage richtet. Wie mancher meiner Generation hatte ich wohl einen etwas überkommenen Treuebegriff und darüber hinaus Illusionen hinsichtlich der Volkswahl. Ich hatte mich nicht durch eine anonyme Organisation gewählt erachtet, sondern durch einen Wahlkörper, der mir sehr wohl zu einem Gefühl oder einer moralischen Haltung fähig erschien. Ich musste erkennen, dass Pflichtbewusstsein, Unterordnungswille, Hang zum Perfektionismus und Diplomatie offensichtlich immer weniger gefragt sind. Personen, die diese Werte verkörpern, laufen Gefahr, unter die Räder zu kommen, wie Fälle auch aus andern Gemeinden zeigen. Während ich den «sozialen Tod» erlitt, konnte der Bauverwalter bis zu seiner regulären Pensionierung im Jahre 2002 zur Höchstform auflaufen. Trotz allem sind wir in Münchenstein wohnhaft geblieben und haben hier weiterhin Steuern und Abgaben entrichtet. Und wir durften in der Folge erleben, dass auch in Münchenstein Bäume nicht in den Himmel wachsen. Dies dürfte sich der Gemeinderat damals wohl nicht ganz so vorgestellt haben. Aber das ist eine andere Geschichte.
FÜNFZEHN MINUTEN RUHM So viel Zeit würde jedem Normalsterblichen zustehen, liest man häufig. Wo also ist denn diese Viertelstunde in meiner Münchensteiner Zeit zu verorten? – Meinen medienwirksamsten Auftritt hatte ich im Münchensteiner Hofmattsaal am 11.09.1989 anlässlich der «Supergant». Zum Verkauf standen nicht weniger als 124‘000 Quadratmeter Land im Münchensteiner Heiligholz». Dieses an der Grenze zu Reinach unweit der 11er-Tramlinie gelegene Gebiet bildete die letzte grosse Baulandreserve der Gemeinde Münchenstein und zugleich auch des unteren Birstals. Verständlich, dass sich die Münchensteiner 1984 an der denkwürdigen Gemeindeversammlung gegen die Überbauung dieses Gebiets ausgesprochen haben. In der Folge wurde das Gebiet gegen den Willen der Landeigentümer etappiert, wogegen sie sich bis vor Bundesgericht gewehrt hatten. Ich hatte also eine in jeder Hinsicht komplizierte und auch heikle Veranstaltung als Gantmeister zu leiten. Es stand nämlich die Vermutung im Raum, die Grundeigentümer hätten gar kein echtes Verkaufsinteresse und führten die Gant nur zur Verbesserung ihres Rechtsstandpunktes durch. Bei dieser Gemengelage befand ich mich als Münchensteiner Gemeindeverwalter in einem Zwiespalt. Es ging mir zunächst um die korrekte Durchführung einer öffentlichen Versteigerung. Als Gemeindebeamter war ich aber auch gewissermassen (Gegen-)Partei, zumal ich von Anfang an die Auffassung vertreten hatte, dass es damals unsinnig wäre, dieses Land einer Überbauung zuzuführen. Deshalb hatte ich volles Verständnis für den geballten Widerstand, der die Gemeinde vor einer schlechten Überbauung bewahrt hatte. Gut, dass die Angebote an der Versteigerung nicht den Vorstellungen der Grundeigentümer entsprachen Deshalb machten sie umgehend von ihrem Verzichtsrecht Gebrauch. So endete die Gant ebenso ergebnislos wie das Hornberger Schiessen, nämlich völlig ergebnislos!
Nach meinem Ausscheiden aus dem Gemeindedienst war der Bauverwalter der einzige am Gemeinderatstisch, der die Heiligholz-Geschichte aktiv miterlebt hatte und gründlich kannte. Damit war die Abhängigkeit vom Bauverwalter in einem für die Entwicklung der Gemeinde sehr wichtigen Dossier Tatsache und wurde vom neuen Gemeindepräsidenten auch so bestätigt.
SPORT IST NICHT MORD – IM GEGENTEIL! Regelmässiges, intensives Velofahren hat mir das (Über-) Leben gerettet. Davon bin ich überzeugt. Zwar wurde bei mir schon bald nach meinem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Gemeindedienst ein Eingriff am Herzen notwendig. Dabei zeigte sich jedoch, dass sich durch die jahrelange, intensive sportliche Betätigung ein natürlicher Bypass gebildet hatte. Ohne diesen hätte ich wohl schon vorher einen Herzinfarkt erlitten. In diesem Zusammenhang ist mir eine dieser abendlichen Ausfahrten in nachhaltigster Erinnerung geblieben. Diese führte mich Richtung Bad Schauenburg, wo ich mich wegen eines sehr nachhaltigen Bedürfnisses in die Büsche schlagen musste. Beim Überstreifen des engen Velo-Trikots war mein Schlüsseletui unbemerkt zu Boden gefallen. Fatalerweise befand sich darin auch der Generalpass der Gemeindeverwaltung. Zerknirscht meldete ich beim nächsten gemeinsamen Gespräch mit dem Gemeindepräsidenten und dem Bauverwalter den Verlust. Innerlich war ich überzeugt, die Schlüssel noch zu finden. In der Folge war ich Abend für Abend zu diesem Waldstück gepilgert und hatte dieses systematisch abgesucht, um schliesslich – zumindest in dieser Beziehung – für meine Hartnäckigkeit belohnt zu werden!
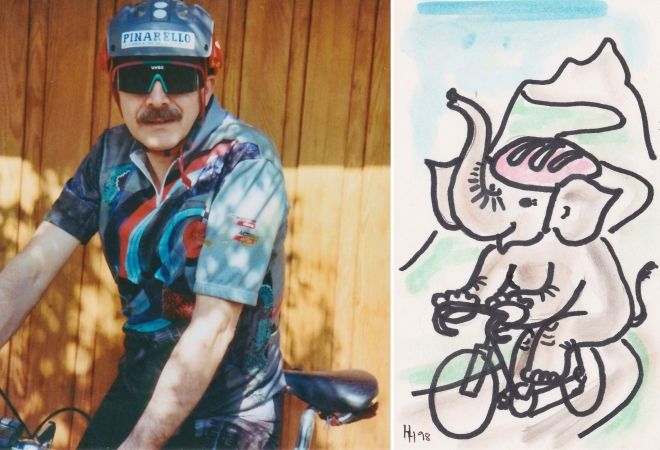
(6) Bereits von Kindsbeinen an ständiger Begleiter des kleinen Elefanten: das Velo
Seit 1983 habe ich dem Verband Basellandschaftlicher Gemeindeverwalter und – schreiber_innen angehört, während längerer Zeit auch dessen Vorstand. Als Ehrenmitglied werde ich auch nach meinen Ausscheiden zum Glück noch immer zu den Verbandsveranstaltungen eingeladen. Seltsamerweise bin ich an keiner dieser Veranstaltungen meinem Amts-Nach-Nachfolger begegnet. Geschätzt hatte ich auch die Kontakte im Rahmen der Schweizerischen Konferenz der Stadt- und Gemeindeschreiber (SKSG), dessen Vorstand ich auch kurz angehörte. Die SKSG- Generalversammlungen waren und sind immer ein tolles Erlebnis und eine Gelegenheit für Erfahrungsaustauch und (Wieder-)Begegnungen.
(7) Mit dem Zuger Stadtschreiber Arthur Cantieni anlässlich SKSG-GV 2010 in Chur
FRAGEN AM ENDE MEINER BERUFLICHEN TÄTIGKEIT Hätte ich angesichts der alles dominierende Unvereinbarkeit diese Stelle nicht annehmen dürfen oder diese gleich wieder verlassen sollen, weil ich von Anfang an zu wenig politischen Rückhalt und Unterstützung ausserhalb meines Bereichs genoss und deshalb in einem «Sandwich» steckte? – Im Nachhinein zu sagen, dass es in Münchenstein nicht funktionieren konnte, wäre zu kurz gegriffen. Klar ist: Wegen der ungelösten Strukturprobleme und der sich daraus ergebenden Unversöhnlichkeit waren die Voraussetzungen alles andere als erfolgversprechend.
Bestimmt war es ein Fehler, zu lange geschwiegen und erst am Schluss Klartext geredet zu haben. Erst nachdem sich der Gemeinderat geweigert hatte, in seiner Verlautbarung zu meinem Ausscheiden auch nur ein Sterbenswörtchen zu den Ursachen zu sagen, hatte ich die Presse mit zwei Medientexten dokumentiert, die recht viel Staub aufwirbelten. Sogar «TeleBasel» zeigte sich für ein Gespräch interessiert, doch musste ich aus gesundheitlichen Gründen eine Mitwirkung ablehnen, worauf sich der alte und der neue Gemeindepräsident sowie der Bauverwalter mit meinen Vorwürfen konfrontiert sahen. Darauf angesprochen, argumentierte der Bauverwalter im Wesentlichen gleich wie in der «Basler Zeitung» vom 9. November 1999 nachzulesen ist. Er räumte erhebliche Differenzen mit dem Gemeindeverwalter ein, unter gleichzeitigem Verweis auf seine hervorragende Zusammenarbeitet mit meinem Vorgänger. Dieser wäre in seiner Domäne tätig geblieben, während sich sein Nachfolger rasch in seine Kompetenzen eingemischt habe, insbesondere bei den Personaldossiers. Anfänglich hätte er dies geduldet, dann jedoch die mangelnde Führungskompetenz des Gemeindeverwalters erkannt. In der Folge wäre es in dessen Zuständigkeitsbereich zu einem Führungsvakuum gekommen, was dazu geführt hätte, dass der frühere Gemeindepräsident «praktisch zum zweiten Gemeindeverwalter» geworden» wäre.
Es lohnt, die erste Aussage des Bauverwalters etwas näher zu betrachten. Für ihn stand am Anfang eine «Kompetenzeinmischung» seitens des Gemeindeverwalters und Personalverantwortlichen hinsichtlich der Personaldossiers. Zutreffend ist, dass ich kurz nach meinem Amtsantritt eine Zusammenführung aller Personaldossiers und deren zentrale Aufbewahrung beim Gemeindeverwalter als Personalchef angeordnet hatte. Diesem Begehren war der Bauverwalter damals zwar nachgekommen, doch muss daraus unbemerkt ein weiterer Funke mit tiefgreifender Wirkung entstanden sein – offensichtlich Ursache des eskalierenden Grundkonflikts. Anders wäre die mehrfache Nennung dieses Vorkommnisses nicht erklärbar. Auch wenn Personaldossiers zu dieser Zeit einzig in Papierform existierten, hätte es möglich sein müssen, offen über das Problem zu sprechen und darauf eine für alle Beteiligten befriedigende Lösung zu finden. Stattdessen war bereits in den ersten Wochen meiner Amtstätigkeit unbemerkt ein während 16 Jahren andauernder Schwelbrand entstanden. Mit diesem Begriff hatte «Telebasel» seinen TV-Beitrag in der Sendung «7vor7» treffend und ganz ohne Fragezeichen überschrieben. Um im Bild zu bleiben: Wenn nicht bereits anfangs der siebziger Jahre mit dem Scheitern des «Pantheon» war der erste Funke spätestens unmittelbar nach meinen Amtsantritt entstanden. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, wollten die Verantwortlichen dies bis zuletzt weder sehen noch wahrhaben und schon gar nichts dagegen tun. Anstatt alles hinzunehmen, hätte ich gegenüber dem Gemeinderat die Probleme deutlich benennen und auf Neben- und Wechselwirkungen und hinweisen müssen, insbesondere nachdem mir die verlangte Hilfe und Unterstützung für meine Lösungsversuche mehrfach verweigert worden waren. Durch den Dauerkonflikt sind all die Jahre materielle und physische Ressourcen vernichtet worden, was der Gemeinderat zunächst in Kauf genommen und am Schluss ebenso in Abrede gestellt hat wie die Mobbingvorwürfe.
Die Tätigkeit in einer Kommunalverwaltung hatte mich seit meiner Lehrzeit in Gossau/SG fasziniert, auch wenn es belastend ist, ständig unter den Augen der «Kundschaft» und damit unter Dauerbeobachtung zu leben. Ein auswärtiger Wohnsitz des Gemeindeverwalters wäre zu dieser Zeit undenkbar gewesen. Durch die Erziehung zur Schweizer Perfektion und durch das soziale Umfeld war ich bestrebt, alles allen recht und stets zu 100 Prozent richtig zu machen, was nicht selten Ursache für Frustration, Wut, Ohnmacht und Depression sein kann. Trotzdem konnte ich mir kaum etwas Vielfältigeres vorstellen als gerade das Amt eines Verwalters: Verwaltungsfachmann für Verwaltungs- und Rechtsfragen (Protokoll, Information und PR, Personal und Kapital als wichtigste Ressourcen, Berater/in der ihn/sie umgebenden Politikerinnen und Politiker). Im Verlaufe der Jahre hatte ich mich immer wieder gefragt, ob ich die nötigen fachtechnischen und gesundheitlichen Anforderungen noch erfülle, war bestrebt, mich auf dem Laufenden zu halten, für die eigene Gesundheit zu sorgen, Beschränkungen und Grenzen zu erkennen und dann und wann über den eigenen Schatten zu springen.
Natürlich war ich immer wieder skeptisch, doch konnte und wollte ich mich nicht auf mein Bauchgefühl verlassen, zu früh resignieren und davonlaufen. Allen Widrigkeiten zum Trotz hatte ich mich in Münchenstein die meiste Zeit wohl und einigermassen verwurzelt gefühlt. Kommt hinzu, dass meine Frau in Münchenstein aufgewachsen ist, wir hier unseren ersten ehelichen Wohnsitz und zwei Kinder hatten, die hier zur Schule gingen, nebst vielen Freunden und Bekannten. Innerlich hatte ich mich damit abgefunden, von einem gewissen Alter an in dieser Funktion nichts anderes übrig bleibt, als weiterzumachen, sich als «ausgebrannte» Führungskraft mit den Wechselfällen der Politik abzufinden, im vorgerückten Alter zur «öffentlichen Angelegenheit» gemacht und schliesslich als «Versager» abgestempelt zu werden, der kaum noch eine verantwortungsvolle Tätigkeit ausüben kann. Wohl dem, der sich beizeiten gewisse Alternativen oder finanzielle Reserven für diesen Fall schaffen kann. Widrigenfalls droht die harte Landung «auf der Strasse» oder, wie in meinem Fall, in einer mit Existenzängsten verbundenen Ungewissheit, dann in der Arbeitsunfähigkeit. Und währenddessen kann sich der Gemeinderat in Unschuld die Hände waschen und sich auf die Suche nach einem/einer neuen Gemeindeverwalter_in machen.
Vieles war in Münchenstein nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Einiges hätte ich mir nicht mal in meinen schlimmsten Träumen vorgestellt, etwa das scheinbar unlösbare Strukturproblem und die damit verbundene dauernde Auseinandersetzung um Macht und Einfluss. Wegen dieses Dauerkonflikts geriet ich mehr und mehr in eine Sackgasse und vermochte schliesslich nichts mehr zu bewegen. Schlimmer noch: Meine starke Seite (volles Engagement für die Sache), mit der ich in meiner bisherigen Karriere stets erfolgreich gewesen war, wurde mir als Charakterfehler ausgelegt.
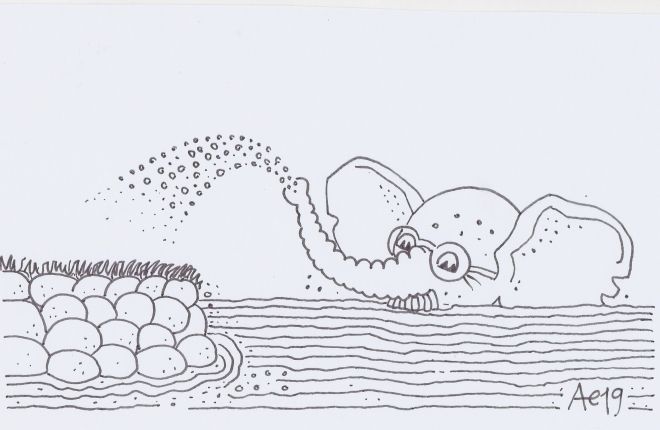
(8)
Erschwerend kam hinzu, dass der Gemeindepräsident an der unzweckmässigen, weitgehend veralteten Verwaltungsorganisation mit separater und damit zu stark gewichteter Bauverwaltung festhielt und überzeugt war, den Dauerkonflikt allein und mit «Feuerwehrübungen» lösen zu können. In einer derartigen Situation hätte es dringend einer aktiven Gesamtbehörde mit Führungsqualität bedurft. Nötig gewesen wäre ein Gemeinderat, der nach einer nachhaltigen Lösung gesucht hätte, wie dies in anderen Gemeinden Mitte der neunziger Jahre der Fall war, z.B. in Pratteln, Allschwil und Laufen. Münchenstein war die einzige Gemeinde, in welcher (noch) der Bauverwalter den Ton angab. Und nicht zuletzt: Die Kultur des Aussitzens von Problemen auf höchster Ebene hatte dazu geführt, dass auch in den für mich zentralen Bereichen, wie persönliche Stellvertretung und Sekretariat, Probleme ungelöst blieben. Ich musste davon ausgehen, mit meinen Lösungsvorschlägen im Gemeinderat hochkant zu scheitern, weshalb auch hier alles beim Alten blieb.
In diesem Zusammenhang stellt sich unweigerlich die Frage nach der Rolle der Kontrollorgane. Als hilfreich hatte ich die Geschäftsprüfungskommission (GPK) empfunden. Sie hatte bereits 1988 Klartext gesprochen. In ihrem Bericht vom 8. April hatte sie nämlich dem Gemeinderat vorgeworfen, dem «Nichtfunktionieren der zwischenmenschlichen Beziehungen» zwischen den beiden Verwaltern nicht mit wirklich tauglichen Mitteln begegnet zu sein. Nur hätte die GPK hartnäckiger sein und bleiben müssen. Bei Gemeindekommissionen ist Kontinuität leider nicht immer gegeben.
Meine Tätigkeit hatte ich trotzdem während langer Jahre geliebt. Für meinen Bereich der Allgemeinen Verwaltung konnte ich auf ein bewährtes Team zählen. Zusammen mit meinen Abteilungsleitern durften wir manchen Erfolg verzeichnen. Eine an der Gewerbeausstellung
GAM 97 unter dem Titel «Mit dem Ohr an der Bevölkerung» durchgeführte Umfrage zeigte einen hohen Zufriedenheitsgrad der Münchensteiner_innen mit ihrer Gemeinde und deren Verwaltung. Bis zum Schluss fühlte ich mich von der Münchensteiner Bevölkerung, von der ich gewählt und regelmässig bestätigt worden war, von einer buntscheckigen «Kundschaft» getragen. Zu ihr hatte sich all die Jahre auch wegen unserer Berichterstattung von den Gemeinderatssitzungen und meiner Kolumnen im «Wochenblatt» (amtlicher Anzeiger) eine gute Beziehung aufbauen können. Im Grunde genommen hätte ich mir keine wirkliche Alternative vorstellen können, ausser einer richterlichen oder einer Tätigkeit als Ombudsmann. Doch diese Opportunitäten waren wegen meiner Parteilosigkeit nicht erfolgsversprechend.
Klar, dass ich in meinem nächsten Leben so Einiges anders machen würde. Als «Zudiener» von Politikerinnen und Politikern unterschiedlicher Couleur sah ich mich immer wieder vor die Wahl gestellt, Farbe zu bekennen. Um alles in der Welt wollte ich nicht als voreingenommen erscheinen, stets der Unparteiische sein und bleiben. Doch war es falsch, mich strikt jeglicher Vereinnahmung durch Parteipolitik zu entziehen und selbst die Mitgliedschaftsanfrage eines Serviceclubs negativ zu beantworten. Entgegen meiner Natur hatte ich mich wie die Wackelfigur «Bambi» stets verbogen. Aus heutiger Sicht erscheint mir mein Hang nach grösstmöglicher parteipolitischer Unabhängigkeit problematisch. Mein Versuch, mich zu einer Zeit, in der politische Parteien bestimmend waren, als Parteiloser um ein Richteramt zu bewerben, erfolgte zu früh und wurde von den Politikern der etablierten Parteien übel genommen. Mit meiner Kandidatur hatte ich mich von Anfang an auf verlorenem Posten befunden. Mit einer politischen «Grossfamilie» im Rücken wäre mein damaliger Versuch anders verlaufen. Davon bin ich heute überzeugt.
Ich denke, es meinen Kontrahenten oft ein Stück weit zu einfach gemacht zu haben und deshalb für sie ein leichtes Opfer gewesen zu sein. Deshalb auch der Vorwurf, ich wäre «zu nett» für den Posten gewesen. Anstatt den Platzhirsch rechtzeitig bei den Hörnern zu packen, hatte ich stets meine Einsteckfähigkeiten entwickelt. Doch Einstecken nützt nur, wenn man auch austeilen mag. Auch wenn es für einen Beamten heikel ist und er schnell Gefahr läuft, «aus dem Nähkistchen zu plaudern», hätte ich die unmögliche Situation frühzeitig und mit aller Deutlichkeit beim Namen nennen müssen. Ohne «Lobby» im Hintergrund wäre dies nicht zu schaffen gewesen.
Herbstlicher Rückblick auf Münchenstein
Wie keine zweite im Jahr hat es mir die Herbstzeit angetan, schon seit jeher. Ich liebe diese meist verhalten beginnenden Herbsttage mit dem zunächst etwas bewölkten Himmel, wo sich das Blau immer stärker durchsetzt und schliesslich die goldene Herbstsonne alles überstrahlt und eine köstliche Wärme verbreitet, die mich grenzenlos erfüllt. Gut möglich, dass mich diese Stimmungen besonders berühren, weil ich in der Mitte des Weinmonats meinen Geburtstag feiern darf, dieses Jahr meinen 75., und dies bei zum Glück guter Gesundheit. Die zeitliche Spanne, die ich im Ruhestand erleben durfte, ist bereits länger als die an der Spitze der Münchensteiner Verwaltung verbrachte Zeit. Für mich jedenfalls die richtige – und auch höchste – Zeit, mich dem Wagnis zu stellen. Und ein Wagnis war es für mich allemal, mich nochmals mit dieser letzten, äusserst schwierigen Phase meiner beruflichen Tätigkeit auseinanderzusetzen, diese niederzuschreiben, weder als späte Rechtfertigung, noch als Anklage, sondern zwecks Versöhnung, um dieses schwierige Dossier danach abzulegen zu können. Die erlittenen Traumata zu verarbeiten, dies allein hatte mir bereits unsagbar viel Zeit und Kraft abverlangt. Es musste viel Wasser die Birs hinunterfliessen, bis ich mit allen Fasern meines Wesens realisierte, dass die schwere Last, die ich während siebzehn Jahren getragen hatte, endgültig von mir gefallen war. In diesem Prozess erschienen Milena und Martina, unsere beiden Enkelkinder, im Jahr 2001 bzw. 2008 als Geschenk des Himmels gerade zur rechten Zeit. Jetzt konnte ich mich wirklich Wichtigem, der Familie mit meiner Frau, unseren Kindern und den beiden Enkelinnen Milena und Martina widmen. Endgültig war nicht mehr die Verwaltung Lebensmittelpunk, sondern Familie, Garten, Küche, Keller und Lebensmittel. Punkt.

(9) Zum Glück nicht nur der Mann fürs Grüne (Juli 2014)
VERSÖHNUNG? Man verstehe mich richtig: Nicht Versöhnung mit dem damaligen Gemeinderat und der verwaltungsinternen Gegnerschaft von damals, sondern zwecks Versöhnung mit mir.
Der Begriff der Selbstversöhnung ist kein neumodischer, findet er sich doch bereits seit 1854 im Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm und kann nur als fortwährender und überall bestimmender Prozess verstanden werden. Dieser Selbstversöhnungsprozess hat mich dazu geführt, zu verstehen, was ich all die Jahre mit mir geschehen liess, nämlich meinen Gegnern zu erlauben, so mit mir umzugehen, mich immer und immer wieder «anzunagen», so wie Wespen herbstliche Trauben.
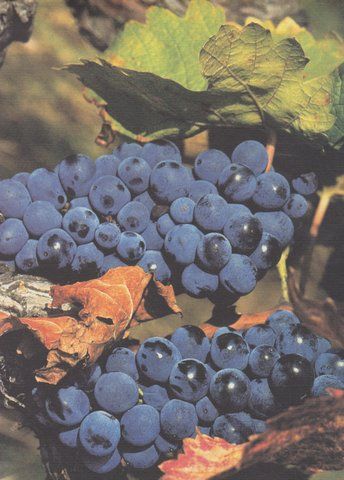
(10)
Diese herbstliche Metapher finde ich sehr passend, sie gefällt mir. Der erste Teil meiner Lebenserinnerungen befasst sich denn auch mit meinen Wurzeln und den ersten 20 Jahren Lebensjahren, mit meiner im St. Gallischen Fürstenland verlebten Jugendzeit. Für diese Wurzeln bin ich dankbar, und auch ein wenig stolz darauf, wie gut der Rebstock gerade während der schwierigen Münchensteiner Jahre der Umwelt getrotzt hat. Natürlich hätte ich mir damals eine dickere Borke und dickere Haut für meine Früchte gewünscht, mehr Wolf und weniger Bambi! Aber ich habe mich stets an das Ermutigungslied von Wolf Biermann erinnert, insbesondere die Zeile „Du, lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich. Du, lass dich nicht verbittern.“
ETWAS IM LEBEN HINTER SICH LASSEN BEDEUTET NICHT, DASS MAN ES VERGISST, SONDERN NUR, DASS MAN AKZEPTIERT, WAS GESCHEHEN IST, UND WEITERLEBT.
Kleine Nachlese aus dem Jahre 2002: Hickhack um Hecken-Höhe
Von Martin Brodbeck (BaZ 13.10.02)
Ein seufzender Gerichtspräsident, ein zorniger Bürger und ein zerknirschter Gemeindebeamter. Vor dem Baselbieter Kantonsgericht ist gestern ein Fall behandelt worden, der die Züge eines absurden Theaters annimmt. Ausgelöst hat es ein zorniger Bürger. Doch sein Zorn ist begründet. Unglaublich, wie amtsschimmelhaft er von den Münchensteiner Behörden behandelt wird. In der schönsten Ecke Münchensteins besitzt der Mann eine Traumvilla. Dahinter verläuft der Wanderweg nach Arlesheim. Mit einer über zwei Meter hohen Hecke schützt er sich vor den neugierigen Blicken - aber nicht mehr lange. Direkt hinter der Hecke hat der Verkehrs- und Verschönerungsverein ein Bänkli aufgestellt. Mit Blick auf die Hecke. Dabei würde eine Aussichtszone den Rotsocken die freie Sicht übers Birstal bis hin zu Jurahöhen und Vogesen garantieren. Der Verkehrsverein motzt bei der Gemeinde. Deren Bauausschuss trampelt durch die Gegend - ohne den Eigentümer anzuhören. Per Verfügung will die Bauverwaltung daraufhin die ungesetzliche Hecke auf 1,6 Meter zurückgestutzt haben. Erst später kommt es zur Aussprache, was die Juristen «Heilung» vom zuvor verweigerten rechtlichen Gehör nennen. Doch es ist zu spät. Die Fronten sind verhärtet. Was eine bürgerunfreundliche Verwaltung auslösen kann - das Gerichtsverfahren ist ein Lehrstück dafür. So beherrscht der zornige Bürger auch auftritt: In seiner Verletztheit zielt er übers Ziel. Nur 13 Wanderer habe er am letzten Wochenende gezählt - da gebe es doch kein öffentliches Interesse an der Aussicht. Nur: Trotz den wenigen Leuten fühlt er sich in seiner Intimsphäre gestört, falls er seine Hecke zurückstutzen muss. Na ja. Das Gericht rückt die Proportionen zurecht und lässt ihn abblitzen. Aber für das Vorgehen der Münchensteiner Behörden gibt es nur Unverständnis. In der Tat: Wie viel einfacher wäre es gewesen, wenn ein netter Gemeindevertreter den Villenbesitzer an der Hand genommen hätte. Ihm gezeigt hätte, dass er an der Grundstückgrenze nur eine 1,2 Meter hohe Hecke haben dürfte, somit gut wegkommt und in der schönsten Ecke von Münchenstein nach wie vor schön abgeschirmt leben kann. Und die Moral von der Geschieht? Wie glücklich muss ein Land sein, dessen Juristen sich einen halben Tag lang mit ein paar Zentimeter Thuja beschäftigen dürfen. Mit einem zerknirschten Gemeindebeamten vor sich, der Besserung gelobt - bis zum nächsten Fall.
Leserbrief von Bernhard Wittmer, alt Gemeinderat, Münchenstein in Form eines Offenen Briefes an BaZ-Redaktor Martin Brodbeck4)
Sehr geehrter Herr Brodbeck: Tja, den zupackenden Haudegen vom Schlage eines R.Z, gibt es in der Münchensteiner Verwaltung nicht mehr. Sie werden dies bedauern, auch wenn derselbe Bauverwalter bei den Paragraphen mehr als genug stolperte. Und den netten Gemeindeverwalter, der den Villenbesitzer bei der Hand hätte nehmen können, gibt’s schon länger nicht mehr.
Sie kennen wohl wie kein Zweiter den Münchensteiner Wurstkessel. Und auch Sie kommen mit Einwohnerinnen und Einwohnern ins Gespräch und lesen das «Wochenblatt» In der Verwaltung wie auch in der Bevölkerung rumort es, so stark wie es in Münchenstein schon lange nicht mehr rumort hat. Ein Gemeinderat, der Probleme lieber auflistet und schubladisiert, mit einem netten aber völlig überforderten Gemeindepräsidenten an der Spitze, der die Bevölkerung nicht mehr regelmässig informiert und einer Blow-up-Gemeindeverwalterin und einem Schreibtischstrategen als Bauverwalter. Ich befürchte, dass die Münchensteiner Pflastersteine demnächst auf deren Erfinder zurückfallen.
Bernhard Wittmer (1930-2021), BaZ 12.11.2002
1)Als einziger Beamter unterstand der Gemeindeverwalter bis 2000 der Volkswahl, während die übrigen Beamten durch den Gemeinderat gewählt wurden.
2)https://deu.archinform.net/arch/1627.htm
3)Markus Felber, ehem. Bundesgerichtskorrespondent (NZZ am Sonntag, 21.02.16)
4)Der in Münchenstein wohnhafte Martin Brodbeck war während längerer Zeit Basel-Landschaft-Redaktor der «Basler-Zeitung». Er pflegte gute Beziehungen zu amtierenden und ehemaligen Gemeinderäten wie auch zum Bauverwalter. Brodbeck hatte mehrmals von «Gemeindeverwalter Z.» anstatt von «Bauverwalter Z.« geschrieben. Wer will da an Zufall glauben. Schon früh hatte Brodbeck sich anheischig gemacht, zu wissen, wo in Münchenstein «der Wurm drin steckt» und wo es inskünftig langgehen sollte. So fand sich bereits am 26.06.1995 in einem Kommentar zur Abstimmung über das Stadtpräsidenten-Amt in Liestal der schicksalsschwere Satz: «Denn es gibt im Baselbiet auch Gemeinden, die unter dem Unvermögen ihres beamteten Gemeindeverwalters leiden, ihn aber am Hals haben, weil niemand öffentlich gegen ihn in den Wahlkampf ziehen will. Den «Fall Liestal» gibt es (wenn auch diskreter) auch anderswo.»
Weitere BaZ-Artikel in diesem Zusammenhang: «Zu den Baselbieter Gemeindewahlen» (11.02.1996); «Der neue Präsident von Münchenstein steht praktisch fest» (22.07.1998); «Münchenstein: Gemeinderäte als Krisenmanager» (29./30.04.1999); «Neuigkeiten aus der Münchensteiner Verwaltung» (18.05.1999); «Münchensteiner Gemeindeverwalter geht im Unfrieden» (09.11.1999).
5) Wochenblatt 2.12.1999, BaZ 6.12.1999
6)2005 wurde mittels Wettbewerb öffentlich nach einem Slogan für Münchenstein gesucht. Auserkoren wurde: «Münchenstein – e guets Pflaschter»

EINES MEINER VORBILDER, HÄTTE ICH IHN EHER KENNENGELERNT
Franz Helfenberger – Hauptmann, Wundarzt und Rebell
Bei den Gossauer Helfenberger sticht vor allem einer ins Auge: Franz Helfenberger. Er muss um 1690 geboren sein, hatte Medizin studiert, war Wundarzt, also Chirurg, und Hauptmann. Militärischer Natur war zunächst sein voller Einsatz im Dienst der schiesstechnischen Ertüchtigung. 1710 erhielt er die Bewilligung zur Errichtung eines sogenannten Scheibenackers (Schiessstands) unter der Bedingung, dass er die «Schützen nach alter Gewohnheit ihre Schiesskunst ausüben lasse». Im Gemeindebuch von 1710 erwähnt und in einem Plan von ungefähr 1731 sind denn auch Schützenhaus und Schützenstand auf dem sogenannten Scheibenbüchel am Gütsch eingezeichnet.
Franz Helfenberger muss ein couragierter Zeitgenosse gewesen sein, der die Auseinandersetzung mit der Obrigkeit nicht scheute. Dies zeigte sein Einsatz nach einer durch den Gossauer Dorfbach verursachten Überschwemmung. Nachdem der Bach wieder einmal über die Ufer getreten und dadurch viel Schaden verursacht hatte, erhob Franz Helfenberger öffentlich wirksam Klage beim Pfalzrat zu St. Gallen, weil dieser seiner Ansicht nach zu wenig für den Unterhalt der Wuhre getan habe.
In seiner militärischen Funktion spielte Hauptmann Helfenberger im Nachgang zum sog. Zwölfer- oder Toggenburger Krieg, spez. dem Gefecht am Hüfrig, am 21.05.1712, eine herausragende Rolle. Er hielt Weiterkämpfen nicht nur für unnütz, sondern für das Gemeinwesen verderblich. Um die Kapitulation vorzubereiten, hatte er sich mit Gleichgesinnten im Gasthaus zur «Sonne» in Gossau getroffen, weswegen ihnen Mutlosigkeit vor dem Feind vorgeworfen wurde. Dessen ungeachtet hatten die Hauptleute Jakob Burgstaller von Waldkirch und Franz Helfenberger von Gossau am Abend des 22. Mai 1712 die Feinde um die Waffenstillstandsbedingungen gebeten und damit weiteres Blutvergiessen verhindert.
Viel politischen Mut hat Franz Helfenberger im sog. Landrechnungshandel bewiesen, als es darum ging, für allfälliges Entgegenkommen in Sachen der Landrechnung demokratische Rechte für das Volk, wie die Wahlart der Richter, einzutauschen. Abt Joseph hatte eine Kommission zur Untersuchung der Klagen aufgestellt, die an Ort und Stelle die Leute verhörte und die Beschwerden beseitigen sollte. Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 9. August 1722 in Gossau zeigte sich der Vertreter des Abts jedoch unnachgiebig. Nachdem sich die Versammlungsteilnehmer zu beruhigen schienen, spielten Ammann Bossart und Franz Helfenberger in diesem politischen Spiel, später als «Gossauer Tumult» bezeichnet, ihren letzten Trumpf aus. Um die Stimmung im Saal wieder anzuheizen, verlasen sie eine Entlassungsurkunde, in der einige Male der verhasste Ausdruck ‚Leibeigenschaft‘ wiederkehrte. Darauf kochte die Stimmung im Saal dermassen hoch, dass sich Landshofmeister und Obervogt nur durch Flucht in das Gemeindehaus körperlichen Verletzungen entziehen konnten. Unglücklicherweise war später ruchbar geworden, auf welch mysteriöse Weise das verfemte Dokument, das die beiden an der Gemeindeversammlung vorgelesen hatten, in deren Hände gekommen war. Ein zugewanderter Schwabe hatte es von einem ausgewanderten Fürstenländer erhalten. In der Folge wurden Ammann Bossart und Hauptmann Helfenberger deswegen vor den weltlichen Pfalzrat geladen. Schirmhauptmann und Landshofmeister erkundigten sich nach den Ursachen des Gossauer Tumultes, worauf Ammann Bossart die Schuld auf den Schwaben schob. In der Folge wurde dieser dem Ortenhauptmann und Pfalzrat vorgeführt. Der Schwabe beschuldigte Bossart und Helfenberger der Aufreizung und bat um Verzeihung und Gnade. Auf die gerichtliche Untersuchung erfolgten am 2. und 3. Oktober 1722 die Urteile: der Schwabe wurde des Landes verwiesen, Ammann Bossart wurde begnadigt, Hauptmann Franz Helfenberger als ehrlos erklärt.
Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Gemeinsamkeiten entdecke ich, ausser Namen und Herkunft. Zunächst dürfte Franz die Aussicht auf ein Studium der Medizin nicht mit in die Wiege erhalten haben. Förderung erfuhren zu jener Zeit vor allem Söhne, die ein Studium der Theologie anstrebten. Wo Franz studiert hat, ist unbekannt, ebenso seine biografischen Daten. Gut möglich, dass er ursprünglich Theologie studiert und sich erst später dem Studium der Medizin zugewandt und dann für eine militärische Karriere entschieden hat. Hauptmann dürfte er geworden sein, weil er seine Heimat liebte und bereit war, sie mit allen Mitteln zu verteidigen. Zu dieser Zeit war die Verbindung Arzt und Militär nicht unüblich, denn in einer der beiden Funktionen gab es immer etwas zu tun. Wundärzte waren auch bei allerlei Krankheiten wichtige Anlaufstelle für die Bevölkerung. In dieser Funktion und als Hauptmann der fürstlich-St. gallischen Miliz war Franz Autoritätsperson und damit Teil jener Obrigkeit, gegen die er mehr oder weniger still rebellierte. Er hat sich nicht gescheut, dem aufkommenden Absolutismus und er damit verbundene obrigkeitlichen Unterdrückung entgegenzutreten, wider den Stachel zu löcken. Dies tut man dies nicht ungestraft. Im Gegensatz zu Ammann Bossart hatte Franz Helfenberger dafür einen hohen Preis zu bezahlen. Die Ehrloserklärung dürfte für ihn den Verlust seiner öffentlichen Ämter und damit seiner Existenz bedeutet haben. Damit endete sein Kampf gegen absolutistische Herrschaft des Fürstbistums Basel nicht ganz so tragisch wie beispielsweise jener von Pierre Péquignat in der Ajoie, nämlich mit der öffentlichen Enthauptung im Jahre 1740 im Schloss Pruntrut. Im Gegensatz zu ihm blieb Franz Helfenberger ein Eintrag im Historischen Lexikon der Schweiz versagt.
Mein Namensvetter Franz war das, was wir heute einen äusserst engagierten und couragierten Zeitgenossen bezeichnen. Er verdient, dass seine bewegte Geschichte aufgearbeitet wird und weiterlebt.
Quellen:
Staerkle, Paul, Geschichte von Gossau, Gossau, 1961, Verlag U. Cavelti & Co.
Pierre Péquignat, Historisches Lexikon der Schweiz
Wikipedia, Ausführungen zum Thema Wundarzt
www.sportschuetzengossau.ch/de/images/stories/sport/arbeiten/jubilumsschrift_100_jahre_feldschtzengesellschaft_gossau.pdf">www.sportschuetzengossau.ch/de/images/stories/sport/arbeiten/jubilumsschrift_100_jahre_feldschtzengesellschaft_gossau.pdf

Über dem Berg - jo weleweg? - Spätlese
Prägendes
WEMER WILL, CHAMER VILL
Schon früh hatten unsere Eltern uns Kindern beigebracht, wie wichtig es ist, Opfer zu bringen, ehrlich zu sein und den Nächsten zu lieben. Wenn wir Kinder Mühe hatten mit den hohen Ansprüchen und glaubten, sie nicht zu erfüllen, erhielten wir ihn als Ansporn immer wieder eingebläut, diesen prägnanten Spruch «Wemer will, chamer vill.» Zu dieser Zeit wurden Kinder nicht danach gefragt, wonach wir Lust hätten. Doch versuchten wir, dies zu tun, wonach uns die Lust stand – unseren Weg zu gehen, auch gegen Widerstand. Nur nicht aufgeben, stets sein Letztes geben, um es schliesslich zu schaffen.
Mit dieser Devise im Hinterkopf hatte ich mir schon früh hohe Ziele gesetzt: die Maturität auf dem zweiten Bildungsweg nachholen, dann Rechtswissenschaft studieren, das Anwaltsexamen ablegen und schliesslich eine Familie zu gründen. Waren diese Ziele einmal erreicht, wurde für mich etwas Weiteres wichtig. Ich hatte es immer als Privileg betrachtet, in einer Gesellschaft mit Perspektiven nach oben leben zu dürfen, in welcher sich mit genügend Fleiss fast alles erarbeiten liess. Deshalb wollte ich der Zivilgesellschaft, die mir das alles möglich gemacht hatte, wieder etwas zurückgeben. Nirgends schien mir das besser möglich als im Öffentlichen Dienst. Auch da hatte ich mir denn auch stets hohe Ziele gesetzt.
MATURABSCHLUSSFEST AUF DER LANDSKRON IM SOMMER 1967
Frankreich, dieses grosse Land, beginnt gleich ein paar Kilometer weiter westlich unseres Zuhauses, im Sundgau. Mit dem Rennvelo habe ich diesen Elsässer Landstrich regelmässig befahren, bisweilen mehrmals wöchentlich, war dort so etwas wie Stammgast. Dazwischen, im benachbarten Leimental, in Therwil, befand sich ab 2008 die Physiotherapie-Praxis unseres Schwiegersohns, just an der Strecke zwischen Münchenstein und der französischen Grenze. Vom Trainingssaal seiner ersten Praxis aus eröffnete sich den Trainierenden ein wunderschöner Blick auf die Ruine Landskron. Die einst mächtige Landskron, deren Ruinen sich stolz oberhalb von Flüh (CH und Leymen (F) erheben, hat als historisches Bauwerk die Geschichte des Sundgaus überdauert. Besucher*innen bietet sich oben auf der Landskron eine prächtige Sicht über das Basler Dreiländereck und den oberen Sundgau. Mit der Ruine Landskron verbinden sich vielfältige Erinnerungen.
Diesen besonderen Ort hatten unsere beiden Klassen der Basler Maturitätskurse für Berufstätige ausersehen, um dort am 24. Juni 1967 die bestandene Prüfung gemeinsam zu feiern. Damals präsentierte sich die Anlage allerdings noch sehr viel bescheidener. Die beiden Mitschüler Hans Sitzler und Markus Müller hatten den Anlass bestens vorbereitet und mit dem alten «NSU Prinz» nicht nur Speis und Trank sondern auch die Ritterrüstung und die weiteren Requisiten aus Eigenproduktionen an den Ort des späteren Geschehens gebracht, angesichts des Zustandes des Autos und des Weges zur Ruine eine einmalige Sache! Unterhalb der Ruine war bereits eine ansehnliche Schar vor allem männlicher Skandinavier mit ausreichend Bier und Wein bereit für die Feier der Mitsommerwende.
Es war der frühe Abend eines Prachtstages als die Maturanden (Maturandinnen waren m.W. keine zugegen) und deren Begleitung beim Eingang von den Organisatoren ritterlich empfangen, standesgemäss eingekleidet und mit Tranksame versorgt wurden. Die Stimmung hätte besser nicht sein können. Doch was am frühen Abend so friedlich begonnen hatte, schlug nach Einbruch der Dunkelheit ins pure Gegenteil um. Die folgende Episode aus meiner Jugendzeit hat mir lehrbuchmässig vor Augen geführt, wie wenig es braucht und wie unheimlich schnell es gehen kann, bis sich eine völlig gelöste, friedliche Stimmung in ihr schieres Gegenteil verkehrt.
Am Anfang stand ein besorgter Klassenkamerad, der seine Gattin vermisste und deswegen mit mächtiger Stimme mehrmals deren Vornamen in die Nacht hinausschrie, weil er vermutete, sie könnte sich in der Dunkelheit verirrt haben oder sogar in der nicht ungefährlichen felsigen Umgebung der Ruine abgestürzt sein. Zwar waren seine Schreie in der nächtlichen Umgebung schnell verhallt, doch lösten sie gleichzeitig nicht nur allgemeines Entsetzen, sondern auch gewisse Fantasien darüber aus, was sich in nächster Umgebung im Zusammenhang mit den Nordländern alles hätte zutragen können. Und wenn dann noch Alkohol mit im Spiel ist, entsteht in einer solchen Übungsanleitung innert kürzester Zeit eine gefährliche Situation mit ungeheurer Eigendynamik, die auch, selbst dann weiterbestand, als die Verschwundene quasi aus dem Nichts wieder aufgetaucht war. Dann bedarf es nur noch eines kleinen Streichhölzchens und der Brand ist vollends entfacht.
In der Folge hatte einer der unsrigen einem Nordländer eine Flasche über den Kopf gezogen. Wohl aus Rache, doch das Opfer soll mit der vermissten Frau nichts zu tun gehabt haben. Darauf verlangten die Nordländer von uns, ihnen den Flaschenschläger auszuliefern, was ihnen verweigert wurde. Stattdessen wurde der Flaschenschläger von einem oder zwei der unsrigen aus der Gefahrenzone evakuiert. Für den Fall, dass wir ihrem Auslieferungsbegehren nicht nachkämen drohten wütende Nordländer mit der Beschädigung von Ausgrabungsgegenständen, die sich in unserer Obhut befanden. Dies war der Moment, in welchem die Auseinandersetzung vollständig aus dem Ruder zu laufen drohte. Auch ich hatte mir - horribile dictu - einen Ausgrabungshammer behändigt.
Was und wie sich damals zugetragen hatte, lässt sich im Nachhinein nicht mehr exakt ermitteln. Fest steht, dass sich in der Folge sogar die Regenz der Universität Basel mit den Ereignissen auf der Landskron zu beschäftigen hatte, weil viele der Skandinavier Studenten der Zahnmedizin waren. Damals war mir auch zum ersten Mal bewusst geworden, wie schnell man in einer Extremsituation zum Täter werden und damit in die Mühlen von Polizei und Justiz geraten kann. Gut möglich, dass diese frühe Einsicht meine spätere Studienwahl und insbesondere meine Haltung in Strafvollzugsfragen massgeblich mitgeprägt hat.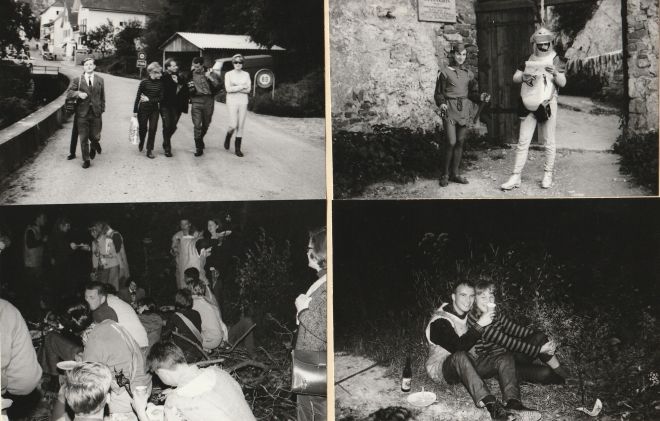
(1) Eindrücke vom Maturabschlussfest vom 24.06.67 auf der Landskron oberhalb Leymen (F) und Flüh (CH
VERRÜCKTHEITEN
Da war bereits während meines Studiums eine erste Verrücktheit, diese möglichst umfassende juristische Dokumentation, damals noch in Karteiform und mit Schreibmaschine – eine Heidenbüetz! Kaum hatte sich die analog geführte Entscheid-Sammlung selbst überlebt, begann ich mit dem Aufbau einer ebenso umfassenden elektronischen Sammlung von Kochrezepten – Sisyphos lässt grüssen! Mit meiner Kochrezept-Sammelleidenschaft bin ich so etwas wie der Mann im Märchen, der sich vorgenommen hatte, die Sterne am Himmel zu zählen. Um sicherzugehen, dass er jeden Stern nur einmal gezählt hatte, zeichnete er sie alle in einem grossen, dicken Buch auf. Er war gerade daran, sein Werk zu vollenden, da machte ihn ein Professor darauf aufmerksam, dass er mit der Zählerei seine Zeit unnütz verlöre, da die Anzahl der Sterne unendlich sei. Worauf der Mann, der die Sterne zu zählen versucht hatte, dem Professor glaubte und sein Sternenbuch für immer schloss. Späte Erkenntnis: Kochrezepte gibt es unzählige, genau wie Sterne am Himmel. Und noch schlimmer: Seit das Internet existiert, lassen sich auch Kochrezepte für praktisch alles und jedes in irgendeiner Form im Netz finden. Rezeptsammlungen sind recht eigentlich ein Anachronismus. Doch weshalb zum Geier werden heute so viele Kochbücher geschrieben wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit? Trotz dieser Einsicht pflege ich meine Rezeptsammlung nach wie vor mit grösstem Fleiss und mit viel Leidenschaft, stets auf der Suche nach dem perfekten Rezept. Gibt es überhaupt «das» perfekte Rezept? Wenn ja, was macht ein perfektes Rezept aus? – Nicht leicht, auf diese Fragen eine Antwort zu finden. Diese Suche dauert lange, sehr lange, in meinem Fall wohl ein Leben lang, weil sich die Vorstellungen darüber im Verlaufe des Lebens immer wieder ändern.
In meiner Sammlung existiert praktisch kein Rezept ohne zahlreiche Varianten, von einfach bis extravagant. Ich liebe diese riesige Vielfalt, wie ich sie in keinem Kochbuch der Welt finden könnte. Nur einen verschwindend kleinen Teil meiner Rezepte konnte ich bis heute kochen. Auch werde ich niemals in der Lage sein, dies zu tun. Meine Rezeptsammlung ist für mich so etwas wie ein persönliches Schlaraffenland, wo ich – ohne mich zu überfressen – ungehemmt und trotzdem ganz ohne Reue schwelgen kann. Die Welt meiner seit Jahrzehnten elektronisch gespeicherten Kochrezepte ist für mich auch immer wieder willkommener Anlass, mich auf kulinarische Reisen in ferne Erdteile zu begeben, dabei meine bescheidenen Fremdsprachenkenntnisse zu nutzen und darob die Zeit zu vergessen. Farbig, üppig, manches vom Feinsten, und jedes meiner 1001 Rezepte nur einen Klick weit entfernt. Und das Schöne daran: Im Idealfall lassen sie sich wirklich kochen! Dann ist dies unter dem Rezept mit einem Datum vermerkt, und mit Berichten über Erfolge – und über so manches grandioses Scheitern, weil ich zu sorglos war, das Rezept unterschätzt hatte – ganz wie im richtigen Leben. Steckt in diesen Rezepten mehr Privates als in meinen Lebenserinnerungen?
Und zu guter Letzt dieser späte Versuch, mein Leben aufzudröseln, etwas gegen das Vergessen und natürlich auch gegen das eigene Vergessenwerden zu tun – wer würde nicht nach ein bisschen Unsterblichkeit streben. Zunächst ging mir darum, Ereignisse meiner Jugendzeit festzuhalten, in erster Linie für meine Enkelinnen. Sie sollten hier ein paar Antworten finden auf die Frage, wie es sich damals im Fürstenland gelebt hat, bevor ich auszog, um am Rheinknie mein Glück zu versuchen, und was ich dabei erfahren habe. Der letzte Teil schliesslich zeigt etwas vom Innenleben einer Kommunalverwaltung, von Lokalpolitik ohne Verklärung. Münchensteiner_innen sollten eine längst zurückliegende Zeit mit ihren komplexen Kreuz- und Quer-Verbindungen aus Sicht ihres langjährigen Gemeindeverwalters nacherleben können.
ÜBER EM BERG
Die Berge in der Nordwestschweiz sind höher als die Hügel im heimatlichen Fürstenland. So überragt etwa der Baselbieter Helfenberg mit seinen 1124 m. den Tannenberg um rund 250 m. Dies ist mir erst im letzten Teil meines Berufslebens so richtig bewusst geworden. Zwar mag das Alter diese und jene Erinnerung trüben, doch schleckt keine Geiss weg, dass man sich mit jugendlicher Unbeschwertheit manches nicht so anspruchsvoll vorstellt, insbesondere wenn es darum geht, hohen Ansprüchen gerecht zu werden, Gestaltungsmacht zu nutzen, sich Freiraum zu erkämpfen. Wer als «Fremder» Chef wird, reorganisieren kann, will und muss, dringt in die gediegenen Verhältnisse einer bestehenden Beamtenschaft ein und wird zwangsläufig zum Feind.
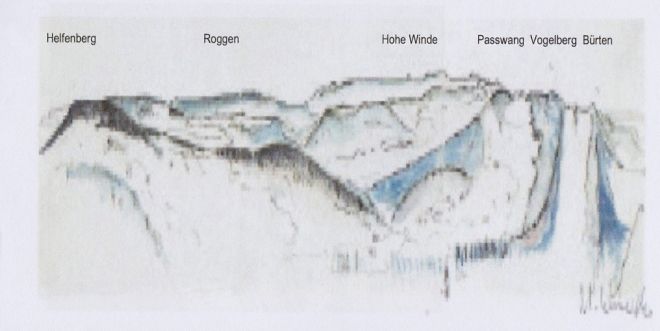
Hierzulande hatte man auf den Musterknaben mit dem Schifflisticker-Dialekt nicht gewartet. Einige bekundeten Mühe mit dessen bisweilen als aggressiv empfundenen Powerplay. Dabei stellt sich immer die Frage, wer am Schluss stärker ist. Aber auch der Starke braucht Allianzen. Diese zu schmieden, gelang anderen besser. Ein Verwaltungschef bezieht seine Stärke vor allem aus der hinter ihm stehenden Behörde. Da kann eine Parteizugehörigkeit überlebensnotwendig sein. Doch er wollte unabhängig sein und bleiben und machte trotz widriger Umstände weiter, und blieb, wie Musterknaben nun einmal sind, eher isoliert und ungeliebt – ein typischer Schweizer eben. Der Spruch «Wemer will, chamer vill» war für ihn zur nie erlahmenden Triebfeder geworden, bis hin zur psychischen Erschöpfung.
Manchen fällt schwer zu verstehen, wie ich so lange durchhalten konnte. Wäre nicht kluger gewesen, nach dem verlorenen Kampf ums Gerichtspräsidium mein eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen, den Bettel hinzuschmeissen und etwas Neues ausserhalb von Münchenstein zu suchen anstatt beharrlich auf eine Änderung der politischen Grosswetterlage zu hoffen?
DORFKÖNIGTUM
Jeder sieht, was du zu schein scheinst, doch nur wenige erfahren, was du wirklich bist
Auch in der urdemokratischen Schweiz sind Dorfkönige, vor allem in der männlichen Ausprägung, immer wieder anzutreffen. Gewisse Gemeindepräsidenten führen sich tatsächlich so auf, als wären sie der Dorfkönig. In meiner Jugendzeit in Gossau/SG verkörperte mein Lehrmeister, Gemeindeammann Dr. jur. Jacques Bossart, dieses Dorfkönigtum formvollendet. Zudem war er Kantonsrat der Katholisch-Konservativen (KK), Oberst und Lobbyist der Stickereiindustrie. Nicht verwunderlich, dass in grauer Vorzeit auch bei mir so etwas wie ein nebulöser Wunsch danach bestand. Noch während meiner Studienzeit begegnete mir anfangs der siebziger Jahre in Münchenstein eine ganz andere Persönlichkeit, die dank ausgeprägter Macher-Qualitäten geradewegs auf das Dorfkönigtum hinzuzusteuern schien: Paul Messmer, 11 Jahre älter, Sanggaller wie ich, in der Stadt aufgewachsen, beide nach Basel heruntergekommene Ostschweizer aus KK-Elternhäusern. Beide hatten wir nach der Schule eine Berufslehre gemacht, Paul Messmer eine Ausbildung zum diplomierten Drogisten, dann Wohnsitznahme und Tätigkeit als Geschäftsführer der Drogerie Tschopp in Basel. Mein Ausbildungsort war, wie erwähnt, die Gemeindeverwaltung in Gossau/SG.
ERFOLGREICHER UNTERNEHMER Zu Beginn seiner Karriere war Messmer dem Fechtsport zugetan. Er habe, wie er mir in einem unserer letzten Gespräche verraten hatte, diese eher ungewöhnliche Sportart gewählt und betrieben, weil er überzeugt war, die sich daraus ergebenden Beziehungen seien ihm und seiner Karriere förderlich. In der Tat hat er es zeitlebens ausgezeichnet verstanden, seine geschäftlichen, persönlichen wie auch politischen Beziehungen optimal zu verbinden und zu nutzen. Nicht weiter erstaunlich, dass sich der zielstrebige und charmante Ostschweizer schon nach drei Jahren in Münchenstein als Drogist selbständig machte und erfolgreich agierte. Drei Drogerien zwei Do-it-yourself-Geschäfte sowie vier Discountläden im Lebensmittelbereich gehörten zuletzt zu seinem Unternehmen, der MEBA. In den ersten Münchensteiner Jahren gehörten auch wir zu den Kunden seiner Drogerie.
DORFKÖNIG Für Paul Messmer war es wichtig, sich nebst seiner beruflichen Tätigkeit auch politisch zu engagieren. In Münchenstein gehörte er als Mitglied der Christlichdemokratischen Volkspartei (CVP) während 12 Jahren dem Gemeinderat als Finanzchef an. In meinen ersten Münchensteiner Jahren hatte ich ihn noch an Gemeindeversammlungen als Gemeinderat auf seinem Weg zum Dorfkönigtum erlebt. Zu dieser Zeit kämpfte ich zusammen mit einigen aufmüpfigen Münchensteinerinnen und Münchensteiner engagiert für die Einführung des Einwohnerrats. Gemeinderat Messmer hatte überhaupt kein Verständnis für eine Änderung der bestehenden Strukturen. Dies erstaunte mich nicht, denn ich erinnerte mich, ihn bereits während meiner Rekrutenschul-Zeit in den Festungsanlagen oberhalb Airolo als Kommandant einer anderen RS-Kompanie erlebt zu haben. Wir Übermittlungs-Rekruten hatten damals so etwas wie Mitleid mit den von Oblt Messmer befehligten Kanonier-Rekruten. Dennoch musste bei ihm in der Folge alles gestimmt haben, denn Paul Messmer reüssierte und schien geschäftlich wie auch privat zu schaffen, wovon andere nur träumen konnten. Nach seinem Rücktritt als Gemeinderat sind wir uns in unserer Wohngemeinde Münchenstein in unterschiedlichsten Situationen und Funktionen begegnet, vor allem zwischen 1983 und 2000, zu meiner Zeit als Gemeindeverwalter. Ganz schwach erinnere Ich mich noch an ein von ihm geleitetes Hearing zu Beginn meiner Tätigkeit, in dem er mich über meine Vorstellungen und Ziele befragt hatte. Während meiner 17jährigen Tätigkeit als Gemeindeverwalter erlebte ich ihn an zahlreichen Gemeindeversammlungen und Veranstaltungen. An der Person Paul Messmer hat mich einiges fasziniert, manches nachdenklich gemacht oder beunruhigt.
STATT DORFKÖNIG OBERSTER DRÄMMLER Wie wohl kein anderer Münchensteiner Gemeinderat kannte Paul Messmer seinen Machiavelli. Zudem beherrschte den verbalen Zweihänder meisterhaft. Dies dürfte ihm 1971 die Wahl zum Gemeindepräsidenten gekostet haben. In einer Schicksalswahl unterlag der von der «Basler Zeitung» als «politisches Urgestein» bezeichnete Paul Messmer damals seinem Gegenkandidaten, dem Advokaten Dr. Fritz Zweifel. Darauf trat Messmer als Gemeinderat zurück und konzentrierte sich auf seine geschäftlichen Tätigkeiten sowie auf sein Landratsmandat, das er von 1971 bis 1977 innehatte. Mit dem politischen Blickwinkel erweiterte sich auch sein Beziehungsnetz. Alles schien möglich; mit einer «Green Card» wäre er auch in den USA erfolgreich geworden. 1974, bei der Gründung der Baselland Transport AG (BLT), der Nachfolgeorganisation der Vorortsbahnen, wurde Paul Messmer BLT-Verwaltungsratsvizepräsident, 1978 Delegierter des Verwaltungsrates und Vorsitzender der BLT-Geschäftsleitung. In diesen Funktionen konnte er sich voll entfalten. Als «oberster Drämmler» sass er an der richtigen Stelle, um zukunftsweisende Schritte für den ÖV in der Region Basel in die Wege zu leiten. Messmer gilt denn auch als einer der Erfinder des U-Abos. Als erfolgsgewohntes Schwergewicht und wegen seines ausgezeichneten Beziehungsnetzes war und blieb er ein wichtiger Strippenzieher, nicht nur für die CVP. Er gilt er als einer der Väter der BüZa (Bürgerliche Zusammenarbeit bei den Baselbieter Regierungsratswahlen).
MACHER WIRD ZUM «TERMINATOR» Dass 1971 in Münchenstein ein 40-köpfiger Einwohnerrat anstelle der Gemeindeversammlung getreten war, musste Messer missfallen haben. Auch für abgefeimte Drahtzieher ist es schwieriger, Einfluss auf ein aus Politikerinnen und Politikern verschiedener Fraktionen zusammengesetztes Parlament zu nehmen als eine Gemeindeversammlung zu dominieren. Etwas überspitzt gesagt: Gemeindeparlamente wirken dem Gemeindekönigtum entgegen. Aus Messmers Optik nur folgerichtig und verständlich, dass er in der Folge lautstark gegen den Einwohnerrat und dessen Beschlüsse wetterte, weil dieser «am Volk vorbei» politisieren würde. Im Februar 1979 erzwang er mit der CVP eine schicksalshafte Neuabstimmung über die Gemeindeorganisation, worauf sich der Souverän mit einem Anteil von 56,24 % für die Rückkehr zur Gemeindeversammlung entschied. Damit hatte Paul Messmer nicht nur dem kommunalen Parlament den Todesstoss versetzt, sondern auch Gemeinderat und Einwohnerrat überlistet. Beide hatten Beibehaltung empfohlen. Messmer war «Terminator» des Münchensteiner Gemeindeparlaments. Damit hatte er sein politisches Meisterstück abgeliefert.
Nach Wiedereinführung der Gemeindeversammlung war er wieder in seinem Element. Dank seines Beziehungsnetzes gelang es ihm immer wieder, im Hintergrund die Fäden zu ziehen, Vorlagen zu bodigen, weil diese aus seiner Sicht nicht dem «Volkswillen» entsprachen und damit «Fehlentscheide» waren. Nebst Politik und ÖV umfasste dieses Netz auch andere Bereiche, etwa den regionalen Energieversorger, wo Paul Messmer während längerer Zeit Sekretär des Verwaltungsrats war. Dieses Unternehmen war damals nebst dem Energiesektor auch noch der lokale Player in der Datenkommunikation.
Nach der Jahrtausendwende war in Münchenstein so etwas wie planerische Aufbruchstimmung spürbar. Diese führte dazu, dass die Gemeindeversammlung 2006 einem kommunalen Richtplan zustimmte. Doch innert Kürze hatte Messmer mit einem prominent besetzten Komitee 1631 Unterschriften für ein Referendum zusammengebracht. Die Art, wie Messmer im Abstimmungskampf argumentierte, lässt vermuten, er habe zeitlebens an einem Akademiker-Komplex gelitten. Gut möglich, dass dabei seine frühe Niederlage gegen Dr. iur. Fritz Zweifel eine Rolle gespielt und seine geheime Agenda beeinflusst hatte. «Studierte», die sich erdreistet hatten, sich seiner Sicht der Dinge zu widersetzen, pflegte er in der Öffentlichkeit besonders hart anzugehen. Angriff war für ihn beste Verteidigung. Beispielhaft auf jenen Geographen, Ökologen und Mitglied des Verbandes Schweizer Umweltfachleute, der sich im Abstimmungskampf um den Richtplan in einem Leserbrief lediglich auf die Ergebnisse der Zukunftskonferenz und der Ergebniskonferenz berufen hatte. In einer Entgegnung warf er diesem zunächst vor, nur auf Kosten der Öffentlichkeit studiert zu haben, um dann wiederum auf Kosten anderer die Welt verbessern zu wollen. Messmer bezeichnete dessen Gedankengänge als die eines «sich am Horizont orientierenden Visionärs und Querdenkers». Solche Zeitgenossen würden sich einen Deut darum kümmern, ob ihre «Visionen» von den Mitbürgern gewünscht oder finanzierbar wären. Und diese würden sich selbst nicht davor scheuen, Gewerbe und Partei-Establishment zu verunglimpfen. Dabei hätten diese «Wolkenschieber» die Öffentlichkeit nur gekostet und für Münchenstein kaum etwas gebracht. «Ich bin fast sicher, dass sie etwas davon verstehen, wie man das Geld der Öffentlichen Hand ausgibt - immer etwas mehr als man hat.» Derweil sich der Alt-Finanzchef und ehemalige Landrat in seiner Entgegnung über eine befürchtete Steuerfuss-Erhöhung als Folge einer vorausschauenden Politik des Gemeinderates sowie über eine Verunglimpfung des Gewerbes durch den Leserbriefschreiber beklagte, verunglimpfte er in weit stärkerem Masse nicht nur einen ihm nicht wirklich bekannten Mitbürger öffentlich, sondern auch alle nicht aus wohlhabendem Elternhaus stammenden Akademiker als eine Art Schmarotzer.
Rückblickend finde ich es gut, hatte das Münchensteiner Stimmvolk 1971 Zweifel und nicht Messmer zum Gemeindepräsidenten erkoren. Zwar hätte Paul Messmer dem Bild des herkömmlichen «Dorfkönigs» als Anreisser, Händeschüttler und Redner mit einfachen Botschaften eher entsprochen. Doch Fritz Zweifel war im Verlaufe seiner 31 Jahre als Gemeinderat, wovon 27 Jahre als Präsident, weniger als «Dorfkönig» denn als grundsolider, kompetenter, um Ausgleich bemühter, vertrauenswürdiger Gemeindevater in Erscheinung getreten. Wenn es darauf ankam, verstand es auch Zweifel, sich zur Geltung bringen, etwa nach der (einzigen) Kampfwahl, die er als Präsident zu bestehen hatte, gegen den Grünen Edi Gysin. Nach seinem Sieg liess sich Zweifel in einer Kutsche durchs Dorf fahren %u0336 übertrieben und nicht sein Stil.
Zu Zweifels Kernkompetenzen gehörte es nicht, für neuen Ideen zu begeistern oder gar Visionen zu verkaufen. Er wirkte eher zögerlich, wenig charismatisch, bisweilen etwas hölzern. So dürfte auch Messmers «Husarenstück», die Abschaffung des Gemeindeparlaments und damit die Rückkehr zur Gemeindeversammlung, Zweifel zupassgekommen sein. Aus heutiger Sicht könnte man sagen, zwischen dem grundsoliden, kompetenten Gemeindepräsidenten Zweifel und seinem ehemaligen draufgängerischen und innovativen Gemeinderatskollegen Messmer hätte es so etwas wie eine bürgerliche „Entente cordiale“ gegeben. Doch zur Höchstform auflaufen konnte Messmer erst unter Zweifels Nachfolger. Mit seiner politischen Gruppierung «Pro Münchenstein» entwickelte er sich immer mehr in Richtung eines seine Prätorianer lenkenden Feldherrn, forderte eine Reorganisation der Verwaltung, die Sanierung der Gemeindefinanzen samt Reduktion des Gemeindesteuersatzes. Mit dem Slogan «Keine Experimente mit Unerfahrenen - Kontinuität sicherstellen» erzwang die Gruppierung eine Änderung des Wahlsystems vom Proporz zum Majorz und zog mit zwei Vertretern in den Gemeinderat ein. Wen erstaunt, dass unter diesen Voraussetzungen sämtliche Bestrebungen in Richtung Wiedereinführung des Einwohnerrats scheiterten.
Im Herbst 2019 ist Paul Messmer verstorben. Bis ins hohe Alter hatte er sich stark für Münchenstein engagiert, etwa in den neunziger Jahren beim Bau eines Kultur- und Sportzentrums (Kuspo), als dessen erster Betriebsratspräsident er amtete, mit der Gründung einer Wohnbaugenossenschaft, die in der Folge 42 seniorengerechte Wohnungen realisiert hat.
MUSS POLITIK WIRKLICH SO FUNKTIONIEREN? Überzeugungen sind in der Politik wichtig. Wer jedoch mit absolutem Anspruch antritt, braucht in der Wahl seiner Mittel nicht wählerisch zu sein. In späten Jahren hat Messmer mir gegenüber seine Maxime so formuliert: «Mit einem prominent besetzten Komitee, Geld und einem mächtigen Apparat lässt sich fast alles bodigen. Wenn zehn qualifizierte Leute sich etwas vornehmen und dafür Zeit und auch ein bisschen Geld einsetzen, dann funktioniert diese ‘ privatwirtschaftliche Organisation’ schneller und viel besser als ein Gemeindeapparat.» Nach diesem Muster scheint Politik häufig noch immer zu oft zu funktionieren, nicht nur in Münchenstein, mit Politikern, die sich vordergründig stets für eine «gerechte Sache» einsetzen, im Hintergrund aber häufig eine verdeckte, eben nicht öffentliche Agenda verfolgen.
Anders als Zweifel verstand es Messmer, sich überall als echter Kerl zur Geltung zu bringen. Doch mir hatten Naturell und politischer Stil eines Fritz Zweifels stets mehr entsprochen, vor allem wenn man bedenkt, welches 1971 die Alternative war! Gemeindepräsident Zweifel und ich waren in manchen Fragen klar unterschiedlicher Auffassung, auch in jener über die für Münchenstein richtige Gemeindeorganisationsform. Zweifel wie auch sein direkter Nachfolger Banga standen einem Gemeindeparlament ablehnend gegenüber, während ich ein solches stets befürwortete. Besonders pikant in diesem Zusammenhang: Es war Banga, der mit seinem präsidentiellen Stichentscheid an der Gemeindeversammlung 2006 einem Vorstoss zur Wiedereinführung des Einwohnerrats den Todesstoss versetze. Doch für mich steht fest: Um die politische Kultur in Münchenstein war es in den über 50 Jahren, in denen ich in dieser Gemeinde lebe, nie so gut bestellt wie zur Zeit des Einwohnerrats (1972 – 1980). Davon hatte ich nur zwei Jahre als aktiver Gemeindepolitiker miterlebt. Diese kurze, intensive Zeit hat mich politisch stark geprägt. Während dieser Zeit sind auch Beziehungen entstanden, die ein Leben lang andauern und beglücken. Deshalb hatte ich mich 2006 und 2014 für die Wiedereinführung des Gemeindeparlaments stark gemacht.
POLITIK ALS TUGENDFEIER RAUM? Politik lebt vom Wettstreit unterschiedlicher Meinungen und Ideen. Aktiv konnte ich da nur kurze Zeit mittun. Vielleicht steckt deshalb noch immer einiges Kämpfertum in mir. Eine gewisse Furchtlosigkeit verdanke ich sowohl meinen beiden Grossvätern wie auch meinen Eltern, alle wie ich stets als Einzelkämpfer unterwegs. Durchtriebenes Powerplay war mir stets zuwider, weshalb ich mich beruflich wie auch als Privatperson stets für die Einhaltung von Fairness auch in der Politik stark gemacht und deren Nichteinhaltung moniert habe, auch gegenüber Messmer, als ich bereits im Ruhestand war.
In der Gemeindepolitik sind «Grossfamilien», wie sie Parteien darstellen, nützlich oder gar notwendig. Rückblickend halte ich es für gut möglich, dass ich als Teil eines grösseren Kollektivs, etwa als engagiertes Parteimitglied, mehr Erfolg gehabt hätte. Doch machen wir uns nichts vor: Matchentscheidend sind die richtigen Netzwerke, wie das Exempel eindrücklich zeigt. Um wirkliche Durchschlagskraft zu haben, etwa um Exekutivpolitiker zu «machen» , Initiativen zu versenken, Referenden zu lancieren und zu gewinnen oder um gar Institutionen «den Stecker zu ziehen», braucht es gleichermassen starke und listige Taktiker der Macht mit dem entsprechenden Instinkt. Verständlich deshalb, wenn der bekannte Aphoristiker Peter E. Schumacher es so formuliert: «Wozu Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit, Bescheidenheit? – Politik ist tugendfrei!». Kein Wunder, hat Politik auch hierzulande nicht den besten Ruf.
SCHREIBEN, SCHREIBEN, IMMER WIEDER SCHREIBEN
Wenn ich es mir genau überlege, hat mir das Schreiben geholfen, über die Runden zu kommen: das frühe, stetige Tagebuchen sowie das späte autobiografische Verdichten des Erlebten. Schreibenderweise habe ich schliesslich entdeckt, wie stark mich diese Ostschweizer Landschaft geprägt hat. Der heimatliche Tannenberg, das ihn umgebende Fürstenland, die Aussicht auf Bodensee und die Appenzeller Berge gehören zum Gewebe meines Lebens. Die Erde, auf der wir geboren wurden und die Jugendzeit verlebt haben, klebt immer unter den Sohlen. Selbst die Geschichte meiner Familie hat sich mir erst im Schreiben so richtig erschlossen. Wenn ich glaubte, am Ende zu sein, hatten mir Einzelschicksale, wie jenes meiner Tante Klara, Kraft gegeben. Nebst dem Velofahren hat mir auch das Schreiben, immer wieder «über den Berg» geholfen und mich vielleicht vor Schlimmerem bewahrt hat. Ganz so schädlich kann Schreiben also nicht sein.