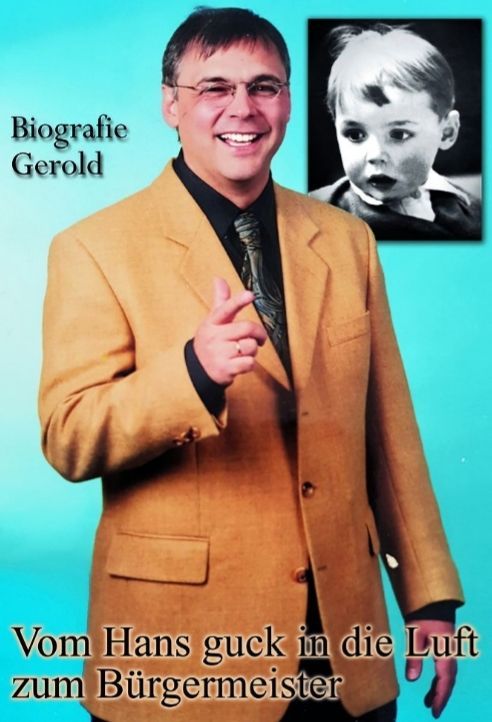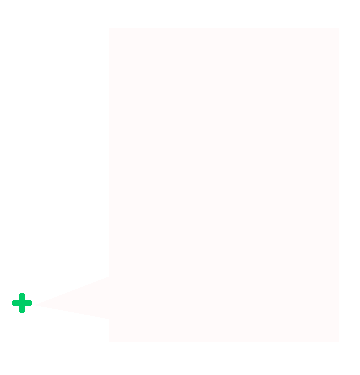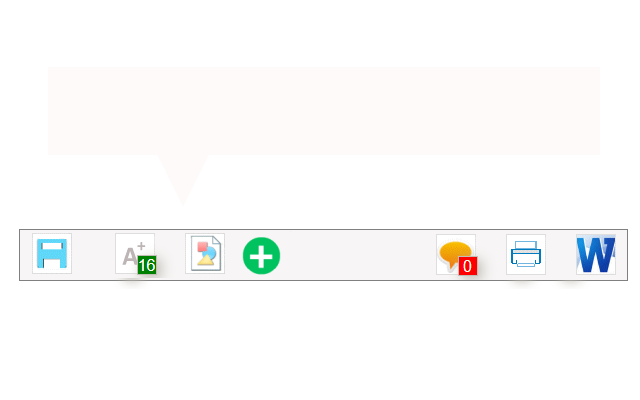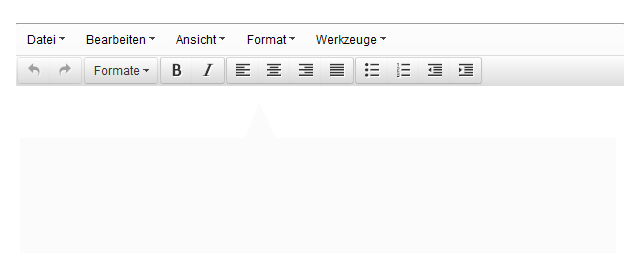Zurzeit sind 520 Biographien in Arbeit und davon 291 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 176
VORWORT Autobiografie Teil I

Willkommen zu einer Reise in meine Vergangenheit! Wer Lebenserinnerungen aufschreibt, wird fündig. Man muss sich nur als Autor oder Autorin erst einmal darauf einlassen wollen. Allerdings: Das ist leichter gesagt als getan!
"Das ist nichts für mich", war mein erster Gedanke, als ich mich 2017 erstmals mit dem Thema Autobiografie schreiben befasste. Aus Skepsis wurde (ab 2019) dann aber Faszination, als ich bemerkte, wie es mir zunehmend gelang, in teilweise sehr alte Erinnerungen einzutauchen. Was dabei herauskam, war - neben sehr vielen Seiten aufgeschriebenen Erinnerungen - die Erkenntnis, dass mich mein Leben - neben all den vielen schwierigen Phasen - sehr viel positives erleben ließ, was mir heute einen fröhlichen Blick zurück ermöglicht. Eine schöne Erfahrung!
Zurück zum Schreiben: "nie fertig"
Eine weitere Erfahrung, die ich beim Schreiben für mich gewonnen habe, ist, dass eine Autobiografie - wie die meine - vermutlich "nie" fertig geschrieben sein wird. Warum? Es fällt mir immer wieder etwas ein oder auf, was ergänzt werden könnte. Außerdem beabsichtige ich noch einen zweiten Teil meiner Lebenserinnerungen zu schreiben (über meine Erlebnisse als Bürgermeister 2002-2013). Was aber auf jeden Fall bestehen bleibt, ist der Titel für diesen ersten Teil meines Rückblicks in vergangene Zeiten: "Vom Hans guck in die Luft zum Bürgermeister".
"HANS GUCK IN DIE LUFT", diese Geschichte aus dem uralten Kinderbuch von Dr. Heinrich Hoffmann (Psychiater, Lyriker, Buchautor, 1809-1894), beschreibt zutreffend meine Besonderheiten in der Kindheit. Auch mein späteres Leben wurde dadurch geprägt, weil ich mit einem extrem ausgeprägten Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) und mit einem Augenhandicap auf die Welt kam.
Mit Handicaps aufwachsen
Als Kind (Jahrgang 1957) und später, ging ich deshalb viele (prägende) Jahre mit erheblichen Benachteiligungen durchs Leben, weil weder mein ADS noch mein Augen-Handicap erkannt wurde. Düstere Erinnerungen sind mir aus dieser Zeit erhalten geblieben, über die ich erzähle. Hinzu kamen Misshandlungs- und Suchterfahrungen in meiner Kindheit und Jugend, die mir das Leben und meine Entwicklung nicht einfacher machten. Aber ab 1981 kam es doch noch zu einer bemerkenswerten Wende in meinem Leben, über die ich in meiner Autobiografie erzähle.
Mut machen
Die dadurch von mir aufgeschriebenen abenteuerlichen Lebenswege, möchte ich nun all den Menschen nicht vorenthalten, die entweder selbst mit dem ADS / ADHS (oder anderen Handicaps) leben, oder welche solche aus beruflichen Gründen oder als Angehörige begleiten. Ich würde mich darüber freuen, wenn es mir gelingen sollte, diesen Betroffenen etwas Mut machen zu können, dass sie - trotz mancher Benachteiligung - ihren Weg dennoch entschlossen gehen, sie immer wieder neue Chancen suchen und sich nicht unterkriegen lassen. Darum habe ich mich entschlossen, meine AB öffentlich zugänglich zu machen.
Nichts für ungut!
Was bei Erinnerungen aus - teilweise sehr lang - zurückliegenden Zeiten immer vorkommen kann, ist, dass meine subjektiven Erinnerungen an Personen von ihnen anders erlebt wurden, als ich es in meiner Biografie beschreibe. Das liegt jedoch in der Natur der Sache, denn alle Menschen haben ihre individuellen Wahrnehmungen, nehmen mit ihren Hintergründen, Besonderheiten oder Lebensumständen wahr (Irrtum nie ausgeschlossen). Meine Erinnerungen schrieb ich jedoch nach bestem Wissen und Gewissen auf und achtete auf eine authentische Schreibweise, verzichtete aber bewusst darauf, meine Erlebnisse "verschönert" oder harmonischer wiederzugeben. Dadurch fand ich zu einem lebendigen Schreibstil und hoffe, dass meine Storys zum Lesen einladen. Viel Spaß dabei!
Im August 2021
Der Autor
Gerold Löffler

1. Kapitel: "Auf los geht's los"
Freiburger "Bobbele"...
Wie ich in meinem Vorwort schon erzählt habe, wurde ich 1957 geboren. In meiner Geburtsstadt Freiburg im Breisgau wuchs in der Altstadt in einer großen Familie mit vier Geschwistern, den Eltern und meiner Großmutter in einer kleinen Dachwohnung in einem sehr alten Haus auf, ganz in der Nähe des Münsters.
Kind fällt auf - Handicap Nr. 1
Was mich deutlich von anderen Kindern unterschied: Ich kam mit zwei Handicaps auf die Welt, welche mein Leben nachhaltig prägten und beeinflussten. Besonders nach meiner Einschulung waren meine Eigenheiten nicht mehr zu übersehen. So schaute ich Menschen, die mit mir reden wollten, meistens nicht an, sondern durch sie "hindurch", hörte ihnen selten zu, wenn sie mit mir sprachen, und war permanent abgelenkt. Damit brachte ich nicht nur meinen Vater und andere Bezugsperson auf die Palme. Ich fiel als Sonderling bereits im Kindergarten auf, war sehr verschwiegen und wandte mich häufig von anderen Kindern ab. Häufig wurde ich „Schlofer“ oder „Träumer“ gerufen, weil ich meistens als „HANS GUCK IN DIE LUFT“ unterwegs war, und das Geschehen um mich herum ausblendete. In der heutigen Fachsprache zeigte ich typische Anzeichen eines Kindes mit einem ausgeprägten Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS).
ADS?
Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS), das in mir sehr intensiv sein Unwesen trieb, kannte, bzw., behandelte man in den Fünfziger- bis Siebzigerjahre in der Fachwelt noch nicht, wenngleich auch zu früheren Zeiten viele Menschen davon betroffen waren. Das Thema war, – im Unterschied zu heute –, wissenschaftlich noch nicht erforscht. In der Fachliteratur kann man heutzutage sehr viel darüber nachlesen. Auch sind die Themen ADS und ADHS (ADHS: wenn Betroffene statt durch Verträumtheit, -wie in meinem Fall-, durch Hyperaktivität auffallen), vielfach in den Medien präsent. Daher will ich in meinem Buch auf abstrakte, fachlich fundierte Erklärungsversuche, verzichten.
„Gewitter im Kopf“
Betroffene umschreiben vielfach diese Besonderheit als „ständiges Gewitter im Kopf“. Das kann ich auch unterschreiben. Soll heißen, dass ein Gehirn von ADS / ADHS – Betroffenen nur unzureichend die Summe der Außenreize im Alltag filtern kann, um eine Überhitzung zu vermeiden. Vielleicht ist dieser Dauerzustand vergleichbar mit einem Computer, der permanent zu viele Daten mit zu wenig Arbeitsspeicher verarbeiten muss, und deshalb bestimmte Auffälligkeiten oder Ausfälle unvermeidlich sind. Diese Dauerüberforderung löst ständige innere Unruhe und Erschöpfung aus, was leider unangenehme Leistungsfunktionsstörungen wie Unkonzentriertheit und hohe Ablenkbarkeit zur Folge hat. Jedenfalls werden Menschen mit einem ADS / ADHS meistens als Sonderlinge, Träumer – bzw. Zappelphilippe -, beschrieben.
Spezielles Medikament
Erst Jahrzehnte später, (um 1990), verschrieb mir ein Facharzt, der mir empfohlen wurde, ein hochwirksames Medikament, das zu dieser Zeit allerdings nur Kindern und Jugendlichen verabreicht werden durfte. Erfahrungen aus seinem Praxisalltag brachte ihn jedoch zu der Erkenntnis, dass das ADS bei vielen Jugendlichen mit dem achtzehnten Geburtstag nicht automatisch verschwindet, sondern sie dieses Handicap in ihr Erwachsensein mitnehmen. In nicht wenigen Fällen führte das Absetzen der bisher wirksam verabreichten Medikamente zu erheblichen Problemen in der Schule, im Studium oder im Beruf.
Hilfreiche Ausnahme
Gott sei Dank machte der Fachmediziner in meinem Fall eine Ausnahme, ignorierte das Verordnungsverbot, und stellte mir ein Rezept für ein spezielles Medikament aus, weil er damit schon manchen erwachsenen Patienten wirksam helfen konnte. Allerdings schränkte er ein, dass dieses besondere Medikament nicht allen Patienten helfen würde. Aber ich solle es einfach einmal ausprobieren.
„Probieren geht über Studieren“
Wie gut, dass ich das tat! Den sofort nach der Einnahme verspürte ich eine enorme Wirksamkeit, ich wurde wesentlich ruhiger und konnte mich deutlich besser konzentrieren. Der hilfsbereite Facharzt für Neurologie und Psychiatrie informierte mich weiter darüber, dass die medizinische Forschung inzwischen zwar erkannt hat, dass auch erwachsene Menschen mit dem ADS oder einem ADHS behandlungsbedürftig sind, es aber aus irgendwelchen rechtlichen Problemen der Ärzteschaft - wie schon erwähnt – nicht erlaubt sei, RITALIN oder ähnlich wirkende Wirkstoffe ihren Patienten zu verordnen.
Neustart
Die spät erkannte Chance, - mit Ausblick auf Erfolg - beruflich neu durchstarten zu können, nachdem durch das bereits beschriebene - sehr wirksame - Medikament mein ADS-Handicap erheblich entschärft werden konnte, sollte mein Leben positiv verändern. Ich verspürte in dieser Zeit eine bisher nicht gekannte Energie und ein Aufbruchswille, als ob ich in kurzer Zeit alles das, was mir bisher an Erfolgserlebnissen verwehrt war, aufholen müsste (mehr dazu in späteren Kapiteln).
Verdrehte Augen - Handicap Nr. 2 (angeboren)
Hinzu kam, dass ich wenige Jahre später, in der mir ein hoch wirksames Medikament im Zusammenhang mit dem ADS verordnet wurde, einen „Schlüssel“ fand, auch mein zweites angeborenes Handikap deutlich zu entschärfen. Das Licht der Welt erblickte ich nach meiner Geburt zwar mit zwei sehenden Augen. Aber es handelte sich um jeweils sehr eigenwillige Sehorgane! Warum? Das Blickfeld beider Augen stimmte nicht überein, sondern wich ganz erheblich voneinander ab. Was von außen kurioserweise nicht ersichtlich war, wirkte sich dafür umso spürbarer beim Lesen und beim Schreiben aus. Zum Beispiel führte dies zu unangenehmen Problemen beim Fixieren einzelner Buchstaben. Ich „schwebte“ über die Schriftzeilen hinweg, konnte mich aber nicht auf einzelne Buchstaben konzentrieren. Versuche, dies dennoch zu erzwingen, führten zu Übelkeit. Das verdeckte Schielen war besonders auch für meine gravierende Lese- Rechtschreibschwäche mit verantwortlich, mit welcher ich in der Schulzeit besonders auffiel. Außerdem hatte ich es oft mit Augenschmerzen zu tun.
Augen "zurechtbiegen" (1997)
Auch dieses Handicap wurde Jahrzehnte nicht erkannt, bis ich schließlich doch noch - wieder durch besondere Umstände - medizinische Hilfe fand. Zunächst versuchte ein spezialisierter, namhafter Optiker in Freiburg meine Augenfehlstellung durch einen damals neu eingeführten „Pola-Test“ zu vermessen, um für mich daraufhin Prismengläser als Sehhilfen anzufertigen, welche mein Sehproblem entschärfen sollten. Als nach mehrstündigem, anstrengendem Ausprobieren von gefühlt hunderten Vermessungsgläschen der Optiker glaubte, ein brauchbares Ergebnis gefunden zu haben, wurden danach entsprechende Sehhilfen angefertigt. Mit großer Erwartung fuhr ich nach Freiburg, um meine neue Wunderbrille eine Woche später ausprobieren zu können, als diese fertiggestellt war.
Enttäuschung! Blümerantes Sehen
Als ich sie aufsetzte, meinte ich, mehrere Flaschen Schnaps auf einmal zu mir genommen zu haben. Alles um mich herum nahm ich völlig verfremdet wahr, und mir wurde sehr bald übel. Möglicherweise waren die Gläser zutreffend bestimmt worden, aber das Sehen erfolgt ja bekanntlich auch in Kooperation mit dem Gehirn, das mit den nun massiv manipulierten Bildern über die - dicken - Prismengläsern vor meinen Augen, spontan wohl nichts anfangen konnte. Apropos „dicke Prismengläser“: Nach dem Aufziehen der Brille streiften meine Augenwimpern gefährlich nahe an den kleinen, aber ziemlich dicken „Glaswänden“ vor den Augen. Das war schon ein komisches Gefühl. Allerdings wurde eines deutlich, was ab sofort intensiv behandelt wurde: Meine beiden Augen arbeiteten überhaupt nicht zusammen und verursachten dadurch erhebliche Probleme bei der optischen Wahrnehmung meiner Umwelt, und das schon seit meiner Geburt.
Erst operieren
Klar war auf jeden Fall auch, dass meinem Augenproblem nicht allein durch die Hilfe eines Optikers abgeholfen werden konnte, so viel Mühe dieser sich dabei auch gab. Er kannte aber einen in der Fachwelt bekannten Professor für Augenheilkunde in der Freiburger Universitätsaugenklinik, mit dem er sich in Verbindung setzte. Ich erhielt dann einen Untersuchungstermin in der Klinik.
Komische Frage
Bei seinen Untersuchungen stellte er mir eine komische Frage: „wie können Sie überhaupt Auto fahren?“, nachdem er bei den Sehtests feststellte, dass mir ein räumlich- perspektivisches Sehen faktisch nicht möglich ist. Wie gut, dass er seine Frage gleich selbst beantwortete. „Ihr Gehirn“, so belehrte mich der Herr Professor, „leistet bei Ihnen Höchstleistungen, weil es ersatzweise dafür sorgt, dass Sie sich dennoch räumlich orientieren können“.
Augenoperation (1997)
Nach vielen Untersuchungen war der Professor schließlich bereit, mich zu operieren, obwohl, – so wurde ich von ihm erneut belehrt, – „bei erwachsenen Patienten die Erfolgsaussichten nicht sehr hoch sind“. Ich bestand aber auf die Operation, weil ich darin meine einzige Chance sah, künftig besser sehen zu können. Das hat sich ausgezahlt. Es gelang dem geschickten und erfahrenen Operateur, meine Augenfehlstellung insoweit zu korrigieren, dass es für den Optiker anschließend möglich war, verträgliche Prismen-Sehhilfen anzupassen, um die restliche Fehlstellung der Augen - soweit noch möglich - auszugleichen. Damit konnte dann erreicht werden, dass schließlich beide Augen in etwa in die gleiche Richtung schauten. Mit diesen neuen Seheindrücken erlebte ich zwar keine vollständige Beseitigung meiner Sehschwächen, aber es wurde eine deutliche Verbesserung meiner Sehfähigkeit erreicht, was sich insbesondere beim Lesen und Schreiben bemerkbar machte. Eine ständige, schmerzhafte Überanstrengung der Augen konnte so beispielsweise nachhaltig erheblich reduziert werden.
Neue Chancen
Nun stand einer „goldenen“ Zukunft nichts mehr im Wege, dachte ich mir. Fortan war ich nun ermutigt, alle sich mir bietenden Chancen zu ergreifen, um mich beruflich zu verbessern. Allerdings, so befürchtete ich, könnten sich solche Chancen wieder eintrüben, weil ich nach der Geburt meiner Kinder ab dem Jahr 1992 für etwa neun Jahre nur noch in Teilzeit erwerbstätig war. Den anderen halben Arbeitstag war ich als Hausmann und mit der Versorgung der Kinder beschäftigt. Aber: Das Ei hat bekanntlich meistens nur einen Dotter, und ich musste mich entscheiden. Doch manchmal geschehen Dinge, welche sich normalerweise nicht ereignen. Trotz meiner Teilzeitbeschäftigung gelang es mir, eine ungewöhnliche berufliche Karriere zu starten, über die ich noch umfangreich in meiner AB erzählen werde. Schließlich wurde ich im Jahre 2002 sogar zum Bürgermeister in einer Schwarzwaldgemeinde gewählt.
Krankheit stoppt Höhenflüge
Leider stoppte eine schwere Erkrankung meinen abenteuerlichen Lebens- und Berufsweg nach vierzig Berufsjahren. Im Jahre 2013 zwang diese mich sogar, das Handtuch zu werfen. Ich wurde aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt. Abrupt war mein turbulentes berufliches Leben beendet und ich stand vor der Herausforderung, mit einem neuen Lebensabschnitt zurechtkommen, - dem Ruhestand.
Lesemuffel wird Buchautor
Nach einigen Jahren der Genesung und Umgewöhnung suchte ich nach einer spannenden Aufgabe. Leider war es mir aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich, irgendwelche Ehrenämter oder Ähnliches anzunehmen. Aber es bahnte sich ein anderes interessantes Betätigungsfeld an, mit welchem ich bisher nie in meinem Leben zu tun hatte. An einer großen Familienfeier zu meinem sechzigsten Geburtstag schlug mir meine ältere Schwester Gudrun vor, ich solle doch meinen ungewöhnlichen Lebensweg in einer Autobiografie aufschreiben, womit ich auch anderen Mitmenschen mit dem ADS, welche unter ihrem Handicap leiden, Mut machen könnte.
Große Schwester - Ideengeberin
Sie verriet mir auch eine gute Hilfestellung für ein solches Projekt und schickte mir einen Link zu der Schweizer Autorenplattform für Autobiografen „meet-my-life.net“. Da eine schriftstellerische Betätigung bisher nie ein Thema für mich war, brauchte es noch etwa zwei Jahre, um mich für ein solche - neue - Lebenserfahrung zu motivieren. Im Frühjahr 2019 war es dann so weit, und ich begann damit, mein Buch zu schreiben.
Konzentrationsmarathon
Für jemand, der - durch beschriebene Handicaps und trotz medizinischen Hilfen –, Bücher nur las, wenn es unbedingt sein musste (für Schule und Beruf, nicht in der Freizeit), war der Einstieg zunächst nicht einfach. Ich war bisher sehr viel besser im Geschichtenerzählen. Geschichten schreiben, das war etwas ganz Neues für mich. Aber ich war ja im Ruhestand und Pensionären wird stets empfohlen, dass sie ihr Gehirn mit neuen Aufgaben trainieren und fit halten sollen.
„meet-my-liefe.net“ machts möglich
Der Fragenkatalog von „meet-my-life.net“ bot mir tatsächlich – wie mir von meiner „großen“ Schwester vorausgesagt wurde, ideale Startbedingungen. Der „Trick“ war, mich durch ein Selbstinterview (durch das Lesen der angebotenen Fragen und der Suche nach Antworten) in meine Erinnerungswelt zuführen, um dann in diese einzutauchen zu können. Ich war total beeindruckt. Denn normalerweise löste es in mir stets ein Unwohlsein aus, wenn ich mich länger auf etwas fokussieren sollte. Besonders bei der Vorstellung, stundenlang etwas aufzuschreiben und das Geschriebene immer wieder neu überarbeiten zu müssen, bis der Stoff gut lesbar wird.
Spaß am Selbstinterview
Aber ich fand zu meinem Erstaunen mit der Zeit sogar Spaß daran, mir Fragen zu meiner Vergangenheit auszusuchen und sie zu beantworten. Der erste, große Themenblock befasste sich naturgemäß mit den frühen, nachfolgenden beschriebenen, Kindheitserinnerungen und es wurde nach dem Zeitgeschehen im Kindesalter gefragt.
Lebensreise erlebbar machen
Es folgten zahlreiche weitere Fragen zu vielen Lebensphasen, welche ich nach und nach beantwortete. Dabei kam viel Stoff für eine, – meine - spannende Lebensreise zusammen, über die ich in verschiedenen Kapiteln in meinem Buch erzähle.

Siehe nachfolgende Unterkapitel

2.1 Erste Kindheitserinnerungen
Stilles Kind
Über eigene Erinnerungen an die Zeiten als kleineres Kind verfüge ich erst ab dem Kindergartenalter. Meine Mutter berichtete mir jedoch, ich sei ein sehr stilles Baby bzw. Kleinkind gewesen, das kaum schrie. Sie habe sich manchmal Sorgen gemacht und nach mir geschaut, wenn ich sehr lange keine Töne von mir gab, um zu sehen, ob ich noch lebe. Solange in meinen ersten Lebensjahren wenig von mir gefordert wurde, lebte ich als Kind unbeschwert. Nachdem meine älteren Geschwister nur ein. bzw., zwei Jahre vor mir geboren wurden (1955, bzw. 1956), traf es sich gut für meine Mutter, dass ich ein sehr anspruchsloses Kind war, wie sie mir erzählte. Schließlich wurden drei, bzw., sechs Jahre nach meiner Geburt (1957) nochmals zwei Geschwister geboren. Bei fünf kleinen Kindern, welche meine Mutter dann zu versorgen hatte, war es sicher vorteilhaft, dass ich mich sehr ruhig und folgsam verhielt. Demgegenüber sei mein ein Jahr älterer Bruder Berthold als besonders lebhaftes Kind aufgefallen.
Vorname Gerold?
Als ich einmal gefragt wurde, ob meine Eltern bei der Auswahl meiner Vornamen eine gute Wahl getroffen hätten, konnte ich nicht spontan antworten. Ich habe mich an meine Vornamen gewöhnt, wenngleich der Rufname Gerold eher selten vorkommt. Aber das muss ja kein Nachteil sein.
Drei Vor- und auch Spitznamen
Mein dominanter Vater war – wie mir überliefert wurde – sehr bestimmend hinsichtlich der Namensfindung für seine Kinder. Meine Mutter legte allerdings bei dem einen oder anderen zu "exotischen" Vorschlag von ihm ihr Veto ein, wie sie mir einmal erzählte. Es sollte auch nicht nur ein Vorname je Kind bei der Namensuche herauskommen. Nein, alle fünf Kinder der Familie erhielten schließlich je drei Vornamen. Also suchten meine Eltern am Ende fünfzehn Vornamen für Ihren Nachwuchs aus.
Ritter und Heilige
Vater bevorzugte für seine drei Buben beispielsweise Namen, die an Ritter, Helden oder an Heilige erinnern. Meine Eltern waren stark katholisch geprägt, insbesondere mein Vater, der konservative Positionen vertrat. So kam es, dass ich den Rufnamen Gerold erhielt (Rittername, übersetzt: „der den Speer hält“). Weiter erhielt ich die Vornamen: Karl (Erinnerung an Karl den Großen oder an meinen Patenonkel Karl) und Maria (wie die Mutter Gottes oder zur Erinnerung an meine Patentante Maria).
Gerold Karl Maria – Künstlernamen?
Wäre ich ein erfolgreicher Künstler geworden, hätte ich mit dem Führen aller meiner Vornamen eine klangvolle Namenskombination präsentieren können: Gerold Karl Maria Löffler. Da mir Letzteres aber nicht vergönnt war, führe ich nur den Rufnamen Gerold.
Spitznamen
Spitznamen wurden mir auch verpasst. Ein solcher, der mich als Tagträumer meine ganze Kindheit begleitete, lautete "Schlofer" (alemannische Mundart, bedeutet Schlafmütze), oder ich wurde "Murmeltier" gerufen. Letzteres ist zwar ein putziges Geschöpf. Aber mein Vater rief mich nicht deshalb "Murmeltier", weil er mich niedlich fand, sondern weil dieser Nager einen großen Teil seines Lebens verschläft. Er benutzte in der Grundschulzeit und später noch einen anderen, technisch klingenden Spitznamen für mich, den ich aber mit meinem ein Jahr älteren Bruder teilen musste. So rief er uns beide gerne mit „ihr Tiefflieger“. Zwar konnten weder Berthold noch ich wirklich fliegen, also somit auch nicht „tieffliegen“. Was unser "liebes", männliches Elternteil damit meinte, war, dass er uns für nicht besonders hell im Kopf hielt, weil wir keine guten Schüler waren.
Großfamilie
Mit meiner Großmutter väterlicherseits waren wir eine acht Personen-Familie und lebten in einer Dachwohnung mit dreieinhalb Zimmern in der Freiburger Altstadt. In diesen engen Wohnverhältnissen bestimmte eine überwiegend aggressive Stimmung das Alltagsleben. Relativ entspannend empfand ich dann die Zeit, die ich ab dem Alter von drei Jahren im Kindergarten verbringen durfte.
Tagträumer mit Schulproblemen
Nach meiner um ein Jahr verschobenen Einschulung (festgestellte Entwicklungsdefizite) hatte ich Probleme mit der Aufnahme des Schulstoffes, weil ich mich kaum konzentrieren konnte. Mein durch das ADS permanent überfordertes Gehirn wollte mich vermutlich dadurch vor Überhitzung schützen, indem es mich in einen - mich ständig begleitenden - Traumweltmodus durchs Leben gehen ließ. Dies erfolgte automatisch, ohne mein aktives Zutun. Aber ich fiel dadurch negativ auf, war ständig abgelenkt oder unaufmerksam, was zum Beispiel meine Erziehungsberechtigten öfter provozierte.
Dankbarkeit
Natürlich habe ich auch schöne erste Erinnerungen an meine frühe Kindheit. Zum Beispiel an liebe Menschen, die mich begleiteten und auf die ich noch in den nachfolgenden Kapiteln näher eingehen werde. Und wenn ich mich an sie zurückerinnere, dann löst das in mir besonders dankbare Gefühle zu meinen Eltern aus. Zu Beginn meiner Autobiographie möchte ich daher die Lebensleistung meiner Eltern ganz besonders würdigen. Sie überlebten eine schwere Kriegs- und Nachkriegszeit und schafften, aus einfacher Herkunft stammend, über viele komplizierte Umstände, höhere Schulabschlüsse und Abschlüsse ihrer Studien. Direkt danach mussten meine Eltern, 1930 und 1931 geboren, in jungen Jahren große Herausforderungen mit der sehr schnell wachsenden Familie bewältigen: 1955 kam meine ältere Schwester, 1956 mein älterer Bruder, 1957 ich, 1961 meine jüngere Schwester und 1963 mein jüngster Bruder zur Welt.
Keine materielle Not
Dennoch gab es nie materielle Not in unserer Familie. Zwar brauchte es nach dem Abschluss des Studiums meines Vaters noch einige Zeit, bis er schließlich eine geeignete berufliche Aufgabe als Sozial- und Berufsfürsorger (Sozialarbeiter) beim Deutschen Caritasverband fand. Das Einkommen meines Vaters als Sozialarbeiter war vermutlich nicht hoch. Trotzdem konnte damit der große Haushalt finanziert werden, wenn auch mit sehr bescheidenen Möglichkeiten.

Freizeitbeschäftigungen
Besondere Nordsee-Ferien

2.4 Story: Wovor hatte ich am meisten Angst?
Angst-Erinnerung
Wie ich das in einem anderen Kapitel über die familiären Wohnverhältnisse als Kind noch ausführlicher erzähle, schliefen mein älterer Bruder und ich, als wir noch in der Altstadtwohnung wohnten, die letzten Jahre in einem Zimmer, das sich einen Stock unter der Wohnung unserer Familie befand. Das dort wohnende alte Ehepaar bot dies meiner Familie an, wegen unseren zu engen Wohnverhältnissen.
Folgen lautstarker Kissenschlachten
In diesem Zimmer, das nie beheizt wurde, durften wir Buben nur schlafen, tagsüber war der Aufenthalt dort nicht gestattet. In diesem externen Schlafgemach schliefen mein Bruder und ich nach dem Zubettgehen jedoch nicht gleich ein. Da ging‘s vor dem Einschlafen mitunter hoch her. Beliebtestes Spiel war die Kissenschlacht, aber nicht die einfache Werfversion. Nein, wir kämpften, wie angehende Männer dies stilgerecht tun: Ich griff meinen Bruder vom Fußboden aus von unten nach oben an, und er wehrte energisch meine tollkühnen Angriffe auf dem Bett stehend von oben nach unten ab. Komischerweise war diese Kampfposition - von unten nach oben - meine stets bevorzugte Aufstellung, kampftechnisch benachteiligte sie mich allerdings sehr. Die vielen Treffer von oben waren von unten schwer abzuwehren und verfehlten ihre Wirkung nicht. Aber ich war hart im Nehmen und stolz, wenn es mir zwischendurch auch mal gelang, die Schläge meines Kampfkissens von unten so nachhaltig mit Wirkungstreffern nach oben zu führen, dass mein Gegner – oben − ausgeschaltet wurde. Solche Erfolge gab es tatsächlich auch, leider jedoch viel zu selten. Wenn sie aber gelangen, dann blieb auch ein besonders lautstarkes Kampfgetöse nicht aus.
Bauz, da geht die Türe auf!
Die unangenehmen Folgen dieser brüderlichen Kampfspiele waren zwar immer die gleichen, aber das hielt uns − warum auch immer − nicht davon ab, doch immer wieder lautstark mit unseren Kopfkissen in die Schlacht zu ziehen. Das mahnende Klopfen unserer Zimmerwirtin überhörten wir dabei meistens, nicht aber die unüberhörbaren – bedrohlichen - Geräusche, welche Unheil androhten, wenn unsere Kampfgeräusche wieder einmal ausgeufert waren und wir - wieder einmal - zu spät die akustische Eigendynamik unseres Tuns deutlich unterschätzt hatten.
Knarrende Holzstufen
Das uralte Haus hatte ein riesiges Treppenhaus mit einer Holztreppe und extra großen Trittstufen. Wenn man darauf trat, knarrte das Holz laut, und die Knarr-Geräusche produzierten einen bestimmten Nachklang in den uralten Gemäuern. Besonders laut, wenn unser wütender Vater begann, diese − unter seinem Super-Schwergewicht besonders laut und knarrend − hinunterzuschreiten, um bei seinen lautstark kämpfenden Sprösslingen „vorbeizuschauen“. Seinen jeweils wütenden Gesichtsausdruck beim Eintritt in unserer Kampfarena werde ich nie vergessen! Was dann geschah, passt gut zu dem Thema: "Wovor hattest Du am meisten Angst?"...

2.5 Hans guck in die Luft - ein Tollpatsch (60erjahre)
Unfallspezialist
Als ein typischer HANS GUCK IN DIE LUFT, - ein Tagträumer -, konnte ich mich als Kind auch bei ganz alltäglichen Dingen sehr schlecht konzentrieren. Hinzu kam, dass mein Gleichgewichtssinn unterdurchschnittlich entwickelt war. Viele unvergessliche Stürze und Verletzungen waren die Folge.
Auf Kollisionskurs
Ich benötigte daher nicht unbedingt eine gefährliche Umgebung, um im Alltag das eine oder andere Mal vom rechten Weg abzukommen. Auch das waren leider unvergessliche Geschichten in meiner frühen Kindheit. So konnte es durchaus vorkommen, dass ich auf einem Gehweg den Rohrpfosten eines Verkehrsschildes übersah. Auch Kollisionen oder Abstürze bei Kletterübungen in Trümmergrundstücken führten dazu, dass ich des Öfteren Verletzungen auskurieren musste. Ansonsten neigte ich zu spontanen, unüberlegten Ideen und Handlungen.
Tollpatsch - kleine Story: Ins eigene Auge
Ganz blöde lief beispielsweise ein Experiment, das mir spontan einfiel, und an das ich mich noch genau erinnere. So fühlte sich mein junger Forschergeist angetrieben, einen spannenden technischen Versuch durchzuführen. Es gab früher solche trichterartigen Spielgeräte, die der Spieler in der Hand hielt und in welche man kleine Bällchen einlegte, die dann durch Betätigung eines Auswurfknopfes aus dem Kunststoffgehäuse herausgeschleudert wurden. Die zurückfallenden Bällchen musste man mit dem Fangtrichter wieder auffangen. Das machte sehr viel Spaß. Eines Tages hatte ich eine Idee. Ich wollte wissen, was geschehen würde, wenn ich statt eines Bällchens ein sehr kleines Lego-Teilchen auf die Auswurfspange des Spielgerätes legte. Selbstverständlich wollte ich die Reaktion des kleinen Legostückchens in der Abschussphase ganz genau beobachten, und positionierte meine Augen − mit kleinem Abstand − direkt über den Auswurftrichter. Beim Betätigen des Auswurfknopfes schoss dann tatsächlich auch mein Mini-Legoteilchen mit Wumms nach oben. Was technisch unvermeidlich war, trat nun auch leider ein: Das kleine Geschoss flog nicht, wie sonst die Bällchen, in das offene Himmelszelt, sondern kerzengerade in eines meiner im Beobachtermodus positionierten Augen, welches (nur) optisch das Geschehen einfangen wollte. Nach diesem unglücklich abgelaufenen Experiment musste ich längere Zeit eine schwarze Piraten-Augenklappe tragen, was meinem Image, dass mit mir ein unverbesserlicher Chaot heranwachsen würde, sehr zuträglich war. Aber es sorgte auch für eine Menge Amüsement um mich herum. Kleine Trottel (zum Beispiel Kinder mit dem ADS) wirkten auch seinerzeit schon wie Clowns und konnten die Menschen zum Lachen bringen.

2.6 Familie und kirchliche Tradition (60erjahre)
Familie und Kirchenfeste
Die Feiertage wurden in unserer Familie in der katholisch geprägten Tradition gefeiert. Darüber erzähle ich auch in anderen Kapiteln. Wie bedeutend Feiertage und die Pflege christlicher Traditionen beispielsweise an Sankt Nikolaus waren, lässt sich am besten mit selbst erlebten Geschichten aus jener Zeit darstellen.
Doppelter Sankt Nikolaus
Sankt Nikolaus besuchte uns in der Familie und im Kindergarten. Zu Hause war der Mann unter dem Nikolausgewand aber bald identifiziert: Es handelte sich um einen Berufskollegen meines Vaters, der öfter bei uns zu Besuch war. Er war ein lieber und guter Sankt Nikolaus, sehr freundlich und brachte uns stets schöne süße Dinge mit. Seine Ermahnungen an uns klangen eher sanft. Somit war dieser Sankt Nikolaus beliebt bei uns Kindern. Vermutlich kam er deshalb in den Folgejahren wieder bei uns vorbei, obwohl er wusste, dass wir wussten, wer er war.
Strengerer Kindergarten-Nikolaus
Andere Eindrücke gab es im Kindergarten: Dort trat ein eher strenger Sankt Nikolaus auf, mit einem Knecht Ruprecht an seiner Seite, der eine große Rute mit sich führte. Sankt Nikolaus hatte eine große Bischofsmitra auf dem Kopf und trug einen langen, weißen Vollbart. Er stützte sich auf einen riesigen Bischofsstab. Wenn ich mich richtig erinnere, bekam jedes Kind ein kleines Geschenk von ihm ausgehändigt. Vor dieser Beschenkung gab er aber dem jeweiligen Kind Ermahnungen mit, die er aus einem großen Buch vorlas. Bei manchen Kindern − meistens Buben − blieb es nicht bei Ermahnungen, in solchen Fällen wurde der Knecht Ruprecht von ihm angewiesen, von seiner Rute Gebrauch zu machen (jedoch eher mit symbolischen Ruten-Berührungen). Einmal ergab sich dazu ein besonders spannendes Finale des Nikolausbesuches, an das ich mich bis heute noch gut erinnern kann: Bei einem besonders bösen Buben − vielleicht ein Kind mit ADHS −, der das ganze Jahr über als Spitzbube und Zappelphilipp aufgefallen war, blieb es nicht bei den symbolischen Ruten-Klatscher von Knecht Ruprecht.
Bursche in den Sack
Sankt Nikolaus gab in seinem "Fall" sogar die Anweisung, ihn, den "besonders ungezogenen Burschen" in einen großen Sack zu stecken (nur symbolisch, wie es sich herausstellte). Ein absolutes Highlight für uns Kinder, welches wir - hoch angespannt – und genaustens beobachteten, schien greifbar nahezukommen. Sankt Nikolaus und sein Knecht Ruprecht boten Spannung pur! Der böse Bube schrie auf vor Schreck, als Knecht Ruprecht ihn in einen offenen Sack stellte (ohne diesen über ihm zu verschließen). Nach diesem Spektakel waren wir Kinder froh, als sich danach "Sankt" Nikolaus mit seinem dunklen Begleiter wieder verabschiedete.
Missetat
Apropos Missetaten zur Adventszeit: Im Kindergarten wurde in der Adventszeit eine große Krippe aufgestellt. Neben der Krippe lagen in großer Zahl aufgehäuft Strohhalme. Immer dann, wenn ein Kind besonders lieb oder sonst irgendwie positiv aufgefallen war, durfte es vor allen anderen Kindern einen Strohhalm in die Krippe einlegen. Bis am Heiligen Abend war dann genug Stroh in der Krippe ausgelegt, damit das Jesuskind sich darin durchaus wohlfühlen konnte. In einem Jahr zu Advent (wahrscheinlich war ich noch nicht lange im Kindergarten), stand ich für einen Augenblick unbeaufsichtigt und allein in unserem Gruppenraum im Kindergarten. Wahrscheinlich wurde ich etwas zu spät abgeholt. Jedenfalls erkannte ich sofort die Gelegenheit: Wenn ich schnell handelte, konnte ich unbemerkt einen Strohhalm hinzufügen. Ich spüre noch das Herzklopfen, das ich hatte, als ich es tatsächlich tat, nämlich einen ganzen Strohhalm unverdient und heimlich in die Krippe zu legen. Meine Missetat blieb wahrscheinlich, dem Jesuskind sei es gedankt, unbemerkt. Wie erleichtert ich war! Diese Erleichterung nach einer hochangespannten Situation zu spüren, empfand ich sehr beglückend.
Vorverlegt
Als kinderreiche Familie waren wir nicht wohlhabend. Die Ausrichtung des Festes für die Erstkommunion der Kinder war bei unserer vielzähligen Verwandtschaft, die eingeladen wurde, eine teure Angelegenheit. Deshalb beantragten meine Eltern im Pfarramt, ich sollte ein Jahr früher als vorgesehen und zusammen mit meinem ein Jahr älteren Bruder das Fest der ersten Heiligen Kommunion begehen dürfen. Da mein Vater Mitglied des Pfarrgemeinderates war, gab es keine Probleme, und dem Antrag wurde entsprochen. Üblicherweise wurden die Kinder einige Monate zuvor in Gruppen von der Pfarrgemeinde auf dieses große kirchliche Fest vorbereitet, also in bestimmten biblischen und kirchlichen Themen unterrichtet. Da für mich in diesen Gruppen aber kein Platz mehr war, bot mein Vater dem Pfarrer an, ich könne von ihm mit häuslich stattfindendem Privatunterricht beschult werden.
Überforderter Privatlehrer
Mein Vater war nicht nur studierter Sozialarbeiter, er hatte auch während seines Studiums eine kirchenamtliche Lehrerlaubnis, "Missio canonica" genannt, erworben. Diese berechtigte ihn dazu, Kindern bis zu einem bestimmten Alter Religionsunterricht zu erteilen. Also machte sich mein Vater daran, mir, seinem Sprössling mit ausgeprägtem ADS-Handicap, einen für meine kindlichen Ohren langweiligen biblischen und kirchlichen Unterrichtsstoff mit viel Strenge und wenig Herz zu vermitteln. Unter anderem musste ich die Zehn Gebote auswendig lernen. Auswendiglernen war, − wie so vieles in dieser Zeit −, allerdings überhaupt nicht meine Stärke. Leider wurden von meinem „Hauslehrer“ sowohl diese Zehn Gebote zu meiner "Freude" ständig abgehört wie auch irgendwelche mehr oder weniger spannenden biblischen Geschichten, die ich mir alle merken sollte. Für diese Aufgaben brauchte ich vermutlich sehr viel Zeit. Wahrscheinlich wesentlich viel mehr, als sich dies mein Privatlehrer vorstellen konnte. Zwar war mein Vater kirchlich geprüfter Religionslehrer, aber als Religionslehrer, und insbesondere mit einem solchen Sonderförderunterricht für seinen lernschwachen Sohn, hatte er keinerlei Erfahrung. Seine Frustrationstoleranz war sehr überschaubar. Die väterliche Einzel-Unterrichtsaktion musste somit folgerichtig scheitern, allerdings mit finalen lauten Misstönen und manchem "Kanonendonner".
Delegiert
Mein gescheiterter familiärer Religionslehrer delegierte schließlich die heikle Mission an meine zwei Jahre ältere Schwester Gudrun. Als Naturtalent im Fach Religionspädagogik, wie er sich wahrscheinlich nach wie vor fühlte, dachte sich mein Vater nun einen ganz schlitzohrigen Schachzug aus: Als Motivationsschub stellte er Gudrun Nachteile und Bestrafungen in Aussicht, falls sie die von ihm übertragene Aufgabe mit ihrem kleinen trotteligen Bruder nicht sorgfältig ausführen und diese Mission nicht mit Erfolg zu Ende bringen würde. Der Erfolgsdruck war daher enorm, sowohl für Gudrun als auch für mich. Ich wollte natürlich auf keinen Fall daran schuld sein, dass meine Schwester, die ich sehr liebhatte, meinetwegen Probleme mit meinem Vater bekam und deshalb sauer auf mich sein würde. Wahrscheinlich war dieser unschöne väterliche Druck letztlich doch zielführend, denn am Ende nahm ich dank Gudrun alle Hürden für die Zulassung zur vorzeitigen Erstkommunionfeier.

2.7 Besondere Story: Beichtstuhl-Schummelei
Mein ein Jahr älterer Bruder Berthold und ich machten im Rahmen der Vorbereitung zur Erstkommunion auch die ersten Beichtstuhl- Erfahrungen. Wir Erstkommunikanten lernten dabei, welchen Sinn die Beichte für die Sündenvergebung hat und welche Vorbereitungen, Gewissenserforschung genannt, für das Beichtgespräch mit dem Priester im Beichtstuhl erforderlich waren.
Zulassungsbedingungen
Praktisch war der Ablauf so, dass sich die Kinder Gedanken über ihre Sünden machten und diese auf einen Beichtzettel aufschrieben. Die Inhalte des Beichtzettels wurden dann im Beichtstuhl dem Priester, Beichtvater genannt, vorgelesen. Also bereitete ich mich sorgfältig auf diese erste Beichte vor und schrieb einige "Sünden" auf meinen Beichtzettel.
Am Beichttag versammelten sich die Kinder im Seitenschiff des Freiburger Münsters an den Bänken vor den Beichtstühlen.
Interessante Lichttechnik
Diese wirkten auf mich wie Holzschränke, in welche man eintrat, mit zwei Zugängen, je ein Zugang für den Beichtenden und ein weiterer für den Priester. Sobald ein Beichtender in den Beichtstuhl eintrat, auf die kleine Bank kniete und sich die Türe schloss, schaltete automatisch eine Leuchte von Weiß auf Rot. War das Beichtgespräch beendet und der Beichtende trat aus dem Beichtstuhl wieder aus, leuchtete das Lämpchen wieder in Weiß. Das war für mich interessant anzuschauen.
Gut vorbereitet!
Meinem Beichtgespräch selbst konnte ich gelassen entgegensehen, bei aller Aufgeregtheit vor dem bisher unbekannten Erlebnis. Weniger gelassen muss sich jedoch mein nachlässiger Bruder gefühlt haben, denn er wagte es doch tatsächlich, ohne einen vorbereiteten Beichtzettel zu seiner ersten Beichte zu kommen. Schließlich begann mein Beichtgespräch, bevor Berthold an der Reihe war.
Taschendieb
Als ich den Beichtstuhl nach der Beichte – befreit von Sünden – erleichtert verließ, wurde ich von dem wartenden Berthold mit fuchtelnder Körpersprache empfangen, was mich irritierte. Bevor ich darüber nachdenken konnte, was mein Beichtkollege von mir wollte, zupfte mir dieser blitzschnell meinen Beichtzettel aus der Hand und flüsterte mir noch zu: „Wir haben ja die gleichen Sünden"(!). Danach verschwand die coole, freche Socke, wie man heute sagen würde, im Beichtstuhl.
Lämpchen auf ROT
Nicht nur das Lämpchen am Beichtstuhl schaltete nun auf Rot um, sondern auch meine Gesichtsfarbe, denn ich war empört, und mein eben erst gewonnener Seelenfriede war im Eimer. Für eine angemessene Reaktion war ich jedoch viel zu verdutzt. Meine Verärgerung wurde kein bisschen gelindert, als Berthold augenzwinkernd und frech lächelnd aus dem Beichtstuhl zurückkam und mich auch noch dankbar anrempelte! Warum der Priester im Beichtstuhl diesen Betrug nicht bemerkte, als er von meinem Bruder die wortgleichen Sünden vorgelesen bekam wie bei mir kurz zuvor, das blieb allerdings ein Beichtgeheimnis.

2.8 Familienleben in den Jahreszeiten (60erjahre)
I. Winter
Besondere Erinnerungen habe ich an die Winterzeit. In dieser Jahreszeit galt es täglich, Kohlen und Brikett-Eimer von dem Tiefkeller des Hauses in die Wohnung der oberen Geschosse zu schleppen. Nicht weit vom Wohnhaus war der Freiburger Schlossberg erreichbar, ideal zum Schlittenfahren für uns Kinder. Im Gegensatz zu heute fiel damals in der Breisgau-Metropole noch Schnee. Auf dem Schlossberg gab es stark abschüssige Wege, auf denen unsere Schlitten mächtig Tempo bekamen. Außerdem kann ich mich noch an die eine oder andere Frostbeule erinnern, wenn wir zu lange draußen im kalten Winterwetter verweilten. Die Weihnachtszeit war natürlich, wie schon erzählt, auch immer spannend.
Abfahrtstechniken
Beim Schlittenfahren war ich übrigens nicht so mutig wie mein älterer Bruder Berthold. Er war der Schlitten-Artist unter uns beiden. Um das Tempo des Schlittens bei der Abfahrt noch zu steigern, saß er nicht aufrecht, nein, er legte sich mit dem Bauch auf den Schlitten, Kopf voraus. Den Vorteil des Sitzens beim Schlittenfahren (meine konventionell angewandte Fahrtechnik) sah ich darin: Wenn man hinfiel, was ja ab und zu der Fall war, fiel man nur auf den Hintern oder sonst relativ ungefährlich. Eine unfreiwillige Vollbremsung am steinigen Wegesrand bei hohem Tempo, welche Berthold leider bei einer rasanten Abfahrt einmal widerfuhr, gab mir recht. Er kam nämlich umständehalber mit dem Kopf, sogar mit seinem Gesicht zuerst an.
Kostümierung
An den Dreikönigsfesten im Januar kam die farbenfrohste Rolle auf mich zu, welche es zu vergeben gab. Ich war nämlich – alle Jahre wieder − das dunkelhäutige Mitglied der Dreikönigsfamilie. Wie man damals diesen König genau beschrieb, das würde heute zu Irritationen führen. Mein älterer Bruder trug meistens den Bethlehem-Stern, um uns Heiligen Drei Königen den Weg zu weisen. Alte Fotos beweisen: Mein königliches, farbenfrohes Kostüm war vom Feinsten. Sogar ein großer, bläulich funkelnder Stein baumelte an meinem Turban, den meine Mutter kunstvoll formte. Rollengerecht trug sie auch ordentlich dunkle Farbe auf meine kleinen Königsbäckchen auf, die manchmal den weißen Turban etwas anfärbte. Die Schminkerei und das Baumeln des Funkelsteines über meinen Augen nervten mich zwar ebenso wie das Abwaschen der Farbe aus meinem Gesicht nach den Hausbesuchen. Auch juckte der Turban mit der Zeit, weil ich unter diesem wolligen Turm schwitzte.
Süße Beute
Aber ein Blick auf die Beute, die in einer großen Tasche bei allen Hausbesuchen und besonders bei den Auftritten in Altenheimen gesammelt wurde, brachte das königliche Team in Freudenstimmung. Unzählige Schokoladentafeln und alle möglichen Süßigkeiten warteten darauf, gerecht aufgeteilt zu werden.
II. Frühjahr
Fröhliche Ostern
Mit dem Ende der Karwoche und dem beginnenden Osterfest konnte ich als Ministrant interessante Beobachtungen machen. Nach den traurigen Gottesdiensten in der Karwoche, bei welchen mein Bruder und ich ministrierten, wechselte die Stimmung um mich herum: Beim beginnenden Osterfest fühlte sie sich viel positiver an, und die Melodien der Lieder mit österlichen Texten klangen fröhlicher. Manche Osterlieder mit fröhlichen Melodien habe ich heute noch im Kopf. Zum Beispiel: Halleluja, lasst uns singen, denn die Freudenzeit ist da. Ohne dies näher begründen zu können: In mir kamen beim Singen solcher Lieder tatsächlich befreiende Gefühle hoch, und ich meinte zu bemerken, dass es den um mich herumstehenden und mitsingenden Leuten auch so ging. Das gefiel mir. Weniger gefielen mir allerdings die nie enden wollenden Predigten bei den feierlich gestalteten Ostergottesdiensten.
III. Sommer
Meine Sommerzeit-Erinnerungen beinhalten natürlich viele Freibadbesuche, das Spielen im Freien, überhaupt viel draußen sein, was ja auch die Abwesenheit von den beengten Wohnverhältnissen mit dem überhitzten familiären Wohnklima bedeutete. Hitzefrei in der Schule bejubelte ich ebenso wie den Beginn der langen Sommerferien. Schulfreie Zeit bedeutete für mich überhaupt ein besseres Allgemeinempfinden. Außerhalb des Schulbetriebes fühlte sich das Leben stressfreier an.
IV. Herbst
Geburtstagsmonat November
Im Herbst gab es ein bedeutendes Ereignis: Meinen Geburtstag im November! Geburtstage wurden bei uns traditionell im großen Verwandtenkreis und manchmal gesondert als Kinderparty mit Schulkameraden gefeiert. Verwandte hatte ich viele: Großeltern, Tanten, Onkels und neben allen Geschwistern eine große Zahl Cousinen und Cousins. Da gab es Unmengen Kuchen zu verdrücken und es warteten viele Geschenke, über die ich mich freute.
Partys stressen ADS-Kind
Mit der Zeit waren aber diese Feiern viel zu laut für mich und verbunden mit sehr viel Unruhe, was bei mir, als Kind mit dem ADS, leider zunehmendes Unwohlsein herbeiführte. Sobald der Stress-Modus einsetzte, fiel es mir zunehmend schwerer, mich an Gesprächen oder Spielen zu beteiligen, und meine Gäste konnten nur noch wenig mit mir anfangen. In diesen Situationen machte ich meinem Image als "Schlofer" alle Ehre. Neben allem Schönen, was ich bei meinen Geburtstagsfeiern erleben durfte, war ich deshalb froh, wenn sich die vielen Gäste abends wieder verabschiedeten.
Start ins neue Schuljahr
Den Wiederbeginn des Schuljahres im Herbst habe ich als stets neuen Versuch und Anlauf mit besten Vorsätzen in Erinnerung, in der Hoffnung, es werde im neuen Schuljahr besser laufen. Leider blieben solche versuchten positiven Neustart-Phasen, wie in anderen Kapiteln beschrieben, bis zur vorletzten Hauptschulklasse erfolglos. Spannend war natürlich, mit welchen Lehrern man es im neuen Schuljahr zu tun hatte.
V. In allen Jahreszeiten
Saisonale Kleiderordnungen
Noch abschließend zum Thema Familienleben in den Jahreszeiten, eine Jahreszeiten- übergreifende Erinnerung: Naturgemäß begleitete uns Geschwister eine saisonal angepasste Bekleidung. Für uns Buben fiel diese recht überschaubar aus: Im Sommer griff Mutters Faustregel, ab 25 Grad war es Zeit für die Sommer-Anziehsachen. Fester Bestandteil waren die kurzen Hosen. Das war ganz angenehm. Werktags, also von Montag bis Samstag, trugen wir Buben kurze Lederhosen mit Trägern, so wie die meisten Jungs zu jener Zeit. Sonntags galt: kurze, graue Stoff-Hosen. Unter der 25-Grad-Zone hatten wir Dreiviertel- Lederhosen und Kniestrümpfe an. Sonntags kleideten wir uns mit langen, grauen Stoff-Hosen und blauem Oberteil. Bis dahin handelte es sich um bequem tragbare Kleidungsstücke.
Erzfeindin Strumpfhose
Schwieriger wurde es bei Minusgraden im Winter. Da wünschte Mama, dass wir unter die Dreiviertel-Lederhosen Strumpfhosen anzogen. Ausnahme: sonntags. Unter den langen hellgrauen Stoff-Hosen konnten lange Unterhosen getragen werden. Bei den Lederhosen waren lange Unterhosen aber definitiv unmöglich, wegen des Kniebundes. Deshalb mussten Strumpfhosen angezogen werden. Eine juckende Katastrophe! Das Tragen von Strumpfhosen unter den Dreiviertel-Lederhosen hatte zwei gewaltige Haken: Erstens zogen Buben keine Strumpfhosen an, das war ein No-Go. Wenn man als Junge damit in der Schule gesehen wurde, war das mehr als peinlich. Zweitens: Diese „sch..“ Strumpfhosen trugen sich höchst unangenehm auf der Haut und juckten, dass man verrückt werden konnte. Solange ich sie trug, muss meine Gangart seltsam gewirkt haben, vermutlich ging ich wie auf Eiern. Oft zogen wir die verhassten Strumpfhosen auf der Schultoilette wieder aus. Das klappte jedoch nur, wenn es gelang, zu Hause ein Paar Kniestrümpfe in den Schulranzen zu schmuggeln. Vergaß man das, dann gewann an diesem Schulvormittag leider die Strumpfhose!

2.9 Erste Wohnungen für Großfamilie (1957-1971)
Wohnen in der Kindheit
"Mittelalterlich"
Wie in ganz Nachkriegs-Deutschland herrschte in Freiburg Wohnungsnot bei vielen Baulücken und Trümmergrundstücken. Wir hausten wie erwähnt äußerst beengt mit acht Personen in einer Drei-Zimmer-Dachwohnung eines uralten Hauses aus dem 14. Jahrhundert, was zu einer konfliktreichen Familien-WG führte. Diese kleine Wohnung hatte kein Bad und nur eine Wasserstelle in der Küche. Gebadet wurden wir Kinder etwa wöchentlich von der Mutter in einer öffentlichen Badeanstalt. Erst nach dem Umzug 1971 in eine deutlich größere Fünf- Zimmerwohnung wurde die Wohnsituation besser. In der neuen Wohnung gab es auch ein Badezimmer, allerdings war ich da schon fast dreizehn Jahre alt. Bis 1971 hatten wir Kinder keine eigenen Zimmer.
Extra "Herrenzimmer" für Ego-Vater:
Von den drei Zimmern und einer Dachkammer mit Fenster zum Hausgang, beanspruchte mein Vater ein eigenes Zimmer (siehe auch Erzählungen dazu in anderen Kapiteln). Also bewohnte der Rest der achtköpfigen Großfamilie die verbliebenen zwei Zimmer, meine Oma Laura die kleine Kammer. Vaters Herrenzimmer war immer steril aufgeräumt. Darin standen ein mächtiges blaues Sofa und eine Schrankwand. Der Raum war mit Gegenständen dekoriert, die mit Vaters Beruf und seiner Tempelritter- Ordenszugehörigkeit zu tun hatten (siehe Erzählungen dazu in einem späteren Kapitel).
Kapellenartig
Der kapellenartige Charakter des Herrenzimmers wurde durch einige kostbare Wandikonen, gemalt von Mönchen des griechischen Klosters Athos, unterstrichen, beispielsweise mit Abbildungen der Mutter Gottes. Auf einem massiven Schreibtisch befand sich, neben anderen Dekorationsstücken, ein Kassettenrecorder, mit dem mein Vater oft gregorianische Choräle oder Volksmusik abspielte. Für uns Kinder war normalerweise der Zutritt verboten. Umso spannender, aber auch gefährlich, (handfeste Folgen) war es, wenn wir Kinder trotzdem in einem unbeobachteten Augenblick in diesen seltsamen Raum gingen. Gäste übernachteten bei uns selten. War dies aber doch der Fall, übernachteten sie auf dem dort stehenden, schweren blauen Sofa, das man ausklappen konnte.

2.11 Story: Nachbarbesuch - Generalvikar (60erjahre)
Ganz besonderer Nachbar
Strenger Würdenträger
Im rechts gelegenen Nachbarhaus wohnte ein in vielfältiger Hinsicht hoher Geistlicher, Generalvikar genannt, also nach den Bischöfen ranghöchster Geistlicher. Viel gibt es zu dieser Nachbarschaft nicht zu berichten, denn eine mindestens zwei Mann hohe Mauer trennte sein Nachbargrundstück von dem langen Hof, der zu unserem Haus gehörte.
Kauziger alter Mann
Er war ein alter, kauziger Mensch, der schon in der Weimarer Republik als Abgeordneter aktiv gewesen war. Ministrieren durfte bei ihm nur ein ausgewählter Ministrant, welcher während der von ihm gelesenen Messe sich so peinlich genau an seine Vorstellungen des Ministrierens hielt, dass er nicht wütend werden musste. Dazu neigte er wohl öfters. Ich erinnere mich daran, dass viele Menschen Angst vor diesem großgewachsenen, alten, knurrigen Mann hatten. Vor allem gegen schwache Menschen, − so wurde erzählt −, konnte er sehr harsch sein.
Übermut tut selten gut
Wir Kinder fürchteten uns davor auch einmal sehr, denn eins von uns Geschwistern – vermutlich der temperamentvolle Berthold − kickte unseren Ball, mit dem wir spielten, über die hohe Begrenzungsmauer zum Generalvikar-Nachbarn. Diesen Ball hatten wir sogleich abgeschrieben, denn keiner von uns traute sich, beim strengen „Nebenan" vorbeizugehen, um „es“ zu fragen, ob wir unseren vom rechten Weg abgekommenen Ball wieder aus seinem Garten holen dürfen. Den Eltern erzählten wir auch nichts davon, das hätte wieder Ärger mit dem Vater erzeugen können.
Kurze Story dazu:
Aufregender Kurzbesuch
Einige Tage später läutete es abends an unserer Haustürklingel. Von unserer Dachgeschosswohnung konnte man tief hinunter schauen in das große Treppenhaus des uralten Hauses. Neugierig wie immer erkundeten wir Kinder, wer uns besuchen würde. Eine große Gestalt betrat schließlich die sogleich laut knarrenden alten Holztreppen ganz unten im Erdgeschoss und kam mit schweren Schritten, Stockwerk um Stockwerk, immer näher zu uns hinauf. Plötzlich stand er oben bei uns vor der Wohnungstüre, dieser furchteinflößende Nachbar. Mit dem Besuch dieses alten und stämmigen Mannes mit dem strengen Gesicht, hatte niemand gerechnet. Daher war die Situation auch besonders aufregend. Sogar unser Vater wirkte etwas erschrocken.
Corpus Delicti
Wir Kinder fühlten uns sogleich etwas unwohl, als uns unser unerwarteter Besucher ansprach. Denn es meldete sich das schlechte Gewissen in uns. Der Grund: Er hielt unseren kleinen Ball in seiner Hand, welchen wir vor kurzem unabsichtlich in hohem Bogen über die Grenzmauer gekickt hatten. Aber wir hätten uns allesamt nicht in die Hosen machen müssen.
Gnade vor Recht!
Den hochwürdigsten Herrn Generalvikar der Erzdiözese Freiburg, stimmten unsere weit aufgerissenen Kinderaugen, die ihn alle neugierig und ängstlich fixierten, offenbar milde. Denn mit einem unerwarteten Lächeln in seinem Gesicht überreichte er uns Kindern unser Bällchen mit der kurzen Bemerkung: „Der gehört wohl Euch." Das machte uns alle für einige Sekunden total sprachlos. Ohne weitere Worte zu verlieren, drehte der Generalvikar wieder um und schritt mit schweren, knarrenden Schritten wieder die vielen Treppen hinunter. Eine Gänsehaut machte sich bei mir breit, vermutlich aber nicht nur bei mir. Erst mit Verzögerung riefen wir Kinder "danke" in das dunkle weite Treppenhaus hinunter. Ob unser Nachbar das noch mitbekam, daran erinnere ich mich nicht mehr, wohl aber an diesen spannenden Auftritt.

Geburtsjahr 1957 - Zeitgeschehen
Nachkrieg
In welche Zeit wurde ich geboren? Was war los im Jahr 1957? Das war auch eine konkrete Frage bei meet-my-life. Manche Antworten darauf, die ich aufschrieb, habe ich "gegoogelt", andere stammen aus rückblickender Erinnerung. Ich wurde jedenfalls zwölf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges geboren. Wie in ganz Nachkriegs-Deutschland gab es auch in meiner Geburtsstadt Freiburg Wohnungsnot und noch viele Baulücken und Trümmergrundstücke. West-Deutschland war noch immer dabei, sich wieder als ein selbständiges, demokratisch regiertes und verwaltetes Land zu organisieren. Politisch war die Zeit jedoch geprägt vom Kalten Krieg. Sowohl West-Deutschland als auch die DDR rüsteten sich wieder mit Armeen und Waffen auf, in Kooperation mit ihren jeweiligen Verbündeten (NATO bzw. Warschauer Pakt).
Wirtschaft
In Schwung kam aber dennoch die Wirtschaft, und der Wohlstand wuchs. Sehr unterstützt wurde diese Entwicklung von den USA, mit dem sogenannten Marshallplan, um Westeuropa zu helfen, die Schäden aus der Kriegszeit zu überwinden und die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das für damalige Verhältnisse mit gigantischen Finanzmitteln ausgestattete Konjunkturprogramm wurde Anfang der fünfziger Jahre vom amerikanischen Kongress beschlossen und in Kraft gesetzt.
Aber es dauerte viele Jahre, bis sich dann schließlich die wirtschaftlichen Verhältnisse − insbesondere in West-Deutschland – stabilisieren konnten und man in den Sechzigerjahren schon von einem Wirtschaftswunder sprechen konnte. Damit verfolgten die USA aber auch eigennützige Ziele, weil sie ein starkes West-Europa als Garant sahen, dass dieses vom Einflussbereich der Sowjetunion und ihren verbündeten Staaten ferngehalten werden kann. Strategisch wurde dieses Ziel der Amerikaner parallel durch eine starke Militärpräsenz – vor allem in West-Deutschland – verfolgt, inklusive einer atomaren Aufrüstung. Um den wachsenden Energiebedarf in West-Deutschland decken zu können, wurden insbesondere um mein Geburtsjahr 1957 herum viele Atomkraftwerke an verschiedenen Standorten in West-Deutschland gebaut. Ebenfalls im Jahr 1957 erfolgte auch die Wiederwahl von Konrad Adenauer zum Bundeskanzler.
Fünfziger- und Sechzigerjahre – Rollenverteilung
Die Mütter der − damals oft kinderreichen − Familien waren wirtschaftlich von ihren Männern abhängig. Das Familienmodell war klar: Väter nahmen ihre Rolle als Brot-Verdiener ein, waren also berufstätig. Ehefrauen wurden üblicherweise nach Eheschließungen für die Haushaltsführung und für die Kinderversorgung zuständig. Wollten sie auch einer Erwerbstätigkeit nachgehen, mussten nach der bis in die Siebzigerjahre gültigen Gesetzeslage ihre Ehemänner zustimmen.
Spießbürgertum
Die Menschen waren in den Fünfzigerjahren (auch 1957) noch sehr verklemmt in einer Spießbürgerlichkeit bis Ende der sechziger Jahre. Die Kirchen hatten sehr viel Einfluss. Erst Ende der sechziger Jahre brachen diese veralteten und fragwürdigen Verhaltenszwänge auf. Auch galten noch teilweise die aus Zeiten vor Kriegsende übernommenen autoritären Strukturen in den staatlichen Verwaltungen, in der Polizei und im Bereich der Justiz. Es brauchte noch viele Jahre, bis alle staatlichen Bereiche an die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland angepasst und reformiert wurden.
Ich und der Trabi
In der DDR gingen 1957 die ersten Trabant-Pkw vom Band.

Siehe nachfolgende Unterkapitel

3.1 Meine Mutter (ab 1957)
Erinnerungen an meine Mutter
Meine Mutter war und ist ein sehr liebenswerter Mensch. Sie lebt bei meiner Schwester in der Nähe von Freiburg im Breisgau und ist für ihr Alter (Geburtsjahrgang 1931) noch beeindruckend fit und lebensfroh. Sie war (ist) immer liebenswürdig, fürsorglich und hilfsbereit. In diesem Zusammenhang war es für mich natürlich auch immer wieder ein interessantes Thema, von welchen ihrer Eigenschaften Sie mir etwas mitgegeben hat.
Ähnlich oder anders...
Wenn ich an meinen Vater zurückdenke, verspüre ich keinerlei Lust, vergleichende Gedanken anzustellen, wo ich ihm ähnlich sein könnte. Ganz anders bei meiner Mutter.
...oder umgekehrt?
Die Sportlichkeit, die meine Mutter − nach ihren Erzählungen − in ihrer Kindheit auszeichnete, hat sie jedenfalls nicht an mich weitergegeben. Ich bin eher kein sportlicher Typ. Schließlich war ich auch im Gegensatz zu ihr nie ein guter Schüler. Auch meine Introvertiertheit passt nicht zum Wesen meiner Mutter, da sie besonders als Kind, Jugendliche, und jüngere Erwachsene ein temperamentvolles Wesen hatte und sie sich immer gerne dort aufhielt, wo viel los war. Bei mir war das genau umgekehrt. Ich habe Gruppen und insbesondere größere Ansammlungen von Menschen schon als Kleinkind gerne gemieden oder mich von solchen entfernt (ADS- bedingter Überreizungsstress), was übrigens auch schon den Erzieherinnen und den Nonnen des Kindergartens auffiel, den ich besuchte. Und nebenbei angemerkt: Das distanzierte Verhältnis meiner Mutter zu Süßspeisen hat sie mit hundertprozentiger Sicherheit nicht an mich vererbt. Ich liebe Süßes!
Leben und Wesen der Mutter
Nerven wie Drahtseile!
Wenn ich besonders ausgeprägte Wesensmerkmale meiner Mutter beschreiben soll, dann fallen mir sofort die gelebte Leichtigkeit und Unbeschwertheit ein, welche sie zumindest ausstrahlte. Man könnte auch sagen, sie hatte Nerven wie Drahtseile. Diese Eigenschaften, zusammen mit ihrem ausgeprägten Gottvertrauen, trugen sie wohl durch das Leben. Von diesen Eigenschaften hat sie zumindest das Gottvertrauen an mich weitergegeben, das auch ich kenne und in mir trage. Was ihre Nervenstärke angeht, konnte ich die ersten Jahrzehnte in meinem Leben leider nicht von einer solchen profitieren. Bis in die fortgeschrittenen Erwachsenenjahre hinein musste ich lernen, mir nicht alles zu Herzen zu nehmen und mich nicht unnötig in Frage zu stellen. Lange Zeit stand ich mir deshalb selbst im Wege.
Frohnatur
Anders bei meiner Mutter: Wenn ich als Kind noch über schwer verdauliche Erlebnisse in der Familie, die auch sie unschön berührt hatten, nachgrübelte, oder darüber weinte, da pfiff meine Mutter oft − im Bilde gesprochen − längst schon wieder die Melodie eines lustigen Liedchens, während bei mir noch die Tränen kullerten. Vielleicht konnte meine Mutter schwer verdauliche Umgebungsereignisse und Probleme ausblenden, als wären sie nie geschehen. Wie auch immer: Wenn ich an meine Mutter denke, fallen mir stets diese beneidenswerten Eigenschaften ein, wie sie mit kindlicher Fröhlichkeit und tiefem Gottvertrauen scheinbar unbeschwert (trotz aller Schwere im Lebensalltag) und unerschütterlich - wie ein tanzendes, singendes und positiv träumendes Mädchen - durchs Leben gehen konnte.
Die Sanfte
Bei den schwierigen familiären Verhältnissen, mit denen ich in der Familie und in der Schule konfrontiert war, insbesondere durch das giftige, aggressive Wesen meines Vaters und mancher Lehrer, strahlte meine Mutter eine sanfte, liebenswerte und damit wohltuende Seite des Lebens aus. Selbst dann, wenn sie selbst hilflos und traurig war. Die immer wieder spürbare zärtliche Zuwendung, wenn sie mich als Kind tröstete oder über die Haare streichelte, oder wenn sie besorgt um meine Gesundheit war, das waren die kleinen, aber unvergessenen schönen Augenblicke, neben den groben, öfter lieblosen und handfesten Umgangsformen meines Vaters in dieser Zeit.
Nach Studium - Kinderreichtum
Manchmal habe ich mich gefragt, ob sich meine Mutter ihren Lebenslauf direkt nach dem Studium anders vorgestellt hatte, sie vielleicht gerne erst ein paar Jahre in ihrem Beruf als Sozialarbeiterin tätig gewesen wäre. Nachdem sie jedoch in kurzen Abständen fünf Kinder gebar, (1955, 1956, 1957-ich, 1961,1963), managte sie "umständehalber" den großen Familienhaushalt. In diesem versorgte sie anfangs noch viele Jahre ihre Schwiegermutter, dann ihre Mutter, darauf ihren Schwiegervater und schließlich einige Jahre ihren Mann bis an deren Lebensende.
Schwere Zeiten ertragen
Mit ihrem damals speziell schwierigen Ehemann, meinem Vater, und der großen Familie durchlebte sie jedenfalls eine aus meiner Sicht unvorstellbar lange Zeit der Überforderung und Überlastung, die sie aber mit bemerkenswerter Geduld und ungebrochenem Grundoptimismus ertrug. Bei der schon durch den Achtpersonenhaushalt äußerst hohen Beanspruchung als Hausfrau, mit fünf - zum Teil schwer erziehbaren - Kindern blieb meine Mutter nach meiner Erinnerung meistens erstaunlich ruhig. Leider fehlten ihr für die Führung des Großhaushaltes in den ersten Jahren (bis Anfang der 60-erjahre) sogar solche technischen Hilfsmittel wie Waschmaschine oder Spülmaschine, wie sie heute selbst in Kleinhaushalten selbstverständlich sind. Außerdem stand ihr mein Vater nicht zur Seite, weil er einerseits berufstätig war und sich andererseits nur als nörgelnder Beobachter in Sachen Haushaltsführung berufen fühlte. Hilfreich war es vermutlich, dass noch meine Großmutter in unserem Haushalt wohnte, die, wenn sie psychisch dazu in der Lage war, meiner Mutter helfen konnte.
Weinen und stark sein
Allerdings erinnere ich mich leider auch daran, wie meine Mutter oft weinte, was mich sehr traurig und auch wütend machte. Nicht nur deshalb, weil es mich als Kind verunsicherte, sondern auch, weil ich es ungerecht fand, dass sie so oft traurig sein musste. Eine gewaltige Improvisationsaufgabe muss es für sie gewesen sein, den emotionalen Kessel zu Hause zu entschärfen, in der langen Zeit, als die Großfamilie in der viel zu kleinen Wohnung lebte. Da war eine Dauerhochspannung vorprogrammiert, insbesondere auch mit unserem stets unter Strom stehenden Haushaltsvorstand (meinem Vater). Mit welcher Flexibilität sie mit dem oft explosiven und brodelnden Familienklima umgehen konnte, erlebte ich als eine große Stärke meiner Mutter. Von diesem starken Wesensanteil meiner Mutter habe ich vermutlich einiges mitbekommen. Nur so konnte auch ich viele Stürme in meinem Leben überstehen (siehe dazu auch nachfolgende Erzählungen).
Dankbarkeit
Ich werde meine Mutter für ihre umfangreiche Lebensleistung, die sie mit ihren Möglichkeiten, ihren - Stärken und Schwächen - vollbracht hat, stets bewundern und ihr dankbar sein. Wie andere Familienmitglieder auch, habe ich sie leider in meinen schweren Zeiten öfter sehr wenig beglückt, was mir auch heute manchmal noch ein schlechtes Gewissen bereitet.
Mütterlicher Beistand
Dennoch hat mir meine Mutter in entscheidenden Krisensituationen meines Lebens beigestanden und mir sehr geholfen, was ich ihr nie vergessen und wofür ich ihr bis an mein Lebensende dankbar sein werde. Wenn ich sie ab und zu auf die früheren wilden Sorgenzeiten ansprach und damit ihr Engagement für mich würdigen wollte, dann winkte sie mit ihrem typischen gütigen Lächeln ab und stellte in ihrer ureigenen Weise fest: „Es hat sich doch alles doch noch zum Guten gewandelt!“. Meine Mutter stellte ihre Bedürfnisse zum Wohle anderer zurück und war immer um ein friedliches Miteinander bemüht. Egoistische Eigenschaften habe ich an ihr nie erlebt. Mit ihrer freundlichen und liebenswerten Art war sie überall beliebt. Ihre Schwestern und ihre beste Freundin, die sie schon aus Kinderzeiten kannte, hielten über alle Jahrzehnte hinweg engen Kontakt zu ihr und waren (sind noch) gerne mit ihr zusammen.
Doch noch Berufseinstieg
Sozialarbeiterin
Positiv erlebte ich es, als meine Mutter in den Siebzigerjahren doch noch (bis zu ihrer Verrentung) in ihrem Beruf als Sozialarbeiterin tätig werden konnte. Somit war ihr Studium an der katholischen Fachhochschule für Sozialarbeit in Freiburg, das sie mit gutem Ergebnis abschloss, nicht umsonst.

3.2 Unterschätzte Mutter
Unterschätzt
Wie in meinem Leben gab es auch in dem meiner Mutter Situationen, wo sie, wenn es darauf ankam, wesentliche Dinge sehr energisch und zielstrebig in die Hand nahm. Da staunten manche Zeitgenossen nicht schlecht! Sie bewies in solchen Fällen Belastbarkeit und Entschlusskraft dort, wo andere – selbsternannte Alpha-Tiere −, also Menschen, welche ansonsten als starke Charaktere wahrgenommen werden wollten, dann eher schwächelnd daherkamen.
1. Beispiel – größere Wohnung
In meiner AB erzähle ich schon an anderer Stelle (Kapitel 6), wie meine Mutter bei der obersten katholischen Kirchenbehörde in Freiburg, (Vermieterin unserer Wohnung), auf den Tisch haute, weil wir als achtköpfige Familie fünfzehn Jahre in - extrem - beengten Wohnverhältnissen und ohne Bad leben mussten. Mein Vater (Sozialarbeiter beim Deutschen Caritasverband), der damals in erzieherischer Hinsicht äußerst "schlagkräftig“ unterwegs war, hätte sich einen solch bahnbrechenden Auftritt nie getraut. Dieser "Feldzug" meiner Mutter war dann offenbar derart beeindruckend, dass wir nach relativ kurzer Zeit in eine große Wohnung umziehen konnten. Eine super Leistung, die sie damals vollbrachte!
2. Beispiel – "Vater Beine gemacht"
Als mein Vater sein Studium beendet hatte, war es zunächst nicht einfach für ihn, einen passenden Job zu finden. In den Fünfzigerjahren war das für junge Sozialarbeiter schwierig. Hinzukam, dass mein Vater etwas suchte, was seinen Idealen entsprach, aber selten angeboten wurde. Allerdings war ein festes Einkommen für seine rasch wachsende Familie äußerst wichtig. Nach Praktika in einem Erziehungsheim und beim Arbeitsamt war er als Sozialarbeiter mit zeitlich befristetem Arbeitsvertrag in einer Justizvollzugsanstalt tätig. Da ihm jedoch das dortige Arbeitsklima unangenehm war, wollte er diesen Arbeitsvertrag nicht verlängern und wurde arbeitslos. Das war für meinen strebsamen Vater aber eine äußerst belastende Situation. Er hing - laut meiner Mutter - apathisch zu Hause herum, war höchst unzufrieden mit sich, und damit auch für seine familiäre Umgebung schwer zu ertragen.
Heft in die Hand
In dieser Sondersituation nahm meine Mutter (wie bei mir später auch) das Heft in die Hand. Zunächst bewarb sich mein Vater selbst bei einigen in Frage kommenden Arbeitgebern im sozialen Dienstleistungsbereich, darunter auch kirchlichen Institutionen. In einem Fall lud man ihn daraufhin zu einem Vorstellungsgespräch bei einem Caritas- Ortsverband im Bodenseeraum ein. Als er daraufhin wieder einmal eine Absage bekam, und herauskam, dass ein lediger und kinderloser Mitbewerber das Rennen machte, da erwachte bei meiner Mutter ihr ganz eigener Kampfgeist, um sich gegen das Ungerechte in der Welt zu wehren.
Heldenhaft
Bei keinem geringeren als dem Präsidenten des Deutschen Caritasverbandes ließ sie sich einen Termin in dessen Dienstsitz in Freiburg geben. Dieser musste sich nach Mutters Überlieferung einiges von ihr anhören. Die Kirche könne sich nicht nach außen als Anwalt der Familien präsentieren, um dann Bewerber, die arbeitslos, qualifiziert und vor allem Familienväter seien, bei ihren Stellenbesetzungen nicht zu berücksichtigen. "Himmelschreiendes Unrecht", bekam der hohe Caritas-Geistliche schließlich von ihr um die Ohren gehauen.
Wutentladung
Eine solche geballte Wutentladung von einer Frau gegenüber einer „hochgestellten“ Persönlichkeit, das war vermutlich für den Caritas-Präsidenten in den Sechzigerjahren eine ganz neue Erfahrung. Ich konnte mir diese Geschichte sehr gut vorstellen. Vor allem wie meine Mutter sich Gehör verschaffte, mit ihrem entschlossenen Gesichtsausdruck (der dann überhaupt nichts mehr mit den stets so gütig wirkenden Gesichtszügen zu tun hatte), und ihrem dazugehörigen äußerst scharf fixierenden Blick − ihrer Geheimwaffe, welche sie zwar selten, aber wenn, dann plötzlich und unerwartet einsetzen konnte. Mit Erfolg!
Geistlicher Bote
Der hochwürdigste Geistliche und einflussreiche Präsident des Deutschen Caritasverbandes war offensichtlich beeindruckt von der Performance meiner Mutter: Zwei Tage später bereits bekam mein Vater Besuch von einem Caritas-Vertreter, der ihm anbot, in Offenburg eine Anlauf- und Beratungsstelle für rückkehrende deutsche Soldaten der französischen Fremdenlegion zu leiten. Diese Bundesaufgabe hatte der Deutsche Caritasverband in Delegation von der BRD übernommen. Dazu wurde ein Sozialarbeiter mit Erfahrungen in der Berufsfürsorge gesucht, die mein Vater ausweisen konnte.
Fremdenlegion?
Ende der Fünfziger- bis in die späten Siebzigerjahre kamen viele deutschstämmige Fremdenlegionäre aus Frankreich zurück nach Deutschland. Das lag daran, dass viele deutsche Kriegsgefangene in der französischen Besatzungszone sich in die französische Fremdenlegion hatten anwerben lassen, da die Lebensumstände für sie dort besser waren als in den Gefangenenlagern. In der Fremdenlegion dienten Soldaten aus allen möglichen Herkunftsländern. Die kriegserfahrenen deutschen Soldaten waren seinerzeit ein begehrtes Reservoir der französischen Fremdenlegion. Dort gab es neben den Berufssoldaten auch sehr viele Zeitsoldaten, welche sich für eine bestimmte Anzahl an Jahren zum Dienst verpflichten und danach in ihre Heimatländer zurückkehrten. Zurückgekehrt in ihre Heimat mussten sie dann wieder eingegliedert werden. Insbesondere ging es um die Vermittlung in Arbeitsverhältnisse und um Nachversicherungen bei den deutschen Sozialversicherungen oder um die Regelung sonstiger Dinge. Manche dieser rückkehrenden Männer gingen auch deshalb einige Jahre zur Fremdenlegion nach Frankreich, weil sie zuvor in ihrem Herkunftsland mit dem Gesetz in Konflikt gekommen waren und sich mit ihrer Verpflichtung als Legionäre einer Strafverfolgung entzogen. In solchen Fällen bekamen sie in der Fremdenlegion neue Namen, sozusagen eine neue Identität. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland (unter ihrem richtigen Namen) waren aber die von ihnen begangenen Straftaten oft noch nicht verjährt, weshalb einige sofort nach Grenzübertritt inhaftiert wurden. In solchen Fällen engagierte sich mein Vater als Sozialarbeiter dafür, dass die Betroffenen mit einem möglichst milden Urteil auf Bewährung davonkamen, was ihm nach seinen Erzählungen auch öfter gelang. Schon deshalb, weil er den Gerichten glaubhaft darlegen konnte, diese von der Fremdenlegion hart gedrillten Männer seien inzwischen zu disziplinierten Menschen umerzogen worden.
Zurück zur Mutter:
Ehemann ohne Job - aber wählerisch!
Meine Mutter erkannte gleich, dass dies ein Arbeitsangebot war, das zu ihrem Mann maßgeschneidert passte. Mein Vater sah das eher skeptisch und zögerte mit seiner Zusage, mit Hinweis auf weitere laufende Bewerbungen. „Ich will die Antworten auf noch laufende Bewerbungen abwarten, um dann das Beste auswählen zu können“, ließ er den Boten des Caritasverbandes wissen. Der Geistliche, welcher im Auftrag seines obersten Chefs das Stellenangebot meinem Vater direkt zu überbringen hatte, verließ somit ohne Vaters Zusage (vermutlich irritiert) unsere Wohnung, was meine Mutter - nach ihren Erzählungen – sehr schockierte.
Schmetterling wird zum Greifvogel
Da war er wieder − der Ausnahme-Modus, mit dem meine Mutter zur emotionalen Hochform auflaufen und sich sekundenschnell vom bunten, verspielten Schmetterling zum zugreifenden Raubvogel verwandeln konnte! War sie meinem schwierigen Vater sonst eine eher sanfte, nachgiebige Ehepartnerin, so nahm sie ihn − laut ihren Berichten − nun derart verbal in die Mangel, dass er schließlich das angebotene unbefristete Arbeitsverhältnis annahm. Daraufhin überließ meine entschlossene Mama dann nichts mehr dem Zufall. Den mit einem gewaltigen „Druckeinlauf“ doch noch herbeigeführten und unterschriebenen Annahmeentschluss ihres zaudernden Ehemannes überbrachte sie höchstpersönlich dem Caritasverband.
Familieneinkommen gerettet!
Damit hatte sie nicht nur das Familieneinkommen langfristig gesichert, sondern auch dafür gesorgt, dass mein Vater tatsächlich ein für ihn hervorragend geeignetes berufliches Betätigungsfeld fand. Am Ende seines Berufslebens erhielt er auch noch das Bundesverdienstkreuz und einen vergleichbaren französischen Orden sowie die höchste Auszeichnung des Caritasverbandes. Bemerkenswert fand ich in diesem Zusammenhang einen Satz des damaligen Regierungspräsidenten in Freiburg, den er unter anderen an meinen Vater im Rahmen der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes richtete: "Für ihre Verdienste werden die Männer geehrt, für welche deren Frauen das Kreuz tragen“.
III. Beispiel: Gegen Soldatenarmut
Ein weiteres Beispiel für Mutters feurigen Einsätze habe ich auch aus meiner Vergangenheit auf Lager, wo übrigens meine Mutter nicht nur ihrem Sohn (mir), sondern bundesweit allen wehrpflichtigen Soldaten, die im Zivilleben in einem Beamtenverhältnis arbeiteten, einen großen Dienst erwies. Als Verwaltungsbeamter im damals so genannten einfachen Dienst war mein Einkommen überschaubar. Ein wichtiger Teil davon war das seinerzeit noch gesondert den Beamten ausbezahlte Weihnachtsgeld, das so genannte 13. Monatsgehalt. Berechnet wurden diese Weihnachtsbezüge aus dem Gehalt, das die Beamten jeweils zu einem Stichtag vor dem Auszahlungsmonat des 13. Monatsbezugs erhielten. Aus beruflichen Gründen musste ich meinen Einzug zum fünfzehn Monate dauernden Wehrdienst beschleunigen, um eine Fortbildungsmaßnahme für den mittleren Beamtendienst ab Januar 1978 antreten zu können. Meine Einberufung in die Bundeswehr war regulär erst im Januar 1977 vorgesehen. Über meinen damaligen Abteilungschef im Freiburger Ordnungsamt, der ehrenamtlich in der so genannten Musterungskommission beim Kreiswehrersatzamt Freiburg tätig war, konnte ich erreichen, dass ich kurzfristig schon im Oktober 1976 die Ableistung meiner Wehrpflicht antreten konnte.
Mini-Wehrsold statt Gehalt
Dieser spontane Wechsel von der Amtsstube in die Kaserne bedeutete aber auch, dass ich ab Oktober statt meinem normalen Einkommen nur noch einen kleinen Wehrsold erhielt. Dennoch hoffte ich irrtümlich darauf, für die neun Monate, in denen ich meinem normalen Job nachging, anteilmäßig neun zwölftel eines Monatsbezuges als Weihnachtsgeld ausbezahlt zu bekommen. Falsch gehofft: Da der Stichtag für den Anspruch auf Weihnachtsgeld leider erst nach meinem Einberufungstermin lag, ging ich zu meiner großen Enttäuschung leer aus und bekam nur noch Wehrsold von der Bundeswehr. Dabei hatte ich schon ein eigenes Auto, für das die Kfz- Versicherung und Steuern sowie andere Kosten bezahlen werden mussten. Deshalb bat ich meine Mutter, ob sie mir etwas Geld dafür leihen könne. Da blitzte er wieder auf, der scharfer Blick meiner Mutter, denn es war wieder Zeit für ihren aufbrausenden Wut-Modus, zum Kampfeinsatz für die Gerechtigkeit. „So eine Sauerei, so eine himmelschreiende Ungerechtigkeit!“, hörte ich sie schimpfen. Und weiter: „Wenn Soldaten für den Staat Wehrdienst leisten müssen, dann können sie doch nicht auch noch bei ihren Gehaltsansprüchen gegenüber ihren vorherigen Arbeitgebern benachteiligt werden“, fügte sie erbost hinzu. Wo sie recht hatte, hatte sie recht! Aber auch juristisch?
Fall für Volksvertreter
Mit ihren schlagkräftigen Argumenten ging sie jedenfalls zum Personalamt meines Arbeitgebers, der Stadt Freiburg im Breisgau. Dort wurde ihr die Rechtslage genau erklärt (ich also kein anteiliges Weihnachgeld bekommen kann). Damit wollte sich meine Mutter aber nicht zufriedengeben. Deshalb ließ sie sich einen Termin bei einem damals einflussreichen Freiburger Bundestagsabgeordneten geben und hinterließ dort vermutlich wieder eine beeindruckende Vorstellung.
Überzeugungskraft siegt!
Der Abgeordnete stimmte ihrem Argument zu, Wehrpflichtige dürften nicht auch noch benachteiligt werden gegenüber denjenigen, die um einen Wehrdienst herumkamen und somit keine Einkommenseinbußen hinnehmen mussten. Deshalb versprach er meiner wehrhaften Mama, diese offensichtlich unsaubere gesetzliche Regelung in einem parlamentarischen Ausschuss in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn anzusprechen. Allerdings sei es wenig wahrscheinlich, fügte er vorsichtshalber hinzu, dass ich, − sollte er Erfolg haben −, noch davon profitieren könne. Der Bundestagsabgeordnete versicherte aber meiner Mutter, falls er Erfolg hätte, würden die künftigen Soldaten nicht mehr benachteiligt, wenn sie aus einem Beamtenverhältnis heraus zum Wehrdienst einberufen würden.
Triumph!
Doch ich traute meinen Augen nicht, als ich − und damit vermutlich auch viele andere betroffene ehemalige Wehrpflichtige im Bundesgebiet − im Jahre 1978, einige Monate nach meiner Entlassung aus dem Wehrdienst, eine fette Nachzahlung auf meinem Konto entdeckte, mit welcher diese neun Zwölftel des Weihnachtsgeldes an mich nachträglich ausbezahlt wurden. Da war ich so richtig stolz auf meine Mutter! Sie hatte nicht umsonst hartnäckig gekämpft. Über einen ungewöhnlichen Weg beseitigte sie damit ein - wenn auch kleines – Stück Ungerechtigkeit in dieser Welt!

3.3 Mutter-Sohn Event "Fahrschule" (1975)
Unternehmungen mit meiner Mutter
Da ich vier Geschwister hatte und meine Mutter eine viel beschäftigte Hausfrau und Managerin der Familie war, hatte sie selten Zeit, etwas speziell mit mir oder einem meiner Geschwister zu unternehmen. Zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Eine kleine Geschichte dazu kann ich aber doch erzählen:
Kleine Story:
Mutter hinter 's Steuer
Als ich im Jahre 1975 achtzehn wurde, machte ich den Führerschein und kaufte mir danach einen alten, gebrauchten VW-Käfer, mein erstes Auto. Eines Tages kam ich auf eine Idee: Ich lud meine Mutter ein, mit mir auf den Verkehrsübungsplatz zu fahren. Dort hatte ich selbst mit einem Freund das Autofahren geübt, bevor ich den Führerschein machte. Mein Ziel: Ich wollte in meiner Mutter die Lust aufs Autofahren entzünden. Zu meiner Überraschung machte meine Mutter mit. Also durfte ich für sie den Fahrlehrer spielen. Als wir auf dem Übungsplatz ankamen, setzte sich meine Fahrschülerin an das Steuer, ich nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Bald war aber unübersehbar, dass meine Mama sich hinter dem Lenkrad nicht besonders wohl fühlte, obwohl ich als Hobby-Fahrlehrer mein Bestes gab, um ihr das Kuppeln, Gangeinlegen, Gas-geben und das Bremsen im Schnelldurchgang beizubringen. Dennoch war ich zunächst beglückt, als es Mutter gelang, meinen VW Käfer zum Rollen zu bringen, wenn auch mit einigem Ruckeln. Zwischendurch würgte sie den Motor ab, wie das eben bei Fahranfängern so vorkommt. Aber das entmutigte mich nicht. Ich motivierte meine Fahrschülerin, es weiter zu probieren, obwohl Mamas Blicke und Gesichtszüge mit jedem Ruckler unlustiger wirkten.
Immer schneller
Schließlich kamen wir voran und rollten auf dem Übungsplatz mehr oder weniger entlang den eingezeichneten Wegen. Entzückt von diesem Erfolg, ermunterte ich meine Mutter, nun doch etwas mehr Gas zu geben, was sie dann auch tat. Das Fahrzeug fuhr nun offensichtlich zu schnell für meine Mutter, die ab einem bestimmten Tempo plötzlich in einen Panik-Modus umschaltete. Was dann folgte, war sowohl für die Fahranfängerin als auch für mich, den Hobby-Fahrlehrer, herausfordernd.
Blackout
Sie gab immer mehr Gas und der Motor heulte ohrenbetäubend auf. Leider schaffte es meine Mutter – vermutlich durch ein typisches Blackout-Verhalten − nicht mehr, Gangschaltung oder Bremse zu betätigen. Oh je! Alle meine Bemühungen, durch Zurufe meine Mutter an die richtige Handhabung der Gangschaltung und der Bremsen zu erinnern, schlugen fehl! Natürlich nicht ohne Folgen. Das Ende des gekennzeichneten Weges nahte, und es galt, das Tempo in den nächsten Sekunden deutlich herunterzunehmen. Aber wie? Meine Crash-Pilotin war in ihrem Panikmodus daran gehindert, eine unverzügliche Entschleunigung des Autos herbeizuführen, und über einen Bremsfallschirm verfügte mein alter VW-Käfer auch nicht. Kurz vor einer drohenden Kollision mit den Absperrungen gab es nur noch eins: Ich zog den Hebel der Handbremse kräftig nach oben. Diese Rettungsmaßnahme brachte meinen VW Käfer gerade noch rechtzeitig zum Stehen, allerdings schüttelte der abgewürgte Motor uns heftig durch.
Leider kein Foto
Wären die Gesichter von Mutter und mir unmittelbar nach dem unsanften Abstellen des VW Käfers fotografiert worden, wir hätten vermutlich die schönsten Schnappschüsse erhalten, die man sich vorstellen kann. Ein passender Fototitel wäre gewesen: "Unvergessliche Augenblicke".
Ende der Fahrstunde
Leider war nun meiner Mutter die Lust am Autofahren absolut vergangen. In solchen Fällen konnte Mama energisch werden. Vor allem ihr Blick wurde in solchen Momenten stechend! Sie wies mich - mit streng fixierendem Blick - an, sofort mit ihr nach Hause zu fahren. Damit endete unser Ausflug zu einer gemeinsamen, - äußerst spannenden - Unternehmung, die wir aber nicht mehr wiederholt haben. Trotzdem erinnerte ich mich immer wieder gern an diese besondere, gemeinsame Ausfahrt mit meiner lieben Mutter.

3.4 Mein Vater (1957-2008)
Erste Anmerkungen
Schwer verdauliche Geschichten
Meine ersten Gedanken zum Thema „Vater“ kann ich kurz und knapp so beschreiben: In meiner Kindheit und Jugend habe ich unter ihm gelitten. Zeitweise hasste ich ihn sogar. Er seinerseits hatte vermutlich viele Jahre erhebliche Probleme mit mir, insbesondere weil er mit meinem introvertierten, linkischen und ambitionslosen Wesen überhaupt nicht zurechtkam. Auf den Punkt gebracht: Vater und Sohn mochten sich nicht. Erst in meinem jungen Erwachsenenalter veränderte sich das Verhältnis.
Authentisch statt Schönfärberei
Während ich über meinen Vater schrieb, fiel mir auf, wie schwer ich mich dabei tat. Bei meinen vielen Erlebnissen mit ihm wollte ich nicht unter-, aber auch nicht übertreiben. Beim Aufschreiben der vielen unschönen Kindheitserinnerungen im Zusammenhang mit meinem Vater spürte ich einen inneren Konflikt. Einerseits hatte ich nicht die Absicht, etwas unter den Teppich zu kehren, andererseits legte ich mir Zurückhaltung auf, um nicht den Eindruck zu erwecken, ich wolle in meiner Autobiografie übel über meinen (2008 verstorbenen) Vater herziehen. Ich erzähle von ihm aber nicht mit dem Ziel, ihn als böses Monster darzustellen. Aber wenn ich ungeschönt über mein Leben berichten will, - so dachte ich mir - dann bleibt mir nichts anderes übrig, als das Verhältnis zwischen ihm und mir so zu schildern, wie ich es in meiner Kindheits- und Jugendzeit erlebte.
Vater? – oh Schreck!
Vielen psychischen Schrott musste ich in meinem späteren Leben über manche Umwege wegräumen. Einige Psychotherapeuten und gute Wegebegleiter gaben sich alle Mühe und halfen mir, umfangreiche Altlasten aus meiner Kindheits- und Jugendzeit abzuräumen, damit ich wieder Raum für neue Lebensperspektiven fand. Diese Altlasten ließen sich zu einem gewichtigen Teil auf das Missverhältnis zwischen mir und meinem Vater zurückführen. Andererseits bekam ich durch die Therapien Chancen auf Neuanfänge geboten, die mir ab dem jungen Erwachsenenalter dann auch gut gelungen sind.
Produkt der Vergangenheit
Für mich ist klar, dass mein Vater selbst ein Produkt seiner Vergangenheit war, aus der er vermutlich im Lauf seines Lebens nur unzureichend herausfand. Mit seiner schweren Kindheit und Jugend hätte ich auch niemals tauschen wollen. Seine kranke Psyche formte aus ihm schließlich aus meiner Sicht den Typ Mensch, der mir als Kind und Jugendlichem große Probleme bereitete. Außerdem plagten ihn viele Krankheiten. Aber sein dadurch entstandenes - extrem - giftiges Alltagswesen war leider fester Bestandteil seiner Persönlichkeit, mit dem seine Umwelt klarkommen musste. In seltenen Situationen konnte ich ihn von einer ganz anderen Seite kennenlernen, und dort zeigte er sich eher ängstlich und unsicher.

3.5 Vaters Sohn?
Anspruchsvoll
Wahrscheinlich war der Umstand, dass mein Vater mit seiner Herkunftsfamilie selbst einen harten Überlebenskampf hinter sich hatte, der Grund dafür, dass seine Kinder in seiner Denkwelt bestimmten Leistungs- und Verhaltensnormen unbedingt gerecht werden sollten, um sich im Leben behaupten zu können.
Vaterträume:
In der Zeit, als seine drei erstgeborenen Kinder eingeschult wurden (Anfang bis Mitte der 60-erjahre), da gab es in beruflicher Hinsicht schon für jedes dieser drei Nachkommen eine konkrete väterliche Vorsehung, was aus ihnen einmal werden soll: Meine ältere Schwester Gudrun, - so war sich ihr Papa sicher, würde einmal Lehrerin werden. Meinen älteren und temperamentvollen Bruder Berthold stellte er sich als strammen Berufssoldaten im Offiziersrang vor.
Priester werden?
Und aus mir? Vielleicht führte meine auffallende kindliche Verträumtheit bei meinem Vater zweitweise zu dem Missverständnis, dass ich als ein vergeistigter, - später geistlicher -, Mensch heranwachsen würde. Denn ich - so die väterliche Vorsehung - hätte das Zeug für einen katholischen Priester. Solche Vorstellungen traten jedoch umso mehr in den Hintergrund, je länger wir drei Geschwister die Schule besuchten. Warum? Unsere Schulzeugnisse ließen Vaters Wunschpläne für unsere berufliche Zukunft als nicht aussichtsreich erscheinen. Besonders ich schockte ihn mit meinen schlechten Noten, die ich nach Hause brachte. Ein Grund mehr, warum mein Vater - insbesondere auf mich - sehr schlecht zu sprechen war.
Kein Platz für Träumer-Sohn (ADS)
Mit meinem zerstreuten Wesen als Kind konnte er ebenso wenig umgehen, wie mit meinen grottenschlechten schulischen Leistungen, oder mit meinem Fehlstart ins Berufsleben. Bei jeder Gelegenheit ließ er seinen Frust darüber bei mir ab, oder machte sich über mich lustig. Dies betraf übrigens nicht nur mich, auch die anderen Mitglieder der Familie bekamen mehr oder weniger ihr Fett weg. Keiner von uns hatte leider das zu bieten, was bei unserem Hauspatriarchen Wohlgefallen auslösen konnte.

3.6 Misshandlungen im Doppelpack (60erjahre)
Unschöne Kindheitserinnerungen
Um Fragen zu Erziehungs- und Bestrafungsmethoden in meiner Kindheit zu beantworten, muss ich in Regionen meiner Erinnerung zurückgreifen, mit welchen ich mich nur noch höchst selten, und wenn, dann nur ungern befasse. Warum? Diese Erinnerungen vermögen es bis heute, bei mir Wut und Empörung über die erlebten Misshandlungen auszulösen, (aber nur so lange, wie ich mich damit beschäftigen will...). Leider waren körperliche Züchtigungen, also Gewalt an Kindern, in den Sechzigerjahren nichts Außergewöhnliches. In diesem Zusammenhang ist es für mich sinnvoll, meine Erfahrungen - neben derselben mit meinem Vater - auch in Verbindung mit einer weiteren Person zu beschreiben, die sich um eine „schlagkräftige“ Erziehung in meiner Kindheit ebenfalls ganz besonders „verdient gemacht“ hat. Dabei denke ich an die Zeit zurück, als ich die vierte Grundschulklasse besuchte.
Misshandlungen im Doppelpack:
Vater & Lehrer
Leider traf mich bei den für mich zuständigen männlichen Erziehungsberechtigten in der Kindheit das Pech einer „handfesten“ Erziehung. Speziell in der vierten Klasse hatte ein älterer Lehrer es besonders auf mich abgesehen, um mich bei jeder Gelegenheit oder wenn ihm danach war, zu schlagen oder zu demütigen.
ADS-Kind provoziert
Beide Männer, - mein Vater und dieser Lehrer -, fühlten sich vermutlich durch ein gehandicaptes, verhaltensauffälliges Kind mit dem ADS permanent provoziert. So jedenfalls blieb dies fest in meinen Erinnerungen aus jener Zeit verhaftet! Als HANS GUCK IN DIE LUFT bot ich diesen schlagbereiten Patriarchen tagtäglich vermutlich perfekte Anlässe, die deren handfeste „Erziehungskünste“ geradezu herausforderten. Ebenso wie beim Erledigen der Hausaufgaben zu Hause, saß ich leider auch in der Schule häufig und für den Lehrer sichtbar abgelenkt und verträumt an meinem Platz im Klassenzimmer. Diese Körperhaltung strahlte vermutlich, - von mir unbemerkt und unbeabsichtigt -, ein ständiges Missverständnis aus: Ich wirkte wahrscheinlich wie ein Kind, das, wie man heute zu sagen pflegt, NULL BOCK auf alles hatte, und meine Außenwirkung ließ nicht im Geringsten erkennen, dass ich bereit gewesen wäre, meinen gestrengen Bezugspersonen um mich herum ein Mindestmaß an Aufmerksamkeit "schenken" zu wollen. Was diese Patriarchen natürlich in Rage versetzte.
Zahlreiche Ohrfeigen und Stockschläge
Öfter kam es in der Schule vor, dass ich von dem Lehrer aufgerufen wurde und er mich fragte, über welches Thema er gerade gesprochen habe. Wenn ich seine Frage nicht sofort korrekt beantworten konnte, setzte es gleich Ohrfeigen oder Stockschläge auf die Hand. Ohrfeigen erhielt ich übrigens auch sonst zahlreich von ihm, beispielsweise wenn er an meiner Bank vorbeikam und mein Hausaufgabenheft durchblätterte. Meistens fand er etwas, das nicht zu seiner Zufriedenheit erledigt war. Ähnliche Reaktionen wiederholten sich zu Hause im Zusammensein mit meinem Vater, zum Beispiel bei den von ihm durchgeführten Schulranzen-Kontrollen, wo sich meistens irgendwelche ungeordneten Verhältnisse herausstellten, oder wenn ich mit ihm Diktate üben musste − ein schreckliches Szenario!
Verbale Züchtigungen
Wenn mein Lehrer in der vierten Klasse korrigierte Klassenarbeiten austeilte, kam ich in beängstigende Situationen, an welche ich mich höchst ungern erinnere und vor denen ich mächtig Angst hatte. Nicht etwa wegen der zu erwartenden Note, die ahnte ich voraus. Nein, Angst hatte ich vor den Erniedrigungen, die mir der Lehrer stets während des Austeilens der Arbeitshefte zufügte. Da ich bei den Diktaten mit meiner damals stark ausgeprägten Lese-Rechtschreibschwäche meistens die Note sechs bekam, ließ er dies nicht nur mich, sondern stets auch die ganze Klasse mit fiesen, blumig artikulierten Worten wissen. Das klang so „lustig“, dass es immer ein Gelächter in der Klasse hervorrief. Oft drohte mir der Wunderpädagoge dabei noch vor der Klasse an, ich würde bald in der Sonderschule landen. Zitat auf freiburgerisch: „Du kummsch bald uf d' Dubelschul, wirsch scho sehe!“
"Mutmacher"
Mein Diktatheft musste ich dann stets von einem Elternteil unterschreiben lassen. Der Lehrer kommentierte neben der Note noch "giftig" in roter Schrift, was er alles an mir auszusetzen hatte, und das klang meistens sehr ungut. Wenn mein Vater das mitbekam, hatte ich Hausarrest und musste mit ihm Diktate üben, die aber meistens auch nicht besser ausfielen als die in der Schule. Das wiederum machte meinen Vater wütend. Seinen Zorn ließ er mich, wie der Lehrer in der Schule, immer wieder mit saftigen Ohrfeigen spüren, weil er mir vorwarf, ich würde mich nicht genug anstrengen. Außerdem feuerte er ausdauernd heftige Beschimpfungsorgien gegen mich ab und prophezeite mir wortreich und in einem schwer erträglichen Wiederholungsmodus, ich hätte später „höchstens als Hilfsarbeiter“ eine berufliche Chance, wenn meine schulischen Leistungen nicht besser würden. Diese Diktate-Übungen fühlen sich in meiner Erinnerung jedenfalls an wie „Folterübungen“.
Ursachen nicht erkannt
Was diese beiden Unheilpädagogen (mein Vater und mein Lehrer) damals noch nicht wissen konnten: Jahrzehnte später erst wurde festgestellt, dass es mir durch eine angeborene, - extrem - ausgebildete Fehlstellung der Augen, die von außen nicht sichtbar war, kaum möglich war, Details in einem Schriftzug oder in allen Worten während des Lesens und Schreibens vollständig zu erfassen. Einzelne Buchstaben, Wörter und Satzzeichen übersah ich daher. In der Universitätsaugenklinik in Freiburg wurden meine Augen operiert − leider erst im Alter von etwa 40 Jahren (siehe dazu meine Erzählungen in anderen Kapiteln).
Zurück zu den "Erziehern"
Züchtigungswerkzeuge?
Wie mein Vater auch, benutzte dieser Lehrer für die körperliche Züchtigung nicht nur seine kräftige Hand, sondern er setzte spezielle Stöcke ein, die beim Schlagen äußerst nachhaltig schmerzhaft waren, oder er drehte mir das Ohr um, bis es sehr weh tat und sich für eine Weile tiefrot verfärbte. Gerne verteilte er auch kräftige Kopfnüsse. Beim Schlagen mit dem Stock bevorzugte er meistens Schläge auf die Fingerkuppen der Kinder, oder den Bereich zwischen den Fingern und den Handflächen, die dann anschwollen. Sich zuhause über diese Misshandlungen zu beschweren, wäre nicht nur zwecklos gewesen, sondern auch kontraproduktiv. Ich musste davon ausgehen, dass ich auch noch von meinem Vater zusätzlich eine Ohrfeige gefangen hätte, als Bestätigung - sozusagen.
Sich wehren?
Zwar war ich immer eher unsportlich veranlagt und neigte wenig zu aggressivem Handeln. Wäre ich aber ein Boxer im Leistungssport geworden, dann hätte ich vermutlich vor einem Kampf nur einige Erinnerungen aus dieser Zeit kurz hervorholen müssen, um mein Aggressionspotential entsprechend angemessen "auf Temperatur" zu bringen. Aber leider, - nein: Gott sei Dank -, war ich weder in meinem Wesen noch körperlich so ausgestattet, dass ich mich wirksam gegen die mir zugefügte Gewalt hätte wehren können. In meiner Kindheit war es außerdem unvorstellbar, sich als Schüler gegen Schläge eines Lehrers zur Wehr zu setzen. Manche der betroffenen Schüler waren vielleicht geschickt darin, Schlagfreudigkeit von Lehrern oder Vätern zu besänftigen. Aber auch in dieser Hinsicht war ich schlecht aufgestellt.
Leider stolz und stumm (oder dumm?)
Wie schon beschrieben, verhielt ich mich bei Misshandlungen vermutlich auch noch aggressionsfördernd gegenüber den mich schlagenden Personen. Ich vermied es zum Beispiel eisern, zu schreien, weil ich zu stolz dazu war, und drückte offensichtlich in meiner Mimik das Gegenteil von Unterwürfigkeit aus. Dies reichte wohl aus, um die schlagkräftigen „Erzieher“ um mich herum aggressionstechnisch zusätzlich in Hochform zu bringen.

3.7 Story: Erst Gottesdienst - dann Prügel
Kindheitsschock (Prügelstrafe)
Heute noch erinnere ich mich an etwas, das mich als Kind besonders schockierte: Die Räume in unserer Wohnung wurden einmal frisch tapeziert. Mein älterer Bruder, meine ältere Schwester und ich schliefen zu dieser Zeit noch in dem großen Wohnzimmer. Wir Buben machten − wie alle Kinder in diesem Alter − unseren Blödsinn vor dem Schlafen. Warum wir einen nassen Waschlappen zum Spielball umfunktionierten, weiß ich nicht mehr. Aber wir taten es. Ein Wurf meines wurfstarken Bruders landete jedoch nicht bei mir, sondern prallte an die frisch tapezierte Wand neben meinem Bett. Dumm wie ich war, ließ ich den sichtbaren Nässefleck nicht einfach trocknen, sondern versuchte, ihn durch Reiben mit einem Stück Stoff zu kaschieren. Der Nachteil: Der Fleck neutralisierte sich nicht mehr durch das Trocknen. In den darauffolgenden Tagen gab es keine Reaktion, und ich glaubte schon, dass unsere kleine Missetat nicht bemerkt wurde. Ich sollte mich irren.
Erst zum Gottesdienst - dann Prügel
Am nächsten Sonntag ging die ganze Familie wie üblich um neun Uhr in den Gottesdienst. Als wir zurückkehrten, griff mein Vater zu meinem Schrecken plötzlich unsanft nach mir und zerrte mich in das Wohnzimmer, wo er mir kurz den kleinen Wandfleck zeigte, den er leider doch entdeckt hatte. Bevor ich erkannte, dass ich nun bestraft werden sollte, nahm mich mein Zuchtmeister schon über sein Knie und startete sogleich einige Serien von harten Stockschlägen auf meinen Hintern. In den Folgetagen wurde es rund um meinen Po rot, grün und blau und das Sitzen tat noch lange weh.

3.8 Mit dem Vater (60er- und 70erjahre)
Gemeinsame Unternehmungen
Bürogehilfe
Gemeinsame Unternehmungen waren mit meinem Vater sehr selten. Aber es gab sie. So durfte ich ihn als Kind ab und zu in Ferienzeiten samstags begleiten, wenn er mit dem Zug von Freiburg nach Offenburg fuhr, um in seinem Büro zu arbeiten. Mein Vater arbeitete grundsätzlich auch samstags. Auffällig für mich war nach der Ankunft in seinem Büro, dass ich meinen Vater dort auf einmal wie ausgewechselt erlebte. Zwar strahlten die beiden Büroräume nicht gerade ein Wohlfühlklima aus, mit den vielen Stapeln ungeordneter Papiertürme auf den Tischen und einigen Schränken. Doch das schien Vaters gute Laune nicht zu trüben. Irgendwie empfand er diese Chaos-Ordnung vermutlich als Normalzustand.
Alkoholische "Gesundheitswässerchen"?
Ob dies auch an den diversen Gläsern Gesundheitswässerchen lag, − so nannte er die nicht wenigen Schnäpse, die er schon vormittags trank, − das weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich war es vor allem die Abwesenheit von unserem stressigen Familienleben zu Hause, die sein Wohlgefühl steigerte. Er tippte dann viel auf seiner Schreibmaschine, und ich hörte von ihm nur ab und zu kurze wütende Zischlaute, wenn er sich vertippt hatte oder irgendetwas suchte und nicht fand. Ansonsten verhielt sich mein Papa – wie schon beschrieben − erstaunlich friedlich. Mich beschäftigte er als kleinen Bürogehilfen, und gab mir beispielsweise Karteikarten, die ich mit der Schreibmaschine beschriften durfte, zu aktuell bearbeiteten Fällen. Dazu lagen die betreffenden Akten auf dem Tisch und die Durchschläge von aktuell abgeschickten Briefen, die abzulegen waren.
Mittagspause in französischer Kaserne
Ein Samstagvormittag ging so schnell vorüber. Zum Mittagessen nahm mich mein „Büro-Chef“ mit in die französische Kaserne. Das fand ich "spannend". Dort saß man gefühlt stundenlang am Mittagessen, das aus mehreren Gängen bestand und zu welchem einige Gläser Wein getrunken wurde. Für mich gab es natürlich Limonade. Zum Abschluss bestellte sich mein Vater dann stets noch einen "Vogel", wie er zu dem Servicedienst immer zu sagen pflegte. Dabei handelte es sich wieder um Gesundheitswässerchen, das vermutlich zu der Verdauung des üppigen, mehrgängigen Mittagsmahls gute Dienste leistete.
Chauffiert
Später, seit 1975, besaß ich ein Auto, beispielsweise seit 1976 einen gelben Opel Kadett B, Baujahr 1972, von da an fuhr ich meinen Vater manchmal zu Terminen und Veranstaltungen in verschiedenen Städten in Deutschland, aber auch nach Frankreich.
Französische Fremdenlegion
Außerdem erinnere ich mich, wie ich ihn 1979 bei einer Busfahrt begleitete, die der Bund ehemaliger Fremdenlegionäre organisierte. Reiseziel war das Hauptquartier der französischen Fremdenlegion bei Aubagne in der Nähe von Marseille. Eine interessante Reise. Normalerweise suchte ich keine Urlaubsgemeinschaft mit meinem Vater. Wenn ich mich richtig erinnere, waren noch Plätze frei im Bus, für die keine Mitreisenden mehr gefunden werden konnten. Deshalb nutzte ich die günstige Gelegenheit, für wenig Geld an einem Ausflug nach Südfrankreich teilnehmen zu können.
Eine kleine Story dazu:
Seltsame Menschen
Dabei lernte ich auch seltsame Verhaltensweisen von manchen dieser ehemaligen Söldner kennen. Als der Bus nach der Besichtigung einer Einrichtung der Fremdenlegion weiterfuhr, sprang ein alter mitreisender ehemaliger Legionär, an dessen Jackett ein paar bunte Abzeichen (vermutlich Orden) baumelten, spontan von seinem Sitz auf, nahm, − so gut es noch ging − eine stramme Haltung an und forderte seine Kameraden auf, mit ihm (wieder einmal) das Glas zu erheben, um auf die Legion zu trinken. Vive la Légion étrangère!, posaunte er in den Bus. Und fügte hinzu: „Kameraden, die Legion wird immer und ewig unsere Heimat bleiben, sie ist und bleibt unser Leben, weil sie richtige Männer aus uns gemacht hat!“ Dann rief er nochmals wie ein lautes Gebet in den Bus: Vive la Légion étrangère! Ruckzuck streckten viele Männer im Bus ihre Fläschchen mit alkoholischem Inhalt in die Höhe. Diesen Auftritt meines nicht mehr ganz nüchternen Vordermanns im Bus fand ich recht seltsam. Seine Frau, die neben ihm saß und sich grinsend zu mir umdrehte, schien dies an meinem Gesichtsausdruck abzulesen. Sie lachte und sagte augenzwinkernd zu mir: „Weißte Junge, die sind manchmal etwas bekloppt.“ Dabei tippte sie mit ihrem rechten Zeigefinger an ihre Schläfe. Einen Kommentar dazu habe ich mir verkniffen, schließlich saß mein Vater neben mir...
Flucht vor Langeweile: nicht nur "Bleistift spitzen…"
Manche der ehemaligen Legionäre im Bus erklärten mir, es sei ihnen sehr wichtig, auf ein abenteuerliches Leben zurückzublicken. Sie würden verrückt werden bei dem Gedanken, wie ein Buchhalter zu leben. Einer dieser älteren Abenteurer-Typen, mit furchigem, rötlich gefärbtem Gesicht und Tränensäcken, wurde konkreter und meinte dazu mit einer tiefen, brummigen Bassstimme: „Junge, stell Dir vor, ein Leben lang morgens Bleistift spitzen, mittags Bleistift spitzen, nachmittags Bleistift spitzen und abends neben deiner Frau vor dem Fernsehen einpennen, was für ein Scheiß-Leben wäre das gewesen. − So hätten wir nie leben können", fügte er noch hinzu. Vielmehr hätten sie Abwechslung und spannende Herausforderungen gesucht und in der Legion gefunden. So erzählte er von seinen Kriegseinsätzen an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt, von der gelebten Kameradschaft unter den Legionären, und noch einige spannenden Geschichten aus der Zeit in der Legion.
Einleuchtend...
Ein nicht langweiliges Leben zu führen, dieses Ziel konnte ich grundsätzlich als Mensch mit dem ADS sehr gut nachvollziehen. Als Berufs- oder Zeitsoldat in der Fremdenlegion zu dienen, wäre allerdings eine grausige Vorstellung für mich gewesen. Zwar musste ich als Wehrpflichtiger bei der Bundeswehr, aus der ich im Dezember 1977 entlassen wurde, zum Glück in keine echten Kriegseinsätze ziehen. Ich erlebte jedoch, anders als die ehemaligen Fremdenlegionäre um mich herum, das Soldaten-Leben als Unfreiheit. Aber diese persönlichen Soldatenerfahrungen behielt ich in der Bus-Gesellschaft mit den vielen überzeugten Soldaten (im Ruhestand) um mich herum besser für mich...
Mittelmeer
Während der Busreise zu verschiedenen Einrichtungen der Fremdenlegion am Mittelmeer war mein Vater sehr guter Stimmung. Das lag nicht nur an den alkoholischen Getränken, die er wie alle im Bus reichlich konsumierte, sondern auch daran, dass hier viele Menschen saßen, denen er bei der Wiedereingliederung in Deutschland helfen konnte nach ihrem Söldnerdienst in der französischen Fremdenlegion. Für diese Leute war er ein guter Mensch, was er spürbar genoss.

3.9 Vaters neuer Sohn? (ab 1983)
Wendepunkt...
Kurioserweise hat sich die grundsätzliche Einstellung meines Vaters zu mir − und somit auch unsere Beziehung zueinander − erst dann um 180 Grad zum Positiven verändert, als ich 1983 meine Frau kennenlernte.
...nach tiefem Abgrund
Kurz davor, in den Jahren 1980 - 1981 war der Tiefpunkt in meinem noch jungen Leben erreicht, ich war auf dem Ritt in den Abgrund, aber dadurch gab es auch wieder die Chance für eine Kehrtwendung bergauf, einen Neustart in eine bessere Zukunft, als ich Hilfe in einer Langzeittherapie für jugendliche Suchtkranke fand. Meine Mutter berichtete mir, wie mein Vater in meiner sechsmonatigen Abwesenheit (Januar bis Juni 1981) − obwohl ich schon nicht mehr zu Hause wohnte −, irgendwann nicht mehr aufhörte zu fragen, "wo de sell isch?“, oder „was de sell macht?“. Sie gab ihm lange keine konkrete Antwort auf seine Fragen, was ihn vermutlich noch neugieriger machte. „Du hesch Dich doch auch sonsch nie für ihn interessiert“, lautete einmal die Gegenfrage meiner Mutter, wie sie mir erzählte.
„Isch der etwa …?“
Irgendwann hatte er dann eine Idee, vermutlich weil ihm mein häufig alkoholisierter Zustand - trotz unserer seltenen Begegnungen - nicht verborgen geblieben war. Er fragte meine Mutter nun direkt: „Isch der etwa in der Trinkerheilanschtalt?“ Da bestätigte sie seinen Verdacht. Die daraufhin auf sie niedergehenden Beschimpfungsorgien und Kommentare zu meiner Person waren laut Erzählungen meiner Mutter nicht vergnügungssteuerpflichtig.
Neuer Sohn?
Mit meinem Aufenthalt in der "Trinkerheilanstalt" wurde mein Vater 1981 negativ geschockt. Positiv geschockt hat ihn dann vermutlich ein Tag im Sommer 1983, als ich meinen Eltern zum ersten Mal meine Freundin und spätere Frau bei einem Familienfest vorstellte. Bei diesem Besuch hatte sich mein Vater - wie mir später erzählt wurde - über die Herkunft meiner Freundin, bereits eingehend erkundigt. Was er hörte, verursachte in ihm einen bemerkenswerten Umdenkungsprozess. Warum?
Kann das wahr sein?
So wie mein Vater damals tickte, bin ich mir sicher, dass er sich umgehend die Frage stellte, wie es sein kann, dass eine junge, gutaussehende Frau mit Abitur und als Studierende an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl, sich mit einem Verlierer-Typen wie mich abgibt. Als solchen hatte er mich - laut meiner Mutter - bisher stets im Rahmen seiner nicht seltenen Lästereien zu meiner Person eingeordnet. Und nun solch eine dicke Überraschung! Dann erfuhr er noch, dass meine Freundin die Tochter eines promovierten Volkswirtes und Psychologen ist, der als selbständiger Unternehmer in der Marktforschung tätig war und ihre Mutter Studienabschlüsse für den gymnasialen Schuldienst hatte. Für meinen Vater stand vermutlich erst einmal die Welt auf dem Kopf und es wird ordentlich in seinem verbogenen Hirn-Gebälk gerumpelt haben. Aber dies löste offenbar erhebliche Folgen bei ihm aus. Nach diesem Vorstellungsbesuch mit meiner Freundin verpasste mir mein Vater offensichtlich einen neuen - positiven - Image-Aufkleber. Denn "ab sofort" - so erinnere ich mich wiederum an Erzählungen meiner Mutter - äußerte er keinerlei Sticheleien mehr gegen mich. Mir war das egal: Meine Freundin und spätere Frau hatte ich ja nicht deshalb kennen und lieben gelernt, um bei meinem Vater zu punkten.

3.10 Rollenspiele
Schwere Zeiten überwinden
Rollenspiele
Sonderbare Geschichten schrieb das Leben für mich, insbesondere auch über die Beziehung zu meinem Vater. In einer Fachklinik für Jugendliche mit Suchterfahrungen konnte ich in einem langen und schwierigen Prozess meine Vergangenheit aufarbeiten.
Kreative Psychotherapie
Erfahrene Psychotherapeuten gaben mir in der Langzeittherapie die kreative Möglichkeit, mich mit gestörten Beziehungen im familiären und sonstigen Umfeld auseinanderzusetzen. So verstand ich diese besser und bekam Ideen, wie ich mein Verhalten ändern konnte. Eine besondere Rolle spielte natürlich das zu dieser Zeit miserable Verhältnis zu meinem Vater.
Theaterbühne
Dabei wurde ich gedanklich von den Psychologen auf eine Theater-Bühne geführt. Aus dem besonderen Blickwinkel der Vogelperspektive und später mit konkreten Rollen-Betrachtungen analysierten wir die Beziehungsgeflechte meines bisherigen Lebens und ordneten sie ein. Da diese Methode für mich als ADS-Betroffenem sehr effektiv war und die Türen für geduldiges Betrachten und für emotionales Einfühlungsvermögen öffnete, konnte ich davon extrem profitieren. Später hatte ich wieder die Chance, eine Bühne für kreative Selbstfindung durch Rollenspiele zu nutzen. Im Jahre 2000 war ich Mitglied einer Theatergruppe in Donaueschingen...
(www.theater-cafe.de/buehne94archiv.htm#schlafzimmer).
Zurück zum Vater:
Tempelritter
Auch mein Vater suchte und fand offensichtlich Rollen für höhere Einsichten und Sinnerfüllung in seinem Leben. Nachdem sein Weg vom einfach geprägten Zuhause und nach zwei vorzeitig beendeten Berufsausbildungen über sonderbare Wege in ein Spätberufenen-Internat für angehende Priester führte, entschied er sich am Ende dann doch nicht für ein zölibatäres Leben. Einerseits fühlte er sich zum Priesterberuf hingezogen. Andererseits waren Begegnungen mit jungen Frauen vermutlich der Grund dafür, dass er einem Sozialarbeiterstudium schließlich den Vorzug gab. Aber ganz ließ die geistliche Berufung meinen Vater dann doch nicht los. Irgendwie wollte er dennoch seinen hohen Idealen folgen und doch noch die Rolle eines geistlichen Würdenträgers finden. Aber wie? Dieses Ziel erreichte er schließlich, indem er sich dem Deutschen Tempelritterorden anschloss, in welchem er später von den Ordensbrüdern sogar in ein oberstes Amt gewählt wurde. Solche geistlichen Ämter konnte er auch als verheirateter Familienvater ausüben.

3.11 Versöhnung mit Vater - ein langer Weg
In der letzten - leidvollen - Phase seines Lebens, als mein Vater viele Jahre ans Krankenbett gefesselt war, zeigte sich mir seine andere, für mich zugängliche Seite. Von diesem Moment an konnte ich mich völlig mit meinem Vater versöhnen und ihm vergeben.
Erinnerungen an Vaters Tod
Meine Mutter lebt seit dem Tod meines Vaters im Haushalt meiner jüngeren Schwester Angelika bei Freiburg. Im Jahre 2008 verstarb mein Vater zu Hause, kurz vor den Osterfeiertagen. Meine Mutter konnte bei ihrem Mann sein, als er starb und von ihm Abschied nehmen.

3.12 Ehe der Eltern - Kinderstube (60igerjahre)
Familien-Rambazamba
Wenn ich an die familiären Verhältnisse zu Hause in meiner Kindheit denke, fällt mir das spannungsreiche Klima ein, dass den Alltag bestimmte. Da gab es viel Streit, und es war immer sehr laut. Ich fühlte mich oft unwohl. Als HANS GUCK IN DIE LUFT - Kind, tat ich mich veranlagungsbedingt in der Großfamilie mit dieser permanenten Überreizung besonders schwer.
Ursache: Problematische Vaterfigur
Zu meinem Vater blieben in meinen Kindheitserinnerungen haften, dass er gern auf Menschen herabschaute, die aus einfachen oder sogar aus normalen Verhältnissen stammten oder keine studierten Leute waren. Über diese lästerte er nach Herzenslust und machte sich über sie lustig. Wenn Besuch von „höheren“ Leuten bevorstand, dann mussten wir Kinder uns ganz arg benehmen. Fühlte sich unser Vater durch uns Kinder oder von einem Familienmitglied blamiert, rastete er total aus. Er war sehr darauf bedacht, von Mitmenschen mit einem höheren Status akzeptiert zu werden. Dafür tat er alles ihm Mögliche. Begegnungen und Freundschaften mit solchen Menschen präsentierte er gern mit Fotos in seinem Herrenzimmer unserer kleinen Altstadtwohnung. Auch sammelte er viele Ehrungen und Auszeichnungen und war sehr stolz darauf.
Patriarchen Allüren
Auch bemerkte ich schon als junges Kind, dass mein Vater oft respektlos mit uns Familienmitgliedern umging. Aber dies kam nicht von ungefähr. In seinem Zuhause hatten ihn in seiner Jugend permanent raue Töne begleitet, die in seiner Heimat auf der Schwäbischen Alb üblich waren (siehe auch Erzählungen dazu in anderen Kapiteln).
Liebloser Umgang mit kranker Oma
Seine Mutter sprach mein Vater beispielsweise nur mit ihrem Vornamen Laura an. Sie wohnte bei uns, weil sie psychisch krank war und ihren Haushalt in einem Dorf bei Sigmaringen, in dem auch ihr noch berufstätiger Mann (mein Opa) wohnte, nicht mehr versorgen konnte. Wie mein Opa ging auch mein Vater sehr lieblos mit ihr um. Es machte mich schon als Knirps wütend, wenn ich beobachtete, dass mein Vater meine Oma versteckte, sobald "besondere" Menschen zu Besuch kamen. Oma Laura musste sich dann in ihre Kammer zurückziehen.
Respektslos gegenüber Ehefrau
Ebenso erinnere ich mich daran, dass ich als Kind schon sehr darüber wütend wurde (ohne es mir anmerken zu lassen), wie mein Vater mit meiner Mutter umging. Er konnte sie ausdauernd beschimpfen mit den übelsten Worten, und das kam leider nicht selten vor. Meine Mutter war eine extrem vielbeschäftigte Hausfrau. Sie musste den großen Haushalt und ihre fünf Kinder versorgen. Außerdem gestaltete sich das Zusammenleben mit ihrem streitigen, launischen und mitunter aggressiven Ehemann äußerst schwierig. Wie viele Hausfrauen in jener Zeit war sie wirtschaftlich total von meinem Vater abhängig. Mitunter war sie allerdings der Erschöpfung nahe. Oft hörte ich sie sagen: „Ich fühle mich wie gelähmt." Außerdem weinte sie viel. Das machte mir oft Angst, und ich war wütend auf meinen ungehobelten Vater.
Apropos weinen:
Psychologen, die mich in meinem späteren Leben therapierten, sahen diese Bedingungen meiner Kindheit als Grund dafür an, warum es mich als Erwachsenen bis heute aggressiv machen kann – leider, und jeweils unberechtigt − wenn ich es mit weinenden Menschen zu tun habe. Das lasse ich mir natürlich nicht anmerken, aber so wird man von seinen Kindheitserfahrungen nachhaltig geprägt.
Mutter schützt Kinder…
Was mir auch im Gedächtnis blieb: Meine Mutter unternahm sehr vieles, um häusliche Konflikte klein zu halten und war sehr kreativ darin, meinem Vater - die ihn wütend machenden Alltagsgeschehnisse - vorzuenthalten oder sie weichzuspülen. Damit schützte sie uns Kinder, was nötig war, weil mein Vater eine hohe Bereitschaft hatte, seine Kinder "schlagkräftig" zu erziehen.
…vor Vaters Misshandlung
Je nach Laune schlug er uns − besonders Berthold und mich − sehr oft. Die Ohrfeigen waren dabei nicht so schlimm, mehr die Stockschläge auf die Hand, auf den Hintern, oder wo auch immer sie trafen. Leider war ich zu introvertiert und zu stolz, um bei diesen körperlichen Misshandlungen, die übrigens nach meinen Erinnerungen in den Sechzigerjahren in der Kindererziehung nichts Besonderes waren, laut zu schreien. Mein extrovertierterer Bruder konnte das viel besser, was ihm manchmal nützte, wenn Vater deshalb das Schlagen früher einstellte, um die Nachbarschaft nicht aufmerksam zu machen.

4. Kapitel: Kindergarten
Großer Kindergarten
Vor meiner Einschulung im Jahre 1965 besuchte ich einen großen Kindergarten am Rande der Freiburger Altstadt, unweit vom Schwabentor, den es heute noch gibt. Er wird in der Trägerschaft der katholischen Kirche geführt. In dem weitläufigen Haus gab es ein großzügiges Raumangebot. Um das Gebäude befanden sich auf zwei Ebenen, zwei große Außenflächen, damit die unzähligen Kinder der damaligen geburtenstarken Jahrgänge viel im Freien spielen konnten. Die Gruppenbetreuungen erfolgten in zwei Stockwerken. In dem großen Betreuungsraum befanden sich mehrere umfangreiche Spieltische, an denen sich Kinder mit den ausgelegten Spielsachen beschäftigten. Aber es wurde auch vorgelesen, und es gab Gruppenspiele.
Strukturierter Tagesablauf
An die Kindergartenzeit habe ich keine schlechten Erinnerungen. Einen Trubel wie im Kindergartenbetrieb war ich von meinem Zuhause in der Großfamilie schon gewöhnt. Allerdings erinnere ich mich, dass die Betreuerinnen uns durchaus positive Zuwendung schenkten, obwohl wir so unglaublich viele waren. Außerdem erinnere ich mich, dass ich den strukturierten Tagesablauf im Kindergarten sehr angenehm fand. Dies verhinderte jedoch keine außergewöhnlichen Ereignisse. Beispiel:
Kleine Story: Kidnapping
Kindesentführung durch Geschwister
Nach einiger Zeit des Kindergartenbesuches durften wir Geschwister allein den gut zwanzigminütigen Weg in den Kindergarten gehen. Anfangs ging ich zusammen mit meinen beiden älteren Geschwistern. Nachdem beide in die Schule gekommen waren, durfte ich diesen Fußweg allein zurücklegen. Eines Morgens trat ich gleichzeitig mit Gudrun und Berthold aus dem Haus. Normalerweise trennten sich dann sofort unsere Wege: Die Schulkinder mussten rechts abbiegen und das Kindergartenkind links, denn die Schulen, die meine Geschwister besuchten, lagen in entgegengesetzter Richtung.
Plan funktioniert
Doch meine umtriebige Schwester hatte an diesem Vormittag einen besonderen Plan ausgeheckt. Sie fand es eine besonders gute Idee und hatte sich fest vorgenommen, mich mit in die Schule zu nehmen, um mir die Welt der Großschüler einmal live näherzubringen. Zuvor verständigte Gudrun sich daher mit Berthold dahingehend, dass beide mich beim Austreten aus der Haustüre in ein Gespräch verwickelten, damit ich, statt den Weg zum Kindergarten einzuschlagen, mit ihnen mitgehen würde.
Ablenkung? Null Probleme bei ADS-Kind
Dieser Plan ging bestens auf, da ich als HANS GUCK IN DIE LUFT − dauerzerstreut, wie ich war −, mich mühelos in eine falsche Richtung locken ließ. Das fand ich auch ganz interessant, denn es war ein völlig neues Erlebnis für mich, statt den täglichen Routineweg in den Kindergarten abzugehen, an diesem Morgen meine Geschwister zu begleiten. Für Abwechslung war ich als ADS-Kind naturgemäß offen. Außerdem gab es auf dem ungewohnten Schulweg meiner Geschwister viel Neues zu entdecken.
Irrwege? Große Schwester beruhigt
Irgendwann fiel mir mein Irrweg dann doch auf, und ich meldete bei meinen Entführern Bedenken an: Ich könnte Ärger bekommen, wenn ich nicht im Kindergarten ankäme. Doch Gudrun hatte schon immer eine besondere Ausstrahlung, so etwas „Mitnehmendes“. Mit Leichtigkeit konnte sie mich davon überzeugen, alles sei in Ordnung, und ich müsse mir keine Sorgen machen. Also ging ich guten Mutes mit meiner großen Schwester weiter bis zur Schule und in ihr Klassenzimmer.
Entzückte Mädchen
Dort hielten sich schon viele Kinder auf, darunter einige Mädchen, die den kleinen Bruder ihrer Mitschülerin süß fanden. Alle wollten dem kleinen Knaben zeigen, was sich um sie herum im Klassenzimmer befand. Dabei wurde ich sogar von unterschiedlichen Mädchen an die Hand genommen und herumgeführt. Das fand ich ultra-spannend und aufregend.
Schwester beruhigt Lehrerin
Als die Lehrerin meine Schwester fragte, warum ich sie an diesem Vormittag begleitete, da antwortete diese, − wieder sehr überzeugend −, es habe sich familiär oder umständehalber so ergeben, und unsere Mutter wisse natürlich Bescheid.
Entführungsfinale: Mutters Standpauke
Spannend war unsere Heimkehr nach der Schule zum Mittagessen. Meine Mutter war bereits vom Kindergarten informiert worden, der kleine Gerold sei dort heute nicht angekommen. Sie machte sich große Sorgen. Dennoch wollte ich − beladen mit vielen neuen Eindrücken − zuhause meiner Mutter die Erlebnisse vom Abstecher in die Schule erzählen. Doch dazu kam ich erst einmal nicht. Meine Schwester und ich erhielten zuallererst eine saftige Standpauke verpasst, in der Mama uns mit ermahnenden Worten erklärte, mein spontaner und unerlaubter Schulausflug sei überhaupt keine gute Aktion gewesen.

Siehe nachfolgende Unterkapitel...

5.1 Unfälle - Kindheit (60erjahre)
Unfallgefahren durch tollpatschiges Kind! - Beispiele...
- Pfosten
Wie schon erzählt, war ich als HANS GUCK IN DIE LUFT, als besonders zerstreutes Kind mit dem ADS, sehr anfällig für Unfälle. Meine Konzentration fixierte sich selten länger auf einen Punkt, was zur Folge hatte, dass ich ab und zu mit Verkehrsschilder-Pfosten kollidierte oder bei Kletterübungen abstürzte.
- Absturz am Trümmergrundstück
Einmal kletterte ich mit anderen Buben in einem Trümmergrundstück im Bereich des Freiburger Stadtgartens herum, zu welchem der Zutritt eigentlich verboten war. Ein entsprechendes Verbotsschild „übersahen“ wir Kinder ebenso wie Absperrungen. Beim Abstieg in die tiefe Baugrube rutschte ich leider ab, fiel entsprechend tief hinunter und knallte unsanft auf dem Grubenboden auf. Kurz bekam ich keine Luft, konnte mich dann schließlich aufrichten, zwar etwas benommen durch den Aufprall, aber stabil. Ich hatte großes Glück: Außer einer Gehirnerschütterung, Verstauchungen und Schürfwunden war nichts passiert.
- Stadtgartensturz
Im Stadtgarten in Freiburg gab es früher ein Kinderbadebecken mit einem Kletterbogen, über welchen die Kinder − wie auf einer waagerecht aufgestellten Leiter mit Sprossen − in einer für ungesicherte Verhältnisse bemerkenswerten Höhe von einem Ende zu dem anderen klettern konnten. Bei sonnigem Badewetter war dieses Klettergerüst bei den Kindern sehr beliebt. Auch ich mochte es. Aus Düsen an einem Zwischengestänge wurden die Kinder beim Klettern von unten mit einem kleinen Wasserstrahl bespritzt. Unfälle gab es trotz des Gefahrenpotentials für die Kletterkinder offensichtlich selten.
Erhebliche Verletzungen
Aber wenn HANS GUCK IN DIE LUFT kletterte, war vieles möglich. Eines Tages rutschte ich tatsächlich auf dem Klettergerüst zwischen zwei Sprossen durch und knallte mit dem Hinterkopf auf das Zwischengestänge, wo die Wasserspritzdüse installiert war. Die Welt drehte sich um mich, und es dauerte einige Minuten, bis ich ansprechbar war und wieder sicher stehen und gehen konnte. Außerdem blutete ich am Kopf und aus dem Mund, vermutlich hatte ich mir beim Aufprall auf die Zunge gebissen. Nachdem die Blutungen am Kopf und anderswo gestillt waren, wurde ich mit meiner faustgroßen Beule am Kopf nachhause und von dort zum Arzt gebracht. Danach musste ich eine mehrtägige Bettruhe einhalten.
- Treppensturz
Ich könnte noch viele Unfallsituationen in meiner Kindheit schildern. Als letztes Beispiel berichte ich noch über einen spektakulären Treppenabsturz in dem großen Treppenhaus des Altstadtgebäudes, in welchem ich und meine Familie wohnten. Ich stolperte über meine eigenen Beine, rollte wie ein Ball viele Treppenstufen hinunter und schlug mehrfach mit dem Kopf auf. Nach einem unsanften Ankommen am Treppenende konnte ich zwar wieder aufstehen, allerdings mussten wieder einmal einige Prellungen und Verletzungen sowie eine Gehirnerschütterung behandelt werden.
Besorgnis – oder Spott und Hohn
Besorgte Mutter
Ich sehe sie noch, die besorgten Blicke meiner Mutter und anderer Bezugspersonen über meine Tollpatschigkeiten.
Spöttischer Vater
Weniger gern erinnere ich mich an die spöttischen Bemerkungen meines Vaters dazu, der sich gerne darüber belustigte, wie schlafwandlerisch ich manchmal durchs Leben ging. „Hast Du wieder einmal ein Nina am helllichten Tage gemacht und nicht auf den Weg geschaut?“, lautete beispielsweise seine „fürsorgliche“ Frage an mich, mit einem ganz eigenen, für mich ekelhaft schadenfrohklingenden Unterton.
Stoff für Gewaltfantasien
Das war übrigens damals guter „Stoff“ für Gewaltphantasien, die ich entwickelte, aber nur in meinen Gedanken und Träumen ausleben konnte. Umso mehr, wenn mein Vater dann noch so saublöde Standard-Sprüche daraufsetzte wie: „Wer nicht hören will, muss fühlen“, oder: „Was das Hänschen nicht lernt,“ (zum Beispiel beim Gehen auf den Weg zu schauen, meinte er vermutlich), „… lernt der Hans nimmermehr“. Wenn ich dann noch sein hämisches Grinsen dabei sah, dann war meine innerlich kochende Wut auf ihrem Höhepunkt, allerdings ohne eine Möglichkeit, sie loszuwerden.
Ohne bleibende Schäden
Festzuhalten bleibt, dass ich trotz überdurchschnittlicher Unfall-Anfälligkeit wegen meiner für ein ADS-Kind typischen Unkonzentriertheit und spontanen Ablenkbarkeit dennoch ohne bleibende äußere Schäden davongekommen bin. Da hatte ich, trotz allen meinen Handicaps doch stets einen treuen Schutzengel an meiner Seite.

5.2 ADS / ADHS und Augenhandicap
ADS-Handicap
(Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom – seit Geburt)
Eingangs, im ersten Kapitel, führte ich schon aus, dass ich von Geburt an besonders von dem Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS) betroffen war. Also mit einem solchen Handicap, bei welchem das Gehirn die Summe der zu verarbeitenden Außenreize nur unzureichend "filtern" kann. Die Betroffenen können sich kaum konzentrieren, sie wirken hyperaktiv (ADHS) oder verträumt / zerstreut (ADS).
ADHS / ADS-Handicap bei Erwachsenen
Früher war man in der Fachwelt lange der Meinung, dass sich das ADHS oder ADS spätestens zum achtzehnten Geburtstag von den Betroffenen automatisch verabschiedet. Zwar nehmen nicht alle Kinder dieses Handicap mit in ihr Erwachsensein. Aber es gibt - wie man heute weiß - sehr viele erwachsene Menschen, die das ADS / ADHS aus ihrer Kindheit "mitnehmen" (so wie das bei mir der Fall war) und lebenslang behandelt werden müssen. In den Universitätskliniken gibt es daher inzwischen spezielle Abteilungen / Stationen, in denen Erwachsene mit dem ADHS bzw. ADS behandelt werden. So wurde ich 2014 in der Universitätsklinik Freiburg intensiv untersucht und getestet, obwohl ich schon seit vielen Jahren ein - für ADS, bzw., ADHS-Patienten hochwirksames Medikament verordnet bekam. Veranlasst hatte diese Untersuchung meine Psychotherapeutin, die mich damals behandelte, um danach eventuell Rückschlüsse für die weitere Psychotherapie gewinnen zu können. Die Diagnose - ADS - fiel dann erwartungsgemäß sehr eindeutig aus. Außerdem gab es Vorschläge für nachbehandelnde Fachärzte (zum Beispiel für das Ausprobieren von verschiedenen - neuen - Medikamenten).
Augenhandicap
Extrem verdecktes Schielen
Ebenfalls im ersten Kapitel erzählte ich schon über die Benachteiligungen, welche das - sehr stark ausgeprägte - verdeckte Schielen als angeborenes Handicap in meiner Kindheit und Jugend verursachte.
Lesen im "Überflugmodus"
Die Folge war, dass ich beispielsweise nicht in er Lage war, Buchstabe für Buchstabe in einem Text lesen zu können, sondern ich die Schriftzeichen in einem "Überflugmodus" aufnahm, was allerdings beim Schreiben dazu führte, dass ich einzelne Buchstaben oder ganze Wörter nicht vollständig aufs Papier brachte. Meine Noten für Diktate, beispielsweise in der Grundschule, waren daher meistens an den "runden Noten" in roter Schrift erkennbar.
Späte Hilfe
Eine (sehr) späte - aber hoch wirksame Hilfe - durfte ich jedoch (wie schon im ersten Kapitel angeführt) ab dem Jahr 1997 erfahren, nach einer gelungenen Operation in der Universitätsaugenklinik Freiburg. Das eigenwillige - extrem unterschiedliche - Sehen meiner beiden Augen wurde - soweit wie noch möglich - operativ zusammengeführt. Danach konnten - bis heute - geeignete Prismen-Sehhilfen von spezialisierten Optikern angefertigt werden, welche zusätzlich für ein entspannteres Sehen sorgen. Solche Prismen-Gläser sind allerdings immer wieder neu anzupassen. Seit den Neunzigerjahren werde ich dabei von einem Optiker in Deißlingen betreut, (unweit von meinem Wohnort entfernt), der sehr viel Erfahrung hinsichtlich der Anfertigung solcher Sehhilfen für Menschen mit schielenden Augen hat.

5.3 Sucht / Wege hinein - und hinaus (1970-1980)
Beruhigungs-Trinken macht suchtkrank
Ab meinem 13. und bis zu meinem 23. Lebensjahr rutschte ich erst langsam, dann aber umso schwerer in die Suchterkrankung hinein. Rückblickend gesehen wurde für mich der Zusammenhang mit meinem ADS und dem Einstieg in die Alkoholabhängigkeit deutlich. Warum? In meiner Kindheit kannte man die Besonderheit und die möglichen schwerwiegenden Auswirkungen für Betroffene mit dem ADS noch nicht. Für mich bedeutete es, dass ich mich - wie schon in einem anderen Kapitel erwähnt - permanent in einem inneren Stressmodus befand (ständig aufgewühlt). Von außen wurde ich aber - wie schon beschrieben - nicht als hyperaktiv (wie ADHS - Kinder), sondern ganz im Gegenteil, als überwiegend „weggedreht“, verschlafen oder verträumt wahrgenommen, eben mit typischen Merkmalen eines HANS GUCK IN DIE LUFT.
Unruhe-Symptome Kleinkind: Kopfschlagen zum Einschlafen
Nur abends neigte ich als ADS-Kind offensichtlich dazu, meine innere Unruhe direkt – von außen sichtbar - abzubauen, indem ich vor dem Einschlafen, teilweise sehr lange, mit meinem Kopf in das Kopfkissen einschlug. Als meine Mutter dieses sonderbare Verhalten der Kinderärztin beschrieb, konnte diese es nicht einordnen. Pragmatisch wie man seinerzeit war, fand sie aber rasch eine Begründung für mein sonderbares Verhalten. Die Kinderärztin beruhigte meine Mutter mit ihrer Diagnose, das Kind habe mit dem Kopf-Einschlagen eben eine ganz eigene Einschlafhilfe gefunden und stellte in Aussicht, das abnormale Verhalten werde sich irgendwann von selbst legen.
Später: Alkohol-"Medizin"...
Als älteres Kind in der beginnenden Pubertät suchte ich dann eine andere Hilfe, um meine ständige, - in bestimmten Situationen unerträgliche - innere Unruhe reduzieren zu können. Sehr bald hatte ich erste Kontakte mit alkoholischen Getränken und war sofort davon fasziniert, wie wohltuend beruhigend Alkohol auf mich wirkte. Es dauerte nicht lange, bis es zu einem regelmäßigen, heimlichen Alkoholkonsum kam, den ich - wie eine Medizin - (zur Entspannung) zu mir nahm. Später als Süchtiger, musste ich ihn dann trinken, um die von dem Alkoholmissbrauch zusätzlich erzeugte innere Unruhe (wenn der Körper wieder "Nachschub" anforderte) überhaupt noch ertragen zu können.
Folge: typische Suchtkarriere eines Jugendlichen (1970 -1980)
Der Verlauf meiner Suchterkrankung in einem sehr jungen Lebensalter, bereits ab meinem 14. Lebensjahr, entsprach exakt den Schilderungen in der Fachliteratur. Kurz zusammengefasst: Erst erleichtert, dann süchtig. Bis man es bemerkt, und die Suchterkrankung eingestehen kann, braucht es meistens einen extremen Leidensdruck. Erst dann nehmen Suchtkranke in den meisten Fällen Hilfe an. So ereignete sich dies auch bei mir.
1980: Letzte Phase des Siechtums
Das Jahr 1980 steht für das Finale meiner Suchterkrankung. Wenn sich mein Alkoholkonsum − insbesondere abends − wieder einmal tagelang extrem gesteigert hatte, bekam ich die Auswirkungen einer Alkoholvergiftung heftig und immer häufiger zu spüren. Dies geschah meistens dann, wenn ich zusätzlich zu dem hohen, täglich gewohnten Bierkonsum auch noch Schnäpse konsumierte. Danach erfolgten heftigste Reaktionen meines Körpers.
Leiden eines schwer Suchtkranken
Ich musste mich − in der Einzimmerwohnung, in der ich inzwischen lebte − ganze Nächte lang ständig übergeben, wurde von Schweißausbrüchen, Schlaflosigkeit und Zitteranfällen an Händen und Armen und Beinen heimgesucht. In dieser heißen Phase der Vergiftung half es dann auch nicht mehr, wieder Alkohol zu trinken, um das gestörte Nervenkostüm zu beruhigen. Ihn hätte ich sofort wieder erbrechen müssen. Die Folge war, dass ich neben den Zitteranfällen und den Schweißausbrüchen auch noch schwere Depressionen, Angstzustände und Panikattacken bekam. Suizid- Gedanken waren in solchen Phasen keine Seltenheit.
Verzweiflung pur!
Das war Verzweiflung pur, ein äußerster Tiefpunkt in meinem Leben! Ich war in diesen Momenten froh, wenn ich es noch schaffte, mich bei meinem Arbeitgeber telefonisch krank zu melden, was immer öfter notwendig wurde. Manchmal musste ich meine Hausärztin anflehen, mir nachträglich eine Krankmeldung auszustellen, damit ich nicht große Probleme mit meinem Arbeitgeber bekam. Auch die äußeren Merkmale waren unübersehbar: Ich wurde stark übergewichtig, sah aufgeschwemmt aus, und mein Gesichtsausdruck sprach Bände. Dazu bekam ich Ausschläge im Gesicht und am ganzen Körper.
Kollegen wollen helfen
Kollegen versuchten, mich auf mein Problem aufmerksam zu machen, und fragten immer öfter, warum ich so viel an Gewicht zunehme, oder was mit mir los sei. Die Antwort kannten die Kollegen vermutlich längst. Nur ich fand keine Antworten für mich selbst und keinen gangbaren Weg, um aus dem Teufelskreis der Sucht, der mich längst fest im Griff hatte, herauszukommen. Helfen konnte mir auch nicht die nette Kollegin, die in der Nähe meines Büros arbeitete und offensichtlich - trotz meiner unguten Außenwirkung - mindestens ein Auge auf mich geworfen hatte. Sie besuchte mich immer wieder und fragte mich zunehmend konkreter danach, ob ich zu viel tränke, was ich aber abstritt. Irgendwann besuchte sie mich nicht mehr, − sie hatte mich wohl aufgegeben.
Rote Zahlen auf Girokonto
Dieses kranke Leben brachte aber auch andere Probleme mit sich, so meldeten meine Kontoauszüge ein immer höheres Defizit. Positiv daran war, dass ich mein Auto aus Geldmangel nicht mehr betanken konnte: In dieser Zeit war es gut, mich nicht hinter das Steuer zu setzen. Dafür ging ich dann zu Fuß an die nächste Tankstelle, um mir Flachmänner zu besorgen. Wenn eine mehrtägige und leidvolle Entgiftungsphase überstanden war, dann sorgte das Alkohol-Teufelchen in mir wieder dafür, dass mich meine psychische Abhängigkeit so lange quälte, bis ich zu dem bewährten Beruhigungsmittel, also wieder zum Glas griff. Dadurch begann dann erneut eine weitere Phase − ein wirklicher Teufelskreis.
Der Weg aus der Suchtkrankheit:
Als ich im Dezember 1977 meinen Wehrdienst nach fünfzehn langen Monaten beendet hatte, kehrte ich zurück in das Zivilleben. Das fühlte sich wesentlich angenehmer an, allerdings hatten sich meine Trinkgewohnheiten in der Bundeswehrzeit noch weiter intensiviert. Wie durch ein Wunder − trotz mitunter extremen Alkoholexzessen − schaffte ich nach sechsmonatigem Besuch der Verwaltungsschule bei Freiburg 1978 dennoch den Abschluss für den mittleren Verwaltungsdienst. Nach der Verwaltungsschule wurde ich zunächst ins Ordnungsamt und 1979 in das Bauordnungsamt bei der Stadt Freiburg versetzt, in dem ich bis 1988 tätig war. Aber auch in dem neuen Amt, in dem ich meinen Dienst antrat, konnte ich meine Suchterkrankung nicht lange verbergen.
Story: Alkoholiker-Eskapaden:
Wo bleibt der Kollege?
Auf dem Freiburger Messeplatz fand jährlich eine große und beliebte Ausstellung statt, bei der viele Angebote zu Haushalt, Garten und Heimwerkerbedarf präsentiert wurden. Die städtischen Bediensteten bekamen durch eine Wander-Freikarte in den jeweiligen Ämtern die Möglichkeit, diese Ausstellung kostenlos zu besuchen. So trugen sich interessierte Mitarbeiter in eine Liste ein und konnten dann jeweils für einen halben Tag die Großausstellung besuchen. Dafür mussten wir Überstunden abbauen. So durfte auch ich an einem Vormittag zu der Messe gehen. So weit, so gut. Als ich in den Ausstellungshallen ankam, beabsichtigte ich zwar, einige für mich interessante Stände zu besuchen, landete aber sehr bald im Bereich der Messe-Gastronomie. Dorthin schien mich ein sehr großer Durst geführt zu haben, denn als ich diesen Bereich wieder verließ, hatte ich spürbar Schlagseite.
Auszeit – statt Rückkehr
Gut war, dass ich zur Mittagszeit in diesem Zustand nicht an den Arbeitsplatz zurückkehrte, weil ich meinen reichlichen Alkoholkonsum nicht hätte verheimlichen können. Schlecht war, dass ausgerechnet ein älterer Kollege aus dem technischen Dienst, der mich sowieso nicht mochte, am Nachmittag meine Wander-Freikarte hätte bekommen sollen. Sein Messebesuch fiel daher − zu seiner großen „Freude“ − aus. Ich fuhr um die Mittagszeit erst einmal mit dem Bus nach Hause, weil ich mich sehr müde fühlte. Allerdings hätte ich mich in meiner Wohnung nicht zu einem Mittagsschläfchen hinlegen sollen, von dem ich erst am späten Nachmittag wieder aufwachte. Als ich am nächsten Tag zum Dienst ging, erwartete mich ein mächtiger „Einlauf“ meines Chefs.
Zuspitzung am Arbeitsplatz
Dieser Chef war ein junger Vorgesetzter, der ehrgeizig eine neue Abteilung aufbaute. Etwa ein Jahr nach meinem Dienstbeginn, es war das Jahr 1980, sank ich so weit in die Alkoholabhängigkeit, dass sie zu immer mehr Fehltagen führte. Schließlich musste ich auch tagsüber Alkohol trinken, um extrem auftretende Unruhezustände damit abzumildern. An einem Arbeitstag hatte ich es wieder einmal mit den Folgen einer durchzechten Nacht zu tun. Um an solchen Tagen überhaupt einen klaren Gedanken zu fassen, musste ich leider schon am Vormittag wieder Alkohol zu mir nehmen, damit sich mein Händezittern beruhigte und ich ruhiger wurde. Die Einnahme von kleinen Jägermeistern erfolgte heimlich auf der Toilette. Allerdings war ich sehr froh, als ich endlich in die Mittagspause gehen konnte. Denn mir ging es an diesem Tag − trotz oder gerade wegen der heimlich konsumierten Beruhigungsschnäpse − sehr schlecht.
Arbeiten - unmöglich
Meiner Arbeit nachzugehen war in solchen Situationen nahezu unmöglich. Aber ich musste an meinem Schreibtisch so tun als ob. Mein schlechter Zustand an diesem Tag führte schließlich dazu, dass ich während der Mittagspause nach Hause ging, (ich wohnte nicht weit von meinem Arbeitsplatz entfernt), weil ich glaubte, mich dort mit einem Mittagsschläfchen wieder etwas erholen zu können. Als ich erwachte, war es aber (wieder einmal) bereits später Nachmittag. Das versetzte mir natürlich einen gewaltigen Schrecken. Irgendwie vermutete ich bereits, dass meine Alkoholkrankheit bei meinem Arbeitgeber schon bemerkt wurde, verdrängte das allerdings immer wieder. So versuchte ich krampfhaft, eine Geschichte zu erfinden, warum ich an diesem Nachmittag nicht mehr zum Dienst erschienen war. Mir fiel aber nichts Plausibles ein.
Mutter handelt
Schließlich wusste ich mir nicht mehr zu helfen und griff nach dem letzten Rettungsanker: Ich bat telefonisch meine Mutter inbrünstig darum, bei meinem Chef anzurufen, um ihm irgendeinen Grund mitzuteilen, warum ich an diesem Nachmittag nicht mehr zur Arbeit kommen konnte. Die Fragen meiner Mutter, warum ich in diese Situation gekommen war, beantwortete ich vermutlich nur sehr ausweichend. Da meiner Mutter meine Alkoholprobleme jedoch nicht unbekannt waren, ahnte sie bestimmt, was bei mir wieder einmal los war. Nach einigem Zögern erklärte sie sich schließlich bereit, meiner Bitte nachzukommen, und rief bei meinem Abteilungsleiter an. Was sie mit ihm am Telefon konkret gesprochen hat, bekam ich dann nicht mehr mit (ich wohnte ja nicht mehr bei meinen Eltern), und meine Mutter wollte mich später auf meine Nachfrage hin auch nicht näher darüber informieren.
Chef spricht Klartext
Als ich am Folgetag wieder arbeiten ging, hatte ich sogleich einen Termin bei meinem Vorgesetzten. Er erkundigte sich zunächst, aus welchem Grund ich am Vortag nachmittags nicht mehr wiedergekommen war. Ich verwies auf den Anruf meiner Mutter, an welchen er sich dann auch, allerdings mit hochgezogenen Augenbrauen, erinnerte. Daraufhin wurde es ernst. Er konfrontierte mich mit einer klaren Ansage und ließ mich wissen, ich stünde schon einige Zeit unter Beobachtung, und meine auffälligen Alkoholiker-Gewohnheiten seien ihm, der Amtsleitung und dem Kollegenkreis nicht verborgen geblieben.
Peinliche Konfrontation
Dann wechselte mein Chef in die Beweisführung. Wie er diese bewerkstelligte? Da hatte er keine große Mühe und er brauchte auch nicht besonders suchen. Ich hatte nämlich am Vortag meinen Schreibtisch nicht abgeschlossen, weil ich ja eigentlich am Nachmittag wieder zum Dienst erscheinen wollte. Nun forderte mein Chef mich auf, zusammen mit ihm zu meinem Schreibtisch zu gehen – und zog zielgenau eine Schublade heraus, in welcher schon auf den ersten Blick keine Stifte oder sonstiges Büromaterial zu sehen waren. Als er die Schublade bewegte, schepperte es vielmehr unüberhörbar. Dann zeigte mein Vorgesetzter entschlossen mit dem Zeigefinger auf eine große Zahl leerer Jägermeisterfläschchen, die ich blöderweise schon länger nicht mehr entsorgt hatte. Am liebsten wäre ich in den Erdboden versunken, so sehr schämte ich mich. Aber diese Lektion hatte gesessen.
Leidensdruck bringt Wende
Sie erzeugte schließlich den Leidensdruck, den ich - wie die allermeisten Suchtkranken - brauchte, um mir helfen zu lassen. Mir war sofort klar, dass ich mich erst gar nicht zu wehren brauchte. Ich hatte die Wahl, mir entweder zeitnah Hilfe zu suchen oder dienstlich erheblichen Druck zu bekommen. Da ich im Sommer 1979 noch kein Beamter auf Lebenszeit war (dies konnte erst mit Vollendung des 27. Lebensjahres erfolgen), drohte meine Entlassung aus dem Beamtendienst, die mir von meinem Chef unmissverständlich in Aussicht gestellt wurde, sollte ich meine Suchterkrankung nicht sehr bald überwinden können.
Hilfesuche
Zeitnah suchte ich dann eine Beratungsstelle für die Suchtkrankenhilfe auf, wo man mir nach eingehender Untersuchung und ambulanter Therapie dringend eine stationäre Langzeittherapie in der Fachklinik Michaelshof für jugendliche Suchtkranke in der Pfalz empfahl.
Psychologin: „In Jugend-Therapie“ mit ihm!
Auch wenn ich zu diesem Zeitpunkt schon 22 Jahre alt war, wurde mir von fachärztlicher Seite und im Gutachten einer Diplompsychologin eine verzögerte Persönlichkeitsreifung bescheinigt. Somit hielt man es für erforderlich, dass ich wie ein Jugendlicher und nicht wie ein Erwachsener therapiert wurde. Der Grund: Wenn eine Suchterkrankung in der Kindheit oder Jugend entsteht, sind bei den Therapien für die Betroffenen ganz besondere Anforderungen zu beachten, damit Heilungschancen überhaupt erreicht werden können.
Finanzierungsloch...
Werden die Kosten für solche Langzeittherapien bei Suchtkranken normalerweise von der Renten- oder den gesetzlichen Krankenkassen übernommen, konnten sich damals bei beamteten Suchtkranken erhebliche Finanzierungsprobleme ergeben. So war das auch bei mir. Beamten und Beamtinnen wurden (wie auch heute noch) Krankenkosten teilweise auf Antrag von ihren Dienstherren und teilweise über die privaten Krankenversicherungen erstattet. Weder meine private Krankenversicherung noch die Beihilfestelle des Dienstherrn wollten aber die Kosten für eine sechsmonatige Suchtkranken- Therapie für mich bezahlen.
… braucht Solidarität
Nun schlug die Stunde der familiären Solidarität. Meine Großmutter Faller, eine Tante, meine Mutter und mein ehemaliger Nachhilfelehrer, ein Freund meines Vaters und noch mehr Leute stellten Geldsummen zur Verfügung. Die Suchtberatungsstelle sorgte dafür, dass meine kleine Wohnung für sechs Monate untervermietet werden konnte, mein Gehalt wurde natürlich eingesetzt, und ich bekam schließlich doch kleine Zuschüsse von meiner privaten Krankenversicherung und der Beihilfestelle meines Arbeitgebers. Letzterer gewährte mir noch ein zinsloses Darlehen. Mit diesem Finanzierungsplan bewarb ich mich (über die Beratungsstelle) um einen Therapieplatz als Selbstzahler in der Fachklinik Michaelshof.
Ablehnung - trotz Finanzierungskonzept
Zu meinem Schock fand ich kurz darauf an einem Samstagvormittag im Briefkasten eine kurze Mitteilung, meine Aufnahme für eine stationäre Therapie werde trotz vorgelegter Finanzierungsplanung abgelehnt. Begründet wurde diese Ablehnung damit, es liege keine Erklärung der Kostenträgerschaft für meine Behandlung vor, die die Rentenversicherung beziehungsweise die gesetzlichen Kranken- Versicherungen ausstellten. Für mich unvorstellbar war, dass demnach beihilfeberechtigte Beamte mit privater Krankenversicherung, die im Gegensatz zu gesetzlich krankenversicherten Patienten keinen Anspruch auf Kostenträgerschaften bei einer Behandlung von Suchterkrankungen hatten, faktisch von fachärztlich dringend angeratenen Langzeit-Therapien ausgeschlossen sein sollten. Als Pensionsberechtigte für den späteren Ruhestand war es für Beamte ja gar nicht möglich, eine Bescheinigung für die Kostenträgerschaft einer Rentenversicherung zu erhalten.
Verzweiflungsanruf erfolgreich
In meiner Verzweiflung griff ich noch an selben Samstagvormittag zum Telefonhörer und rief in der pfälzischen Fachklinik an. Zwar war dort samstags die Verwaltung nicht besetzt, aber ich wurde mit dem Verwaltungsleiter verbunden, der zufällig im Hause war. Er war übrigens selbst als Jugendlicher alkoholkrank gewesen, wie man in der Klinik-Broschüre nachlesen konnte.
Klinikleitung macht Weg frei…
Offensichtlich machte mein verzweifelter Anruf bei dem Verwaltungsleiter mächtig Eindruck, als ich ihm energisch aufzählte, wer sich alles für mich engagiert hatte, damit ich für alle Therapiekosten aufkommen könnte. Bevor mein Gesprächspartner zu Wort kommen konnte, um zu antworten, tat ich ihm noch wortreich mein Unverständnis, meine Enttäuschung und Verzweiflung kund, dass ich trotz aller Bemühungen doch keinen Therapieplatz bekommen sollte. Aber auch damit beließ ich es noch nicht und versuchte meinen Gesprächspartner mit aller Emotionalität, die ich aufbringen konnte, zu überzeugen, dass ich dringend behandelt werden müsste, weil ich sonst vor einem totalen Absturz stünde.
„Also gut!“…
Als der Verwaltungsleiter dieser Fachklinik es dann endlich schaffte, zu Wort zu kommen, beendete er schon bald unser Telefonat mit den Worten: „also gut, dann kommen sie halt erst mal zu uns – ausnahmsweise“, was mich sehr erleichterte. Allerdings, so gab er mir klar zu verstehen, sei ich dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass die monatlichen Rechnungen pünktlich überwiesen würden. Ansonsten, so kündigte mir der Klinik-Chef unmissverständlich an, müsste ich sofort aus der Therapie entlassen werden. Kurz darauf erhielt ich tatsächlich den ersehnten Brief der Fachklinik, in welchem meine zeitnahe Aufnahme als Patient für eine sechsmonatige Langzeittherapie zum 16. Dezember 1980 mitgeteilt wurde.
Schuldenberg – dafür Neustart
Nach der Therapie hatte ich dann zwar eine Menge Schulden, musste meine Stereoanlage verkaufen und meinen Opel Kadett abgeben. Aber ich hatte wieder die Chance, neu anzufangen.

5.4 Depressionen (ab ca. 2011 schwerer Verlauf - vorzeitiger Ruhestand: 2013)
Viel wird zwar in den Medien geschrieben und gesendet zum Thema Depression. Dass es sich dabei um eine handfeste und gefährliche Erkrankung handeln kann, ist vielen Leuten dennoch nicht so richtig bewusst. Ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall, das sind spektakuläre - öfter auch tödlich endende - Krankheitsverläufe, die allgemein nachvollzogen werden können. Aber schwere Depressionen? Für mich entwickelte sich diese Erkrankung der Psyche jedenfalls nicht weniger bedrohlich, wie die eben genannten schweren Erkrankungen. Deshalb möchte ich nachfolgend den Vorhang etwas lüften, damit man verstehen kann, wie sie sich in der Lebensrealität bei mir auswirkte.
Komplexe Ursachen
Es gab einige Ursachen und Gründe rund um diese heimtückische Erkrankung, die für die behandelnden Ärzte in Frage kamen. Krankheitsgeschichten, die letztlich in schweren Depressionen landen, reichen aber in den meisten Fällen bis in die frühe Kindheit zurück, wie bei mir. Außerdem gibt es genetische Veranlagung und andere fachmedizinische Zusammenhänge zu beachten. Ein äußerst komplexes Thema. Letztlich ausgelöst wurde bei mir die schwere Phase der Depression vermutlich durch besondere Umstände im beruflichen Umfeld, auf die ich in späteren Kapiteln und im Teil II meiner Autobiografie noch ausführlich eingehen werde. Aber diese Umstände waren „nur“ die Auslöser der schweren depressiven Phase, die etwa ab dem Jahr 2011 damit begann, dass meine Psyche eine Eigendynamik entwickelte. Es wurde zunehmend schwieriger, gegen die krankheitstypischen Symptome anzugehen. Man wird sich selbst zunehmend "fremder". Im Bilde gesprochen: Nach und nach schalten sich bestimmte "Lichter" in der Psyche aus, bis eine bedrohliche Dunkelheit droht, von der es kein Endrinnen mehr zu geben scheint. Die Außenwirkung verändert sich. Auch früher kannte ich Situationen, in denen ich in einen Tunnel hineinzufahren schien. Aber meistens war für mich immer noch eine Ausfahrt erkennbar, die ich irgendwann zu erreichen hoffte, und die hinaus ins helle Tageslicht führte. Vom Beginn meiner depressiven Erkrankung an verlängerten sich jedoch die Fahrzeiten in der Dunkelheit des Tunnels immer mehr, bis schließlich − weiter im Bilde gesprochen − keine Ausfahrt mehr erkennbar war.
Risiken und Wirkungen
Es drohte also eine unendliche Fahrt in eine dunkle Sackgasse, mit konkreten Auswirkungen auf mein psychisches, aber auch auf mein physisches Befinden. Beispiele: Niedergeschlagenheit, Stress, Herz- Kreislaufbeschwerden, Hörsturz, oder dauerhafte Schlafstörungen. Zeitweise machte sich eine bleierne Müdigkeit in mir breit, die zu Erschöpfungszuständen führte. Auch Angstgefühle kamen auf, die ein normales Agieren beispielsweise in Sitzungen und Gesprächen unmöglich machten. Als Bürgermeister einer Gemeinde, also in einem Amt in der Öffentlichkeit, waren das äußerst unglückliche Zustände. die sich kaum mehr überspielen ließen. Es brauchte in diesen Situationen äußerst viel Kraft, um solche verwirrenden inneren Vorgänge nach außen hin zu überspielen, soweit dies überhaupt noch möglich war. Irgendwann klappte es aber leider immer weniger, und ich musste schließlich die Notbremse ziehen.
Familie besorgt
Auch meiner Familie blieben diese Veränderungen nicht verborgen. So wurde ich als schweigsam wahrgenommen und war nur noch schwer ansprechbar. Ich zog mich − laut meiner Familie − immer mehr zurück.
Gesundheit geht vor
Da ich zuletzt beruflich ein politisches Amt ausübte, und nachdem ich wegen der Beschwerden 2011 und 2012 bereits zwei Mal mehrwöchig stationär in Fachkliniken für psychosomatische Medizin behandelt wurde, konnte ich meinen vorzeitigen Rückzug aus dem Bürgermeisteramt, so schwer mir das fiel, ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr vermeiden oder hinauszögern, in der Hoffnung, alles würde irgendwann wieder besser werden.
Zeit zu gehen
Die Erkenntnis, dass die Zeit gekommen war, das Unausweichliche anzunehmen und entsprechend zu reagieren, war gekommen, als ich nach meiner letzten stationären Behandlung in einer Fachklinik für psychosomatische Medizin im Jahre 2012 merkte, dass sich die zunächst wieder zurückerlangten Kräfte ins Gegenteil verkehrten. Die Folge: Mein Krankheitszustand pendelte sich sehr bald wieder auf den Tiefpunkt ein wie vor meiner Klinikbehandlung.
Eindeutige Einschätzungen der Fachmediziner
Deshalb kamen die Fachmediziner zum Schluss, mir die umgehende Beendigung meiner Berufstätigkeit dringend nahezulegen. Dabei wiesen sie auch auf die sich verschlimmernden physischen Erkrankungen hin (Herz- und Kreislaufbeschwerden, Hörsturz, u.a.). Mir blieb daher nichts anderes übrig, als aufgrund meines desolaten Gesundheitszustandes - dem Landrat gegenüber - meinen Amtsverzicht zu erklären, in Form eines Antrags auf Versetzung in den Ruhestand aus gesundheitlichen Gründen.
Amtsarzt – klare Einschätzung:
Es erfolgte eine amtsärztliche Untersuchung. Der Amtsarzt schloss sich schließlich den fachärztlichen Gutachten mit der Empfehlung an, die Ablösung aus meinem Bürgermeisteramt zu vollziehen.
Aus und vorbei!
Der Landrat folgte der fachbehördlichen Empfehlung und kündigte an, mich ab dem 1. September 2013 aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand zu versetzen. Er nahm deshalb im Juli 2013 als Gast an der letzten - von mir geleiteten - Sitzung des Gemeinderates teil und verabschiedete mich aus dem Amt. Damit endete leider meine elfjährige Amtszeit als Bürgermeister.
Abschied und Trost nach vierzig Jahren Dienst
Tröstend für mich war allerdings, dass ich auf eine erfolgreiche Zeit zurückschauen durfte, was der Landrat bei meiner Verabschiedung ausdrücklich hervorhob, und worüber in der Presse ausführlich berichtet wurde. Auch auf anderen Zeitdokumenten findet sich diese Würdigung aus meiner elfjährigen Amtszeit wieder. Gleichzeitig überreichte er mir eine Ehrenurkunde für meine vierzigjährige Zugehörigkeit im öffentlichen Dienst (von 1973 bis 2013), unterschrieben vom Ministerpräsidenten des Landes Baden- Württemberg. Darüber hinaus stellte mir das Landratsamt (auf meinen Antrag hin) einen Schwerbehindertenausweis aus.
Familie spendet Kraft
Gott sei Dank hatte ich in der schweren Zeit meiner Erkrankung und danach die liebevolle Unterstützung meiner Familie, der ich dafür sehr dankbar bin. Besonders meiner Frau. Gerade in solchen Situationen ist es dann wichtig, solche Menschen um sich zu haben, die einen liebevoll und mit Verständnis begleiten. Da hatte ich großes Glück!
Herausforderung: Zurückfinden
Um den Weg aus der Lebenskrise zu finden, nahm ich ab dem Beginn meines Ruhestandes mehrere Jahre lang psychotherapeutische Hilfe in Anspruch (ambulante Therapie), bei der ich lernte, auf bestimmte Warnsignale zu achten und meine Grenzen zu kennen. Außerdem durfte ich lernen, anzunehmen, dass sich mein Selbstwert nicht nur oder nicht mehr durch beruflichen Erfolg definiert, sondern es eine Vielfalt von alternativen Möglichkeiten für eine positive Lebensgestaltung und für die Selbstannahme gibt.
Großes Stück geschafft
Dies in die Praxis umzusetzen, brauchte jedoch ein paar Jahre. Aber nun habe ich, − glaube ich −, schon ein großes Stück geschafft, neue Wege für mein Ruhestandsdasein zu finden, um zufrieden leben zu können. Als Pensionär bieten sich für mich jetzt auch Möglichkeiten an, Dinge zu tun, die für meine Gesundheit nachhaltig förderlich sind. Zum Beispiel:
Auf den Hund gekommen
Ich verbringe mit meiner lieben kleinen Hündin täglich viel Zeit im Wald, wozu es um meine Wohngemeinde im Schwarzwald herum naturgemäß zahlreiche Möglichkeiten gibt. Letztere, eine besonders liebenswürdige kleine Parson-Russel-Hündin, lebt seit 2014 treu an meiner Seite. Als fünfjährige Zuchthündin entließ sie die Freiburger Züchterin in den Ruhestand. Seither teilt Kitty mit mir diesen – für uns beide neu eingetretenen – Lebensabschnitt, was uns gegenseitig sehr guttut!
Unter Menschen gehen
Auch lernte ich es zu vermeiden, dass ich mich − außerhalb der Familie − ganz aus sozialen Kontakten zurückzog. In der schweren Phase meiner Erkrankung an Depression fiel es mir allerdings schwer, mich an Orten aufzuhalten, wo sich viele Menschen trafen. Da meldeten sich gerne die Alarmsymptome zurück. Deshalb musste ich mich für eine lange Zeit absolut zurückziehen. Doch inzwischen gelingt es mir wieder, mich unter Leute zu begeben, mit der Einschränkung, dass ich auf meine inneren Warnsignale höre und mich zurückziehe, wenn dies geboten ist.
Nie unterkriegen lassen!
Doch auch in diesem Zusammenhang galt, was sich in meinem Leben bisher stets in Krisenzeiten als effektivste Gegenwehr bewährt hatte: immer wieder aufstehen, sich gegen vermeintlich Überforderndes zur Wehr setzen, sich überwinden.

5.5 Herz - Notfalloperation (Juni 2020)
Auch wenn ich auf einem guten Weg in den vergangenen sieben Jahren meines frühen Ruhestandes wähnte, mit der Bewältigung der eben erzählten schweren Erkrankung an Depressionen, meldete sich meine Herzerkrankung überraschend mit Wucht im Frühsommer 2020 - nach der ersten großen Welle der Corona-Krise - zurück. Da mir 2006 bei plötzlich auftretenden Herzbeschwerden ein Stent eingesetzt wurde und ich seither Medikamente (Blutverdünner) einnehmen musste, um weitere Herzprobleme zu vermeiden, glaubte ich, mich auch in dieser Hinsicht auf einem guten Weg zu befinden. Falsch gedacht! Regelmäßige Belastungs-EKG meldeten zwar keine Störungen. Doch zeigte es sich, dass auch hochmoderne medizinische Messgeräte nicht immer vollständig hinter "die Kulissen" blicken können.
Fahrradtour endet vorzeitig
Bei einer kleinen Fahrradtour (die erste im vorangeschrittenen Frühjahr 2020), die ich mit meiner Frau mit unseren E-Bikes unternahm, führte uns ein längerer Weg teilweise steil bergauf. Natürlich unterstütze mich dabei der elektrische Motor meines E-Bikes. aber ich fuhr - wie immer - so, dass ich nicht die höchste Stufe der motorisierten Hilfe in Anspruch nahm, um auch meine Muskelkraft trainieren zu können. Offensichtlich habe ich mich dabei überschätzt.
Runter vom Fahrrad!
Denn plötzlich wurde mir übel und ich musste sofort vom Fahrrad absteigen. Auch einige Minuten danach konnte ich die Fahrt nicht fortsetzen, weil mir schwindlig wurde. Erst nach längerem Warten setzen wir unsere Fahrt fort. Allerdings nicht weiter bergauf, sondern mit dem schnellsten Weg - bergab - zurück nach Hause. In den Tagen darauf konnte es passieren, dass ich beim Gehen auf ebener Strecke plötzlich das Gefühl hatte, wie wenn ich im Laufschritt einen Berg hinauflaufen würde.
Schleunigst zur Klinik-Untersuchung!
Ich vereinbarte daher einen Termin für eine Untersuchung in der Schwarzwald-Baar-Klinik in Villingen-Schwenningen. Zunächst durfte ich dort wieder Fahrrad fahren während den Aufzeichnungen bei einem Belastungs-EKG. Nach einigen zugeschalteten Erschwerungsstufen beim Treten (bei ca. 60 % für eine durchschnittlich gemessenen Leistungen von Patienten in meinem Alter) musste ich wieder - wie bei meiner Frühlingstour mit dem E-Bike - abbrechen, weil mir übel wurde. Die Messungen des Blutdruckes danach ergaben jedoch, dass sich dieser wieder relativ geordnet beruhigte.
Antworten machen Chef-Arzt stutzig
Der mich behandelnden Chefarzt fragte jedoch beim anschließenden Gespräch nach den Verläufen meiner Beschwerden, wegen denen ich zur Untersuchung gekommen bin. Als ich ihm diese geschildert hatte, wollte er mich sofort für eine Herzkatheter- Untersuchung stationär aufnehmen. Also eine solche Untersuchung, wo in den Handgelenken der Patienten ein super kleines "U-Boot" mit einem Verbindungsdraht auf die Reise in die Blutbahnen um das Herz geschickt wird und dieser Hightech-Winzling dann exakte Bilder von dort übersendet. Meine Klinikaufnahme konnte jedoch erst am Tag drauf erfolgen.
Umgehend stationäre Aufnahme
Nachdem diese Herzkatheteruntersuchung durchgeführt war, zeigte der Chefarzt ein sonderbares Verhalten. Er meinte kurz, dass ich bestimmt nichts dagegen hätte, wenn er sofort seinen Kollegen - einen namhaften Herzchirurgen - in der Universitätsklinik Freiburg kontaktiert, damit dort meine umgehende Aufnahme für eine dringend durchzuführende Bypassoperation veranlasst werden kann. Abends kam dann der mich behandelnde Professor an mein Bett und überbrachte mir eine - bei mir Gänsehaut verursachende - Hiobsbotschaft. Danach seien alle wichtigen Blutbahnen um mein Herz herum völlig verkalkt und ich könnte "dem lieben Gott danken", dass ich bisher kein totales Herzversagen erlitten hätte!
Zu jung für Herzstillstand
"Sie sind doch noch viel zu jung", hörte ich ihn noch sagen beim Weggehen. Damit beschrieb er die lebensgefährliche Situation, in der ich mich offensichtlich befand. Ab sofort wurde ich behandelt, wie "ein rohes Ei". Ich durfte keinen Schritt mehr gehen. Transportiert wurde ich stets mit einem Rollstuhl. Auch meine Umlagerung vom Krankenbett in den Krankenwagen erfolgte nur per Rollstuhl bzw. auf einer Trage.
Spezieller und umgehender Krankentransport nach Freiburg
Im Krankenwagen begleitete mich eine freundliche Sanitäterin und überwachte während der Fahrt von Villingen-Schwenningen nach Freiburg (in die Uni-Klink) die Messgeräte, welche Auskunft über meine Herztätigkeit gaben. Diese vielen Geräte und manche Pieps-Geräusche während der Fahrt, das waren schon befremdliche Eindrücke für mich. Allerdings hatte ich ja diese freundliche Begleiterin des DRK neben mir, die es verstand, mich aufzumuntern.
Ankommen in der Uni-Klinik Freiburg
Auch die Aufnahme in der Uni-Klinik in Freiburg erlebte ich als spannendes Ereignis. Ich konnte nicht fassen, dass dort schon alles vorgerichtet war. Nach der Ankunft wurde ich auf eine Station gefahren und - mit einigen Messgeräten - in ein Klinikbett verfrachtet. Kaum lag ich dort im Bett, da gaben sich verschiedene Fachärzte, Krankenschwestern und Pfleger "die Klinke in die Hand". Ich musste viele Fragen beantworten und Unmengen von Formularen unterschreiben. Dann kam noch eine freundliche Dame aus der Klinikverwaltung, um mit mir - vor Ort im Krankenzimmer - alle Aufnahmepapiere auszufüllen.
Heiße Informationen vor der Operation
Schließlich schaute auch der operierende Professor vorbei und informierte mich, ebenso wie seine Kollegen der Anästhesieabteilung, ausführlich über die bevorstehende umfangreiche Operation. Dabei erfuhr ich, dass dieselbe etwa 7 Stunden dauern wird, mir der Brustkorb geöffnet und das Herz sozusagen "abgeschaltet" wird. Dessen Funktionen, so die Fachärzte, würde solange eine Herz-Lungenmaschine übernehmen. Um operieren zu können (Anbringen von Ersatzblutleitungen als ständige "Umleitungen"), so wurde mir noch erklärt, müsse man die Knochensäge einsetzen. "Wir müssen ihren Brustkorb so weit öffnen, damit wir die umfangreichen Eingriffe an Ihrem Herzen durchführen können". Das leuchtete mir ein. Aber mein Wohlbefinden reduzierte sich nach dem Gehörten kurzfristig auf einen Tiefpunkt. Der freundliche Chefarzt versicherte mir aber glaubhaft, dass er solche Operationen schon Jahrzehnte sehr erfolgreich an unzähligen Patienten durchgeführt hat und ich mir keine Sorgen machen müsse.
Ersatzteillageruntersuchung
Ganz speziell fühlte sich für mich auch eine Ganzkörperuntersuchung per Ultraschall an, die länger dauerte. Dazu wurde ich wieder mit dem Rollstuhl in das Untersuchungszentrum der Klinik im Kellergeschoss gekarrt. Aufgabe für den Fachmediziner: Strategisch abgestufter Entnahmeplan von körpereigenen Blutgefäßen erstellen, die sich am besten für Ersatzblutbahnen für das Herz eignen. Auf meine besorgte Frage, ob nach einem solchen Eingriff, beispielsweise an meinem linken Unterarm, derselbe nicht lahm werden würde, beruhigte mich der Fachmediziner sofort. Beispielsweise seien die Arterien im Unterarm doppelt vorhanden, weshalb man eine davon normalerweise - ohne Schaden anzurichten - entnehmen könne. Diese sei ein besseres Material mit längerer Haltbarkeit (!), als wenn eine Vene aus dem Oberschenkel entnommen werden müsste.
Die Operation steht "vor der Türe"
Laut meiner Frau Barbara war es an dem Vormittag der Operation im Hause Löffler mucksmäuschenstill. Beide erwachsenen Kinder waren an diesem Tag zuhause. Die siebenstündige OP begann frühmorgens gegen acht Uhr. Am Vorabend wurde ich von einem Krankenpfleger an bestimmten Körperteilen glattrasiert. Jegliche Einnahme von Speis und Trank ab dem Vorabend wurde streng unterbunden. "Ganz nüchtern" müsse ich sein, lautete die Auskunft des Klinikpersonals, weil ich viele Stunden in eine Vollnarkose versetzt, mit Schläuchen künstlich beatmet und die Herz-Kreislauffunktion ebenfalls von einer Maschine übernommen würde (das Herz also "angehalten" wird (!)). Schlafen konnte ich in dieser Nacht vor der Operation überhaupt nicht.
OP-Vorbereitungen beginnen
Aufregend empfand ich den Augenblick, als am frühen Morgen die Stationsschwester mich zum Abtransport in den OP-Bereich der Uni-Klinik abholte. Nachdem ich ein eigenartiges weißes Nachthemd mit wenig Stoff und kleinen Schnürchen zum Festbinden angelegt bekam, rollte sie mich auf meinem Krankenbett auf mehreren Fluren in Richtung Aufzug, der uns einige Stockwerke tiefer in ein Labyrinth von Zubringerwegen in den Vorbereich des zutreffenden Operationssaals brachte. Dort angekommen, nahm ich einen merkwürdigen Hochbetrieb in früher Morgenstunde wahr. Die erste Station war das Kontroll-Center zum Einchecken. Das Personal dort stellte mir eigenartige Fragen. "Wie lautet Ihr Vor- und Zuname"? "Wann sind Sie geboren"? "Was wird heute bei Ihnen operiert"? "Was für ein Datum haben wir heute"?, "Wann haben Sie zuletzt etwas gegessen oder getrunken"? Und so weiter. Das waren schon seltsame Augenblicke. Schließlich wurde ich in einen kleinen Raum gerollt, mit unzähligen elektronischen und anderen medizinischen Geräten. Es roch eigenartig. Über mir leuchteten einige Leuchtstäbe an der Decke. Die freundliche, aber auch energische Stationsschwester drückte mir die Hand zum Abschied, mit den "besten Wünschen für den bevorstehenden Operationsverlauf" und sagte mir zu, für mich die Daumen fest drücken zu wollen. Irgendwie verspürte ich ein "Endzeitgefühl", so als würde bald mein letztes Stündchen schlagen. Aber es gelang mir, dieses bald wieder zu verdrängen. Hilfreich dabei waren bestimmt die ersten Beruhigungsmittelchen, die mich über eine der vielen Infusionsschläuche erreichten, welche mir nun zahlreich anmontiert wurden.
Humor hilft
Der dazukommende Oberarzt der Anästhesieabteilung sprach mich mit seinem herzhaften Humor an, indem er feststellte, dass meine Blutgefäße überdurchschnittlich schwer für die vielen Nadeln erreichbar wären und sie sich einiges einfallen lassen müssten. Seine direkte Ausdrucksweise mit breitem Freiburger Dialekt hatte aber etwas Beruhigendes für mich, denn sie strahlte Sicherheit für mich als Patienten (der auch aus Freiburg stammt) aus. Das konnte ich in diesen Augenblicken sehr gut gebrauchen! "Kei Sorg, junger Mann, wege Ihre verschteckte Blutbahne, mir hän no immer alle gfunde, glaube se 's mir", sicherte er mir lachend zu. Dann verriet er mir auch, warum das seinem Anästhesieteam immer gelingt: "Sie sin hier bei de bsunders Gute glandet"! Seinen letzten lockeren Spruch an mich habe ich mir auch in Erinnerung behalten: "Vor mir Sie jetzt für e lange Wiele schlofe lege, verrote Sie mir bitte noch, wo Sie am liebschte Urlaub mache, dann könne mir uns dort glei treffe". Als ich ihm mit "Südtirol" antwortete, hörte ich noch seine Antwort: "Sell trifft sich gut, dorthin geh' i' au viel in Urlaub, zum Ski-fahre". Dann wurde mir die intensive Vollnarkose verpasst.
Etwas zu frühes Erwachen
Meine ersten Aufwachwahrnehmungen fing ich in einem großen Raum ein (Intensivstation). Der Blick war verschwommen. Um mich nahm ich Gesichter wahr, die mich anschauten. Der zweite Aufwachmoment war dann allerdings mit einem Panik-Stressmoment verbunden. Denn ich erwachte vermutlich etwas zu früh, exakt in dem Moment, als mir die Beatmungsschläuche aus meinem Hals gezogen wurden. Bis dieses entnommen waren, verspürte ich intensivste Würgereize und bekam keine Luft. Ich hörte dann laute Zurufe, dass dies gleich vorbei wäre und alles gut verlaufen sei. So kam es auch und mein Stressmoment wich auch bald wieder einem entspannten Wohlgefühl, für das offensichtlich der Inhalt eines - über mir hängenden - Fläschchens sorgte, der mir über einen Schlauch zugeführt wurde. Danach wurde ich ständig beobachtet, umgeben von piepsenden elektronischen Geräten.
Erlösender Anruf zuhause
Meine Frau Barbara wurde dann in der Mittagszeit von dem Professor angerufen, der mich operiert hat. Seine Informationen sorgten für Aufatmen in meiner Familie. Er teilte ihr mit, dass die Operation sehr gut verlaufen sei und es mir den Umständen entsprechend gut ginge. Diese frohe Botschaft wurde auch mir überbracht und ich konnte nach einer Nacht schon wieder von der Intensivstation in mein Zimmer auf der Station verlegt werden. Die Heilungsphase nach der Operation verlief sehr positiv. Genervt hat mich aber der Blasenkatheter, der mir einige Tage nicht abgenommen werden konnte. Hintergrund war, dass ablaufender Urin ständig dahingehend untersucht werden musste, ob sich auch ausreichend viel Wasser aus meinem Körper entfernt, das sich operationsbedingt in größerer Menge dort abgelagert hatte. Ansonsten verspürte ich erstaunlich wenig Schmerzen im Brustbereich, wofür vermutlich auch die vielen Medikamente sorgten, welche mir zugeführt wurden. Allerdings durfte ich nur auf dem Rücken liegen und jede Seitwärtsbewegung musste ich vermeiden, weil das Brustgebein nach der Operation nur zusammengebunden wurde, und erst wieder in der richtigen Position zusammenwachsen musste. Sehenswert sind die verbliebenden Operationsnarben. Ein langer Längsschnitt am Brustkorb ist gut zu erkennen und eine - den ganzen linken Unterarm verlaufende - Schnittnarbe (Entnahme der Arterie als Bypass-Material) erinnern noch an die aufregenden Klinik Zeiten im Frühsommer 2020, die ich in meinem restlichen Leben vermutlich nie vergessen werde!
Operation gelungen - mit einer Einschränkung
Aus dem Operationsbericht der Uni-Klinik war später nachzulesen, dass drei Bypässe laut Operationsplan an meinem Herzen angelegt werden sollten. Zwei konnten jedoch nur realisiert werden, weil besondere Umstände an der Stelle, wo dieser dritte Bypass angelegt werden sollte, dies nicht zuließen. Mir wurde jedoch bei einem Nachschautermin im September 2020 von dem Professor der Uni-Klink, der mich operierte, versichert, dass mein Herz auch mit nur zwei verpassten Bypässen funktionieren kann. Bis jetzt behielt der erfahrene Mediziner recht mit seiner Prognose. Ich hoffe, das bleibt so!
In der Reha wieder funktionieren "lernen"
Nachdem im Juli 2020 die Corona-Patienten in der Rehaklinik Königfeld (nahe bei meinem Wohnort gelegen) wieder weniger wurden, konnte die Uni-Klinik Freiburg für mich dort zeitnah nach meiner Entlassung einen Reha-Platz buchen. Mit routinierten Behandlungsschritten wurden dort in der Albert-Schweizer-Klinik die frisch operierten Herzpatienten wieder befähigt, genügend Kondition - Luft - zum Gehen zu bekommen. Täglich wurden zunächst Hofgänge mit wenigen Schritten durchgeführt, dabei wurde der Blutdruck gemessen. Anfangs zeigte dieser hohe Werte und die kleinsten Bewegungen fühlten sich sehr anstrengend an. Von Tag zu Tag verbesserte sich jedoch die Kondition und die Gehversuche wurden zunächst zu kleinen, dann zu großen Spaziergängen. Allerdings waren das sonderbare Erfahrungen, dass man ganz normale Körperaktivitäten, wie das Gehen, erst wieder einüben muss. Parallel standen täglich Gymnastik und weitere Fitnessübungen, sowie unzählige Untersuchungen und auch ein tägliches Wiegen des Körpergewichtes auf dem Reha-Programm. Die medizinischen Nachkontrollen ergaben schließlich, dass der Heilungsprozess bei mir zügig voranging. Es brauchte jedoch noch ein paar Monate, bis ich wieder so fit war, dass ich beispielsweise meine Autobiografie zuhause wieder weiterschreiben konnte. Insbesondere musste sich in meinem Körper wieder genügend Blut nachbilden, damit der größere - operationsbedingte - Blutverlust wieder "aufgefüllt" war.
Fazit - nach diesem letzten Klinikabenteuer:
Wieder einmal schmiss es mich gewaltig auf die "Bretter" und wieder einmal schaffte ich es, wieder aufzustehen!

5.6 Rückblick: Gesundheit überstrapaziert?
Abschließende Anmerkungen:
Krank durch falsche Berufswahl?
Öfter wurde mir seit meiner Pensionierung die Frage gestellt, was ich aus heutiger Sicht anders entscheiden würde, um schwere Erkrankungen - wie eben erzählt - zu vermeiden. Ob ich es bereuen würde, berufliche Abenteuer eingegangen zu sein, von denen ich meiner Biografie erzähle (zum Beispiel: zwei Bürgermeisterwahlkämpfe hintereinander in den Jahren 2001 und 2002).
Klare Antwort:
Null und nichts zu bereuen - ganz im Gegenteil!
Ich würde wieder meine Chancen entschieden nutzen, welche sich ab einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben ergeben haben. Warum? Menschen, die lange durch Handicaps daran gehindert waren, erfolgreich sein zu können und darunter seit ihrer Kindheit sehr leiden mussten, die wissen, wie es sich anfühlt, wenn man - nach möglich gewordenen - medizinischen Hilfen neue Chancen geboten bekommt, die man nutzen kann. Besonders kennen solche Leidensgenossen auch das schöne Lebensgefühl, wenn sie ihr Leben zum Positiven wenden können. Darauf zurückschauen zu können, erfüllt mich mit Freude und Stolz!
Und außerdem:
Was die Herz-Kreislauferkrankung angeht: Hier scheint bei mir das Sprichwort zuzutreffen: "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm". Beispielsweise mussten sowohl mein Vater als auch sein Bruder (mein Onkel), - noch bevor sie sechzig Jahre alt wurden -, früher in Rente gehen. Warum? Aus gesundheitlichen Gründen. Beide wurden schwer herzkrank und es wurden auch bei ihnen Bypass-Operationen erforderlich.

6. Kapitel: Wohnverhältnisse
Lebensumstände
Wohnverhältnisse beschreiben ist nicht nur eine Abfolge über räumliche Lebensumstände zu bestimmten Zeiten. Sie erzählen auch vieles über die Lebensumstände in verschiedenen Lebensphasen.
Bescheiden gestartet
Wie ich schon bei meinen Kindheitserinnerungen ausführlich erzählt habe, lebte ich in den ersten dreizehn Jahre meines Lebens nicht gerade in einer familiären Wohlfühlgemeinschaft. In einer beengten Wohnung mit acht Mitbewohnern zu leben (1957-1971), war eine mitunter sehr spannende Angelegenheit. Insbesondere mit einem besonders schwierigen Patriarchen als Haushaltsvorstand, wie man früher die berufstätigen Ernährer der Familien nannte.
Fünf Mal umgezogen
Die erste Wohnung, in der ich mit meiner Großfamilie seit meiner Geburt (1957) bis 1971 lebte, befand sich in der Altstadt in Freiburg. Danach zog ich insgesamt fünf Mal um.
1971 zog meine Familie in eine große Wohnung im Freiburger Stadtteil Wiehre um.
1979 wagte ich den Sprung in die ersehnte Selbständigkeit und mietete eine kleine Wohnung im Freiburger Stadtteil Bischofslinde.
1982 mietete ich eine alte kleine Doppelhaushälfte im Stadtteil Mooswald (FR). Für weniger Mietkosten konnte ich dort in eine größere Wohnung umziehen.
1987, nach meiner Hochzeit, bezog ich mit meiner Ehefrau Barbara die erste eheliche Mietwohnung in Donaueschingen in einem älteren Einfamilienwohnhaus aus den Fünfzigerjahren, das meiner Schwiegermutter gehörte.
2002 erfolgte dann nochmals ein letzter Umzug in die Schwarzwaldgemeinde, wo ich zum Bürgermeister gewählt wurde. Dieses Mal zog ich mit Frau und Kindern in die "eigenen vier Wände".
Wie wohnte es sich wo?
Über die "mittelalterlichen" Wohnverhältnisse in der ersten Familienwohnung habe ich schon eingangs berichtet (siehe "Kindheitserinnerungen"). Ein Wohlfühlereignis war dann der Umzug in die wesentlich größere Wohnung im Jahre 1971, der sich auch entspannend auf das Zusammenleben unserer achtköpfigen Großfamilie auswirkte.
Eine Story zur 1971 bezogenen - großen - Wohnung:
Heldenhafte Mutter!
1971 kam es endlich zum Umzug in eine für unsere Familiengröße angemessen große Wohnung. So zogen wir von der Altstadt weg in den Freiburger Stadtteil Wiehre. Darüber waren wir sehr glücklich, dass unsere Großfamilie endlich in angemessenen Wohnverhältnissen leben durfte. Insbesondere war ich darüber erfreut, mit meinem Bruder ein großes Zimmer beziehen zu können, in welchem wir uns auch tagsüber aufhalten durften. Ohne den energischen und erfolgreichen Einsatz unserer sonst - so sanften - Mutter, wäre der Einzug in unsere neue Behausung jedoch nicht möglich gewesen.
Termin mit Entscheidungsträger
So ließ sie sich in der Chefetage der großen Kirchenbehörde, die unsere Vermieterin und gleichzeitig auch indirekt Arbeitgeber des Vaters war, einen Termin bei einem besonders hohen Kirchenmann geben. Insbesondere deshalb, weil alle ihre vorangegangenen Anfragen für eine größere Wohnung bei dieser Kirchenbehörde verpufften oder ignoriert wurden. Nun war der Zeitpunkt gekommen, dass sich ihr aufgestauter heiliger Zorn Luft verschaffen musste.
Gnädiges Gehör
Dabei fand ihr Donnerwetter bei den Kirchenoberen offensichtlich gnädiges Gehör, nachdem sie die nun schon lange Jahre andauernde, äußerst beengte Wohnsituation ihrer Großfamilie wirkungsvoll anprangerte, welche sich durch das Anwachsen der Großfamilie und das Älterwerden der Kinder mit der Zeit deutlich zuspitzte. Schließlich erinnerte sie − der Überlieferung nach – die von ihr kräftig in die Mangel genommene Geistlichkeit an die kirchliche Verantwortung für kinderreiche Familien und forderte diese ein. Kurz nach Mamas polterndem Auftritt kamen Angebote für größere Mietwohnungen.
Endlich Umzug
In der neuen großen Wohnung teilte ich dann – wie schon erwähnt - ein Zimmer mit meinem Bruder Berthold, wo wir uns auch tagsüber aufhalten durften. Allerdings zog mein Bruder bald wieder in eine Wohngemeinschaft für Auszubildende um. Danach bewohnte ich dieses Zimmer alleine. Die Räume der Fünfzimmerwohnung, zu der zusätzlich ein Zimmer im Dachgeschoss gehörte, (das Haus war etwa um 1900 erbaut), waren ungewöhnlich hoch und mit Stuckrosetten an der Decke verziert: Ein Kontrastprogramm zu bisherigen Uralt-Wohnräumen in der Altstadt. Alle Räume außer denen im Dachgeschoss waren ungewöhnlich hoch, etwa vier Meter. Die Wohnung war totalsaniert und hatte ein Badezimmer, (was wir wie gesagt bis dahin nicht hatten). Auch sonst war die Familie froh über die erheblich verbesserten Wohnverhältnisse.
Zwei weitere Storys:
Flower Power
Ganz ungewöhnlich für meinen Bruder und mich war es in der neuen, großen Wohnung, in welche wir 1971 umzogen auch, dass wir uns sogar die Tapeten für das - für unsere bisherigen Wohnverhältnisse - große "Palast"- Zimmer, mit riesigen Schiebetüren zum benachbarten üppigen Wohnzimmer, selbst aussuchen durften. Wie in den Siebzigerjahren nicht unüblich, gab es da ganz verrückte bunte Tapetenmuster. Mein Bruder und ich suchten uns dann wohl die verrückteste Bemusterung aus. Große mehrfarbige ineinandergreifende Farbringe auf giftgrünem Hintergrund schenkten uns in den kommenden Jahren eine "bunte" Wohnkultur. Die Wirkung dieser knallbunten "Leucht-Tapeten" an den hohen vier Zimmerwänden kann man sich vorstellen. Gott sei Dank war die Decke in weißer Farbe belassen worden.
Ultra-starke Zimmerbeschallung
Toll war auch eine große Lautsprecherbox, welche mir ein Freund meiner älteren Schwester zusammenbaute und unterhalb der Decke im neuen Zimmer installierte. Diese war mehrfach so groß, als mein erster "Mono-Plattenspieler", den ich mir günstig bei NECKERMANN besorgt hatte und sie war bestückt mit richtig großen Lautsprechern. Das traf sich gut, denn meine Lieblingsplatten waren jene von DEEP PURPLE oder LED ZEPPELIN. Solche Musik brauchte eine voluminöse Tonwiedergabe. Meine neue Lautsprecherbox brachte dann auch volle Leistung und mir und meinem Bruder viel Freude, aber auch manchmal mächtig Ärger mit unserer Mutter und den Nachbarn der anderen Wohnungen im Hause ein. Beispielsweise habe ich heute noch die Reaktion meiner lieben Mutter vor Augen, wenn ich manchmal das Musikstück "SPEED KING" von der Rockgruppe DEEP PURPLE abspielte. Da gab es nach einem anfänglichen, kurzen sowie saftigen, Rockmusik-Getöse - eine längere Phase eines Orgel-Solos zu hören, das sich - auch bei aufgedrehter Lautstärke - für sie im benachbarten Wohnzimmer zunächst noch sehr verspielt anhörte. Dieses schöne Orgelspiel drehte ich dann gerne hinsichtlich der "Lautstärke" besonders gerne auf. Das hatte einen besonderen Grund: Nach Ende des verspielt klingenden Orgel-Solos setzte dann das explosionsähnliche Fortissimo der harten Rockmusik ein, was bei meiner Mama dann regelmäßig eine Panikattacke auslöste, welche meistens mit dem Abschalten der Stromsicherung endete.
1979: reif für selbständiges Wohnen?
In meine erste - selbst gemietete - Wohnung zog ich - wie schon erwähnt - im Jahre 1979 ein. Nachdem ein Arbeitskollege und Kumpel eine kleine Einzimmerwohnung in der Nähe bezogen hatte, wollte ich mir auch ein kleines eigenes Reich mieten. Zufällig wurde in dieser Gegend ebenfalls eine kleine Einzimmerwohnung zur Vermietung angeboten. Nach der Besichtigung unterschrieb ich meinen ersten eigenen Mietvertrag. Diese Wohnung befand sich in einem dreigeschossigen Appartementhaus, hatte ein großes Zimmer, eine kleine Küche, ein Bad mit WC und Zentralheizung. Außerdem gehörte ein großer Balkon mit Sicht auf einen Sportplatz dazu, ein Kfz-Stellplatz und ein kleiner Kellerraum. In diesem Haus wohnten überwiegend Studenten.
Neue Wohnung – neues Glück?
Erstmals eine eigene Wohnung zu bewohnen war schon ein schönes Gefühl, an das ich mich erinnere. Allerdings blieb mir auch in Erinnerung, wie geschockt ich erst einmal war über meine exorbitant gewachsenen monatlichen Mehrkosten. Das hätte ich mir auch vorher überlegen und durchrechnen können. Im „Hotel Mama“ musste ich zwar 300 DM monatlich abgeben, in diesem Betrag waren jedoch alle Kosten für Wohnen, Essen, Wäschewaschen enthalten. Nun kostete bereits die monatliche Kaltmiete für meine schöne kleine Wohnung mehr als 300 DM. Zuzüglich musste ich die Wohn-Nebenkosten tragen, sowie teure Lebensmittel einkaufen. Auch das Auto schlug kostenmäßig zu Buche. Mit der damals kleinen Beamtenbesoldung war mein Girokonto daher ständig überzogen.
1982: Umzug in kostengünstigere Wohnung
Nach drei Jahren wurde mir 1982 eine kleine Haushälfte angeboten. Es handelte sich um ein altes sogenanntes Siedlerhaus, das in den Dreißigerjahren mit wenig Geld für Arbeiter gebaut wurde. Hinter dem Haus befand sich ein größerer Garten, damit sich die Bewohner durch Anbau von Lebensmitteln selbst versorgen konnten. Den nutzte aber meine Vermieterin, was mir ganz recht war, denn ich bin nicht zum begeisterten Gärtner geboren. Das alte Haus hatte ein großes Zimmer im Dachgeschoss und ein Schlafzimmer neben der Küche sowie ein Badezimmer im Erdgeschoss und einen großen Kellerraum. Diese alte „Hütte“ war im Gegensatz zum kleinen Einzimmerappartement sehr primitiv gebaut. Der Wind pfiff durch das Gemäuer, es gab keine Zentralheizung; die Räume mussten noch klassisch mit Kohleöfen beheizt werden. Im Badezimmer gab es keine Möglichkeit zu heizen. In diesem Raum tat ein Elektro-Strahler seinen Dienst, der aber viel Strom verbrauchte. Für mich war besonders attraktiv, dass die neue Wohnung mit zwei Zimmern und einer großen Wohnküche im Vergleich zu meiner bisherigen Unterkunft mehr Platz bot und sogar etwas weniger Miete kostete. Somit zog ich zeitnah um, und nach einigen Monaten untervermietete ich das Zimmer neben der Küche an einen Studenten. Das entlastete meine chronisch angespannte finanzielle Situation wesentlich.
Eheliche Wohnverhältnisse - siehe späteres Kapitel

Siehe nachfolgende Unterkapitel

7.1 Grundschule (1965-1969)
Einschulung / Erster Schultag
Im Jahre 1965 wurde ich eingeschult und besuchte bis 1972 zuerst die Grund- und danach die Hauptschule. Meine Einschulung erfolgte erst im Alter von sieben Jahren, nach einem Jahr Rückstellung. Der Grund hierfür war eine festgestellte Unreife. Deshalb wurde ein Jahr zugewartet. Leider besitze ich kein Foto zur Erinnerung an diesen Tag. Ich erinnere mich, dass ich eine Schultüte bekam wie jedes Erstklässler-Kind. Nach dem uns Kindern das Klassenzimmer vorgestellt wurde, so kann ich mich noch gut erinnern, setzte ich mich gleich in eine ziemlich hinten stehende Schulbank. Darauf befand sich ein mit schwarzem Blechdeckel verschließbares Fach für Federhalter und ein Tintenbehältnis am oberen Tischende. Dies, obwohl wir bald (nach der Tafel) mit einem Tintenfüllhalter mit Feder schreiben durften, also nicht mit einer musealen Feder. Diese antike Schulbank war ein uraltes Einrichtungsexemplar in einem Klassenzimmer, wie es in Bildern und Filmen aus den Anfängen des 20. Jahrhundert zu sehen ist. Unangenehm war ein muffiger Geruch in den Klassenräumen. Die Schulklassen bestanden aus sehr vielen Kindern. Wenn ich mich richtig erinnere, waren wir über dreißig Schüler*innen.
Schulwege
Karlsklotz − Karlsplatz − Karlstraße − Karlschule
An den Schulweg kann ich mich noch gut erinnern. Zu Fuß mussten wir Kinder zwanzig bis dreißig Minuten einplanen, mit dem Fahrrad waren wir aber ruckzuck vor Ort. Der Weg führte in westlicher Richtung aus der Freiburger Altstadt hinaus über einen sehr großen Parkplatz, den Karlsplatz, wo Ende der Sechzigerjahre ein riesiges Betonmonster hochgezogen wurde, das die Freiburger heute noch den Karlsklotz nennen. Danach ging der Weg entlang der Karlstraße zur Karlschule, in der ich die Grundschulzeit erlebte. Angekommen an der Karlschule, war diese nicht zu verfehlen: Sie fiel schon von weitem als alter, muffiger Kasten auf. Kein Wunder: Es handelte sich auch um das älteste Freiburger Schulgebäude, das schon 1877 erbaut wurde. Damals war eine solche strenge Schulhausarchitektur wohl zeitgemäß. Übrigens: Das Äußere passte auch gut zu manchem Inneren in dieser Schule.
Erfahrungen mit Lehrkräften
In den ersten drei Schuljahren hatte ich noch Glück. Die Lehrerinnen, welche mich in diesen Klassenstufen unterrichteten, waren vermutlich ganz in Ordnung. Zumindest erinnere ich mich an keine negativen Erlebnisse aus dieser Zeit. Allerdings erinnere ich mich noch gut an meine erste Arreststunde, die mir in der ersten Klasse aufgebrummt wurde.
Story: Erstklässler-Arrest
Warum ich bestraft wurde, weiß ich nicht mehr. Vermutlich, weil ich wieder einmal zu spät in den Unterricht kam. Diese Arreststunde bot für mich aufregende - schockierende - Erlebnisse. Als Arrestkind, das eine Stunde nachsitzen musste, wurde ich in ein Klassenzimmer geschickt, wo die neunte Klasse ihren Unterricht hatte. Deren Lehrer hieß Stahl. Seinen Namen konnte ich mir gut merken, weil er zu diesem Menschen passte, sowohl vom Äußeren her als auch zu seiner Art. Meine erste Begegnung mit ihm war harmlos, ja geradezu rührend und liebevoll. Als ich mich bei ihm als kleiner "ABC-Schützling" schüchtern als Arrestant meldete, beugte er sich sehr freundlich − wie ein lieber, fürsorglicher Onkel − zu mir hinunter, nahm mich an die Hand und führte mich an einen freien Platz im Klassenzimmer. So weit, so gut. Dann startete die Schulstunde. Ab diesem Zeitpunkt wusste ich, welche Stimme ich immer aus dem oberen Stockwerk schon beim Hineingehen in das Schulgebäude vernommen hatte, wenn ich ab und zu etwas verspätet in die Schule kam, weil ich auf dem Schulweg zu lange getrödelt hatte.
Vorgeschichte: Trödler
Eigentlich sollte ich in solchen Situationen schleunigst mein Klassenzimmer im ersten Stock aufsuchen, weil zu spät kommende Kinder desto mehr geschimpft und bestraft wurden, je später nach dem Unterrichtsbeginn sie das Klassenzimmer betraten. Aber kurioserweise interessierten mich beim Eintritt in das Schulhaus zunächst erst einmal immer die Geräusche und das Gemurmel, die / das aus den Klassenzimmern kamen und in den hohen Fluren des alten Schulgebäudes hallten. Das faszinierte mich und löste in mir ein eigenartiges Wohlgefühl aus.
Zwischendurch: "Geborgenheitsträume"
Besonders wohltuend war das durch mein Lausch-Abenteuer künstlich herbeigeführte "Sicherheitsgefühl". In meiner kindlichen Fantasie und als Tagträumer (ADS-Kind) war ich nämlich in der Lage, manche - sich bedrohlich anhörende - Geräusche aus den Klassenzimmern sogleich mit bestimmten Vorkommnissen zu verbinden, die ich mir real, bzw. tagträumerisch, vorstellte. Wohltuend war mein Gefühl deshalb, weil ich annahm, diese gefährlichen Ereignisse, die ich mir vorstellte, könnten sich nicht direkt auf mich (auf dem Flur lauschend) auswirken −, solange mich nicht der Hausmeister dabei erwischte. Auf jeden Fall verschaffte ich mir einen Überblick über Stimmen und Stimmungen in den vielen Klassenräumen. Aus manchen Klassenzimmern konnte man ab und zu Gelächter vernehmen, aus anderen hörte man Schüler oder Schülerinnen, die etwas vortrugen. Besonders oft und genau registrierte ich jedoch die gewaltige, bedrohlich klingende Stimme eines bestimmten Lehrers aus dem oberen Stock. Und nun saß ich in dessen Klassenzimmer.
Zurück zum Arrest:
In der bekannten hohen Lautstärke, die mich sofort zusammenzucken ließ, befahl Lehrer Stahl zu Beginn der Stunde den Neuntklässlern, sie sollten ihre Hausaufgaben vorzeigen. Zwei kräftig gewachsene Schüler hatten diese entweder nicht vollständig ausgearbeitet, oder sie hatten ihre Hausaufgabenhefte zu Hause vergessen. Mit eisernem Ton befahl er die beiden Jungen nach vorne, von denen einer sogar deutlich größer war als Herr Stahl selbst. Knallhart wie dieser Pädagoge jedoch war, interessierte ihn dieser Größenunterschied zu seinen Schülern überhaupt nicht. Zu jener Zeit traute sich sowieso niemand, gegen Lehrer zurückzuschlagen.
Brille ab! – dann lautes Klatschen
Als nun beide Schüler vorne standen, folgte ein weiterer Befehl an einen der beiden Jungen. Er solle sofort seine Brille abnehmen. Als der Schüler das getan hatte, verpasste Lehrer Stahl ihm und danach seinem Klassenkameraden jeweils zwei heftige, lautklatschende Ohrfeigen. Seine kräftige "Handschrift" war danach auf jeweils beiden Gesichtshälften der Burschen in kräftig roter Farbe deutlich nachvollziehbar. Dieses Geschehen machte auf mich natürlich einen unheimlichen Eindruck, ängstigte mich, und ich wäre am liebsten geflüchtet. Aber so etwas traute sich ein kleiner Erstklässler selbstverständlich nicht. Mir waren körperliche Züchtigungen zwar von zuhause „bestens“ bekannt, aber ein solcher spektakulärer Strafvollzug an Schülern vor der Klasse war dann doch etwas Besonderes für mich, sozusagen ein Stoff für schlechte kindliche Träume. Mit dieser Arreststunde bekam ich, ohne es zu wissen, einen Vorgeschmack davon vermittelt, was mich ab der vierten Klasse selbst im Schulalltag begleiten sollte.
Vierte Klasse: Albtraum-Lehrer
In dem Kapitel zu meinem Vater (siehe "Misshandlung im Doppelpack") schrieb ich bereits auch die Geschichten zu meinem Lehrer in der vierten Schulklasse. Für mich eine böse Erinnerung an meine Grundschulzeit. Aus heutiger Sicht würde eine solche Lehrkraft wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen strafrechtlich verurteilt und aus dem Schuldienst entfernt werden. Aber in den Sechzigerjahren war es leider solchen Gewalttätern möglich, sich als Lehrer bei Schülern austoben zu können.
Grauenhafter Notenspiegel
In meinem damaligen Zeugnis ist ein Notenspiegel nachzulesen, der für jeden Schüler normalerweise bedeutet hätte, todsicher "sitzen zu bleiben" und die Klassenstufe wiederholen zu müssen. Mit diesen Noten verfehlte ich das Klassenziel nicht nur knapp, sondern war extrem deutlich daran vorbeigeschossen. In den Benotungen zu den einzelnen Fächern waren mehrfach die Noten ungenügend oder mangelhaft, im besten Fall ausreichend zu lesen. Nur in Musik bekam ich eine bessere Note.
Sitzenbleiben fällt dennoch "aus"
Dass trotz dieses Horrornotenspiegels meine Versetzung in die nächste Schulklasse erfolgte, kann in meinem Zeugnisheft aus der damaligen Zeit ebenfalls nachgelesen werden. Hintergrund waren, wie schon ausgeführt, zwei Kurzschuljahre, weil der Beginn des Schuljahres vom Frühjahr auf den Herbst verlegt wurde. An zwei Schuljahren wurde ein Viertel des Schuljahres gekürzt, damit sich die Abstände der Schuljahre im Jahresrhythmus nach zwei Jahren wieder einspielten. Diese verkürzten zwei Schuljahre machten offensichtlich den Gnadenakt meiner Versetzung in die nächste Klasse − in die Hauptschule − möglich.
Erinnerungen an den Unterricht
Klassischer Frontalunterricht
Der Unterricht erfolgte in meiner Schulzeit ganz klassisch als Frontalunterricht. Der/die Lehrer*in stand vorne vor den Schülern während des Unterrichts. Er oder sie rief die Seitenzahlen in dem jeweiligen Schulbuch auf und erläuterte den Stoff an der Tafel. Dann wurden die Schüler einbezogen. Schließlich musste der unterrichtete Schulstoff über Hausaufgaben nachgearbeitet werden.
Werken für Buben, Handarbeiten für Mädchen
Für den Werkunterricht gab es entsprechend ausgestattete Räume. Übrigens: Am Werkunterricht nahmen seinerzeit nur Jungen teil. Die Mädchen hatten gleichzeitig Handarbeitsunterricht.
„Leibesübungen“
Das Fach Leibesübungen hasste ich. Später wurde es in Turnen, dann in Sport umbenannt. In den unteren und mittleren Klassen hatten diese Stunden eine feste Struktur: Zunächst mussten wir Schüler uns ziemlich lange im großen Kreis warmlaufen. Dann galt es, Matten auszulegen und die − von mir schon damals als sinnfrei empfundenen − Turngeräte aufzubauen. Beispiele: Die knarrenden Holzelemente des Sprungkastens aufeinandersetzen, über den man nach einem Anlauf zunächst auf eine Absprungrampe aufsprang, um mit Schwung über den mit abgegriffenem Leder bezogenen hohen Kasten zu springen. Ich sorgte dabei immer wieder für Gelächter bei meinen Mitschülern, da ich es öfter nicht schaffte, meine Beine beim Überspringen des Kastens richtig „sortiert“ zu bekommen und deshalb häufiger auf die ausgelegten Matten knallte. Als Kind wurde bei mir öfter schlechte Koordination von Bewegungen von Lehrern bescheinigt. Rückblickend führe ich das auf mein ADS zurück.
Klammer-Affe
Als absolut ungenügend wurden stets meine Leistungen an den Stangen bewertet, an denen man sich - wie die Affen an den Bäumen - festklammern und hocharbeiten sollte. Es war, glaube ich, nicht die zu hohe Erdanziehung, (ich war als Kind nicht übergewichtig), die mich daran hinderte, wenigstens ein paar Zentimeter vom Boden abzuheben, so sehr ich mich auch bemühte. Irgendwie schaffte ich es auch bei diesen Turnunterrichtsübungen nicht, die erforderliche Bewegungskoordination ziel- beziehungsweise in die Höhe führend hinzubekommen. Ähnlich „erfolgreich“ war ich bei den Turnübungen an den von mir besonders unbeliebten Reck- und Barren-Geräten.
Ring-Hänger
Ebenso aussichtslos präsentierte sich meine Turnbegabung bei den Ringen, zu denen man zum Eingreifen hochgehoben wurde, um dann irgendwelche Schwung- und andere Übungseinheiten zu vollbringen. Bei mir reduzierte sich der Übungsverlauf auf das Hängen an den Ringen, bis ich sie dann loslassen musste, (nachlassende Kraft), und unsanft auf die Matte zurückkehrte. Mir gelang es leider nie, aus solchen Hängesituationen irgendwelche Schwünge oder andere übungsgymnastische Erfolgserlebnisse hervorzubringen.
Dauerersatz-Spieler
Auf die Turnübungen folgte dann zum Abschluss eine Spieleinheit. Soweit es sich dabei um Mannschaftsspiele handelte, bei welchen die Mitspieler von den Schülern ausgewählt wurden, fand ich meinen Platz, weil nicht auserwählt, als ewiger Ersatzspieler auf der Bank, denn weder als Fußballer noch in anderen Ballsportarten konnte ich eine erfolgversprechende Besetzung für meine Mitschüler sein.
Noch eine kleine Unterrichts-Story:
Kurioser Lehrer-Auftritt
Viele Erinnerungen zu Höhepunkten aus dem Schulalltag habe ich zwar nicht mehr. Aber eine Erinnerung aus der vierten Klasse ist mir erhalten geblieben, die auch etwas über die Verfassung mancher älteren Lehrkräfte der Karlschule aussagt: Neben meinem Klassenzimmer lernte die Parallelklasse, und dort unterrichtete ein älterer Lehrer mit einer besonders knorrig-verbitterten Außenwirkung. Ab und zu ging während unserer Schulstunde plötzlich die Türe auf, was stets eine willkommene Abwechslung im lästigen Schulalltag war. Hereingestürmt kam dann der Nebenan-Kollege unseres Klassenlehrers. Das machte er immer dann, wenn er sich über ein Verhalten eines Schülers in seiner Klasse besonders empörte und wieder einmal dringend Dampf ablassen musste. Sein Auftritt war gleichsam aufregend, wie auch zum Fürchten. In schnellem Schritt und mit einzigartig verbiesterter Mimik ging dann dieser „Vollblutpädagoge“ mit strenger Kurzhaarfrisur und markanter Hornbrille durch den Klassenraum auf unseren Lehrer zu, der schon "erwartungsvoll" das Näherkommen seines wütenden Kollegen registrierte und etwas genervt seinen Unterricht unterbrach. Dann informierte ihn das Rumpelstilzchen aus dem Nachbarklassenzimmer wortreich und lautstark, (es klang so ähnlich wie Maulen oder Meckern), über den ihn aktuell empörenden Fall, und er zeigte unserem Lehrer eifrig und hektisch gestikulierend die Beweisstücke, meistens Hefte des betreffenden Schülers seiner Klasse, der sich danebenbenahm.
Rumpelstilzchen wird abgeführt
Das waren für uns Schüler spannende Geschichten, die wir neugierig aufsaugten. Ab und zu bekam ich dabei eine Gänsehaut. Unseren Lehrer schienen diese Geschichten seines Kollegen aber nicht sehr zu beeindrucken. Er antwortete ihm nach meiner Erinnerung immer mit gleichen oder ähnlichen Worten. Beispielsweise, er solle sich diesen bösen Schüler "doch mal richtig vornehmen und ihm eine kräftige Lektion verpassen, die der so schnell nicht vergessen werde". Mir war sofort klar, was gemeint war. Auf jeden Fall griff unser Lehrer seinen Kollegen, nachdem dieser seine Wut entladen hatte, meistens am Arm und führte ihn mit beschwichtigenden Worten aus dem Klassenzimmer.
Schulzeugnisse: Eltern-Reaktionen
Wie ich das schon in anderen Kapiteln erzählte, waren meine Zeugnisse immer "geschmückt" mit Notenbezeichnungen, die aus vielen Buchstaben bestanden. Also: ungenügend, mangelhaft oder ausreichend, statt gut oder sehr gut, (im besten Fall befriedigend). Meine Mutter reagierte meistens gütig oder besorgt auf meine Zeugnis-Präsentationen und gab mir Ermahnungen mit auf den Weg, damit es nicht bei den vielen schlechten Noten blieb. Von meinem Vater stammte die nachfolgende Formel, welche die Würdigung der einzelnen Schulnotenstufen überschaubar regelte und nicht weiter kommentiert werden muss:
Bei einem Einser gibt es fünf D-Mark
bei einem Zweier gibt es zwei D-Mark
bei einem Dreier gibt es eine D-Mark
bei einem Vierer gibt es nichts,
bei einem Fünfer gibt es Ohrfeigen
und bei einem Sechser Hosenspanner.

Rund um die Hauptschulzeit
An den ersten Schultag in der Hauptschule (5. Klasse) zu Beginn der fünften Klasse kann ich mich nicht erinnern. Ich muss sehr froh gewesen sein, den schrecklichen Lehrer aus der vierten Klasse endlich loszuwerden. Der neue Klassenlehrer war wieder ein älterer Pädagoge, der zwar auch immer laut sprach, den ich aber bei weitem nicht als so aggressiv und bedrohlich empfand wie seinen Kollegen aus der vierten Klasse. Zwischen meinem Vater und dem neuen Lehrer ergab sich zudem ein positiver Kontakt, was sich für mich vorteilhaft auswirken sollte.
Sitzenbleiben - oder nicht?
Nachdem ich hinsichtlich der schulischen Leistungen die vierte Grundschulklasse „im Tiefflug“ verlassen hatte, fielen die Zeugnisnoten in den folgenden Hauptschulklassen, − vermutlich durch den Lehrerwechsel −, etwas besser aus. Als sich das wieder bedrohlich änderte, hatte ich Glück: Da mein Vater sich als Elternsprecher engagierte, hatte er bei meinem Lehrer einen Stein im Brett. Am Ende des siebten Schuljahres, vor meinem Schulwechsel, gab ihm mein Lehrer zu verstehen, er habe für mich hinsichtlich der Zeugnisnoten zwei Augen zugedrückt, (ich vermute, meinem Vater zuliebe), damit meine Versetzung in die nächste Klasse überhaupt möglich wurde. Das war also das zweite Mal, dass ich knapp am Sitzenbleiben vorbeischrammte. Das Lernen fiel mir, wie schon in der Grundschule, schwer. An meinen Handicaps hatte sich nichts verbessert, und vermutlich war ich durch die ständigen Misserfolge inzwischen psychisch angeschlagen. Jedenfalls konnte ich bis zur siebten Klasse leider keinen Durchbruch hinsichtlich schulischer Leistungen erreichen, und es gab auch keine Idee dazu, wie ich mich hätte verbessern können.
Psychologin testet
Meine Eltern veranlassten, dass ich von einer promovierten Psychologin der städtischen Erziehungsberatungsstelle umfassend getestet wurde. Überraschenderweise bescheinigte sie mir aber keine schwerwiegenden Störungen oder gar Schwachsinnigkeit, sondern eine durchschnittliche Intelligenz. Lediglich hinsichtlich der Erkennung, Wahrnehmung und Deutung von bestimmten Bildmaterialien stellte sie erhebliche Schwächen fest.
ADS? – unbekannt
Darüber hinaus attestierte mir die erfahrende Psychologin größere Defizite hinsichtlich visueller Merk- und Konzentrationsfähigkeit. Meine äußerst starke Betroffenheit als Kind mit dem ADS und die Auswirkungen meiner angeborenen Augen-Probleme würden heutzutage sicher auffallen, konnten aber seinerzeit noch nicht diagnostiziert werden. Die Psychologin empfahl, mich für einen Förderunterricht bei einer speziell ausgebildeten Förderpädagogin für lernschwache und Legastheniker-Kinder anzumelden. Allerdings brachten diese Fördermaßnahmen am Ende keine wesentlichen Verbesserungen.
Licht am Horizont
Erst nach dem Schulwechsel von der Freiburger Karlschule in die Turnseeschule 1971 konnte ich eine Leistungssteigerung in der achten und letzten von mir besuchten Hauptschulklasse erzielen. Herbeigeführt wurde diese von einem jungen Klassenlehrer, der eine positiven Einfluss auf mich hatte (siehe Erzählungen dazu in anderen Kapiteln). Dies machte deutlich, welche Bedeutung das Lehrer-Schüler-Verhältnis haben kann, hinsichtlich Motivation und Leistung von Schülern. Mein Notenspiegel verbesserte sich jedenfalls auf einmal deutlich.

Gewalt in der Schule - Mobbing
Stark sein auf Kosten anderer
„Starke“ Mitschüler, Weggefährten, aber auch „starke“ erwachsene Menschen erlebte ich viele als Kind, als Jugendlicher und auch später. Bei manchen war ich sicher, es handelte sich bei ihnen tatsächlich um starke Persönlichkeiten. Vor allem wenn sie es nicht nötig hatten, ihre Stärken zur Schau zu stellen. Ihre starken Seiten sprachen einfach erkennbar aus ihnen. Aber es gab darunter viele Menschen − kleine wie große −, die eine große Sehnsucht in sich trugen, als starke Typen wahrgenommen zu werden. Dafür konnten sie nach meinen Beobachtungen sehr weit gehen. Zum Beispiel auf Kosten und auf dem Rücken der von ihnen als schwach erkannten Mitmenschen ihre Dominanz auszuleben. Diese Spezies von Menschen erlebte ich oft aggressiv und lautstark. Manchmal war es (bei allem Unangenehmen) auch amüsant zuzuschauen, wie sie ihre aufgesetzte Arroganz spazieren führten. Es wirkte dann kurioserweise hilflos, weil maßlos überhöht.
Prügelnde Lehrer
Besonders unangenehm empfand ich Mitschüler, wenn sie Schläger waren und andere Schüler verprügelten, die ihnen nicht passten, (auch manchmal mich, obwohl ich Prügeleien und Aggressivität aus dem Weg ging). Wenn allerdings gewaltbereite Menschen nicht nur aus der Schülerschaft kamen, sondern es sich um Lehrkräfte handelte, dann empfand ich dies als besonders bedrohlich. Manche von ihnen konnten in meiner Schulzeit in den Sechzigerjahren ihre Gewaltambitionen unter dem Vorwand erzieherischer Ziele ausleben und ihre Schüler misshandeln. Sofern sie ihnen keine bleibenden Verletzungen zufügten, mussten sie keine Strafverfolgung befürchten. Väter wie der meine fanden diese Art von „Kindererziehung“ damals nicht kritikwürdig, was auch paradox gewesen wäre, da mein Vater ja selbst oft draufschlug, wenn ihm danach war.
Apropos körperliche Züchtigung:
Bis zu meinem Geburtsjahr 1957 war noch im Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 1631) der Bundesrepublik Deutschland nachzulesen, "kraft Erziehungsrechtes darf der Vater angemessene Zuchtmittel gegen das Kind anwenden". Geändert wurde dieser Paragraf danach aber nicht deshalb, um die Kinder zu schützen, sondern weil es durch Kriegsfolgen in vielen Familien keinen Vater mehr gab und die Frauen, bzw., Mütter, gleichberechtigt werden sollten.
Schläge nur noch "Maßregelungen"
Danach durften beide Elternteile nach dem Gesetz ihre Kinder schlagen, was man aber nicht mehr mit "Züchtigung", sondern als "Maßregelung" bezeichnete. Ein kleines Entgegenkommen des Gesetzgebers zum Schutz der Kinder gab es aber dann doch noch: Das Gesetz stellte das Züchtigungsrecht unter den "Vorbehalt der Gebotenheit" (!). Gegenüber dem elterlichen Recht zur Züchtigung, bzw. Maßregelung, ihrer Kinder war das Züchtigungsrecht in Schulen zwar nicht in einschlägigen Gesetzen vorgesehen. Es war bis zur eindeutig gesetzlich geregelten Abschaffung in den Siebzigerjahren im Rahmen eines Gewohnheitsrechtes aber auch nicht strafbar. Quelle: Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde / Universität Köln, von Martina Julia Laura Maiorino aus Bielefeld, 2003. Thema: "Elterliches Züchtigungsrecht und Strafrecht in rechts-vergleichender Sicht". Link: https://d-nb.info/96927596X/34
Seelische Folgen
Mindestens so verletzend wie die häufig erlebten physischen Gewalterfahrungen fand ich ständige verbale Herabwürdigungen, demütigendes Verlachen, Intrigen und Verleumdungen, im schulischen, aber auch im nahen und ferneren familiären Umfeld. Dazu gehörte insbesondere auch, wenn Mitschüler, Lehrer, mein Vater oder andere sich über meine offensichtlichen Handicaps lustig machten.
Ohnmacht
Das Gefühl der Ohnmacht bereitete mir dabei die größten Probleme, auch in meinem späteren Leben. Mein Selbstbewusstsein in der Kindheit und als Jugendlicher wurde derart reduziert, dass sich daraus eine permanente Lebensangst entwickelte. Letztlich prägten diese traumatischen Erfahrungen meine Zeit als Schüler. Um dies verarbeiten zu können, musste ich später einige psychotherapeutische und fachmedizinische Therapien in Anspruch nehmen. Gott sei Dank gab es einen Durchbruch in Richtung Gesundung, 1981, nach meiner Langzeittherapie.
Schwächen zu Stärken wandeln
Dass man heute mehr über Mobbing in der Schule, in der Familie oder am Arbeitsplatz spricht und diese Dinge auch medial als gesellschaftlicher Missstand angeprangert werden, geht meines Erachtens in die richtige Richtung. Aber ich fürchte, sie wird dieses sehr alte und weit verbreitete Problem unseres Zusammenlebens nur zu einem kleinen Teil lösen, da solche Bösartigkeiten bei den Menschen in allen Bereichen unserer Gesellschaft eher zunehmen.
Auswege finden
Was mir aber schließlich half: Ich schaffte es, - wenn auch sehr viel später und nach vielen Jahren Gewalterfahrungen -, einen Weg aus der Lebens-Ohnmacht zu finden und zu einer sehr starken Phase meines Lebens zu kommen, auf die ich heute noch gerne und auch stolz zurückschaue. Diese Lebenserfahrungen ermöglichten es mir, willensstärker und durchsetzungs- sowie widerstandsfähiger zu werden, mit der Unterstützung der mich in jener Zeit begleitenden Menschen, die es gut mit mir meinten.
Abwehr-Ressource
Je nachdem, wie ich heute auf meine überwiegend verkorkste Schulzeit zurückblicke, kann ich tatsächlich feststellen, dass ich aus meiner schweren Zeit als Schüler und häufiges Mobbingopfer auch eine Zurüstung für das spätere Leben habe mitnehmen können. Beispielsweise profitierte ich viele Jahre danach, indem ich ein Gespür dafür entwickeln konnte, wie man sich bei wahrgenommenen Intrigen verhält, um Akteure hinter den Kulissen aus ihren "Verstecken" zu locken. Das ist manchmal vergleichbar mit einem Schachspiel. Dies half mir durchaus (jedoch nicht immer), schwierige Phasen überleben zu können. Manche Intrigenspiele von Kontrahenten konnte ich dadurch abwehren, oder üble Spieler - da und dort - mit ihren eigenen Waffen überlisten.
Intrigen – gefährliches Spiel
Wenn dies gelang, war es − zugegeben − ein schönes, motivierendes Gefühl! Jedoch auch in diesem Zusammenhang gilt, dass Gewalt wiederum Gewalt und böse Spiele wiederum böse Spiele erzeugen. Nach erfolgreich abgewehrten Intrigenspielen kann man zwar manche "Schlacht" erfolgreich überstehen, geht jedoch nicht unbedingt als Sieger aus einem ganzen „Krieg“ hervor. Und zur Wahrheit gehört auch, dass ein sich wehrendes Opfer aufpassen muss, nicht irgendwann selbst zum Täter (oder Rächer) zu werden. Denn jahrzehntelang erlebter psychischer Frust ist vergleichbar mit Sprengstoff in einer nicht explodierten Bombe.
Nicht selbst Täter werden
Wenn bestimmte Umstände zusammenkommen, kann aufgestaute Wut eine gewaltige Explosion mit unberechenbaren Auswirkungen verursachen. Dieser Zusammenhang kenne ich aus meinem Leben sehr gut. Bei einigen Mitpatienten, die ich in Fachkliniken kennenlernte, führte dieses Gefahrenpotential zu tragischen Folgen. Aber ein goldenes Lösungsrezept gibt es leider nicht als Anleitung für den optimalen Umgang mit den vielen Streitereien, Bösartigkeiten und intriganten Machenschaften, mit denen man in seinem Leben konfrontiert wird und denen man nicht ausweichen kann. Das gilt für die Schulzeit ebenso wie im späteren Berufsalltag oder auch im privaten Leben. So gesehen ist und bleibt das Leben immer ein Abenteuer! Zu dieser Thematik schreibe ich übrigens einige spannende Geschichten im zweiten Teil meiner Biografie.
Story: Suizidgefährdung
In der Tat gab es, als ich so um die vierzehn Jahre alt war, suizidäre Gedanken. So klaute ich einmal nach erheblichem, heimlichen Alkoholkonsum vor dem Schlafengehen meiner Mutter alle Tabletten aus einer VALIUM-Packung und schluckte sie. Am anderen Tag wachte ich aber wieder auf und startete umständehalber nicht gerade standfest in den neuen Tag. Als meine Mutter mich weckte und die extremen Gleichgewichtsstörungen ihres Sohnes bemerkte, wollte sie mir zunächst helfen, damit ich doch noch aufrechten Ganges mein Bett verlassen konnte. Leider ohne Erfolg, denn ich fiel sofort wieder um. Nachdem sich das einige Male wiederholte, rief sie den Krankenwagen. Als sich mein Stehvermögen durch eine ambulante Behandlung im Krankenhaus rasch wieder normalisierte, wurde ich anschließend zu einem Nervenarzt überwiesen, der mich dann weiter behandelte. Das war sozusagen der Startschuss für eine Vielzahl von Therapien bei Psychiatern und Psychologen, die mein Leben für einige Jahrzehnte immer wieder begleiten sollten.

Neue Freizeitaktivitäten
In meinen Grundschuljahren gab es außerhalb der Schule einige Neuerungen, die meine Kindheit bis zum Eintritt der Pubertät bereicherten und an die ich gute Erinnerungen habe. Alle diese - über die katholische Pfarrgemeinde, die Dompfarrei -, organisierten Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche waren allerdings für uns Kinder erst nach der Teilnahme am Fest der ersten Heiligen Kommunion möglich.
Türöffner
Wie ich schon erzählt habe, wurde meine Zulassung zur Erstkommunion um ein Jahr vorgezogen, damit ich dieses große Fest zusammen mit meinem ein Jahr älteren Bruder Berthold feiern konnte. So mussten meine Eltern nicht zwei Mal hintereinander ein solches Fest ausrichten, was ja mit hohen Kosten für die Familie verbunden war. Für mich hatte dieses Vorgehen den Vorteil, dass ich schon ein Jahr früher die bereits erwähnten Freizeitaktivitäten nutzen durfte.
Ministrant werden
Mein Bruder und ich konnten uns nach der ersten hl. Kommunion bei den Ministranten anmelden. Abgesehen vom auswendig lernen müssen von teilweise unendlich langen Gebetsformaten in lateinischer Sprache, habe ich das Ministrieren aber in guter Erinnerung behalten. Da gab es einiges zu erleben und Neues kennenzulernen. Außerdem verbanden sich mit diesem Amt auch Freizeitangebote. Wir besuchten regelmäßig die Ministranten-Stunden, bei denen interessante Unterhaltung und Ausflüge geboten wurden. Sogar mein Vater äußerte sich positiv, weil er es gerne sah, wenn wir in den Gottesdiensten ministrierten.
Pfadfinder werden
Nach der Erstkommunion war auch der Weg für interessierte Kinder frei, um sich den Sankt-Georg-Pfadfindern anzuschließen. Immer samstagnachmittags fanden die Pfadfinderstunden im Gemeindehaus statt. Das war der Start für neue besondere Erlebnisse, an die ich gerne zurückdenke.
"Wölfling"
Neue Pfadfinderkinder hießen Wölflinge. Zunächst trug man ein Pfadfinderhemd mit dem Wappen der Stankt-Georgs-Pfadfinder und einem kleinen Schwarz-Rot-Gold-Aufnäher über der Brusttasche. Ich war stolz wie ein kleiner Pfau, als ich solch ein Hemd anziehen durfte. Als ich es ganz neu erhielt, da roch es auch so gut nach Baumwollstoff. Das Tragen dieses Hemdes vermittelte das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer besonderen Gruppe, was mir gefiel. Das frischte zudem mein zu klein geratenes Selbstbewusstsein auf.
Halstuch schafft Status
Vollständig als aufgenommen galten Pfadfinderkinder jedoch erst, wenn sie die Pfadfinderregeln gelernt und einige Voraussetzungen erfüllt hatten, wie zum Beispiel die regelmäßige Teilnahme an den Gruppenstunden und den glaubhaften Nachweis der den Pfadfindern aufgegebenen täglichen guten Taten, die sie bewusst zu verrichten hatten. Eine solche endgültige Aufnahme im Kreis der Pfadfinder geschah durch die feierliche Überreichung des Halstuches und das damit verbundene Recht, es mit einem Lederknoten tragen zu dürfen. Leider kam ich erst etwas zeitversetzt zu dieser Ehre, weil ich hinsichtlich der Vorbereitungsregularien schlampig vorbereitet war. Aber nach der Beseitigung dieser Verfehlung war es so weit. Ich konnte es kaum erwarten.
Kleine Story: Enttäuschung mit Happyend
Die Überreichung dieses mich magisch anziehenden, weil bedeutenden, Halstuches als Symbol für eine vollständige Zugehörigkeit zu den Pfadfindern sollte während eines Zeltlagers an die Wölflinge stattfinden. In diesem Zusammenhang wäre es nicht schlecht gewesen, wenn ich daran gedacht hätte, das Halstuch, das für mich schon gekauft wurde, aber ich noch nicht tragen durfte, auch zu dieser Freizeit mitzunehmen.
Oh je! Halstuch vergessen
Aber zerstreut, wie ich - als HANS GUCK IN DIE LUFT - des Öfteren war, vergaß ich, es mitzunehmen. Als ich der Zeltlagerleitung das Tuch übergeben sollte, um es bei einer Zeremonie während des Feld-Gottesdienstes vor allen Teilnehmern des Zeltlagers wieder (zusammen mit anderen Kindern) feierlich umgelegt zu bekommen, da musste ich eingestehen, dass ich es nicht mitgenommen hatte. Zunächst hieß es dann, damit müsse die feierliche Halstuchüberreichung für mich ausfallen.
Rettung vor Enttäuschung
Vor Enttäuschung flossen reichlich Tränen, da kam schließlich der oberste Pfadfinder zu mir, nahm mich in den Arm und beruhigte mich. Neben einem Taschentuch (zum Tränen-Abwischen), stellte er mir überraschend ein ihm gehörendes Halstuch als Provisorium für die bald beginnende Zeremonie zur Verfügung, welches er für sich zum Wechseln mitgenommen hatte. Damit rettete er mein sehnlichst erwartetes Ereignis an diesem Tage. Das Tuch musste ich ihm nach dem Zeltlager wieder zurückgeben. Diese Rettung in letzter Sekunde machte mich überglücklich, was man mir vermutlich auch ansah.
Gute Tat
Einem tieftraurigen, geschockten Kind mit einer solchen Geste aus der Patsche und doch noch zu seinem großen Glücksgefühl zu verhelfen, das dürfte auch für den Oberpfadfinder ein schöner Moment gewesen sein. Darüber hinaus hatte er an diesem Tag seine "gute Tat" − wie gesagt für jeden Pfadfinder eine tägliche Pflichthandlung − auf jeden Fall wirkungsvoll vollbracht.
Spannende Pfadfinderangebote
Die Pfadfinderleitung hatte immer gute Ideen für die Gestaltung der wöchentlich stattfindenden Treffs. Dort war auch der Ort für die Planung gemeinsamer Projekte wie beispielsweise Aktionen in der Pfarrgemeinde (soziales Engagement), Ausflüge, Zeltlager. Außerdem fanden am nahegelegenen Freiburger Schlossberg oft Geländespiele statt. Weiter wurde viel gesungen, was ich als kleiner Musikus natürlich gerne tat.

Siehe nachfolgende Unterkapitel...

8.1 Freizeit - Hobbys u.a. (1972-2021)
Pflege von Hobbys?
In meinem Alter − sechzig plus − schaue ich bei der Beantwortung dieser Frage sehr lange zurück, um Erinnerungen aus den einzelnen Lebensphasen zurückzurufen. Da ich, abgesehen von Ausnahmen (Musik) kaum wegen Ausübung vieler Hobbys in meinem Leben auffiel, ich schon gar nicht zu den Sammlern oder Sportlern gehörte und auch beispielsweise keine Leseratte war, kann ich hinsichtlich kreativer Gestaltung meiner Freizeit nur wenige Geschichten aus den verschiedenen Phasen meines Lebens erzählen.
Sucht verhindert Hobbys (1970 - 1980)
In den Siebziger- bis Anfang der Achtzigerjahre (bis zu meiner Langzeittherapie für jugendliche Suchtkranke 1981) verbrachte ich leider einen großen Teil meiner Freizeit in Kneipen, besonders in einer, die trotz des seltenen Namens "Zum Grammophon" eine ganz normale Gaststätte war − hauptsächlich zum Durstlöschen, aber auch kleine Mahlzeiten waren im Angebot, jedoch ohne Besonderheiten hinsichtlich musikalischer Aktivitäten. Dort an Durst oder Hunger leiden zu müssen, war mehr, als unwahrscheinlich (nur wenn man kein Geld dabeihatte). Noch unwahrscheinlicher war es jedoch, in solchen Kneipen kreativen Hobbys nachgehen zu können. Zum Grammophon hatte ich es übrigens nicht weit: Es lag ganz in der Nähe der Wohnung meiner Familie im Freiburger Stadtteil Wiehre. Das hatte den Vorteil, dass ich auch bei meinem häufigen bis regelmäßigen Überkonsum von Bier und anderen alkoholischen Getränken zu Fuß noch relativ gefahrlos auf kurzem Weg mein Bett erreichen konnte.
Musik
In meiner Langzeittherapie in einer Fachklinik für suchtkranke Jugendliche legte man mir nahe, ich sollte zur Stabilisierung meines notwendig gewordenen „trockenen“ Lebens (ohne Konsum von alkoholischen Getränken) meine musikalische Begabung pflegen. Schon im Kindergarten und in der Grundschule fiel als eine meiner wenigen Begabungen auf, dass ich gut singen konnte. Außerdem klimperte ich auf einem alten Klavier bei meinen Eltern gerne und lange immer wieder herum. Leider habe ich keinen Unterricht genommen. Allerdings spielte ich manchmal durchaus klangvolle Eigenkompositionen, jedoch ohne Noten.
Eine Story dazu: Musizieren trotz Augenprobleme
Ein Musikinstrument zu erlernen, scheiterte schon als Kind durch meine Probleme beim Notenlesen, als ich im Kindesalter kurze Zeit im Haus der Jugend mit meiner Schwester Gudrun einen Akkordeon-Kurs besuchte. Die Ursache sollte sich leider erst Jahrzehnte später herausstellen: Meine erhebliche, damals nicht erkannte Sehbehinderung machte es mir nahezu unmöglich, die kleinen Punkte der Notenzeichen als Notenwert (Taktlänge oder Punktierungen) und die Platzierung auf den Notenlinien korrekt visuell zu erfassen. Außerdem war es beim Akkordeonspielen erforderlich, gleichzeitig sowohl die Melodiestimme (linke Hand), als auch die Bassstimme (rechte Hand) vom Notenblatt abzuspielen. Also das gleichzeitige Lesen von zwei Notenlinien.
Kreative Umgehungsstrategien
Als ich Anfang der Achtzigerjahre begann, mich um alternative Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung zu kümmern (statt „Saufen“), beschäftige ich mich − als musikalischer Mensch − mit der Musik. Ich hörte beispielsweise besonders gerne die Töne eines Blasinstrumentes, die der Querflöte, mit ihrem samt-schwingenden Tönen, die man über drei Oktaven vielseitig variabel erzeugen kann. Dieses Blasinstrument hatte auch noch den Vorteil, dass man nur ein Notensystem (Melodiestimme) bespielen musste, also nicht noch zusätzlich ein zweites Notensystem für die Bassnoten. Das war besser mit meinem Augenhandicap in Einklang zu bringen.
Ausweg finden
Dass dieses existierte, konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, es stellte sich erst viele Jahre später durch eine fachärztliche Diagnose heraus. Aber die dadurch verursachten Probleme, - mit all den damit ständig erforderlichen Improvisationen, um funktionieren zu können -, waren mir natürlich von Geburt an bekannt. "Not macht erfinderisch". Nach diesem bekannten Sprichwort begann ich, sozusagen in Selbsthilfe zu handeln. Als ich schließlich − trotz Handicap − mit dem Musizieren, dem Spielen nach Noten begann, entdeckte ich beim Improvisieren einen sehr hilfreichen Trick: Ich alphabetisierte jede Note mit Bleistift darüber, schrieb beispielsweise über die Note h den Buchstaben h. Das Notenblatt sah zwar nach meiner Spezialbearbeitung aus wie eine Buchstabensuppe, insbesondere bei schnell zu spielenden Läufen, aber das war mir egal.
Musiklehrer: Erst Entsetzen – dann Einsicht
Der Musiklehrer, bei dem ich Einzelunterricht nahm, ein älterer Mann, damals Querflötist beim Freiburger Theater, reagierte anfangs entsetzt auf meine ungewöhnliche Noten-Alphabetisierung. Aber schließlich kam auch er zu dem Schluss, dass gut ist, was hilft, und nicht unbedingt nur gut ist, was sein soll. Mit dieser kreativen, - bewusst von der Norm abweichenden Selbsthilfe -, war ich nämlich sehr viel besser in der Lage, Noten zu lesen und auf meine Querflöte zu übertragen. Manchmal konnte ich dann sogar ein Musikstück bald vom Blatt spielen.
Handicaps überwinden
Handicaps überwinden durch individuelle und unkonventionelle Selbsthilfe, das war übrigens eine Erkenntnis, die fortan zunehmend mein Denken und Handeln bestimmen sollte. Also das bewusste, kreative Heraustreten aus durch Handicaps verursachten Behinderungen in der Lebensgestaltung, bei der man auch bisher als unüberwindbar empfundene Grenzen überschreitet. Dieses Vorgehen, das mir ein Psychotherapeut schon in der 1981 absolvierten Langzeittherapie nahelegte, erlebte ich zunehmend als Erfolgsrezept. Es steigerte mein Selbstbewusstsein und brachte mich sehr voran.
Gemeinsam musizieren
Meine Frau spielt ebenfalls Querflöte, und wir beide sind seit einigen Jahren Teil einer Hobbymusikergruppe, in der Musiker*innen, die irgendwann einmal ein Musikinstrument gespielt und danach länger pausiert haben, sich wöchentlich treffen, um gemeinsam in einer Gruppe ihr Hobby wieder aufleben zu lassen. Dazu gehören unter anderem Akkordeons, Gitarren, Saxofon, Klarinetten, ein Hackbrett, Keyboards, Schlagzeug und ähnliche Rhythmus-Instrumente.
Chorsänger
Über eine weitere regelmäßige Freizeitgestaltung als Musikus kann ich noch berichten: Von Kindesbeinen an habe ich gerne gesungen. Später in Chören mit verschiedenen musikalischen Ausrichtungen. Zunächst im Alter von etwa zwölf Jahren für kurze Zeit in dem damals neu gegründeten Freiburger Chor der Domsingknaben. Diesen musste ich jedoch alsbald wieder verlassen, weil sich bei mir − neben dem schon früh einsetzenden Bartwuchs auf der Oberlippe − auch früh der Stimmbruch einstellte. Meine Familie war danach in diesem Chor aber dennoch längere Zeit durch meinen sechs Jahre jüngeren Bruder Roland vertreten, der ebenfalls ein guter Sänger war (und auch heute noch ist).
Kein(en) Spaß ohne Bass
Ab den Achtzigerjahren begann meine "Hobbykarriere" als Bass-Chorsänger. Zunächst sang ich mit meiner Frau im Kantatenchor einer evangelischen Kirchengemeinde in Freiburg, danach in Donaueschingen. In diesen Chören wurde anspruchsvolle Chormusik von Bach und anderen alten Meistern gesungen, die bei den Konzerten mit eindrucksvollen Solisten und instrumental von Orchestern begleitet wurden. Aus dem Donaueschinger Kantatenchor gründete sich dann zusätzlich ein Gospel-Chor, bei welchem wir ebenfalls mitwirkten. Dieser Chor trat auch bei meiner Amtseinführung als Bürgermeister in der Schwarzwaldgemeinde im Jahre 2002 auf, was mich sehr freute. Danach schlossen wir uns immer wieder Projektchören an, wie zum Beispiel in der Adventszeit in Königsfeld für eine feierliche Gottesdienstumrahmung, oder in Furtwangen, wo es einen für anspruchsvolle Gospelsongs regional bekannten Chor gibt. Letztlich fand ich ab 2014 den Weg zu dem großen Pop-Chor "Colours of Pop", in Obereschach (einem Ortsteil von Villingen-Schwenningen), der kleine und große Musik-Shows einübt und erfolgreich aufführt.
Naturnahe Freizeit mit Familie
Als Familienvater verbrachte ich außerdem die Freizeit mit der Familie und den damals noch kleineren Kindern im großen Garten hinter dem, - von uns bewohnten Wohnhauses -, in Donaueschingen, den ich allerdings nur durch Rasenmähen und Laubfegen beackerte. Für sonstige typische Gartenarbeiten interessierte ich mich weniger. Diesbezüglich engagierten sich meine Schwiegereltern, die an Wochenenden und in den Ferien ebenfalls in ihrem Wohnhaus wohnten. Aber mit einer Fläche von tausend Quadratmetern gab es für unsere Kinder viel Platz zum Spielen in diesem Garten hinter dem Wohnhaus. Ansonsten gingen meine Frau und ich mit ihnen gerne in der Natur spazieren oder wandern. Wir wandern heute noch gern und oft.
Hündin lockt ins Freie
Natur pur bot und bietet seit 2014 eine Freizeitgestaltung der besonderen Art, die ich mir zu Beginn meines Ruhestandes gönnte. Da ich als Herz-Kreislaufpatient von ärztlicher Seite stets angehalten wurde, mich viel zu bewegen, lag es nahe, einen Hund, in diesem Fall eine Hündin anzuschaffen. Neben allen Freuden der Hundehaltung hat sie auch den Vorteil, dass man als Hundehalter mehrmals am Tag zu ausgedehnten Spaziergängen nachhaltig und schwanzwedelnd aufgefordert wird. Übrigens bei Sonnenschein ebenso wie bei Regenwetter. Meine Hündin Kitty nimmt auch keine Rücksicht, wenn es stürmt oder schneit, oder wenn ich keine Lust habe rauszugehen. Das Tier besteht einfach zu seinen gewohnten täglichen Zeiten darauf, seinen Bewegungsdrang auszuleben − und das ist gut so. Denn so bleibt auch das Herrchen regelmäßig in Bewegung, ohne Chance, viel auf dem Sofa zu faulenzen. Auch meine Frau ist Hundeliebhaberin. Nachdem es möglich war, über eine Züchterin bei Freiburg eine fünfjährige Parson Russel-Hündin zu erwerben, ist diese nun seither unsere treue tägliche Wegegefährtin bei ausgiebigen Waldspaziergängen. In der Region und rund um den Schwarzwaldort, in dem ich mit meiner Familie wohne, gibt es jede Menge Möglichkeiten für größere und kleinere Wanderungen.
Sport als Hobby? Meilenweit entfernt!
Als Kind und Jugendlicher kann ich mich nicht erinnern, je gerne Sport getrieben zu haben. Wie schon ausgeführt, hasste ich den Schulsport, ganz besonders das Turnen an Geräten. Das war für mich ein Gräuel. Als jugendlicher Schüler vergaß ich übrigens immer wieder gerne, das Sportzeug in die Schule mitzunehmen, womit ich mir Bestrafungen einhandelte, die ich aber in Kauf nahm.
Keine Fußballerkarriere
Wegen meiner Handicaps konnte ich auch nicht beim Mannschaftssport glänzen. Dort beließen mich meine Mitschüler am liebsten auf der Reservebank. Beispielsweise konnte ich aus „technischen“ Gründen (Augenprobleme, ADS) nie Fußball spielen, weil es mir unmöglich war, einerseits schnell zu laufen und andererseits gleichzeitig einen schnell rollenden Ball im Auge zu behalten. Für mich bedeutete es zum Beispiel Stress pur, wenn ich einen Ball zugespielt bekam, weil ich ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht im Interesse meiner Sportmannschaft weiter bespielte, was mir dann stets reichlichen „Applaus“ einbrachte.
Doch weit vom Stamm?
Was mich heutzutage in diesem Zusammenhang immer wieder beschäftigt, ist die Tatsache, dass mein Sohn Lukas (als Tormann) und meine Tochter Sarah (als Torfrau) talentierte Fußballspieler sind. Beispielsweise engagiert sich Sarah schon viele Jahre als Torfrau in Fußballvereinen. Keine Ahnung, "woher" meine Kinder dieses Talent haben. Von ihrem Vater jedenfalls nicht. Auch meine Frau fiel von Kindheit an nicht unbedingt als talentierte Fußballerin auf. So kann es kommen...
Tormann auf der Flucht
Zurück zu mir, als "Sportsmann": Wenn man mich früher ins Tor stellte, dann wurde ich von dort zeitnah wieder ausgewechselt. Der Grund war, dass ich mich vor den harten Ballschüssen auf das Tor stets reflexartig wegduckte, was meiner Funktion als Torhüter natürlich absolut widersprach. In solchen Situationen kassierte ich übrigens auch vielfache Anschisse während des Sports bei der Bundeswehr. Hintergrund der Verärgerung der Bundeswehr-Übungsleiter war vermutlich, dass ein sich ständig wegduckender Tormann auch niemals ein guter und tapferer Soldat sein konnte (damit lagen sie auf jeden Fall nicht falsch).
Passiver Sportsmann
Für Sport habe ich mich später insofern interessiert, als ich immer wieder gerne Fußballspiele des SC Freiburg und von anderen Mannschaften im Fernsehen anschaue, oder ab und zu (bis heute) mit meinen Kindern ins Schwarzwald-Stadion in meine Heimatstadt Freiburg reise, um ein Bundesligaspiel live zu erleben. Früher spielte ich ab und zu gerne Tischtennis, was mir auch heute noch möglich ist. Auf der Terrasse unseres Hauses steht eine Tischtennisplatte, die aber hauptsächlich von meinen inzwischen erwachsenen Kindern genutzt wird. Mein Sohn Lukas spielt Tischtennis übrigens sehr erfolgreich in einer Vereinsmannschaft. Durch meine Beschwerden in Rücken und Knie kann ich aber nur noch bedingt an dieser sportlichen Freizeitgestaltung teilnehmen.
Sport - Mobilitäterhaltung
Mich zu bewegen und mich sportlich zu engagieren kann ich heutzutage aber nicht mehr vermeiden. Das wäre unvernünftig, würde sich negativ auf die Mobilität im Alter auswirken und hätte einen herben Verlust von Lebensqualität zur Folge. Deshalb meldete ich mich nach einer Knieoperation 2018 in einem Fitness-Center an und absolviere dort mehrmals wöchentlich ein Zirkel-Training an technischen Sportgeräten, um meine Beweglichkeit zu erhalten. Außerdem bewege ich mich, wie schon erwähnt, täglich bei langen Spaziergängen mit meiner Hündin Kitty.

8.2 Besondere Begegnungen (Thema: Sexualität, 60-, 70-erjahre)
Begegnungen zum Thema Sexualität
Verklemmter HANS GUCK IN DIE LUFT
Sexualität war in meiner Kindheit und Jugend ein im Alltag und auch in der Schule äußerst wenig präsentes Thema. Was mich betrifft, so verhielt ich mich lange wie ein HANS GUCK IN DIE LUFT, der stets damit beschäftigt war, den Alltag zu bestehen. Mein gehemmtes Wesen und meine dauerhafte Zerstreutheit sorgten dafür, dass ich ein verklemmtes Verhältnis zu Mädchen hatte.
Besondere Begegnungen
Der Umgang zu homosexuellen Menschen, war früher und ist heute ein Thema, bei welchem es nach meinen Erfahrungen einen Unterschied macht, ob man "abstrakt" darüber diskutiert, oder ob es einen konkreten Hintergrund dazu gibt. Als Kind - aus einem sehr katholischen Elternhaus - war ich in den Siebzigerjahren noch sehr geprägt von anerzogenem Denken. Beispielsweise waren Sexualität und Aufklärung eher keine normalen Gesprächsthemen (darüber wurde auch kaum gesprochen). Aber ich kannte aus meiner konservativ katholischen Erziehung "klare" Grenzen, wenn es um anders sein von Menschen ging, beispielsweise wenn solche homosexuell waren.
Wenn es konkret wird
Aber wie das in einem Leben manchmal so vorkommt, begegnet man genau solchen besonderen - bisher nur "abstrakt" - bekannten Themen auf einmal ganz real. Ich lernte beispielsweise auch solche Jugendlichen oder junge Männer zufällig am Arbeitsplatz bzw. im Jugendzentrum kennen, welche sich zu ihrer Homosexualität bekannten. Das war für mich damals zunächst schon eine kleine Herausforderung.
Kontakte zulassen, oder abwehren?
Einerseits mochte ich diese jungen Menschen, andererseits "meldete" sich aus meinem Inneren erst einmal der anerzogene "erhobene Zeigefinger", ob ein weiterer Umgang mit diesen Leuten denn gut für mich sein würde. Aber auch nach besonders kritischem "Hinschauen" fand ich keine Gründe, die dagegensprachen. Ich verstand mich mit diesen Leuten sehr gut. Darüber hinaus erinnere ich mich sogar an besonders einfühlsame sowie aufmerksame Gesprächspartner, welche auch zuhören konnten. Deshalb suchte ich gerne das Gespräch mit ihnen, - jedoch keine sexuellen Kontakte-. Das war möglich und verursachte keine Probleme. Mit einem früheren – homosexuellen - Kollegen traf ich mich sogar häufiger und wir waren eine längere Zeit befreundet.
Lerneffekt: Selbst eine Meinung bilden
Jedenfalls lernte ich so bereits in jungen Jahren schon, dass ich mich von unangebrachten Vorurteilen und verklemmten Gedankenwelten besser trennen sollte, weil sie sich einfach als beengend, lebensfremd, bösartig bzw. diskriminierend gegenüber bestimmten Personengruppen herausstellten.
Begegnung der unangenehmen Art:
Missbrauch knapp entkommen
Wenn ich alte Fotos von mir anschaue, dann übertreibe ich vermutlich nicht, wenn ich feststelle, dass darauf ein hübsches, (zumindest kein hässliches) Kind zu sehen ist. Auf manchen dieser Fotos ist erkennbar, dass ich gerne verträumt, mit großen dunklen Augen, in die Welt blickte. Diese Außenwirkung führte vermutlich dazu, dass sich mir vereinzelt erwachsene männliche Personen auf eine unangenehme Weise nähern wollten. An konkrete schwere sexuelle Missbräuche erinnere ich mich zwar nicht.
Pfadfinderführer lockt zum Solo-Spazieren
Aber an einen grenzwertigen Vorfall mit einem Gruppenleiter bei den Pfadfindern schon, der allerdings nach meiner Erinnerung nur kurzzeitig diese Funktion ausübte und bald nicht mehr zu sehen war. Vielleicht wurde er auch in weiteren Fällen mit seiner pädophilen Veranlagung auffällig. Aber dies bekam ich nicht mit.
Seltsame Einladung
Mitbekommen habe ich jedoch seine Annäherungsversuche. Nach einer Pfadfinderstunde im Gemeindehaus der Dompfarrei in Freiburg, die immer samstags nachmittags stattfand, lud er mich zu einem Waldspaziergang im nahegelegenen Schlossberg ein. Das war ungewöhnlich. Schon deshalb, weil er nur mit mir alleine spazieren gehen wollte. Aber ich dachte mir nichts weiter dabei. Als wir an einer Sitzbank ankamen, welche vom Weg aus wegen dichtem Baumbewuchs nicht gut einsehbar war, setzte er sich auf dieselbe und bat mich, neben ihm Platz zu nehmen.
Seltsame Berührungen
Dann fing mein Begleiter an, davon zu sprechen, dass ich "bald geschlechtsreif würde", und fragte mich, ob ich schon erste sexuelle Erfahrungen gemacht habe, die "etwas sehr Schönes" seien. Als ich vermutlich begriffsstutzig auf seine seltsamen Annäherungen reagierte, legte er seine Hand dorthin, wo diese nichts zu suchen hatte. Dabei flüsterte er mir zu, dass mir dies "gleich gefallen würde", wenn er mich dort eine Weile "streicheln dürfe" und ich "müsste keine Angst haben". Als ich dann von der Bank aufsprang, weil mir seine Fummeleien unheimlich wurden, fing er gleich an, mich zu beruhigen.
Seltsame Schweigeverpflichtung
Dann sprach er mit strengem Unterton davon, dass ich "niemand davon erzählen dürfe", was ich ihm versprechen musste. Unser Waldspaziergang fand darauf ein baldiges Ende. Diese sehr unangenehme Erfahrung mit einer Bezugsperson führte dazu, dass ich seither sehr misstrauisch wurde, wenn manche Personen mir "zu nahe" kamen, was mich auch vor solchen schützte.

Siehe nachfolgende Unterkapitel

9.1 Welcher Beruf ? (1972-1974)
Berufsfindung und Ausbildungen
Ohne Plan
Gedanken zur Berufswahl hätte ich mir schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt machen sollen, denn ich verließ ja freiwillig die Hauptschule ein Jahr vor dem Hauptschulabschluss im Jahre 1972, nachdem ich überraschenderweise - kurz vor Schuljahresende - darüber informiert wurde, aus eigenartigen Gründen früher von der Schule abgehen zu können.
Früher Schulabgang ohne Berufsfindung?
Dies kam − wie schon ausgeführt − zustande, indem der Rektor der Freiburger Turnseeschule mir zum Ende des achten Schuljahres plötzlich und unerwartet seine kuriose Erkenntnis eröffnete, durch die Zurückstellung meiner Einschulung 1964 wegen mangelnder Schulreife sei ich schulrechtlich so zu behandeln, als hätte ich das zurückgestellte Schuljahr wiederholen müssen, also, wie wenn ich als Erstklässler sitzengeblieben wäre. Für ihn hatte ich also nach Abschluss des achten Schuljahres meine Schulpflicht erfüllt und konnte vor dem eigentlichen Abschluss der Hauptschule die Schule verlassen. Ob diese bei heutiger Betrachtung völlig unsinnige Auslegung des Schulrechts damals jemand verstanden hat, daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
Freiheitsdrang verdrängt Vernunft
Wohl aber daran, dass ich, diese Möglichkeit der vorzeitigen Schulentlassung sogleich nutzen wollte, um durch eine früher beginnende Berufsausbildung auch früher selbständig werden zu können. Verblendet wie ich war, (man könnte das auch als blöd bezeichnen...), dachte ich keinen Augenblick daran, dass es durchaus Sinn machen könnte, doch die neunte Hauptschulklasse zu besuchen, da in dieser letzten Klasse Wissen vermittelt wurde, das man beispielsweise in der Berufsschule später benötigen könnte.
Berufswahl? Keine Ahnung!
Aber ich war wild entschlossen, die Hauptschule zu verlassen, und meine Eltern hatten nichts dagegen. Da ich aber, als Vierzehnjähriger, keinen "blassen Dunst" hatte, welchen Beruf ich ergreifen sollte, richtete ich mich pragmatisch aus.
Großen Schwester folgen
Nachdem ich also nicht wusste, was ich wollte, abgesehen von dem Wunsch, vorzeitig die Hauptschule zu verlassen, dachte ich, einfach mal zu schauen, was meine große Schwester Gudrun mit ihren immer guten Ideen so machte. Sie wurde nämlich im gleichen Jahr wie ich aus ihrer Schule entlassen. Wie gut, dass Gudrun schon eine Berufswahl getroffen hatte: Sie interessierte sich für eine Lehre als Industriekauffrau. Was meine große Schwester gut fand, fiel auch bei mir auf fruchtbaren Boden, und ich meldete mein Interesse an, zusammen mit ihr eine Lehre als Industriekaufmann zu beginnen. Für meine Eltern war das in Ordnung.
Bewerbungsglück
Manchmal stand in beruflichen Situationen − wie hier ganz am Anfang − ein unerklärliches Glück auf meiner Seite. Da mein älterer Bruder Berthold beim Herder-Verlag schon ein Jahr zuvor eine Lehre als Industriebuchbinder begonnen hatte, kannten meine Eltern den Ausbildungsleiter dieses großen Freiburger Verlagshauses. Vermutlich gab es noch andere Gründe, warum mein Vater diesen einflussreichen Menschen kannte, jedenfalls war er unserer Familie zugetan.
Zusage über Beziehungen?
Für meine große Schwester und mich war das vermutlich vorteilhaft. Warum? Ich erinnere mich daran, dass ich mich bei dem vom Herder-Verlag durchgeführten Eignungstests für Bewerber um Ausbildungsstellen schwertat und ich davon ausging, dass ich durchgefallen bin. Denn nicht alle Fragen konnte ich vollständig beantworten und in den Aufschrieben bei dem Test machten sicher einige Rechtschreibfehler auf sich aufmerksam. Dennoch erhielt nicht nur Gudrun, sondern − zu meiner totalen Überraschung − auch ich eine Zusage, und wir konnten beide im Herbst 1972 die Ausbildung beginnen. Leider brach ich diese aber nach ein paar Monaten schon wieder ab.
Ausbildung geschmissen - Alternative?
Als Fünfzehnjähriger fand ich die mir zugewiesenen Bürokraten-Tätigkeiten stinklangeilig und ich tat mir auch in der Berufsschule schwer. Deshalb kam ich zum Schluss, den falschen Beruf gewählt zu haben. Eine Alternative hatte ich jedoch auch nicht parat.
Vielleicht Zuckerbäckerlehre?
Da kam mir in den Sinn, als älteres Kind schon in einer Backstube bei einer befreundeten Bäckerfamilie in der Nachbarschaft geholfen zu haben (siehe Erzählungen im Kapitel zur "Schulzeit"). Deshalb kam ich zu dem Entschluss, es mit einer Ausbildung als Konditor zu versuchen. Es fand sich auch über die befreundete Bäckerfamilie ein Ausbildungsbetrieb, bei dem ich - quer - in das laufende erste Lehrjahr (Januar 1973) einsteigen durfte. Doch auch dieser Ausflug in die süße Backstubenwelt stellte sich nicht als geeignetes Betätigungsfeld für den HANS GUCK IN DIE LUFT heraus.
Doch wieder Büro-Ausbildung?
Wie ich dies in einem anderen Kapitel schon erzählt habe, hatte ich das Glück, nach zwei abgebrochenen Ausbildungen innerhalb weniger Monate sogar noch eine dritte Chance für einen Berufsstart zu bekommen. Ich wurde als Dienstanfänger im Juni 1973 im Ausbildungsjahr (1972/1973) von der Stadtverwaltung Freiburg übernommen. Zu verdanken hatte ich dies der Vermittlung meines ehemaligen Hauptschullehrers. Diese (zuletzt genannte) Ausbildung konnte ich dann schon 1974 mit einer Prüfung abschließen, weil überraschend eine Verkürzung der Ausbildungszeit für den einfachen Beamtendienst von drei auf zwei Jahre verfügt wurde.
Drei Mal Sonderglück - kuriose Berufsfindung!
Wenn ein fünfzehnjähriger Jugendlicher - wie schon erwähnt - in einem Jahr zwei Ausbildungsstellen kurz nach Beginn wieder hinschmeißt und im gleichen Jahr nochmals eine dritte Chance erhält, diese ungewöhnliche Story lieferte Stoff für lustige Reime in einem - mir von meiner Frau in den späten Achtzigerjahren gewidmeten und wohl gereimten - Gedicht. Allerdings machte es die Formgebung ihrer schönen Reimkunst unumgänglich, dass sie von ihrer künstlerischen Freiheit geschickt Gebrauch machte und die Reihenfolge der Ausbildungsgänge ein kleines bisschen anpasste. Wenn man allerdings bedenkt, dass sich diese Ereignisse in insgesamt nur zwei Jahren abspielten (1972 - 1974), dann stellen diese kleinen Verschiebungen keine epochalen Verdrehungen dar. Ein so schönes Dokument des Zeitgeschehens soll in meiner Autobiographie nun einen würdigen Platz bekommen. Viel Spaß beim Lesen!
DER LEHRLING
(Trilogie – nach wahren Begebenheiten)
Die Schule hat er jetzt beendet;
nach diesem Lebensabschnitt wendet
als Lehrling sich der junge Spund
dem Leben zu; da geht es rund:
I
Zunächst bei einem Zuckerbäcker
- da schmeckt es fein und riecht es lecker-
tatsächlich wird hier hart geschafft,
das hat der Junge bald gerafft.
Torten, Leckereien, Kuchen,
gar nichts darf er selbst versuchen,
vielmehr wird geputzt, gerührt,
geformt und dann auf’s Blech geführt.
Mit Sorgfalt muss der Lehrbub backen,
den Meister prüfend stets im Nacken,
denselben packt die nackte Wut,
gelingt ein Lehrstück nicht so gut.
„Käsekuchen, musst Du sehen,
haben kräftig aufzugehen“,
mahnt der Meister – kurz darauf
nimmt das Schicksal seinen Lauf:
Der Junge, ängstlich und beflissen,
lässt’s nicht an Treibsubstanzen missen,
entsprechend wächst im Ofenloch
die ganze Kuchenladung, doch:
Es quellen zu Giganten-Haufen
die Teige unhaltbar und laufen
weit über ihre Kuchenform,
und der Schaden ist enorm:
Hinüber sind die Kuchen alle,
der Meister spuckt nun Gift und Galle,
und klar ist, wer als Folge putzt
das Backrohr, so mit Teig beschmutzt!
Gelernt daraus hat unser Bube,
nicht in des Bäckers heißer Stube
liegt für ihn das Lebensglück:
Drum zieht er sich von dort zurück.
II
Des Jungen Wirkstatt Nummer zwei
liegt in der Bücherbinderei,
auf dass bei einer neuen Lehre
er nun Erfolg und Wissen mehre.
Doch dort steckt man ihn kurzerhand
in den Versand ans Förderband,
zum Zwecke, dass der junge Racker
nun werde zum Akkord-Verpacker.
An des Förderbands Beginn
stapelt man die Bücher hin,
ein jedes kriegt nun eine Hülle,
auf dass kein Schmutz die Seiten fülle.
Als nächstes müssen immer zehn
Bücher in ein’ Karton gehen,
dies alles muss sich schnell gestalten,
kennt doch das Förderband kein Halten.
Karton nun wandert um Karton,
ohne Pause und Pardon,
dorthin wo unser Lehrling eben
die Kisten jetzt hat zuzukleben.
Der Junge – das ist üblich hier! –
trank schon um neun so zwei, drei Bier,
von dessen Wirkung leicht beflügelt
wird nun das Klebband hingebügelt.
So schafft er fröhlich und beschwingt,
wobei er leis’ ein Liedchen singt,
derweil das Klebband automatisch
schwingt um die Päckchen wie fanatisch.
Doch stop! Zu Hilfe! Was ist los?!
Des Knaben Augen werden groß,
denn pausenlos schlingt ohne Ende
das Klebband ihm sich um die Hände!
Der Junge sieht umher geschockt
und durch den Kleber festgepflockt,
ohne Chance, sich zu rühren
und seine Arbeit auszuführen.
Das Weitere ist vorstellbar:
Die Kisten – voller Bücher, klar! –
sammeln sich und fallen runter
vom Förderband – denn das läuft munter!
Der Arbeitsnachbar voller Gift
tobt mit dem festgeklebten „Stift“,
und alle Förderbandkollegen
tun mit ihm gleichsam sich erregen.
Dem armen Lehrling wird nun klar,
dass dies auch nicht das Wahre war,
doch er lässt sich nicht frustrieren,
will bald was Neues ausprobieren...
III
Statt mit Nichtstun sich verderben,
will unser „Stift“ sich neu bewerben,
als er von einer Sache hört,
die seinen Geist sofort betört:
Dass die Persönlichkeitsentfaltung
gelinge wohl in der Verwaltung,
die habe manchen schon gelehrt,
was er zuvor total entbehrt.
In der Verwaltung angekommen
- rein und unvoreingenommen –
erblasst der Lehrling, als er sieht
sein neues Arbeitssachgebiet:
Ein alter Mann gleich einer Kröte,
laut schnaufend und von kranker Röte,
hockt wie ein kleiner Gartenzwerg
vor einem großen Aktenberg.
Einen Riesen-Schreibtisch zieren
gleichsam Stapel von Papieren,
und ganz hinauf bis an den Rand
mit Ordnern voll hängt jede Wand.
„Ich habe müde alte Knochen,
drum musst Du mir die Blätter lochen,
und hefte sie genau und fein
in die Ordner hier hinein!“
Der Junge denkt: „Dass ich nicht lache,
das ist doch eine leichte Sache“;
er schafft drum nicht sehr konzentriert,
und prompt ist das Malheur passiert:
Die Ordner sind voll schiefer Blätter
- der Froschmann macht ein Donnerwetter –
denn der „Stift“ hat’s nicht vermocht
und alles krumm und schräg gelocht!
Um den Alten zu versöhnen,
muss der Lehrling ihn verwöhnen,
und bringt ihm täglich etwas mit:
z.B. Wein und Aquavit...
Als nächstes, wie ein Imperator,
befiehlt der alte Registrator
dem Jungen, dass – nun fehlerfrei! –
die Amtspost zu sortieren sei.
Der Lehrling plagt sich nun mit Mengen
von Postein- sowie Postausgängen,
doch leider Gottes – ach wie dumm –
macht er jetzt alles falsch herum:
Die Post, die fort soll, wird nun bleiben,
um sie dem Amte zuzuschreiben,
das, was grad ankam, wird verschickt,
was manchen Bürger nicht erquickt.
Bald ist dieses aufgeflogen,
und fast hinaus in hohem Bogen
fliegt unser Lehrling, denn zuvor
war hier noch nie ein solcher Tor!
Epilog
Letztlich ist er doch geblieben
- man schmiss ihn nicht hinaus –
manch Dummes hat er noch getrieben
in dem Behördenhaus.
Doch später hat er sich gewandelt,
er wurde wissensreich und klug,
und keiner weiß, dass es sich handelt
um den, der sich so dumm betrug.
Und nach allen diesen Hürden
in seiner frühen Lehrlingszeit
ist heute er in Amt und Würden,
hochangesehen weit und breit!
(© Barbara Löffler)

9.2 Lehrmeister - und Lebenscoaching (1973-1974)
Cholerischer Konditormeister
Der Lehrmeister in der Konditorei, der mich in den wenigen Monaten der Lehrzeit bis zum Abbruch betreute, war ein cholerisch veranlagter Mensch. Wenn ich, als tollpatschiger ADS-Jüngling, an einen wutanfälligen Lehrer (wie zum Beispiel in der vierten Grundschulklasse) oder an einen solchen Ausbilder geriet, war ein Dauerkonflikt sozusagen vorprogrammiert. Sehr oft konnte mein Meister total ausflippen, wenn etwas schiefgelaufen war, was leider häufig passierte.
Eine kleine Story: Zuckerbäckerpech
Ich könnte nun ausführlich über meine (Un-)Taten als Konditorlehrling erzählen. Aber meine Frau, die meine Erzählungen von einer Backstuben-Heldentat im vorherigen Unterkapitel für die Ewigkeit festgehalten hat, übernahm dies in ihrem Gedicht bereits sehr gelungen, wie ich finde.
Aufquellendes Teigmalheur beendet Ausbildung
Eine solche unglückliche Episode in meiner noch kurzen Ausbildungszeit als Konditor lupfte nicht nur viele Kuchen im Backofen aus ihren Formen, sondern ließen auch meinen Ausbilder in die Luft gehen bei seiner Zornentladung. Vermutlich habe ich wieder einmal nicht genau hingehört bei seinen Anweisungen hinsichtlich der Zusammenstellung einer bestimmten Teigmasse. Nach diesem folgenreichen Backstubenmalheur war endgültig geklärt, dass die Konditoren-Ausbildung für mich zu Ende war. Bevor mich mein Ausbilder rausschmiss, kam ich ihm zuvor. Das Ausbildungsverhältnis wurde - im gegenseitigem Einvernehmen - beendet.
Besondere Meister: Lebenscoaching
Besonders in der Jugendzeit und als junger Erwachsener lernte ich sehr wichtige und besondere Menschen kennen, auch außerhalb meines familiären oder verwandtschaftlichen Umfeldes, die meine Entwicklung beeinflusst und mich mehrfach vor grobem Scheitern bewahrt haben.
Alarmierter Sonder-Coach
Als meine Konditoren-Ausbildung - wie oben erzählt - gescheitert war, wurde ich für wenige Monate arbeitslos. Für meine Mutter war klar, dass ein höchst ungünstiger Lebensumstand auf ihren schwer erziehbaren und pubertierenden Sohn zukommen würde. Sie kam zu dem Schluss, dass eine längere Arbeitslosigkeit für mich unbedingt verhindert werden musste. Deshalb wollte meine Mama gleich aktiv werden, damit ich erst gar nicht auf die Idee kam, mich tagsüber dort aufzuhalten, wo reichlich alkoholische Getränke konsumiert wurden. Doch was tun? Da erinnerte sie sich, dass ich mich mit meinem letzten Hauptschullehrer gut verstanden und dieser einen großen Einfluss auf mich hatte. Zur Erinnerung: Im Jahre 1971, als wir von der Freiburger Altstadt in den Stadtteil Wiehre umzogen, war damit auch ein Schulwechsel verbunden. Eine äußerst glückliche Fügung war dabei, dass ich diesen guten Pädagogen als Lehrer bekommen habe!
Zugewandt - einflussreich
Mich mochte er wohl von Anbeginn des Schuljahres an besonders. Warum das so war, weiß ich nicht mehr. Das Einzige, was er als Sportlehrer an mir nicht mochte, war mein Desinteresse am Sport. Neu und motivierend war jedenfalls für mich, dass dieser Lehrer mich so behandelte, als sei ich ein intelligenter, leistungsfähiger Schüler. Das war eine absolut neue Erfahrung, an die ich mich gern erinnere. So, als wolle er mir zu Beginn eines jeden Schultages sein persönliches Motto vermitteln: „Wenn Du Dir mehr zutraust, dann kannst Du künftig viel mehr erreichen als Du glaubst!“
Krisenintervention
In meinen Ex-Lehrer setzte meine Mutter nun alle Hoffnung und telefonierte mit ihm. Sie beschrieb ihm meine Situation, und er handelte sofort, wie es ein guter Schulsozialarbeiter heutzutage nicht besser machen könnte. Zeitnah lud er mich zu einem Gespräch ein. Und wieder schaffte er das, was ich schon in der Schule so positiv erlebt hatte. Wie ein guter Lehrmeister für das Leben baute er mich auf, sprach davon, wo er meine Stärken sah (ohne meine Schwächen zu verschweigen) und konnte mich schließlich davon überzeugen, dass ich beruflich nirgends anders, "als wieder an den Schreibtisch" zurückkehren solle.
Kreativer Macher
So wie er argumentierte, konnte ich ihm mühelos folgen und er, dieser clevere Fuchs, hatte mich nach unserem längeren Gespräch so weit, dass es auch aus meiner Sicht keinerlei Zweifel mehr gab, seine wohldurchdachten Empfehlungen anzunehmen. Als ich ihm dies auf seine Nachfragen hin bestätigte, wurde mein Wohltäter auch gleich konkret.
Wenn jemand- jemand kennt, der jemanden kennt
Was dann folgte, war gut mit dem Wörterspiel "wie gut, wenn jemand - jemand kennt, der jemanden kennt" in Verbindung zu bringen. Zufällig hatte mein Ex-Lehrer mit jemandem Kontakt, der den Ausbildungsleiter bei der Stadtverwaltung in Freiburg gut kannte. Er schaffte es, dass wir einen Termin beim Personalamt der Stadt bekamen, für ein gemeinsames Gespräch. Dort durfte ich mich kurz vorstellen und darüber informieren, was ich mir für einen künftigen beruflichen Weg vorstellte.
Zielgenau vorbereitet…
Wie ich es zuvor mit meinem früheren Klassenlehrer, nun mein Berufsfindungscoach, geübt hatte, äußerte ich mein großes Interesse, "möglichst bald eine Ausbildung in der Verwaltung bei der Stadt Freiburg beginnen zu können". Außerdem sagte ich ein paar − ebenfalls zuvor eingeübte − Sätze zu der Frage, weshalb ich meine Ausbildungsstellen aufgegeben hatte. Wenn ich mich richtig erinnere, sollte ich das mit „vorübergehend aufgetretenen Problemen in meinem familiären Umfeld“ begründen, mit dem Zusatz, dass "diese inzwischen überwunden" seien.
… mit Erfolg
Mein Kurzauftritt muss positiv verlaufen sein, wie mir das kurze Augenzwinkern meines Ex-Lehrers andeutete. Danach schickte man mich hinaus und mein in Kommunikation sehr geschickter Berufsfindungscoach verhandelte längere Zeit mit dem leitenden Beamten des Personalamtes. Offensichtlich verstand er es, den Ausbildungsleiter zu überzeugen, mit mir einen geeigneten Bewerber für eine Ausbildung in der Verwaltung einstellen zu können.
Probleme als Seiteneinsteiger?
Auch schaffte er es vermutlich überzeugend darzulegen, ich könne den bisher verpassten Schulstoff in der Berufsschule aufholen. Zur Erinnerung: Ich stieg in ein bald zu Ende gehendes erstes Lehrjahr ein, das nach nur einem Monat (Juli 1973) endete. Da hatte ich große Lücken. Wegen den zwei vorausgegangenen Ausbildungsabbrüchen besuchte ich nur für kurze Zeiten eine Berufsschule. Aber die Verhandlungsstrategie meines "Agenten" war vermutlich darauf ausgerichtet, dass ich sofort wieder in ein Ausbildungsverhältnis einsteigen kann. Dieses Ziel konnte er erreichen.
Ab sofort wieder Azubi
So bekam ich − für mich total unerwartet − tatsächlich eine Zusage von der Stadtverwaltung Freiburg auf Probe und konnte meinen neuen Ausbildungsplatz als Dienstanfänger im Verwaltungsdienst am 18. Juni 1973 antreten. Dem öffentlichen Dienst blieb ich dann allerdings vierzig Jahre lang treu.
Fehlstart in der Berufsschule
Nach einer langen und erfolgreichen beruflichen Zukunft sah es allerdings bei dem glücklichen Neustart zunächst nicht aus. Ganz im Gegenteil: Um ein Haar wäre ich im zweiten Ausbildungsjahr (Halbjahreszeugnis Februar 1974) schon wieder gefeuert worden, weil sich dort herausstellte, dass ich es nicht schaffte, den Stoff eines ganzen (ersten) Schuljahres im Schnelldurchgang nachzuholen. Aber genau dies wäre erforderlich gewesen, um den Anschluss im zweiten Ausbildungsjahr zu finden.
Auch das noch! Prüfung wird vorgezogen
Dann wurde mir auch noch völlig überraschend zu Beginn des zweiten Lehrjahres mitgeteilt, dass sich im Rahmen einer Reform die Ausbildungszeit von Beamten für den einfachen Dienst kurzfristig von drei auf zwei Jahre verkürzt. Meine erst Mitte Juni 1973 frisch angefangene, dritte Ausbildung, endete somit schon wieder bereits im Sommer 1974. Hintergrund war, dass nach unserem Jahrgang die Ausbildung für den einfachen Verwaltungsdienst abgeschafft, und danach nur noch eine solche für den mittleren Dienst angeboten wurde. Die Eingangsvoraussetzung dafür war allerdings die Mittlere Reife.
Null Durchblick
Nun stand ich vor einer scheinbar unlösbaren Situation. Im aktuellen Unterricht in der Berufsschule fühlte ich mich chancenlos, Anschluss zum Unterrichtsstoff zu finden, und nun stand schon, ein Jahr früher als vorgesehen, die Abschlussprüfung vor der Türe. Gott sei Dank erhielt ich Ende Juli 1973 erst einmal keine Zeugnisnoten, da ich die Berufsschule erst seit wenigen Wochen besuchte. Aber es kam, wie es kommen musste: Im September 1973 ging es schulisch im zweiten Lehrjahr weiter und ich erhielt im Februar 1974 ein Zwischenzeugnis, das es in sich hatte.
Geschockter Dienstherr
Der Notenspiegel, welcher aus diesem Zwischenzeugnis sprach, erinnerte mich fast an den aus der vierten Grundschulklasse. Damit schockte ich natürlich meinen Arbeitgeber, den Ausbildungsleiter bei der Stadtverwaltung, denn er hatte ja geglaubt, ich könne problemlos den Anschluss in der Berufsschule finden. Meine Mutter wurde zum Krisengespräch in das Personalamt der Stadt eingeladen. Sie musste ein Papier unterschreiben, dass ich sofort entlassen würde, sollte ich die nahende Abschlussprüfung nicht bestehen.
Rettende Turbo-Nachhilfe
Ein Freund meines Vaters, der damals als Kaufmann in einem Fachgeschäft für Schreib- und Künstlerbedarf in Freiburg arbeitete, nahm sich meiner an. Vermittelt hatte diese intensive Sondernachhilfe wieder einmal meine Mutter, die bewährte Krisenmanagerin! Mehrere Wochen lang ging ich alle zwei Tage abends zu meinem kompetenten Nachhilfelehrer, der mich in Buchhaltung und kaufmännischem Rechnen − von den ersten Seiten der Schulbücher des ersten Lehrjahres beginnend, bis zum aktuellen Stand des Unterrichts im angelaufenen zweiten Schuljahr – in kurzer Zeit fit machte.
Tempobüffeln – Prüfung bestehen!
Das klappte jedoch nur mit einer straff durchgeführten Nachhilfe. Mein strenger Nachhilfelehrer bemerkte bald, dass ich Buchführung hasste. Deshalb achtete er besonders darauf, dass ich mich sorgfältig mit dem nachzulernenden Stoff befasste. Sein Unterricht begann damit, dass er den Stoff der letzten Nachhilfestunde konsequent abhörte und damit testete, ob ich die Hausaufgaben, die er mir mitgab, tatsächlich von mir vollständig durchgearbeitet wurden. Wenn ich etwas vergessen hatte zu lernen, dann wurde ich von ihm (zurecht) gerügt. Nach dem Repetieren des Nachhilfestoffes vom Vortag nahm er sich dann ein neues Thema aus dem Schulstoff vor. Dieses Extrem-Nachhilfe-Coaching war zwar ziemlich anstrengend für mich, es verfehlte aber seine Wirkung nicht und ich schaffte letztlich die Abschlussprüfung für den einfachen Verwaltungsdienst.
Auf sechs folgt eins – auf fünf eine zwei
Waren die Einreichungsnoten für die Prüfung in den Fächern Buchführung und kaufmännisches Rechnen noch ungenügend beziehungsweise mangelhaft, konnte ich mit den Prüfungsarbeiten - ein sehr gut -, beziehungsweise - ein gut - entgegensetzen.
Kopf aus Schlinge ziehen – Schlüsselereignis!
Das war ein nachhaltig wichtiges Ereignis für mich. Zum zweiten Mal hatte ich − nach dem schon erzählten Erlebnis mit dem Ex-Lehrer in der letzten Hauptschulklasse − das Gefühl, dass ich aus einer scheinbar aussichtslosen Situation, mit den richtigen Menschen an meiner Seite, die mich förderten und forderten, sowie mit entsprechendem Einsatz wieder aus einem Jammertal herauskommen konnte.
Fazit: Jugendförderung lohnt sich!
Wenn leistungsgestörte Jugendliche mit Handicaps zum richtigen Zeitpunkt auf die richtigen Lehrkräfte und Lehrmeister*innen treffen und von fürsorglichen Menschen begleitet werden, (wie ich von meiner Mutter), kann manchmal das Unmögliche möglich werden. Auch dann, wenn alle Fakten absolut dagegensprechen. Das war jedenfalls meine Erfahrung!

9.3 Story: Lehrlings-Lohn (Dienstanfänger 18.6 1973)
Lehrlings-Lohn?
Die Ausbildungsvergütungen lagen zwischen 100 und 300 DM je nachdem, in welchem Lehrjahr sich der Auszubildende befand. Etwas höher waren die Ausbildungsbezüge nach meinem Antritt der Verwaltungsausbildung bei der Stadt Freiburg.
Dazu eine kleine Story: "jetzt gesch halt eifach…"
In den ersten Tagen meiner Ausbildung musste ich sehr viele Formulare ausfüllen, unter anderem eines, in dem nach meiner Bankverbindung gefragt wurde. Als ich diese speziellen Formulare abgab, erhielt ich die Anweisung, ich solle mich gleich zu den Schalterräumen der Stadtkasse im Erdgeschoss des großen Rathaus-Anbaues begeben, um dort für den ersten Monat meiner Ausbildung (an meinem ersten Arbeitstag) bereits die Bezüge in bar abzuholen. Darüber war ich etwas verdutzt, was nicht unbemerkt blieb.
Naiver Wissensdurst vom Dienstanfänger
Auf meine schüchterne Nachfrage, warum man denn schon Geld bekommt, obwohl man noch gar nichts gearbeitet hat, bekam ich meine erste behördliche Belehrung verpasst, von einem älteren Beamten aus dem Personalamt. „Sell muscht Dir merke, Bub...“, so begann dieser in markantem Freiburger Dialekt. Dann ging‘s weiter in Hochdeutsch: „Beamte bekommen nicht am Ende des Monats einen Verdienst aus ihrer Arbeit ausbezahlt, sondern Du erhältst nun als Beamtenanwärter Bezüge von Deinem Dienstherrn, weil Du laut Gesetz in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zu ihm stehst. Da es sich um Bezüge und nicht um Löhne handelt, bekommst Du diese fortan immer am Anfang des Monats ausbezahlt, ab dem Zeitpunkt des Beginns deines Dienstverhältnisses.“
Verwinkeltes Beamtendeutsch
Ich glaube, mein Gesichtsausdruck verriet diesem Staatsdiener, dass ich den ersten Teil seiner Antwort, den kurzen im Freiburger Dialekt, besser verstanden hatte als den zweiten im Beamtenhochdeutsch.
"Jetzt gesch halt!"
Er übergab mir schließlich etwas unwirsch einen Auszahlungszettel für die Stadtkasse und meinte: „Jetzt gesch halt eifach runter zur Kasse und holsch Dir Dei Geld ab.“ Von jetzt auf nachher verstand ich wieder alles, was mir dieser Mann im Personalamt sagte und nahm sogleich erfreut bei der Kasse den unerwartet frühen Geldsegen in bar entgegen. Somit blieb mir dieser erste Arbeitstag als Dienstanfänger angenehm in Erinnerung: Geld entgegennehmen, ohne einen Finger krumm gemacht zu haben...

9.4 Story: Jugend-Coach als Ehrengast (2017)
Lebens-Coach und Wohltäter
Ehrengast beim Sechzigsten
2017 feierte ich im Hofgut Himmelreich bei Freiburg meinen sechzigsten Geburtstag. Bei meiner großen Verwandtschaft und einigen dazu eingeladenen Weggefährten handelte es sich um eine große Feier. Winfried, mein verdienstvoller Lebens-Coach und Wohltäter-Lehrer aus der letzten Hauptschulklasse lud ich als Ehrengast ein. Das Hofgut Himmelreich, ein viele Jahre schon bestehender sogenannter Integrationsbetrieb, der benachteiligte Menschen für den ersten Arbeitsmarkt qualifiziert, kannte er sehr gut. In diesem Hotel- und Gastronomiebetrieb arbeitete seit seiner Gründung einer seiner Söhne, der mit einem Handicap geboren wurde.
Rettung in schwerer Jugendzeit
Besonders erfreulich für mich war, dass mein Retter in schwerer Jugendzeit die Einladung tatsächlich annahm und sogar in Begleitung seiner Frau kam. Auch blieben er und seine Frau nicht wie erwartet nur mal kurz zum Gratulieren, sondern den ganzen langen Abend. Augenzwinkernd ließ mich mein Ehrengast bei der Verabschiedung noch wissen, er werde immer wieder zu runden Geburtstagen ehemaliger Schüler*innen eingeladen, es falle ihm dann immer ein guter Grund ein, um sich bald wieder verabschieden zu können. An meiner Feier zum Sechzigsten hätte es für ihn und seine Frau aber keinen Grund gegeben, früher zu gehen, wie er mir versicherte.
Passende Feierrunde
Denn an meinem Tisch, an dem auch Freunde − darunter ebenfalls ein pensionierter Lehrer – und zwei langjährige, kommunalpolitisch aktive Weggefährten aus der Schwarzwaldgemeinde saßen, fühlte er sich augenscheinlich gut platziert. Unsere Tischgemeinschaft hatte an diesem Abend viel Spaß. Insbesondere auch, als mein Ehrengast davon erzählte, was ihm an mir damals überhaupt nicht gefallen hatte, nämlich mein Desinteresse am Sportunterricht, (erstaunt war ich, dass er sich daran noch erinnern konnte). Er sei frustriert darüber gewesen, dass er als Sportlehrer speziell in diesem Fach bei mir wenig verändern konnte.
Kleine Story dazu:
Politisches "Kabarett"
Ansonsten waren an meinem Tisch Vertreter unterschiedlicher "politischer Herkünfte" versammelt (vermutlich: schwarz, rot, grün...), die es jedoch verstanden, humorvoll über ihre verschiedenen Sichtweisen zu diskutieren, einander scherzhaft zu provozieren und dabei viel lachten. Beispielsweise konnte sich mein ehemaliger Lehrer besonders darüber amüsieren, wenn sich sein origineller Kollege (ebenfalls im Ruhestand) aus der Schwarzwald-Gemeinde (den er bis dahin noch nicht kannte), und der als CDU- Ortsvorsitzender auch Mitglied des dortigen Gemeinderates war, über seine hingebungsvolle Verehrung für seine "Angie" (Bundeskanzlerin Angela Merkel) in blumiger Sprache ausließ. Im Anschluss an die von ihm inbrünstig und stark überzeichnet vorgetragene Liebeserklärung für die Kanzlerin kam es dann zu einem theaterreifen, längeren und lustigen "Schlagabtausch" der Tischgemeinschaft (köstliches politisches Kabarett).
Gute Gelegenheit - DANKE zu sagen
In meiner Festansprache an die Gäste hob ich die besonderen Verdienste meines früheren Lehrers für eine doch noch geglückte Wende in meinem Leben hervor. Dabei blieb ich nicht ungerührt und ich spürte emotionale Reaktionen in mir. Meine Stimme stockte nämlich kurz bei meiner Rede und meine Augen wurden bestimmt feucht, (was bei mir äußerst selten vorkommt). Aber diese Würdigung für einen der wichtigsten Wegebegleiter in meinem Leben, der sich nebenberuflich auch nach meiner Schulentlassung noch mit großem Engagement um mich kümmerte und mich im wahrsten Sinne des Wortes "vor dem Absaufen" rettete, war mir an diesem Abend ein großes Anliegen. Ich hatte dadurch auch einen guten Rahmen gefunden, meinem Wohltäter in der Jugend im feierlichen Rahmen danken zu können.

9.5 Von unten nach oben... (1972 - 2013)
Weiterbildung: Aufwärts geht's
Wie berichtet, konnte ich 1974 schließlich im dritten Anlauf die Berufsausbildung für den einfachen Verwaltungsdienst mit der bestandenen Abschlussprüfung abschließen. Dem Verwaltungsberuf blieb ich treu: Erst nach vierzig Berufsjahren endete meine aktive Dienstzeit im Jahre 2013, mit Eintritt in den Ruhestand. Allerdings befand ich mich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im einfachen, auch nicht im mittleren und auch nicht im gehobenen Dienst, sondern beendete meine aktive Berufstätigkeit im höheren Beamtendienst, für den in der Regel ein abgeschlossenes Universitätsstudium oder vergleichbares Hochschulstudium vorausgesetzt wird.
Aufstiegsleiter
In den mittleren und den gehobenen Verwaltungsdienst kam ich durch gezielte Fortbildungsmaßnahmen in den Jahren 1978 und 1999. In den höheren Beamtendienst schaffte ich es, weil ich im Jahre 2002 zum Bürgermeister gewählt wurde, also in ein politisches Wahlamt, für das es besondere Zugangsvoraussetzungen gibt.
Berufliche Weiterbildung - Prüfungen
Aufstiegs- und Laufbahnprüfungen
Während meiner vierzigjährigen Dienstzeit nutzte ich also alle vorstellbaren Möglichkeiten für Laufbahnaufstiege für einen Verwaltungsbeamten, von ganz unten nach ganz oben. Dazu musste ich die zwei eben genannten Prüfungen ablegen. 1978, am Ende der sechs Monate dauernden staatlichen Verwaltungsfachschule in Au bei Freiburg, und im Jahre 1999, nachdem ich zur Aufstiegsprüfung für den gehobenen Dienst zugelassen wurde. Vorbereiten konnte ich mich für die zuletzt genannte Prüfung durch berufsbegleitend angebotene Fortbildungsgänge der Hochschule für die öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg, speziell für Aufstiegsbeamte. Für diese mehrwöchigen Fortbildungsveranstaltungen wurde ich von meinem Dienstherrn (Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis in Villingen-Schwenningen) freigestellt.
Gehobener Dienst
Komplizierte Aufstiegsregeln
Die Zulassung für den zuletzt beschriebenen Karrieresprung in den gehobenen Dienst war allerdings an mehrere Bedingungen geknüpft, die ich vor der Bewerbung zur Aufstiegsprüfung erfüllen musste. Erste Voraussetzung: Ich musste mindestens vierzig Jahre alt sein. Das war die unproblematischste Hürde. Dann musste ich die Staatsprüfung für den mittleren Dienst mindestens mit der Gesamtnote befriedigend bestanden haben. Diese Bedingung erfüllte ich ebenfalls. Aber dann war noch eine weniger einfach zu bewältigende Hürde zu nehmen: Ich musste − bei guter dienstlicher Beurteilung − in einem festgelegten Mindestzeitraum als Beamter des mittleren Dienstes auf einer Stelle des gehobenen Dienstes gearbeitet haben, um mich für die bereits erwähnte Aufstiegsprüfung bewerben zu können.
Aufstieg trotz Teilzeit?
Doch wie sollte ein solcher Hürdenlauf gelingen können? Ich arbeitete zu der damaligen Zeit nur halbtags, weil ich meine Kinder betreute und als Hausmann tätig war, während meine Frau in Vollzeit und im gehobenen Dienst das Haupteinkommen für die Familie verdiente.
Zufallsblick mit Folgen
Eines Tages "winkte" mir aber eine passende Chance vom Schwarzen Brett des Landratsamtes entgegen. Im Jahre 1997 wurde dort ein Beamter, bzw., eine Beamtin im gehobenen Dienst für eine Stelle im Jugendamt in Teilzeit gesucht. Ich bewarb mich sofort für diese Stelle - obwohl ich dem mittleren Dienst zugehörig war - und war dennoch erfolgreich. Allerdings hatte ich Glück, weil keine Mitbewerber aus dem gehobenen Dienst Interesse an dieser Ausschreibung anmeldeten. So kam ich (als Beamter des mittleren Dienstes) zum Zuge. Als dann mein Chef im Jugendamt meine Arbeit nach der in den Aufstiegsregeln vorgegebenen Zeit-Vorgabe auch noch mit der erforderlichen Gesamtnote bewertete, war der Weg frei. Nach dem Beamtengesetz durfte ich mich nun über meinen Dienstherrn, das Landratsamt, für eine Laufbahnprüfung zum Aufstieg in den gehobenen Dienst bewerben, was ich tat. Es gelang mir schließlich, die Prüfung im Jahre 1999 erfolgreich abzuschließen.
Hoch gepokert – gewonnen!
Zum ersten Mal spielte ich damit, eine ganz besondere berufliche Herausforderung erreichen zu können, überwand normal übliche Laufbahnbegrenzungen, und konnte die Hürden erfolgreich nehmen. Das war eine große Freude und Genugtuung für mich, es so weit geschafft zu haben. Angesichts meiner Handicaps und der schwierigen Umstände, unter denen ich nach einer mehr oder weniger verkorksten Schulzeit in jungem Alter ins Berufsleben stolperte (und 1973 - im dritten Anlauf - in der öffentlichen Verwaltung startete), beendete ich 2013 meine berufliche Laufbahn − durch Nutzung der sich bietenden Fortbildungsmöglichkeiten mit einem - in meinem Rückblick - sensationellen Ergebnis.

10. Kapitel: BUNDESWEHR -Wehrpflicht (1976-1977)
Ohne Jubel in die Kaserne
Über das Für und Wider des Wehrdienstes machte ich mir vor meinem Einzug keine Gedanken. Für mich war klar: Als junger Mann muss man Wehrdienst leisten. Die Musterungsbehörde stellte nun mal meine Tauglichkeit fest; danach war die Frage für mich nicht, ob, sondern nur: wann ich zur Bundeswehr muss. Wehrdienstverweigerung war für mich kein Thema.
Vorgezogene Einberufung
Weil ich unbedingt ab Januar 1978 einen sechsmonatigen Lehrgang für den Aufstieg in den mittleren Beamtendienst absolvieren wollte, nutzte ich die Beziehungen meines damaligen Chefs, der auch ehrenamtlich in einem Gremium im Kreiswehrersatzamt in Freiburg saß. Er machte es möglich, dass ich ruckzuck - statt normalerweise zum 1. Januar 1977 - schon zum 4. Oktober 1976 zum Wehrdienst einberufen wurde. Den Wehrdienst antreten musste ich in der Generaloberst von Fritsch- Kaserne in Pfullendorf (heute umbenannt in Staufer-Kaserne), zwei Autostunden östlich von Freiburg gelegen. Meine Einheit, der ich nach der sechswöchigen Grundausbildung zugeordnet wurde, war das I. Feld-Artillerie-Bataillon (2. Batterie) in Pfullendorf, welches zu der 10. Panzerdivision (Sigmaringen) gehörte. Übrigens: Da Pfullendorf im Winter als ein äußerst kaltes Loch galt, war es ein Glücksfall, dass ich die unvermeidliche Grundausbildung, die bekanntlich im Freien durchgeführt wird, im goldenen Oktober 1976, bei warmer Herbstsonne, statt im eisigen verschneiten Januar 1977 hinter mich bringen konnte. Nach fünfzehn Monaten Grundwehrdienst wurde ich dann im Dezember 1977 entlassen. Ab Januar 1978 saß ich, wie geplant, auf der Schulbank der Verwaltungsfachschule.
Nicht zum Elite-Soldaten geboren
Karriere als Soldat machte ich allerdings keine, strebte sie auch nicht an, und ich fiel auch nicht als motivierter Kämpfer für das Vaterland auf. So brachte ich es nur zum Gefreiten, was für mich aber überhaupt keinen Schmerz bedeutete. Für einen sehr oft abgelenkten Rekruten mit einem ADS ist die Wehrdienstzeit mitunter eine herausfordernde Zeit, für den Soldaten selbst, als auch für seine Vorgesetzten. Mein erster Eindruck nach dem Einrücken in die Kaserne war daher, die Männer in Uniform, mit denen ich es als Rekrut zu tun hatte, schrien viel oder sprachen zumindest meistens sehr laut. Manchmal, wenn ich meine Ohren als Soldat mit einem ADS routiniert auf Durchzug stellte, während man mich − wie so oft − anschrie, dachte ich, diese Menschen müssten von einem anderen Stern sein. Beim Brüllen bekamen manche der Schreihälse purpurrote Köpfe, fiel mir auf.
Verstanden! –
Unterscheidung: oben und unten
Einen Zusammenhang kapierte ich dadurch bei der Bundeswehr sehr bald: die Rangordnung. Wer durch eindeutige Erkennungsmerkmale an der Uniform als Vorgesetzter (oder an der lauten Stimme) erkennbar war, der hatte die Hosen an, und nicht ich als Rekrut. Er konnte bestimmen, in welcher Lautstärke er mit mir sprach, wie, und was ich, wann anzuziehen hatte, wann ich aufstehen und wieder schlafen gehen sollte, wie ich mich bei bestimmten Exerzierübungen zu bewegen und wann ich strammzustehen hatte, wie lang meine Kopfhaare sein durften. Und so weiter…
Merkwürdiges Soldaten-Leben
Ganz besonders verrückt fand ich das Exerzieren, bei dem wir zu bestimmten Schrittfolgen und Formationen gedrillt wurden. Unzählige Jähzorn-Anfälle löste es bei Vorgesetzten aus, wenn das Kasernenhof-Ballett der Rekruten nicht in jedem kleinsten Detail nach deren Vorstellungen tanzte. Schließlich mussten wir auch noch ein Lied im Marschier-Rhythmus singen. Zwar war ich immer ein Freund des Chorgesangs. Aber unter diesen Umständen versperrten sich meine Stimmbänder! An einem solchen, - in meiner damaligen Wahrnehmung als sinnfrei empfundenen - Aktionismus teilnehmen zu müssen, das hasste ich wie die Pest. Aber ich musste mich widerwillig daran gewöhnen.
Erziehungsmaßnahmen
Meine innere Auflehnung gegen dieses eigenartige Tun blieb meinen Vorgesetzten vermutlich nicht verborgen. Vielleicht hatte ich deshalb das Gefühl, die Ausbilder spielten ihre Macht besonders mir gegenüber aus und bedachten mich − wie früher ein bestimmter Lehrer in der Schule − mit vielen Strafen. Zwar kein Prügeln mehr, aber dafür jede Menge Sonder- und Wochenenddienste.
Unwillig bei sinnfreiem Tun
Während des Exerzierens, so erinnere ich mich deutlich, musste ich unzählige Male dem gebrüllten Befehl folgen: „Soldat, nach hinten wegtreten, marsch-marsch!“ Meine, - noch nicht so lange eingeübten - Marschier-Schrittchen, waren nicht mit denen meiner Kameraden kompatibel, oder meine Kopfhaltung wich von der meiner Kameraden ab, weil ich gern einmal in die falsche Richtung schaute. Da kam ich umständehalber öfter durcheinander. Der Befehl bedeutete: Ich sollte mich sofort im Laufschritt von meiner Ballett-Formation entfernen, bis der Schreihals von Anführer mich wieder zurück befehligte − wieder rennend. Das empfand ich als Irrsinn und vermutlich so, wie es gedacht war, nämlich als Gehirnwäsche, um individuelles Denken und Handeln aus dem Soldaten heraus zu erziehen. Auch sonst bot ich den Vorgesetzten jede Menge Steilvorlagen für Sanktionen. Ich war oft begriffsstutzig, mein Spind war selten ordentlich aufgeräumt und ich war beispielsweise auch nicht der Schnellste, wenn wir für eine besonders eilige Mobilmachung befehligt wurden.
Reaktionsschwach - umständehalber
Das häufig vorkommende nächtliche Wecken zum Üben von Alarmsituationen war mir höchst lästig. Besonders weil ich in dem von mir erlebten fünfzehn Monate andauernden Ausnahmezustand am Abend in der Kantine täglichen Trost bei einigen Flaschen Goldochsen-Bier suchte. Damit war ich mitten in der Nacht bei dem vorzeitigen, abrupten und sehr lauten Wecken einfach nicht fit genug für schnelle und strukturierte Handlungen.
Keine Waffenaffinität
Zu den Waffen und dem technischen Zeug wie den großen Geschützen auf gepanzerten Fahrzeugen und den Haubitzen um mich herum hatte ich ein mehr als distanziertes Verhältnis. Bei der Ausbildung an diesen Waffen stellte ich mich vermutlich ungeschickt an, unter anderem auch deshalb, weil ich, desinteressiert und wenig konzentriert, den Ausführungen der Ausbilder kaum folgte. Das fiel natürlich auf. Wehe, ich wurde aufgerufen, um zu wiederholen, was der Ausbilder eben von sich gegeben hatte. Solche - leider häufig vorkommende – Situationen, sorgten für Wutanfälle bei meinen Vorgesetzten und amüsiertes Gelächter bei den Kameraden.
Keine Tricks bei Gewehrreinigung
Schließlich machte ich mich auch dadurch unbeliebt, dass beim obligatorischen Waffenreinigen nach den Kampfeinsatzübungen mein Gewehr kaum verunreinigt war. Das kam dadurch, dass ich während des Geschehens auf dem Felde nur äußerst sparsam und zögerlich die Schusswaffe einsetzte. Ich wusste, dass die Übungsmunition (nur zum Knallen, nicht für scharfe Schüsse) in meinem Gewehr viel Dreck hinterlassen würde, den ich später wieder penibel aus dem zerlegten Gewehr putzen musste, und das machte mir überhaupt keinen Spaß. Aber die Kontrollen nach dem Waffenreinigen waren streng. Das stets so sauber gebliebene Gewehr des Kanoniers Löffler nach den Kampfeinsatzübungen fiel natürlich irgendwann auf, und ich durfte dann neben meinem Gewehr auch noch ein Maschinengewehr komplett in einer Sonderschicht putzen, mit dem - tausendfach - Übungsmunition verschossen worden war. Das Maschinengewehr hatte sehr viel mehr Teile als ein normales Gewehr und war höllisch verdreckt!
Durchstehen
Aber ich überlebte diese Wehrdienstzeit, wie viele hunderttausende Wehrpflichtige vor und nach mir auch. Darüber hinaus lernte ich, anstrengende und lästige Lebenssituationen durchzustehen. Mein Alkoholproblem hatte ich schon mitgebracht, aber in der Bundeswehrzeit "wuchs" es leider weiter.

Siehe nachfolgende Unterkapitel

11.1 Wie kommt Man(n) zur Frau? (ab 1983)
Besondere Wege
Manche lernen ihre Partner oder Partnerinnen einfach beim Tanzen in der Disko oder bei sonst einer Gelegenheit direkt kennen. Bei mir gab es eine Vorgeschichte, bis ich über Umwege meine spätere Frau kennenlernen durfte.
Schüchtern
Als therapierter Ex-Suchtkranker musste ich Anfang der Achtzigerjahre noch lernen, „trocken“ durchs Leben zu gehen, das heißt auf den Konsum von alkoholischen Getränken zu verzichten. Der Alkohol war aber für mich das Mittel gewesen, das mich so locker machte, dass ich mit einem Mädchen, das mir gefiel, überhaupt in Kontakt kommen konnte. Ohne diesen Mutmacher hatte ich nun die Herausforderung zu bestehen, auch nüchtern zurechtzukommen, falls ich mich verlieben sollte. Das ging jedoch nicht von heute auf morgen beziehungsweise dauerte seine Zeit.
Hübsch und jung – wo liegt das Problem?
Wenn ich allerdings frühere Fotos von mir anschaue aus dieser Zeit, dann sehe ich darauf einen durchaus gutaussehenden jungen Mann, von dem sich junge Mädchen nicht unbedingt abwenden mussten. Aber das Äußere ist ja bekanntlich nicht alles. Dennoch tat ich genau dafür in dieser Zeit einiges, indem ich beispielsweise für meine Verhältnisse viel Sport trieb. Wenige Jahre davor war nämlich mein Äußeres noch durch eine lange Suchtkarriere geprägt. In diesem Zustand hätte ich bei den Mädchen nicht mit einer positiven Ausstrahlung punkten können. Aber trotz meines inzwischen erreichten guten Aussehens musste ich erst einmal zusehen, wie ich zu mehr Selbstbewusstsein kam, damit auch meine Psyche bereit wurde für die Liebe. Das war jedoch gar nicht so einfach. Wie schon erwähnt, begleitete mich meine Sucht-Karriere bis zu ihrer Überwindung (1981) immerhin circa zehn Jahre lang. Außerdem war ich 1983 erst knapp zwei Jahre trocken, als sich für mich eine schöne Gelegenheit auftat, ein Mädchen kennenzulernen, in das ich mich schließlich verliebte. Doch der Reihe nach.
Neue Perspektiven
Im Sommer 1981 schloss ich mich in einer Selbsthilfegruppe vom BLAUEN KREUZ für Suchtgefährdete und Angehörige in Freiburg an. Nachdem ich etwa ein Jahr lang dieser christlich orientierten Organisation angehörte, kamen zwei junge Frauen dazu. Sie waren weder suchtkrank noch Angehörige von Suchtgefährdeten, vielmehr gingen sie ihrem Beruf als Familienpflegerinnen nach und waren beim Diakonischen Werk Freiburg angestellt. Als christlich orientierte Familienpflegerinnen suchten sie fachliche Hilfe für ihre Arbeit, weil in den Familien, in denen sie tätig waren, oft Alkoholkranke oder Angehörigen von ihnen lebten.
Familienpflegerinnen führen zusammen
In der Selbsthilfegruppe sprach ich Ende des Jahres 1982 ein Problem an. Zwar ging es mir über ein Jahr nach meiner Klinikbehandlung wieder gut, ich konnte ohne Alkoholkonsum leben, und auch meine Berufstätigkeit war gut wieder angelaufen. Aber ich wollte neben meinem Arbeitsalltag und der Selbsthilfegruppe gern mehr Kontakte zu jungen Leuten haben. Als die beiden jungen Frauen das hörten, fragten sie mich, ob ich Anschluss an eine christliche oder kirchliche Gemeinde hätte. Da musste ich passen. Sie erzählten mir, sie seien bekennende junge Christinnen und hätten sich deshalb einer Chrischona-Gemeinde angeschlossen, die auch Teil der evangelischen Landeskirche war. Dort, so informierten sie mich weiter, gebe es auch einen Jugendkreis, der sich wöchentlich treffe. Sie luden mich ein, Kontakt zu diesem Gemeinde-Jugendkreis aufzunehmen. Ich wurde zwar stramm katholisch erzogen, dachte mir aber: „Was soll’s?“, und kam zu der Überzeugung, dass gut ist, was hilft.
Jugendliches Umfeld hilft
Im Januar 1983 gab ich mir dann einen Ruck und besuchte diese Gruppe. Dort traf ich auf freundliche Leute, die meisten davon waren jünger als ich. Das störte mich überhaupt nicht, und ich fühlte mich in diesem Kreis bald wohl. Ich wurde gleich zu einer Jugend-Winterfreizeit in einem Schweizer Freizeitheim am Vierwaldstätter See eingeladen. Dort lernte ich die jungen Mitglieder des Jugendkreises aus der Chrischona-Gemeinde gut kennen, darunter einige Musiker. Musikalisches Engagement war übrigens ein wichtiger Bestandteil der Aktivitäten in der Gruppe. Mir gefielen die christlichen Lieder, mit modernen Melodie-Sätzen, die mit Gitarren, Klavier und anderen Instrumenten (zum Beispiel mit meiner Querflöte) begleitet wurden. Überhaupt waren der Kontakt und das Erlebnis, einer Jugendgruppe anzugehören, in der ich mich wohlfühlte und wo ich akzeptiert war, eine neue, sehr schöne Erfahrung. Das half mir in dieser Phase meines Lebens enorm.
Neues Lebensgefühl
Wenige Monate später wurde ich wieder eingeladen, diese Jugendgruppe zu einem großen Pfingstjugendtreffen 1983 in dem Chrischona-Zentrum in Aidlingen (Württemberg) zu begleiten. Mehrere Jugendliche kamen auf die Idee, am Vortag der Abreise bei mir in der kleinen Einzimmerwohnung zu übernachten, damit wir am Morgen des Folgetages gemeinsam zeitig aufbrechen konnten. Es war gar nicht so einfach, diese vielen Übernachtungsgäste mit ihren Luftmatratzen in meiner kleinen Wohnung unterzubringen. Aber es funktionierte.
Gemochtes Gruppenmitglied
Für mich fühlten sich damals diese Ereignisse direkt um mich herum äußerst angenehm an. Sehr gern erinnere ich mich daran zurück. Denn in den zwei Jahren davor hatte ich relativ einsam in meiner bescheidenen Behausung gelebt. Mein Alltag bestand darin, der Arbeit und einem bescheidenen Freizeitprogramm nachzugehen. Einmal in der Woche besuchte ich abends die Blau-Kreuz-Gruppe. An einem weiteren Abend nahm ich am Training einer Feierabend-Sportgruppe von Arbeitskollegen teil, die mir anboten, mit zu trainieren, damit ich nicht allein zuhause nach Feierabend herumhing. Um auch am Wochenende einer Freizeitbetätigung nachgehen zu können, schloss ich mich auch noch samstags nachmittags der Breitensportgruppe eines Freiburger Sportvereins an, die ebenfalls ein Arbeitskollege trainierte. Zwar war das Sporttreiben nie meine Leidenschaft. Aber ich nahm diese Möglichkeiten wahr, um als seinerzeit sich einsam fühlender junger Mann nicht schwermütig oder rückfällig zu werden. Bloß nicht wieder Alkoholprobleme bekommen! Ab und zu besuchte ich an den Wochenenden meine Eltern. Damit sind meine damaligen Aktivitäten schon vollständig aufgezählt.
Aufbruch statt Anpassung
Aber alle diese Freizeitaktivitäten waren einseitig, das heißt, ich schloss mich irgendwo an, um nicht zu vereinsamen, aber ich lernte niemanden kennen, der oder die auch den Kontakt zu mir suchte. Und nun übernachtete eine Gruppe Jugendlicher in meiner Wohnung, um mit mir zu einer Freizeit aufzubrechen. Sie freuten sich offensichtlich, Gemeinschaft mit mir zu haben. Das war eine sehr erfreuliche Entwicklung, zu der ich durch den Tipp der beiden jungen Familienpflegerinnen aus der Blau-Kreuz-Gruppe gekommen war.
Chormusik und Sängerinnen
Wie schon erwähnt, engagierte ich mich gern bei allen musikalischen Aktivitäten des Jugendkreises in der Gemeinde. So schloss ich mich auch dem Jugendchor an, der moderne christliche Songs mit instrumentaler Begleitung probte. Dort bekam ich ein höchst positives Feedback: Die Chormitglieder und der Chorleiter lobten meine Bassstimme. Überhaupt waren die Chorsänger und Sängerinnen total nette junge Leute, und es machte mir großen Spaß, mit ihnen zu singen.
Was zwitschert denn da?
Apropos nette Sängerinnen: Eine von ihnen, die bei den Alt-Stimmen eines Tages ganz neu mitsang, stand direkt vor uns Bass-Sängern. Sie hieß Barbara, war die Freundin einer Chorsängerin, die sie hatte anwerben können und zog meine Aufmerksamkeit an, gegen die ich mich nicht wehren konnte. Sie gefiel mir extrem gut. Um Missverständnisse zu vermeiden: Auch die anderen Chorsängerinnen waren allesamt nicht hässlich. Jedoch diese eine, die ich meine, ließ meine Augen nicht zur Ruhe kommen. Das blieb nicht ohne Folgen; vermutlich fiel mir ab und zu das Notenblatt aus den Händen und auch manche Töne werden hin und wieder ungewohnt falsch geklungen haben. Aber was sollte ich machen? C’est la vie...
Anziehende Altstimme
Schließlich gelang es mir tatsächlich, Kontakt mit der süßen Altstimme vor mir aufzunehmen. Vielleicht auch deshalb, weil sie und ich merkten, dass wir beide eine nicht ganz so fundamental-biblisch-christliche Glaubensprägung hatten wie die meisten jungen Leute der Gemeinde. Jedenfalls verstanden wir uns auf Anhieb und konnten unsere Stimmen zu einem harmonischen Klang zusammenführen. Barbara lachte gerne über meine Sprüche, auch über die weniger frommen oder nicht immer schlauen, und ich mochte ihre herzhafte, natürliche Art und ihren ultrafesten Händedruck − ich nannte es „jemandem die Hand er-drücken". Bei dem eben geschriebenen Satz zeigt sich wieder, wie schwer man sich tun kann, in wenigen Worten Schmetterlinge im Bauch zu umschreiben − oder auszudrücken, warum genau ich mich damals schlicht und einfach verliebt habe!
Eine kleine Story: Herz erobern - aber wie?
Dazu fällt mir ein uraltes Berliner Volkslied ein, das bei einer kleinen Anpassung das weitere Geschehen zutreffend beschreibt: "Pack die Badehose ein, nimm Dein Zwitscher-Vögelein (nicht Dein kleines Schwesterlein) und dann nischt wie raus an Feldsee" (statt Wannsee …). Manchmal hilft zwei frisch verliebten jungen Menschen, sie 19, ich 25 Jahre alt, die einander ihre Verliebtheit noch nicht offenbaren konnten, das Glück des Augenblicks. Auch einem „balzenden Gockel“ wie mir, der noch mit angezogener Handbremse unterwegs war. Die zu lösende Herausforderung: Beide Turteltäubchen würden sich gerne mehr berühren, trauen sich aber noch nicht so richtig. Die Lösung: Wie gut, dass der Jugendkreis auf die Idee kam, an einem sehr heißen Tag im Sommer 1983 dem Glutofen Freiburg zu entfliehen und an den hoch gelegenen Feldsee im Schwarzwald zu fahren, um dort in dem erfrischenden Wasser eines Natursees zu schwimmen. Meine ausgeguckte Chorsängerin Barbara und ich fuhren auch gerne mit. Nach dem Schwimmen legten wir uns − nicht ganz zufällig − etwas abgelegen von den anderen Ausflüglern in die Sonne zum Trocknen. Irgendwann brannte die Sonne sehr intensiv auf unsere Haut und es drohte Sonnenbrand! Deshalb mussten wir uns, ohne Zeit zu verlieren, schnellstens mit Sonnenöl einreiben. Bekanntlich kann man sich überall selbst damit einreiben, nur nicht so gut am Rücken, dazu nimmt man am besten die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch.
Hilfsbereit beim Sonnenbaden
Barbara und ich verhielten uns nun bei dieser Gelegenheit ausgesprochen hilfsbereit zueinander und nahmen es sehr genau mit dem Öl-Einreiben. Jedenfalls kann ich mich ganz genau daran erinnern, dass wir dank dieser mehr als vorbildlich durchgeführten Vorbeugemaßnahmen beide nach dem Badeausflug nicht die Spur eines Sonnenbrandes bekamen! Allerdings erinnere ich mich auch daran, dass unsere umständehalber veranlassten Ölsalbungen zunehmend zu Streicheleinheiten wurden. Schließlich war für unsere Umgebung unübersehbar geworden, dass ein neues Pärchen zueinandergefunden hatte.
Erfahrungen als Liebespaar
In der ersten Zeit unserer Liebschaft schlief meine Freundin stets zu Hause. Einmal kam es anders und sie blieb bei mir in der Wohnung über Nacht. Der Entschluss dazu muss sich wohl spontan ereignet haben.
Schwiegervater - Ermahnung
Dies brachte mir aber am anderen Morgen sogleich eine Zurechtweisung meines späteren Schwiegervaters ein. Zusammen mit seiner Frau ärgerte er sich darüber, dass sich ihr einziges Kind, damals noch nicht zwanzig Jahre alt, nicht zuvor abgemeldet hatte und einfach bei mir die Nacht verbrachte. Später hatte Barbara zeitweise drei Wohnsitze, wo sie nächtigte. Bei ihren Eltern, ab und zu bei mir und ansonsten ihr Studentenzimmer, an ihrem Studienort in Kehl, wo sie an der Hochschule für öffentliche Verwaltung zwei Jahre studierte.
Verlobt – verheiratet
Nachdem sie ihr Studium im Jahre 1986 abgeschlossen und wir uns inzwischen verlobt hatten, wohnte sie häufiger bei mir. Dieser Zustand der wilden Ehe dauerte jedoch nur einige Monate. Im Juni 1987 heirateten wir, und im Sommer zogen wir von Freiburg nach Donaueschingen um. Erst dort gründeten meine Frau und ich unseren ersten gemeinsamen Hausstand, darüber erzähle ich in einem nachfolgenden Kapitel.

11.2 Kleine Story: Verloben - aber wie? (1986)
Eine kleine Story: Zwei Heiratsanträge
Als ich etwa zwei Jahre mit Barbara zusammen war, kam ich auf die Idee, die Beziehung sozusagen einzutüten; seriös ausgedrückt, wollte ich Barbara fragen, ob sie mich heiraten will. Nicht etwa nur deshalb, weil ich wusste, dass andere Mütter auch schöne Söhne hatten, die zufällig auch „alle“ in Kehl mit meiner Freundin studierten. Und auch nicht, weil ich 1985 den vorletzten Geburtstag unter dreißig feierte, (meine Freundin war sechs Jahre jünger als ich). Nein − ich war einfach nach zwei Jahren immer noch verliebt und dachte, die jahrelange Zeit unseres Zusammenseins könnte Grund genug sein, um meiner Freundin bei passender Gelegenheit einen Heiratsantrag "ins Ohr flüstern" zu dürfen.
Angst vor eigener Courage?
Zugegeben: Manche Gelegenheiten dazu habe ich sausen lassen, wahrscheinlich weil das Wetter gerade schlecht war, ich vielleicht den Schnupfen hatte oder am Ende Angst vor der eigenen Courage. Aber bei einem Spaziergang auf dem Freiburger Schlossberg war es dann so weit und der spannende Augenblick war gekommen. Nein, ich fiel nicht auf die Knie, und besonders romantisch habe ich vermutlich auch nicht geklungen. Aber das hätte Barbara wohl auch eher irritiert, denn ich war nicht so der Süßholzraspler-Typ.
Katze aus dem Sack lassen
Ich ließ schlicht und einfach die Katze aus dem Sack, das heißt, ich fragte meine Lebensgefährtin, ob sie es sich „eventuell oder vielleicht“ vorstellen könnte, mich zu heiraten. Wahrscheinlich fragte ich zu ungenau oder doch etwas zu unromantisch. Die Folge war, dass ich an diesem Tag meinen Goldschatz noch nicht überzeugen konnte. Sie freute sich zwar über mein Anliegen, bat aber um Bedenkzeit. Meine Fast-Verlobte ließ mich wissen, sie wolle zuerst einmal ihr Studium abschließen und schlug vor, wir könnten danach gerne darauf zurückkommen. Aufgeschoben war also nicht aufgehoben, und meine Hartnäckigkeit zahlte sich am Ende aus.
Bingo!
Denn ein Jahr später, 1986, Barbara hatte gerade ihr Diplom in der Tasche, nahm ich erneut einen Anlauf und: Bingo! − jetzt hatte ich Erfolg, und sie sagte JA! Im Juni 1987 fand dann die Hochzeit statt, sechs Monate vor meinem dreißigsten Geburtstag.

11.3 Eheliches Wohnen (ab 1987)
1987: Donaueschingen - erste gemeinsame Wohnung
Nach der Hochzeit von Barbara und mir zogen wir von Freiburg nach Donaueschingen um. Es genügte ein kleiner Transporter, den wir uns für den Umzug mieteten, denn viele Möbel gab es (noch) nicht zu transportieren. Die meisten Möbel aus meiner letzten Junggesellenwohnung, darunter das alte Schlafzimmer meiner Großeltern, holte die Freiburger Heilsarmee ab, die Gebrauchtmöbel sammelte, um sie an Bedürftige weitergeben zu können.
Abschied und Zukunft
Dem Umzug in die erste gemeinsame eheliche Wohnung gingen lebensverändernde familiäre Geschehnisse voraus, ein trauriges und ein schönes, innerhalb eines halben Jahres. Wie das Leben manchmal spielt.
Schön und traurig
Der traurige Teil der Geschichte war, dass Barbaras Großmutter, die Mutter meiner künftigen Schwiegermutter, im Dezember 1986 im Alter von achtzig Jahren in Donaueschingen verstarb. Das war auch deshalb besonders traurig, weil sie sich sehr auf die geplante Hochzeit ihres einzigen Enkelkindes im Juni 1987 gefreut hatte, bei der sie nun nicht mitfeiern konnte. Der erfreuliche Teil der Geschichte:
Bereit für Neues
Für meine Frau Barbara und mich taten sich als frisch verheiratetes Ehepaar Perspektiven unseres gemeinsamen Lebensweges auf, die insbesondere auch unsere berufliche Zukunft nachhaltig beeinflussen sollten. Barbara schloss in jenem Jahr ihr Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl ab, erwischte dann jedoch einen nicht als glücklich erlebten Start in das Berufsleben im Sozialamt des Landratsamtes Breisgau Hochschwarzwald in Freiburg. Deshalb war sie mehr als bereit für eine baldige berufliche Veränderung, also für einen neuen Job im gehobenen Verwaltungsdienst. Ich war seit 1979 im mittleren Verwaltungsdienst als Stadtsekretär im Technischen Rathaus der Freiburger Stadtverwaltung beschäftigt. Auch ich war offen für berufliche Veränderungen, da der Job im städtischen Bauordnungsamt mir ebenfalls keine Zukunftsaussichten bot.
Angebot der Schwiegermutter
Nachdem mir die Wohnung in der Doppelhaus-Hälfte im Freiburger Stadtteil Mooswald vier Jahre günstiges Obdach geboten hatte, mein Untermieter aus-, und meine künftige Ehefrau eingezogen war, unterbreitete uns meine künftige Schwiegermutter zum Ende des Jahres 1986 ein folgenreiches Angebot. Nach unserer Hochzeit im Juni 1987 könnten wir unsere Zelte in Freiburg ab- und in Donaueschingen wieder aufbauen. Der Hintergrund war, dass durch den Tod von Barbaras Großmutter das Einfamilienwohnhaus leer stand und wir es nun mieten konnten. Die Schwiegereltern beabsichtigten, sich dort einen Zweitwohnsitz einzurichten.
Bereit für Umzug?
Ich empfand diese Offerte meiner künftigen Schwiegermutter als eine gute Option und hatte Lust auf Neues. Allerdings beschäftigte mich schon der Gedanke, ob es gut gehen würde, wenn meine Frau und ich an Wochenenden und in Ferienzeiten in einer Hausgemeinschaft mit den Schwiegereltern wohnen. Außerdem bewohnte ich zu diesem Zeitpunkt schon acht Jahre eine eigene Wohnung in Freiburg. Aus der elterlichen Wohnung war ich 1979 in jungen Jahren ausgezogen, weil mir ein unabhängiges Leben wichtig war.
Umzug – alles neu
Meiner Frau fiel es zunächst schwer, sich einen Wegzug aus ihrer Heimatstadt Freiburg vorzustellen. Aber schließlich öffnete auch sie sich für einen Umzug in den Schwarzwald-Baar-Kreis. Allerdings erst, nachdem das Landratsamt eine attraktive Stelle im Baurechtsamt Villingen-Schwenningen ausschrieb und sie sich erfolgreich bewarb. Für sie günstig war auch die Tatsache, dass ihre neue Dienststelle sich nicht im Landratsamt VS-Villingen, sondern in dessen Außenstelle Donaueschingen befand.
Ein Jahr Bahn-Pendler
Für mich ergab sich zum Zeitpunkt unseres Umzugs erst einmal keine Möglichkeit, eine berufliche Zukunft in einer Behörde im Raum Donaueschingen zu finden. Deshalb pendelte ich ein Jahr zwischen Donaueschingen und Freiburg. Mit der Bahn war das jedoch gut machbar, wenngleich die Fahrt morgens zwei und abends etwa eineinhalb Stunden dauerte. Zu meinem Glück fand ich dann ab Juni 1988 auch eine neue Arbeitsstelle im Wasserwirtschaftsamt in Donaueschingen, das damals eine Sonderbehörde des Landes Baden-Württemberg war. Der neue Arbeitsplatz war aber nicht nur deshalb besonders interessant, weil ich wohnortnah arbeiten konnte, sondern er bot, wie sich herausstellte, auch sehr gute berufliche Zukunftsperspektiven, (siehe das Kapitel Beruf oder Berufung).
Guter neuer Wohnort
Für unsere Kinder, die 1992 und 1995 geboren wurden, boten die großzügigen Wohnverhältnisse in Donaueschingen ein schönes Umfeld für ihr Aufwachsen, insbesondere auch die etwa tausend Quadratmeter große Gartenfläche vor dem Hause. Überhaupt lebten wir als Familie gerne in dieser kleinen Stadt auf der Baar. Sie war überschaubar, bot aber dennoch die vielseitigen Möglichkeiten einer städtischen Infrastruktur. Auch waren der Kindergarten, die Schulen und verschiedene Einkaufsmöglichkeiten fußläufig erreichbar.
Gute Entwicklung
Mit dem Umzug nach Donaueschingen war für Barbara und mich zwar der Abschied von der geliebten Heimat- und Großstadt Freiburg verbunden, wo wir geboren und aufgewachsen waren. Was mich betraf, bot der neue Wohnort in ländlich geprägter Umgebung der Baar, später im Schwarzwald, dennoch in zweierlei Hinsicht große Vorteile: Erstens waren, bzw. sind, die klimatischen Verhältnisse für mich − besonders mit zunehmenden Alter − wesentlich vorteilhafter als das im Sommer glühende Bratpfannen-Klima in der Breisgau-Metropole. Und zweitens bekam ich unvorhersehbare, supergute berufliche Entwicklungsmöglichkeiten geboten, viel bessere als die in meiner alten Heimat (siehe dazu umfangreiche Berichte im Kapitel Beruf und Berufung).
Abschiedsschmerz
Kleinere Nachteile gab es natürlich auch, die übrigens meine ehemaligen Arbeitskollegen im Freiburger Technischen Rathaus bei meiner Verabschiedung 1987 mit ihren Abschiedsgeschenken thematisierten. Mir wurden beispielsweise warme Unterwäsche, Socken und eine kleine - symbolische - Schneeschaufel mit auf den Weg gegeben. Damit wollten sie mir helfen, den längeren und schneereicheren Winter auf der Baar (bei Freiburgern „Badisch Sibirien“ genannt), besser überstand. Dieser Einschätzung konnte ich nicht widersprechen, ebenso wie der damit verbundenen Tatsache, dass der Frühling in der Region Schwarzwald-Baar wesentlich später ankommt als in Freiburg.
Klimatischer "Himmel" im Höllental
Während ich durch das berufliche Pendeln für ein Jahr zwischen 1987 und 1988 an den Werktagen nach Freiburg pendelte, waren die klimatischen Unterschiede in den Hochsommermonaten ganz real spürbar. In den Monaten Juli bis September stieg ich manchmal bei tropischer Gewitterschwüle am Freiburger Hauptbahnhof in den aufgeheizten Zug und schwitzte während der Fahrt selbst bei weit geöffneten Fenstern. Die Erlösung kam dann beim Aufstieg des Zuges im Höllental, ungefähr ab der Bahnstation Himmelreich. Von dort an konnte man die sich himmlisch anfühlende Abkühlung der Luft genießen.
Letzter Umzug (2002)
Von 600 auf 900 Meter ü.d.M.
Mein letzter Umzug in ein Wohnhaus in die Schwarzwaldgemeinde ergab sich im Jahre 2002 - wie schon erwähnt - aus beruflichen Gründen.
Näheres dazu erzähle ich im nächsten Unterkapitel...

11.4 Story: Grundstücksuche im Schwarzwalddorf (2002)
Grundstückssuche – Erlebnisse
Nach der überraschend schon im ersten Wahlgang gewonnenen Bürgermeisterwahl Anfang März 2002 galt es für mich − möglichst vor dem Antritt des neuen Jobs als Rathaus-Chef am 1. Juni 2002 − die Wohnverhältnisse zu klären. Meine Frau und ich verschafften uns zunächst einen Überblick über die Vermietungs- und Verkaufsangebote von Wohnhäusern im Schwarzwalddorf. Die stellten sich aber als sehr überschaubar heraus. Wohnhäuser zur Miete fanden wir überhaupt keine. Für den Kauf von Häusern gab es zwar einige Angebote, letztlich kamen aus verschiedenen Gründen keines der Gebäude für uns in Frage. Deshalb suchten wir nach einem geeigneten Baugrundstück für einen Neubau. Zunächst dachten wir an ein Fertighaus, um einen baldigen Umzug zu ermöglichen.
Wo baut es sich am besten?
Also fuhren wir eines späteren Nachmittags nach Feierabend mit den Kindern von Donaueschingen aus in die Schwarzwaldgemeinde an einen Platz im oberen Teil des Dorfes („Sommerberg“). Ich wusste, dass dort noch Grundstücke zum Verkauf standen. Dort angekommen, stapften wir vier neugierig über ein an eine Straßenkurve angrenzendes Gelände, das sehr schön gelegen war. Während wir die Umgebung erkundeten, hielt ein Auto am Straßenrand. Die Fahrerin erzählte uns, wie sehr sie sich freue, dass ich die Wahl als Bürgermeister gewonnen hätte und wir bald in das Dorf zögen. Darauf fuhr sie weiter und winkte uns beim Wegfahren zu.
Bauunternehmer bemerkt uns
Als meine Frau und ich gerade wieder dabei waren, unsere Fantasien schweifen zu lassen, was für ein Haus wir dort vielleicht bauen könnten, da geschah etwas, was man nur in einem Dorf erlebt. Es fuhr ein schwarzer SUV-Geländewagen an dem Baugelände vorbei. Der Fahrer − Geschäftsführer einer großen Baufirma am Ort − bemerkte uns, legte sogleich den Rückwärtsgang ein und parkte sein Fahrzeug am Straßenrand. Er stieg aus und kam auf uns zu, um uns zu fragen, ob wir auf der Suche nach einem Baugrundstück seien. Als wir seine Vermutung bestätigten, bot er an, uns ein freies Grundstück hinter einem Gewerbegebiet auf der anderen Seite des Dorfes vorzustellen, auf dem seine Firma preisgünstig und schlüsselfertig Doppel- und Einfamilienhäuser baue. Das fanden wir interessant, weil wir es - wie schon erwähnt - eilig hatten, unsere neuen Wohnverhältnisse hier zu klären. Außerdem klang das Wort „preisgünstig“ in unseren Ohren gut, als künftige Bauherren, die ihren Neubau zu hundert Prozent finanzieren mussten, weil meine zwei Bürgermeisterwahlkämpfe eine Rücklagenbildung für einen Hausbau unmöglich gemacht hatten.
Ruckzuck Entscheidung
So fuhren wir zusammen mit dem Bauunternehmer an sein noch nicht bebautes Grundstück. Die etwas abgelegene Lage sagte uns ebenso zu wie auch das Angebot für den Bau einer Doppelhaushälfte, welches er uns in seinem nahegelegenen Büro gleich nach der Besichtigung unterbreitete. Zunächst entschieden wir uns noch am selben Tag für die Realisierung dieses Angebotes. Nachdem sich meine Schwiegereltern kurz darauf dazu entschieden haben, eine Einliegerwohnung neben unserem Wohnhaus als ihren Zweitwohnsitz bauen zu wollen, erfolgte in Windeseile eine entsprechende Umplanung. Aus der ursprünglich geplanten Doppelhaushälfte wurde ein Dreigenerationenhaus, das wir nach (nur) sechsmonatiger Bauzeit - kurz vor Weihnachten des Jahres 2002 - beziehen konnten.

Siehe Unterkapitel

12.1 Schwangerschaften und Geburten (1992 / 1995)
Gemeinsamer Kinderwunsch
Nach dem Umzug von Freiburg nach Donaueschingen galt es für uns zunächst, in unserem neuen Wohnstandort und an unseren neuen Arbeitsplätzen anzukommen. Ich musste jedoch noch ein Jahr lang täglich von Donaueschingen nach Freiburg und zurück pendeln. 1988 konnte auch ich einen Job in Donaueschingen antreten. Wir lebten uns gut ein in Barbaras großelterlichem Haus und wir lernten neue Freunde kennen. 1991 reifte aber dann der Entschluss, Eltern zu werden, und so kam es auch. 1992 kam unser Sohn Lukas auf die Welt, und drei Jahre später wurde unsere Tochter Sarah geboren.
Schwangerschaft:
Kleine Story: Stechmückenangriff
Ich erinnere mich lebhaft an einen Schreckmoment, als meine Frau hochschwanger mit unserem ersten Kind war. Wir spazierten einen Waldweg entlang, es war Sommer, da kreisten zunächst ein paar Stechmücken um uns, insbesondere um meine Frau herum. Plötzlich griff ein großer Stechmücken-Schwarm meine Frau an. Es schienen tausende zu sein, die bedrohlich um sie herum kreisten. Wir hatten alle Mühe, diesen Angriff wirksam abzuwehren, und mussten im Laufschritt geradezu aus dem Wald flüchten.
Wunder der Geburt
Die Geburten meiner beiden Kinder waren ganz besondere Ereignisse in meinem Leben, die ich nie vergessen werde. Da ich meine Frau bei den jeweiligen Entbindungen in den Kreißsaal begleitete, war es für mich schon sehr beeindruckend, welchen Herausforderungen die Mütter bei dem Geburtsvorgang ausgesetzt sind.
Schön dabei zu sein
Zum anderen war es aber auch sehr schön, dabei gewesen zu sein, wenn sich das Wunder vollzieht, dass man schließlich von einen auf den anderen Augenblick ein neues Lebewesen im Arm hält. Ich war jedenfalls froh darüber, den ersten Augenblick, den Beginn des Lebens meiner Kinder mitzuerleben. Mein Sohn Lukas und meine Tochter Sarah kamen in der Klinik in Donaueschingen zur Welt, die im Gegensatz zu heute in den Neunzigerjahren noch eine Entbindungsstation hatte.
Geburt des ersten Kindes miterleben
Die Geburt unseres ersten Kindes erfolgte nicht zu dem berechneten Geburtstermin, sondern ereignete sich etwas später. Als bei Barbara die ersten Wehen-Signale die bevorstehende Geburt ankündigten, fuhren wir - als unerfahrene werdende Eltern - sogleich gegen Abend in die Klinik. Es vergingen dann aber noch einige Stunden bis zur Geburt.
Treppensteigen als Geburtshilfe
Zwischendurch schickte das Klinikpersonal meine Frau und mich ins Treppenhaus. Unser Auftrag: Mehrmals die Treppen in alle Stockwerke hinauf und hinunter gehen, um damit den Geburtsvorgang anzuregen. Der Geburtstag meines Sohnes Lukas im August 1992 war ein besonders schwül-warmer Tag und selbst nachts schwitzte man - schon ohne körperliche Anstrengungen -. Unsere gemeinsamen Treppenhaus-Auf- und Abstiege sorgten daher bei meiner hochschwangeren Frau und bei mir für zusätzliche Schweißtropfen. Insbesondere bei der Geburt selbst wirkte sich die Hitze für Barbara nicht gerade angenehm aus. Passend zu den Temperaturverhältnissen hörte man durch das geöffnete Fenster heiße Musik von einer benachbarten Tankstelle, hinter der die Eröffnung eines Fahrradladens gefeiert wurde.
Kreißsaal-Verbannung
Nach vielen Stunden des Wartens wurde ich zwischendurch, während den - wehenfördernden - Behandlungen bei meiner Frau, vom Klinik-Personal kurzerhand aus dem Kreißsaal geschickt. Nach einiger Zeit war es aber dann so weit. Das Geburtsereignis kündigte sich an. Bevor ich jedoch wieder zurück zu meiner Frau in den Kreißsaal gerufen wurde, machte ich in meiner „Verbannung“ auf dem Klinik-Flur eine irritierende Entdeckung:
Eine kleine Story: Klinikflurgeschehnisse
Während des langweiligen Wartens auf den großen Klinik-Fluren freute ich mich während meiner Verbannung aus dem Kreißsaal über alle Ereignisse, die sich optisch einfangen ließen, damit das Warten kurzweiliger wurde. So schaute ich aufmerksam den Betten nach, die an mir vorbei geschoben wurden (obwohl man ja eigentlich diskret wegschauen sollte). Auf diesen lagen meistens Frauen, bei denen das Geburtsereignis kurz bevorstand, oder bei denen die Entbindung bereits erfolgte. Mit der Zeit fiel mir aber auf, dass meine Augen ermüdeten, denn es war schon spät und das Geschehen rund um die Geburt unseres ersten Kindes war auch für mich mit der Zeit anstrengend.
Schnurrbart?
Diesen Umstand machte ich dann auch spontan dafür verantwortlich, als ich meinte, auf dem zuletzt an mir vorbei geschobenen Bett weder eine Mutter noch einen Säugling, sondern ein Gesicht mit Schnauzer gesehen zu haben. Das empfand ich als höchst ungewöhnlich, und ich konnte es nicht lassen, diese Irritation sogleich aufzuklären. So folgte ich unauffällig diesem Bett-Transport, um Klarheit zu schaffen. Und tatsächlich: Auf dem Bett lag ein Mann mit einem dicht gewachsenen Oberlippenbart! Ihn hatte es offensichtlich umgehauen, während er seiner Frau bei der Geburt seines Kindes beistehen wollte. Kaum hatte ich nun diese Irritation aufklären können, wurde ich wieder in den Kreißsaal gerufen.
Sohn geboren (1992)! Erste Eindrücke
Als die Hebamme mir nach der Geburt den gerade entbundenen Säugling in die Arme legte, war das ein besonders beglückender und aufregender Moment. Ich durfte ihn nach dem Waschen abtrocknen. Das Schreien des Babys klang eigenartig.
Musikalisches Babyschreien
Mein frisch geborener Sohn schrie zwar für seine winzige Größe bemerkenswert laut. Dafür schloss er zwischendurch seine Schrei-Folgen mit abrundenden, fast schon harmonisierenden Klangfarben ab. Mein Sohnemann wechselte sozusagen vom Fortissimo ins Piano, bevor er wieder mit Vollgas − mit hochrotem Köpfchen − neu durchstartete. Das klang in meinen Musikerohren ganz anders als bei den anderen kleinen Schreihälsen nebenan in ihren Bettchen, die ihre Verlautbarungen eher ohne Klangvarianten zum Besten gaben. So hatte ich erste väterliche Erkenntnisgewinne hinsichtlich bestimmter Alleinstellungsmerkmale, die mir mein neugeborener Sohn kurz nach seiner Geburt präsentierte.
Ähnlichkeiten?
Beim Vergleichen unseres Babys mit den anderen Neugeborenen fiel mir spontan auf, dass mein Sohn mit Abstand das schönste, und süßeste Babys auf dieser Entbindungsstation war. Ob dies nun daran lag, dass er im Gesichtsausdruck mehr mir oder mehr seiner Mutter ähnelte, das blieb erst einmal ungeklärt. Darüber tauschten sich dann später die Großeltern, Verwandten und Freunde aus, nachdem wir ihnen mit einem sehr gelungenen Hochglanz-Baby-Foto auf einer Karte die Geburt unseres Kindes mitgeteilt hatten. Meine Schwiegereltern, die in Donaueschingen in ihrer Zweitwohnung weilten, beglückte ich noch in der Geburtsnacht mit einigen Polaroidfotos, die ich nach der Geburt von meinem Söhnchen machte.
Tochter wird geboren (1995)
Meine Tochter Sarah wurde im November 1995 geboren. Sie war auch ein zuckersüßes Baby. Auch von ihr versuchte ich, direkt nach der Geburt Polaroid-Fotos zu machen. Im Gegensatz zu ihrem Bruder, der nach seiner Geburt ab und zu eine Schreipause einlegte, schrie meine Tochter mit langer Ausdauer volles Rohr und ununterbrochen.
Probleme bei Schnappschüssen
Schade dabei war nur, dass sich ein schreiendes Baby mit rotglühender Hautfarbe und weit aufgesperrtem Schrei-Mundwerk, eingekniffenen Äugchen und Runzel-Näschen überhaupt nicht für schöne Überraschungsfotos eignete. So fertigte ich zunächst ein Foto vom schreienden Baby an. Als dann aber die Hebamme auf die Idee kam, unserer neugeborenen Tochter ein Schnuller-Fläschchen mit Tee anzubieten, saugte diese sofort daran fest und war danach wesentlich fotogener aufgelegt. Ihr Alleinstellungsmerkmal lernte ich somit früh kennen: Sie machte ihrem Vater und ihrer neuen Umwelt gegenüber gleich nach ihrer Geburt klar, bei ihr gebe es überhaupt nichts umsonst, und sie verstehe es, ihre Bedürfnisse zielorientiert einzufordern.
Eine kleine Story dazu: Earth Song
Natürlich machte ich mir als besorgter Vater Gedanken, warum mein süßes, neu angekommenes Töchterchen so laut in unserer schönen Welt aufschlug. Eine Erklärung, die ich spontan parat hatte: Vielleicht hatte ihr die Premiere von Michael Jacksons neuem Earth Song nicht gefallen, die wenige Stunden vor ihrer Geburt am Samstag, dem 4. November 1995 um etwa 22 Uhr im Fernsehen bei der Sendung "Wetten dass?" zu sehen war, (für sie nur zu hören). Kurz vor seinem Auftritt meldeten sich bei Barbara allerdings auch schon erste Wehen-Signale, welche die bald bevorstehende Geburt unserer Tochter ankündigten.
Michael Jackson: Earth Song nicht verpassen!
Der Zeitpunkt war aber insofern etwas ungünstig, als Michael Jackson sich gerade fertigmachte, um seinen neuen Earth Song zu präsentieren. Da ich schon einmal das Geschehen vor einer Geburt miterlebt hatte, war mir klar: Für Panik wegen der ersten Geburtssignale bei Barbara gab es keinen Grund. Ich hielt es daher für vertretbar, meine Frau zu überreden, noch die Aufführung des schönen „Earth Songs“ abzuwarten, ehe wir zur Klinik fuhren. Sie konnte sich, − erfahren wie sie war −, damit einverstanden erklären und verfolgte mit mir zunächst das unvergessene Michael Jackson-Show-Spektakel, bevor wir gleich danach in die Klinik fuhren. Dort kamen wir auch noch rechtzeitig vor der Geburt an − und durften uns nach einigen Stunden über die Ankunft unserer ganz besonderen Tochter freuen!

12.2 Vater wird auch Hausmann (ab 1992)
Elternschaft: Arbeitsteilung
Schon während der Schwangerschaft mit unserem ersten Kind im Sommer 1992 besprachen und beschlossen Barbara und ich grundsätzlich die Arbeitseinteilung. So zogen wir diesen Plan auch konsequent durch.
Vater halbtags zuhause
Beruflich und einkommenstechnisch war meine Frau in einer besseren Position als ich. Ihre Bezüge als Beamtin des gehobenen Verwaltungsdienstes lagen zum Zeitpunkt der Geburt unseres ersten Kindes vier, später drei Besoldungsgruppen über den meinigen. Deshalb machte es Sinn, dass sie nach der Mutterschutzzeit in den Vollzeitdienst zurückkehrte, während ich auf die Hälfte eines Vollzeitdienstes reduzierte. Für die andere Hälfte eines Arbeitstages engagierten wir eine Tagesmutter, die unseren kleinen Sohn betreute (siehe dazu auch die Story im nachfolgenden Unterkapitel "Glücksfall Tagesmutter").
Teilzeit-Hausmann
Das Führen eines eigenen Haushaltes schon einige Jahre vor der Ehe mit Barbara führte dazu, dass der Hausmannsjob für mich kein Neuland war. In die Babypflege musste ich mich allerdings einarbeiten und Erfahrungen sammeln. Doch auch das funktionierte, wenngleich einige Herausforderung zu bewältigen waren. Beispielsweise den Alltag im Haushalt und als Säuglingspfleger mit meinem Teilzeit-Job im Landratsamt unter einen Hut zu bringen. Dabei kam mir aber entgegen, dass ich es, wie schon beschrieben, gewohnt war, in meinem Leben immer wieder improvisieren zu müssen.
Kinder-Krabbelkreise
Ich suchte auch Anschluss an einen sogenannten Krabbelkreis, in dem sich vor allem Mütter, aber auch vereinzelt Väter mit ihren Säuglingen und Kleinkindern trafen und wo man Erfahrungen austauschte. Das war sowohl hilfreich als auch unterhaltsam.
Zu viel Baby-Blues
Allerdings war das Schwerpunktthema Säuglingspflege, bestehend aus einem ganz großen Blumenstrauß von Einzelaspekten, im ersten Mutter-Kind-Kreis, dem ich mich in der katholischen Kirchengemeinde in Donaueschingen zunächst anschloss, für meinen Geschmack zu überfrachtet. Diese Mütter − nach meinem Eindruck alles einheimische Gewächse aus Donaueschingen − sprachen fast nur über Themen wie Erfahrungen beim Stillen (da konnte ich natürlich nicht so gut mitsprechen), welche Windeln die besten sind, wer der beste Kinderarzt und wer die beste Hebamme ist, wie schreiende Säuglinge am besten in den Schlaf begleitet werden können, ob Säuglingsimpfungen eventuell gefährlich sind und so weiter. Auch hatte ich unterschwellig das Gefühl, als Mann unter den Müttern zwar stets freundlich begrüßt zu werden, aber doch mehr geduldet als willkommen zu sein.
Neuer Treff: Zugezogene Eltern
Als ich mitbekam, dass es in der evangelischen Gemeinde ebenfalls einen Krabbelkreis gab, in dem sich aber vor allem die zugezogenen Eltern trafen, zog ich mit meinem Söhnchen zu diesem wöchentlichen Treff um. In dieser Umgebung fühlte ich mich wesentlich wohler als in der klassischen Mutter-Kind-Krabbelgruppe. In dem neuen Treff wirkten die Mütter und die wenigen Väter wesentlich zugänglicher und lockerer auf mich und sprachen auch über ganz normale Themen. Außerdem wurde öfter gelacht. Manchmal organisierten wir kleine Ausflüge.
Herausforderungen mit Kleinkind
Auch wenn ich − wie schon erwähnt − durch meine Zeit als Junggeselle mit eigener Haushaltsführung bereits Erfahrungen als Hausmann gesammelt hatte, gab es nach der Geburt unseres ersten Kindes neben den Besonderheiten der Säuglingspflege auch ganz alltägliche Herausforderungen zu bewältigen.
Einkaufen während Schreipausen
So musste ich oft einkaufen gehen. Diese Einkäufe legte ich morgens stets in das Zeit-Fenster, in dem mein Söhnchen schlief. Nachdem er von mir mit Nahrung versorgt wurde, (mit Schoppen oder Babynahrung, so viel er bereit war aufzunehmen oder so viel in ihn hineinpasste), und ich stets dafür sorgte, dass er sein ordnungsgemäßes Bäuerchen (Aufstoßen) hinter sich brachte, ihn außerdem sorgfältig gewickelt hatte, fiel er stets in einen längeren Tiefschlaf. Berechnend wie ich war, nutzte ich diese schweigende Zeit meines zu versorgenden Babys, um mit ihm im Kinderwagen einen längeren Spaziergang zu unternehmen, den ich mit dem Einkauf verband. Nachdem diese Hausmann-Strategie gut funktionierte, war ich auch etwas stolz auf mich und auf meinen süßen Nachwuchs, dass wir beide unseren Alltag so gut gewuppt bekamen.
Wenn Baby zu früh erwacht
Winzig kleine Pausen in dieser positiven Vater-Kind-Beziehung stellten sich jedoch dann ein, wenn mein Söhnchen einmal unverhofft und unplanmäßig zwischendurch erwachte und in höchst ungünstigen Situationen anfing zu schreien. So sanft sich das Wesen meines Kindes sonst anfühlte, so brutal laut wurde es, wenn es schrie! Nirgends sonst hatte ich je ein Baby so laut schreien hören (bis heute nicht)! Ganz blöd und höchst unangenehm fühlte sich diese Situation an, wenn mein Baby gerade während des Einkaufens im Supermarkt aufwachte.
Eine kleine Story dazu: Schreikind beim Einkaufen
Wie ich schon bei meiner Geschichte der unharmonischen Suche nach einem geeigneten Beruf in den Siebzigerjahren erzählte, schrieb meine Frau Barbara wunderbare Gedichte über solche kuriosen Vorgänge. Ebenso wie sie meine Geschichten als stolpernder Lehrling gekonnt in witzige Verse reimte, so verarbeitete sie in einem Gedicht auch die im Nachhinein - kurios - zu lesende Episode, wie ich einmal mit meinem Söhnchen im Kinderwagen morgens einkaufen ging. Speziell fokussiert sich der Inhalt ihrer Verse natürlich auf die besondere Begebenheit, als mein Baby beim Eintritt in einen Supermarkt noch fest schlief, dann aber durch ein lautes Geräusch plötzlich erwachte und aus voller (kleiner) Kehle anfing zu schreien. Schön zu lesen, wie sie supertreffend meine Befindlichkeit in einer solchen Situation als Vater beschreibt, die sicher viele Eltern kennen, und wie meine damalige Stresstoleranz aussah − vor allem während des Wartens an der Kassen-Schlange. Viel Spaß beim Lesen!
Einkauf mit Baby
Mit dem Baby Einkauf machen brachte Papa große Not;
heute kann er drüber lachen, damals war er schamesrot.
Er befand sich im Geschäfte mit dem Baby, schlafend leis’,
im Einkaufszettel stand, dass Säfte nötig wär’n und zudem Reis.
Weiter ging’s mit Götterspeise, und es war des Vaters Ziel,
mit dem Säugling, schlafend leise, einzukaufen richtig viel.
Es war am Dosenobst-Regale, da fiel hinab aus seinem Fach
ein Kirschenglas, und das Fatale: Das Kind erwachte von dem Krach!
Da begann es, das Theater, aus schlafend leis’ wurd’ wach und laut,
und es ward dem lieben Vater gar nicht wohl in seiner Haut.
Das Weinen schwoll zu wildem Brüllen, dem armen Papa schwand der Mut,
sein Innerstes begann zu füllen mit Sorge sich – doch auch mit Wut.
Mit dem Schreihals Richtung Kasse stürzte er verzweiflungsblind,
indes begann der Leute Masse zu sammeln sich um’s laute Kind.
„Armes Kindchen, ist Dir bange ohne Mutti so allein?“
Die Fragen aus der Kassenschlange stürzten auf die beiden ein.
Frischerwachte Muttertriebe sorgten für den besten Rat:
„Dem Baby fehlt ein bisschen Liebe, vielleicht hilft auch ein heißes Bad.“
„Nein, es möchte doch nur trinken...“, setzte eine Dame fort,
„Es ist nur, weil die Windeln stinken“, fiel die nächste ihr ins Wort.
Ein Streit begann ob Babys Wohle, dasselbe unbeeindruckt schrie,
der Papa, wie auf heißer Kohle, schwitzte, stressgeplagt wie nie!
Endlich konnte er bezahlen an der Kasse; dies war so
auch das Ende aller Qualen: Er griff den Säugling und entfloh!
Dem bösen Grauen so entronnen schlief alsdann wie zum Beweis
das Baby selig ein voll Wonnen: Aus wach und laut wurd’ schlafend leis’.
Aus dem Laden drang dagegen noch manches laute Wort im Streit:
Man schien die Diskussion zu pflegen, weshalb ein Kind beim Einkauf schreit …
(© Barbara Löffler)

12.3 Story: Glücksfall Tagesmutter (1993)
Story zu: Tagesmutter-Suche
Wenn Eltern eine geeignete Tagesmutter für ihre Kinder suchen, dann gibt es dabei manchmal spannendes zu erleben. So war dies auch bei uns der Fall. Nach einem Inserat in dem Anzeigenteil des Amtsblattes in Donaueschingen - direkt nach der Geburt unseres (erstgeborenen) Sohnes - meldete sich kurioserweise eine Interessentin, die nicht sehr weit weg von unserem Haus entfernt wohnte. Genauer gesagt: Es handelte sich um unsere Nachbarin. Dieser Umstand zeigt, dass wir bis dahin nicht gerade ein besonders enges nachbarschaftliches Verhältnis hatten, sonst hätte man sich ja viel einfacher bei einem Plausch am Gartenzaun verständigen können. Aber, wie sagt schon der Volksmund: „Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.“ Wir einigten uns schließlich mit der Nachbarsfrau darauf, nachmittags unser Kind zur Betreuung bei ihr vorbeizubringen, bis es von meiner Frau nach Dienstschluss wieder abgeholt wurde.
Tagesmutter will nicht mehr
Leider war diese Nachbarschaftshilfe nur von kurzer Dauer. Nach ein paar Monaten kündigte unsere Nachbarin ihren Tagesmutter-Job − für uns überraschend − schon wieder und bat mich und meine Frau, baldmöglichst eine andere Tagesmutter zu suchen. Also setzte ich wieder eine Annonce in den Anzeigenteil des Amtsblattes. Dieses Mal meldete sich umgehend eine Interessentin, mit der sich eine mehrjährige Zusammenarbeit in unserer häuslichen Kinderpflege ergeben sollte.
Eine kleine Story dazu: "Volltreffer"
Nachdem das Amtsblatt zugestellt wurde, in welcher meine Annonce geschaltet war, klingelte am Morgen des Zustellungstages bereits bei uns das Telefon. Am anderen Ende meldete sich eine Frau von Mitte vierzig, mit einer „heimeligen“ Stimme, aus der ich sogleich eine erfahrene Hausfrau und Mutter heraushörte, was sich bestätigen sollte.
Erfahrene Hausfrau und Mutter
Zunächst tat sie mir kund, sie würde gerne in meiner Familie als Tagesmutter tätig werden. Dann legte sie überzeugend dar, sie sei in noch sehr jungen Jahren Mutter geworden und habe deshalb schon erwachsene Kinder, die sie als Hausfrau versorgte. Weiter führte sie aus, sie habe nun als gelernte Kinderpflegerin und Vollzeit-Hausfrau Zeit für einen Nebenverdienst in der Kinderbetreuung. Das hörte sich für mich schon sehr gut an, weil mein Söhnchen Lukas erst einige Monate alt war.
Unfassbar: "Joker-Angebot"
Meine freundliche Gesprächspartnerin setzte am Telefon schließlich noch eins drauf: Sie ließ mich wissen, sie werde zur Betreuung gerne zu uns ins Haus kommen, denn die gewohnte Umgebung des Kindes - zuhause - sei doch die beste Voraussetzung für eine gute Betreuung. Kurz dachte ich, das alles höre sich zu gut an, was ich da gerade hörte, um wirklich wahr sein zu können. War es aber!
Energisch: "Herr Löffler – s' isch doch klar!"
Als ich kurz zurückfragte, ob sie wirklich jeden Tag zu uns in die Wohnung kommen könne, da unterbrach mich meine Gesprächspartnerin schon fast energisch mit ihrem Hinweis: „Herr Löffler, s isch doch klar: so kleine Kinderle sottet nit jeden Tag rumgfahre were müsse, sie fühle sich daheim doch am wohlschte, des isch doch viel gschickter so. Oda denke Sie drann, wenn s Kind krank isch, dann ischs doch daheim am beschte ufghobe!“
Herr Löffler lässt nichts anbrennen!
Ich wartete natürlich keine Sekunde, um sie in ihrer Meinung zu bestätigen. Das Profil der Bewerberin hörte sich an "wie ein Sechser im Lotto". Die Anruferin war also keine gestresste Mutter, die nebenher für einen Nebenverdienst noch weitere Kinder betreuen musste, (solche lernte ich auch kennen), sondern mir bot eine gelernte und erfahrene Kinderpflegerin ihre Dienste an, die keine eigenen Kinder mehr zu betreuen hatte und darüber hinaus auch noch in die Wohnung des Kindes kommen würde!
Stressfreie Kinderbetreuung in Aussicht
Und außerdem: Was viele berufstätige Eltern kennen, ist der Umstand, dass bei einer Kleinkinderbetreuung im Haushalt einer Tagesmutter, die selbst Kinder hat, (wie dies beispielsweise auch bei unserer Nachbarin der Fall war), immer das Problem auftauchte, dass kurzfristig die Tagesbetreuung abgesagt werden musste, weil eines der Kleinkinder der Tagesmutter erkrankt war. Dazu kam, dass natürlich auch das eigene Kind ab und zu erkrankte und man als Eltern dann dieses Kind auch nicht zur Betreuung bringen konnte. In diesen Fällen musste ich öfter Urlaub nehmen. Mit der neuen Tagesmutter würde sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Betreuung für unser Kleinkind ausfiel, also stark verringern.
Sich treffen – aber dringend!
Mir war es am Ende des Telefongespräches ein äußerst drängendes Bedürfnis, die so mütterlich klingende und freundliche Tagesmutterbewerberin möglichst sofort zu einem Kaffee einzuladen, um ihr super Betreuungsangebot für mein kleines Söhnchen „einzutüten“. Denn mir war klar, dass diese Kinderpflegerin sofort vom Markt genommen würde, wenn noch weitere Eltern eine suchten.
Mit Speck fängt man Mäuse –mit Kuchen Tagesmütter!
Um nichts anbrennen zu lassen, griff ich sogar zu einer kleinen "Notlüge": Ich erzählte meiner Anruferin, (ohne rot zu werden), ich hätte gerade ganz besonders feine Kuchenstücke beim Bäcker eingekauft und würde mich freuen, wenn ich sie gleich zu Kaffee und Kuchen einladen dürfte. Das war zwar etwas mit der Tür ins Haus gefallen, aber meine Einladung hatte Erfolg. Gott sei Dank hatte unsere zukünftige Tagesmutti kein eigenes Auto und musste zwanzig Minuten zu Fuß gehen, um unsere Wohnung zu erreichen. Ich startete deshalb sogleich mein Auto und fuhr zum nächsten Bäcker, um die angegebenen − tatsächlich aber noch nicht eingekauften − Kuchenstückchen schleunigst zu beschaffen. Auch das klappte, und ich war vor ihrem Eintreffen wieder zurück in der Wohnung.
Glücks-Deal gesichert!
Wir einigten uns dann auch gleich bei Kuchen und Kaffee auf die zu besprechenden Einzelheiten, beispielsweise Bezahlung, Betreuungszeiten und Ähnliches. Deal! Meine Familie hatte − viel schneller als gedacht − eine neue Tagesmutter, und zwar täglich im Hause, und gleich am Folgetag konnte sie bei uns anfangen. Übrigens: Meine Tochter Sarah wurde von ihrer Geburt an von dieser erfahrenen Kinderpflegerin betreut.

12.4 Aufgabenteilung - Kindererziehung (ab 1992)
Erst der Vater - dann die Mutter
Bei der Erziehung unserer Kinder ergaben sich naturgemäß − je nach deren Lebensalter - unterschiedliche Anforderungen. Da hatten meine Frau und ich unterschiedliche Begabungen. Ich selbst war überhaupt nicht geprägt von Erziehungsidealen und hätte es selbst für mich gerne bevorzugt, von möglichst wenigen Menschen erzogen zu werden. Da spielten auch meine Kindheitserinnerungen eine große Rolle.
Berücksichtigung: Stärken und Schwächen
Was ich, − glaube ich zumindest −, ganz gut hinbekommen habe, war, die Pflegephase der Kinder in den ersten Jahren zu managen. Insgesamt war die Arbeitsaufteilung von Barbara und mir in den verschiedenen Altersphasen der Kinder ganz gut gewählt. Ich war in der Zeit halbtags zuhause, als meine Kinder sich vom Säugling bis ins Schulalter entwickelten. Als Hausmann kam ich, − wie schon erwähnt −, in der Kinderpflegephase ebenso gut zurecht wie später, als meine Kinder in den Kindergarten gingen. Überhaupt waren meine Nervenstärke, Flexibilität und mein Grundoptimismus damals sehr gut ausgeprägt, was sich insbesondere während des Übergangs vom reinen Berufsleben (ohne Kinder) zum Status als berufstätige Eltern sowie in der Kleinkinder-Phase durchaus vorteilhaft auswirkte. Da waren unsere Kinder bei mir ganz gut aufgehoben.
Rollentausch
In den ersten Jahren der Kindererziehung hatte meine Frau in ihrem Vollzeit-Job eindeutig ein höheres Einkommen, im Vergleich zu meinen Bezügen. Als mir der berufliche Aufstieg gelang, bei meiner Rückkehr in den Vollzeitdienst, näherte sich mein Einkommen dem meiner Frau an. Das war finanziell gesehen im Jahre 2001 eine gute Grundlage dafür, dass meine Frau und ich unsere Rollen tauschten. Sie reduzierte ihren Vollzeitdienst auf die Hälfte und ich stieg wieder in den Vollzeitdienst ein.
Schulkinder: Mutter übernimmt
Als unsere Kinder dann in die Schule gingen, war es aus meiner Sicht gut, dass Barbara halbtags zuhause sein konnte. Da zahlte sich der Rollentausch der Eltern aus, weil ich, was meine erzieherischen Fähigkeiten anging, nicht gerade ein besonders begnadeter Vater für meine Kinder sein konnte. Warum? Als jemand, der seit seiner Kindheit wegen Handicaps oft improvisierend durchs Leben gehen musste, war ich im Vorleben von Regeln und Erziehungsgrundsätzen benachteiligt.
Strenger Vater?
Lebenstüchtigkeit statt Strenge
Schlaue Kinder, wie die meinen, merken sofort, was hinter der Strenge von Elternteilen steckt! Das kannte ich schon aus meiner Kindheit. Wenn ich den strengen Vater hätte geben wollen, wäre ich vermutlich schnell von ihnen durchschaut worden. Schaue ich aber zurück, dann bin ich mir sicher, dass meine Kinder, intelligent wie sie sind, auf der einen Seite meine Schwächen mitbekommen haben, weil man das sowieso nicht verhindern kann. Auf der anderen Seite bekamen sie aber auch meine Stärken mit.
Eigene Wege gehen lassen
Für sie war es vermutlich unübersehbar, dass ich bereit und dabei kreativ war, unkonventionelle Wege zu gehen, um das Beste aus schwierigen Situationen oder meinen Handicaps im Leben zu machen. Die Erfahrung, die ich in meinem Leben machte und die ich gerne an meine Kinder weitergeben wollte, war, nie aufzuhören, an sich zu glauben, damit sie Rückschläge im Leben wegstecken können. Ich lebte ihnen diesbezüglich vor, dass ich bereit war (wenn es darauf ankam), auch Grenzen zu überspringen, wenn es sich anbot. Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn meine Kinder manches aus dieser - von mir gelebten - Lebensbewältigungsstrategie mitnehmen konnten. Aber klar ist auch, dass sie ihren eigenen Weg finden werden.
Froher Rückblick
Rückblickend bin ich froh darüber, dass meine Frau und ich unsere Eltern- und Familien-Rollen und die Aufgabenteilungen unter der Berücksichtigung unserer Stärken und Schwächen und der faktischen Voraussetzungen (zum Beispiel zeitweise höheres Einkommen von Barbara) optimal lösen konnten.

Siehe nachfolgende Unterkapitel

13.1 Beruflicher LEBENSLAUF (1974 - 2002) - eine lange Reise
Berufswahl auch Berufung?
Vorbemerkungen
Für viele Menschen, die auf ein langes Berufsleben zurückschauen können, stellt sich immer wieder die Frage, ob das, was sie als Beruf ausüben, auch Berufung gewesen war. Normalerweise dürfte für alle Erwerbstätige zutreffen, dass es Sonnen-, wie auch Schattenseiten gibt. Beneidet habe ich daher stets solche Leute, wenn sie mit dem Ausspruch zitiert wurden: „ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“. Soll heißen: Sie hatten ständig Spaß an dem, was sie beruflich ausübten. Das kann ich so leider nicht für meine gesamte Berufslaufbahn feststellen, obwohl ich insbesondere zum Ende meines vierzigjährigen Berufslebens durchaus sehr viel Freude an meinen beruflichen Erfolgen hatte, aber dabei auch große Herausforderungen bestehen musste. Ein komplexes Thema: Beruf - oder Berufung?
Autobiografischer Kernbereich
In diesem letzten Kapitel komme ich jedenfalls zum Kernbereich im ersten Teil meiner Autobiographie (AB) hinsichtlich des von mir ausgewählten Titels: VOM HANS GUCK IN DIE LUFT ZUM BÜRGERMEISTER.
Theaterstück mit vielen Akten
Vielleicht kann ich Einblicke in dieses Thema am besten dadurch geben, indem ich den Vorhang für ein etwas länger dauerndes Theaterstück − mit vielen Akten − öffne und diejenigen, welche sich dafür interessieren, mitnehme auf eine vierzig Jahre andauernde Abenteuerreise. Auf dem Weg werde ich an einigen Stationen anhalten, damit, wer will, sich über meinen ungewöhnlichen Berufsweg − "von ganz unten nach ganz oben" − ein Bild machen kann.
Die Reise beginnt 1972
Stolperer, dann Erfolg
Über meine Berufsfindung habe ich in vorangegangenen Kapiteln schon umfangreich erzählt. Ob das, was ich Jahrzehnte lang als Beruf ausübte, Berufung war, kann ich, – wie eingangs schon erwähnt -, nur schwer beantworten. Rückblickend habe ich in meinem beruflichen Leben ab dem Punkt viel erreichen können, als es mir gelang, den Blick konsequent nach vorne zu richten und den ständigen Blick in den Rückspiegel zu unterlassen. Mit Letzterem meine ich, nicht mehr ständig um die Vergangenheit, um das viele Scheitern in meiner Kindheit und Jugend, kreisen zu müssen, damit der Mut für Neuanfänge, auch berufliche, wachsen konnte. Nachdem ich dazu in der Lage war, ging es Schritt für Schritt aufwärts und ich spürte in der Folge in mir die Berufung, doch noch etwas aus mir zu machen.
Afrikanisches Sprichwort
Erste Grundlagen dafür gewann ich in der Langzeittherapie für suchtkranke Jugendliche, wo ich im Jahre 1981 behandelt wurde, (siehe Erzählungen in anderen Kapiteln). Charakteristisch für die sich anbahnende Lebenswende war ein wegweisender Spruch aus Afrika, den mir seinerzeit bei der Entlassung mein Einzeltherapeut mit auf den Weg gab, der sechs Monate lang für mich zuständig war: „Wende Deinen Blick der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter Dich“. Er wusste genau, was mich in meinem damals noch jungen Leben ständig ausbremste, weshalb er mich immer wieder − manchmal auch sehr energisch − auf eine andere Spur führen wollte. Ich höre ihn heute noch in meinen Erinnerungen, mit welchen Worten er mich − manchmal gebetsmühlenartig − immer wieder wach zu rütteln versuchte:
Anschieber-Coach
"Geh doch einfach mal Deinen Weg"! "Frage nicht lange"! "Traue Dir endlich mal etwas zu"! "Bremse Dich nicht selbst aus"! "Schau zu, wie weit Du kommst"! "Hake schnell ab, was schief geht, und schaue nach vorne"! "Gib nie vorschnell auf"! "Suche Deine Chancen"! Es fehlte nur noch, dass mir, – mein ungeduldiger Psycho-Coach -, ab und zu nicht nur verbal, sondern ganz real in den Hintern trat. Langfristig hämmerte er mir aber − im positiven Sinne - mit seinen Merksätzen tatsächlich so etwas wie mein neues Lebenskonzept in mein Hirn hinein, was nicht ohne Folgen blieb: Tatsächlich begann ich, wenn auch erst nach einiger Zeit, das Konzept schrittweise umzusetzen.
Wirre Jugendzeit
Lange zuvor, in den Wirren meiner frühen Jugendzeit (1972/1973) stolperte ich jedoch zunächst, − wie schon in vorangegangenen Kapiteln beschrieben − über zwei Ausbildungsversuche, die ich nach kurzer Zeit wieder aufgab. Erst im dritten Anlauf schloss ich eine Ausbildung für den öffentlichen Verwaltungsdienst 1974 schließlich ab. So fand ich zu meinem Beruf. Ob das Berufung war? Meine spätere berufliche Entwicklung verlief zwar alles andere als geradlinig und steuerte auf ihrer Berg- und Talfahrt immer wieder spannende Umwege an. Aber Mitte der Achtzigerjahre vollzog sich in mir eine Wesensveränderung, wie später ein naher Angehöriger (früherer Schwager) zu mir einmal bemerkte. Er meinte vermutlich, dass ich erwachsen wurde.
180 Grad-Wende
Ende der Achtziger-, Anfang der Neunzigerjahre, führte dies schließlich zu einer enormen Leistungssteigerung, was damalige dienstliche Beurteilungen bestätigten. Zu Beginn der Neunzigerjahre verspürte ich einen großen Schub. Ich wurde erfolgreicher, als ich mir dies je zuvor hätte vorstellen können. Ab dem Jahr 1999 durfte ich dann in beruflicher Hinsicht sogar äußerst erfolgreiche Zeiten erleben. Dabei spürte ich Biss und Ehrgeiz in mir, wie noch nie in meinem Leben und wurde hungrig nach Erfolgen.
Dankbarer Rückblick
Rückblickend stelle ich fest, dass ich sehr viel Hilfe erfahren durfte. Der liebe Gott hat mir vermutlich − besonders in Krisenzeiten − einen guten Schutzengel zu Seite gestellt, der mir in entscheidenden Augenblicken meines Lebens tatkräftig zur Seite stand. Er griff nämlich immer dann ein, wenn es notwendig wurde. Ob er mir deshalb in besonderer Weise beistand, weil meine gläubige Mutter viel für mich betete, weiß ich nicht. Aber ich durfte unerwartete Hilfen immer dann erfahren, wenn es auf Messers Schneide stand (was nicht selten vorkam), oder wenn bestimmte Ereignisse nachhaltige Bedeutung für mein Leben hatten. Anders kann ich mir viele außergewöhnliche, mitunter verrückte Geschichten in meinem vierzigjährigen Berufsleben nicht erklären, aus dem ich nun nachfolgend erzählen will.
Berufliche Aufbruchszeit
Handicaps getrotzt
Trotz meinen Handicaps und sehr schlechten Voraussetzungen beim Start ins Berufsleben (ADS, Sehschwäche, Alkoholprobleme, schlechte Schulzeugnisse usw. (siehe auch in vorherigen Kapiteln) wachte ich, − wie schon erwähnt −, ab Mitte der Achtzigerjahre auf und wurde zunehmend effizienter darin, Chancen im beruflichen, aber auch im privaten Leben, für mich zu nutzen. Ich wurde dabei getragen von sehr positiven Umständen in meinem Leben, welche sich parallel in dieser Zeit ergaben.
Familie
Fühlte sich früher mein Leben meistens so an, als sei ich dazu verurteilt, immer wieder im Chaos zu münden, so änderte sich dies, als ich 1983 meine spätere Ehefrau Barbara kennenlernte. Ab diesem Zeitpunkt schwenkte mein Leben in bisher nicht gekannte neue Bahnen um. Später wurde ich Familienvater, durch die Geburt meiner beiden Kinder (1992 und 1995), die mir viel bedeuten. Damit wuchsen auch erheblich meine Bodenhaftung und Selbstvertrauen, was sich wiederum positiv im beruflichen Leben auswirkte.
Täglich in zwei Berufen
Nach der Geburt meines Sohnes 1992 arbeitete ich sogar in zwei Berufen. Die Arbeitszeit in meinem bisherigen Hauptberuf in der öffentlichen Verwaltung reduzierte ich ab 1992 für neun Jahre auf halbtags, um in meinen Zweitberuf als Hausmann in der zweiten Hälfte des Arbeitstages tätig zu sein, zu welchem auch die Versorgung meines Sohnes gehörte. 1995 kam dann noch meine Tochter zur Welt. An diese Zeit − mit zweierlei Berufen − denke ich sehr gerne zurück: Einerseits halbtags im Büro in Behörden und während des anderen halben Arbeitstages zuhause als Hausmann tätig zu sein. Dabei gab es viel Abwechslung, was manchmal natürlich auch herausfordernd sein konnte.
Hausmann und Kinderbetreuung
Meine morgendliche Hausmannstätigkeit war zwar nicht immer eine einfache, aber es war eine gute Zeit und einzigartig für mich, die Kinder zu versorgen und sie aufwachsen zu sehen. Diesen besonderen Lebensabschnitt möchte ich nie missen. Als Vater und Hausmann war ich natürlich alles andere als perfekt, aber wer ist das schon bei solchen neuen Aufgaben? Vater oder Mutter wird man ja mit allen Stärken und Schwächen seiner Persönlichkeit, die man aus der Vergangenheit mitbringt.
Lebensumstände verändern
Aber diese neuen Lebensumstände als Vater ließen mich, − wenn ich dies rückblickend betrachte −, rasch reifen und eröffneten mir ganz neue Lernfelder, die mich verändern sollten. Beispielsweise wurde ich wesentlich belastbarer, was sich dann wiederum auf meine Berufsausübung auswirkte. Ich lernte jedenfalls in meinem Zweitberuf schnell dazu und konnte bald routiniert Windeln wechseln, die Kinder füttern, baden, anziehen und auch andere Hausmannstätigkeiten bewältigen, wie Waschen, Bügeln, Putzen Einkaufen oder Kochen.
Teilzeit-Job bringt Chancen
Während ich dann nachmittags ins Büro zur Ausübung meines Erstberufes ging, beschäftigten wir in unserem Haushalt eine Tagesmutter. Meine Frau arbeitete nach der Geburt der Kinder wieder in Vollzeit, weil sie zu dieser Zeit ein deutlich höheres Einkommen hatte als ich. Während es sich für viele Elternteile, meistens Frauen, nachteilig auswirkte, die Arbeitszeit aus familiären Gründen zu reduzieren, erwuchs für mich dadurch sogar eine unerwartete Chance zum beruflichen Aufstieg (siehe dazu meine Erzählungen in einem vorangegangenen Kapitel).
Ehrenämter helfen
Was mich in beruflicher Hinsicht auch weiter brachte, war nicht etwa noch ein Drittberuf, sondern, dass ich durch mein ehrenamtliches Engagement bekannt wurde, mit welchem ich in Donaueschingen eine Selbsthilfegruppe für Suchtgefährdete und Angehörige gründete und leitete. Angesprochen für ein solches Engagement wurde ich 1989, zwei Jahre nach unserem Umzug von Freiburg nach Donaueschingen, von der Hauptstelle einer Suchthilfe-Selbsthilfe- Organisation, welche zum Diakonischen Werk gehörte. Dieser Organisation war bekannt, dass ich schon in Freiburg eine solche Selbsthilfegruppe besuchte.
Ausbildung für Öffentlichkeitsarbeit
Sehr bald erhielt ich eine Ausbildung für die Öffentlichkeitsarbeit und hatte öfter Kontakt mit der Presse. Später organisierte ich auch große Informationsveranstaltungen, bei welchen bekannte Sucht-Experten und auch eine Moderatorin des Südwestfunks mitwirkten, und ich selbst war ab und zu Gast bei Rundfunksendungen zum Thema Suchthilfe.
Gründung Ehrenamtsbörse
Außerdem engagierte ich mich ehrenamtlich in einem weiteren Arbeitsfeld, das öffentliche Beachtung fand. Ich hatte die Idee, in Donaueschingen − zusammen mit Wohlfahrtsverbänden − ein Bürgerbüro einzurichten, in welchem Angebote und Nachfragen für, bzw., nach ehrenamtlichem Engagement gesammelt und koordiniert werden. Das Bürgerbüro "Arche" war geboren. Die Wohlfahrtsverbände waren sehr interessiert und einer davon, der Caritasverband, stellte dem Bürgerbüro-Arche-Team, bestehend aus ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern, einen kleinen Büroraum mit Telefonanschluss zur Verfügung. Während regelmäßiger Öffnungszeiten konnte dann dort diese neue Börse für Angebote und Nachfragen im Bürgerschaftlichen Engagement seine Arbeit aufnehmen, über welche auch die örtlichen Medien umfangreich berichteten. Später wurden solche Ehrenamtsbörsen in die kommunalen Verwaltungen übernommen ("Anlaufstellen für Bürgerschaftliches Engagement").
Fazit:
Mit diesen öffentlichkeitswirksamen Engagements überschritt ich bisherige Grenzen und wuchs sozusagen über mich hinaus. Ich traute mir immer mehr zu, und der einst so introvertierte junge Mann mauserte sich zu jemanden, der bewusst und in den jeweiligen Fachthemen kompetent die Kommunikation mit der Öffentlichkeit suchte (was für mich zu früheren Zeiten absolut unvorstellbar gewesen wäre).
Neuer Job 1988
Durch meinen Umzug von Freiburg nach Donaueschingen 1987 suchte ich eine Arbeitsstelle in der Nähe meines neuen Wohnortes. Ich fand sie ab Juni 1988 beim Wasserwirtschaftsamt in Donaueschingen. Erfreulich dabei war einerseits, dass ich nun nicht mehr dreieinhalb Stunden täglich für die Hin- und Rückfahrt mit der Bahn als Berufspendler einsetzen musste. Andererseits wartete auf mich im neuen Job ein Mix von interessanten neuen Aufgaben, welche deutlich anspruchsvoller waren als jene an meinem bisherigen Arbeitsplatz in Freiburg.
Traditionelle Verwaltung
Allerdings galt an meinem neuen Arbeitsplatz noch eine althergebrachte Arbeits- und Dienststruktur, auf die ich mich umstellen musste. Dieses Wasserwirtschaftsamt − eine Außenstelle von Rottweil und Sonderbehörde des Landes Baden-Württemberg −, war nicht nur in einem alten fürstlichen Gebäude untergebracht (dem ehemaligen Amtsgebäude des Fürsten zu Fürstenberg). Es arbeitete auch noch - wie schon erwähnt - in traditionellen Strukturen. Über zwei Dutzend technische Beamte verrichteten dort ihren Dienst, meistens im Außendienst.
"Verwaltungschef" – vor Ort
Der "Verwaltungschef", wie man mich dort gerufen hat, war direkt dem Außenstellenleiter beziehungsweise der (tatsächlichen) Verwaltungschefin in der Hauptstelle in Rottweil unterstellt. "Verwaltungschef" war damals für einen Beamten im mittleren Dienst, wie mich, zwar nicht de facto, aber umgangssprachlich eine großzügige, und anerkennende „Beförderung“ durch die Kollegen. Mit diesem positiven Image konnten sich meine Einflussmöglichkeiten für den Dienstbetrieb mit der Zeit vorteilhaft entwickeln. Das machte großen Spaß!
Frohes Schaffen
In meinem neuen Aufgabenbereich räumte man mir erstaunlich viele Freiheiten ein, und ich konnte eigeninitiativ und selbständig arbeiten. Auch durfte ich viele Aufgaben mit der Zeit eigenverantwortlich erledigen. Begünstigt wurde dies dadurch, dass der Außenstellenleiter, ein Baudirektor mit sehr ruhigem Wesen, froh war, wenn er sich nicht mit allzu vielen Verwaltungsdingen befassen musste. Je selbständiger ich arbeitete, desto besser gefiel ihm dies. Eine Chance, die ich zu nutzen verstand.
Sonderbare Chefs
Allerdings − wenn etwas falsch lief, dann veranstaltete mein Chef gerne ein etwas unangemessenes Gedöns drumherum, und seine Ermahnungen an mich hatten schon fast poetische Züge. Aber damit konnte ich leben. Kritisierendes Gedöns hatte ich ja in meinem Leben schon vielfach erlebt. Nervös wurde dieser Außenstellenleiter übrigens auch, wenn sein Chef, der „Leitende Baudirektor“ aus Rottweil vorbeischaute.
Lebendige Karikatur
Dieser wirkte auf mich wie eine lebende Karikatur. Wenn seine Wichtigkeit (der Haupt-Chef) unserer Außenstelle die Ehre erwies, dann wandelte er zunächst durch alle Gänge, um mit eher unangemessen wirkenden schnellen Schrittfolgen seine Bedeutung hervorzuheben. Sein Blick wirkte entschlossen, und seine Stimme klang laut durch die hohen Amtsräume.
Lustiges Begrüßungsritual
So stürmte dieser - auf die Wirkung seines Vielbeschäftigt seins - sehr bedachte Mensch in die Büros, um eilig seine Beamtenschaft zu begrüßen. Dabei trat er schon mit einem ausgestreckten Arm ins Büro, ohne einen Blickkontakt zum Personal zu suchen, drückte jedem im Vorbeigehen die Hand (auch die meine) und verschwand ruckzuck wieder in Richtung Ausgang. Das fand ich immer äußerst amüsant. Weniger lustig war dieser „Leitende Regierungsbaudirektor“ für alle, die dienstlich mit ihm zu tun hatten. Davon blieb ich Gott sei Dank aber meistens verschont, weil auch er (wie sein Außenstellenleiter) sich nicht gerne mit den "Niederungen" der Verwaltungsbereiche wie Haushalt, Kassen, Rechnungs- und Beschaffungswesen befasste. Hierbei handelten meine Chefs nach dem Grundsatz: So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Mir war's recht.
Lebendiger Treffpunkt
Mein Arbeitsplatz befand sich in einem sehr großen Büroraum, wo auch der Kopierer stand. Er wurde Kanzlei genannt. Mir gegenüber saßen, morgens und mittags je eine Mitarbeiterin, welche halbtags in der Verwaltung als Schreibkräfte und als Bearbeiterinnen von Aufgaben in der Verwaltung tätig waren. Organisatorisch waren diese Kolleginnen dem "Verwaltungschef" der Außenstelle, also mir, zugeordnet. Somit war ich auch schon ein bisschen Chef. Umgangssprachlich wurde ich ab und zu auch „Chefle“ gerufen. In einem großen Wandregal befanden sich viele Postfächer, für jeden Beamten eines. Deshalb war die Kanzlei ein Ort, wo ständig etwas los war. Im Laufe des Tages kam jeder Kollege mindestens einmal vorbei, um zu schauen, ob sich für ihn ein neuer Posteingang ereignet hatte. Je nach Kommunikationsfreude der Kollegen brachten die meisten von ihnen mindestens ein Thema mit, das sie mit mir kurz besprechen wollten. Und wenn es nur um die Feinheiten der letzten Reisekostenabrechnung ging, die ich zuletzt angewiesen hatte.
Unterhaltsame Kollegen
Aber auch nicht-dienstliche Themen wurden gern mal besprochen. Da gab es einen älteren Jehova-Zeugen mit seinem obligatorischen Sorgenfalten-Gesicht, der mit mir immer wieder zu seltsamen Themen das Gespräch suchte, vermutlich, um für seine Glaubens-Gemeinschaft zu werben. Oder der einarmige Kollege vom Nachbarbüro, ein liebenswerter Mensch, der es aber verstand, mit seinen Sticheleien etwas zu nerven. Weiter gab es einen fröhlichen Kollegen, den man schon von Weitem pfeifend ankommen hörte, und stets muntere Geschichten von einem seiner acht Kinder zu erzählen wusste.
Neue Aufgabe wertet auf
Mit der Zeit bekam ich für mein Verwalteramt noch Aufgaben dazu, wie zum Beispiel im damals neu eingeführten Aufgabenbereich für den Informations- und Kommunikations- (IuK-) Beauftragten, den jedes Amt benennen musste. Ich wurde zu dessen Stellvertreter berufen. Im Zuge der Datenverarbeitungsmodernisierung kam eine Vielzahl von neuen Begrifflichkeiten in der Landes-Verwaltung auf.
Crashkurs in Stuttgart
Zum Einstieg wurde ich für diese − in den Augen der Vorgesetzten besonders wichtige und anspruchsvolle − Aufgabe zu einem zweiwöchigen Seminar nach Stuttgart geschickt, (wohnte citynah in einem Hotel), wo ich viele Vorträge anhören musste. Die dort behandelten Themen hatten für mich aber leider den Nachteil, dass ich kaum etwas Brauchbares mit nach Hause nehmen und den Inhalten nur bedingt und nach wenigen Tagen zum großen Teil gar nicht mehr folgen konnte. Bei den Teilnehmern wurde viel technisches Vorwissen vorausgesetzt, das ich nicht hatte. Einen wesentlich höheren Spaßfaktor boten dagegen die Unternehmungen mit Lehrgangsteilnehmern in Stuttgart nach Dienstschluss.
Keine Prüfung – Glück gehabt!
Am Ende der üppigen Schulung zum Know-how im Umgang mit neuen Techniken in der Datenverarbeitung waren Gott sei Dank keine Tests oder Prüfungen vorgesehen. Dann hätte ich alt ausgesehen. Stattdessen erhielten die Teilnehmer am Ende eine repräsentative Bescheinigung mit einer umfangreichen Auflistung von Fachbegriffen und Qualifizierungen, zu deren Inhalten ich angeblich fit gemacht wurde. Beim Durchlesen fragte ich mich allerdings, ob ich tatsächlich diese Schulung selbst absolviert hatte, und mir wurde angst und bange bei der Vorstellung, jemals als IuK- Vertreter tätig werden zu müssen.
Outing fällt aus
In solchen Fällen, das war mir klar, hätte ich zwangsläufig enttäuschen müssen. Andererseits beschloss ich, ich würde mich zur Aufrechterhaltung eines positiven Images im Amt nicht outen, wegen der bei mir nicht angekommenen Qualifizierungen durch den umfangreichen Fachlehrgang in Stuttgart. Ich vertraute darauf, meine Vertretungsrolle vorerst nie qualifiziert wahrnehmen zu müssen, und zu Einzelthemen mit der Zeit von dem hauptamtlichen IuK-Kollegen doch noch etwas in der Praxis zu lernen. Das war jedoch ein etwas riskantes Spiel, welches auch hätte schiefgehen können. Tat es aber nicht. Eine weitere Erkenntnis dazu ergab sich rückblickend für mich: Zum ersten Mal pokerte ich sozusagen in beruflicher Hinsicht, um eigene Vorteile nicht aufs Spiel zu setzen und wartete einfach ab, was passiert.
Turbo für Stellenbewertung
Für die Stellen-Bewertung wirkte sich aber der stellvertretende IuK-Beauftragte sehr positiv aus. Bei meinem Dienstantritt im Juni 1988 führte ich noch den Dienstgrad Stadtsekretär, beziehungsweise nach Übertritt in den Landesdienst Regierungssekretär (nicht zu verwechseln mit dem hochbezahlten politischen Amt in den Ministerien). Bald wurde ich dann aber zum Obersekretär und nach relativ kurzer Zeit auch noch zum Regierungshauptsekretär befördert.
Beschaffungswesen
Was meine sonstigen − eigentlichen − Aufgaben betraf, war das Beschaffungswesen für mich besonders interessant. Die technischen Beamten, darunter ein Chemiker, der ein eigenes Labor betrieb, brauchten beispielsweise viele, teilweise teure Spezialgeräte, für die ich Angebote einholte und die Beschaffungen durchführte. Auch die Beschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges gehörte einmal zu meiner Aufgabe. Als Haushaltssachbearbeiter konnte ich besonders punkten, indem ich mich beim Regierungspräsidium Freiburg (das für die Zuteilung von Finanzmittel an die Sonderbehörden zuständig war) zielstrebig für die Erneuerung des veralteten Mobiliars in den Büros unseres Amtes einsetzte. Schließlich gelang mir das, und dem Amt wurden entsprechend - hohe – Haushaltsmittel zugewiesen. Fortan fuhren für zwei Jahre immer wieder große Möbelwagen vor, welche neu beschaffte Büromöbel für unsere Amtsräume lieferten.
Fazit:
Insgesamt war meine Dienstzeit beim Wasserwirtschaftsamt in Donaueschingen eine sehr gute Zeit. Von dem Klein-Klein in der großen, engmaschigen Verwaltungsstruktur des Technischen Rathauses in Freiburg wechselte ich in eine überschaubare Verwaltungseinheit, in welcher handfestes und eigenverantwortliches Handeln gefragt war. Auch musste und konnte ich lernen, mit ganz unterschiedlichen Typen von Kollegen umzugehen und eine zielführende Kommunikation einzusetzen, besonders auch mit meinen Chefs. Die dabei gewonnene Erkenntnis, mein Verhalten so einzusetzen oder anzupassen, dass ich in beruflicher Hinsicht das Bestmögliche herausholen konnte, sollte sich mit der Zeit tatsächlich noch sehr erfolgreich für mich auswirken. Diese Chancen, das hier gebotene Lernfeld konnte ich nutzen, und ich wuchs dabei mit den Aufgaben. Am Ende habe ich deutlich an Selbstvertrauen gewonnen, was für meine weitere berufliche Entwicklung ebenfalls gut war.
Landkreisverwaltung ab 1995 (bis 2001)
I. Veterinäramt
1995 war meine schöne Zeit als Verwalter beim Wasserwirtschaftsamt Donaueschingen vorbei. Durch eine Verwaltungsreform des Landes Baden-Württemberg wurden die Sonderbehörden des Landes in die Landratsämter eingegliedert. So kam es, dass ich ab Juli 1995 zum Landratsamt des Landkreises versetzt wurde, wo seit 1987 schon meine Frau beschäftigt war. Da die bisherigen staatlichen Veterinärämter 1995 ebenfalls − wie die Wasserwirtschaftsämter − von der Eingliederung in die Landkreise betroffen waren, wurde dort eine Verwaltungskraft gesucht, welche sich um die Neuorganisation und das Abrechnungsverfahren für Personalvergütungen und Gebührenerhebungen kümmerte, die durch amtlich durchzuführende Fleisch-Beschauungen bei Schlachtbetrieben oder privaten Schlachtungen fällig wurden.
Neuer Halbtagsjob
Da ich aus familiären Gründen seit 1992 nur noch halbtags arbeitete, passte ich genau in das Anforderungsprofil für diese Stellenbesetzung. Ich lernte ich in diesem Zusammenhang das Arbeiten mit einem PC kennen, der mit einem Windows-Betriebssystem und Microsoft Office-Programmen ausgestattet war. Zunächst bedeutete dies für mich einen Sprung ins kalte Wasser, da dieses Abrechnungswesen bereits ab dem Zeitpunkt meines Dienstantritts beim Veterinäramt monatlich durchzuführen war. Zuallererst benötigte ich eine intensive Schulung, um mit den damals - für mich - neuen, modernen PC und Microsoft-Programmen arbeiten zu können. Aber ich hatte Glück: Eine Praktikantin (sie studierte Veterinär-Medizin), welche mit mir ihren Dienst im Veterinäramt antrat und sich durch ihr Studium im Umgang mit diesen Programmen bereits gut auskannte, sprang mir zur Seite und half bei der Einarbeitung. Außerdem hatte ich einen guten Chef, mit dem ich sehr gut klarkam, es machte Spaß, mit ihm zu arbeiten. Nach zwei Monaten lief das - neu zu entwickelnde - Abrechnungssystem unter Einsatz des EXCEL- Programms, verknüpft mit der Serienbrieffunktion im WORD-Programm. Neben diesen Gebühren- und Vergütungsabrechnungen bearbeitete ich auch amtliche Verfügungen des Veterinäramtes in bestimmten Aufgabenbereichen.
Neuorientierung per Zufall
Insgesamt war ich etwa eineinhalb Jahre im Veterinäramt tätig. Diese Behörde war auch in der Außenstelle Donaueschingen untergebracht, nicht am Hauptsitz in Villingen-Schwenningen, was für mich praktisch war, weil ich so nur einen kurzen Weg zu unserem Zuhause hatte. Wie ich dies in einem vorangegangenen Kapitel schon erwähnt habe, war dann ein Zufall dafür verantwortlich, dass sich meine berufliche Zukunft ab 1997 verändern sollte. Eines Tages besuchte ich meine Frau an ihrem Arbeitsplatz, der ebenfalls in der Außenstelle des Landratsamtes in Donaueschingen war. Dabei fiel mir das Schwarze Brett in ihrem Amt auf, und ich schaute es mir an.
Neue Höhenflüge
Neben anderen Informationen des Landkreises bemerkte ich eine Stellenausschreibung für eine Halbtagsstelle im Kreisjugendamt im Landratsamt in Villingen-Schwenningen. Dabei ging es um die Abteilung Beistandschaften und Amtsvormundschaften. Für soziale Arbeit war ich sehr aufgeschlossen. Allerdings handelte es sich bei dieser Stellenbeschreibung nicht um Sozialarbeit, sondern mehr um staubtrockene Rechtsgebiete, beispielsweise Unterhaltsrecht, Vaterschaftsklagen und Vormundschaftswesen. Besonders fielen mir zwei Informationen ins Auge: Erstens, es handelte sich um eine Stelle des gehobenen Dienstes und zweitens, um eine Teilzeitstelle. Ganztags konnte ich nicht arbeiten, wegen meines Zweitberufs als Hausmann, beziehungsweise wegen der Kinderbetreuung zu Hause.
Schauen, was passiert
Ich war mir natürlich bewusst, dass ich dem mittleren und nicht dem gehobenen Dienst angehörte, der in der Ausschreibung angefordert war, aber ich bewarb mich trotzdem und wollte (wieder) einfach mal schauen, was passiert.
Lust auf Neues
Für meine Lust, mich zu bewerben, sprachen zwei Gründe. Zum einen begeisterte mich der Job im Veterinäramt auf die Dauer nicht wirklich. Zum anderen vollendete ich 1997 mein vierzigstes Lebensjahr und, wenn man sich in diesem Alter in der letzten Stufe seiner Laufbahn befand, dann konnte man nach dem damaligen Beamtenrecht - unter bestimmten Voraussetzungen - zu einer Aufstiegsprüfung für den gehobenen Dienst zugelassen werden (siehe dazu meine Erzählungen in einem vorangegangenen Kapitel). Ich zögerte daher nicht eine Sekunde und schickte spontan meine Bewerbung ab. Vom Veterinäramt, meiner bisherigen Arbeitsstelle bekam ich ein 1a-Dienstzeugnis, was natürlich sehr hilfreich war. Dennoch rechnete ich eher damit, abgelehnt zu werden, da ich ja − wie erwähnt − dem mittleren und nicht dem gehobenen Dienst zugehörig war.
Gewagt und gewonnen
Zu meiner Überraschung kam es anders, und meine Bewerbung war erfolgreich. Dies machte mich glücklich, wenngleich auch der Umstand Pate stand, dass sich für diesen heiklen Job kein/e Kollege oder Kollegin aus dem gehobenen Dienst beworben hatte. Sehr viel später sollte sich jedoch herausstellen, dass diese neue Stelle im Kreisjugendamt den Grundstein legte, für einen − für mich nie vorstellbaren − großen und letzten Karrieresprung einige Jahre später.
II. Kreisjugendamt
1997 war es dann so weit: Ich wechselte meinen Job innerhalb des Landratsamts vom Veterinäramt zum Jugendamt. Dieser positive Karriereschritt war zunächst einmal ein Grund zur Freude. Allerdings gab es auch zwei Nüsse zu knacken: Mein neuer Dienstort in VS-Villingen lag nicht mehr sozusagen "vor der Haustüre" in Donaueschingen. Und ich musste die Herausforderung meistern, in kurzer Zeit mir sehr viel Fachwissen in einem komplexen Sachgebiet anzueignen, was völliges Neuland für mich bedeutete. Beispielsweise das Unterhaltsrecht oder im Bereich Vormundschaftswesen.
Stressige Zeiten für Halbtagskraft
Für einen Sachbearbeiter, der nur halbtags berufstätig war, ergaben sich dadurch stressige Zeiten. Schließlich schaffte ich es dennoch, mich einzuarbeiten in meinen "gehobenen-Dienst-Job", als Beamter des mittleren Dienstes. Nach etwa zwei Jahren Tätigkeit im Sachgebiet Beistandschaften, Amtsvormundschaften im Kreisjugendamt konnte ich mich über eine ausreichend gute dienstliche Bewertung seitens meines Vorgesetzten erfreuen, die es mir - nach einer Beförderung zum Amtsinspektor (Spitzenamt im mittleren Dienst) - ermöglichte, mich für einen Aufstieg in den gehobenen Verwaltungsdienst zu bewerben.
Ausdauer bringt Aufstieg
Meine Ausdauer für ein berufliches Weiterkommen zahlte sich schließlich aus, und ich konnte erfolgreich ins neue Jahrtausend starten. Die Jahre 1999 bis 2002 sollten der Auftakt für ganz besondere finale Karrieresprünge werden, die folgten. Kurz vor Weihnachten des Jahres 1999 ereignete sich dann der lange von mir angestrebte und vorbereitete Prüfungstermin für Aufstiegsbeamte beim Landespersonalausschuss in Stuttgart.
Aufstiegsprüfung geschafft
Welch eine Freude war das, nach der Prüfung mit den Kollegen, die ebenfalls diese Prüfung am Ende des Jahres 1999 bestanden haben, auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt zu feiern. Nach so langer "Abstinenz" von schulischer Weiterbildung waren die Vorbereitungen zu dieser Aufstiegsprüfung eine Herausforderung, insbesondere das viele Lernen im Zusammenhang mit den Seminaren zur Prüfungsvorbereitung an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg. Diese wurden berufsbegleitend angeboten, also neben meinen zwei Berufstätigkeiten im Jugendamt und als Hausmann, der zu Hause seine noch kleinen Kinder versorgte. Allerdings wurde man für die Teilnahme an diesen Fortbildungen vom Dienst freigestellt und für zuhause brachte die Tagesmutter zusätzliche Betreuungszeiten ein. Dennoch musste vieles von zu Hause aus nachgearbeitet und gelernt werden. Schließlich stellte dann auch die Prüfung selbst für uns Prüflinge, die wir alle über vierzig Jahre alt waren, ein besonderes Ereignis dar.
Kleine Story: Prüfungsphobie
Zu den Seminaren nach Ludwigsburg in die Verwaltungshochschule hatte ich eine Fahrgemeinschaft mit einem schwäbischen Kollegen aus einem benachbarten Landkreis, der dort Leiter des Kassenamtes war. Mit ihm freundete ich mich an, und wir tauschten uns in der langen Vorbereitungszeit gegenseitig aus. So konnte er mir beispielsweise einige Tipps in den Fächern Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen geben. Mit ihm hatte ich vereinbart, dass ich ihn am Tag der Prüfung, wie immer, wenn ich nach Stuttgart fuhr, auf einem Parkplatz an einer Ausfahrt an der A 81 abholen sollte, um ihn nach Ludwigsburg mitzunehmen.
Hautausschlag wegen Prüfungsangst
Einen Tag vor der Prüfung rief er mich zu Hause abends an, um mir mitzuteilen, er könne nicht mit mir zur Prüfung fahren. Seine Begründung: Er sei "zu aufgeregt" für die anstehende Prüfung und habe dadurch schon einen Hautausschlag am ganzen Körper bekommen. "Gerold, i muas passa, dees isch mia eufach üba mei Kopf naus gwachsa, klagte er am Telefon. Zunächst glaubte ich an einen Scherz. Als ich aber merkte, dass sich mein Kollege aus dem Schwabenland tatsächlich in einem Ausnahmezustand befand, schaltete ich in den Seelsorger-Modus um.
Seelsorge
Unser Telefongespräch dauerte dann länger, und ich gab alles, um ihn davon zu überzeugen, dass er es in einhundert Jahren noch bereuen würde, sollte er jetzt − kurz vor dem Ziel und nach so vielen Mühen der Vorbereitung − voreilig aufgeben. Schließlich ließ sich mein Kollege dann doch noch von mir am Folgetag zur Prüfung abholen. Sein Ausschlag war zumindest im Gesicht und an den Händen kaum noch sichtbar. Trotz seiner Prüfungsangst bestand mein Kollege schließlich ebenso wie ich die Prüfung, und er war mehr als erleichtert darüber. Als wäre er gerade einer Hinrichtung entkommen! Ich wollte mir nicht seinen Zustand ausmalen, wäre er durch die Prüfung gefallen: Vermutlich hätte ihn ein Hubschrauber sofort in die nächste Hautklinik fliegen müssen. Aber so weit kam es nicht, und somit hatten wir beide doppelten Grund, unseren Prüfungserfolg zu feiern.
Zurück in den Berufsalltag
Zurückgekehrt in die Mühlen des Jugendamtsalltags, zu dem ständigem Zoff mit Kindesvätern wegen Unterhaltsberechnungen oder Zahlungsrückständen, und auch ab und zu mit Müttern wegen irgendwelcher ungelösten Probleme im Rahmen der Beistandschaft, hatte ich bald das Bedürfnis, für einige Jahre beruflich auszusteigen. Mein Ziel, den beruflichen Aufstieg in die gehobene Beamtenlaufbahn, hatte ich ja nun geschafft und in der Tasche.
Aussteigen?
Ich fasste schließlich ganz konkret den Beschluss, mich aus familiären Gründen einige Jahre beurlauben zu lassen und wollte den dadurch entstehenden Einkommensverlust durch die Aufnahme eines Pflegekindes in den familiären Haushalt etwas ausgleichen. Dazu besuchte ich bereits ein Fortbildungsseminar des Jugendamtes in Freiburg und eines Vereins für angehende Pflegeeltern, zu welchem mich auch meine Frau begleitete.
Seltsamer Zufall
Mein Vorhaben formulierte ich in einem schriftlichen Antrag an die Personalabteilung des Landratsamtes und ließ dieses auch meinem Sachgebietsleiter zukommen. Von ihm erhielt ich kurz darauf ein überraschendes Angebot, dass ich auf einen neuen Halbtagsjob in die Geschäftsführung einer Jugendhilfeeinrichtung wechseln könne, welche organisatorisch zum Jugendamt gehörte (in der Trägerschaft des Landkreises). Dabei handelte es sich um eine Einrichtung, welche benachteiligten Jugendlichen in der Berufsfindungsphase oder während ihrer Berufsausbildung Hilfsangebote mit entsprechendem Fachpersonal anbot: Ziel war, dass die zu betreuenden Jugendlichen ihre Berufsausbildung trotz ihrer Probleme erfolgreich abschlossen.
Wie das Leben so spielt
Bemerkenswert fand ich allerdings, dass achtundzwanzig Jahre, nachdem ich selbst fast in einer Dauerschleife des Versagens bei Berufsausbildungsversuchen gelandet wäre, ich nun ausgerechnet Geschäftsführer einer solchen Einrichtung werden sollte. Zur Erinnerung: Damals hatte ich nur durch besondere Fördermaßnahmen − im dritten Anlauf − die Berufsausbildung abschließen und gerade noch den Hals aus der Schlinge ziehen können. Wie das Leben so spielt...-Zufall?
Zu viel für Halbtagskraft?
Zwar befürchtete ich von Anfang an, eine solche, kommunikativ sehr anspruchsvolle Leitungsaufgabe wäre mit einer Halbtagsstelle völlig unterbesetzt, auch schon deshalb, weil umfangreiche Angelegenheiten aufgearbeitet werden mussten. Auch sah ich eine besondere Herausforderung auf mich zukommen, weil ich für eine solche Führungsaufgabe überhaupt nicht vorbereitet war. In diesem Zusammenhang hatte ich besonders das Fachpersonal im Blick, das überwiegend aus Pädagogen oder Sozialpädagogen bestand, welche es naturgemäß verstanden, sehr selbstbewusst und zielorientiert zu kommunizieren.
Chance nicht vermasseln
Aber ich wollte mir diese Chance nicht entgehen lassen, Geschäftsführer einer solchen Jugendhilfeeinrichtung werden zu können. Deshalb sagte ich meinem Chef spontan zu, trotz meiner Vorbehalte.
Ausstiegspläne in Papierkorb
Meine schriftlichen Anträge für eine längere Beurlaubung vom Dienst warf ich umgehend in den Papierkorb. Schließlich konnte ich so endlich und kurzfristig den ungeliebten Job in der Abteilung Beistandschaften und Amtsvormundschaften hinter mir lassen und künftig eine für mich wesentlich interessantere Aufgaben übernehmen. Es wartete ein Abenteuer auf mich, das mich reifen ließ, für einen späteren - finalen - Karrieresprung.
Volles Programm
Nachdem ich den neuen Leitungsjob im Jahre 2000 angetreten hatte, war mein Alltag mit zwei anspruchsvollen Jobs vollständig durchgetaktet. Morgens versorgte ich den Haushalt und die Kinder, brachte sie in den Kindergarten und ging anschließend einkaufen oder erledigte sonstige Hausmannstätigkeiten. Wenn unsere Tagesmutter mich mittags ablöste, pendelte ich mit dem Zug von Donaueschingen aus nach Villingen, um von dem dortigen Bahnhof zur ebenfalls nahegelegenen Jugendhilfeeinrichtung zu gehen. Zwischendurch wechselte ich auch meine Dienstzeit auf vormittags, je nach dem - wie dies dienstlich notwendig war und wie es sich mit unserer Tagesmutter zuhause vereinbaren ließ (Gott sei Dank war diese sehr flexibel). Meine Frau arbeitete, − wie schon erzählt −, in Vollzeit.
Überstunden-Inflation
Es dauerte aber nicht lange, da saß ich zunehmend sowohl vormittags als auch nachmittags im Büro, oder ich war von zu Hause aus noch für den Job tätig. Der auflaufende Überstundenberg konnte nicht mehr abgebaut werden. Ich hätte dies natürlich ablehnen können, aber ich hatte Feuer gefangen und war "angefressen" davon, in dieser neuen Herausforderung bestehen zu können. Das gab mir einen bisher nie gekannten, hoch-dynamischen Antrieb. Über mich hinauswachsen wollte ich aber nicht in erster Linie, um von meinem Dienstherrn möglichst viel Lob einfahren zu können, sondern weil ich es mir selbst beweisen wollte.
Spannungen
Aber das grobe Missverhältnis meiner Halbtags-Geschäftsführerstelle zu den vielfältigen Leitungsaufgaben wurde zunehmend zu einem Problem für mich, das einer Lösung zugeführt werden musste.
Lösung für Vollzeit-Job gesucht
Nachdem ich auch hinsichtlich des Einkommens in den gehobenen Dienst aufgestiegen war und meine Rückkehr in den Vollzeitdienst keinen erheblichen Einkommensverlust mehr für die Familie bedeutet hätte (meine Frau verdiente vor meinem Aufstieg deutlich mehr als ich), schlug ich den Vorgesetzten vor, meine Leitungsstelle von einer bisherigen Halbtagsstelle in eine Vollzeitstelle umzuwandeln. Meine Frau war umgekehrt einverstanden damit, in einem solchen Fall die Reduzierung ihres Vollzeitdienstes auf eine halbtägige Teilzeitbeschäftigung in einem anderen Amt im Landratsamt aus familiären Gründen zu beantragen. Viele gute Gründe, die den Vollzeitdienst an meinem Arbeitsplatz rechtfertigten, listete ich in meinen Vorschlägen an die Amtsleitung auf. Dazu auch solche zur Entlastung der damit verbundenen Personalkostenerhöhung, durch Abschöpfung von Zuschüssen des Landes Baden-Württemberg mit Übernahmen von zusätzlichen Aufgaben.
Auf NEIN folgt JA (2001)
Mein Vorschlag auf Aufstockung meiner Halbtags- zu einer Vollzeitstelle fand jedoch zunächst keine Zustimmung bei der Amtsleitung. Doch ich ließ nicht locker, und ersetzte meine Vorschläge in einen Antrag an meinen Dienstherrn, mit der Bitte, mich künftig in den Vollzeitdienst zu übernehmen. Allerdings hatte ich nicht sehr viel Hoffnung, damit erfolgreich sein zu können. Aber - oh Wunder! Zu meiner Überraschung wurde dieser dann doch nicht abgewiesen, sondern es wurde über ihn letztlich positiv von Leitungsebene im Landratsamt entschieden. Auch wurde ich noch zum Kreisoberinspektor befördert und meine Frau Barbara wechselte in den Teilzeitdienst. Meine Versetzung zum Landkreis im Jahre 1995 war also unterm Strich gesehen in den vergangenen sechs Jahren insgesamt eine Erfolgsgeschichte für mich und ich wurde sehr gefördert. Auch mein Ziel, künftig den Job als Geschäftsführer der Jugendhilfeeinrichtung im Vollzeitdienst ausüben zu können, hatte ich erreicht. Allerdings wurde ich das Gefühl nicht los, dass die schwierigen Verhandlungen darüber mein bisher gutes Verhältnis zu meinen Vorgesetzten trübten. Das machte mir zu schaffen. Ich spürte bereits, dass eine baldige berufliche Veränderung auf mich zukommen würde.
Naher Karrieresprung?
Bemerkenswert war aber dann, wie nah ich vor genau einer solchen Veränderung stand. Die eben geschilderte − und für mich zuletzt nicht so glücklich verlaufende − letzte Episode in meinem beruflichen Werdegang hatte nun aber einen bedeutenden Einfluss auf meine Entscheidung, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Denn: Mein bisher kunterbuntes berufliches Leben, mit all seinen Besonderheiten und Überraschungen − von ganz unten nach ganz oben − sollte mit einem letzten, großen Karrieresprung eine farbenfrohe Krönung erhalten!

13.2 Weg in's BÜRGERMEISTERAMT
(Wahlkämpfe in zwei Gemeinden 2001 - 2002)
Weg in's Bürgermeisteramt
Es kommt eher selten vor, dass ein Mensch, den man zwar kennt, der einem aber nicht nahesteht -, mit wenigen Worten nachhaltige Veränderungen im Leben herbeiführen kann, die bisherige Grenzen wegsprengen.
"Aber sprich nur ein Wort"
Ein Kollege meiner Frau hat genau das getan. Ihn (ein Bauingenieur) lernte ich bei Grillfesten in den Jahren 2000 und 2001 kennen, zu denen meine Frau ihre Kolleginnen und Kollegen in unser damaliges Wohnhaus in Donaueschingen eingeladen hatte. Markus (so lautete sein Name) und ich verstanden uns von Anhieb und tauschten unsere Lebensgeschichten aus. Dabei erzählte ich ihm unter anderem, ich hätte gerade als Aufstiegsbeamter meine Prüfung für den gehobenen Verwaltungsdienst erfolgreich abgelegt. Außerdem sprachen wir über meine damaligen ehrenamtlichen Engagements, von denen auch öfter in der Presse zu lesen war, zum einen die von mir gegründete Selbsthilfegruppe für Suchtgefährdete und Angehörige, zum anderen das Bürgerprojekt Arche in Donaueschingen, das ich initiiert hatte, um Angebote und Nachfragen hinsichtlich des bürgerschaftlichen Engagements zu vermitteln.
Folgenreiches Gespräch
Einige Zeit später ergab sich ein bemerkenswertes Gespräch zwischen ihm und meiner Frau, das für unsere Zukunft entscheidende Änderungen hervorbrachte. Markus präsentierte meiner Frau eine Idee, die jedoch nicht sie selbst, sondern meine Person betraf. Er ließ seine Kollegin wissen, dass er der Auffassung sei, ich sei ein sehr geeigneter Typ für das Amt eines Bürgermeisters. Dabei bezog er sich auf die Eindrücke, die er bei seinen Gesprächen mit mir gewonnen hatte, und auf meine - ihm bekannten - ehrenamtlichen Engagements. Er hatte erfahren, dass in einer Gemeinde im Hegau, wo er im Fanfarenzug spielte, eine Bürgermeisterstelle ausgeschrieben war. Meine Frau, die bisher eine berufliche Betätigung im politischen Bereich (wenn wir allgemein darüber diskutierten) eher skeptisch betrachtete, reagierte auf den Vorschlag ihres Kollegen zu meiner Überraschung - sehr offen.
Abenteuerreise beginnt
Irgendwie war ich total fasziniert von dieser Idee des Kollegen meiner Frau und ich fühlte mich natürlich auch geehrt. Ich spürte geradezu eine Begeisterung auf Abenteuer in mir, der ich vermutlich nicht mehr ausweichen konnte oder wollte. Der Wunsch wuchs heran, mich in einen Bürgermeisterwahlkampf zu begeben. Mir war natürlich auch klar, dass ein Bürgermeisteramt - im Vergleich zu meinem bisherigen Job – noch mehr Arbeit und Engagement erfordern würde, allerdings mit dem Unterschied, dass ein Amtsträger dafür auch entsprechend bezahlt würde.
Bock auf etwas ganz Besonderes
Die Risiken, die ich einging, waren für mich überschaubar. Sollte mein Wahlkampfabenteuer scheitern, konnte ich danach mit dem Status als Beamter auf Lebenszeit an meinen bisherigen Arbeitsplatz zurückkehren. Nur das viele Geld, das ich dann für die Katz in einen verlorenen Wahlkampf investiert hätte, das war natürlich ein real existierendes Risiko. Aber ich nahm das in Kauf, denn ich hatte Bock auf neue berufliche Abenteuer! So nahm ich spontan Anlauf für einen sehr großen Sprung, ohne zu wissen, wie weit ich überhaupt springen kann. Aber ich war sehr gespannt darauf, was passiert.
Kommunalpolitik? – keine Ahnung!
Gesagt, getan: Im August 2001 schickte ich meine Bewerbung in die von dem Arbeitskollegen meiner Frau empfohlene Gemeinde und trat in den Wahlkampf ein, obwohl ich keine Ahnung hatte, wie sowas funktioniert. Bisher hatte ich zwar viele Erfahrungen in der öffentlichen Verwaltung gesammelt.
Unvorteilhafte Startbedingungen
Aber nie war ich in einem Hauptamt eines Rathauses tätig gewesen, wo man das Betriebssystem einer Kommune, also die direkte Arbeitsplattform eines Bürgermeisters und das Netzwerk zwischen kommunalpolitischem Handeln (Gemeinderat) und der Verwaltung mitbekommt und damit arbeitet. Zwar waren solche Arbeitsfelder auch ausführlich Themen in der Berufsausbildung. Aber schulisch Erlerntes und die Arbeitsrealität sind oft zwei unterschiedliche Welten. Ganz besonders − und das sollte ich noch gut kennenlernen − im Bereich der Kommunalpolitik. Nur in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hatte ich schon Erfahrungen sammeln können, allerdings nicht in kommunalpolitischer Hinsicht.
Professionelle Begleitung? – Fehlanzeige!
Deshalb erkannte ich sofort, dass ich mich umgehend von Fachleuten, die Bürgermeisterwahlkämpfe begleiten, zurüsten lassen sollte. Durch meinen spontanen Start in den Wahlkampf während der Sommerferien des Jahres 2001 war dies aber nicht mehr möglich, weil der erste Wahlgang bereits im Oktober 2001 stattfand. Die Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl, wo meine Frau studiert hatte, bot angehenden Bürgermeisterkandidaten und Kandidatinnen ein entsprechendes Seminar an, allerdings nur einmal im Jahr, und es hatte schon stattgefunden. Deshalb musste ich mich mit Anleitungen aus der Fachliteratur und aus anderen Quellen begnügen. Nur bei einem Dienstleister, der Rhetorikkurse durchführte, konnte ich kurzfristig Einzelstunden buchen, um meine Fähigkeiten und Wirkungen hinsichtlich meiner Auftritte und Reden – im bevorstehenden Wahlkampf - fit machen zu können.
Wenig Zeit für Zurüstung
Viel Zeit, um mich als Wahlkämpfer fit zu machen, hatte ich nicht mehr. In etwas mehr als zwei Monaten fand schon die Bürgermeisterwahl statt. Deshalb suchte ich das Gespräch zu Bürgermeistern in der Region, um mit ihnen über ihre Wahlkampferfahrungen zu sprechen, Tipps zu ergattern und um vielleicht etwas abgucken zu können. Flyer und Anzeigen im Amtsblatt sowie für die Zeitung musste ich für den ersten Wahlgang alle selbst kreieren, schreiben und drucken. Zeitnah galt es auch, mich in das kommunalpolitische Geschehen und in dessen Themenspektrum vor Ort einzuarbeiten. Hierfür beschaffte ich mir alle möglichen Informations-unterlagen, beispielsweise die Amtsblätter und die lokalen Presseberichte der letzten Monate.
Vorsicht Presse!
Meine ersten Schritte als Wahlkämpfer boten mir auch schnelle Lerneffekte. Ich musste rasch dazulernen. Zum Beispiel lud ich einen Pressevertreter der örtlichen Tageszeitung ein, nachdem ich meine Bewerbung für das Bürgermeisteramt im Rathaus abgegeben hatte. Dieser schrieb schon am nächsten Tag einen großen Artikel über das Interview mit mir als neuem Bürgermeisterkandidaten, mit großem Foto. Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich auch, dass sich ein Amtsleiter der Verwaltung vor Ort schon beworben hatte und bald noch ein weiterer Kandidat in den Startlöchern stehen würde. Und dann gab es noch eine Überraschung: Dieser Pressebericht wurde nicht nur in der Lokalausgabe der Gemeinde im Hegau gedruckt, wo ich mich als Bürgermeisterkandidat beworben hatte, sondern auch der Redaktion der gleichen Tageszeitung für die Ausgabe im Bereich Villingen-Schwenningen weitergeleitet, wo ich wohnte und vor allem arbeitete. Ungünstig war nur, dass ich meinen Amtsleiter noch nicht in meine neuen beruflichen Pläne eingeweiht hatte.
Nicht vergessen - Chef informieren!
Ich informierte ihn daher sofort, wenn auch nachträglich. Er fragte mich, ob ich mir den Wechsel in ein politisches Amt auch gut überlegt hätte. Ob ich nicht zu schnell gesprungen wäre mit meinem spontanen Entschluss, in einen Wahlkampf zu ziehen. Dabei verwies er (zutreffend) darauf, dass ich kommunalpolitisch bisher keine Erfahrungen hatte und damit Neuland betreten würde. Aber er räumte auch ein, so etwas Besonderes wie ein Wahlkampf für ein Bürgermeisteramt könne durchaus seltene Chancen hervorbringen, um sich einen großen Erfahrungsschatz hinsichtlich Kreativität und Ideenreichtum zu erschließen, unabhängig davon, ob ich letztlich als Sieger daraus hervorgehen würde oder nicht. Zu der letzteren Möglichkeit − wenn ich am Ende nicht zum Bürgermeister gewählt würde − fügte er noch mit verschmitztem Lächeln an, dass ihm dies dann auch nicht unrecht sei. In einem solchen Fall würde er seinen engagierten Einrichtungsleiter nicht verlieren. Letzteres klang dann doch wieder versöhnlich, und ich war froh, dass er nicht verärgert reagierte. Jedenfalls gab er seinem Respekt Ausdruck. Ich bewiese viel Mut, und er wünsche mir Kraft und Erfolg für die aufregenden Wahlkampfwochen, die nun vor mir lagen.
Pessimisten-Blues
Neben den abgewogen nachdenklichen Nachfragen meines Chefs erreichte mich auch eine Reihe von weniger zurückhaltenden, dafür kopf-schüttelnden Rückmeldungen − insbesondere aus Kollegenkreisen −, welche teilweise hämisch fragten, ob es mir zu wohl geworden sei. Sie brachten mehr oder weniger deutlich ihre Skepsis zum Ausdruck, ob ich einen Bürgermeisterwahlkampf erfolgreich abschließen könnte. Manche belustigte mein Vorhaben auch, doch damit hatte ich gerechnet. Den Pessimisten-Blues bekam ich ja schon seit meiner Kindheit von vielen "Musikern" in die Ohren geflötet. Solche "Melodien" waren mir nicht fremd. Ich kannte das ja, dass man mir eher sehr wenig, als sehr viel zutrauen wollte. Aus meinem direkten Umfeld in der Jugendhilfeeinrichtung fielen die Reaktionen freundlicher aus. Zum Beispiel ließ man mich wissen, mir deshalb nicht allzu viel Erfolg wünschen zu wollen, um mich nicht als Geschäftsführer zu verlieren. Das hörte ich nicht ungern. Woran ich mich jedoch auch noch gut erinnern kann, ist, dass ich so richtig entschlossen war, meine neuen Pläne zu verwirklichen. Da konnten mich keine Bedenkenträger mehr aufhalten.
Erkenntnis
Rückblickend gesehen verhielt ich mich im Jahre 2001 vermutlich wie ein Leistungssportler, der spät, fast zu spät, seine ganz eigenen Wege zum Erfolg entdecken konnte und sich danach, beflügelt von erreichten Erfolgen, immer größere Herausforderungen suchte, um zu sehen, in welche Höhen ihn die Flügel noch tragen werden.
Wahlkampfauftakt im Hegau
Ende August 2001 startete ich meinen Wahlkampf in der kleinen Hegau-Gemeinde mit einer Informationsveranstaltung in einem großen Gasthof. Vorbereitet hatte ich diese mit einer groben Übersicht über die kommunalpolitischen Themen der Zukunft, und ich nahm mir vor, mit den Besuchern darüber ins Gespräch zu kommen. Mein Ziel war es, mich als bürgernaher Kandidat zu präsentieren, der nicht mit einem vorgefertigten Positionierungskatalog aufschlug, sondern zunächst einmal vor allem zuhören wollte, um die Dorfgemeinschaft und ihre Anliegen kennenzulernen.
Erste Bürgerkontakte
Das kam nach meiner Wahrnehmung zunächst ganz gut an. Unter den Themenüberschriften sammelte ich Stichworte von Aussagen der Besucher. Die Besucherzahl war zwar noch relativ überschaubar, aber es gab muntere Diskussionspartner. Dennoch wäre es rückblickend besser gewesen, das Ende der Sommerferien abzuwarten, um nicht schon zu früh als erster von drei Bürgermeisterkandidaten mit einer öffentlichen Veranstaltung den Wahlkampf zu eröffnen. Es folgten zwei weitere Veranstaltungen in Gasthäusern, welche etwas besser besucht waren. Insgesamt konnte ich aber mit dem Verlauf dieser ersten Auftaktveranstaltungen für meinen Wahlkampf zufrieden sein.
Erste Panne
Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht überschauen konnte, waren die einflussreichen "Spieler", welche die kommunalpolitische Szene in der Gemeinde prägten. Da gab es beispielsweise den stellvertretenden Bürgermeister, ein Handwerksmeister mit einem großen Betrieb im Ort, der den Wahlkampf für "seinen" Kandidaten mit all seinen Vernetzungen unterstützte. Ebenso ein ehemaliger Kommunalpolitiker, ein Gastwirt, der ein Ausflugslokal an einer bekannten Sehenswürdigkeit im Ort führte. Letzter ließ mich eines Tages telefonisch zu "einem Stammtisch", - wie mir gesagt wurde -, in sein Gasthaus einladen. Diese Einladung nahm ich natürlich gerne an.
Vorsicht Falle!
Allerdings tappte ich damit in eine Falle, in welche nur ein unerfahrener Wahlkämpfer wie ich treten konnte. Mit Stammtisch meinte mein Gastgeber mitnichten einen Runden Tisch in seinem Lokal, wo sich eine Hand voll Gäste regelmäßig trafen, um ihr Bierchen zu genießen. Viel mehr traf ich bei meinem Eintreffen zu meinem Erstaunen eine große Gruppe ältere Männer vor, die an einer extra für diese Veranstaltung hergerichteten, langen Tischreihe Platz genommen hatten.
Wenn es anders kommt, als man denkt
In keiner meiner bisherigen Veranstaltungen in anderen Gasthäusern hatte ich so viele Besucher gehabt, und ich spürte sofort, wie mich alle diese Herren erwartungsvoll fixierten. Das war für mich im ersten Augenblick eine mehr als spannende Wahrnehmung. Mir war sofort klar, dass ich bei einer solchen Zuhörerschaft, Dorf-Multiplikatoren, im Ort bekannte Leute, ehemalige Geschäftsleute, Vereinsvertreter meinen Auftritt ganz anders hätte vorbereiten müssen als für ein Treffen mit ein paar biertrinkenden Gästen an einem Stammtisch. Aber dazu war es nun zu spät! Wie gut, dass mich diese älteren Herrschaften nicht wegen meiner Überraschungsaufregung haben "schlucken" hören, als ich mich bei meinem Eintreffen in das Lokal erst einmal innerlich sammeln musste. Aber ich atmete tief durch, riss mich zusammen und legte los, allerdings nur in einem Improvisationsmodus.
Strenge Zuhörerschaft
Als ich mich selbst, meine Eindrücke von der Gemeinde, sowie erste Anmerkungen zu einigen Themen für die künftige Kommunalpolitik kurz und improvisiert vorgestellt hatte, lud ich die Besucher − wie auch bei den Informationsabenden zuvor in anderen Gasthäusern − ein, nun ebenso ihre Themen oder auch ihre Erwartungen einzubringen, um dazu mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Tritt an's Schienbein
Wie aus der Pistole geschossen belehrte und ermahnte mich daraufhin ein älterer Mann aus der Tischreihe mit forderndem Unterton. Er und seine Tischgenossen seien nicht gekommen, um meine Fragen zu beantworten, sondern um von mir zu erfahren, mit welchen konkreten Konzepten und Ideen ich ihre Gemeinde erfolgreich in die Zukunft führen wolle. Dafür bekam er viel Applaus. Ich antwortete zunächst, ich würde rechtzeitig vor der Wahl mein ausführliches Konzept dazu vorstellen. Dann bekräftigte ich aber meine Absicht, ein bürgernaher Bürgermeister zu werden. Ich könne nur dann glaubwürdig sein, so meine Klarstellung, wenn ich zuerst die Anliegen und Meinungen der Bürgerschaft zur Zukunft ihrer Kommune kennenlernte, bevor ich mich zu Einzelthemen festlegte. Mit diesem Argument hoffte ich, mich mit den Zuhörern doch noch austauschen zu können. Doch ganz habe ich die Kurve an diesem Nachmittag leider nicht mehr hinbekommen. Mit Einsatz mancher - kommunikativer Hilfsgriffe - brachte ich zwar dieses große Männertreffen der Senioren noch mit einem blauen Auge hinter mich. Aber mir sprang viel Skepsis entgegen, das spürte ich schon bald.
Selbstkritisch
Ich musste selbstkritisch erkennen, dass ich leichtsinnig und naiv dorthin gegangen war, was mich ärgerte. Besonders wütend machte mich, dass ich es versäumt hatte, mich im Vorfeld ausreichend darüber zu informieren, welche Zielgruppe mich bei diesem "Stammtisch" erwartete. Sonst wäre mir klar gewesen, dass ein Männer-Seniorenstammtisch sich nicht für eine "Werkstattmoderation" eignet. Dass er unterhalten werden will, mit handfesten Aussagen, wie ich mir die künftige kommunal-politische Entwicklung vorstelle, sollte ich Bürgermeister werden.
"Hätte, hätte, Fahrradkette"
Da war ich mit Recht sauer auf mich selbst. Es ging mir schlecht. Aber ich fing mich auch bald wieder. Und wie es manchen Leuten geht, besonders Menschen mit einem ADS, wenn sie etwas Wichtiges richtig verbockt haben, so träumte auch ich im Nachhinein davon, wie es besser gelaufen wäre, wenn ich alles richtig gemacht hätte. Das tat ich übrigens schon als Kind, wenn Dinge schlecht liefen. Dann träumte ich davon, ich hätte es besser gemacht. Nun erlebte ich diese reflexartige Träumer-Reaktion auch als Wahlkämpfer.
Kreative Verdrängungsträume
Bei solchen Träumen hatte ich durchaus kreative Vorstellungen zu möglichen Handlungsalternativen. So auch hinsichtlich dieser verbockten Wahlkampfveranstaltung mit dem Männer-Senioren-Stammtisch. In meinem Traum fühlte sich alles besser an. Dort "sah" ich, in welcher gewinnenden Art und Weise ich den älteren Herrschaften mein Wahlkampf-Menü in drei Gängen servierte, wie es ihnen super schmeckte, und wie sie sich nach dem Mahl pappsatt auf ihren Stühlen zurücklehnten. Dazu gab es auch allen Grund, weil ich meine Zuhörerschaft mit meiner traumhaften Präsentation nach allen Regeln der Kunst verwöhnt hatte.
"Moderationsmenü"
- Vorspeise -:
Mein selbstbewusstes Auftreten, mit einer überzeugenden persönlichen Vorstellung.
- Hauptgang -:
Vortrag eines kommunalpolitischen Feuerwerks, mit umfangreichen Aufzählungen von konkreten Zielen während meiner Regentschaft nach meiner Wahl zum neuen Bürgermeister,
- Dessert -:
Moderation einer lebhaften Diskussion zu den von mir vorgetragenen Themen.
Aus der Traum!
So verliefen sie, meine Traumvorstellungen zu der letzten Wahlkampfveranstaltung. Durch die lauten Beifallsstürme meiner betagten Zuhörer wachte ich dann leider wieder auf − und da war sie wieder, die reale Welt! Für diesen Männer-Senioren-Stammtisch war es leider zu spät, um positiver auffallen zu können. Allerdings brannten sich bei mir die Ursachen dieser Panne tief ein, und ich bereitete Wahlkampftermine fortan sorgfältiger vor. Aus Schaden wird man klug, dieser Spruch traf auf mich bei meinen weiteren Aktivitäten zu. In diesem Sinne stand ich bald wieder auf und setzte den Wahlkampf mit großem Engagement fort.
Wahlkampf-Aktivitäten
Wesentlich erfolgreicher verlief die Umsetzung einer meiner Wahlkampfideen zu einem Thema, das ich von Eltern und Großeltern der Gemeinde zugesteckt bekam. Die Gemeinde, in welcher ich mich als Bürgermeister bewarb, hatte unterschiedliche topografische Ebenen. Im oberen Teil der Kommune fehlte den (Groß-)Eltern ein großer Spielplatz für ihre Kinder und Enkel. Neben der Jugendhilfeeinrichtung, die ich in Villingen-Schwenningen leitete, befand sich ein Lager des so genannten Kreisjugend-Rings. Dort konnten Träger von Einrichtungen für die Kinder- und Jugendarbeit oder auch andere Gastgeber von Veranstaltungen mit Kindern kleine bis große Spielgeräte ausleihen oder mieten. Von der Hüpfburg über Trampolingestelle bis hin zu provisorischen Sandkästen und Schaukelpferden gab es eine umfangreiche Auswahl. Da hatte ich leichtes Spiel für eine Wahlkampfidee.
Einladung an Familien mit Kindern
Ich lud Familien mit Kindern in der Hegau-Gemeinde an einem Samstag auf einem größeren Platz in diesem oberen Ortsteil zu einem Treffen ein, auf welches ich über die Zeitung, mit einer Werbeanzeige im örtlichen Amtsblatt und über von mir verteilte Einladungszettel aufmerksam machte.
Spielgeräte
Mit einem gemieteten VW-Bus transportierte ich einige Spielgeräte für einen improvisierten Spielplatz an den vorgesehenen Standort und baute mit diesen einen provisorischen Kinderspielplatz auf. Meine Familie unterstützte mich dabei. Bei diesem Familientreffen ergaben sich gute Möglichkeiten, mit einigen Eltern und interessierten Leuten öffentlichkeitswirksam zu sprechen und mit ihnen über neue Ideen für mehr Familienfreundlichkeit in der Wohngemeinde zu diskutieren. Auf einem aufgebauten Flipchart gab es für alle Besucher und Besucherinnen die Möglichkeit, Wünsche für mehr Familienfreundlichkeit in der Gemeinde mit bunten Filzschreibern aufzuschreiben. Ich erhielt so eine ergiebige Sammlung von Anregungen, die ich für meine künftigen Wahlkampfauftritte nutzen konnte. Die Presse war vor Ort und berichtete danach recht positiv über meine Aktion. Überhaupt verstand ich mich mit dem Journalisten der Lokalpresse sehr gut. Diese und andere Aktionen kamen gut an.
Hunderte Klinken putzen
Gefühlt hunderte von Kilometern legte ich bei den wochenlang täglich durchgeführten Hausbesuchen zurück, bei welchen ich überall dort das kurze Gespräch suchte, wo sich die Türen öffneten. Bei solchen Hausbesuchen machen Wahlkämpfer ganz bunte Erfahrungen. So auch ich. Von Haus aus war ich allerdings nicht so gestrickt, dass es mir leichtgefallen wäre, an den Haustüren zu klingeln und Leute spontan anzusprechen. Dazu brauchte es einige Überwindung, doch mit der Zeit lief es ganz gut.
Interessante Begegnungen
Es gab positiv verlaufende Begegnungen, aber auch weniger freundliche, und auch − jedoch selten − schroffe Ablehnung. Überwiegend positive Begegnungen hatte ich mit Gewerbetreibenden und Selbständigen, welche ich − wie meine zwei Mitbewerber auch − vor Ort besuchte. Eine solche Begegnung sollte im Wahlkampf für den zweiten Wahlgang noch große Bedeutung haben. Aber dazu später.
Seltsamer Dorf-Promi
Eine Ausnahme hinsichtlich freundlicher Begegnungen mit Gewerbetreibenden gab es aber auch: Als ich den selbständigen Handwerksmeister, der auch Bürgermeisterstellvertreter war, in seinem Betrieb besuchte, wurde ich zunächst in einen Warteraum geführt. Lange musste ich dort warten, bis ich zum Gespräch empfangen wurde. An die Gesprächsatmosphäre kann ich mich gut erinnern: unterkühlt und kurz. Mein extrovertierter und wortgewaltiger Gastgeber "beschenkte" mich mit einer Selbstdarstellung, die keinen anderen Schluss zuließ, als dass es sich bei ihm um einen besonders begnadeten und einflussreichen Kommunalpolitiker handelte. Bestärkt in diesem Eindruck wurde ich, als mich der ungekrönte Ortskönig noch wissen ließ, wie er auch ab und zu schon mal Entscheidungen des amtierenden Bürgermeisters veränderte, wenn dieser im Urlaub war und er so lange im Rathaus, − als sein dann amtierender Stellvertreter −, das Sagen hatte.
Bunte Meinungsvielfalt
Je näher der Wahltermin heranrückte, desto mehr Meinungsäußerungen gab es zu den Bürgermeisterkandidaten bei meinen Hausbesuchen. Selbstverständlich warb ich nur um Vertrauen für mich und fragte die Leute nicht an der Haustüre direkt, welchen Kandidaten sie wählen wollten. Das wäre sehr ungeschickt gewesen. Aber manche sprachen mir von sich aus ihr Vertrauen aus und wünschten mir viel Erfolg. Die meisten blieben jedoch zurückhaltend und legten sich nicht fest, welche Wahl sie am Wahltag treffen würden. Aber sie äußerten in Form von interessanten Zwischentönen ihre Vorbehalte, ihre Zustimmung oder ihr Desinteresse. Andere ließen mich direkt wissen, ich sei in ihren Augen nicht der richtige Bürgermeisterkandidat für die Gemeinde.
Neuer Spitzname
Irritierend war in diesem Zusammenhang auch, dass ich − ebenfalls bei den Hausbesuchen − zunehmend mitbekam, wie mir in einer Kampagne ein Spitzname verpasst wurde. Ich war für viele Leute, mit denen ich sprach, "nur" noch der Sozialarbeiter. Damit hatte ich zwar grundsätzlich kein Problem, weil ich mit diesem Beruf ein gutes Image verband und diese Berufsgruppe unverzichtbare Leistungsträger im sozialen Umfeld der Gesellschaft sind. Aber ich musste ab einem bestimmten Zeitpunkt sehr oft erklären, dass ich aus dem gehobenen Verwaltungsdienst kam und sehr wohl auf eine langjährige Erfahrung in der kommunalen Verwaltung zurückschauen konnte. Die gestreuten Gerüchte verfolgten offensichtlich das Ziel, mit der Bezeichnung "Sozialarbeiter" Menschen zu verbinden, die keine Ahnung von kommunaler Verwaltung haben, und den Eindruck zu erwecken, es handele sich dabei um blauäugig in die Zukunft schauende Polit-Romantiker.
Wahlkampf-Finale
Der viele Wochen andauernde Wahlkampf näherte sich inzwischen dem bevorstehenden Wahltag Anfang Oktober 2001 an. Ich hatte mit Herzblut gekämpft und alles mir Mögliche eingesetzt, um bei der Bürgermeisterwahl erfolgreich zu sein. Auch alle meine Urlaubstage waren aufgebraucht. Das waren aufregende und höchst anstrengende, aber auch super-spannende Wochen. Bei meiner bunten beruflichen Vorgeschichte und nach meinen errungenen Aufstiegen wäre ein Wahlsieg natürlich die Trophäe aller Trophäen gewesen. Ein kolossaler Triumph!
Schaulaufen vorbereiten
Doch zunächst galt es noch, die höchste Hürde im Wahlkampf zu nehmen, die obligatorisch stattfindende offizielle Kandidatenvorstellung durch die Gemeinde erfolgreich zu überstehen, die üblicherweise in einer Festhalle stattfindet. Zu diesen in ihrem Ablauf streng strukturierten und meistens bis auf den letzten Platz gefüllten Veranstaltungen kommen sie alle: Die normale Bürgerschaft, die Multiplikatoren aus den Vereinen und Organisationen, Einflussreiche und welche, die es werden wollen. Erfahrungsgemäß ist der Verlauf dieser Präsentation der Kandidaten dort vorentscheidend für den späteren Wahlausgang.
Verzockt!
Also galt es für die drei Bürgermeisterkandidaten, uns für dieses Ereignis optimal vorzubereiten. Bei einer vorherigen Hallenbegehung mit dem noch amtierenden Bürgermeister der Gemeinde fragte dieser uns Kandidaten unter anderem, ob jemand beabsichtige, seinen Vortrag mit Folien oder Lichtbildern zu gestalten. Man werde dann das technische Gerät bereithalten.
"Köder muss dem Fisch schmecken (…)"
Leider kannte ich damals noch nicht das Sprichwort: Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ansonsten hätte ich mich nicht spontan für einen frei vorgetragenen Lichtbildervortrag entschieden, nur weil mir eine solche bunt-kreative Idee spontan sehr zusagte. Aber ich tat es. Allerdings war ich später der Einzige, der in diesem Lichtbilderformat seine Vorstellung präsentierte, was sich aber nicht vorteilhaft für mich auswirken sollte. Dazu später mehr…
Choreografie
Dann erläuterte der Bürgermeister den genauen Ablauf. Zuerst standen seine Anmoderation sowie die gemeinsame, kurze Vorstellung aller drei Kandidaten, auf dem Programm. Daraufhin war vorgesehen, dass zwei der Kandidaten in einen Nebenraum geführt wurden, damit sie nicht die Ausführungen des Konkurrenten belauschen konnten. Nacheinander – so die Planung – folgte dann die Auswechslung der Kandidaten für ihre Solo-Auftritte, für jeweils zwanzig Vortragsminuten. Anschließend war es der Bürgerschaft erlaubt, Fragen an den Kandidaten zu stellen. Insgesamt konnte aber jeder Kandidat nur dreißig Minuten in Anspruch nehmen, also waren zehn Minuten für die Fragerunde übrig. Wenn dann alle drei Kandidaten den ersten Teil der Vorstellung absolviert hatten, wurden sie gemeinsam wieder auf das Podium geführt, und die Zuhörerschaft durfte dreißig Minuten lang allen Kandidaten Fragen stellen. Nach zwei Stunden sollte also die geplante Show enden.
Die Show beginnt
Wer hat wie gepunktet?
Nach dieser Vorstellungsshow war ich natürlich neugierig, wie ich im Vergleich zu meinen Mitbewerbern abgeschnitten hatte. Die Vorträge meiner Mitbewerber konnte ich − wie schon beschrieben − zwar nicht selbst mitverfolgen, dafür aber meine Frau und einige Unterstützer, welche bei den Zuhörern saßen. Von ihnen erhielt ich nach der Show einige Informationen:
I. Der Amtsleiter
Der Erstredner und Amtsleiter vom Rathaus brillierte nach den mich später erreichten Rückmeldungen mit einer gut durchstrukturierten, überzeugenden Rede. So sei es ihm gelungen, alle wichtigen und aktuelle Themen im Ort, die ihm durch seine Arbeit im Rathaus naturgemäß bestens bekannt waren, gut, vollständig und verständlich zu beschreiben. Außerdem war er gut mit den Vereinen vor Ort vernetzt und sprach − so die Beobachter − aus, was die zahlreich vertretenen Vereinsvertreter im Saal hören wollten. Zu den vorgetragenen Themen habe er sich auch plausibel positioniert und sei mit diesem fundierten orts- und sachkundigen Vortrag insgesamt gut angekommen. Darüber hinaus traf er offensichtlich den Nerv der Bürgerschaft mit mahnenden Worten für die weitere Einhaltung einer soliden Finanzpolitik, welche er als Voraussetzung dafür darstellte, dass die Gemeinde auch in der Zukunft handlungsfähig bleiben würde. Schließlich habe er, - mit erhobenen Zeigefinger -, seine Ausführungen abgeschlossen. Bei allen Wünschen für Investitionen müsse man stets beachten, dass man jeden Euro nur einmal ausgeben könne. Dafür sei er dann − so meine Informanten − mit kräftigem Applaus belohnt worden.
II. Der "Sozialarbeiter" (ich)
Nach dem ortskundigen Zahlen-Daten-Fakten-Amtsleiter-Mann kam dann ich, der "Sozialarbeiter" ans Rednerpult. Meine Lichtbilder-Performance habe manche Besucher im Saal irritiert, wurde mir als Erstes von meinen kritischen Beobachtern gesteckt. Mit meinen mühsam gestalteten Folien präsentierte ich meine Vita. So waren eingangs auf diesen Folien Fotos meiner Familie und meiner Geburtsstadt Freiburg ebenso wie grafische Darstellungen zu meinem bisherigen beruflichen Leben abgebildet. Es schlossen sich Folien zu kommunal-politischen Themen an, die ich in meine Rede aufnahm. Ebenso zeigte ich meine jeweiligen Positionierungen zu bestimmten Themen auf und die Ziele, die ich verfolgen wollte, falls ich Bürgermeister werden sollte. Zum Abschluss sah man noch eine Bilderreihe von meinen Wahlkampfterminen.
Zurückhaltung kostet Punkte
Zu einem in der Hegau-Gemeinde sehr aktuellen kommunalpolitischen Thema wollte ich in meiner Vorbereitung besonders punkten. Es ging um konkrete Maßnahmen, die ich im Falle meiner Wahl verfolgen würde, um die Situation hinsichtlich der stark befahrenen Ortsdurchfahrt zu entschärfen, die Optik des umgebenden Ortsbildes verbessern und ebenso die eingeschränkte Lebensqualität der Anwohner. Dafür hatte ich mich zwar gut und umfangreich vorbereitet. Aber ich konnte trotz aller Bemühungen inhaltlich nicht konkret genug werden. So blieb ich oberflächlich hinsichtlich der Machbarkeit meiner Vorschläge, weil mir dazu leider belastbare Informationen der zuständigen Straßenverkehrsbehörde fehlten, die ich mir erhoffte. Versprechungen loszulassen, die ich nicht glaubwürdig als machbar darstellen konnte, das war mir zu riskant. Außerdem befürchtete ich, in eine Falle zu tappen, wenn ich am Ende meiner Rede von Unterstützern meiner Mitbewerber mit unangenehmen Fragen vor allem zur Verkehrsberuhigung in der Ortsmitte konfrontiert worden wäre. Es bestand die Gefahr, manche Antworten schuldig bleiben zu müssen. Dann wäre ich angreifbar geworden. Ich entschied mich deshalb in letzter Minute für eine Darstellung meiner Ideen in einer allgemeineren Form.
Unterstützer enttäuscht
Meine Unterstützer enttäuschte das allerdings sehr, weil gerade dieses Thema mir durch seine hohe Aktualität die beste Chance geboten hätte, mich von meinen Mitbewerbern in positiver Weise abzusetzen. Entsprechend erreichte mich nach dem Vorstellungsabend Kritik. Aber es gab auch positive Rückmeldungen für meinen Auftritt.
Der III. im Bunde
Der Vortrag des dritten (auswärtigen) Kandidaten, der zum Schluss seinen Auftritt hatte, sei − wie mir erzählt wurde − zwar nicht besonders fesselnd und auch nicht so detailverliebt gewesen, wie bei dem ortsansässigen Mitbewerber und Gemeinde-Amtsleiter. Aber er habe mit seinem ebenfalls sehr gut durchstrukturierten Vortrag überzeugen können, der übrigens wieder im klassischen, seriösen Stil, ohne Lichtbilderzauber (wie bei meinem Vortrag) präsentiert wurde.
Wahltag ist Zahltag
Nach der Veranstaltung blieben noch ein paar Tage, welche für den Restwahlkampf genutzt werden konnten. Dann kam der Sonntag der Wahl. Vorweg: Die Stimmenauszählung am Wahlsonntag ergab, dass ein zweiter Wahlgang erforderlich wurde, da keiner der drei Kandidaten die absolute Mehrheit von über fünfzig Prozent der abgegebenen Stimmen erreichen konnte. Mein Abschneiden bei diesem ersten Wahlgang war zwar respektabel und mit etwas unter zwanzig Prozent der abgegebenen Stimmen musste ich mich bei drei Bewerbern überhaupt nicht verstecken. Aber es war halt nur der dritte von drei Plätzen, was mich natürlich sehr enttäuschte.
Schwerer Schlag
Nach einem wochenlangen Wahlkampfmarathon war dies zunächst einmal ein schwerer Schlag, den ich verkraften musste. Zum Verarbeiten und als Trost hinsichtlich dieses enttäuschenden Abschneidens wäre ein kurzer Rückblick geeignet gewesen, um mir bewusst zu machen, wie ich überhaupt zum Wahlkämpfer wurde. Zur Erinnerung: Ich war im August 2001 ganz spontan, ohne jede Vorbereitung und ohne jede Erfahrung in der Kommunalpolitik einfach in einen handgestrickten Wahlkampf gestartet.
Wunden lecken
Aber eine solche Rückschau hilft dem Wahlkämpfer mit dem schlechtesten Ergebnis am Wahlabend nicht wirklich weiter. Er muss erst einmal seine Wunden lecken. Dazu brauchte es eine Menge Frustrationstoleranz und für das Wieder-Aufstehen ein großes Maß an positivem Denken. Vermeiden musste ich außerdem, in dieser Phase des Rückschlags an die vielen Leute zu denken, die mir entschieden davon abgeraten hatten, in diesen Wahlkampf zu ziehen, und die mich teilweise auch für verrückt erklärten. Auf der anderen Seite verspürte ich einen sehr starken inneren Drang, mich von jahrzehntelang festgezurrten Fesseln zu befreien, mich nicht mehr als Verlierer zu sehen. Ich wollte mich neu erleben und es allen zeigen. Dazu war ich bereit, einen hohen Einsatz zu bringen. Diese Entschlossenheit gab mir Adrenalin sowie neue Energie zum Weitermachen und aus dem früheren HANS GUCK IN DIE LUFT wurde ein erstaunlich zielbewusster Kämpfer.
Flinte ins Korn werfen?
Noch am Wahlabend wurde ich auf eine schwierige Entscheidung angesprochen, die ich zeitnah treffen musste. Weiter machen, oder aufgeben? Welche Kandidaten gehen im zweiten Wahlgang in die Stichwahl und wer gibt auf?
Hilfe! – Trostspendermarathon
Zunächst musste ich aber an dem nicht enden wollenden Wahlabend nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses sehr viele warme Worte der Tröstung bei laufendem Blitzlichtgewitter entgegennehmen. Am liebsten wäre ich auf einer Wolke davongeflogen. Auch viel Schulterklopfen, das ich teilweise als widerlich empfand, musste ich aushalten. Schließlich gab es noch umfangreiche Respektäußerungen für das Achtungsergebnis, das ich nach der Auszählung der Wählerstimmen mit meinem dritten von drei Plätzen erreichen konnte. Darunter gab es auch einige ehrliche und Mut-machende Reaktionen aus der Bürgerschaft. Man wünschte mir viel Erfolg, falls ich in den zweiten Wahlgang gehen würde. Diesen konnte der einheimische Mitbewerber mit dem besten Stimmenergebnis auf jeden Fall ermutigt angehen. Ihn umgaben sehr viele Gratulanten und Unterstützer, lautstark angeführt vom Stellvertreter des Bürgermeisters, dem kommunalpolitischen Schwergewicht und Handwerksmeister aus der Gemeinde. "Des hescht guet gmachet" rief er mehrfach seinem − von ihm unterstützten − Mitbewerber voller Freude zu, während andere ihn herzlich umarmten.
Ja oder nein?
Dann aber kam - die bereits erwähnte - brenzlige Frage auch auf mich zu. Insbesondere die Lokalpresse wollte sie direkt beantwortet haben: Werden Sie in die Stichwahl gehen, drei Wochen später, ja oder nein?
Emotionen siegen über Vernunft
Es hätte nahegelegen, mich aus dem Wahlkampf zurückzuziehen und die Stichwahl meinen zwei besser platzierten Mitbewerbern zu überlassen, obwohl der Zweitplatzierte nicht sehr weit von meinem Stimmenergebnis entfernt lag. Aber auch der Blick in meinen Geldbeutel mit seiner inzwischen gähnenden Leere sprach sehr für einen Rückzug aus dem teuer gewordenen Wahlkampf. Aber diese Szene verlief wie in einem Boxring, nachdem einer der Kontrahenten einen Wirkungstreffer kassieren muss und kurz ins Taumeln gerät. Er muss dann kurzfristig das Signal an den Ringrichter geben, ob der Kampf trotzdem weiter gehen oder abgebrochen werden soll. Nicht immer reagieren Boxer und seine jeweilige "Ecke", vernünftig. Vielleicht war es ab diesem Zeitpunkt gefühlte Berufung, einmal Bürgermeister einer Gemeinde zu werden. Oder es lag an dem überschießenden Adrenalin am Wahlabend.
Ja zu neuem Feldzug
Wie auch immer: Ohne lange über das Für und Wider nachzudenken, entschied ich mich fürs Weitermachen. Ich wollte und konnte mich nicht geschlagen geben, und setzte - voll entschlossen - auf Neustart, dem auch meine Frau grünes Licht gab. Der Erstplatzierte des Abends wird sich darüber gefreut haben, denn mit meiner Entscheidung stiegen für ihn die Chancen enorm, dass sich seine beiden auswärtigen Kontrahenten auch im zweiten Wahlgang wieder die Stimmen teilen mussten, und er der lachende Dritte sein würde, mit einer einfachen Mehrheit. Und so ging es bald in eine zweite - nicht weniger spannend verlaufende - Runde im Bürgermeisterwahlkampf der Hegau-Gemeinde.
Niemals aufgeben
Als die Presse mich fragte, woher ich denn so viel Zuversicht nehme, das Blatt als Drittplatzierter noch wenden zu können, da gab ich vollmundig meiner Zuversicht Ausdruck. Ich stellte - mit zugegeben - aufgesetzter Lässigkeit fest: "Nach einer Analyse des bisherigen, und anschließender Optimierung des folgenden Wahlkampfes werde ich in den verbleibenden drei Wochen nochmals alles geben, mit dem Ziel, die Wählerinnen und Wähler davon zu überzeugen, dass ich für sie der richtige Kandidat bin".
Selbstkritik nach "Liebesschwur"
Dann setzte ich noch eins drauf: Ich verriet meinen Zuhörern, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als am Ende doch noch zu ihrem neuen Bürgermeister gewählt zu werden. Spätestens als ich diesen Satz später selbst in der Zeitung las, musste ich mir insgeheim eingestehen, kurz über mich selbst irritiert gewesen zu sein, von dem, was ich da losgelassen hatte. Ich erkannte, dass ich mich nun auch umgangssprachlich inzwischen zu einem Politiker gemausert hatte, wenn es um die zielführende Wortwahl zur Erreichung einer bestimmten Außenwirkung ging. Aber für Gefühlsduseleien blieb keine Zeit, und ich war mir sicher, meine Auftritte müssten im weitergehenden Wahlkampfverlauf ab sofort noch bestimmter, noch entschlossener und noch siegesgewisser wirken. Wie bei meinen Mitbewerbern auch, formulierte ich meine Wahlkampfaussagen fortan zugespitzter.
Guter Imagewechsel?
Mein anfängliches Image als ein ehrlicher, bodenständiger, netter sowie berufserfahrener Familienvater, das mich als bürgernahen Kandidaten glänzen lassen sollte, gab ich teilweise auf. Ich glaubte, mit einem kantigeren Auftritt bei den Wählern besser punkten zu können.
Neustart
Unmögliches möglich?
Aber - wie - ich eine solche Image-Korrektur zielführend in nur noch drei Wochen umsetzen konnte, das war die Frage der Fragen. Und als ich gerade begann, in meinem kleinen Büro zuhause in Donaueschingen über einer Antwort darauf zu brüten, da läutete das Telefon. Tatsächlich eine Szene wie in einem Film. Auch sollte ich gleich zu Beginn des Telefongesprächs an ein Sprichwort erinnert werden: "Die schönsten Dinge passieren unerwartet". Was war geschehen?
Verrückt-wahre Geschichte
Am anderen Ende der Telefon-Leitung meldete sich ein Grafiker aus der Gemeinde im Hegau, den ich bei meinen Hausbesuchen kurz hatte kennenlernen können. Er eröffnete mit Kollegen eine Werbeagentur in einer nahegelegenen Großen Kreisstadt und teilte mir zunächst mit, er habe meine Auftritte im bisherigen Wahlkampf mit Interesse beobachtet.
Professionelles Outfit
Was meine persönlichen Auftritte betreffe, − so sein Resümee −, sei ich in seinen Augen positiv "rübergekommen". Allerdings sei ihm als Werbefachmann aufgefallen, dass mich keine professionell gestalteten Werbeträger begleitet hätten. Deshalb, − so war sich der junge Marketingspezialist sicher, − sei das Wahlergebnis beim ersten Wahlgang nicht vorteilhaft für mich ausgegangen. Das Sprichwort "Kleider machen Leute" gelte aus seiner Sicht auch für wahlkämpfende Bürgermeisterkandidaten.
Überraschendes Angebot
Ich war zunächst perplex, dass ein Werbefachmann mich als Dritt-Platzierten anrief, um mir seine Unterstützung anzubieten. Natürlich dachte ich gleich daran, diese Kontaktaufnahme hätte das Ziel, mich geschickt als neuen Kunden für teure Werbeproduktionen zu angeln. Ich konfrontierte den Werbefachmann deshalb sogleich mit meinem Vorbehalt für sein Angebot und setzte ihn bewusst über meine schwierige finanzielle Lage in Kenntnis sowie darüber, dass ich mir ihn nicht leisten könne. Damit würde unser Telefongespräch bald zu Ende sein, dachte ich. Falsch gedacht, ganz im Gegenteil!
Hochinteressante Offerte
Nun folgte der überraschende, hoch interessante Teil der Offerte. Der Werbeprofi schlug mir vor, mich für sein neu eröffnetes Werbebüro sozusagen als Werbefigur zur Verfügung zu stellen. Meinen sofort angemeldeten Erläuterungsbedarf beantwortete er mit seriösen Vorschlägen und Vorstellungen. Danach würde seine neue Firma mich zunächst und umgehend zu einem Fototermin mit Profi-Fotograf einladen, (damals war ich übrigens gutaussehend und fotogen …), zu welchem ich allerdings "etwas Zeit" mitbringen müsse. Schließlich würde die Werbeagentur mit mir Texte für Kampagnen erarbeiten und abstimmen. Am Ende käme es dann zum Druck von Hochglanz-Flyern und Plakaten. Als ich ihn fragte, welche Kosten auf mich zukämen, bot er an: Für die reinen Sachkosten müsste ich einmalig einen kleinen Betrag (etwa 200 Euro) übernehmen. Sollte ich im zweiten Wahlgang verlieren, kämen garantiert keine weiteren Kosten auf mich zu. Bei einem Wahlsieg müsste ich allerdings die (hohen) Gesamtkosten für die Herstellung solcher hochwertigen Werbeprodukte tragen.
Deal perfekt
Nach kurzem Nachdenken realisierte ich, dass am anderen Ende der Telefonleitung ein pfiffiges Schlitzohr saß, der eine − in der Öffentlichkeit intensiv ausstrahlende − Werbeaktion im Rahmen eines Bürgermeisterwahlkampfes als Marketingplattform sah, um Aufmerksamkeit für seine neu gegründete Werbeagentur zu erzeugen. Gleichzeitig bot er mir eine einmalige Gelegenheit, professionell gestaltete Werbeträger für die zweite Runde des verlängerten Wahlkampfes einsetzen zu können, die ich mir finanziell nicht hätte leisten können. Von einem solchen, − in finanzieller Hinsicht risikofreien − Glücksdeal, welcher derart total überraschend um die Ecke kam, konnten oder können wahlkämpfende Bürgermeisterkandidaten ansonsten vermutlich nur träumen. Mich freute es jedenfalls, ich fühlte mich geehrt und spürte einen − in dieser Phase eines Wahlkampfes − so wichtigen Motivationsschub.
Fotoshooting
So kam es dann zeitnah zu einem vereinbarten Fototermin vor Ort mit meiner ganzen Familie an Bord, um gewinnende Bilder für die geplanten Werbeträger einzufangen. Ebenfalls an Bord hatte ich, − wie zuvor besprochen −, verschiedene Jacketts, Pullover und Hemden. Treffpunkt war der historische Altstadtbereich des kleinen Städtchens. Als wir pünktlich auf einem Platz in der Nähe des alten Stadttores ankamen, wollte ich direkt wieder umdrehen. Warum? Am Ort des Geschehens hielten sich schon mehrere Leute auf, welche hochaktiv dabei waren, ein aufwendiges Equipment inklusive große Sonnenschirme aufzubauen. Man konnte meinen, hier würde gleich ein Kinofilm gedreht. Mit so hochprofessionellen Werbefachleuten und Fotografen hatte ich es noch nie in meinem Leben zu tun gehabt. Aber es gab natürlich kein Zurück mehr.
Szenen wie am Set in Hollywood
Als ich aus dem Auto stieg, wurde ich sogleich in Empfang genommen. Eine nette junge Dame begleitete mich an eine Stelle, wo schon ein Stuhl auf mich wartete. Auf diesen durfte ich mich sogleich setzen und sie begann, mein Gesicht aufzuhübschen, wie man das aus der Maske im Theater kennt. Zuvor musste ich schon einige Kleidungsstücke wechseln. Als ich dann sozusagen runderneuert und bereit war für den ersten Teil des Fotoshootings, wurden mir verschiedene Plätze zugewiesen, auf die ich mich stellen sollte, und mir wurde erklärt, was nun in welcher Umrahmung mit mir gleich fotografiert werden sollte und wie ich mich jeweils zu verhalten hätte. Gerade hatte ich mich zu der ersten Fotoreihe positioniert, da kamen einige Bürger an dem Ort des Geschehens vorbei und grinsten breit über das ganze Gesicht, als sie mich erkannten und sahen, was für ein Spektakel gerade stattfand. Einerseits war mir das megapeinlich, andererseits faszinierte mich das Geschehen.
Technik – ohne Ende
Einen solchen Aufwand zu treiben, nur um mich zu fotografieren, das konnte ich kaum fassen. Meine Blicke saugten alles auf, was Spannendes um mich herum geschah. Vieles gab es zu sehen sowie gedanklich einzuordnen. Ich vermutete schließlich, dass durch die Neugründung dieser Werbeagentur mit mir auch das neu angeschaffte Equipment und die Zusammenarbeit zwischen Werbefachleuten und Fotografen geübt und getestet wurde und alles, was sich technisch anbot, zum Einsatz kommen sollte. Ansonsten wäre - so war ich mir sicher - ein Aufgebot von solch umfangreichem technischen Gerät und mehreren Akteuren für nur einen Fototermin mit mir glatte Übertreibung! Kurz überlegte ich mir noch, was es wohl kosten würde, wenn ich dieses Showlaufen selbst finanzieren müsste. Dann jedoch hörte ich die ruhige, entschlossene Stimme des Fotografen, die mir unmissverständlich zu verstehen gab, ich möge mich ab sofort ausschließlich auf die Foto-Aktionen konzentrieren. Es war Show-Time, die gerade gestartet war.
Zappeliges Fotomodell
Ein paar Zuschauer hatten sich schon eingefunden, und das Team der Werbeagentur schaute nun ebenso interessiert zu, wie auch meine Kinder und meine Frau, als es losging. Eine unwirkliche Situation. Aber ich vermutete, dass für mich am Ende supergestaltete Werbeträger warteten, und das motivierte mich, nun alles zu geben für schöne Fotos. Aber für einen Schnappschuss-Fotografen wie mich war es gar nicht einfach, immer die richtigen Bewegungen auszuführen und jeweils die gewünschte Mimik zu zeigen. Da hatte sich schon manche Rhetorik-Trainer bei mir die Zähne ausgebissen. Zunächst war ich noch sehr steif bei diesen inszenierten Posen. Aber mit der Zeit wurde ich dank unterstützender Zurufe aus meinem Publikum lockerer.
Nerviges Herumzupfen
Nervig empfand ich, dass ständig an mir herumgezupft wurde, bis ich richtig stand, bis das Jackett richtig saß, bis meine Frisur und mein Gesichtsausdruck stimmte … Aber dann klickte der mächtig große Fotoapparat des Fotografen gefühlt hunderte Male, während er mir immer wieder Anweisungen gab, mich leicht umzustellen, schöner zu lächeln, nicht zu blinzeln oder ernster zu gucken oder bestimmte Bewegungen auszuführen. Das war ganz schön anstrengend und ich konnte es nicht fassen, welcher Aktionismus getrieben werden musste für die wenigen Fotos, die später vom Fotografen beziehungsweise von der Werbeagentur für den Druck ausgewählt würden. Schließlich wiederholte sich die Prozedur noch an anderen markanten Orten in der Gemeinde, bis dann die Familienfotos am Dorfbrunnen, zusammen mit meiner Frau und den Kindern, dieses aufregende und anstrengende Event abschlossen.
Neue Selbstwahrnehmung
Die Bilder, die daraus entstanden, waren natürlich Spitzenklasse. Bei der ersten Sichtung fragte ich mich kurz, ob es sich bei diesem schönen, gutaussehenden, stets wirkungsorientiert in die Kamera guckenden Mann auf den Bildern tatsächlich um mich handelte. Das fühlte sich einzigartig komisch, aber auch sehr gut an. Ich gefiel mir, was sonst kaum der Fall war, wenn ich Fotos von mir sah − und das machte etwas mit einem.
Beflügelt
Schließlich erkannte ich, dass die Ergebnisse aus diesem spektakulären Fototermin und überhaupt, dass sich die Begleitung dieser Fachleute aus der Werbeagentur sehr förderlich auf meine positivere Selbstwahrnehmung auswirkte. Auch wenn mir bewusst war, dass diese Profi-Aufnahmen inszeniert waren, identifizierte ich mich sofort mit den von der Werbeagentur gewünschten Wirkungsprofilen. Dieses Erlebnis selbst, aber auch das höchst ungewöhnliche Zustandekommen dieser Zusammenarbeit mit den Werbefachleuten werde ich in meinem Leben nie vergessen. Eine schöne, fast unglaubliche Geschichte, die sich jedoch genau so zugetragen hat und die eine prägende Wirkung entfaltete − besonders bei einem späteren Wahlkampf, in einer anderen Gemeinde. Aber dazu später.
Aufgehübscht verloren
Dennoch glaubte ich trotz neu hinzugewonnenem Selbstbewusstsein und trotz dieser tollen Unterstützung der Werbeagentur nicht mehr daran, dass ich tatsächlich als Sieger aus dem zweiten Wahlgang in der Hegau-Gemeinde hervorgehen könnte. Selbst die besten Werbeflyer und noch so supergestalteten Plakate oder sonstige perfekt abgelieferte Wahlkampfauftritte in der dreiwöchigen Schlussphase hätten keinen Stimmenerdrutsch auslösen können, um dem zweiten auswärtigen Mitbewerber nahezu alle seine Stimmen abnehmen zu können. Dies wäre aber rechnerisch erforderlich gewesen, um unterm Strich den Stimmenanteil des ortsansässigen Kandidaten zu toppen.
Wieder nur Bronze
Und genau so präsentierte sich schließlich das Ergebnis der Stichwahl Ende Oktober 2001. Als Sieger ging mit einfacher Mehrheit der ortsansässige Kandidat hervor, der nun als Bürgermeister auf dem Chefsessel in seinem Rathaus Platz nehmen konnte, wozu ich ihn noch am Wahlabend beglückwünschte. In der Nachbetrachtung gesehen, war er auch der richtige Kandidat für diese Hegau-Gemeinde.
Trauriger Tiefpunkt
Natürlich war am Abend dieses Wahlsonntags nach der Stichwahl meine Stimmung im Keller. Müde, abgekämpft und finanziell mehr als abgemagert durch die hohen, verlorenen Kosten für den langen Wahlkampf in zwei Akten, machte ich mich mit meiner Familie, die mich tröstete, auf den Heimweg.
Unsichtbar: Niederlage nicht umsonst
Ich konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, dass mein Wahlkampf- Abenteuer noch nicht zu Ende sein würde, und die wundersam zustande gekommene Kooperation mit der Werbeagentur aus dem Hegau eine Zurüstung sein würde, für einen nochmaligen, dann aber erfolgreich verlaufenden Wahlkampf.
"Wer den Schaden hat" (…)
Zunächst musste ich aber nach meiner Rückkehr aus dem verlorenen Wahlkampf erleben, wie wahrhaftig das Sprichwort, "wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen", sein kann. Alle, welche mich nach meinem Entschluss, in einen Bürgermeisterwahlkampf zu ziehen, mit ihrem Pessimisten-Blues beglückten, hatten nun wieder "Singstunde".
Kleine Story: Kollegiale Turbo-Provokation
Ein früherer "Lieblingskollege" im Landratsamt aus schwäbischer Herkunft sprach mich beispielsweise laut lachend in der Kantine vor der Essensausgabe mit den Worten an: "Hahaha, Gerold, sieasch, Burgermeischter wära ischt halt doch it so eufach wi da denkt hoscht, sell hesch jetzet glernet und sell wirsch beschtimmt au nimma probiera, gell?"
Selbstbeherrschung hilft
Gott sei Dank konnte ich meine Emotionen schon immer − meistens − gut in Schach halten. Deshalb hielt ich mein Tablett weiterhin ruhig in meiner Hand und warf es nicht mit Wucht meinem "sympathischen" Hintermann an den Kopf. Aber ich konnte mir es nicht verkneifen, meinem Kollegen ebenso laut und bestimmt zu antworten: "Warte mal ab, wer weiß ...", was dieser mit spöttischem Blick zur Kenntnis nahm. In diesem Augenblick konnte ich allerdings noch nicht wissen, wie wahr diese Worte bald werden sollen.
Auch ehrliche Tröstungen
Aber es erreichten mich auch tröstende Worte, sowohl aus dem Kollegenkreis als auch aus meiner Familie und Verwandtschaft. Mein Chef äußerte sich erfreut darüber, dass ich weiterhin als Leiter der Jugendhilfeeinrichtung arbeiten würde und auch die Kolleginnen und Kollegen empfingen mich in meiner alten Wirkungsstätte ebenfalls mit tröstenden Worten.
Wenn das Telefon öfter klingelt
(Wahlkampf Nr. II kündigt sich an)
An einem Nachmittag im November 2001 läutete zuhause das Telefon. Da ich noch nicht zu Hause war, nahm meine Frau den Hörer ab. Auf der anderen Seite der Leitung sprach ein ehemaliger Kollege von uns, der früher auch im Landratsamt gearbeitet hatte. Er kannte also sowohl meine Frau als auch mich persönlich. Seit ein paar Jahren war er als Bürgermeister in einer kleinen Stadt im Schwarzwald tätig.
Verführende Informationen
Er kam bei seinem Anruf gleich zur Sache und informierte meine Frau, in seiner Nachbargemeinde werde ein altgedienter Bürgermeister nach vierunddreißig Jahren aus dem Amt scheiden, und dessen Nachfolge werde gerade ausgeschrieben. Dann las er meiner Frau aus einem Presseartikel vor, welchen die Hegau-Redaktion für den Landkreis übermittelt hatte, in dem wir wohnten. Dort wurde über den Ausgang der Bürgermeisterwahl in der Hegau-Gemeinde berichtet, und wie sich der Kandidat aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis bei dieser präsentiert hatte. Trotz des Wahlausgangs (Dritter Platz bei drei Kandidaten) gab es zu meinem Wahlkampf darin durchaus anerkennende Anmerkungen zu lesen.
Ringen
Dann wurde der Anrufer konkret mit seinem Anliegen. Er bat meine Frau, sich bei mir dafür einzusetzen, dass ich erneut (wenige Wochen nach der verlorenen Bürgermeisterwahl im Hegau) in einen Wahlkampf ziehen solle. Meine Frau äußerte sich daraufhin aber skeptisch zu seiner Idee. Sie gab zu bedenken, dass ich noch zu sehr mit der Verarbeitung der frischen Niederlage vom Wahlkampf in der Hegau-Gemeinde beschäftigt und für einen erneuten, praktisch sofort - wiederbeginnenden – Wahlkampf eher weniger zu begeistern sei. Ihrem Eindruck, so lautete ihr Resümee, hätte ich dafür noch viel zu sehr die Schnauze voll.
Ausdauernde Überzeugungskunst
Der anrufende Bürgermeister wollte aber nicht aufgeben, für sein Anliegen zu werben. Er gab engagiert am Telefon seiner Überzeugung Ausdruck, dass ich doch gerade erst richtig warmgelaufen sei und ich mich, nach seiner Einschätzung, noch in einem erfolgversprechenden Wahlkampfmodus befinden würde. Weiter argumentierte er, dass ich doch nun die Früchte aus all meinen Anstrengungen und Erlebnissen aus dem letzten Wahlkampf ernten könnte, mit meinen gewonnenen Erfahrungen und manchen Optimierungen, mit welchen ich mich ja noch zurüsten könnte. Schließlich gab er zu bedenken, dass meine hohen Investitionen in den zuletzt verlorenen Bürgermeisterwahlkampf so nicht vergebens wären und ich diese doch noch zu einem Happy End führen könnte.
Coole Ehefrau
Als ich nach Feierabend nach Hause kam und meine Frau mir von dem ungewöhnlichen Telefongespräch mit unserem ehemaligen Kollegen erzählte, war ich zunächst wieder erstaunt darüber, wie sie auf diese Empfehlung für einen neuen Wahlkampffeldzug reagierte. Nach allem, was während des Hegau-Wahlkampfes auch sie mitgemacht und mitgetragen hatte, hätte ich erwartet, sie würde sich geradezu empört von einem solchen neuen Vorhaben distanzieren. Aber falsch gedacht! Soweit sie Vorbehalte äußerte, betrafen diese nur ihre Sorge über mein Wohlergehen, sollte ich wieder in den Kampf ziehen. Ähnlich überraschend verhielt sie sich, (wie ich schon erzählte), als sie mir im Sommer 2001 eine ähnliche Empfehlung ihres Kollegen überbrachte, mich in der Hegau-Gemeinde zum Bürgermeister zu bewerben.
Wieder mit Erfolg "verführt"
Zunächst verhielt ich mich zu diesem Vorschlag tatsächlich wie jemand, der die Schnauze voll hat. Aber unser ehemaliger Kollege und Bürgermeister aus dem Schwarzwaldstädtchen ließ nicht locker. Er rief noch mehrmals an. Schließlich sprach ich direkt mit ihm über seine Idee. Dabei malte er mir nach allen Regeln der Kunst aus, was für Möglichkeiten sich auftun könnten, für eine künftige Zusammenarbeit und wiederholte mehrfach seine Überzeugung, ich sei in seinen Augen der richtige Kandidat als neuer Bürgermeister in seiner Nachbargemeinde.
Nur mal anschauen
Nach kurzem Zögern beschlossen meine Frau und ich, uns diese Schwarzwaldkommune mal anzuschauen. Wir fuhren also dorthin, und was wir sahen, gefiel uns sehr. Es handelte sich um eine Tourismusgemeinde, herrlich in der Schwarzwaldlandschaft gelegen, mit einem schönen Ortsbild und einer erstaunlich guten, familienfreundlichen Infrastruktur. Beeindruckt von dem Gesehenen bei unserem Ausflug, diskutierten wir zu Hause über das Für und Wider eines neuen Abenteuers, wenn ich mich erneut um ein Bürgermeisteramt bewarb.
Mutige Entscheidung
Start in neues Wahlkampfabenteuer
Schließlich fiel die Entscheidung, und ich gab als erster Kandidat meine Bewerbung im Rathaus dieser schönen Schwarzwaldgemeinde im Dezember 2001 ab. Danach suchte ich sofort die Zeitungsredaktionen der zwei Lokalzeitungen auf, um meine erneute Bürgermeisterkandidatur öffentlichkeitswirksam zu präsentieren.
Chef rechtzeitig informieren
Dieses Mal informierte ich auch rechtzeitig zuvor meinen Chef. Wenn ich mich richtig erinnere, äußerte er sich nur sehr zurückhaltend auf meine Ankündigung, nochmals in einen Bürgermeisterwahlkampf ziehen zu wollen.
Wenig Geld - wenig Vorbereitung
Der Geldbeutel war durch den vergangenen, intensiv geführten Hegau-Wahlkampf zwar mehr als leer, aber mein Kopf war voll von Erfahrungen, auf was man achten sollte, um in einen erfolgreich geführten Wahlkampf zu ziehen. Auch meine Familie unterstützte mich erneut. Aber ich musste meinen Kopf erst einmal frei bekommen, um mich für eine weitere, mehrere Monate andauernde, superstressige Zeit einstimmen zu können. Viel Zeit für eine Vorbereitung blieb wieder nicht.
Alles auf eine Karte
Meine bisherigen, inzwischen nun reichhaltigen Erfahrungen im Berufsleben erinnerten mich daran, dass ich größere Erfolge nach mutig eingeschlagenen Wegen in der Regel nicht sofort, sondern erst nach Umwegen einfahren konnte. Zu Beginn meines neuen beruflichen Abenteuers musste ich also fest daran glauben, dass ich aus diesem neuen Wahlkampf, den ich dieses Mal komplett über einen Bankkredit finanzieren musste, als Sieger hervorgehen werde. Es galt also, alles auf eine Karte setzen, um das Spiel − mit ganz hohem Einsatz − doch noch zu gewinnen!
Selbstbewusstsein gewonnen
Aber trotz der erlittenen Niederlage aus dem ersten Wahlkampf in der Hegau-Gemeinde habe ich mir dennoch daraus das Zutrauen aneignen können, das ein Wahlkämpfer braucht, um am Ende siegen und als Bürgermeister in ein Rathaus einziehen zu können. Um es vorwegzunehmen: Ich wurde sensationell für meinen risikoreichen und hohen Einsatz belohnt! Doch der Reihe nach.
Wieder Singstunde: Pessimisten-Blues
Nun lagen wieder heiße Wochen vor mir. Wie gut, dass ich bei diesem erneuten Anlauf in einen Wahlkampf wusste, was mich erwartet. Aber wie ist das schon im Neuen Testament der Bibel anschaulich beschrieben? Nicht der einfache Weg, über breite Straßen, sondern der holprige, steinige Weg, führt zum Ziel. Dieses Gleichnis habe ich mir in jener Zeit wohl zu eigen gemacht. Oder, um bei biblischen Bildern zu bleiben: Der Glaube kann Berge versetzen. Zunächst galt es aber auch, sich wieder einmal über eine große Zahl von Skeptikern hinwegzusetzen. Der intensive Pessimisten-Blues erklang wieder, welcher mir bald auf breiter Front begegnen sollte. Aber auch dieser war nichts Neues für mich.
Rückblick: Kraftstrotzend!
Wichtig für mich war aber zu diesem Zeitpunkt − rückblickend betrachtet − die Tatsache, dass ich mich inzwischen nicht mehr so einfach von Meinungen anderer herunterziehen ließ, weil mein Selbstvertrauen erheblich zugenommen hatte. Diese neu erlebte Willenskraft stand im vollkommenen Widerspruch zu meiner früheren Selbstwahrnehmung in der Kindheit, über die Jugendzeit, bis hin in das junge Erwachsenenalter. Besonders wurde dann meine kämpferische Seite angesprochen, wenn mir Menschen zu verstehen geben wollten, dass sie mir etwas nicht zutrauten. Das hatte sich sozusagen zu einem bedingten Reflex entwickelt. Denn gerade zum Jahreswechsel 2001 / 2002 spürte ich − trotz des verlorenen Hegau-Wahlkampfes und trotz der hohen beruflichen Belastungen − so unglaublich viel Energie, dass ich aufkommende Selbstzweifel meistens wieder rasch ablegen konnte.
Profi-Coaching
Aber als inzwischen erfahrener Wahlkämpfer wusste ich natürlich auch, dass Kraft, Selbstvertrauen und Disziplin allein nicht ausreichen, um letztlich erfolgreich sein zu können. In den Hegau-Wahlkampf war ich wie ein Abenteurer von jetzt auf nachher, ohne jede Vorbereitung und ohne kommunalpolitische Erfahrung gestartet.
Aufrüsten angesagt
Dieses Mal setzte ich auf professionelle Begleitung von Anfang an, was mich natürlich eine Menge Geld kostete. Allerdings war mir klar, dass eine solche Investition unverzichtbar sein würde, um erfolgreich aus dem neuen Wahlkampfabenteuer hervorgehen zu können. Fachmännische Unterstützung brauchte ich beispielsweise für das Planen von Veranstaltungen, für die Analyse der kommunalpolitischen Grundlagen vor Ort, für das Einstimmen auf Mitbewerber, für Vorbereitungen von Reden und für das Klären eines ganz wesentlichen Punktes: Was für ein Bürgermeister-Typ möchte ich sein, wie will ich mich der Wählerschaft glaubhaft präsentieren?
Wiederholungsfehler vermeiden
Im Hegau-Wahlkampf fiel mir auf, dass zunächst die Prägung dieses Eigenbildes von Anfang an in einem Wahlkampf eine hohe Bedeutung für eine spätere glaubhafte Präsentation hat. Also das Gegenteil von Improvisation im Bereich der Selbstvermarktung, um zu vermeiden, am Ende von der kritisch prüfenden Wählerschaft abgestraft zu werden. Leider konnte ich wieder kein entsprechendes Vorbereitungsseminar für angehende Bürgermeisterkandidaten in der Hochschule in Kehl buchen, weil ein solches auch zu diesem Zeitpunkt (Dezember 2001 − Februar 2002) nicht stattfand. Ich musste also in der Start-Phase des bevorstehenden Wahlkampfes in der Schwarzwaldgemeinde ein teures Einzel- Coaching „einkaufen“. Über das Internet wurde ich fündig. Ich entdeckte einen Dienstleister, der nebenberuflich Bürgermeisterkandidaten coachte. Wegen seiner hauptberuflichen Tätigkeit an einer Hochschule war er für mich - solange er für mich tätig war -, der „Coaching-Professor“.
Teuer – aber erfolgversprechend
Er hatte zwar am Ende einen stolzen Preis, weil er sich sein Honorar im Falle eines Wahlsieges als Erfolgshonorar verdoppeln ließ. Aber ich wollte kein Risiko eingehen, ohne Coach in den Wahlkampf zu ziehen. Daher fragte ich nicht lange nach den Kosten und buchte schließlich den „Coaching-Professor“, weil er mir eine sofortige Begleitung zusagte und keine Zeit mehr verloren gehen sollte.
Zweck- nicht "Liebesheirat"
Als Entscheidungshilfe wirkte darüber hinaus auf mich der Hinweis des geschäftigen Wahlkampftrainers, dass ihm schon weitere Anfragen von Bürgermeisterkandidaten vorlägen und er deshalb bald ausgebucht sei. Meine Zusammenarbeit mit ihm empfand ich von Anfang an zwar nicht als spannungsfrei, aber − und darauf kam es an – sie war am Ende erfolgreich. Auch wenn wir uns gegenseitig eher nicht in ausgeprägter Sympathie verbunden waren, war dies − rückblickend gesehen − die beste Voraussetzung dafür, um in der knappen Zeit, die zur Verfügung stand (zweieinhalb Monate bis zum Wahltag), den nochmaligen, - sehr anspruchsvollen - Wahlkampf erfolgreich über die Ziellinie zu bringen. Ein netter Coach beispielsweise würde seinem Zögling nicht verbal in den Hintern treten, wenn es sein musste. Mein Coach hatte damit im Umgang mit mir überhaupt keine Probleme (er war auch das Gegenteil von nett − siehe dazu auch meine späteren Erzählungen).
Drill-Einheiten am Start
Nach einigen Vorbereitungen über E-Mails und telefonisch kam es an einem kalten Januarmorgen des Jahres 2002 zur ersten Sitzung mit dem Wahlkampftrainer, zu dem ich mit einer langen Bahnfahrt anreiste. Er erkannte vermutlich auf Anhieb, dass es hinsichtlich meiner Außenwirkung als Bürgermeisterkandidat noch deutlich Luft nach oben gab. Gleich zum Einstieg stimmte mich mein Coach daher mit den Worten ein: "Wenn wir das, was vor uns liegt, in der kurzen Zeit bis zum Wahltag noch schaffen wollen, dann müssen Sie sich aber noch mächtig ins Zeug legen."
Déjà-vu
Genau an einen solchen Coaching-Einstieg erinnerte ich mich. Damals, 1974, wurde ich als kurz vor dem "Absaufen" stehender Jugendlicher von einem Kaufmann-Freund meiner Eltern in einem ebenfalls sehr kurzen und streng geführten Einzel-Nachhilfe-Drill gerettet. Der damalige Coach paukte mit mir in nur wenigen Wochen den Lehrstoff für zwei Berufsschuljahre in Buchführung und kaufmännischem Rechnen komplett nach, (siehe Erzählungen hierzu in anderen Kapiteln). Am Ende bestand ich durch die intensiven Bemühungen meines strengen Nachhilfelehrers doch noch die Abschlussprüfung. Aber nur deshalb, weil mir derselbe stets "auf die Finger klopfte", wenn ich nicht bei der Sache blieb. In meiner Wahrnehmung schien diese Methode nun auch der Coaching-Professor bei mir anzuwenden. Sie war das Gegenteil eines Wohlfühlevents für mich. Aber das war gut so!
Zusätzliches Rhetoriktraining
Einen Rhetorik-Trainingskurs verordnete ich mir übrigens auch noch, zusätzlich zur eben beschriebenen Wahlkampfbegleitung und nach einem ersten Anfänger-Rhetorikkurs in Donaueschingen, welchen ich schon kurz vor dem Wahlkampf in der Hegau-Gemeinde absolviert hatte. Dazu suchte ich mir aber einen anderen Trainer aus (nicht den Coaching- Professor). Damit wollte ich erreichen, in meiner Vortrags- und Gesprächstechnik wesentlich überzeugender auftreten zu können. Jedoch erwies sich auch dieses Vorhaben als harte Nuss, sowohl für mich als auch für den Rhetorik-Lehrer. Verursacht durch mein ADS-Handicap war es offensichtlich mein Schicksal, als Schüler stets eine besondere Herausforderung für alle Coachs darzustellen. Im neuen Rhetoriktraining musste ich vor allem lernen, meine zappelige - hin und wieder wenig vorteilhafte - Körpersprache besser zu steuern. Mir fiel es eben schwer, mich gleichzeitig auf Redehalten und auf Körperhaltung zu konzentrieren. Das war wie früher beim Fußballspielen, was ich nie konnte, weil es mir beim Laufen auf dem Spielfeld unmöglich war, gleichzeitig auf die Ballführung zu achten.
Kleine Story dazu:
Kurioses beim Rhetorik-Training
Da in den Rhetorik-Unterrichtseinheiten sofort die von mir bereits beschriebene unvorteilhafte Körpersprache beim Sprechen auffiel, wurde das Freie Sprechen mit mir besonders geübt, und zwar ohne hinter einem Pult zu stehen. Zunächst jedoch mit der Möglichkeit, von Karten den Text ablesen zu können. Die angenommenen Zuhörer sollten bei dieser Übung also meine ganze Gestalt während der Rede im Blick haben, einschließlich aller Bewegungen der Beine und Füße.
Anweisungsinflation
Mein Übungsleiter überschüttete mich vor dem Start der Rede mit Anweisungen. So wies er mich an, ich solle die Füße beim Hinstehen und während der Rede nicht in einer X-Formation, sondern seriös nebeneinander abstellen. Weiter wurde darum gebeten, dass ich während des Ablesens der Rede immer wieder den Blickkontakt zum Publikum suchte und dabei Sprechpausen einlegte.
Herausforderung: Gestus beim Sprechen
Gleichzeitig wurde Wert daraufgelegt, dass ich meine Arme und meine Hände während des Vortrags nur gezielt einsetzte, wenn ich etwas hervorzuheben hatte (und nicht, um mit diesen ständig herum zu fuchteln). So beispielsweise bei dem Ausspruch: Sie können mir vertrauen, meine Damen und Herren. Bei diesem Satz sollte ich meine geöffneten Hand-Innenflächen ruhig, aber bestimmt erheben und in Richtung Publikum ausrichten. Das sei, so die Begründung des Rhetorik-Pädagogen, eine vertrauensstiftende Geste gegenüber den Zuhörern. Leider waren das, − wie sich bei den Übungen herausstellte − für mich eindeutig zu viele Anweisungen auf einmal. Und außerdem: Wie hätte das funktionieren sollen, beide geöffnete Handinnenflächen zu erheben und dem Publikum zu präsentieren, wenn mindestens eine meiner beiden Hände meine Rede-Zettel festhielt (diese vorübergehend in den Mund zu nehmen, wäre ja auch keine Lösung gewesen).
Irritierende Nachfragen
Als ich versuchte, mit einem Zwischenruf einen solch banalen Sachverhalt während der Übung zu klären, (Video-Aufzeichnung war aktiv und musste unterbrochen werden), da seufzte mein ungeduldiger Rhetorik-Lehrer etwas in sich hinein. Dann ermahnte er mich sogleich, ich solle bei den Übungen bitte ernsthaft bleiben, denn ich hätte ja noch einiges zu verbessern. Schließlich erhielt ich kopfschüttelnd die Antwort, die Geste mit der Erhebung der geöffneten, inneren Handflächen zum Publikum könne nur am Schluss einer Rede ihre vertrauensstiftende Wirkung entfalten, bei dem man die Redezettel sowieso wegzustecken hätte, um das Finale der Ansprache mit einem nachhaltigen, positiven Eindruck abzuschließen. Also bestand meine Aufgabe darin, den Schlussteil der Rede auf jeden Fall frei vorzutragen.
Freie Rede – chaotisch
Aber beim freien Reden war das mit meiner Körpersprache eben so eine Sache. Solange ich eine Rede ablesen durfte, funktionierte dieses Marionettentheater bei einem Vortrag ja noch einigermaßen. Sobald ich aber anfing, etwas freizusprechen, dann ging es nicht lange und meine Hände und meine Arme fuchtelten wieder automatisch herum. Schließlich zeigten meine Füße ruckzuck wieder die X-Haltung.
Nervig: Video-Aufzeichnungen
Video-Aufzeichnungen während meiner Redeübungen zeigten diese Defizite gnadenlos auf. Eine solche visuelle Beweisführung fand ich übrigens ebenso nervig wie die manchmal resigniert wirkenden Blicke des Rhetorik-Lehrers, meines Chef-Choreographen bei der Auswertung. Meine zugegeben individuelle Körpersprache mag vielleicht nicht den Verhaltensmaßstäben von Rhetorik-Profis entsprochen haben, aber letztlich wirkte sie beim Anschauen von Video-Aufzeichnungen auf mich natürlicher und glaubhafter als die eingeübten Bewegungsabläufe wie bei einer Marionettenpuppe. Doch eine solche amateurhafte Sichtweise wollte mein Rhetorik-Trainer überhaupt nicht mit mir diskutieren. Dafür rang er öfter um Fassung, wenn sich meine spontane, reflexartig reagierende Körpersprache wieder einmal nicht nach seinen Vorstellungen steuern ließen. Ich − und vermutlich auch mein Übungsleiter − waren jedenfalls sehr erleichtert, als die Fortbildungseinheit zum Thema Rhetorik ihr Ende fand.
Zurück zum "Coaching-Professor"
Wahlkampfschachspiel lernen
Dafür gab es nun für die strategischen Planungen von Wahlkampf- Veranstaltungen viel zu tun. Auch das Üben einer zielführenden Kommunikation mit Besucherinnen und Besuchern bei diesen Events standen beim Coaching-Professor auf dem Programm. Weiter wurde ich darin geschult, die Eigenheiten meiner Mitbewerber zu analysieren, um darauf passend reagieren zu können, beispielsweise bei Podiumsdiskussionen. Außerdem wurde das Schreiben von Texten für die Wahlkampfwerbung oder für Reden zu bestimmten Themen behandelt.
Schwierige Motivation
Bei dem etwas angespannten Coaching-Klima war es wichtig, dass ich mich selbst motivierte, indem ich mir immer wieder mein großes Ziel vor Augen führte, für das ich ein hartes Training zu absolvieren hatte. Auch wusste ich aus meinen Lebenserfahrungen, dass − wie eingangs erwähnt − nur ein sehr fordernder Coach in der Lage sein würde, in kurzer Zeit sehr gute Ergebnisse bei mir zu erzielen. So wie in diesem Fall, wo es darum ging, mich in professioneller Hinsicht kurzfristig für den Wahlkampf fit zu drillen.
Mit harter Hand
Ohne die "harte Hand" des Wahlkampftrainers wäre ich ihm sonst wahrscheinlich - ohne brauchbare Erfolge im Gepäck - wie ein Träumer davon getanzt. Ein ausbleibender Lernerfolg konnte aber wiederum nicht in meinem Interesse sein, schon wegen des hohen Honorars, das in den Sand gesetzt worden wäre. Also arbeitete ich, so gut wie mir das möglich war, mit meinem Coach zusammen. Dazu gab es keine Alternative. Schließlich wurde ich für diese Disziplin während des Coachings trotz all der geschilderten Probleme belohnt. Denn die angestrebten Ziele für die Wahlkampf-Zurüstung wurden aus meiner Sicht erreicht.
Eigene - gute Wahlkampf-Ideen
Allerdings kannte ich die Tastatur des Wahlkampfklaviers − also die Praxis − bereits. Wenn es um das Umsetzen von pfiffigen Ideen für Aktionen ging, war ich nicht auf Ratschläge meines Coachs angewiesen. Besondere Werbeinszenierungen zu kreieren − das war der Teil des Wahlkampfs, zu dem ich Lust hatte, und worin ich auch sehr einfallsreich war.
Kleine Story dazu: Grußkarten
Vor dem eigentlichen Start des Wahlkampfes ab Januar 2002 überlegte ich mir, wie ich mich bei möglichst allen Dorfbewohnern als erster Bewerber, (die Mitbewerber bewarben sich erst im Januar 2002), mit einem sympathischen Auftakt bekannt machen könnte. Beim Wahlkampf-Coaching lernte ich, dass die erste Präsentation eines Kandidaten gegenüber der Wählerschaft dann besonders vorteilhaft für deren Wahlentscheidung sein kann, wenn es gelingt, diese mit einer - im Gedächtnis bleibenden - positiven Außenwirkung zu verbinden.
Guten Rutsch!
Da der Silvestertag des Jahres 2001 nahte, kam ich auf die Idee, mich in der Dorfgemeinschaft mit einem besonderen Silvestergruß bekannt zu machen und mit diesem meiner Freude Ausdruck zu geben, als Bürgermeisterkandidat die Bürgerschaft in der schönen Schwarzwaldgemeinde im neuen Jahr kennen lernen zu dürfen. Eine solche Grußkarte zum Jahreswechsel sollte − so meine Vorstellung − von der für mich tätigen Werbeagentur rechtzeitig für eine Zustellung am Silvestertag hergestellt werden. Weiter stellte ich mir vor, dass auf dieser Karte ein Bild von mir aufgedruckt wird, aufgenommen in einer für die Bürgerschaft bekannten, winterlichen Umgebung in ihrem Dorf. Außerdem wünschte ich fettgedruckt den Karten-Empfängern einen "Guten Rutsch", und ein gutes neues Jahr. Selbstverständlich sollten meine Kontaktdaten gut sichtbar zu lesen sein und zu ersten Kontaktaufnahmen einladen.
Keine Massendrucksache
Mir war es auch wichtig, diese besonders gestalteten Silvester-Grußkarten an möglichst viele im Dorf wohnende Personen direkt zu adressieren und persönlich zu unterschreiben, also keine anonyme Wurfsendung verteilen zu lassen. Letztere wäre zwar wesentlich kostengünstiger herzustellen und einfacher zu organisieren gewesen, aber ich befürchtete, mit ihr nicht die beabsichtigte besondere Aufmerksamkeitswirkung erzielen zu können.
Persönlicher Kartengruß – höchst aufwendig
Jedoch war dieses aufwendige Werbe-Projekt in zweierlei Hinsicht mit sehr viel Arbeit verbunden: Zum einen musste ich mir ein „Bürgerbuch“ beschaffen, um aus diesem alle Adressen (hunderte) herauszuschreiben, diese in eine WORD-Liste im PC zu übertragen und sie dann auf Aufkleber-Papier auszudrucken. Daraufhin galt es, unzählige Aufkleber für ein kleines Postkarten-Adressfeld passend auszuschneiden, und auf die Karten zu kleben. Da gingen viele Arbeitsstunden drauf. Allerdings half mir meine Frau dabei. Zum anderen war rasch ein geeignetes Foto vom Fotografen der Werbeagentur anzufertigen und der Druck der Neujahrsgrußkarte musste sehr bald erfolgen. Ich besprach diese Aktion daher zeitnah mit der Werbeagentur, die schon im Hegau-Wahlkampf für mich tätig gewesen war und beauftragte sie mit der Produktion aller Werbeträger für diesen Wahlkampf in der Schwarzwaldgemeinde (dieses Mal kostenpflichtig für mich). So wurde diese neu gegründete Firma für die Werbeaktion belohnt, die sie für mich zum Schluss des Wahlkampfes im Hegau erarbeitet und an der sie nichts verdient hatte.
Eisiger Fototermin
Für das Foto wurde eine wunderschöne Landschaftskulisse des Schwarzwalddorfes ausgewählt. Sehr froh war ich, dass der Profi-Fotograf nicht wieder mit so vielem technischem Gedöns anreiste, wie bei dem hollywoodreifen Fotoshooting in der Hegau- Gemeinde. Er brachte nur seinen üppigen Fotoapparat mit. Leider war es saukalt an diesem Wintertag. Der ausgesuchte Ort für das Foto lag auf knapp 1.000 Meter Höhe. Anziehen durfte ich als Oberbekleidung nur ein Hemd mit Krawatte und ein Jackett. Bis das letzte Foto im Kasten des Fotografen war, dauerte es einige Zeit, was man später auf dem Foto sehen konnte. Meine Nase war deutlich gerötet (aber noch nicht erfroren). Ansonsten entstanden sehr gute Aufnahmen, von welchen eine für das Karten-Bild ausgesucht wurde. Die Druckvorlage konnte ich meinem Bruder Berthold übergeben, der Betriebsleiter einer großen Druckerei war und der für mich den Druck dieser Karten dankenswerterweise kurzfristig veranlasste.
Großauftrag an die Post
Als meine Frau und ich die Adressen-Aufklebe-Aktion auf den tausend Karten geschafft hatten, übergaben wir das umfangreiche Postgut dem Briefzentrum der Post, mit dem Auftrag, unsere Kartensendung zum Silvestertag an die aufgeklebten Adressen zuzustellen. Dieser Auftrag wurde pünktlich ausgeführt, und ich erhielt (neben einer großen Rechnung) danach sehr viel positive Rückmeldungen aus der Bürgerschaft über diese Aktion. Sogar mein strenger Wahlkampf-Coach stellte mir anschließend für diese Aktion zur Abwechslung einmal gute Noten aus. Vielleicht war er auch etwas überrascht, weil er mir das nicht zugetraut hatte. Jedenfalls meinte er, dass ich es damit geschafft hätte, mich mit einer pfiffigen Idee als Bürgermeisterkandidat nachhaltig positiv bekannt zu machen. Mit dieser nachträglich geäußerten fachlichen Einschätzung sollte mein Coaching-Professor tatsächlich recht behalten. Bei einigen Leuten im Wählervolk hatte ich nach dieser Aktion den Spitznamen "der Postkarten-Kandidat". Jedenfalls wurde ich so öfter bei meinen späteren Hausbesuchen angesprochen.
Postkarte – Sympathieträger:
"jetzt hab' i' di'…"
Eine ältere Dame, die ich kurz nach meiner Wahl zu einem Geburtstagsjubiläum als Bürgermeister besuchte, erzählte mir schmunzelnd, dass sie sich über meine Neujahrskarte sehr gefreut habe, diese ihr aber beim Lesen einmal leider plötzlich aus der Hand in den Schnee gefallen sei. Als sie − als gehbehinderte Frau − diese wieder mühsam aufgehoben und getrocknet hatte, so berichtete sie mir augenzwinkernd weiter, hätte sie zu sich gesagt (Original-Ton): "Jetzt hab i di, du Siach, mit viel Müh vom Bode ufghobe, jetzt wirsch au gewählt."
Wahlkampfplanung
Im Januar 2002 trat ich dann in den Wahlkampf im Dorf aktiv ein. Wieder suchte ich mir drei Gasthäuser im Dorf aus, in welchen ich − wie in der Hegau-Gemeinde auch − meine ersten Wahlkampfauftritte veranstaltete.
Themen für Wahlkampfabende
Meine Veranstaltungen plante ich jeweils zu bestimmten kommunalen Themen und lud in Flyer und über die Presse dazu ein. Für das große - uralte - Dorf-Gasthaus, sah ich meine erste persönliche Vorstellung vor. "Kennenlernabend mit Bürgermeisterkandidat Gerold Löffler", war der Slogan auf den Einladungen. Für die Gaststätte der Sportvereine passte der Slogan: "Die Zukunft des Ehrenamts und des Bürgerschaftlichen Engagements mit Bürgermeister-Kandidat G.L. diskutieren". Für das dritte Wirtshaus mit Ausblick auf einen kleinen See wählte ich den Slogan "Gewerbe- und Tourismusförderung für Wohlstand und Arbeitsplätze im Dorf". Darüber hinaus wurde ich zu Vereinsversammlungen, in den Seniorenkreis und zu anderen Gruppierungen, zu Pressegesprächen oder auch zu einer Rundfunksendung eingeladen.
Hausbesuche – wieder größter Schwerpunkt
Den größten Zeitaufwand plante ich aber wieder für Hausbesuche ein, um mit möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern persönlichen Kontakt zu bekommen. Schließlich legte ich großen Wert darauf, möglichst alle Funktions- und Würdenträger in der Gemeinde zu besuchen. Beispiele: Pfarreien, Kindergarten, Schule, Feuerwehr, Vereinsvorstände, Firmen sowie die Mitglieder des Gemeinderates.
Erster Gasthaus-Auftritt
Meine erste Vorstellung im großen Dorfgasthaus bleibt mir unvergessen. War meine vergleichbare Wahlkampf- Auftaktveranstaltung in der Hegau-Gemeinde eher mäßig besucht, so quoll hier der große Hauptgastraum in dem alten Gasthof fast über von interessierten Besucherinnen und Besuchern. Mit so viel Interesse hatte ich nicht gerechnet. Aber ich war natürlich erfreut.
Gut vorbereitet in die Arena
Zunächst stellte ich mich und meine berufliche Herkunft vor und präsentierte daraufhin in kurzen Sätzen meine grundsätzlichen Vorstellungen für die verschiedenen Bereiche einer künftigen Kommunalpolitik in der Gemeinde, sollte ich Bürgermeister werden. Dieses Mal allerdings − wie bei meinem Coaching geübt − gut vorbereitet und mit "Herzblut" (nicht improvisiert wie beispielsweise beim Senioren-Männerstammtisch in der Hegau-Gemeinde).
"Eifach so wie Sie sin…"
Leider orientierte ich mich dabei etwas zu sehr am Drill meines Coachings und schaute − schon von Anbeginn meiner Vorstellung − ständig auf meine Stichwortkärtchen, um ja nichts auszulassen. Rückblickend hätte ich dies sein lassen sollen. Besser wäre es gewesen, gleich von Anfang an frei, so wie mir der Schnabel gewachsen war, den Leuten gegenübergetreten, egal, ob ich dabei vielleicht etwas vergessen hätte. Das wäre vorteilhafter angekommen, und es hätte vermutlich niemand bemerkt. Interessanterweise haben mir Besucher während dieses Abends wohlwollend genau dazu geraten. Originalton: „Sie hen des gut gmacht heut Obed, aber schwätze Sie künftig eifach so wie Sie sin, sell dät am beschte kumme.“ Solche Tipps nahm ich mir dankbar sehr zu herzen.
Gute Noten von vielen
Insgesamt konnte ich diesen ersten Info-Abend in der Schwarzwald-Gemeinde als vollen Erfolg verbuchen. Das gab mir viel Mut und Motivation. Auch die Presse berichtete recht positiv. Nach meiner Vorstellungspräsentation wanderte ich - im noch lange voll besetzten Gasthaus - von Tisch zu Tisch und traf auf durchweg interessierte Gäste. Hierbei bewährte sich das Kommunikationstraining vom Coaching, wo es darum ging, Diskussionen mit Veranstaltungsbesuchern zielführend zu moderieren. Jedenfalls durfte ich mich über einen guten Verlauf meiner Auftaktveranstaltung im frisch gestarteten Wahlkampf und über viele positive Feedbacks von Besuchern freuen. Allerdings gab es auch vereinzelt kritische Stimmen, die ich mir zu Herzen nahm. Erkenntnisse aus kritischen Äußerungen konnte ich nutzen, um an der Optimierung meiner Außenwirkung weiterzuarbeiten. Außerdem gaben sie Hinweise darüber, welche Themen im Wahlkampf noch Bedeutung erhalten sollten.
Kleine Story: Treuer wird untreu
Ein im Dorf sehr angesehener älterer Mitbürger war Stammgast in allen Sitzungen des Gemeinderates, die ich während des Wahlkampfes besuchte. Ich hatte die Ehre, dass er sich im Besucherbereich stets neben mich setzte. Ihn hatte ich als Orts-Promi natürlich längst auch schon zuhause besucht. Er wirkte auf mich zunächst sehr zugetan und gab mir auch schon Tipps für meine Amtsführung, sollte ich als Bürgermeister gewählt werden. In ihm sah ich also einen treuen Unterstützer. Darüber war ich erfreut und das machte mir Mut für meine Wahlkampfaktivitäten.
Wie gewonnen, so zerronnen
Doch seine Treue als mein Dauer-Nebensitzer bei Gemeinderatssitzungen endete leider exakt zu dem Zeitpunkt abrupt, als sich kurz vor Bewerbungsschluss ein weiterer Kandidat für das Bürgermeisteramt zur Wahl stellte. Ab diesem Zeitpunkt wechselte mein bisher so treuer Sitznachbar seinen Platz und war von da an stets und ausnahmslos neben meinem Mitbewerber zu finden. So kann es gehen. Später als Bürgermeister schätzte ich jedoch das große Engagement dieses Bürgers in der Gemeinde sehr.
"Turbo"-Mitbewerber schlägt auf
Der eben genannte - neue Mitbewerber - schlug jedenfalls mit seiner Bewerbung und einer - mich geradezu "umhauenden" - Auflistung einschlägiger Bewerbungsqualifikationen im Schwarzwalddorf auf. Als ich dessen groß aufgemachte Präsentation in der Presse las, musste ich mich erst einmal schütteln. Aus den Gesprächen mit Mitgliedern des Gemeinderates und mit kommunalpolitisch ambitionierten Leuten aus der Gemeinde hörte ich heraus, die Ortsprominenz habe ein ganz unbescheidenes Anforderungsprofil für die Nachfolge des Bürgermeisters für ihr Dorf ausgedacht: Demnach wurde für die erfolgreiche Tourismusgemeinde mit damals etwa 3.000 Einwohnern, aber wenigen Gewerbebetrieben, ein erfahrener Wirtschaftsförderer, insbesondere auch im Bereich Tourismus gesucht. Derselbe sollte zusätzlich einschlägige und lange Erfahrungen in der Kommunalpolitik und in der Verwaltung, sowie idealerweise noch Kompetenz in der Vereinsarbeit aufweisen können.
Märchen- (Wunsch-) Prinz?
Der Ortsprominenz schien es also gelungen zu sein, einen solchen Traumprinzen kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl noch wachgeküsst zu bekommen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich nahezu geschockt war, von der - von mir wahrgenommen - Strahlkraft des Aufschlages meines neuen Wahlkampfkonkurrenten.
Farbenpracht pur!
Der neue Super-Kandidat hatte nicht nur einige Zeit in dieser Schwarzwaldgemeinde gewohnt und somit beste Ortskenntnisse. Seine aktuelle Berufstätigkeit befasste sich mit der kommunalen Wirtschaftsförderung, zu welcher auch der Bereich Tourismusförderung gehörte. Und nicht nur das! Mit ihm hatte ich es mit einem langjährig erfahrenen Verwaltungsprofi zu tun, der auch schon als persönlicher Referent eines Oberbürgermeisters tätig war, und somit das kommunalpolitische Leben aus dem Effeff kannte. Und als leuchtete sein Gefieder nicht schon genug in allen Farben: Er war auch noch Vorsitzender eines großen Musikvereins, also auch Leistungsträger in der ehrenamtlichen Vereinsarbeit.
Unterstützung von allen Seiten?
Auch verstand ich seine Aussage in den Presseinterviews so, dass seine Vorstellung bei Gemeinderäten, Vereinsvorsitzenden und bei weiteren Multiplikatoren in der Gemeinde bereits erfolgte, und diese ihm ihre volle Unterstützung signalisiert hätten, sollte er sich als Bürgermeisterkandidat bewerben.
Hosenflattern?
Was sich jedoch ebenfalls herausstellte, war, dass Wahlkämpfer auch nur Menschen mit Emotionen sind. Von Letzteren hatte ich vermutlich etwas zu viel des Guten. Allerdings stand ich seinerzeit auch − aus mehreren (bereits erwähnten) Gründen − erheblich unter Erfolgsdruck, was nicht spurlos an mir vorbeiging.
Wahlkampf-Rückzug?
Nach der augenfälligen Bewerbungspräsentation des neuen Mitbewerbers in der Presse dachte ich beispielsweise einmal kurz daran, mich vom Wahlkampf aus diesem Schwarzwalddorf zurückzuziehen. Das, was ich über meinen Super-Mitbewerber gelesen hatte, fühlte sich für mich so an, als sei diese Bürgermeisterwahl bereits zu seinen Gunsten gelaufen. Sogleich hatte ich dringenden Beratungsbedarf mit dem Coaching-Professor. Deshalb rief ich ihn an.
Coaching-Professor flippt aus
In meinem vorübergehenden Tunnelblick hatte ich allerdings beinahe vergessen, dass ich mich in einem Wahl-KAMPF, und nicht auf einem Laufsteg für einen Schönheitswettbewerb befinde, an dem sich am Ende drei Männer zur Schau stellen (den ich am Ende vermutlich gewonnen hätte). Stattdessen ließ ich meinem Seelenschmerz freien Lauf, den ich meinem Coach am Telefon vortrug. Mit seiner Reaktion, die dann spontan folgte, hatte ich allerdings nicht gerechnet. Ich zuckte so richtig zusammen! Nun machte sich das raue Wesen meines Wahlkampftrainers bemerkbar. Statt erwarteter - mitfühlender - Seelenmassage folgte sein verbaler und wuchtiger Tritt in meinen ängstlichen "Hintern".
Explosives Telefonat
Er wurde am Telefon, aus dem es unüberhörbar heraus schallte, so richtig streng: „Wer sich sein Selbstbewusstsein für seine Bürgermeisterkandidatur von vermeintlich wahrgenommener Überlegenheit neu auftretender Mitbewerber spontan derart zusammenschießen lässt, der hätte erst gar nie kandidieren dürfen!“, schnauzte er mich ungerührt von meinen Sorgen an. Dann machte er mir doch noch etwas Mut, als er mir in aller Strenge prophezeite, "auch dieser scheinbar hoch qualifizierte Mitbewerber muss sich erst die Sympathie der Wählerschaft erarbeiten, die sich nicht nur nach aufgeschriebenen Qualitätsmerkmalen entscheidet".
"Reißen Sie sich zusammen!"
Zu guter Letzt forderte er mich mit scharfen Worten auf: "reißen Sie sich gefälligst zusammen". Dabei wurde er nochmals mehr als deutlich: „Besuchen Sie Ihre Wählerschaft, gehen Sie von Haustür zu Haustür und erzählen Sie den Leuten, warum Sie gerne ihr Bürgermeister werden wollen, dann können Sie sehr wohl noch erfolgreich abschneiden! Allerdings nur, wenn Sie Zuversicht und Selbstbewusstsein ausstrahlen.“ Dann legte er den Telefonhörer auf.
Hintern zusammenkneifen
Bums, das hatte gesessen. In einer solchen Heftigkeit wurde ich schon lange nicht mehr "zusammengeschissen". Nachdem ich diesen soeben zu Ende gegangenen, geräuschvollen Auftritt meines Coachs zunächst einmal mit nicht jugendfreien Schimpfwörtern kommentierte, spürte ich zugegebenermaßen die heilende Wirkung dieser ruppigen Zurechtweisung. Ich sammelte nämlich daraufhin mich und meine Kräfte wieder ein und setzte den Wahlkampf engagiert fort.
Nochmals Foto-Shooting
Das Wahlkampftreiben nahm mit großer Dynamik Fahrt auf. Nach meiner ersten Vorstellung im größten Gasthaus im Dorf und einigen Besuchen bei Gemeinderäten und Funktionsträgern in der Gemeinde, war es an der Zeit, den Wahlkampf-Flyer zu gestalten. Wie schon erwähnt, beauftragte ich damit die Werbeagentur, welche im Schlussspurt des Wahlkampfs in der Hegau-Gemeinde mit dem außergewöhnlichen Angebot auf mich zugekommen war.
Werbe-Flyer für Hausbesuche
Ein baldiger Druck dieser Werbe-Flyer war für mich nun deshalb erstrebenswert, weil ich im Rahmen meiner anstehenden Hausbesuchsaktionen dieses Werbematerial gerne persönlich an die Frau oder an den Mann bringen wollte. Nun ging es darum, Fotos mit mir und mit meiner Familie vor typischen Motiven im Dorf und in der Umgebung anzufertigen. Wieder war ich froh darüber, dass der Profi-Fotograf auch zu diesen Fototerminen nur mit seiner großen Kamera anreiste, ohne weitere technische Hilfsgerätschaften wie beim Foto-Shooting in der Hegau-Gemeinde. Er schoss vor verschiedenen Hintergründen gekonnt unzählige hervorragende Fotos von mir, teilweise mit meiner Familie, und ich war begeistert von seiner Kreativität.
Gelungene Bilderauswahl
Zurück in der Werbeagentur wurden mir verschiedene Gestaltungsvorschläge unterbreitet, und wir verständigten uns schließlich auf einen bestimmten Entwurf, als Druck-Vorlage für einen Flyer. Mein Bruder Berthold, technischer Betriebsleiter in einem Druckereibetrieb im Ortenaukreis, erklärte sich wieder bereit, den von der Werbeagentur letztlich bearbeiteten Drucksatz zeitnah zu drucken. Diese familiäre Kooperation hatte auch noch in den − zu jener Zeit besonders willkommenen − Effekt für mich, dass sich die Druckkosten dadurch in Grenzen hielten. Sogar auch dann noch, als mein kreativer Bruder jeden Flyer in einen dekorativen, transparenten Umschlag einpacken ließ, (man konnte den Flyer durch den Umschlag sehen). Wie schon in der Hegau-Gemeinde hatten diese professionell gestalteten Werbeträger einen eigenartigen Einfluss auf meine Selbstwahrnehmung als Bürgermeisterkandidat.
Aussagekräftig
Recht zielsicher wurde ich von den Profis auf den Fotos so "eingefangen", dass sie − auch ohne geschriebene Worte − bestimmte Aussagen, die ich in meinem Wahlkampf verband, zum Ausdruck brachten. Ich konnte es dann kaum erwarten, bis ich diese Druckerzeugnisse bei meinem Bruder abholen konnte, um das supergestaltete Werbeprodukt bei unzähligen Begegnungen und Gesprächen an den Haustüren und bei anderen Terminen für meine Kandidatur einzusetzen.
Hausbesuche: Klinken putzen und kein Ende
Auch ohne den – sorry − Arschtritt meines Wahlkampf-Coaches hatte ich schon vor, mich, wie in der Hegau-Gemeinde auch, durch möglichst alle Straßen und Wege des Schwarzwalddorfes zu arbeiten, um so viele Menschen wie möglich antreffen und mich bei ihnen persönlich vorstellen zu können.
Kleine Story dazu:
In dem Schwarzwalddorf, in dem ich als Bürgermeisterkandidat unterwegs war, gibt es eine Narrenzunft. Deren Narrenfigur erzählt die Geschichte, dass früher die armen Bauern aus dem Dorf, die auch viel im Wald arbeiteten, in die angrenzende Große Kreisstadt auf den Markt gingen, um Kienspan-Erzeugnisse zum Anfeuern oder als langsam abbrennende Lichtquelle zu verkaufen. Von den Stadtkunden sei der Überlieferung nach diesen Waldbewohnern ein Spitzname verpasst worden, welcher sich aus zwei Wortteilen zusammensetzte: Kie für Kienspan und schtock, weil sie sich sehr verschlossen, also vers(ch)tockt präsentieren. Aus diesen beiden Wortteilen sei dann das Wort KIESCHTOCK entstanden, welches von dieser Narrenzunft als Name gewählt wurde.
Origineller Dorfbewohner
Ein bisschen an diese KIESCHTOCK-Geschichte erinnert wurde ich, als ich bei meinen ersten Hausbesuchen einen älteren − in der Dorfgemeinschaft nicht unbekannten − Bürger bei strömendem Regen vor seiner Haustüre ansprach, in welche er gerade eintreten wollte. Als ich ihn begrüßte, wirkten seine Blicke auf mich misstrauisch und nicht erfreut. Auf mein "Grüß Gott" erhielt ich zunächst keine Antwort.
Willkommen?
Es wirkte, als ob ich zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort möglicherweise nicht sehr erwünscht war. Dennoch wollte ich nicht einfach weiter gehen und beschloss spontan, das Risiko einzugehen, ein paar freundliche Worte an diesen kritisch guckenden Menschen zu richten, ob er sie hören wollte, oder nicht, sowie ihm anschließend meinen Wahlkampf-Flyer in die Hand zu drücken. Vermutlich war dann dieser typische KIESCHTOCK-Nachkomme etwas überrascht, dass ich trotz des Starkregens, der auf mich niederprasselte, nicht von meinem Vorhaben ablassen wollte, ihn anzusprechen. Deshalb ließ er mich nicht einfach stehen, sondern verweilte schweigend unter dem Vordach seines Hauseinganges, (wo er − im Gegensatz zu mir − nicht nass wurde...).
Verstockter wird freundlich
Um ihn möglichst wenig durch meine weitere Anwesenheit zu nerven, legte ich sogleich im Schnelldurchgang los, um die kurzen Sätze für meine Vorstellung loszuwerden. Als ich den letzten Satz gerade beendet hatte und ihm abschließend noch meinen Flyer in die Hand drücken wollte, da wechselte dieser Ureinwohner des Dorfes auf einmal seinen Gesichtsausdruck, von misstrauisch auf freundlich. Eine solche unerwartete Metamorphose irritierte mich, weil ich nicht wusste, wie ich diesen plötzlichen Sinneswandel zuordnen sollte. Schließlich erbrachte der von mir angesprochene, bisher eisern schweigende Mann dann doch den Nachweis, dass er in der Lage war zu sprechen.
"Jetzt kommet se erscht mol rei"…
Er gab sogar freundliche Worte in der örtlich üblichen Mundart von sich: "Jetzt kommet se erscht mol rei, sie wäret jo ganz nass!" Wo er recht hatte, hatte er recht! Ich war in der Tat schon ziemlich durchnässt von meinem Ausharren vor seiner Haustüre im Starkregen. Aber ganz im Sinne meines strengen Wahlkampf-Coaches durfte ich mich als Wahlkämpfer nicht wehleidig zeigen und musste selbstverständlich bereit sein, mich allen Herausforderungen zu stellen, egal ob es sich um aufkommenden Gegenwind oder um Starkregen handelte. Das Durchhalten hatte sich gelohnt. Ich durfte mich schließlich darüber freuen, dass die sich zunächst distanziert anfühlende Begegnung mit diesem - auf den zweiten Blick sehr freundlich schauenden KIESCHTOCK-Menschen - so unerwartet aufhellte und ich mich bei ihm und seiner Frau bei einer Tasse Kaffee vorstellen (und auch etwas trocknen) konnte.
Zweite kleine Story: zu viel Kaviar
Gerade durch die Kaffeepause bei meinem letzten Hausbesuch gestärkt, läutete ich bei einem Mehrfamilienwohnhaus im ersten Stock. Sogleich wurde geöffnet, und mich begrüßte ein kleiner, schmächtiger, älterer Mann. Er fragte, was mich zu ihm führe. Ich stellte mich daraufhin als Bürgermeisterkandidat vor, der die Menschen im Ort gerne persönlich kennenlernen wollte. Darauf führte er mich in sein Wohnzimmer, und ich durfte mich auf eine leuchtend farbige Couch setzen.
Herzensgute Gastgeber
Dann rief er sehr temperamentvoll nach seiner Frau, welche sich sogleich auch sehen ließ. Sie war auch nicht zu übersehen. Ihr korpulenter Umfang ließ ihren kleinen, schmächtigen Mann fast unsichtbar werden. Das waren meine ersten Eindrücke bei diesem Besuch. Gleich fiel mir auch auf, dass dieses freundliche Ehepaar keine KIESCHTÖCKE sein konnten, weil ihr Akzent sie als sogenannte Spätaussiedler verriet. Genau so war es. Zunächst zeigten sich beide Eheleute sehr erfreut und angetan, dass ich sie als Bürgermeisterkandidat besuchen kam. Ruckzuck tischte die lebhafte Seniorin Kaffee und Zuckerringe auf und bat mich, kräftig zuzugreifen. Zwar war und bin ich seit jeher bei Süßspeisen nie abgeneigt. Aber beim letzten Besuch hatte ich schon Kaffee getrunken, und mir waren dazu ebenfalls Süßigkeiten angeboten worden.
Zu viel Kaffee und Süßes
Ich trank dennoch eine weitere Tasse Kaffee und naschte dazu erneut Süßigkeiten. Da ich viel zu Fuß unterwegs war, konnte ich diese maximale Nahrungsaufnahme später auch wieder ablaufen. Während ich mich beim Kaffee mit meinen Gastgebern unterhielt, erzählten sie mir von ihren früheren Lebensverhältnissen in Kasachstan, von wo sie in den Neunzigerjahren nach Deutschland umgesiedelt waren. Schließlich war diese Schwarzwaldgemeinde ihre neue Heimat geworden. Das waren tatsächlich sehr interessante Geschichten.
Wahlkampfunterstützer gewonnen
Dann erzählte mir der ältere Mann, wie groß sein Kreis von Verwandten und Bekannten im Dorf sei. Er sagte zu mir, − inzwischen duzte er mich: „Du brauchst in bestimmten Straßen nicht mehr überall hingehen, ich werde Dich dort überall empfehlen.“ Mein Besuch versprach, sich so richtig zu lohnen. In dem Schwarzwalddorf lebten verhältnismäßig viele Spätaussiedler, weil sich ganz in der Nähe ein klosterartiges großes Gebäude befindet, wo viele dieser Übersiedler Anfang der Neunzigerjahre nach ihrer Einreise nach Deutschland zunächst Aufnahme fanden, ehe sie auf einzelne Gemeinden verteilt wurden. Viele davon ließen sich dann in der benachbarten Schwarzwaldgemeinde nieder. Die Vorstellung, mein Gastgeber würde Werbung für mich im Dorf machen, fühlte sich natürlich sehr erfreulich an.
Abschiedsspezialität kosten…
Meine umtriebigen Gastgeber kamen während unseres Gesprächs immer mehr in Stimmung, und als ich schließlich zu verstehen geben wollte, ich müsse nun weiterziehen, wurde ich gebeten, noch etwas zu bleiben, weil sie mir noch eine "Überraschung" anbieten wollten. Diese geheimnisvolle Einladung konnte ich nicht ausschlagen, das war mir klar. Dann wurde mir eine seltene Spezialität serviert, bei der es sich entweder um Kaviar oder eine ähnliche Kostbarkeit handelte. Mit erwartungsvollen Augen sahen diese herzensguten Eheleute mir nun dabei zu, wie ich ihre erlesene Speise zu mir nahm, welche mir nur leider überhaupt nicht schmeckte.
… und noch eine Portion
Als ich das Tellerchen relativ schnell geleert hatte, schien dies die Frau des Hauses so zu verstehen, als hätte mich eine Genusseuphorie in ihren Bann gezogen. Sogleich ging sie in die Küche und brachte mir nochmal eine Portion heraus, welche ich dann auch noch genießen durfte. Ich hoffte, dass ich mir nichts anmerken ließ, aber es wurde wirklich Zeit, die Wohnung meiner mich verwöhnenden Gastgeber wieder zu verlassen. Das waren sehr nette Menschen, die ich da bei meinem zweiten Hausbesuch kennengelernt hatte, aber ich musste erst einmal eine Weile an der frischen Luft meine Beine vertreten, bevor ich wieder an einer Haustüre klingelte.
Kontakt mit Kommunalpolitikern: berufene Menschen…
Wie in jeder Gemeinde gab es auch in der Schwarzwaldgemeinde, wo ich Bürgermeister werden wollte, markante Leute, die sich für politisches Engagement in ganz besonderer Weise berufen fühlten, bzw., die auf mich den Eindruck machten, sie könnten gute, kooperative Partner in der Kommunalpolitik werden.
…drei Beispiele:
I. Beispiel – ehemalige Gemeinderätin:
Eine Vertreterin aus der kommunalpolitisch aktiven Bürgerschaft, die ich besuchte, war vor ein paar Jahren auch schon Mitglied im Gemeinderat gewesen. Eine Auffälligkeit konnte ich gleich registrieren: ihr großes Sendungsbewusstsein. Sie besuchte auch meine erste Vorstellung im großen Dorfgasthaus.
Parteiversammlung
Schließlich wurde ich von ihr zu einer Versammlung des örtlichen Ablegers der Partei eingeladen, der sie zugehörte. Dort traf ich die überwiegend älteren Mitglieder der Vorstandschaft sowie einige Mitglieder an, die sich ein Bild von mir machen wollten.
Wünsche-Blumenstrauß
Bei solchen Treffen mit kommunalpolitisch besonders ambitionierten Menschen ist es typisch, dass Bürgermeisterkandidaten mit einem Wünsche-Katalog konfrontiert werden, sowie mit vielfältigen Meinungsäußerungen hinsichtlich diverser Verbesserungsvorschläge für die Gemeinde. Die Machbarkeit solcher Ideen - so meine Erfahrungen - standen dabei meistens weniger im Mittelpunkt, wohl aber die Präsentation von gut klingenden Ideen. Das kannte ich schon von ähnlichen Veranstaltungen in der Hegau-Gemeinde.
Für und wider – dafür und dagegen
Bei dieser Veranstaltung wurde beispielsweise gefordert, der neue Bürgermeister sollte dringend für die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe im Ort sorgen. Offen blieb - nach meiner Erinnerung - jedoch die Frage, wo genau eine solche umfangreiche und angeblich Gewerbesteuer einbringende Ansiedlung in der engen Tal-Topografie des Schwarzwalddorfes mit schlechter Straßenanbindung überhaupt realisiert werden könnte. Nach dem Vorschlag für eine Gewerbeansiedlungsoffensive folgten gleich daran anknüpfende Anliegen, man müsse das bestehende Gewerbe auf jeden Fall und unbedingt mehr fördern und es solle nicht immer "alles" für die Tourismusförderung ausgegeben werden. Andere Parteimitglieder hielten aber gerade die weitere − und noch bessere − Förderung des Tourismus für die nach wie vor wichtigste Aufgabe in der Gemeinde, um zum Beispiel die Nahversorgung im Dorf langfristig zu sichern. Wieder andere machten sich dafür stark, dass für die Einwohner "mehr" gemacht werden müsse, zum Beispiel im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs. Also sich beim Landkreis auf die Hinterfüße zu stellen, um eine bessere Anbindung des Dorfes zu erreichen. Besonders beliebt waren auch „grüne“ Themen. Beispiele: "Mehr Sauberkeit im Dorf", "bessere Pflege auf dem Friedhof" oder ein sorgfältigerer Winterdienst und Ähnliches. Umweltschutzthemen hatten seinerzeit aber noch nicht so große Bedeutung bei den diskutierten Themen, im Vergleich zu heute.
Themen zum Mitnehmen
Zwei Themen sprachen mich an diesem Abend aber besonders an: Zum einen, betreutes Wohnen für Senioren, das immer wieder gefordert wurde und - bis dahin - immer gescheitert war, weil sich interessierte Investoren stets zurückzogen. Zum anderen gab es seinerzeit im Schwarzwalddorf eine grottenschlechte Internetanbindung, weil weder Deutsche Telekom noch Kabel BW bereit waren, eine schnellere Anbindung einzurichten. Für beide Themen konnte ich später erfolgreiche Lösungen erreichen.
II. Beispiel – seltsame Begegnung
An den Besuch eines Mitglieds des Gemeinderates aus der zweiten Wählervereinigung im Dorf kann ich mich deshalb noch sehr gut erinnern, weil er mich gleich zu Beginn unseres Gespräches mit seltsamen Fragen konfrontierte.
Sparsamkeit - erste Bürgermeisterpflicht!
Bei unserem Gespräch fragte mich dieser kommunalpolitisch engagierte Bürger, sogleich: "Was verstehen Sie unter Sparsamkeit?" Dabei lächelte er mich etwas schlitzohrig an, mit einem Gesichtsausdruck eines Rechnungsprüfers. Meine erste Reaktion war wohl ein verdutzter Blick, ich wirkte bestimmt auch etwas irritiert, und stellte erst einmal eine Verständnisfrage. Darauf wollte das Gemeinderatsmitglied aber gar nicht eingehen, sondern beantwortete seine Frage gleich selbst, mit einer für mich etwas merkwürdigen Antwort. Er ließ mich wissen, dass seines Erachtens ein Bürgermeister "bis ins kleinste Detail und so weit wie irgend möglich, äußerst sparsam mit den ihm anvertrauten Steuergeldern umzugehen hat". Weiter führte er aus: "Ich erwarte von dem neuen Bürgermeister, dass er im Rathaus streng kontrolliert, ob auch sorgsam mit Büromaterialien umgegangen wird und neue Stifte und anderes Verbrauchsmaterial erst dann wieder neu beschafft werden, wenn das vorrätige Material vollständig aufgebraucht sind". Nachdem ich ihm grundsätzlich hinsichtlich der verantwortlichen Verwendung von Steuergeldern recht gab, brachte ich zum Ausdruck, dass ich als meine eigentliche Aufgabe als Bürgermeister die Gestaltung der Kommunalpolitik in Kooperation mit dem Gemeinderat sehen würde.
Gegenseitig irritierend
Darauf reagierte das Gemeinderatsmitglied etwas irritiert. Ohne es auszusprechen, spürten wir vermutlich gegenseitig, dass wir einander in diesem Moment und in unserer etwas schwierigen Gesprächsatmosphäre nicht gerade in inniger Zugewandtheit verbunden waren. Später, als ich Bürgermeister war, ergab sich mit ihm jedoch eine gute sachliche Zusammenarbeit im Gemeinderat.
III. Beispiel – sozial engagierter Gemeinderat
Aus dieser dritten, kleinsten Wählergruppe lernte ich einen gestandenen Sozialarbeiter mit herzhafter Außenwirkung kennen, der auf mich wie ein Kontrastprogramm zu den beiden vorangegangenen Gesprächspartnern aus der Kommunalpolitik wirkte. Mit ihm hatte ich ein gutes Gespräch, in welchem wir uns nach meinen Erinnerungen jedoch nicht nur über Kommunalpolitik unterhielten, sondern auch bald zu anderen Themen fanden. Seine handfeste, klare Sprache fühlte sich für mich sehr positiv an. Mit ihm hatte ich später als Bürgermeister einen zuverlässigen Partner und tatkräftigen Unterstützer sowie Wegebegleiter bei großen Themen. Außerdem organisierte ich mit ihm größere Projekte wie eine große Spendenaktion, Projekte in der Jugendarbeit mit internationaler Beteiligung, sowie Veranstaltungen, um die Nahversorgung im Dorf zu stärken.
Herzliche Begegnung
Wie es sich für einen wahlkämpfenden Bürgermeisterkandidaten gehört, sucht er nicht nur baldmöglichst das Gespräch mit der Leitung der Schule und den Vorständen aus den Vereinen und der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort, sondern er bemüht sich auch zeitnah um ein Gespräch mit dem Pfarrer der (kath.) Kirchengemeinde. Eine solche Kontaktaufnahme konnte dann auch unkompliziert erfolgen und ich saß sehr bald mit ihm an einem Nachmittag bei einer Tasse Kaffee an einem Tisch im Pfarrhaus, zusammen mit dem Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates und sozial engagierten - ehrenamtlichen - Mitarbeitern des Pfarrers. Was mir sofort auffiel war das herzliche, humorvolle Wesen des schon älteren Pfarrers. Er verstand es, gute Tipps für den - vielleicht - neuen Bürgermeister augenzwinkernd in witzige Erzählungen und Andeutungen zu verpacken. Ich fühlte mich sehr wohl dabei und musste öfter schmunzeln über das heitere Auftreten des Ortsgeistlichen. Auch war ich angetan von der sehr freundlichen Begegnung mit dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden. Mit ihm (einem pensionierten Schulrat) hatte ich später als Bürgermeister einen treuen Begleiter, wenn es darum ging, sich mit spannenden Projekten hinsichtlich der Gemeindegeschichte zu befassen.
Unternehmerpersönlichkeiten
Ganz besonders markante Persönlichkeiten lernte ich auch bei meinen Haus- und Firmenbesuchen bei alteingesessenen Unternehmen im Ort kennen. Als Interessenträger und Arbeitgeber vertraten sie - teilweise sehr engagiert - ihre Positionen in der Kommunalpolitik des Dorfes. Unter ihnen gab es durchaus herausfordernde Gesprächspartner.
Kleine Story:
Raubeinig
Als einen der ersten Betriebe im Dorf besuchte ich einen Handwerksbetrieb. Dort wollte ich die Anliegen der Firmeninhaber kennenlernen. Beim Eintreffen in einem solchen Betrieb traf ich zunächst die Frau des Unternehmers an. Mit ihr hatte ich ein freundliches und informatives Gespräch über die Gemeinde und über die Situation des Handwerks im Dorf. Dann traf auch der Firmen-Chef ein. Mein erster Eindruck: Der Mann verfügte über einen sehr kräftigen Körperbau sowie einen frechen, entschlossenen Blick, mit welchem er mich musterte, als ich mit einem ultrakräftigen Händedruck von ihm begrüßt wurde. Danach glaubte ich kurz, mit meiner Hand in einem geschlossenen Schraubstock gelandet zu sein. Das war der freundliche Teil meiner Begegnung mit ihm.
Wutentbrannt
Was für Probleme genau der Handwerksmeister mit der Gemeinde in jüngster Vergangenheit hatte, war mir nicht bekannt. Aber nur ein konfliktreicher Hintergrund konnte dafür verantwortlich sein, warum mich plötzlich bei meinem Besuch seine geballte Ladung kritischer Anmerkungen zum aktuellen Gemeinde-Geschehen traf. So ließ er mich zum Beispiel mit ruppigen Worten wissen, was er von der anstehenden Bürgermeisterwahl halte, nämlich "null und nichts", wie er sich ausdrückte.
Rettende Rückzugschance
Gott sei Dank traten exakt zu dem Zeitpunkt, als mein fauchender Gastgeber vor mir diese Worte ausgesprochen hatte, zwei Besucher in das Büro ein. Sie konnten sofort die Meckerlaune des Firmen-Chefs wieder aufhellen. Diese Gelegenheit nutzte ich, ohne zu zögern, um mich zu verabschieden, weil es für mich keinen Zweifel gab: An diesem Tag war ich in dieser Firma nicht wirklich willkommen. Als ich Bürgermeister war, lernte ich den Handwerksmeister jedoch auch von seiner kooperativen Seite kennen.
Hilfsbereitschaft
In einer Gaststätte im Bereich von Sportvereinen veranstaltete ich einen Informations- und Diskussionsabend zum Thema Ehrenamt, Vereinsarbeit und bürgerschaftliches Engagement. Der Abend war gut besucht und es kamen Vertreter von Feuerwehr, Vereinen, Jugendarbeit und Kirche. Es wurde über viele Themen diskutiert, unter anderem darüber, wie wichtig die Hilfsbereitschaft und das freiwillige Engagement im Dorf sind. Dass es sich bei dem letzteren Thema nicht nur um politische Phrasen handelte, das erlebte ich nach der Veranstaltung ganz praktisch.
Auto eingefroren
Es war ein saukalter Winterabend mit reichlich Schneefall. Als ich meinen alten Opel-Corsa, den ich als Zweitwagen für meine Wahlkämpfe anschaffte, von der umfangreichen Schneehülle befreite, die sich während meiner Veranstaltung auf ihm angesammelt hatte, erlebte ich eine unschöne Überraschung. Aus meiner Heimfahrt in das etwa 25 Kilometer entfernt gelegene Donaueschingen wurde nichts, da die Bremsen eingefroren waren.
Einsam auf dem Parkplatz
Die zahlreichen Autos, welche auf dem Parkplatz parkten, wurden nach und nach alle weggefahren. Und nun stand ich allein mit meinem vereisten Karren auf dem Platz. Allein? Nicht ganz! Denn ein netter Mann, Ende fünfzig, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, der an meinem Diskussionsabend teilgenommen hatte, bemerkte mich und meine hilflose Situation. Er versuchte zunächst, zu helfen. Aber es gelang leider nicht mehr, das eingefrorene Gefährt in Bewegung zu setzen. Daraufhin fuhr er mich nach Donaueschingen. An diesem späten Abend hatte mir mein Schutzengel doch noch einen herzensguten Retter vor dem Erfrieren geschickt.
Darf ich Ihr Auto reparieren?
Am anderen Tag erhielt ich zuhause früh am Morgen einen Anruf. Am anderen Ende der Leitung sprach mich wieder dieser freundliche Helfer vom Vorabend an, der mir mitteilte, er befinde sich gerade mit seinem Werkzeug neben meinem eingefrorenen Opel und wolle gerne versuchen, das Fahrzeug wieder einsatzbereit zu machen. Bevor er sich ans Werk machte, wollte er mich fragen, ob mir "das recht" sei. Ich war natürlich hoch erfreut über so viel Hilfsbereitschaft und sehr gerührt von der Frage meines Anrufers (besonders, wie er fragte), die ich natürlich gerne mit "ja" beantwortete. Als meine Frau mich wieder in den Schwarzwaldort zu meinem Pannen-Auto fuhr, war dieser hilfsbereite Mensch schon an der Arbeit. Der Opel war bereits mit einem Wagenheber hochgebockt und ich hatte den Eindruck, mein Helfer wusste genau, was er tat. Und so kam es. Sehr bald konnte ich wieder mit meinem PKW fahren.
Helferfreude
Ich bedankte mich sehr für die mir entgegengebrachte Hilfsbereitschaft. Das Rührende dabei war, als sich auch mein Helfer sichtbar, wie ein Schneekönig freute, dass es ihm gelang, mir zu helfen. Das war ein schönes Erlebnis!
Radiosender-Termin platzt
Meine wiedererlangte Mobilität war auch sehr willkommen, denn ich hatte noch unzählige Termine in meinem Wahlkampf. Neben Treffen mit vielen Leuten vor Ort und Interviews mit Journalisten der Tageszeitungen interessierte sich für den Wahlkampf im Schwarzwalddorf auch ein Privat-Radio-Sender, der in der Region gerne von bestimmten − und für Wahlkämpfer interessanten Zielgruppen − gehört wurde (wurde auch "Hausfrauen-Sender genannt"). Dieser lud alle drei Bürgermeisterkandidaten zu einer bei den Hörern und Hörerinnen sehr beliebten Feierabendsendung ein.
Kleine Story: Wo bleibt Gerold Löffler?
Als ich zu diesem Termin des Radiosenders fahren wollte, startete für mich ein misslingender Wahlkampfabend, den ich nie vergessen werde. Was für eine super Pleite war das! Nicht deshalb, weil ich dummes Zeug im Vergleich zu meinen beiden Mitbewerbern während der Sendung von mir gegeben hätte. Nein! Peinlich war, dass ich erst gar nicht beim Radio-Sender ankam, somit von dieser guten und seltenen Gelegenheit, in einer Sendung für mich werben zu können, ausgeschlossen war, und dafür meine beiden Mitbewerber mehr Sendezeit hatten.
Auto und Orientierung streiken
Begonnen hatte der chaotisch verlaufende Abend damit, dass ich wieder einmal mit meinem alten Auto Probleme hatte, welche erst behoben werden mussten, um damit weiter fahren zu können. Nach dieser Pannenbehebung war es aber bereits zu spät, um noch pünktlich im Radiostudio anzukommen. Nun wäre es angebracht gewesen, dass ich beim Radiosender anrufe, um mich aus diesen nachvollziehbaren Gründen zu entschuldigen. Aber eine solche vernünftige Handlung hatte leider keinen Platz mehr in meinem adrenalingeladenen Wahlkampf-Hirn, das "Besitz" von mir genommen hatte. Und außerdem: Diesen Gefallen gönnte ich meinen beiden Mitbewerbern nicht, ohne mich im Radio auftreten zu können. Ausgeschlossen! Ich musste es irgendwie schaffen, an diesem öffentlichkeitswirksamen Termin teilzunehmen. Jedoch so viel "Gas" konnte ich gar nicht geben, um doch noch pünktlich zur Sendung beim Radiosender anzukommen.
Zwar zu spät – aber: was soll's
Egal! Ich drückte auf das Gaspedal in meinem alten Opel, soweit dies irgendwie möglich war (Gott sei Dank wurde ich nicht geblitzt). Und nun passierte das, was in einer solchen Situation absolut deplatziert ist: Ich verfuhr mich auch noch heillos, was wahrscheinlich meiner aufgeheizten Stimmung geschuldet war. In meinem kleinen Auto herrschte Explosionsgefahr, so wütend wurde ich! Dafür konnte ich "meine" Radiosendung, die umständehalber ohne mich begann, vom Autoradio aus mithören. Das waren sehr unerfreuliche Momente! Gott sei Dank hörte niemand, wie ich laut fluchte.
Moderator erneut: Wo bleibt…?
Zwischendurch hörte ich dafür immer wieder den Moderator besorgt sagen: "Der Bürgermeister- Kandidat Gerold Löffler ist leider immer noch nicht im Studio angekommen, und wir hoffen alle, dass ihm nichts passiert ist." Dann fügte er noch hinzu: "Vielleicht kommt er ja noch“. "Er" konnte aber nicht mehr rechtzeitig kommen und auch ich begriff irgendwann, dass es keinen Sinn mehr machte, zum Radiosender weiterzufahren (um kurz vor dem Ende der Sendung anzukommen). Da meine Frau am Radio zu Hause mithörte, machte sie sich Sorgen und rief mich über das Handy an. Ich erklärte ihr das Missgeschick und bat sie, mich beim Sender zu entschuldigen.
Sogar vorteilhaft?
Kurios an dieser Geschichte war aber die Wirkung bei manchen Leuten im Schwarzwald-Dorf. Diese sprachen, als ich sie bei Hausbesuchen traf, weniger davon, wie diese Sendung am Vorabend verlief, sondern mehr von der Besorgnis, was mit dem "verlorenen Sohn" los war, der nicht im Radio gehört werden konnte. So gesehen hat mein Nichterscheinen bei der Radiosendung vermutlich mehr Aufmerksamkeit für mich gebracht, als wenn ich an dieser teilgenommen hätte. Meine Flüche im Auto konnte ich also nachträglich "stornieren".
"Trostpflaster": eigener Sendetermin
Bemerkenswert war dann auch noch die Reaktion des Radiosenders, denn man lud mich auf eine folgende Sendung − ganz allein − ein, um das Gespräch mit mir nachzuholen. So konnte ich mir zuvor die verpasste Sendung anhören, welche meine Frau aufgezeichnet hatte, und war so bestens auf die Fragen des Moderators vorbereitet. Außerdem musste ich meine Sendezeit nicht mit Mitbewerbern teilen. Wieder einmal bestätigte sich für mich, dass manchmal Dinge geschehen, die unvorhersehbar sind und verblüffende Reaktionen auslösen.
Finale - offizielle Vorstellung
So gingen die Tage und Wochen in meinem zweiten Wahlkampfabenteuer in der schönen Schwarzwaldgemeinde schon deshalb schnell vorüber, weil jeder Tag reichlich gefüllt war mit Vorbereitungen, Terminen, Hausbesuchen. Somit kam auch das große, offizielle Schaulaufen der Bürgermeisterkandidaten immer näher. Insbesondere bei der offiziellen Vorstellung der Kandidaten in einer großen Halle kommt es darauf an, zu punkten. Dieses Spektakel kannte ich ja schon von meinem Wahlkampf in der Hegau-Gemeinde, welche gerade erst vor wenigen Monaten, im Herbst 2001 stattgefunden hatte. Inzwischen zeigte das Kalenderblatt den Monat Februar 2002.
Gut vorbereitet zum Wahlkampfendspurt
Der Coaching-Drill lief schon auf Hochtouren. In den vergangenen Wochen des Wahlkampfes konnte ich auch einige Themen einfangen und mir durch meine unzähligen Hausbesuche ein rundes Bild machen, was die Dorfbewohner wirklich interessierte. Entsprechend richtete ich meine Bewerbungsrede an die Bürgerschaft aus. Mein Wahlkampf- "Zuchtmeister" ließ nichts aus (soweit ihm dies bei seinem speziellen Zögling möglich war), mich optimal auf meinen Auftritt in der Festhalle der Schwarzwaldgemeinde vorzubereiten.
Zettelstapel statt Rede-Mappe
Wegen meiner Handicaps beim Nah-Sehen und beim Ablesen der Redetexte kam ich am besten mit quer ausgedruckten DIN A 5 Blättern mit großen Buchstaben zurecht, auf welchen ich mit bunten Anmerkungen bestimmte Betonungen und Bedeutungen hervorhob. So druckte ich einen entsprechend umfangreichen Papierstapel für meinen Auftritt aus. Allerdings ließ sich dieser nicht in eine hochfeine Leder-Mappe für DIN A 4 Blätter einlegen. Solche trugen jedoch stilvoll meine Mitbewerber beim Einzug in die Festhalle unterm Arm. Ich hatte meinen Zettelstapel in der Innentasche meines Jacketts verstaut, das unvermeidlich etwas anschwoll. Da machten sich schon die ersten Stilunterschiede der drei Bürgermeister- Kandidaten bemerkbar. Ferner trug ich auch keinen feinen dunklen Anzug, wie meine ein wenig älteren Mitbewerber, sondern ein gelbes Jackett. Ob das wohl gut ankommen würde?
Festlicher Einzug
Nach dem Einzug der Kandidaten, begleitet vom noch amtierenden Bürgermeister als Wahlleiter und Moderator der Veranstaltung, begrüßte dieser zunächst die etwa fünfhundert Besucher der großen Wahlkampf-Show. Dazu nahmen er und wir drei Bürgermeisterkandidaten an einer Tischreihe im Bereich der Hallenbühne Platz, auf welcher Mikrofone auf ihren Einsatz warteten. Welcher Kandidat - wo - sitzen durfte, war auch schon geregelt, durch aufgestellte Namensschilder an der Tischaußenkante. Auf der anderen Seite der Bühne befand sich das mit Blumenschmuck verzierte Rednerpult. Der Sitzungsleiter erläuterte als erste Amtshandlung - nach einer Begrüßung der Bürgerschaft - das streng strukturierte Programm des Abends, das sich in allen Kommunen bei solchen offiziellen Kandidatenvorstellungen ähnelt. Dann ging es los.
Show beginnt – Erstredner
Da ich meine Bewerbung als erster Bewerber im Rathaus abgegeben hatte, durfte ich auch als erster Kandidat reden. Meine Mitbewerber wurden von einer freundlichen Gemeindemitarbeiterin in einen Raum im Untergeschoss "abgeführt", weil sie die Rede des Kollegen nicht mithören durften. Dafür hatten wir Kandidaten unsere Fans im Saal, welche uns später über die Wirkung unserer Auftritte und dieselben der Mitbewerber nach der Show informierten.
Seriöser Auftritt
Nun wurde ich gebeten zu beginnen. Hinter einem Pult zu reden, kam mir entgegen. Gegenüber der vergleichbaren Situation in der Hegau-Gemeinde, als ich mich experimentierfreudig für eine frei vorgetragene Vorstellung mit Lichtbildern entschieden hatte, erlebte ich dieses konservative Format meiner Vorstellung vor sehr vielen Zuhörern als wesentlich vorteilhafter. Schon deshalb, weil ich mich nicht − wie als Freiredner − unter den kritisch beobachtenden Augen des Publikums während der Rede auch noch auf viele Details für eine zielführende, - im Rhetorik-Training andressierte - Körpersprache konzentrieren musste.
Auftakt-Improvisation
Also fühlte ich mich ganz wohl hinter dem Pult und auch erstaunlich locker an diesem Abend. Selbst dann noch, als mir plötzlich auffiel, dass das Herausnehmen meiner vielen Redezettel aus der Innentasche meines Jacketts trotz Pult nicht unbeobachtet vom Publikum erfolgen konnte.
Dicker Zettelstapel
Aber das Improvisieren war mir nicht fremd. Deshalb bückte ich mich kurz hinter dem Rednerpult, als ob ich etwas aufheben wollte, zupfte meine vielen Zettel eiligst aus dem Jackett und legte sie beim Wiederaufrichten auf die Ablage, die nicht von außen einsehbar war. Allerdings war es gut, dass mein strenger Coaching-Professor diese Situation nicht mitbekam, er hätte mich im übertragenen Sinne vermutlich an den Ohren gezogen.
Lange Schweigesekunden
Aber nach diesem kleinen Missgeschick verhielt ich mich wieder drehbuchmäßig, entsprechend der Dressur im Coaching zur Vorbereitung des Auftritts. So stellte ich mich einige (gefühlt einhundert …) Sekunden aufrecht hin, mit klarem, entschlossenem, aber nicht unfreundlich wirkendem Blick zum Publikum und trank langsam einen Schluck Wasser aus dem bereitgestellten Glas. Damit − so lautete bei den Redeproben im Rhetorik-Kurs die Begründung für dieses Verhalten − sollte es dem Publikum zunächst ausreichend und "ungestört" ermöglicht werden, den Redner vor Beginn des Auftritts in Ruhe wahrzunehmen. Nicht umsonst, so hatte dies mir mein Wahlkampf-Dompteur eingebläut, sagt der Volksmund, dass die ersten Blicke darüber entscheiden, ob man jemanden mag oder nicht. Also sollte man diesen ersten Blick nicht „versauen“. Ich tat nun alles, um dieses Ziel bei einer solch wichtigen Veranstaltung zu erreichen.
Backstage-Körpersprache
Wenn ich mich richtig erinnere, stellte ich sogar während meiner Rede meine beiden Füße nicht X-förmig, sondern seriös nebeneinander, wie beim Rhetorik-Training eingedrillt, obwohl diese von den Zuhörern überhaupt nicht sichtbar waren. Aber: Was durch hartes Training in Fleisch und Blut übergangen war, das saß und kam zur Anwendung, ob sinnvoll oder nicht. Übrigens: Die verdeckte Redezettelaufhebaktion zu Beginn meines Vortrages blieb zwar vom Publikum, nicht aber von den Presseleuten unbemerkt. Eine Tageszeitung schrieb einen lustigen Satz dazu bei der Wahlkämpfer-Einzelkritik, als über manche Auffälligkeiten der Kandidaten während des Abends berichtet wurde. Wie sich zeigte, sollte mir das aber überhaupt nicht schaden.
Gedrilltes Vortragsverhalten
Dann hielt ich meine Rede und achtete stets darauf, immer wieder ins Publikum zu schauen, insbesondere, wenn es etwas Bedeutendes aus meiner Rede hervorzuheben galt, was unter anderem auch meine farbenfrohen Markierungen auf den Redezettel steuerten.
Auch Sonder-Gestus klappt
Auch meine − nach außen gerichteten − Handinnenflächen fuhr ich dann an der Stelle in der Rede aus, als ich das Publikum bat, mir ihr Vertrauen zu schenken. Schließlich achtete ich mehr oder weniger erfolgreich darauf, während meines Vortrags nicht schneller zu werden und nicht nuschelnd zu sprechen, wozu ich ansonsten in meinem Freiburger Dialekt neigte, sondern ich bremste meinen Redefluss immer wieder künstlich ab. Letzteres fiel mir besonders schwer, weil sich − in meiner Wahrnehmung − mein Gesprochenes dann hinsichtlich der Dynamik wie eine Gutenachtgeschichte anhörte. Aber auch in dieser Hinsicht war ich durch eine strenge Coaching-Schule gegangen. Das hat wohl geholfen.
Applaus - dann Fragerunde
Der Applaus nach meinem Vortrag fühlte sich so an, als würde er nicht nur aus Höflichkeit gespendet, und mein Vortrag wurde, laut den mich später vielfach erreichten Rückmeldungen, überwiegend positiv bewertet. Nach meiner Rede hatten die Zuhörer die Gelegenheit, Fragen an mich zu stellen. Sie sprachen einen ganzen Blumenstrauß von Themen an, von meiner politischen "Heimat" bis hin zu konkreten Fragen, zum Beispiel, ob ich mich hinsichtlich Betreutem Wohnen für Senioren einsetzen würde, oder wie ich mir eine Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat vorstelle, sollte ich Bürgermeister werden.
Wohltuende Frage
Interessant für mich war auch die Frage, wie lange ich, − sollte ich gewählt werden −, vorhätte, Bürgermeister im Schwarzwaldort zu bleiben, oder ob dieses Amt für mich dann nur ein Sprungbrett für weitere Karrieresprünge bedeuten würde. Das fand ich wohltuend, denn so fragt ja nur jemand, der sich mich als neuen Schultes wünscht. Als jüngster Kandidat war es auch dann ein Leichtes für mich zu antworten, weil ich altersbedingt eine lange Amtszeit in Aussicht stellen konnte. Für das Betreute Wohnen im Dorf machte ich mich schon im Wahlkampf stark, (dieses Projekt konnte ich später auch umsetzen). Somit überstand ich diese Bürgerfragerunde in meiner Wahrnehmung mit gutem Ergebnis.
Zwischenfazit: Schwarzwald-Arena besser als Hegau-Show
Im Unterschied zu meinem Abgang nach der Rede bei der Kandidatenvorstellung der Hegau-Gemeinde ging ich an diesem Abend mit einem guten Gefühl aus der Halle, aus der ich nach meinem Auftritt von einer sehr freundlichen Gemeindemitarbeiterin weggeführt wurde, damit der nächste Kandidat den Platz am Rednerpult einnehmen konnte. Übrigens: Meine vielen Redezettel musste ich beim Herausgehen eingerollt in der Hand tragen und konnte sie nicht mehr verstecken. Aber das hat, − glaube ich jedenfalls −, niemanden mehr interessiert.
Backstage-Szenen nach dem Auftritt
Gesprächiger ortsansässiger Mitbewerber
Als ich den Backstage-Raum im Untergeschoss der Festhalle betrat, waren noch beide Mitbewerber im Raum. Der ortsansässige Kandidat machte sich vermutlich etwas locker, indem er mir − für mich in dieser Situation total unerwartet − mit erheiternder Mimik versicherte: "Herr Löffler, diese Wahl wird sicher nicht heute entschieden". Nachdem ich an diesem Abend noch keine Gelegenheit hatte, mit diesem Mitbewerber zu sprechen, war ich über seine - so spontan und engagiert - vorgetragene Meinungsäußerung kurz etwas irritiert. Schließlich fand ich seine direkte Ansprache aber dann ganz amüsant, weil sie so ungekünstelt wirkte, wie aus einem kindlichen Gemüt entsprungen.
Verkrampfter anderer Mitbewerber
Weniger amüsant fand ich, wie mein von mit "gefürchteter" Mitbewerber (der Wirtschafts- und Tourismusförderer) kurz vor seinem beginnenden Auftritt wirkte. Ich vermutete erst, ihm sei vielleicht schlecht geworden. Sein Blick machte auf mich einen sehr angestrengten Eindruck, die Gesichtsfarbe wirkte blass und die Körpersprache des Kollegen drückte in seinem dunklen, feinen Anzug das Gegenteil von Zuversicht und Lockerheit aus. Das verwunderte mich, denn ich erwartete, er werde doch gleich mit - „geschwellter“ Brust - siegessicher in die Arena steigen, bei den Spitzen-Qualifikationen, welche er in der Tasche und von denen die Presse umfangreich berichtet hatte. Auch stellte ich mir schon vor, wie ihn bald ein besonders herzlicher Beifall der anwesenden Ortsprominenz und von einigen kommunalpolitisch engagierten Bürgern begeistert begrüßen würde. Oder sollte mein Coaching-Professor doch mit seiner Einschätzung − im Rahmen seiner ruppigen Zurechtweisung mir gegenüber − recht behalten, dass SCHEIN nicht gleich SEIN bedeutet? Schließlich wollte ich dann erst einmal doch nicht glauben, was ich sah und dachte, der bedrückt wirkende Zustand des Mitbewerbers sei eben seine besondere Art der Fokussierung auf das, was er nun gleich in der Halle als zweiter Kandidat professionell gekonnt und exzellent präsentieren würde. Zu dieser, seiner Präsentation wurde er nun auch vom Gemeindepersonal abgeführt.
Lebhafte Unterhaltung
Für meine Backstage-Unterhaltung während der folgenden, etwa halbstündigen Pause sorgte dann, ohne zu zögern, der ortsansässige Mitbewerber, welcher als dritter und letzter Kandidat zum Schluss an der Reihe war. Lampenfieber war für ihn offensichtlich ein Fremdwort. Stattdessen erzählte mir das muntere Gemeinderatsmitglied einige Geschichten aus dem Dorf-Geschehen. Vor allem, so erinnere ich mich, war es ihm ein Herzensanliegen, die großen Verdienste des noch amtierenden Bürgermeisters in dessen dreieinhalb Jahrzehnte dauernder Regentschaft zu beschreiben. Diesen begleitete er schon einige Jahre im Gemeinderat. Die Erzählungen waren mit einem Festival der Superlative verbunden.
Hohes Lied auf Altbürgermeister
"Sein Vermächtnis", so lautete die von meinem Wahlkampfkollegen mehrfach bedeutungsvoll hervorgehobene Botschaft, an die ich mich erinnere, müsse nun weiter fortentwickelt werden. Dafür sollte der neue Bürgermeister besondere Eigenschaften mitbringen, war er sich sicher. Mit diesem gesprächigen Mitbewerber gab es jedenfalls null Langeweile während der halbstündigen Wartezeit, die im Nu verging.
Szenenwechsel: Bedrückt - warum?
Als meine "Pausenunterhaltung" dann für ihren Auftritt den Raum in Richtung Bühne verlassen hatte, war es für einen kurzen Augenblick mucksmäuschenstill um mich herum. Dann kam mein favorisierter Mitbewerber, der Wirtschaftsförderer aus der Halle zurück, der als zweiter Kandidat seinen Auftritt gehabt hatte. Da bestätigte sich für mich eindeutig mein Eindruck von seinem unwohl wirkenden Befinden, den ich schon vor seiner Vorstellung gehabt hatte. Nur wirkte der Kollege aber noch geschaffter auf mich, ja fast erschöpft. Meine erste Deutung seines Gesichtsausdruckes nach dem Auftritt war, er müsse mit sich und seiner Performance unzufrieden gewesen sein. Die nächste knappe halbe Stunde, welche ich jetzt mit diesem Mitbewerber zu verbringen hatte, war dann ein Kontrastprogramm im Vergleich zu der Pause zuvor, während seines Auftritts. Die Stimmung im Warteraum glich nun einem meditativen Schweigen. Die halbe Stunde Wartezeit empfand ich nunmehr als eine Ewigkeit. Wenn ich mich richtig erinnere, ergab sich kaum ein Gespräch zwischen uns. Beide blätterten wir zum Zeitvertreib in unseren Redemanuskripten.
Zurück in die Arena
Nachdem auch der dritte, - der ortsansässige Kandidat - seinen Soloauftritt hinter sich gebracht hatte, wurden der zweite Mitbewerber und ich wieder aus dem Backstage-Raum abgeholt und in die Halle begleitet. Dort, an der großen Tischreihe auf der Bühne, nahmen alle Kandidaten und der amtierende Bürgermeister als Vorsitzender des Wahlausschusses, wie schon ganz zu Beginn des Abends, wieder ihre Plätze ein.
Abschluss – Fragerunde
Der Vorsitzende erläuterte nochmals das weitere Vorgehen, wonach Fragen an einzelne oder an alle Kandidaten aus dem Publikum gerichtet werden konnten. Die befragten Kandidaten mussten sich bei ihren Antworten an eine bestimmte Zeit-Vorgabe halten und wurden durch ein akustisches Signal gestoppt, wenn sie überzogen.
Positives Presse-Feedback
Auch bei dieser Frage-Antwort-Runde zum Schluss ereignete sich nichts, wofür ich mich hätte im Nachhinein ärgern müssen. In den späteren Presseberichten war nachzulesen, ich hätte mich bei diesem letzten Teil der offiziellen Vorstellung insgesamt souverän mit einem lockeren Auftritt präsentiert.
Zurück in die Vorstellungsshow:
Wer liegt vorne?
Positive Rückmeldungen erhielt ich von meinem "Fan-Club" aus der Halle unmittelbar nach der Veranstaltung. Auch bei den folgenden Hausbesuchen wurde mir mehrfach bestätigt, ich hätte mit meiner Vorstellung überzeugt und könne viel Zuspruch erreichen. Dass ich bei manchen Fragen einräumte, nicht schon fertige Antworten parat zu haben, hätte mir nicht geschadet. Allerdings war mir klar, dass es durchaus noch Chancen für meine Mitbewerber gab, im Dorf punkten zu können. Insbesondere für den Kollegen vom benachbarten Oberzentrum mit seinen Qualifikationen. Aber auch die vielfältigen Erfahrungen meines ortsansässigen und gesprächigen Mitbewerbers in der Kommunalpolitik, seine langjährige Zugehörigkeit im Gemeinderat und seine intensive Vernetzung im Dorf, - insbesondere bei den Vereinen -, waren nicht zu unterschätzen.
Wer kann mehr Bürgernähe vermitteln?
Die Frage war für mich außerdem, welcher von den beiden auswärtigen Bewerbern sich mehr für einen bürgernäheren Politikstil im Wahlkampf empfehlen konnte, und damit bei der Wählerschaft die Nase vorne haben würde. Jedenfalls waren diese Wahlkampferkenntnisse für mich der Schlüssel für den Wahlerfolg und ich legte daher auf sie den Schwerpunkt in meiner Rede bei der Vorstellung in der Festhalle.
Zweites großes Show-Laufen
Aber der Wahltag war erst Anfang März 2002; im Februar lief der Wahlkampf noch auf Hochtouren. So lud eine Woche nach der großen Vorstellungsshow der Gemeinde eine in der Region viel gelesene Tageszeitung zu einer Wahlkampfveranstaltung mit Podiumsdiskussion im Saal des großen Dorfgasthauses ein. In der Einladung wurden die Besucher mit dem Versprechen gelockt, sie dürften gerne mehrfach und hartnäckig bei den Bewerbern nachfragen. Außerdem gab es für die Leser die Möglichkeit, zuvor Fragen an die Redaktion einzureichen, welche der Moderator des Abends dann den Kandidaten präsentierte. Eine zielgerichtete Vorbereitung auf dieses Format der Kandidatenpräsentation war schwer möglich. Bei diesem stand für den Veranstalter neben der Informationsvermittlung natürlich auch die "Show" im Vordergrund, über die dieser anschließend umfangreich berichten konnte, gespickt mit Schnappschüssen der Pressefotografen.
Vorsicht!
Besonders mussten wir Kandidaten auf der Hut sein, dass wir uns bei Nachfragen aus dem Publikum nicht in Widersprüche verwickelten. Auch wäre es für uns ungut gelaufen, hätten wir auf konkrete Fragen aus dem Publikum ausweichend geantwortet, oder - noch schlimmer - mit einem Herumeiern reagiert, um uns so aus der Affäre zu ziehen. Auf solche Situationen lauerte naturgemäß der Moderator des Abends. Wir Kandidaten taten deshalb gut daran, gegebenenfalls offen eine Lücke in unserem sonst reichhaltigen Antworten-Schatz einzuräumen und die umgehende „Nachreichung“ einer Antwort in Aussicht zu stellen. Unser listiger Gastgeber, ein erfahrener Journalist, hätte es ansonsten professionell verstanden, gezeigte Schwächen auf Hochglanz zu polieren, um uns aus der Reserve zu locken. Gleiches galt, wenn sich einer oder mehrere Kandidaten im Wahlkampffieber hätten provozieren lassen und laut geworden wären.
Kandidaten bleiben cool
Aber wir Bewerber um das Bürgermeisteramt hatten uns alle drei im Griff. Entsprechend vorsichtig verhielten wir uns während des Abends. Alle Kandidaten wollten kurz vor dem Wahltermin des ersten Wahlgangs Anfang März des Jahres 2002 keinen größeren Bock mehr schießen. Dennoch erinnere ich mich an lebhafte Diskussionen an diesem Abend, bei denen ich und auch meine Mitbewerber zwar nicht auf alle Fragen konkret antworten, ich aber mit dem Verlauf dennoch zufrieden sein konnte.
Kleine Story dazu:
Wahlkämpfer auf die Probe stellen
Nicht umsonst nennt man die Bewerbungsphasen auf politische Ämter Wahl-KAMPF. Schon der frühere langjährige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm brachte einmal das Politikgeschäft treffend mit den Worten auf den Punkt: „Politik ist Kampf, wer Harmonie sucht, muss sich etwas anderes suchen.“ Als ich mich spontan zu der ersten Bürgermeisterkandidatur in der Hegau-Gemeinde im August 2001 entschloss, hatte ich noch keine Vorstellung davon, was konkret auf mich zukam. In der Politik war ich ja noch nie tätig gewesen. Nach sieben Monaten Wahlkampf im Rahmen von zwei Wahlkämpfen hintereinander hatte ich dann allerdings intensiv und im Schnelldurchgang meine Lektionen gelernt.
Test: Flexibel - oder nicht?
Meine gesammelten Erfahrungen: Neben einer guten Kampfkondition muss man bereit sein, einiges aushalten zu können. Wer in einen Wahlkampf, besonders einen Bürgermeisterwahlkampf zieht, auf den warten viele unerwartete Situationen, welche es zu bestehen gilt, und man braucht neben viel Humor ein hohes Maß an Frustrationstoleranz, einen langen Atem - und - ab und zu auch die Gabe, improvisieren zu können, weil man beispielsweise auch bereit sein muss, sich auf besondere Tests einzulassen. Eine solche Situation ergab sich gleich zum Auftakt der Vorstellungsshow, zu welcher, wie schon erwähnt, eine Tageszeitung ins große Dorfgasthaus eingeladen hatte. Es kamen wieder viele interessierte Leute zu diesem Event.
Kuriose Aufgabe
Der Moderator holte nach einer gemeinsamen Begrüßung aller Kandidaten zum Auftakt jeden Kandidaten einzeln auf die Bühne und belehrte diesen zunächst, warum er gleich eine seltsame Frage an ihn stellen werde. Damit solle getestet werden, so seine Ankündigung, wie schlagfertig und flexibel sich die Bewerber bei unerwarteten Situationen verhalten. Da ich als Erstbewerber auch wieder als erster an der Reihe war, wurden die beiden anderen Kandidaten aus dem Raum geführt, damit sie keine Antworten kopieren konnten.
Ausflug nach "Texas"
Dann legte der Moderator schwungvoll und gut gelaunt los: "Herr Löffler, stellen Sie sich vor: Sie sind ein Bürgermeister in einem kleineren, landwirtschaftlich geprägten Dorf in Texas, USA. Von weitem sehen Sie eine Reitergruppe kommen, welche direkt auf ihre Gemeinde zureitet. In dem Anführer der Gruppe erkennen Sie bei näherem Hinsehen einen bekannten superreichen Industriellen, der in der texanischen Gemeinde einen großen Industriebetrieb ansiedeln möchte. Wie empfangen Sie Ihren Besucher?" Zugegeben, mit einem solchem "rund-karierten" Szenario, das ich mir auf die Schnelle vorstellen musste, fiel es mir nicht gerade leicht, mich schnurstracks gedanklich nach Texas zu verpflanzen. Mit Texas verband sich für mich ein Kontrastprogramm zu der Realität in dem saukalten, schneereichen Schwarzwalddorf im Februar 2002.
Achtung - Glatteis!
Aber Obacht: So etwas in einer solchen Situation in der Öffentlichkeit von sich zu geben, hätte automatisch zur Folge gehabt, vom Moderator mit, der für Wahlkämpfer sehr heiklen Frage konfrontiert zu werden, was denn gegen ein schneereiches, saukaltes Schwarzwalddorf im Winter spreche, in welchem sich in der Winterjahreszeit gerade wegen des Schnees viele Touristen gern aufhalten. Diesen Gefallen wollte ich ihm natürlich nicht tun. Eine klassische, wohlfeile Antwort zu geben, fand ich aber auch langweilig. Zum Beispiel wenn ich gesagt hätte, "ich würde den betuchten Reiter bei seiner Ankunft sofort als willkommenen Unternehmer in Empfang nehmen und dabei versuchen, ihm mit der Aufzählung einiger besonderer Standortvorteile in meiner Texas-Gemeinde den Mund wässrig zu machen".
Sekunden vergehen im Nu
Nun stand ich da, wie der dumme Schulbube, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat und dem spontan keine plausible Ausrede einfällt. Die Sekunden vergingen und die Blicke des Publikums fixierten mich zunehmend intensiver. "Jetzt bloß nichts Blödes von dir geben", schoss es mir durch den Kopf.
Mit Emotionen einfangen?
Da mir nichts Schlaueres einfiel und ich nicht länger warten durfte, gab ich schließlich spontan den Satz von mir: "Ich würde den Unternehmer herzlich begrüßen und gleich meiner Bewunderung zu seinem Pferd Ausdruck geben".
Moderator gibt den Verdutzten
Darauf schaute der Moderator − scheinbar verdutzt − mit hochgezogenen Augenbrauen, fragend und grinsend, sowie schulterzuckend erst mich und dann das Publikum an und provozierte damit Gelächter im Saal. Fast bekam ich Herzklopfen. Aber so leicht ließ ich mich dann doch nicht beirren und erläuterte noch, mit welchen weiteren Worten ich den reichen Besucher willkommen heißen würde: "Hallo, Mister Unternehmer, Sie reiten ein faszinierendes Pferd, fällt mir auf". Und weiter: "Wissen Sie, wir haben hier nicht nur besonders gute Hotels und die besten Baugebiete für große Industriegebäude in ganz Texas. Bei uns finden sie auch besonders gute Arbeiter und hervorragende Pferdezüchter, Tierärzte und Farmer! Wir lieben hier Pferde! Sie werden sich bei uns sehr wohl fühlen! Seien Sie herzlich willkommen!"
Witzig oder Bullshit?
Danach überkam mich ein komisches Gefühl, so als schämte ich mich. Ich konnte nicht einschätzen, ob ich nun gerade großen Bullshit oder eine lustige Nummer von mir gegeben hatte. Nachdem ich aus dem Publikum aber Klatschen und manches Kichern vernahm, war ich dann erleichtert, dass ich diese erste, sehr seltsame Prüfung an diesem Abend zumindest nicht "verkackt" hatte. Aber danach ging ich gerne und rasch wieder an meinen Platz zurück und war gespannt auf die Auftritte der Mitbewerber. Ein bisschen erinnerte mich das Geschehene an meine Schulzeit, wenn ich an die Tafel musste. Szenenwechsel....
Letzte Hausbesuche
Kritik bei Überraschungsbesuch
Die letzten Tage vor dem Wahltag nutzte ich nochmals für viele Hausbesuche. Meine schön gestalteten Flyer konnte ich zwar nicht in allen Haushalten persönlich vorbeibringen, aber dort, wo ich nicht mit den Bewohnern sprechen konnte, legte ich die Flyer in die Briefkästen. Bei meinen letzten Rundgängen durch die Straßen und Wege im Schwarzwalddorf traf ich eine ehemalige Gemeinderätin einer örtlichen Wählergruppe, mit welcher ich schon mehrfach Kontakt hatte. Sie lud mich spontan zu einem Parteifreund und dessen Frau ein, welchen sie gerade besuchen wollte. Dieser war nach meiner Wahrnehmung mir jedoch überhaupt nicht zugetan. Er äußerte sich gleich zu Beginn unseres Aufeinandertreffens kritisch über Inhalte in meinem Wahlkampf.
Selbstzweifel – finale Erschöpfung
Nun war ich seit Sommer 2001 bis Anfang März 2002 ununterbrochen im Wahlkampfeinsatz in zwei Gemeinden unterwegs, ausgenommen in den Zeiten, wenn ich in der Jugendhilfeeinrichtung arbeiten musste, (weil sonst der mir zustehende Urlaub nicht ausgereicht hätte). Das waren sehr aufregende und äußerst anstrengende Monate. Nie in meinem Leben durfte und musste ich in einem relativ kurzen Zeitrahmen so viele Erfahrungen machen, insbesondere beim Kennenlernen von so zahlreichen Menschen aus allen Generationen, Berufen, Mentalitäten, mit freundlichem oder wenig angenehmem Wesen. Und nie zuvor war ich einer solchen Herausforderung ausgesetzt, mir so unglaublich viel Wissen im Schnelltempo aneignen zu müssen im Rahmen der Planung und Durchführung von höchst umfangreichen Wahlkampfaktivitäten. Aber nach dem unerwartet kritischen Feedback bei meinem letzten Hausbesuch verspürte ich ein sehr unangenehmes "Hosenflattern" bei der Einschätzung meiner Erfolgsaussichten.
Kein Anruf bei Coach-Professor
Allerdings kam ich nicht nochmals auf die Idee, meinen Wahlkampf-Coach über meine Gefühlsregung zu informieren, (wie ich das bei Bekanntwerden meines Mitbewerbers aus dem benachbarten Oberzentrum getan hatte). Er hätte mir bestimmt sogleich wieder in sehr rauem Ton Beine gemacht und mir erklärt, ich solle mich nicht so anstellen. Ich konnte mich auch ohne erneuten verbalen Hintern-Tritt meines Coachs schließlich wieder fangen und weiterkämpfen.
Zwischenfazit: Chancen und Risiken
Fragte ich in den ersten Jahrzehnten meines Lebens eher danach, wie ich in diesem Leben überhaupt bestehen könne, fand ich mich nun auf einer extrem anderen Seite eines Selbstfindungsprozesses wieder. Nun ging es um ein politisches Spitzenamt in einer Gemeinde, welches ich - bei hoher Risikobereitschaft - nur durch ein ganz besonderes Engagement erreichen konnte und um das mehrere Bewerber kämpften, gegen die ich mich durchsetzen musste. Mir blieb sozusagen nichts anderes übrig, als über mich hinaus zu wachsen. Irgendwie hatte ich dabei auch ab und zu das Gefühl, dies sei nur ein Film, der da ablief. Aber das war die von mir empfundene Lebensrealität Ende Februar 2002, kurz vor dem Wahltag.
Gut - oder umsonst investiert?
Nicht nur nebensächlich war dabei auch die Tatsache, dass ich noch nie zuvor in meinem Leben derart viel Geld in kurzer Zeit für ein bestimmtes berufliches Ziel investiert hatte, ohne zu wissen, ob sich diese voluminösen Investitionen überhaupt bezahlt machen, oder ob ich das viele ausgegebene Geld im Falle eines wieder nicht erfolgreichen Abschneidens bei der Bürgermeisterwahl in den Wind schießen würde. Und nicht nur das: Bei einem Scheitern hätte ich zusätzlich auch einen (nicht kleinen) Kredit für die Finanzierung des zweiten Wahlkampfes ohne Zielerreichung wieder zurückzahlen müssen.
Erfahrungssammlung im Zeitraffer
Das Ganze war rückblickend für mich ein großes, manchmal auch verrücktes Abenteuer, an das ich aber immer wieder gerne und mit großer Genugtuung zurückdenke. Es war auch - wie schon erwähnt – ein geballtes Sammeln von Lebenserfahrung pur, im Zeitraffer-Modus. Nebenher musste ich, wie schon erwähnt, auch noch meinem Job als Leiter der Jugendhilfeeinrichtung nachgehen. Das waren hoch stressige Zeiten mit unglaublich viel Druck! Aber ich war heiß auf Erfolg und das hielt meine Motivation hoch.
Wahlkampf-Finale
Aber alles hat seinen Preis, und es war kein Wunder, dass sich nun, kurz vor dem Wahlsonntag für den ersten Wahlgang, die ersten Erschöpfungserscheinungen zeigten. Zum Beispiel, wenn ich zum Abschluss meines Wahlkampfmarathons mit solchen besonders "liebenswürdigen" Leuten konfrontiert wurde, wie bei meinem eben beschriebenen - letzten Hausbesuch - vor dem Wahltag, zusammen mit der ehemaligen Gemeinderätin. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich am Freitag vor dem Wahlsonntag schließlich beschloss, nun alle meine Wahlkampfaktivitäten einzustellen.
Alles umsonst?
Irgendwie fiel ich in ein "Loch" und stellte mir immer wieder vor, was sein würde, wenn nun alle Mühen und alle Investitionen auch für diesen zweiten Wahlkampf vergebens sein würden. Das machte mich zeitweise sehr unglücklich. Aber, so dachte ich mir, es würde kurz vor dem Wahlsonntag nun keinen Sinn mehr machen, nochmals in Aktionismus zu verfallen. Ich akzeptierte, dass nun die Kugel rollte und keine Aktionen für mich als Spieler mehr möglich oder sinnvoll waren.
Rien ne va plus
Rien ne va plus lautet in solchen Situationen die Ansage im Spielkasino am Spieltisch. Das galt im übertragenen Sinne nun auch für mich und ich konnte nur noch das Urteil aus der Wählerschaft abwarten. Natürlich war ich äußerst gespannt darauf, wie ich abschneiden würde. Die letzten Tage vor dem Wahlsonntag waren für mich daher schwer erträglich und ich musste sehr meinen Geduldsfaden pflegen. Aber meine Frau und meine Kinder halfen mir dabei, sie konnten mich zuhause erfolgreich ablenken.
Endlich Wahlsonntag
Nun war er da, der Wahlsonntag am 3. März 2002. Meine Familie und ich gestalteten diesen auf Entspannung ausgerichtet in unserem damaligen Wohnort in Donaueschingen und nicht in der Schwarzwaldgemeinde. Dort fuhren wir zusammen erst abends hin und kamen etwa eine halbe Stunde vor Schließung der Wahllokale in der Aula der Grund- und Hauptschule an. Sehr viele Menschen hatten sich dort schon eingefunden, und neben den Musikern des örtlichen Musikvereins meinte ich - zu meinem Erstaunen - auch solche von dem Musikverein meines Mitbewerbers gesehen zu haben, in welchem er im benachbarten Oberzentrum Vorsitzender war. Vermutlich wollten diese auswärtigen Musiker im Fall der Fälle, (falls die Entscheidung schon im ersten Wahlgang auf ihren Vereinshäuptling fiel), dem neuen Bürgermeister ein Sonderständchen spielen.
Stilvoller Besucherempfang...
Der zuletzt genannte Mitbewerber hatte auch − vermutlich schon länger − mit seiner Frau Aufstellung direkt am Eingangsbereich der Schulaula genommen, in welche auch ich nun mit meiner Familie eintrat. Er war schick gekleidet, mit langem Mantel und Hut. Einige Leute sammelten sich um ihn herum, um deutlich zu machen, wen sie als ihren neuen Bürgermeister sehen wollten.
... durch siegessicheren Mitbewerber
Der von den Dorf-Promis favorisierte Kandidat selbst begrüßte persönlich und einzeln die eintretenden Besucher, (auch mich und meine Familie) beim Eintreten in das Schulgebäude. Aus ihm sprach unmissverständlich Siegessicherheit. In der Betrachtung dieses Geschehens vor der Verkündung des Wahlergebnisses hätte man den Eindruck gewinnen können, es gebe keinen Zweifel, welcher Kandidat heute, spätestens jedoch nach dem zweiten Wahlgang, seinen Triumph feiern würde.
Regionale Kommunalpolitiker
Neben meinen Mitbewerbern waren auch einige Bürgermeister aus dem Umland gekommen, allerdings nicht so zahlreich wie sonst bei Wahlabenden in den Kommunen. Vermutlich rechneten auch sie nicht mit einer Wahlentscheidung im ersten Wahlgang. Außerdem fand parallel an diesem Wahlsonntag noch eine weitere Bürgermeisterwahl in der Region statt.
Auch "Coaching-Professor" schwänzt
Mein Coach-Professor war auch nicht zu sehen, warum auch immer. Wahrscheinlich hatte er mich sowieso schon abgeschrieben, wer weiß? Andererseits war ich auch nicht besonders scharf auf eine Begegnung mit ihm.
Erfahrener Finalist
Ansonsten kannte ich das Szenario eines Wahlabends schon aus dem Hegau-Wahlkampf und nahm deshalb das Geschehen relativ gelassen hin, wenngleich natürlich auch ich und meine Familie ungeduldig auf das Wahlergebnis warteten. So suchten wir uns einen geeigneten Platz unter den vielen wartenden Leuten.
Warteplatz abseits
Im Eingangsbereich brauchten wir uns ja nicht aufzustellen, weil dort schon viele Menschen standen und die Türsteher-Rolle bereits vergeben war. So bevorzugten meine Familie und ich einen Platz etwas abseits vom Eingang des Schulgebäudes, aber näher an den Wahllokalen. Statt mit langem Mantel und Hut ließ ich mich aber nur mit Jeans und einem grünen Freizeit-Sakko sehen, denn ich war darauf eingestellt, heute nur ein Zwischenergebnis entgegennehmen zu können.
Eigene Fans kommen dazu
Dennoch: Auch zu uns gesellten sich nach und nach Leute, die mich und meine Familie herzlich begrüßten und versicherten, sie drückten mir fest die Daumen. Das fand ich sehr berührend. So etwas hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Aber diese Wohlfühleindrücke sollten nur Vorboten auf das sein, was sich nun bald ereignen würde.
Spekulationen zum Wahlausgang
Einer meiner Fans hatte Freude daran, sich immer wieder durch die Menschenansammlungen in die Wahllokale durchzuarbeiten, um die aktuellen "Wasserstände" oder die jeweilige Tendenz der Stimmenauszählungen in den beiden Wahllokalen (Schulräumen) zu erkunden. Kehrte er anfangs noch mit einem eher zurückhaltenden, aber dennoch zuversichtlichen Gesichtsausdruck zur "Berichterstattung" zurück, hellte sich dieser nach jedem neuen Erkundungsgang immer mehr auf, bis er schließlich über das ganze Gesicht strahlte.
"Das läuft auf Sie hinaus"
"Das läuft eindeutig auf Sie hinaus, Herr Löffler", wisperte er mir immer wieder ins Ohr. Doch ich konnte das Gehörte nur schwer gedanklich aufnehmen. Deshalb versuchte ich, meine Emotionen zurückzuhalten, um später, wenn sich das Wahlergebnis doch noch anders entwickeln sollte, gefasst bleiben zu können. Aus dem Hegau-Wahlkampf wusste ich ja, wie schmerzhaft sich es anfühlt, wenn man unterliegt oder das Ergebnis enttäuschend ausfällt.
Triumphaler Wahlsieg
Erst Wispern dann Jubel
Doch knapp eine Stunde nach Schließung der Wahllokale senkte sich auf einmal der Geräuschpegel und es war nur noch − wie vor einem gleich beginnenden Gottesdienst in einer Kirche − ein eigenartiges Wispern zu hören sowie teilweise ungläubig dreinschauende Blicke zu sehen (teils mit freundlichem, teils mit besorgtem Gesichtsausdruck), und es deutete sich an, das finale Warten würde bald ein Ende haben. Gemurmel hörte man dann auch weniger.
Presseleute kommen näher
Plötzlich merkte ich, wie Presseleute mit ihren Fotoapparaten aus den Auszählräumen herausliefen, sich schnurstracks in meine Nähe begaben und mich vielsagend anlächelten. Wieder hatte ich so ein Gefühl, als säße ich gerade im Kino, wo gerade ein spannender Film läuft.
Es wird amtlich!
Dann trat der amtierende Bürgermeister ebenfalls aus den Wahlräumen heraus und stellte sich auf die große Treppe, welche von der Aula hinauf in die weiteren Etagen führte. Nachdem er einige Stufen nach oben gegangen war, konnte ihn die Besuchermenge gut sehen und er startete die Verkündigung des Wahlergebnisses mit den Worten: "Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Auszählung für die Wahl meines Nachfolgers ist abgeschlossen und ich bedanke mich bei allen Wahlhelfern für den Dienst, den sie heute für die Gemeinde geleistet haben."
Wahlsieg! Kann das wahr sein?
Dann folgte die so lange erwartete Botschaft: "Ich darf Ihnen mitteilen, dass wir bereits heute einen eindeutigen WAHLSIEGER haben". Da mein Name als erster auf den Stimmzetteln stand, folgte sogleich auch das mich betreffende Wahlergebnis:
Spannung pur – …endlich: Sensation!
"Auf den Kandidaten Gerold Löffler entfielen 68,7 Prozent der gültigen abgegeben Stimmen". Das war nicht nur in meiner Wahrnehmung eine Sensation! Wegen - spontan aufbrausendem - Jubel vieler Besucher musste der Wahlleiter eine kurze Pause einlegen, bevor er dann die jeweiligen Wahlergebnisse für meine Mitbewerber noch verkünden konnte. Danach stellte der Bürgermeister schließlich als Leiter des Gemeindewahlausschusses auch formal fest, mit diesem Ergebnis seien über fünfzig Prozent der abgegebenen Stimmen für einen Kandidaten (für mich) abgegeben worden, und somit sei nach der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg eine Wahlentscheidung bereits im ersten Wahlgang erfolgt.
Gang zur Siegerehrung
Schließlich wurde ich mit meiner Familie vom Herrn Bürgermeister nach vorne auf die Treppe gebeten. Er gratulierte mir zu dem sehr guten Wahlergebnis und für den "großen Vertrauensvorschuss der Bürgerschaft" in der Schwarzwaldgemeinde, was er als "gute Ausgangsbasis für mein künftiges Amt" bezeichnete. Gott sei Dank sah man nicht die Gänsehaut, die sich bei mir breitmachte.
Bleibende Erinnerungen
Einen solchen triumphalen Augenblick, wie diesen grandiosen, total überraschend so frühzeitig eingetretenen Wahlsieg, vor den Augen einer - Beifall klatschenden, jubelnden - Öffentlichkeit, erleben in ihrem Berufsleben sicher nur ganz wenige Menschen. Für jemanden wie mich, der einen großen Teil seines Lebens nicht von Erfolgen verwöhnt wurde (ganz im Gegenteil), fühlte sich ein solcher einmaliger Triumph an, wie ein sich plötzlich entladendes, superschönes Feuerwerk, ein Tsunami der Gefühle. Wenn ich heute daran zurückdenke oder Fotos von diesem Wahlabend sehe, dann kann ich dieses Glücksgefühl auch nach bald zwei vergangenen Jahrzehnten immer noch nachempfinden.
Allen gezeigt!
Ich erinnere mich an viele Gefühle. Zum einen natürlich die Freude über das Erreichte. Zum anderen aber auch eine tiefe Genugtuung, es endlich mir und "allen" gezeigt zu haben, besonders den „Musikern“, die mir so leidenschaftlich in der Vergangenheit den Pessimisten-Blues gesungen haben. Letzteres lässt sich jedoch so richtig nur nachvollziehen, wenn man die Vorgeschichte aus meiner Autobiografie gelesen hat.
Wahlausgang: Freud und Leid
Nach der Ergebnisverkündigung wurde meiner Frau ein Blumenstrauß überreicht. Darauf gratulierte der - ortsansässige - Mitbewerber und Gemeinderat, der mir seine Unterstützung zusicherte.
Wo ist favorisierter Mitbewerber?
Der favorisierte Mitbewerber vom benachbarten Oberzentrum war vermutlich zu sehr geschockt, um mir gratulieren zu können. Er verließ, wie mir erzählt wurde, ziemlich bald das Schulgebäude mit seiner Begleitung und vielen seiner Anhänger. Ihn habe ich seither nie mehr gesehen. Da ich das schmerzliche Gefühl von dem Wahlabend wenige Monate zuvor in der Hegau-Gemeinde in Erinnerung hatte, wenn man viel schlechter abschneidet, als man sich das je vorstellen konnte, wusste ich auch, wie bedrückend sich eine solche Enttäuschung anfühlt. Es waren für meinen Mitbewerber nach diesem Wahlausgang sicher sehr schwere Stunden.
Verschätzt? - Überschätzt?
Umso mehr, weil er sich − im Unterschied zu meiner Selbstwahrnehmung im Hegau- Wahlkampf − ab dem Zeitpunkt seiner Bewerbung -, wo möglich als klarer Favorit gesehen hatte und als solcher in bestimmten einflussreichen Kreisen im Dorf gehandelt und begleitet wurde. Er glaubte wahrscheinlich, die breite Unterstützung von Seiten prominenter Multiplikatoren in der Gemeinde, die ihm signalisiert wurde, würde für einen Wahlsieg ausreichen. Für mich hatten sich meine unendlich vielen Hausbesuche und die Suche nach möglichst vielen persönlichen Kontakten zu dem Wahlvolk in der Gemeinde, offensichtlich bezahlt gemacht.
Coaching-Professor behielt recht
Mein strenger Coach-Professor sollte tatsächlich recht behalten. Zur Erinnerung: Nachdem ich mit ihm über einen möglichen Rückzug aus dem Wahlkampf sprechen wollte, als mein favorisierter Mitbewerber vom benachbarten Oberzentrum kurz vor Bewerbungsschluss seine Bewerbung abgab, wurde ich von ihm am Telefon harsch in den Senkel gestellt. Nach seiner Aufforderung an mich, "reißen Sie sich gefälligst zusammen"! folgte seine stramme Anweisung: „Nun besuchen Sie Ihre Wählerschaft, gehen Sie von Haustür zu Haustür und erzählen Sie den Leuten, warum Sie gerne ihr Bürgermeister werden wollen, dann können Sie sehr wohl noch erfolgreich abschneiden! Allerdings nur, wenn Sie Zuversicht und Selbstbewusstsein ausstrahlen.“ Das hatte wohl funktioniert!
Wahlsieg feiern
Nach einem vom Musikverein der Gemeinde zu meinen Ehren aufgespielten Musikständchen ergriff ich das Wort, um die in einer solchen Situation üblichen Dankesworte auszusprechen. Das war gar nicht so einfach, denn eine solche Situation war ja absolut neu für mich. So im Scheinwerferlicht zu stehen und hundertfache Zuwendungen und Glückwünsche entgegenzunehmen, das durfte ich in den vierundvierzig Jahren davor noch nie erleben. Bildhafte große Presseberichte davon habe ich archiviert (schaue ich auch heute noch gerne ab und zu an).
Erleichterung statt Druck
Ich war völlig überwältigt, aber auch erleichtert. Nun fühlte ich mich befreit von dem monatelang aufgestauten Druck und ich konnte mir erlauben, mich erst einmal so richtig zu freuen! Auch meine Frau und meine damals sechs und neun Jahre alten Kinder freuten sich mit mir.
Danksagungsmarathon
In meinem Danksagungsmarathon zählte ich viele Adressaten auf, denen ich sehr dankte für ihre Unterstützung. Nach den Wahlhelfern zunächst meine Frau und meine Familie, und daraufhin alle, welche mir in meinen Wahlkämpfen zur Seite standen. Auch würdigte ich besonders meinen Kollegen aus der Nachbargemeinde, dass er mich - nach dem nicht erfolgreichen Ende des Hegau-Wahlkampfes - ermunterte, in dieser schönen Schwarzwaldgemeinde nochmals meinen Hut als Bürgermeisterkandidat in den Ring zu werfen. Ebenso hob ich auch meine Mitbewerber und die Pressevertreter hervor, hinsichtlich des fairen Wahlkampfes, beziehungsweise für die faire Berichterstattung. Mein abschließender Dank galt noch dem Musikverein für sein Ständchen.
Bürgernähe versichern
Schließlich versprach ich noch, dass ich ein bürgernaher Bürgermeister sein will, der sich in den nächsten acht Jahren nach Kräften für das Wohl der Bürgerschaft und für die Gemeinde einsetzt. Dabei sprach ich auch an, denjenigen die Hand zu reichen, welche sich in der Wahl für einen der beiden Mitbewerber entschlossen hatten. Außerdem bot ich den Mitgliedern des Gemeinderates und den Vertretern aus Vereinen, Kirchen, anderen Einrichtungen und Organisationen sowie meinen Nachbarkollegen meine konstruktive Zusammenarbeit an.
Gerade noch rechtzeitig: Fauxpas verhindert
Fast hätte ich es vergessen, aber ein durstiger Bürgermeisterkollege rettete mich gerade noch rechtzeitig mit einer kurzen, unübersehbaren Geste vor einem Fauxpas: Ich war ja nun in der Pflicht, meine zahlreichen Party-Gäste zu einem Umtrunk einzuladen. Und so schloss ich meine kleine Ansprache an die vielen – zum Feiern aufgelegte - Besucher mit dem erwarteten Hinweis ab, sie zu einem Umtrunk in das große Dorfgasthaus einzuladen.
Freibier für alle! Dorfgasthof „wackelt“
Da niemand mit einer Wahlentscheidung an diesem Sonntagabend (erster Wahlgang) gerechnet hatte, auch ich nicht, hatte ich zuvor keine Absprachen mit einem Wirt getroffen. So musste ich hoffen, dass sich im großen Dorfgasthaus, in welches ich spontan einlud, nicht viele Gäste aufhielten, welche gerade in ruhiger lauschiger Atmosphäre ihr Abendessen einnehmen wollten, und der Gastwirt die unzähligen Gäste aufnehmen konnte, die nun bei ihm auftauchten. Doch es gab keine Probleme. Das Gasthaus füllte sich bis auf die letzten Plätze, der Gastwirt durfte sich über einen gewaltigen Umsatz und ich über eine hohe Rechnung freuen.
Ein Meer von Glückwünschen
Nachdem mein Wahlsieg in der Schwarzwaldgemeinde gebührend gefeiert worden war, kehrte ich noch für drei Monate an meinen alten Arbeitsplatz in der Jugendhilfeeinrichtung zurück. Dort erreichte mich zunächst eine Vielzahl von Glückwünschen, vom Landrat, seinem Stellvertreter, von der Sozialdezernentin und dem Amtsleiter des Jugendamtes, von vielen Kollegen, bis hin zu den Mitarbeitern der Jugendhilfeeinrichtung. Meinem Dienstherrn teilte ich schriftlich mit, dass ich wegen Übernahme meines neuen Amtes ab Juni 2002 aus dem Dienst des Landratsamtes nach siebenjähriger Zugehörigkeit ausscheiden werde. Dabei bedankte ich mich für die weitreichende berufliche Förderung, die mir in dieser Zeit geboten wurde.
Glückwünsche sogar vom schwäbischen Kollegen
An einen bemerkenswerten Glückwunsch des früheren „Lieblingskollegen“ erinnere ich mich auch noch sehr gut. Zur Erinnerung: Dieser hatte mich vor wenigen Monaten nach dem verlorenen Hegau-Wahlkampf in der Warteschlange der Kantine des Landratsamtes lautstark verhöhnt. Auch er beglückwünschte mich in seiner markanten schwäbischen Mundart, und − wie könnte es anders sein − wieder unüberhörbar für die nicht wenigen herumstehenden Leute. Dabei klopfte er mir kräftig mit seiner Hand auf meinen Rücken und gab laut lachend die Worte von sich: "Mensch Gerold, dees hau i mia gar it vorschtelle könne, dass Du dees nomole probira duasch und jetzt hosches au no gschaffat! I muaß Dir saga, dees hät i gar nia für möglich ghalta! Jetzet hoscht nomol älles gäbe, odr? No machs no guat, Herr Bürgameischta!“
Voller Briefkasten
Weiter füllte sich mein Briefkasten zu Hause mit vielen Glückwunschschreiben, und ich erhielt auch solche auf einigen langen Schlangen aus der Thermopapierrolle, auf welcher seinerzeit Faxe mit kleineren Privatgeräten empfangen wurden, unter anderem von meinen Eltern, Geschwistern, Schwiegereltern, und vielen anderen mehr. Ebenso leitete das Rathaus im Schwarzwaldort viel Glückwunschpost an mich weiter, insbesondere von Amtsträgern und Geschäftsführern, vom Regierungspräsidium, Fachämtern und anderen Behörden. Weiter von Geschäftspartnern der Gemeinde, welche beispielsweise als Dienstleister für diese arbeiteten oder schon einmal für ihre Dienste werben wollten. Außerdem gratulierten viele Amtsträger politischer Spitzen- und Parteiämter.
Glückwunsch vom Ministerpräsidenten
Ein besonders ansprechendes Glückwunsch- schreiben erhielt ich von dem damaligen Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Erwin Teufel, der sein Amt als Landtagsabgeordneter für den CDU-Wahlkreis − mit Sitz im benachbarten Oberzentrum − innehatte. Sein Schreiben unterschied sich (nicht nur, weil er ein hoher Amtsträger war) deutlich von den üblichen stereotypen Textbausteinen, die bei solchen Glückwünschen häufig eingesetzt werden, weil er mir auf dem getippten Brief mit Handschrift ein paar persönliche Worte dazugeschrieben hatte, die mich beeindruckten. Auch später sollten sich gute Begegnungen mit ihm ergeben.
Senior-Unternehmer: unerwartet nachdenklich
Neben den vielen Glückwünschen gab es auch nachdenkliche Reaktionen auf meinen Wahlsieg. Von einem in der Schwarzwaldgemeinde bekannten und streiterprobten Unternehmeroriginal im Ruhestand, der sehr lange die Kommunalpolitik vor Ort als Mitglied im Gemeinderat mitgeprägt hatte, erreichten mich bemerkenswerte Worte, welcher er mir mit seinen Glückwünschen an mich mit auf den Weg gab. Bei einer zufälligen Begegnung auf dem Dorfplatz wünschte mir der "Haudegen" im fortgeschrittenen Lebensalter "alles Gute, sowie eine glückliche Hand!“ Dann fügte er noch hinzu: „Sie werden auch eine harte Hand brauchen, für Ihr neues Amt“! Nach seinen Glückwünschen richtete er schließlich einige nachdenkliche Worte an mich: "Ich hoffe für Sie, dass Sie sich Ihre Kandidatur sehr gut überlegt haben“.
"Beneide Sie nicht"
Dann ließ der erfahrene Mann mich wissen, er beneide mich überhaupt nicht hinsichtlich meines neuen Amtes, weil − so prophezeite er mir –, nun bald die "die Mühlen des kommunalpolitischen Geschäftes" in dieser Gemeinde, die er bestens kenne, auf mich zukämen. Dabei verlieh er dem Wort "Mühlen" eine besondere Klangfarbe, an welche ich mich noch sehr gut erinnern kann. Ich verstand ihn so, dass er diese "Mühlen" - rückblickend betrachtet - als ein mühsames, kräftezehrendes Geschäft empfunden hat.
Vorwarnung?
Vielsagend ergänzte der Senior noch seine persönlichen Erfahrungen mit der Feststellung, dass das Wirken eines Bürgermeisters in der Gemeinde "öfter nicht von der Sonne beschienen" sei. Fast schon fürsorglich gab er mir abschließend den Rat mit auf den Weg, im eigenen und im Interesse meiner Familie solle ich nicht vergessen, "auf mich und meine Gesundheit aufzupassen". Gerade von ihm solche nachdenklichen Gedanken zu hören, empfand ich als total überraschend. Viele Geschichten hatte ich schon gehört über den bemerkenswerten Gratulanten, der nach dem Zweiten Weltkrieg mit ganz bescheidenen Mitteln im Dorf ein Unternehmen gründete, das bis zum Eintritt seines Ruhestandes zu einer beachtlichen Größe heranwuchs. Auch wenn dieser betagte Unternehmensgründer sich bei solchen persönlichen Begegnungen sehr freundlich, fast schon bescheiden oder charmant, geben konnte, so lief er beispielsweise bei Wahlkampfveranstaltungen unüberhörbar zu Hochform auf, wenn es um bestimmte Themen in der Gemeindepolitik ging, drosch er regelrecht ein.
Wahlkampf-Nachlese
Berufung oder riskantes Spiel?
Was war verantwortlich für meinen Wahlsieg und für das Durchhaltevermögen? Berufung für den Bürgermeisterberuf, oder nur die Bereitschaft, ein riskantes Spiel mit sehr hohem Einsatz einzugehen, welches ich letztlich gewinnen konnte? Die seltsamen Wege, in meiner Autobiografie schon mehrfach beschrieben, die zu meinen spontanen Bewerbungen für ein Bürgermeisteramt führten, ohne dass ich zuvor kommunalpolitische Erfahrungen gemacht hatte, sprechen für eine Berufung. Aber die Wahlkämpfe waren bewusst eingegangene Abenteuer, und Abenteurer sind bekanntlich auch Spieler. Zu dieser komplexen Thematik gab es jedenfalls am Wahlabend noch keine einfachen Antworten. Brauchte es aber auch nicht! Für mich war die gewonnene Bürgermeisterwahl ein triumphales Ereignis in meiner beruflichen Laufbahn, und überhaupt in meinem Leben, und ich denke heute noch - wie schon mehrfach erwähnt – gerne daran zurück.
Was kommt?
Mit der gewonnenen Wahl eine Person des öffentlichen Lebens zu sein, das erlebte ich als einen neuen Lebensabschnitt, an den ich mich und meine Familie allerdings erst noch gewöhnen mussten. Als Wahlkämpfer hatte ich die Rolle, für meine Person und für Positionierungen zur Gestaltung der künftigen Kommunalpolitik zu werben. Als neuer Bürgermeister kam aber sofort ein großer bunter Blumenstrauß an Erwartungen auf mich zu, denen ich alle gerecht werden sollte. Sehr bald wurde ich daher mit der Bedeutung eines bekannten Zitates von Robert Bosch (1861-1942) konfrontiert: "Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann".
1. Juni 2002 – Amtsantritt
Direkt nach dem Wahlsonntag im März 2002 und lange Zeit danach blieb ich jedoch beflügelt von den Ereignissen rund um den Abschluss meiner Wahlkämpfe und von meinem schließlich errungenen Wahlsieg und freute mich über die vielzähligen Glückwünsche.
Erst mal in Urlaub fahren
So konnte ich frohen Mutes erst einmal mit meiner Familie nach den äußerst stressigen Wahlkämpfen in den Urlaub in die Toskana fahren. Das waren wohltuende Tage, und ich genoss diesen Urlaub so richtig. Ich merkte, dass es höchste Zeit war, wieder einmal herunterzukommen in das normale Leben. Mit meiner Frau und meinen Kindern und in der traumhaften Toskana-Landschaft war dies auch sehr gut möglich.
Erste große Veranstaltungen
Aufstiegsfeier des Fußballvereins
Nach meiner Rückkehr aus der schönen Toskana-Region übernahm ich gerne den ersten, offiziellen Termin und besuchte die Aufstiegsfeier des Fußballclubs der Schwarzwaldgemeinde. Ich erinnere mich an ein schönes Fest und an viel Jubel über den großen sportlichen Erfolg des Vereins.
Weitere Eröffnungsfeiern
Am Wochenende darauf stand der nächste Termin an, ein großes Fest im Dorf. Ich durfte die Wiedereröffnung des Hallenbades übernehmen, das mit einem hohen finanziellen Aufwand zuvor saniert worden war. An einem bald darauffolgenden Wochenende wurde ein attraktiv überbauter Teil des Dorfplatzes − ebenfalls mit einem großen Fest − eröffnet. Dieser ermöglichte es, ganzjährig bei jedem Wetter dort Veranstaltungen durchzuführen, von denen es in dieser Schwarzwaldgemeinde viele gab, auch im Rahmen des Unterhaltungsprogramms für den Tourismus, das von einigen ortsansässigen Vereinen (Musikverein, Narrenzunft und andere) übernommen wurde. Überhaupt war die Neugestaltung des Dorfplatzes über ein Landessanierungsprogramm hervorragend gelungen. Sogar eine uralte Schwarzwaldmühle, welche an ihrem ursprünglichen Standort abgebaut worden war, hatte dort in dem schwarzwaldtypisch gestalteten Gebäudeensemble an einem Flüsschen einen neuen Platz gefunden.
Großprojekte „einweihen“
Eigentlich hätten diese Eröffnungsfeiern noch in der Amtszeit meines Amtsvorgängers stattfinden sollen. Aber da er ein ganzes Feuerwerk von Bau- und anderen Maßnahmen zur Vollendung seines ehrgeizig vorangetriebenen Dorfentwicklungsprogramms "abgebrannt" hatte, klappte leider die rechtzeitige Fertigstellung dieser vom Land Baden-Württemberg reichlich aus einem Landessanierungsprogramm für das Dorf bezuschussten Bauwerke und Maßnahmen nicht mehr. Deren Eröffnungspartys fielen somit in meine Amtszeit, der frühere Bürgermeister wurde jedoch stets eingeladen und erhielt von verschiedenen Seiten wegen seiner großen Leistungen für die Gemeinde viel Lob und Ehre.
Erste Eindrücke „Große Fußstapfen“
Überhaupt wurde ich ständig wegen der großen Leistungsbilanz angesprochen, die mein Vorgänger im Amte in dreieinhalb Jahrzehnten vorweisen konnte. Daran konnte es auch keinen Zweifel geben. Öfter wurde ich jedoch sogar bedauert, ich würde es nun äußerst schwer haben, in seine großen Fußstapfen treten zu müssen. Auch kam immer wieder die seltsame Frage auf, was ich denn überhaupt − außer dem Verwalten des Erbes meines Vorgängers − im Schwarzwalddorf noch für neue Investitionen tätigen und Akzente setzen könnte...
Kleiner Ausblick:
Solche - weniger Mut machenden - Äußerungen zu Beginn meines neuen Jobs als Bürgermeister nervten mich allerdings mit der Zeit. Heute als Pensionär, mit einigen Jahren Abstand, kann ich in dieser Hinsicht jedoch gelassen zurückschauen. Denn gemessen daran, dass die Amtszeit meines Vorgängers drei Mal so lange dauerte (1968- 2002) wie meine (2002-2013), braucht sich meine Erfolgsbilanz − in nur elf Jahren − überhaupt nicht zu verstecken. Wie ich dies schon in einem vorherigen Kapitel erzählt habe, erhielt ich sogar ein „amtliches“ positives Feedback: Bei meiner Verabschiedung in den Ruhestand (nach schwerer Erkrankung) im Jahre 2013 lobte der Landrat die Gemeindeentwicklung in meiner Amtszeit und nannte einige Beispiele. „Zeitzeugen“ hierfür sind - unter anderem - viele Presseberichte (die meine liebe Frau für mich in den Jahren 2002 - 2013 mit sorgfältiger Gründlichkeit gesammelt hat), welche umfangreich informierten. Diese üppig gefüllte Fundgrube über das lebhafte Zeitgeschehen rund um meine elfjährige Amtszeit als Bürgermeister, mit allen Höhen und Tiefen, beinhalten umfangreichen Stoff für viele spannende und kuriose Geschichten, um die ich mich im geplanten zweiten Teil meiner Autobiografie gerne "kümmern" werde.
Zurück zum Amtsantritt: offizielle Amtseinführung
Nachdem ich die ersten Wochen in meinem Amt damit verbrachte, anzukommen, meine künftige − direkte und indirekte − Arbeitsumgebung kennen zu lernen und mich etwas einzurichten, da näherte sich das nächste große Ereignis, meine Amtseinführung, in welcher der Gemeinderat meine offizielle Verpflichtung in öffentlicher Sitzung, mit der in der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vorgesehenen Vereidigung vornahm.
Prominenter Gast
Groß wurde das Ereignis aus einem besonderen Grund: Aus terminlichen Gründen, wegen der Ehrengäste, hatte der Gemeinderat schon vor meinem Amtsantritt beschlossen, meine offizielle Amtseinführung sollte zusammen mit der Verabschiedung des Amtsvorgängers durchgeführt werden, der sein Amt - wie schon erwähnt - dreieinhalb Jahrzehnte ausgeübt hatte. Damit wurde auch noch die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an ihn und seine Erhebung in den Ehrenbürgerstand verbunden.
Großaufrüstung – Bilder-Show
Dazu baute der Ehrenbürger des Dorfes und langjähriger Wegebegleiter meines Vorgängers im Amte als Hobby-Fotograf und Ortschronist ein umfangreiches technisches Equipment für einen größeren Lichtbildervortrag in der Festhalle auf. Die Anzahl der Dia-Kästen, die er zur Vorbereitung an seinem Projektor-Tisch aufstapelte, ließ vermuten, dass er einen sehr weitreichenden Rückblick auf die Verdienste seines Freundes zu präsentieren beabsichtigte. Und das aus mehreren Gründen: Zum einen, − wie schon erwähnt −, zur Würdigung des zu verabschiedenden, verdienstvollen ehemaligen Amtsträgers. Zum anderen wurde höchst prominenter Besuch erwartet.
Ministerpräsident kommt
Denn kein geringerer als der damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg Erwin Teufel wurde erwartet. Er würde auch die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes und weitere Ehrungen für den zu verabschiedenden Amtsvorgänger vornehmen. Mit diesem Hintergrund war erkennbar, welches Ereignis diese Veranstaltung nahezu komplett vereinnahmen würde. Und so kam es auch.
Amtseinführung und Verabschiedung
Marathonveranstaltung
Meine Amtseinführung erfolgte nach der mehrstündigen Verabschiedungsfeier des Altbürgermeisters zum Schluss, am sehr späten Abend, dafür im Beisein des höchsten Repräsentanten des Landes Baden-Württemberg, was wiederum bei den wenigsten Amtseinführungen von Bürgermeistern kleinerer Gemeinden der Fall sein dürfte.
Attraktion für meine Gäste
Die Länge der Veranstaltung stellte zwar eine Herausforderung für die von mir eingeladenen und aus dem Freiburger Raum bzw. aus Donaueschingen angereisten Gäste, dar. Dafür hatte der gewählte festliche Rahmen den Vorteil, dass meine Gäste den damals sehr prominenten Ehrengast, Ministerpräsident Erwin Teufel, miterleben konnten. Er wäre nicht zu einer gesonderten Feier meiner Amtseinführung nochmals in die Gemeinde gekommen. Neben Geschwistern, Verwandten, Freunden und ehemaligen Kollegen, (sogar auch aus meiner Zeit bei der Stadtverwaltung Freiburg), ließen es sich meine Mutter und mein Vater, der damals schon schwer erkrankt und an den Rollstuhl gefesselt war, nicht nehmen, zu dieser Veranstaltung aus Freiburg in das schöne Schwarzwalddorf zu fahren.
Vater entzückt
Meinem schwerbehinderten Vater gefielen die Feierlichkeiten - trotz Rollstuhl und langer Veranstaltungsdauer- sehr gut. Da die Festhalle nicht über einen Aufzug verfügte, wurde er, in seinem Rollstuhl sitzend, von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr in die Halle getragen. Dort wurde mein Vater, in der ersten Reihe sitzend, dann sogar von Ministerpräsident Teufel persönlich begrüßt, der kurz mit ihm sprach.
Sitzfleisch
Nach dem erwartet umfangreichen Lichtbildervortrag über die Arbeit und Verdienste meines Amtsvorgängers und der Laudatio dazu, nach der Rede des Ministerpräsidenten sowie weiteren Ansprachen, zum Beispiel vom stellvertretenden Bürgermeister, folgten unzählige Gruß- und Dankesworte von Vertretern der örtlichen Vereine über Institutionen und Organisationen, die mit der Gemeinde und meinem Vorgänger zusammengearbeitet hatten, bis hin zu Bürgermeisterkollegen aus der Region.
Höchste Ehrungen für Amtsvorgänger
Dann folgten weitere Ehrungen für den Altbürgermeister, ebenfalls mit den dazugehörigen Ansprachen. Zwischendurch spielte der Musikverein seine wohlklingenden Musikstücke.
Mein nächtlicher Auftritt
Dann durfte auch ich noch ans Rednerpult gehen, um einige Worte zu meinem Amtsantritt an die Bürgerschaft zu richten. Allerdings hielt ich mich dabei kurz, weil meine Zuhörer sichtlich nur noch sehr bedingt aufnahmefähig waren. Meiner kurzen Antrittsrede ging meine offizielle Verpflichtung und Amtseinführung durch den stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde voraus, der mir auch eine Amtskette umhängte.
Nächtliche Schlussereignisse
Abschließend − zu vorgerückter nächtlicher Stunde − durfte ich mich aber noch über zwei Ereignisse freuen: Das erste war, dass mir der Ministerpräsident Teufel eine große Fahne des Landes-Baden-Württemberg persönlich überreichte, was insbesondere für meinen Vater ein beeindruckender Augenblick war, (davon gab es auch Pressefotos, die ich ihm schenkte). Das zweite Ereignis, das mich freute, war, dass zu meinen Ehren der Gospelchor aus Donaueschingen sang, in dem ich und meine Frau lange aktiv waren. Vor allem, dass die Mitglieder des Chores trotz sehr langer Wartezeit noch bereit waren, zu ganz später Stunde aufzutreten. Die Gospel-Gesänge bildeten den erfrischend klingenden musikalischen Schlusspunkt an diesem sehr langen Abend.
Schlussanmerkungen
Lang waren meine Ausführungen zu diesem Kapitel mit dem Titel: „Beruf oder Berufung?“ Zum guten Schluss noch einige nachfolgende Anmerkungen dazu: Wie nun umfangreich zu lesen war, startete ich mein Berufsleben unter denkbar schlechten Bedingungen. Fast zog es mir bereits in sehr jungen Jahren den Boden unter den Füßen weg und ich hätte in beruflicher Hinsicht − vielleicht auf Lebenszeit − schon kurz nach dem Start Schiffbruch erleiden können. Aber ich schaffte es, immer wieder − trotz meiner Handicaps, nach jedem Scheitern oder nach Misserfolgen – aufzustehen. Zum einen, weil ich manchmal sehr viel Glück hatte. Zum anderen dank der Hilfe vieler Menschen, welche ich beschrieben habe. Schließlich − das gehört auch zur Wahrheit − fand ich, wenn auch spät, meine ganz persönlichen, vielfach schon beschriebenen Wege zum Erfolg, die ich - als ich dazu in der Lage war – konsequent und ehrgeizig nutzte.
Dankbarkeit
Allen, die mir in meinem Leben beigestanden sind, besonders auch in schwierigen Zeiten, besonders auch meiner Mutter, meiner Frau sowie meinen inzwischen erwachsenen Kindern, danke ich sehr für ihre Unterstützung. Sie schenkten mir Kraft und Motivation, um in meinem (Berufs-) Leben bestehen zu können. Ebenso danke ich auch dem lieben Gott, für seinen Schutz und seine Begleitung in meinem Leben. Vielleicht helfen diese Lebensgeschichten zu meinem Berufsleben anderen Menschen mit Handicaps, welche sich auch ab und zu in schwierigen Zeiten befinden und zurechtkommen müssen, obwohl sie manchmal nicht wissen, wie.
Niemals aufgeben!
Ihnen hoffe ich etwas Mut machen zu können, dass sie niemals aufgeben, oder sich von bösen Menschen unterkriegen lassen, welche vermutlich sehr viele Leute im Leben leider immer wieder einmal begleiten und ihnen schaden wollen. Denn - so meine Erfahrung - man begegnet irgendwann auch wieder hilfsbereiten Wegebegleitern, die einem weiterhelfen.
Immer wieder aufstehen
Mein weiterer Wunsch ist es, dass Menschen in Lebenskrisen und solche mit Handicaps immer wieder, auch wenn es ihnen schwerfällt, aufstehen, neu anfangen und daraufhin wieder an sich glauben können. Selbst auch dann, wenn ihre Selbstzweifel sie "auffressen" wollen oder ihr Lebensumfeld versucht, ihnen solche einzureden.
Bleibt stark!

(Bürgermeisterzeit und danach)
Mein nächstes Projekt....