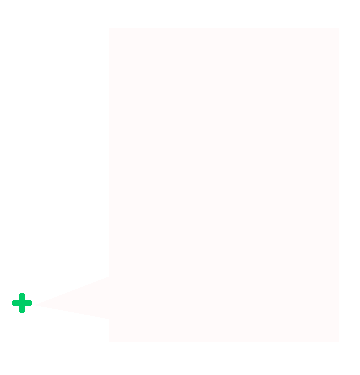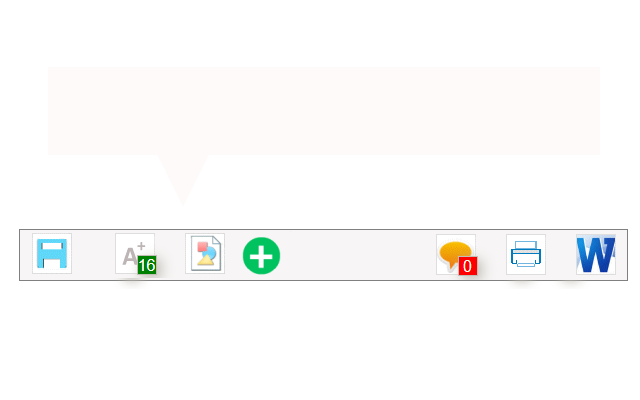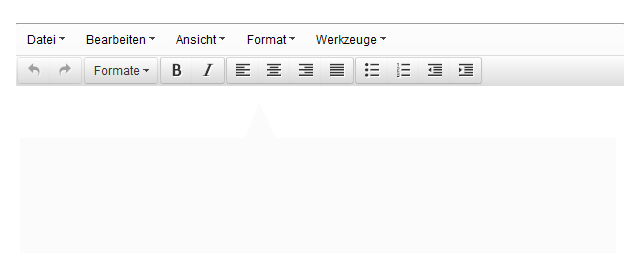Zurzeit sind 519 Biographien in Arbeit und davon 290 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 176
Leserstimmen und Vorwort

Kleine Rose - Lichter wie Du und ich
Unglaublich, ergreifend, voller Tiefen und Höhen ist Mathews Schilderung seines Lebenslaufs. Er stellt sein Leben und sein Umfeld mit großer Kraft und Dringlichkeit dar.
Dabei erkennen wir den Blick des Filmregisseurs, der das Geschehen so plastisch ablaufen lässt, es so visuell gestaltet, dass man meint, mittendrin und dabei zu sein. Als ehemalige Lehrerin von Mathew am Goethe-Institut bewundere ich, wie er seit seinem schon damals exzellent absolvierten Sprachkurs zu einer solchen Meisterschaft in der Beherrschung der deutschen Sprache gelangt ist.Absolut lesenswert !!!
Ute Vagnard
Mathew Kuzhippallil ist ein begnadeter Geschichtenerzähler, der in Bildern schreibt. Man spürt in seiner Sprache den cineastischen Horizont und Background. Mathew schreibt über die vermeintlich kleinen Dinge des Lebens, fokussiert und zoomt zuweilen gnadenlos auf sie. Seine Erzählkunst ist Breitleinwand und hinterlässt einen nachhaltigen Eindruck. Trotz der Härte des Erlebten und Geschilderten vergisst er die versöhnliche, überlebenswichtige Komponente des Menschseins nie. Grandios!
Felice Zenoni
Wie kann ein Mensch, hier die Kleine Rose, dieses Leben aushalten und erdulden? Die Erzählungen wühlen auf, fordert den Lesenden. Die "Nachtschicht" ging mir sehr nahe. Eindrücklich. Voller Spannung, Meisterhaft geschrieben.
Erika Pierson
Eine sehr fesselnde und emotionale Autobiografie.
Shali Springer
Thank you so much for giving me the chance to have a look into your childhood and for sharing all these feelings and thoughts with me. I nearly had to cry while reading your lines. I felt like sitting in your hut, too. It was rather interesting to read through your lines and I really like your style.
Silvia Hofstetter
Es ist zutiefst berührend, Deiner Lebensgeschichte so echt und sprachlich so schön zu begegnen, auch wenn der Inhalt bedrückend schwer und traurig ist.
Gerina Goeth
Die Wucht Ihrer äusserst guten Schilderung Ihres Lebens in Indien zerschlägt mir den Atem, macht mich tief betroffen und sehr nachdenklich. Macht mich auch zornig, wenn ich Ihre Erfahrungen als Internatsschüler lese. Zornig wegen der Heuchelei und dem verschwenderischen Leben von weissgekleideten, sogenannten "Jesus-nachfolgenden" Missionaren. Wirklich zornig macht mich das, sie "predigen Wasser und trinken Wein", was noch gar nicht das Schlimmste wäre. Sie haben noch Schlimmeres erlebt..... Noch habe ich Ihre Geschichte nicht zu Ende gelesen, aber jetzt hat es mich einfach überwältigt und ich musste Ihnen dies sagen.
Maria.v. Däniken
................................................................................................................................
Vorwort
Ich bin nicht mehr der, der ich einmal war. Meine Welt ist nicht mehr die, die es einmal war. Auch mein Gott ist nicht mehr der, der er einmal war.
An Anfang war ich ohne einen Namen, bloss ein Kind. Meine Lehmhütte war meine Welt. Hinter den Bergen kannte ich nichts, es gab nichts. Und Gott war mal Vater, mal Grossvater. Grossvater lehrte mich das Alphabet. Er brachte mir Süssigkeiten. Er hatte aber auch viele Stöcke: Spazierstöcke, Schlagstöcke, eine Hierarchie der Stöcke.
In der Schule und später als Student lernte ich Indien und die Welt kennen. Als Filmregisseur und Redaktor sah ich tausende von Filmen. Sie zeigten mir ferne, vergangene, imaginäre Welten. Als neugieriger Mensch entdeckte ich - entdecke ich - täglich Neues: Planeten, Exoplaneten, Sternenhaufen und Schwarze Löcher. Stets verändern sich mein Horizont und mein Selbst.
Der Autor der nachfolgenden Kapitel bin ich. Die ersten drei Kapitel verfasse ich aus der Perspektive eines Kindes. Die darauf folgenden Kapitel sind aus dem Blickwinkel eines jungen Mannes. Die letzten Geschichten enthalten die Ansichten und Erlebnisse eines Erwachsenen.
Der "Ich-Erzähler" meiner Biographie definiert sich durch seine Beziehung zu seinen Mitmenschen. In den Geschichten des Grossvaters, der Grossmutter und der Mutter liegt meine eigene Biographie verborgen. Meine Geschichte ist die eines sich stets verändernden Seins.
Ich bin nicht mehr der, der ich gestern war.
Mathew Kuzhippallil


(1) Meine Familie 1966 mit 2 Missionaren und einem Schulfreund versammelt vor unserer Lehmhütte.
Stille.
Ashan ist hier. Seitdem der alte Mann im Hause ist, herrscht gespannte Stille. Denn nichts darf meinen Grossvater Ashan an diesem heiligen Tag verärgern. Nichts. Auch nicht die Schreie eines Säuglings. Aber das Kind wird schreien müssen, Geschrei, das Ashan nicht ertragen kann. Grossvater wird sehr wütend werden. Seine Augen werden rot glühen. Dann wird der alte Mann zornig zum Dachrand hinauf blicken, den Hals gestreckt, den Körper gespannt und gebogen, wie der einer angriffslustigen, verwundeten Kobra.
Das Tuch mit dem Kind hängt wie eine kleine Hängematte vom Dach. Es ist glühend heiss in unserer Hütte. Das Gras auf dem Dach ist von einem langen Sommer ausgetrocknet. Es ist immer dünner geworden, rarer mit jedem Windstoss, so dass es grosse Lücken im Dach gibt. Noch wird das Kind von einer dunklen Wolke geschützt. Die Sonne steht genau über unserer Hütte. Sie wartet nur darauf, durch die Spalten bis ins Tuch zu dringen. Das Kind zu wecken. Es wird lange schreien. Sehr lange. Denn Mutter muss heute Wasser vom Brunnen holen, Brennholz sammeln, Brot backen. Auch Grossmutter muss Brot backen, Brot mit einem Kreuz aus Palmblätterspitzen. Sie schuften am Brunnen und Vater ist hin zu den Feldern geflüchtet, wie immer, wenn Grossvater Ashan zu Besuch kommt.
Nur Ashan, der Säugling und ich sind in der Hütte. Ich muss meine Schwester hüten, sie vor der Sonne schützen. Aber ich darf sie nicht aus ihrem Tuch herausnehmen. Dafür bin ich nicht alt genug. Grossmutter sagt, ich sei drei Jahre alt. Ashan sagt vier. Ich denke, ich bin fünf. Ich weiss es nicht. Bald wird meine Schwester schreien. Niemand wird sie dann beruhigen können. Ashan wird meine Mutter prügeln. Die kleine Rose wird weinen. Winseln wie eine geschlagene Hündin. Grossmutter wird hilflos zusehen und fluchen. Denn Ashan ist mächtig. Er ist das Familienoberhaupt und hat viele Stöcke. Der Dachrand neben seinem Bett ist geschmückt mit Stöcken. Krumme Stöcke. Spazierstöcke. Schlagstöcke. Eine Hierarchie der Stöcke.
Ashan sammelt sie. Seit bald vierzig Jahren sammelt er. Spazierstöcke, Sandalen, Heiligenbilder. Auch Medaillons, Regenschirme und Bücher. Er ist Sakristan[1] in einer entfernten Pfarrei. Zuvor war er Sakristan in einer weiter entfernten Pfarrei. Zuvor? Bereits vor langer langer Zeit war er schon Sakristan. Er ist hier und dort gewesen. Vierzig Jahre lang. So zieren Stöcke und Schirme aus vielen Orten den vorderen Dachrand unserer Hütte. Zwischen dem Bambusgerüst und dem trockenen Gras reihen sich die Sandalen. Von den niedrigeren Bambusstangen baumeln graue durchlöcherte Regenschirme. Und Bücher. Kleine Bündel. Bücher in Malayalam, Sanskrit, Tamil. Bücher in Hindi, Englisch und Latein. Verschlossene Welten.
Ashan hat sie von Geistlichen erbettelt. Die Spazierstöcke, die Schirme und die Sandalen haben Gläubige hinterlassen, vergessen nach unzähligen Kirchenbesuchen. Pflichtbesuche sind es, ohne welche Grossmutter und ihresgleichen im Fegefeuer schmoren müssten, sagt Ashan. Er ist, soviel weiss ich, kein Brahmane wie die anderen. Er schmückt sich nicht mit Asche auf der Stirn, er trägt keine schweissgetränkte, fettverschmierte weisse Schnur. Auch blickt er weg, wenn er an einem Tempel oder einer Moschee vorbeigeht. Sein Hals ist schwer mit Kreuzen und Medaillons von Heiligen beladen, mit Göttern aus Zinn oder Bronze, sauber versteckt unter einem weissen Hemd, das er immer zuknöpft.
Seine Heiligen können die Cholera verhindern, wilde Elefanten aus den Reisfeldern fernhalten und die Seelen der Gläubigen ins Himmelreich begleiten, dahin wo die Seelen der Teeplantagenbesitzer gelangen, allesamt Engländer. Die meisten von ihnen sind vor meiner Geburt weggezogen, und ich sehe keine weissen Männer oder Frauen mehr in unserem Dorf, Koottu-Puscha. Ashan ist mit weissen Geistlichen aufgewachsen, Engländer, italienische Priester, aber auch Iren. Einige wenige sind geblieben, in benachbarten Orten. In fernen Orten.
Ashan glaubt, diese Menschen seien heilig, wir dagegen Sünder. Denn es ist nicht ohne Grund, dass ihre Haut rosarot ist und unsere dunkelbraun. Ashan, dies habe ich gesehen, pflegt rosarote Bilder zu küssen. Meist sind es Bilder der Heiligen Maria. Manchmal sind es andere Heilige oder Nonnen. Er versteckt seine Bilder. Er versteckt seine Bücher. Er versteckt alles. Ausser Sandalen, Regenschirmen, Stöcken.
„Junge, hast du Sand vom Flussufer geholt?“
„Ja, Grossvater.“
„Wischt diesen Hühnermist hier weg! Der ganze Boden dieser Hütte ist voller Mist! Ist denn deine Mutter nicht zu Hause?“
„Nein, Grossvater. Ich bin allein.“
„Wo ist die Kleine Rose? Wo ist deine Grossmutter?“
„Sie holen Wasser vom Brunnen".
"Versteck deinen Kleinen Vogel. Gott sieht so etwas nicht gern!"
Hastig verlasse ich die Hütte. Ein schmaler Streifen Tuch, mit einer dünnen Schnur an meinem Huft befestigt und zwischen den Beinen längs gezogen, verdeckt meinen "Kleinen Vogel". Von einem Strauch sammle ich eine Handvoll breite Blätter und stürze zurück in die Lehmhütte. Mit den Blättern wische ich den Hühnermist ab und werfe den aufgesammelten Misthaufen vom Vorhof der Hütte hinunter in den Gemüsegarten. In dem kleinen Raum mit dem Säugling und auch in der Küche sind noch ein Dutzend weitere Hühnermisthäufen, aber diese lasse ich links liegen.
Ashan kommt selten ins Innere der Hütte. Er kommt nie in die Küche. Er ist grossgewachsen, nicht wie meine kleine Mutter, nicht wie meine Grossmutter. Er müsste sich bücken. Die Welt der Frauen widert ihn an. Von der Decke der Küche hängen viele kleine Töpfe. Töpfe voller Gewürze, Reis oder getrocknetem Fisch. Auch die Küchengerüche erträgt er nicht. Unsere Küche ist finster. Ausserdem ist zu viel Asche drin. Zu viel Rauch drin. Zu viel Mist. Hühnerkacke!
Er liebt Weihrauch, nicht Rauch aus dem offenen Feuer einer armen Küche. Nicht die düstere Ecke einer Lehmhütte. Er liebt es, mitten im Kerzenlicht zu stehen. Dazu würde er gern noch goldgeschmückte Gewänder tragen, wie die des Dorfvikars. Denn er beneidet Priester. Er wollte selbst Priester werden, ist aber nur Sakristan geworden. Seine Berufung hatte nicht ganz ausgereicht, wie er mir eines Tages erzählt. Er vertraut mir. Er erzählt mir alle seine Geheimnisse. Aber zuerst muss ich seine Buchstaben lernen. Er wird mir alle Buchstaben und Ziffern beibringen. Auch Englisch und Hindi. Denn ohne Buchstaben sei ich verloren in einem tiefen Ozean der Bitterkeit, in der verdammten sündigen Welt, sagt er mir.
Alle müssen Ashan gehorchen. Ausser vielleicht der Dorfvikar. Ashan ist jemand Besonderes. Alle Männer in meinem Dorf lassen ihre gefaltete ‘Dhotis’[1] bis hin zur Ferse fallen, wenn sie ihm begegnen. Die Frauen halten ihren Abstand, wagen es nie, ihm ins Gesicht zu sehen. Er ist weiss gekleidet mit einem langärmligen Hemd und einer hellweissen ‘Dhoti’. Immer. Ashan sieht man immer in weiss. Denn Ashan ist fromm, sehr fromm. Er spricht leise. Lächelt selten. Laut lacht er nie. Und obwohl er nicht ganz Priester geworden ist, zeigt er sich stets würdevoll, gar arrogant. Fast wie der Dorfvikar.
Dennoch mag ich ihn. Er bringt mir gesüsstes Brot mit. Und wenn ich ihm neben seiner Kirche begegne, schenkt er mir Heiligenbilder, Bilder hübscher Männer und Frauen, rosaroter Wesen mit Heiligenschein.
"Kleiner Sohn, streue Sand neben mein Bett. Heute zeige ich dir, wie man 'Wasser' schreibt."
"Aber ich muss auf meine kleine Schwester aufpassen!"
Ich will nicht in den Sand schreiben. Ich will keine krummen Buchstaben zeichnen. Elefanten zeichne ich gern.
"Deine Schwester nimmt dir niemand weg", antwortet er mir in schroffem Ton. Es bringt wenig, Ashan zu widersprechen.
Ich streue den grobkörnigen Sand genau dort, wo er mir hindeutet. Ashan setzt sich neben mich und zeichnet zwei rundliche Buchstaben. Der erste fängt wie eine Zierpflanze ganz unten an, wendet sich nach oben, stürzt nach unten, um nochmals nach oben zu gelangen. Er stürzt wieder, hat einen langen Schnörkel. Ein lustiger Buchstabe. Der zweite ist ähnlich, aber auch nicht, hat vorne und hinten zwei unabhängige Begleiter, krumme Striche, wie Ashans Schlagstöcke.
'Wasser' zu schreiben, ist recht kompliziert. Ich zögere. Ashan nimmt meinen Zeigefinger, hält ihn fest, drückt ihn auf den rauen Sand. Aufwärts, Schwung nach unten, wieder aufwärts. Wieder der Schwung nach unten. Dann der zweite Buchstabe. Krümmungen, eine lustige Windung. Zuletzt ein Kreis, kleiner als die Sonne. Nochmals von vorne, immer wieder. Ashan glättet den Sand, verteilt ihn auf einem Flecken Erdboden der Hütte. 'Wasser' ist nun verschwunden. "Schreib", befiehlt er. Langes Zögern. Ich zeichne eine Schlange mit einem langen langen Schnörkel. Ashan findet das nicht lustig. Er schreibt 'Wasser' noch einmal, pflügt den Sand mit meinem Finger. Es schmerzt.
"Das letzte Mal lerntest du, wie man 'Auge' schreibt. Nicht wahr? Wenn du 'Auge' und 'Wasser' zusammen schreibst, welches Wort gibt es dann?"
”Ich glaube, ich denke, ich meine... Augenwasser?"
Grossvater Ashan schweigt. Seine Augen leuchten. Dann schreibt er die zwei Wörter 'Auge' und 'Wasser' dicht nebeneinander, sieht mich erneut fragend an. Ich versuche das neue Wort aus seinen Lippen heraus zu lesen.
”Trä...” Grossvater liest es laut vor. ”Trä...nen! Siehst du? Ja, es gibt ein völlig neues Wort. Tränen!"
Wie lustig! Wie seltsam die Welt Ashans! Wie seltsam seine krummen Buchstaben!
"Und Tränen sind mehr als bloss das Auge und ein paar Tropfen Wasser."
Das Kind in dem Tuch weint, aber Grossmutter steht bald neben der Hängematte, verdeckt die Sonne mit ihrem gebückten Körper, schwingt das Tuch sanft. Ashan fasst meine Hand, ich soll schreiben. Es gelingt mir unter seinem 'Augenwasser' ähnliche Windungen zu zeichnen.
"Schreib weiter", sagt er und steht auf. Er geht in die Hütte hinein, steht eine Weile neben Grossmutter. Schlägt er sie?
Ich soll schreiben, ermahnt er mich mit seinem Blick, mit den Falten auf der Stirn, mit einem entschlossenen Kopfnicken. Ich wende mich 'Tränen' zu, diesem seltsamen Wort im Sand. Blut sammelt sich an meiner Fingerspitze. Der Wind fegt den feinen Sand in meine Augen. Grossvater ist nicht mehr zu sehen. Auch Grossmutter ist nicht mehr zu sehen. Das gefaltete schwere Tuch pendelt hin und her, einen Sonnenstrahl brechend. Wo sind sie bloss geblieben?
Ashan war vor langer Zeit geboren. Vor hundert Jahren? Ashan gab es immer, soweit ich denken kann. In meiner Familie bekamen die erstgeborenen Söhne die Namen ihrer Grossväter, die Töchter bekamen die Namen ihrer Grossmütter. So trägt Ashans Grossvater den gleichen Namen wie Ashan und auch ich trage den Namen meines Grossvaters. Aber nicht den Titel Ashan. Denn Ashan bedeutet Meister, und es ist nicht sein wirklicher Name. Ashan heisst in Wirklichkeit Matthu, nach dem Apostel Matthäus. Nicht nach einem Sahib, einem Engländer. Ashan und seine Vorfahren waren Christen, lange bevor die Engländer oder die Holländer oder die Chinesen kamen. Ashan sagt mir, sie alle waren da, auch die Franzosen, die Portugiesen und die Juden.
Er besuchte drei Jahre lang ein Priesterseminar. Danach war er ein Leben lang Sakristan. So war seine Welt die Welt der Engel, der Seligen, der Märtyrer. Sein Leben war ein Kreuzweg durch die Kirchen im damaligen Travencore. Reich war dieses Königreich am südlichen Zipfel Indiens an Pfeffer und Ingwer und Kardamom. Aber ein Sakristan blieb dennoch arm.
Ashan hatte Grossmutter geheiratet, noch sehr jung, als er die Kirche noch zu sehr liebte. Er hatte keinen Grund, seine Frau zu lieben und sie keinen Grund, ihn zu lieben. So sahen sie sich einmal im Jahr, vielleicht auch zwei- oder dreimal. Er schämte sich sogar, sie zu sehen. Denn etwas anderes als liegengelassene Schirme, Spazierstöcke und die abgenutzten Sandalen konnte er ihr nicht bringen.
Gewöhnlich ass er, nachdem der Vikar gegessen hatte. Gewöhnlich gab ihm der Vikar ein paar Münzen, nachdem er die Geldscheine beiseite gelegt hatte. Gewöhnlich hatte er den Gotteslohn.
Dennoch lebte Ashan für die Kirche, polierte die Statuen der Heiligen, bis sie rosarot leuchteten, zündete unzählige Kerzen an und blies sie aus. Er läutete kleine Glocken, mittelgrosse Glocken, zerrte mehrmals täglich an rauen Seilen, an noch schwerere Glocken, um die Seligen aus ihren Träumen zu wecken, damit sie zwischen Gott und uns Sündern vermittelten.
Er lernte Latein, um die Messe zu begleiten. Er lernte Syrisch, um die Messe zu begleiten. Er lernte Englisch von den Teeplantagenbesitzern, Tamil von seinen Nachbarn und Sanskrit von den Brahmanen. Und von allen sammelte er rosarote Bilder. Ausser von den Brahmanen. Ihre vielen Götter, die Götter seiner Vorfahren, ihre Bilderwelt waren ihm fremd und verdächtig geworden. Brahma, Vishnu und Schiva gehörten zur Unterwelt, sagte er, zur Welt der Dämonen.
Und die Muslime verachtete er, denn ihr Allah hatte kein Gesicht. Die Muslime pflegten sich nicht, sie badeten nicht zweimal täglich im Fluss, wie es die Christen und die Hindus taten, sie weigerten sich, ihre Kinder in die Schulen zu schicken, waren geborene Kulis oder unehrliche Händler. So lehrte mich Ashan. So lehrte mich mein Vater. Auch der Dorfvikar.
Tippu, der Sultan von Malabar, war nahe Mysore in langwierigen, zermürbenden Kriegen mit den Engländern gefallen. Eine Handvoll Zamindars, Grossgrundbesitzer, teilten unter sich den Tropenwald, ihre Besitztümer eingegrenzt mit hohen langlebigen Teakbäumen und herausragenden Felsbrocken. An einem dicht bewaldeten Gebirgshang kaufte sich Grossvater Ashan sieben acre[3] Land von einem Zamindar. Boden, unzugänglich im Dickicht. Verwoben mit durstigen Wurzeln wildgewachsener Banyanbäume.
Ashan überliess es seiner zierlichen Frau, meiner Grossmutter, das Land urbar zu machen. Er überliess seine zwei Söhne und seine fünf Töchter der Gnade giftiger Schlangen, zerstörungswütiger Elefantenherden, herumschleichender Wildkatzen. Er selbst zog sich zurück, um mit einem halbwüchsigen Priester eine Pfarrei zu gründen, dort als Sakristan zu dienen, der Lieblosigkeit seiner Ehe zu entfliehen, in die Welt seiner rosaroten Heiligen, in seine Welt der Einsamkeit.
'Wasser' habe ich fertig geschrieben. Mir gefällt nach wie vor der lange Schnörkel des zweiten Buchstabens. Das Tuch bewegt sich nun fast nicht mehr. Es ist still im Haus. Aber nur für kurze Zeit. Bald steigt hinter der Hütte das rhythmische Donnern meiner Mutter hoch. Sie zermahlt Reis in einem rundlichen Granitloch, fest verankert im Boden. Leise steige ich über eine Türschwelle in das grösste Zimmer der Hütte. Plötzlich wendet sich Ashan von meiner Grossmutter ab. Ashan verlässt den düsteren Raum. Er zieht ein grimmiges Gesicht. Grossmutter faltet ihre Hände über ihrer Brust, rollt ihre weisse Bluse hinunter, auch sie verlässt den winzigen Raum. Wortlos. Was hat er ihr angetan? Hat Ashan sie geschlagen? Weint meine Grossmutter?
Ashan steht mit leicht gespreizten Beinen wie ein stiller Turm über 'Wasser', den Buchstaben im Sand. Erstarrt. Das Kind schläft noch. Mutter donnert wild im Hinterhof. Wolken ziehen über der Hütte vorüber. Staubgeladene Sonnenstrahlen bilden eine Oase des Lichts in der finsteren Welt unserer Hütte. Ameisen, angelockt vom kostbaren Zucker, winden sich durch die unendliche Weite des Erdbodens, durch die Lichtoase, durch Löcher in den Erdwänden, in die noch finstere Welt unserer Küche.
Ashan wollte keine Ameise sein. Kein Massenmensch. Als Sakristan lebte er abgesondert. Er fertigte die runde heilige Hostie an, bügelte die Soutanen der Priester, überwachte die Dekoration des Altars. Ausserhalb der Wände der Kirche lebte er an der Seite des Pfarrers, war sein Assistent, sein Sekretär, sein Koch. Sein Sklave!
Dann und wann wanderte Ashan in die Niederungen seiner eigenen Familie, vielleicht nur einmal im Monat, sogar seltener, wechselte hier und dort ein Wort mit Zugewanderten, redete auf sie ein, ihre Kinder zur Schule zu schicken, in der er selbst lehrte. Und weil es nur wenige Menschen waren, die sich in den Wäldern Malabars niedergelassen hatten, gründete er seine Kalaris[4], eine Schule nach der anderen, wo immer er als Sakristan tätig war.
Seine häufigen Zänkereien mit den Priestern und mit Grossmutter führten dazu, dass er ständig von Pfarrhaus zu Pfarrhaus, von Dorf zu Dorf wechselte. Denn die Hirten der Kirche zählten ihn, ein aus einem Priesterseminar entlassenen armen Hund, zu den Unberührbaren. Zu den Geächteten. Weder Hirte noch Schaf, ergriff er immer wieder die Flucht. In der Regel diente er zwei bis drei Jahre in einer Pfarrei, bis er ins benachbarte, oft ein neu entstehendes Dorf mitten im Wald wechselte, wieder ans Werk ging und ein neues ‘Kalari’ gründete.
An Sonntagen rezitierte er unzählige Male und am lautesten das Amen, liess den Weihrauch steigen, kniete vor dem Vikar und zählte die Münzen aus der Kollekte. Und wenn er allein war, in der kalten Welt der Heiligen, der stummen rosaroten Bilder, wenn sein Schmerz und sein Verlust ihn quälten, ging Ashan über enge Fusswege, über schlüpfrige Trennwege winziger Reisfelder, von Dorf zu Dorf wandernd, um Kinder zu suchen, unter sie seine Buchstaben zu säen, Wörter und Fabeln zu schenken, von seinem Wissen grosszügig zu geben, wie ihm die Wälder ihre Früchte gaben.
"Die Hirten, die Guten Hirten, die selbsternannten Stellvertreter Christi, sie bringen ihre Schafe zum Metzger", sagt er voller Zorn vor sich hin. "Sie ziehen das Geld aus den Taschen der Metzger. Blutbesudeltes Geld!"
Ashan spricht oft vor sich hin. Er hat niemanden, mit dem er reden kann. Auf seinen vielen Wanderungen, wenn er einem ihm bekannten Menschen begegnet, fragt er ihn nach den Ernten, nach Verwüstungen durch Wildschweine, nach der Heftigkeit vergangener Monsunregen. Einfach so. Um des Gesprächs Willen.
"Eines Tages wirst du verstehen, warum ich durch die Dörfer so wandere", sagt er mir. Aus den Falten eines Regenschirms entnimmt er Süssigkeiten, drückt sie mir in die Hand.
"Nur heute! Morgen darfst du sie nicht mehr essen, morgen darfst du dich nicht freuen. Nicht lächeln. Morgen ist Karfreitag."
”Für mich ist heute Karfreitag.”
Mutter Rose kommt kurz auf die vordere Veranda der Hütte. ”Schweig”, befiehlt ihr Ashan.
”Für uns Frauen ist jeder Tag Karfreitag.”
Mutter lässt nicht locker. Ashan wendet sich seiner Bibel zu. Er singt die Psalmen leise vor sich hin. Im Vorhof unserer Hütte zerkleinert Mutter das Brennholz, trockene Äste der Kaschewbäume. Die Axt verfehlt den Ast, der wie eine in Eisen gegossene Schlange auf steinernem Boden liegt. Sie flucht.
Ashans leises Summen erträgt sie nicht.
”Was, was ist denn so hochheilig an Karfreitag? Was ist so liebevoll daran, dass ein Vater seinen Sohn kreuzigen liess? Liebte Gott den Menschen? Soll ich so einen Schwachsinn glauben? Wieso liess er sich denn nicht selbst kreuzigen?”
Ich gehe zu meiner Mutter hin und halte sie an ihrer Kleidung fest. ”Mutter", flüstere ich. Mutter ist nicht zu beruhigen. Grossmutter kommt auf die Veranda. ”Lass es, Rose”, besänftigt sie Mutter. Sie fängt an, die Holzsplitter zu sammeln.
”Und wer soll dieses dumme Geschwätz von Erlösung glauben? Bin ich etwa erlöst? Wenn die Herren der Schöpfung, der mächtige Ashan, der mächtigere Sohn, nur einen Bruchteil meiner Arbeit machen würden! Dann wäre ich erlöst!”
Mutter stichelt weiter.
”Schweig! Halte deine böse Zunge, Teufelswerkzeug”, zischt Ashan. ”Schweig, du elendes Weib!”
Vater kommt auf die Hütte zu. Mutter eilt zur Küche zurück. Vater sieht Grossmutter beunruhigt an. Er übergibt ihr einen Brief. ”Von Chettan[5]”, kündigt er an. ”Es wird Krieg zwischen Pakistan und uns geben”, sagt er Ashan. Chettan ist Soldat an der pakistanischen Front. ”Ein schrecklicher Krieg”, fügt er hinzu. ”Gott bestimmt”, sagt Ashan. ”Auch den Krieg?” fragt Mutter. Er summt seine Psalmen. ”Es ist jeden Tag Karfreitag”, ruft Mutter aus der Küche.
”Du sollst deiner Frau eine Lektion erteilen”, mahnt Ashan meinen Vater.
”Schweig, schweig, schweig”, befiehlt, besänftigt, bittet Vater.
Ashan wird Mutter nicht schlagen. Dafür hat er seinen Sohn. Ashan wird nur Grossmutter schlagen, nur seine eigene Frau. Denn trotz allem ist er ein frommer Mann. Ein guter Katholik. Aus einer ehrenwerten katholischen Familie. Das Recht dazu hätte er. Sogar die Pflicht, der Widerrede Einhalt zu gebieten. Dafür zu sorgen, dass niemand aus seiner Familie in Versuchung gerät, dass niemand in die Fallen des Teufels tappt. Auch wenn er die Grossfamilie nur selten besucht und ihr nichts bringt als einen Blick auf den Himmel durch seine durchlöcherten Regenschirme, kann er Mutter schlagen. Auch Grossmutter oder meinen Vater darf er schlagen. Familienoberhaupt bleibt Familienoberhaupt.
”Denkt daran, mit wem ihr sprecht”, mahnt er.
Grossmutter nimmt meine kleine Mutter in Schutz. ”Sie hat die letzte Nacht durchgearbeitet. Sie muss noch schuften, während andere sich auf dem Thron breit machen und Psalmen summen. Ihr habt keine Sorgen! Mein ältester Sohn steht irgendwo in der Wüste an der gottverdammten Grenze zu Pakistan. Die Uniform brennt auf seiner Brust. Seine Blechmedaillen schmelzen. So viel Angst hat er. So viel Angst habe ich.”
Auch Ashan macht sich Sorgen. Die Psalmen summen ist seine Antwort auf seine Ängste. Er kann nicht anders. Auf die wenigen Rupien seines Sohnes, der in einem ausbrechenden Krieg steckt, ist seine Familie angewiesen.
”Dieser vom Teufel besessene Jinnah![6]” denkt er laut. ”Und diese tollwütige Horde von Muslimen! Wären bloss die Engländer nur geblieben! Die Engländer sind mitschuldig! Jinnah wollte unbedingt die Teilung Indiens. Einen eigenen Staat für Muslime. Sechs Millionen Tote hat diese Trennung gefordert. Und nun wollen sie das Leben meines Sohnes. Blutdürstige Bande! Hungernde Soldaten hier, hungernde Soldaten dort. Hilf mir Mutter, Mutter Gottes!”
Die Glocken der benachbarten Kirche rufen die Gläubigen zum Abendgebet. Als Grossvater seine Gebete anfängt, läuten schrille Glocken aus einem fernen Tempel. Aus einer nahestehenden Moschee ruft der Mullah noch dazu 'Allaaahuu Akbar'.
”Ja, ja, genug! Ich hab's gehört!” schimpft Ashan.
Es ist dunkel geworden. Aelikochu, die jüngste Schwester meines Vaters, ist nach Hause gekommen. Sie hat am Fluss die gesamte Wäsche der Familie gewaschen. Ausser den Kleidern meiner Mutter hat sie alles gewaschen und getrocknet. Mutter hat in die Grossfamilie eingeheiratet. Deshalb wird Aelikochu die Wäsche meiner Mutter nicht anrühren. Als Schwester meines Vaters stellt sie sich eine Stufe höher in der Familienhierarchie als meine Mutter. Vater hat noch drei Schwestern, Peramma, Mary, Kuttypennu. Alle sind verheiratet. Alle sind weg. Aber wenn sie zu Besuch kommen, sind sie immer noch höher eingestuft als meine kleine Mutter, die Kleine Rose.
Ashan ist nach Hause gekommen, um mit seiner Familie das Pessahfest zu feiern. Das ist das einzige Mal im Jahr, wenn in unserer Hütte das Fladenbrot mit dem Palmenkreuz gebacken wird. Dazu gibt es süsse Milch, gepresst aus frischen Kokosnüssen. Dafür lohnt es sich, wach zu bleiben. Ich gehe mehrmals in die Küche mit einer Kerosinlampe, um mich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen. Ashan hat einen weissen Schal um sich gelegt. Seine Hände sind gewaschen. Wir alle haben unsere Hände gewaschen. Ausser mein zwei Jahre alter Bruder und der Säugling. Dafür sind sie noch nicht alt genug. Nicht wie ich.
Wir sitzen im Kreis auf dem Erdboden. Ashan segnet das Brot, das im Lichte einer Kerosinlampe flach auf einem Bananenblatt liegt. Er nimmt das Palmenkreuz weg, küsst es und gibt es meinem Vater. Vater küsst das Kreuz, tut so als ob, wirft es heimlich weg. Dann hebt Ashan das flache weisse Brot hoch, vor sein Gesicht. Er teilt das Brot, legt die eine Hälfte zurück auf das Bananenblatt. Die andere Hälfte zerkleinert er mit seinen Händen. Widerwillig gibt er Grossmutter, das erste Stück. Sie nimmt es respektvoll entgegen. Sie blickt in Dankbarkeit hinauf zu Ashan. Er will ihrem Blick nicht begegnen, schaut weg, summt seine Gebete, teilt das gesegnete Brot in noch weitere Stücke. Dann gibt er Vater ein Stück, dann seiner Tochter Aelikochu, mir, meinem Bruder. Ein winziges Stück Brot drückt er an den Mund des schlafenden Säuglings. Das Kind beginnt zu weinen. Dann gibt Ashan das letzte Stück meiner kleinen Mutter.
Ashan isst. Dann hält er inne. Er wirft einen Blick auf meine Grossmutter. Er wirft einen flüchtigen Blick auf meine kleine Mutter. ”Sauer”, zischt er. Ein unendliches Schweigen.
”Nichts ist sauer”, erwidert meine Grossmutter.
”Wer das Brot nicht essen will, braucht es nicht zu essen”, sagt die kleine Mutter.
”Es ist doch etwas sauer”, urteilt auch Vater.
”Ertrage es”, empfiehlt die Grossmutter.
”Jedes Jahr dasselbe Theater”, schimpft Vater.
”Welch eine Arroganz! Frauen! Eine Spezies ohne Demut. Ohne jeglichen Sinn für Gehorsamkeit!” klagt Ashan.
Der Säugling schreit sich das Leben aus dem Hals. Die kleine Mutter drückt ihn an ihre Brust.
”Musst nicht deinen Busen aller Welt zeigen. Wie respektlos!” zischt Ashan.
”In der Kirche gibt's auch das Pessahbrot. Wer nicht hier essen kann, soll dorthin gehen. Und die Nonnen dort sind alle fromm und heilig. Sie müssen ja nicht Kinder stillen”, sagt die kleine Mutter.
”Schweig, schamloses Weib!”
Ashan steht auf. Er holt einen seiner Schlagstöcke. Legt ihn auf den Boden. Neben das zertrampelte Palmenkreuz.
”Ich will nicht schweigen, Vater und Sohn. Ich will nicht schweigen, Vater im Himmel, Sohn im Himmel. Und du Heiliger Geist! Ich werde nicht schweigen!”
Kleine Rose sieht mich beängstigt an.
”Auch du wirst schlagen lernen, eines Tages, eines Tages.”
”Schweig”, befiehlt Grossvater.
”Schweig”, befiehlt Vater.
”Bitte, Rose”, ruft meine Grossmutter dazwischen.
”Lass sie in Frieden”, befiehlt Grossmutter.
Aber Befehle erträgt Ashan nicht. Sogar der Dorfvikar bittet ihn. Er nimmt den Schlagstock, hebt ihn hoch über Grossmutter.
”Schweig du!”
Er drischt auf meine Grossmutter. Sie verstummt. Meine kleine Mutter schreit ihn an.
”Teufelskerle! Ihr seid die wahren Teufel”, flucht sie.
”Warum habt ihr mich in diese elende Familie geholt? Warum? Habe ich euch aufgesucht? Bin ich hier eure Kirchendienerin?"
Ashan sieht Vater an.
"Wie lange willst du untätig zusehen?"
Vater hebt seine Hand gegen Mutter Rose.
”Genug!” schreit er.
„Nicht genug, nie genug, nie!” schreit die kleine Rose.
Vater reisst den Schlagstock aus der Hand Ashans. Der Säugling schreit. Meine Grossmutter rettet ihn, nimmt ihn aus der Hütte hinaus. Vater schlägt auf die kleine Rose. Er schlägt und schlägt und schlägt.
”Gottesmutter, was habe ich getan?” Meine kleine Mutter weint.
”Weine nicht kleine Mutter, weine nicht.”
Aber sie hört nicht auf mich. Sie kann nicht auf mich hören. Sie flucht. Sie ringt nach Luft, weint weiter. Niemand kann sie trösten.
Weint Ashan?
Noch am späten Abend verlässt uns Grossvater Ashan. Meine grosse Mutter seufzt. Mutter schluchzt die ganze Nacht hindurch. Der Säugling schreit bis tief in die Nacht. Der Himmel mit den unermesslich schweren Wolken fällt auf unser Strohdach. Er droht uns platt zu drücken.
Ashan sehe ich am nächsten Morgen. Grossvater begleitet den Dorfvikar durch die vierzehn Stationen des Kreuzwegs. Zwei junge Messdiener tragen kleinere Kreuze. Sie gehen links und rechts des Priesters. Ashan folgt dem Vikar, einen kleinen Schritt hinter ihm. Er trägt ein dünnes Kissen. Der schmale Weg ist voller Kieselsteine und Unebenheiten. Entlang des Weges stehen vierzehn Kreuze aus Bambus. Vor jedem Kreuz legt Ashan das Kissen auf den Boden, damit der Vikar seine Soutane beim Hinknien schont. Auch seine Knie. Ashan kniet auf den rauen Kieselsteinen. Kinder, Frauen, Männer knien hinter dem Priester, hinter Ashan. Auch die Nonnen.
Ich folge Ashan, meinem Grossvater. Seine reinweisse Dhoti ist am Knie blutverschmiert. Frisches Blut. Er nimmt einen Glassplitter und gibt ihn mir. ”Nicht irgendwo wegwerfen, in ein tiefes Loch”, flüstert er. Ich betrachte den blutigen Glassplitter in meiner Hand. Eine Weile später werfe ich ihn weg. Ins Loch eines Ameisenhaufens. Der Priester steht auf und wandert zum nächsten Kreuz. Er liest aus seinem goldverzierten Buch.
"Jesus fällt das erste Mal zu Boden.”
Der Vikar leidet mit. Seine Stimme zittert. Dann kniet der Vikar hin und furzt. Oder war es Ashan? Die Messdiener kichern. Ich muss mich beherrschen. Jesus ist zu Boden gefallen. Mit seinem schweren Kreuz. Mit seiner Krone aus stacheligen Dornen. Mit seinen Peinigern im Nacken. Der Dorfvikar leidet. Ashan leidet. Die Nonnen leiden. Aber der Furz geht seinen Weg. Auch der Glassplitter.
Der Pfarrer sitzt in einem Rattansessel, fächert sich Luft zu und erholt sich von den Strapazen des Kreuzwegs. Der Dorfvikar deutet mir den Weg zu Ashan.
”Er befindet sich in seinem Zimmer hinter dem Pfarrhaus.”
Es ist Samstagabend. Der Vikar sammelt seine Kräfte für die Auferstehung. Ashan bereitet ihm das Abendmahl zu. Hinter dem Pfarrhaus, ausserhalb seines Zimmers, sitzt Grossvater Ashan im Schatten einer Palme. An der Schwelle seiner Welt. In seinem Zimmer brennt wenig Licht. Das Sonnenlicht ausserhalb des Zimmers macht den winzigen Raum geradezu düster. Das Holz in der Küche brennt noch. Ashan kocht Reis für den Vikar und für sich selbst. Was vom Tage übrigbleibt, bekommt er. Ashan braucht wenig. Sehr wenig. Er lebt vom Reiswasser, Wasser das heraus gefiltert wird, nachdem der Reis fertig gekocht ist.
”Unpolierter roter Reis braucht eine Stunde zum Kochen. Zum Glück habe ich das Gemüse bereits gekocht. Nun mache ich einen dieser Schirme fertig”, erklärt mir Ashan.
Ashan macht sich nützlich, während der Reis kocht. Es sind liegengelassene Regenschirme aus Holz mit grauschwarzem Baumwollgespann. Er näht die durchlöcherten Stellen zusammen. Er knotet das Tuch fest ans Gerüst.
”Wer kann sich neue Schirme leisten?” fragt er sich selbst. ”Bald kommt der Monsun. Ich will so viele Schirme reparieren wie ich nur kann. In meiner ‘Kalari’ braucht fast jedes Kind einen Schirm."
Das Reiswasser kocht über. Ashan wendet sich seinen Pflichten zu. Das Wasser ist auf das Brennholz hinunter geflossen. Die Küche ist voller Rauch. Ashan pustet in das Feuer. Er holt tief Luft und pustet weiter. Atemzug um Atemzug. Er schliesst die Augen, stützt seinen Kopf, holt tief Atem.
”Sohn, ich sehe Sterne. Meine Zeit ist bald gekommen.”
Der Rauch entweicht. Wieder flackern die Flammen. Trockene Kokospalmblätter beleben das Feuer rasch wieder. Er kommt aus der Küche mit Tränen in den Augen.
"Die Heiligen habe ich während der Karwoche in Samt eingewickelt. Morgen muss ich alle wieder enthüllen. Die Heilige Maria, der Heilige Joseph, der Heilige Georg. Der Ostergottesdienst ist um drei Uhr früh. Mit dem Aufgang des Pulari, des Morgensterns. Dann eine Messe um sieben. Später eine um zehn Uhr. Nach der ersten Messe habe ich viel zu tun. Es kommt noch ein Hilfspfarrer. Noch heute vor dem Abendmahl. Ich muss die Kerzen aufstellen. Den Altar schmücken. Ich muss die schweren Glocken läuten. Ostersonntag ist viel schlimmer als Karfreitag.”
”Warum ist Mon[7] zu mir gekommen?”
”Vater schickt mich.”
Ashan schweigt. Ununterbrochen näht er an seinem Schirm. Ich nehme einen grauen Schirm und öffne ihn. Ameisen haben unzählige Löcher in das graue Tuch genagt. Löcher wie durchsichtige Inseln in einem grauschwarzen Meer. Ich halte den Schirm über meinen Kopf und blicke hinauf zum Himmel. Es ist ein grüner Himmel voller Palmenblätter, goldene Blätter der Mangobäume, lichtgetränktes Hellgrün der Papayabäume. Da und dort ein leuchtender Fleck Himmel. Hellblau und grosszügig. Der Himmel ist ein Schirm ohne Löcher. Ein Schirm für alle, für Ashan, für meine kleine Mutter, für mich.
”Du weisst nicht, wieso dein Vater dich zu mir geschickt hat?”
”Er sagte mir nichts.”
Wieder Schweigen. Durch ein grosses Loch im Schirm sehe ich reife Mangos. Mangos so rot wie der Schnabel eines Papageis. Papageienschnabelmangos.
”Grossvater, kann ich eine Mango haben?"
”Leider gehören sie uns nicht. Die gehören zur Kirche, nicht wahr? Sie sind für den Vikar und für die Nonnen bestimmt.”
Ich entdecke ein paar auf dem Boden unweit des Stammes.
”Heb sie auf und leg sie in die Küche. Das sind nicht unsere.”
Aus der Ferne ist Donner zu hören. Ein Gebrüll der Berge. Eine Unruhe, die mit einem Knall endet. Ein Wirbelwind sammelt Laub und fegt es über das trockene Kirchgelände hinweg.
”In meinem Zimmer steht eine Holzkiste. Holst du sie mir?”
Ich trete in das Zimmer von Ashan. Es ist ein Loch. Wäre es unter der Erdoberfläche, könnte man es ein Grab nennen. So klein ist es. Ein Holzrahmen, von dünnen Seilen gehalten, dient Ashan als Bett. Eine Bastmatte liegt sauber zusammengerollt auf dem engen Bett. Darunter steht eine Holzkiste. Neben ihr ein Bügeleisen aus Bronze auf einem Metallring. Die Kiste ist auf einer Seite angesengt. Neben der Kiste sind noch Bücher. In einer Ecke des Zimmers stehen Spazierstöcke nach Grössen geordnet und ein paar Sandalen.
Ashans Sandalen. Ashans Bücher. Ashans Welt.
Ashan nimmt einen Schlüsselbund und öffnet seine Kiste.
"Nimm deine neugierigen Augen weg", befiehlt er mir.
Ashan öffnet seine Kiste nur einen Spalt. Darin sind noch einige Bücher. In einem kleinen Fach befinden sich Zinnmedaillons. Er nimmt eine kleine Kartonschachtel voller abgebrannter Kerzenstummel. Er nimmt auch eine Metalldose heraus. Darin befinden sich Knöpfe, Fäden, Nadeln. Zuletzt nimmt er eine mit dünnem Jutefaden zusammengeknotete Sammlung von Weihnachtskarten. Er dreht sich weg. Eine Weile später streckt er mir seine Hand entgegen. Ich sehe, wie seine Hand zittert. Seine Augen sind feucht. Er lächelt mir zu.
"Nimm, gib dies deinem Vater. Ich hab nur so viel."
Ashan gibt mir drei Rupien. Drei gefaltete schmutzige Rupien, mit fast so vielen Löchern wie in seinen Schirmen. Dann stellt er seine Habseligkeiten fein säuberlich zurück, Weihnachtskarten, darüber die Dose und die Kartonschachtel. Er schliesst die Holzkiste und lässt sie mich in sein Zimmer tragen.
"Stecke das Geld tief in die Hosentasche. Du darfst es nicht verlieren. Mehr habe ich nicht."
Dann verschwindet er eine Weile in der Küche und nimmt den gekochten Reis vom Kochherd. Er siebt das Wasser ab, sammelt es in einem Tontopf.
"Ich spare Geld für einige Gottesdienste. Das ist alles, was ich für deine Grossmutter machen kann. Die Gottesdienste kosten eine Menge Geld. Es ist nicht leicht, eine Todsünde aus der Welt zu schaffen."
”Todsünde?”
Ashan schweigt. Das Gebrüll der Berge kommt näher.
"Du wirst es verstehen, wenn du grösser bist.”
Ich verstehe nicht, wem Ashan was schuldet. Warum er das Geld spart. Warum er so einsam lebt.
”Es ist Zeit für dich, nach Hause zu gehen."
Ashan begleitet mich durch den Garten der Kirche bis hin zur Strasse. Er ist auch der Gärtner. Er sammelt Blumen für den Altar. Hibiscus, Rosen, Jasminblüten und weitere Blumen, deren Namen ich nicht kenne.
"Deine Grossmutter hat gesündigt. Sie ist tief gefallen. Der Teufel hat sie verführt. Ich habe mit dem ehrwürdigen Bischof gesprochen. Er sagte mir, ich solle einundzwanzig Messen lesen lassen. Eine feierliche Liturgie darunter. Ich habe ein Gelübde abgelegt, zur Rettung ihrer Seele."
Dann flüstert er vor sich hin. „Eine verlorene Seele...Tief dunkle Nacht...Ewige Nacht!“ Er schliesst die Augen.
"Dein Vater soll an Ostern etwas Fleisch kaufen. Dann ist die Fastenzeit vorbei. Der Metzger Mani wird drei oder vier Tiere schlachten. Wenn Iescho[8] auferstanden ist."
Ich weiss nicht, ob drei Rupien dafür ausreichen. Ich weiss nicht, ob Vater noch Geld für Fleisch übrig hat. Warum hat er mich dann zu Ashan geschickt, wenn nicht wegen des fehlenden Geldes?
"Metzger Mani kommt sehr selten in unsere Kirche, wo ‘Iescho’ aufersteht. Wie weiss er denn, ob ‘Iescho’ wirklich auferstanden ist?" Frage ich Grossvater.
"Am Ostersonntag, während der Messe, da läuten zunächst die kleinen Glocken. Dann die mittelgrossen Glocken. Zuletzt läuten alle Glocken zusammen. Ich läute die ganz grosse Glocke, die am Ast des Aanjili Baumes hängt. Dann wird ‚Iescho’ auferstehen. Der Klang der grössten Glocke hört man bis ganz ganz weit. Metzger Mani weiß es dann!"
Ashan kommt mit mir bis zur Strasse. Er begleitet mich noch ein Stück bis zu seiner Kalari. Seine Einmannschule ist eine Hütte. Seine Schule hat ein wackeliges Palmendach, getragen von vier krummen, abgeholzten, ameisenbewohnten Baumstämmen. Darunter ist ein Erdboden, den Ashan eigenhändig flachgedrückt hat und ein kleiner Sandhaufen, den Ashan vom Flussufer zusammengetragen hat. Es ist ein offener Raum ohne Wände, ohne Tafeln, ohne Bänke.
"Weisst du jetzt, wie man ‘Tränen’ schreibt?”
”Zuerst schreibe ich das Wort ‘Salz’ und dann ‘Wasser’.“
Und was bedeutet das?
„Trä...nen!? Salzwasser?”
Ashan lacht.
”Nicht Salz! Kannu[9] und Nier[10]. Und wenn wir diese zwei zusammen schreiben, ergibt das 'Kannu-Nier'. Also Tränen! Und Tränen sind mehr als bloss salziges Wasser."
Wo der Fusspfad sich mit der ungeteerten Landstrasse trifft, stehen ein paar wenige Einrichtungen des Alltags mit noblen Namen. India Hotel nennt sich ein kleines Restaurant. India Hotel hat ein Palmendach, vier luftige Wände aus gespaltenem Bambus, vier Bänke und vier längliche Tische. Im Inneren des Hotels gibt es reife Bananen, kleinere, grössere, sogar rote Bananen. Sie baumeln an Kokosfasern vom Dach. In einem Blechkanister kocht hellbraunes Teewasser von morgens bis spätabends. Von Kalendern auf den Innenwänden lächeln hübsche Frauen. Gegenüber dem India Hotel ist das Hotel Nava Kerala. Es ist eine Kopie des India Hotels, schmückt sich aber mit roten Fahnen. Am Eingang des Hotels auf der Aussenwand befindet sich eine Hammer und Sichel-Zeichnung, viel grösser als ich.
Neben den beiden Hotels steht der Lebensmittelladen des Kakka[11]. Vater kauft hier gewöhnlich Salz und Kerosin, aber auch Zwiebeln und getrockneten Fisch. Vater schuldet dem 'Kakka' Geld von den vielen Einkäufen auf Kredit. Gewöhnlich plagt mich der 'Kakka'. Er will Vater sprechen. Will sein Geld. Sofort. Aber heute lässt er mich in Frieden. Er ruht mit geschlossenen Augen, ähnlich dem roten Briefkasten an der äusseren Wand seines Ladens. Am Strassenrand auf grossen goldenen Bambustangen wehen Fahnen. Einer in rot weiss grün mit einem Rad in der Mitte. Grün mit einem weissen Halbmond. Rot mit Hammer und Sichel.
Mein Fussweg biegt von der schmalen staubigen Landstrasse seitlich ab. Er führt mich mitten durch dicht bewachsene Kaschewbäume. Sie sind voller Früchte, mit mausgrauen Nüssen. Die goldene Abendsonne scheint durch das dunkelgrüne Laub. Zwischen sattgrünen Feldern liegen vereinzelte offene Flächen frisch beackerter Erde. Rotbraune, kniehohe Erdhügel bilden gewundene Reihen. Hier und dort kräftige hochgewachsene Mangobäume. Die Bäume tragen so viele Früchte, dass man kaum noch Blätter sieht. Rotgelbe Früchte, unerreichbar für Kinderhände.
Am Ende der breiten Kaschewfelder liegt eine Steingrube, tief eingeschnitten in den Bauch der Erde. Am Rande dieser Grube steht ein massiger Kashewbaum. Mit unzähligen Ästen, tiefliegenden Ästen, deren Spitzen die Erde berühren. Ich sehe Metzger Mani unter dem Baum. Er streichelt seine Tiere. Eine Kuh und drei Büffel warten auf Ostern. Friedlich trinken sie aus Eimern. Auch den Hund von Metzger Mani sehe ich unter dem Baum. Er ist mager und hungrig. Auch er wartet auf Ostern.
Auf einem niedrigen Ast sehe ich eine grosse rostbefallene Waage. Darunter, an den Baum angelehnt, steht ein schwerer Hammer. Am Ostermorgen wird Mani die Tiere an dem Baum festbinden, sehr eng, damit sie sich kaum bewegen können. Dann wird er den Hammer hoch über ihren Köpfen halten. Auf den Glockenschlag warten. Die Tiere mit zittrigen Händen, mit unsicheren Schlägen, mit unzähligen Schlägen schlachten.
Die Tiere starren mich an, mit ihren sterngrossen Augen.
Ashan begegne ich in der Dunkelheit während der Ostermesse. Er sitzt auf den Treppen ausserhalb der Kirche seitlich des Altars. Er bläst Leben in die Holzkohle, damit sie besser glüht, damit die Kirche gefüllt wird mit Weihrauch. Dann beteiligt er sich an dem Gottesdienst. Es ist eine lange, ewig dauernde Messe. Aufstehen. Hinknien. Hinsetzen. Dann singen, nochmals hinknien, immer wieder hinknien. Er schwingt das Weihrauchfass, das an schmalen silbrigen Ketten hängt, hin und her. Hin und her. Der Rauch zähmt das Kerzenlicht.
Ashan sieht mich mit seinen traurigen Augen an und wendet sich dem Vikar zu. Der Dorfpfarrer ist in lange goldene Gewänder gekleidet. Es ist sein Tag des Triumphs. Er donnert seinen Gesang über die Köpfe der knienden Kinder, über die ersten Reihen der Männer und über die hinteren Reihen der Frauen. Vor den Türen der Kirche warten ein paar arme Tagelöhner, sie warten auf Ashan, auf das Läuten der grossen Glocke, sie warten darauf, ihre Dynamitstangen anzuzünden, zusammen mit dem Glockengeläut, damit ‘Iescho’ feierlich auferstehen kann. Sie warten auf ihren Lohn, noch sehnlicher warten sie, wie auch die Gläubigen, auf das frische Fleisch, vom Metzger Mani in rotgrünen Teakblättern verpackt, bluttropfend. Der Hund von Mani wartet, auch andere Hunde.
Ashan verlässt den Altar mit einer Laterne, die Ministranten nehmen ihre kleinen Glocken, noch stumme Glocken, Ashan steht unter dem himmelhohen Aanjili Baum, greift nach dem dicken Seil. Im schwachen Licht der Laterne, im kalten Dämmerlicht des Morgensterns Pulari, sehe ich sein reinweisses Hemd, seine reinweisse Dhoti, seine dürren langen Arme, die das Seil herunterziehen mit seiner ganzen Kraft.
Die Glocken läuten, Ohren betäubend. Donnerknall folgt auf Donnerknall. Der Erdboden zittert. Die Hunde bellen. Sie jaulen. Jesus ist auferstanden! Ich sehe einen erhobenen Hammer. Ich sehe Ashans Augen. Gespenstische Augen. Ich sehe die Augen der Tiere. Die Augen meiner Grossmutter. Die Augen meiner kleinen Mutter. Augen und Wasser.
[1] Küster
[2] weisses Tuch
[3] Masseinheit für Boden aus der Kolonialzeit
[4] Schule mit einem Lehrer
[5] älterer Bruder
[6] Staatsgründer von Pakistan
[7] Sohn. Im erweitertem Sinne wie hier auch Enkel
[8] Jesus
[9] Auge
[10] Wasser
[11] Moslem

In der Kürbisschale meiner grossen Mutter, meiner Grossmutter, versteckt unter Kleinkram, bewahrt sie alle ihre Münzen auf. Die ausgehöhlte Schale, oben eng, unten gewölbt, einem Krug ähnlich, hängt vom leicht gespitzten Dach der Küche. Einsam, grau, geheimnisvoll. Niemand darf sie berühren. Niemand darf sie herunternehmen. Nicht die kleine Rose, nicht mein Vater. Nicht einmal Ashan. Eine Stufe tiefer, von einem Bambusgerüst, hängen weitere Schalen, mit getrockneten Pfefferkörnern, getrocknetem Ingwer und Tamarind, mit geräucherten kopflosen Sardinen. Das rauchverfärbte Strohdach unserer Küche ist geschmückt mit Kürbisschalen. Mit dunklen Sonnen, dunklen Monden, rätselhaften Sternen am schwarzen Himmel unserer kleinen warmen Welt.
Meine grosse Mutter schubst mich weg, zählt ihre vielen Münzen.
”Was du alles wissen willst! Einen Elefanten verstecke ich in meiner Kürbisschale. Fort mit dir!”
Sie nimmt eine Handvoll, legt den Rest in ein buntes Tuch. Einen Augenblick lauscht sie nach Stimmen, nach sich nähernden Schritten, blickt umher. Aus ihrem Krug, von tief innen, nimmt sie ein zerknülltes hellgrünes Blatt, steckt es blitzschnell unter ihre weisse Bluse. Danach knotet sie das alte Taschentuch, legt es tief in ihre Kürbisschale zurück. Sie füllt die Schale mit schwarzen Pfefferkörnern auf, mit ihren Haarbändern, mit bunten Armbändern aus Glas. Sie hängt den dunklen Krug auf das hohe Bambusgerüst zurück, noch bevor Mutter Rose mit einem Krug voll Trinkwasser vom Brunnen in die Küche zurückkehrt.
Ich begleite Grossmutter, die ich meine grosse Mutter nenne, nach Koottu-Puzha. Ich muss sie so nennen, da ich die meiste Zeit mit ihr verbringe. Sie, die Mutter meines Vaters, gibt mir zu essen, sie wäscht meine Kleider, kämmt mein Haar. Sie schickt mich zur Schule. Auch schlafe ich nachts neben der grossen Mutter. Ich habe jetzt vier Geschwister, Thankachan, Alice, Babu und das Baby. Meine eigene Mutter, die kleine Rose, kümmert sich um unseren Jüngsten, um den Säugling. Er ist gerade drei Monate alt. Da hat meine kleine Mutter viel zu wenig Zeit für mich.
Meine grosse Mutter hat Geld gespart, um mir ein weisses Hemd zu kaufen, ein langärmliges, das zu einer weissen Dhoti passt. In wenigen Tagen empfange ich meine Erstkommunion. Der Vikar sagt, ich habe das Alter erreicht, in dem man das Gute und das Böse erkennen kann, das Jahr der Erkenntnis. Die Nonnen im Dorf haben uns Kindern, die die Erstkommunion empfangen, Kronen gebastelt. Pappkronen, geschmückt mit weissen Papierblumen. Mein Bruder Babu will unbedingt meine Krone haben. Er ist zwei Jahre alt. Meine Mutter will ihm meine Krone nach der Erstkommunion überlassen. Auch Vater will, dass ich meine Krone an Babu abgebe. Ich will ihm meine Krone niemals geben. Niemals. Meine einzige Hoffnung ist meine grosse Mutter.
Der Weg ins Dorfzentrum verläuft entlang eines namenlosen Flusses. Es ist ein staubiger, steiniger Weg ohne jeglichen Verkehr. Es sind zwei Meilen bis zum Dorfzentrum Koottu-Puscha, immer den windigen Fluss entlang. Man kann an drei oder vier Stellen durch den Fluss waten, um das andere Ufer zu erreichen. Das Wasser ist durchsichtig wie Glas. Felsen ragen aus dem Wasser heraus. Man sieht aber auch Felsen, die unter Wasser liegen, mit Grün überzogen, auch weite Strecken ohne Felsen, nur Sand. Die beiden Ufer bestehen aus breiten Sandflächen, mit welligen Hügeln. Hier und dort sieht man rote, grüne oder gelbe Saris, gewaschen und auf Sand ausgelegt, damit sie in der Sonne trocknen.
Der noch unberührte Wald am anderen Ufer, in Mysore, steigt sanft vom Flussufer an. Nah am Fluss sieht man alles sehr deutlich. Einzelne Blätter. Weit ausgestreckte Äste. Mächtige Baumstämme. Man sieht Scharen von Schmetterlingen, bunten Vögeln, herumspringenden Affen. Es sind auch Spitzen von hochgewachsenen Bambussen zu sehen, ihre Blätter leuchtend grün oder goldfarben. Nah am Fluss ist der Wald dunkelgrün, das Laub im Licht gebadet, einzelne Baumstämme im tiefen Schatten verloren. Bis zu den nahen Hügeln hinauf sieht man Bäume, geschmückt mit gelben, samtblauen oder tiefroten Blüten. Etwas weiter vom Fluss weg erkennt man keine einzelnen Bäume mehr, die Baumkronen sind rundlicher und dichter gewachsen. Noch weiter weg vom Flussufer besteht der Wald nur aus Wellen. Eine breite dicke Welle aus Dunkelgrün, eine zweite Welle aus Hellgrün, dahinter eine mit einem Hauch von Blau. Im Schatten der Wolken erscheint der Wald tiefblau, sogar purpur. In der Ferne am Horizont stehen sanfte hellblaue Hügel, ihre runden Spitzen ruhen, in den Wolken geborgen.
Meine grosse Mutter will zum anderen Ufer hinüber. Der geteerte Weg, entlang dem rechten Ufer, ist auch kürzer. Wir gehen einen kleinen Hang hinunter, flach absteigend, einen dornigen Pfad mit Gras überwachsen. Meine grosse Mutter geht mir voraus. Sie trägt eine Chatta[1]. Ihre Mundu[2] trägt sie anders als die Männer. Für einen Sari ist sie zu alt, meint sie. Ein sehr feiner Schal mit einem wunderschönen goldenen Rand bedeckt ihren Kopf. Unter einem Mangobaum lässt sie mich an ihr vorbeigehen. Ich stürze hinunter zu den Sanddünen und warte auf sie im Schatten eines Strauches mit hunderten von dünnen, sich sanft biegenden Ästen.
Meine Grossmutter ist hübsch. Sie hat eine hellere Haut als meine Mutter. Auch hat sie ein herzliches Lächeln, klare grosse Augen, ein gütiges Gesicht. Sie kommt zu mir und zeigt mir eine Mango, eine Papageienschnabelmango, rot, reif, duftend.
"Mutter, woher...?"
Sie zieht mich zur Seite, weg vom staubbedeckten rötlichen Fussweg, dorthin, wo der Sand fast weiss ist. Sie setzt sich hin im Schatten eines anderen grösseren Strauches, dicht am Wasser. Sie wäscht die Mango im fliessenden Wasser, trocknet sie mit einem Ende ihrer langen 'Mundu' und gibt sie mir.
"Iss, ich habe sie für dich gepflückt.”
”Hätte jemand dich gesehen!”
” Du musst nicht so ängstlich sein. Iss und wasch dir die Hände.”
Grossmutter setzt sich auf einen rundlichen Fels, ihre Füsse im Wasser. Sie nimmt ein leichtgrünes Blatt, hundertmal gefaltet und starrt darauf. Sie bemüht sich, die rundlichen Buchstaben auf dem Blatt zu entschlüsseln.
"Sohn, du musst mir diesen Brief vorlesen. Ich sehe die einzelnen Buchstaben, aber nicht die Wörter. Man hat mich nicht zur Schule geschickt.”
Sie gibt mir zögernd das Blatt.
"Sohn, du sollst niemanden etwas von diesem Brief sagen. Niemandem und niemals. Du bist mein goldener Sohn, nicht wahr?"
”Dafür musst du meine Krone hoch oben an die Wand hängen. Babu darf sie mir nicht wegnehmen, auch Mutter nicht.”
”Ich werde es nicht zulassen, dass jemand dir deine Krone wegnimmt.”
”Und wenn Vater sie wegnimmt? Oder Ashan?”
”Niemals werde ich so etwas zulassen!”
Meine grosse Mutter ist mir mehr wert als meine kleine Mutter.
"Liebe Mutter", beginnt der Brief. "Du kennst mich kaum, hast mich nur dreissig Tage in deinen Armen getragen. Ich muss dir diesen Brief schreiben. Mein Vater ist nach vielen Jahren des Leidens gestorben. Er hatte Tuberkulose. Spuckte zuletzt nur noch Blut. Seine Bemühungen, dich ein letztes Mal zu sehen, sind gescheitert. Seine Briefe an dich blieben unbeantwortet. Er hatte dich so sehr geliebt. Warum hast du uns nie geschrieben? Er schrieb einmal auch an deinen Mann, an Ashan, den Sakristan. Seine Antwort war, dass genug Unglück geschehen sei, dass wir nie mehr schreiben sollten, dass die Vergangenheit ruhen soll."
Ich sehe meine grosse Mutter an. Sie hat den Kopf gesenkt. Sie ist Teil des runden Felsens geworden. Schluchzt sie? Oder war es bloss das Rauschen des Flusses? Oder eine andere menschliche Stimme? Sie blickt hoch. Ihre Augen sind feucht.
"Lies weiter!”
Ich brenne darauf zu sehen, wer diesen Brief geschrieben hat.
"Der Brief endet mit ‘dein Sohn‘, ohne einen Namen", bemerke ich.
Grossmutter hat zwei Söhne. 'Der General' und meinen Vater. Wir nennen Onkel Joseph 'den General', weil er beim Militär ist. Ich habe ihn nur ein paar Mal gesehen. Er ist irgendwo weit oben im Norden Indiens. Im Himalaja. Und mein Vater. Meine Grossmutter hat nur zwei Söhne! Und fünf Töchter.
"Lies weiter, lies weiter”, drängt meine grosse Mutter.
"Vor drei Monaten ist Acchan[3] gestorben. Er hat mir nichts als Schulden hinterlassen. Ich arbeite als Autorikschafahrer in Trichur. Bin fast immer in der Umgebung der Busstation. Deine Familie wird mich zerstückeln, wenn ich zu dir kommen sollte. Bitte versuch doch, liebste Mutter, einmal zu mir zu kommen. Nur ein einziges Mal möchte ich dich sehen. Durch mich fliesst dein Blut, Mutter. Dein Sohn.”
Grossmutter nimmt mir den Brief weg, bevor ich ihn genauer ansehen kann. Sie steht auf und wäscht sich in der Strömung das Gesicht. Sie nimmt entschlossen meine Hand, zieht mich auf den Fusspfad zurück. Sie eilt zu einer ihr vertrauten Stelle, wo der Fluss am breitesten ist, wo das Wasser flach dahinfliesst, wo die runden Steine im Flussbett nicht so glitschig sind. Sie kennt die Stelle, wo wir den Fluss sicher durchqueren können, hin zur geteerten Strasse am Waldrand. Sie schweigt. Der Fluss rauscht über runde farbige Steine, über Steine, die im Licht der Sonne leuchten.
Der Weg über die Felsen führt uns zu einer kleinen Insel, einer Ansammlung von dichtgewachsenen Sträuchern mit rosaroten Blüten, zu einem feinen Sandstrand, der von unserem Ufer aus nicht zu sehen ist. Als wir den Felsen nahe dieser winzigen Insel erklimmen, sehe ich eine Gruppe Frauen, dunkelhäutige Ureinwohner der Wälder, mit zarten runden Brüsten, nackt, badend, frohlockend. Meine Grossmutter ist ihnen nicht fremd, aber auch nicht vertraut, denn sie sprechen die Sprache der Wälder und leben in Lichtungen, zu denen wir keinen Zutritt haben. Grossmutter lassen sie unbehelligt vorbeigehen. Ich bin ihnen eine willkommene Abwechslung, sie tauchen ab ins kristallklare Wasser, um dicht an meinem Körper aufzutauchen, mir fröhlich lachend Wasser zuzuspritzen, um erneut abzutauchen und wegzuschwimmen wie bunte Fischschwärme.
Der Fluss ist übersät von runden Granitbrocken, die da und dort aus dem Wasser herausragen. Auf den Felsspitzen weilen bunte Vögel, verwirrt von den Fischschwärmen, unfähig eine Wahl zu treffen oder einfach gesättigt und müde, trunken vom Zauber des Flusses. Wo wir in die Strömung steigen, bilden die Felsen eine durchbrochene Brücke. Fels reiht sich an Fels, grau, weiss, gold. Zwischen den Felsen wachsen dünne zarte Pflanzen, grüne oder zartgelbe Fäden, die in der Strömung tanzen wie die langen Haare der Frauen.
Grossmutter bewegt sich von Fels zu Fels, mit ihrer 'Mundu' hoch gesteckt, ihre Füsse sicher auf den runden nassen Steinen. Sie wartet auf mich. Wenn die Strömung zwischen den Felsen an Schnelligkeit zunimmt oder wenn der Fluss von einer Stelle zu einer leicht tieferen Ebene stürzt, streckt sie mir ihre Hände zu. Bald hält sie inne, um ihre Mundu noch einmal zu festigen, ihre Füsse zwischen zwei äusserst glitschigen weissen Steinen zu sichern, wartend, in Gedanken versunken, immer noch schweigend. Woran denkt sie? Was hat sie denn zu verbergen? Wer ist dieser Sohn?
Mutter, so sprechen sie viele Menschen an. Metzger Mani, der Moslem 'Kakka' vom Lebensmittelladen, auch der Dorfvikar. Demnach könnte 'der Sohn' irgend jemand sein, irgend jemand, der sie kennt, vielleicht sogar aus ihrer Kindheit. Durch ihn 'fliesst ihr Blut'. Ihr Blut? Dieses Fliessen verwirrt mich. Ein unbekannter Fluss. Ein blutiger Fluss. Ein seltsamer Fluss!
Meine grosse Mutter erreicht das andere Ufer, sieht mich sicher aus dem Wasser heraustreten und verschwindet hinter einem Strauch, um ihre Mundu kurz abzulegen, die nassgewordenen Stellen zu trocknen und dann erneut zu befestigen. Sie lockert das Haar, bindet es wieder fest. Ich sehe sie durch das dünne Laub der Sträuche. Sie wirkt schön, gefasst und wenn sie einen Augenblick lang traurig war, dann scheint ihr Schmerz jetzt vorüber zu sein. Aber sie schweigt noch, sie schweigt noch eine ganze Weile. Ich wünschte, sie würde mir etwas zurufen, etwas sagen. Nur ein einziges Wort!
Am Strassenrand zuckt der Leib einer Python, von einem Baum hinuntergestürzt und von einem Laster überfahren, eine leblose Masse wie ein Berg, zu bewundern und zu fürchten, auch nachdem der Tod sie besiegt hat. Meine grosse Mutter nähert sich der Schlange, stellt ihren Fuss auf den noch bebenden Leib. Das kopflose Wesen zuckt zusammen. Grossmutter zieht sich zurück, wirft einen Blick auf den dicken runden Ast direkt über ihrem Kopf, von welchem die Schlange hinuntergestürzt sein muss.
"Die Schlange ist wahrscheinlich vor drei oder vier Stunden überfahren worden", bemerke ich, als wir geschützt von den riesigen Schatten am Rande der bereits sehr heissen Strasse stehen. Aber meine grosse Mutter schweigt noch. Sie nimmt mich bei der Hand und macht sich auf die brennend heisse Strasse, auf den Weg nach Koottu-Puscha. Weder Grossmutter noch ich tragen Sandalen. Vielleicht bekomme ich welche für meine Erstkommunion. Mein Vater würde mir gerne welche kaufen. Das Geld dafür hat er aber nicht. Schuhe und Sandalen können sich nur wohlhabende Familien leisten. In unserem Dorf sind es nur wenige. Nur gerade zehn oder zwölf Familien. Und der Dorfvikar. Selbst Ashan trägt liegengelassene Sandalen. Sandalen von anderen.
Grossmutter bringt mich nach Koottu-Puscha, damit der Schneider Rama Mass nehmen kann. Ich habe nur zwei Hemden, und auch sie sind mir zu eng geworden. Sie sind beide farbig und kurzärmelig und somit für die Kommunion ungeeignet. Meine beiden kurzen Hosen sind ebenfalls unpassend. Grossvater hat mir meine erste weisse 'Dhoti' versprochen. Er arbeitet in einer Pfarrei ziemlich weit von unserem Dorf entfernt. Ich sehe ihn nur selten, aber er wird bestimmt kommen. Bestimmt.
Der Wald ist ohne menschliche Stimmen, aber nicht totenstill. Ich höre Vögel aller Art. Insekten und Scharen von Affen. Die Affen sind ganz aufgeregt. Vielleicht wegen der toten Python. Vielleicht wegen einer anderen Schlange oder einer anderen Gefahr. Tiger und Wildkatzen schleichen durch das Dickicht, sie verweilen im Sommer nah am Fluss. Sie überqueren den Fluss im Sommer und kommen manchmal bis in unser Dorf. Letzte Woche wurde die Kuh unseres Nachbarn von einem Tiger weggeschleppt. Wir haben noch mehr Angst vor den Elefantenherden, die über dem Fluss in unser Dorf bei Nacht eindringen. Sie zerstören alles, ziehen die Bananenbäume aus der Erde, trampeln durch die Reisfelder. Sie drücken unsere Hütten platt.
Affen springen über unseren Köpfen von Ast zu Ast, hunderte von Affen, ihr Schrei bietet mir Trost. Denn das Schweigen meiner Grossmutter ist unerträglich. Niemals schweigt sie so lange. Ihr bestimmtes Gehen ohne ein Lächeln, ohne auch nur ein Wort macht mich bange.
Vor unseren Augen überquert eine Schlange mühevoll die geteerte Strasse.
”Mein Heiliger Gheevargheese!" ruft die grosse Mutter.
Meine Grossmutter streckt ihre Hand seitlich, um mich zu warnen, mich aufzuhalten, die Schlange nicht unnötig zu provozieren. Sie kennt Schlangen gut. Auch ich erkenne diese.
"Eine Kobra, eine giftige!”
Ich hebe einen lockeren Stein, um die Kobra auf ihrem Weg etwas zu beschleunigen. Aber Grossmutter hält mich von meinem Vorhaben ab.
"Einer Kobra nie weh tun. Sie hat ein gutes Gedächtnis und wird sich irgendwann einmal rächen.”
Der Heilige Gheevargheese, Sankt Georg, ist der Schutzpatron unserer Kirche. Er reitet auf einem weissen Pferd und kämpft mit einer feuerspuckenden Schlange. Da er Schlangen besiegt, ist er natürlich der wichtigste Heilige unserer Kirche. Noch wichtiger als die Heilige Maria oder der Heilige Joseph. Denn nicht nur der Wald ist voller Schlangen, auch unsere Felder. In Wirklichkeit sind unsere Felder Teil des Waldes, die wenigen Dörfer kleine, mit Landwegen verbundene Lichtungen darin.
Die Kobra windet sich die steile Erdwand hinauf, erschreckt dabei einen Affen. Das Tier stürzt auf die niedriger liegende Strasse, mit einem winzigen Säugling, welcher an seinem Bauch hängt. Meine grosse Mutter starrt eine Weile die Affenmutter an. Ihr Kleines ähnelt so sehr einem Menschenkind. Es saugt an der Brust und betrachtet mich mit seinen riesigen Augen.
Grossmutter will weiterziehen. Ihr Blick fordert mich auf mitzugehen. Nach wenigen Schritten dreht sie sich um und betrachtet die Affen.
"Eine Affenmutter gibt ihr Kind nie auf, wusstest du das?"Wenn jemand eine Affenmutter erschiesst, dann klammert sie sich an ihr Kind, so lange wie sie nur kann. Vor ihrem letzten Atemzug, küsst sie das Kleine, dann gibt sie es dem Wald.”
Ich wünschte, ich wäre so ein kleiner Affe!
Ein paar Kurven weiter hinten verbindet eine kleine Brücke die Staaten Mysore und Kerala. Die Brücke wurde von den Engländern gebaut. "1928" steht auf einer gelben Tafel auf der bogenförmigen Brücke geschrieben. An einem Ende der Brücke steht eine Hütte, in der hausgemachter Arrack[4] und Toddy[5] verkauft werden.
Koottu-Puscha ist ein sehr kleiner Ort und bedeutet Begegnung zweier Flüsse. Hier gibt es eine Reihe von Tee- und Lebensmittelläden, einen Fischmarkt, eine Moschee und viele kleine Einrichtungen. In Koottu-Puscha gibt es auch jede Menge Fahnen und Plakate. Die Fahnen sind rot oder grün. Ich interessiere mich wenig für Fahnen. Sie wehen viel zu hoch über meinem Kopf. Aber die Plakate sind herrlich, allesamt aus dem entfernten Kino in Iritty. Ich habe viel vom Kino gehört, aber nie einen Film gesehen. Iritty ist mehr als zehn Meilen von Koottu-Puscha entfernt, gut zwölf Meilen von zu Hause. Es nützt wirklich nicht viel vom Kino zu träumen. Vater kann mir nicht mal ein paar Sandalen kaufen, kein Hemd für meine Kommunion und keine Dhoti. Nur Vater könnte sich einen Kinobesuch leisten, nur zwei oder drei Mal im Jahr. Dann muss er um Mitternacht nach dem Kinobesuch die ganze Strecke von Koottu-Puscha zu Fuss nach Hause gehen, was auch gefährlich sein kann, wegen wilder Elefanten oder giftiger Schlangen unterwegs.
Der Schneiderladen von Kochuraman, dem kleinen Raman, ist gut besucht. Kochuraman ist ein sehr guter Schneider. Es gibt insgesamt drei Schneider in Koottu-Puscha, und Raman hat sehr viele Kunden. Es ist die Jahreszeit der Hochzeiten, kurz vor dem Monsunregen. Sein Laden ist voll von Stoffresten. Die Stoffreste sind als Haarbänder sehr begehrt. Junge Mädchen sammeln sie eifrig. Raman hat keine freien Stühle mehr in seinem Laden. Er schickt einen seiner Assistenten für meine grosse Mutter einen Stuhl holen. Der jüngere Schneider lässt seine Arbeit liegen, holt alsbald einen Stuhl aus einem benachbarten Laden. Kochuraman lässt in Gläsern verdünnten Joghurt servieren, einen für Grossmutter, einen für mich.
Während er an seiner alten Nähmaschine fädelt, erkundigt er sich nach Grossmutter und ihrer Familie. Kochuraman und meine Grossmutter kennen sich seit meiner Geburt. Meine grosse Mutter ist gut bekannt in Koottu-Puscha. Sie und Ashan waren mit einer Handvoll weiterer Familien die ersten Einwanderer, die nach Kacheri-Kadavu kamen. Kacheri-Kadavu ist ein Flussüberquerungspunkt zwei Meilen östlich der Brücke in Koottu-Puscha. Grossmutter heisst Aeli, aber alle nennen sie respektvoll Mutter. Auch Kochuraman nennt sie so.
”Als ich vor dreizehn Jahren nach Koottu-Puscha kam, gab es hier überhaupt keinen Schneider, da war nur der Muhammed 'Kakka' mit seinem Fischladen. Ich bin kurz vor der Ermordung von Mahatma Gandhi hierher gekommen, im Jahr 1948, am Anfang des Monsuns”, erinnert sich meine grosse Mutter.
"Ein Jahr, nachdem Indien von Grossbritannien unabhängig wurde. Die Weissen verliessen gerade das Land. Da war ich bereits dreissig Jahre verheiratet. Ich bin mit einer ganzen Horde hungriger Mäuler hierher gekommen. Damals gab es nur drei Busse von hier. Zwei nach Kannur und einen nach Mysore.”
”Es sind heute fünf”, ergänzt Kochuraman.
Grossmutter war bereits mit zwölf Jahren verheiratet worden. Ihre Familie war noch ärmer als die Familie Ashans. Ashan war gerade aus dem Priesterseminar entlassen worden und kaum älter als zwanzig. Ihre Familien hatten sich getroffen, die Formalitäten besprochen, auch die Frage der Mitgift. Grossmutter brachte etwas Gold mit. Ashan kaufte ihr ein goldenes ‘Thali’. Ein winziges Stück Gold, das Grossmutter immer noch an einer Kette mit sich trägt. Das wenige Gold, das sie in die Ehe einbrachte, trägt sie in Form grosser Ohrringe. "Es ist, zusammen mit meinen wenigen Münzen und Armbändern in der Kürbisschale, alles, was mir gehört”, höre ich sie oft sagen.
Meine grosse Mutter sieht trotz all dieser harten Zeiten immer noch sehr jung aus. Und ihre Hände sind noch zart. Sie sind nicht wie die Hände meines Vaters. Auch ihre Haut ist zart. Ihr Gesicht kennt kaum Falten. Auch darum ist sie meine grosse Mutter und nicht meine Grossmutter. Und wenn sie lächelt, wie sie es so oft tut, dann ist sie genau so hübsch wie die Frauen auf den Kinoplakaten, vielleicht sogar hübscher. Auch darum nennen sie alle Mutter. Deshalb hat sie viele Söhne und viele Töchter. Der Brief, den sie aus meinen Händen so plötzlich weggerissen hat, stammt sicher von so einem Sohn. So muss es sein.
Kochuraman nimmt den Stoff, den Vater bereits für mich gekauft hat und nimmt Mass.
”Hast du eine passende 'Dhoti' dazu?”
”Sein Grossvater bringt ihm eine”, antwortet die grosse Mutter.
”Ich habe Ashan lange nicht gesehen, zwei Jahre mindestens", so Kochuraman.
”Er ist jetzt in Peravoor. Er kommt zur Erstkommunion meines Knaben.”
”Wie alt bist du denn?”, fragt mich Kochuraman.
”Sieben.”
”Alt genug, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden”, ergänzt meine grosse Mutter.
Ich sehe eine farbige Reklame von einem Film, der demnächst in Iritty gezeigt werden soll. ”Lanka Dahanam[6]” heisst es in grossen Buchstaben.
”Kann man wirklich 'Lanka Dahanam' im Film sehen”, will ich von Kochuraman wissen.
”Weisst du, wie Gott Rama seinen Gegenspieler Ravana besiegt hat? Weisst Du wer Ravana ist?” fragt mich Kochuraman.
Ravana hat zehn Köpfe und zwanzig Hände. Er ist König von Lanka und hat Sita, die Frau von Gott Rama entführt. Mit seinem Blumen-Flugzeug. Hanuman, der Affengott, ist mit Rama befreundet. Ravana, der zehnköpfige Dämon, nimmt auch Hanuman, Ramas Freund, gefangen. Er will seinen Spass. Ravana befiehlt seinen Soldaten, den Schwanz von Hanuman mit einem Tuch zu umwickeln, ihn anzuzünden. Aber der Affe Hanuman wächst und wächst und wächst. Die Soldaten haben grosse Mühe seinen Schwanz mit Tüchern zu umwickeln, überhaupt genügend Tücher dafür zu finden. Der Schwanz wächst unaufhörlich weiter. Endlich zünden sie ihn an. Aber der Affe ist nicht mehr klein und ohnmächtig, er ist Gott und allmächtig. So springt er von Dach zu Dach über die ganze Stadt Lanka. Bis sie in Schutt und Asche liegt.
”Kann man das alles im Kino sehen?”
”Alles. Alles. Und die vielen Lieder!”
Begeistert summt Kochuraman eine Melodie, schnipst und schneidet.
Meine grosse Mutter und ich überqueren den Fluss ein zweites Mal. Es ist bereits Nachmittag und wir kehren heim. Kochuramans Antwort macht mich keineswegs glücklich. Im Kino kann man bestimmt sehen, wie Prinz Rama Sita bei einem Bogenschiesswettkampf gewinnt, wie Ravana sie entführt, wie die Götter und die Affen zusammen eine Brücke bauen, um nach Lanka zu gelangen. Natürlich kann man sehen, wie Hanuman die ganze Stadt in Brand steckt, wie Rama seine Frau Sita zurückgewinnt, wie sie siegreich in die Stadt Ayodhya zurückkehren nach vierzehnjährigem Exil. Wie Rama an Sitas Unschuld zweifelt, wie ihre Mutter, die Erde, ihre Hilferufe hört, sie zurück zu sich nimmt. Wie Sita in die Erde hinabtaucht.
Schwarze Wolken mit goldenen Umrissen liegen am Abgrund des Flusses. Meine grosse Mutter lehnt sich an einen Felsen.
„Grossmutter, nimmst Du mich ins Kino mit?“
”Dein Grossvater Ashan wird es nie erlauben. Kino meint er, ist Teufelswerkzeug. Und ich habe so wenig Geld. Vielleicht begleitest du mich nach Trichur. Dort könnten wir ins Kino.”
Für einen Augenblick scheint meine grosse Mutter glücklich zu sein.
”Aber Trichur ist sehr weit. Zwei oder drei Tagesreisen. Und wie soll ich, eine gebrechliche Frau ...”
Plötzlich scheint sie an ihrem Vorhaben zu zweifeln.
”Warum willst Du nach Trichur, Grossmutter?”
Meine grosse Mutter schweigt lange.
”Musst du denn alles so genau wissen?”
Am Tag der Erstkommunion muss ich leiden. Die 'Dhoti', die Grossvater Ashan mir geschenkt hat, ist zwar schön, aber ich kann sie unmöglich tragen. Ich habe nie eine 'Dhoti' getragen. Um dieses lange Tuch an den Hüften zu befestigen, muss man tief Luft holen, das Tuch um den Körper wickeln und festbinden, dann ausatmen. Aber jedes Mal wenn ich ausatme fällt es zu Boden. Es ist mir sehr peinlich, mehr als peinlich, denn unter der Dhoti trage ich keine Unterhosen. Wir Kinder haben keine Unterhosen. Deshalb begleitet mich meine grosse Mutter auf Schritt und Tritt.
Ich bemühe mich, meinen Atem so lange zu halten, wie es mir nur möglich ist. Zu allem Unglück haben die Nonnen ausser der Pappkrone auch noch jedem Kind einen kleinen Blumenstrauss in die Hand gedrückt. Papierblumen. Ich halte den Blumenstrauss in der Hand und kann es nicht mehr verhindern, dass meine Dhoti wie ein Vorhang herunter fällt. Ich schäme mich für meinen "Kleinen Vogel".
Mein Leiden wird beim Empfang des Bischofs noch grösser. Er wird uns nicht nur die Erstkommunion erteilen, sondern auch das heilige Sakrament der Firmung spenden. Seine Limousine ist recht gross und kann nicht auf dem Landweg zu unserer Kirche gefahren werden. Der Bischof wird deshalb am gegenüberliegenden Flussufer vom Vikar empfangen. Sein teures Auto sehen wir am Strassenrand, wo er vom Dorfvikar empfangen wird. Solche Autos gibt es nicht in Indien, flüstern meine Nachbarn.
Der Bischof kommt zu uns, in einem hölzernen Kanu über den Fluss gleitend. Mit seinem Hirtenstab und seiner goldenen Krone. Die Nonnen teilen uns Kinder in zwei Reihen auf, die Knaben auf der einen Seite eines langen, aus Kokosfasern hergestellten Teppichs, die Mädchen auf der anderen Seite. Das Bewegen mit der unsäglich langen 'Dhoti' auf dem Sand bereitet mir Mühe. Sie rutscht mir immer wieder nach unten. Meine Kameraden kichern. Die Mädchen kichern. Die Nonnen kichern.
Während der Kommunion rutscht mir die Dhoti hundertmal vom Leib. Hundertmal steht meine grosse Mutter neben mir. Sie verdeckt meinen kleinen "Vogel" mit ihrer Hand. Sie schützt mich vor den neugierigen Blicken der Nonnen, den feindseligen Augen des Vikars, der finsteren Miene des Bischofs. Meine Krone bewahrt sie nach der feierlichen Messe auf. Sie hängt sie an eine Wand in unsere Hütte, hoch über das Herzjesubild, damit Babu, mein Bruder, sie nicht wegnehmen kann. Damit auch meine Mutter oder mein Vater sie nicht wegnehmen können.
Die Reisernte muss bewacht werden. So schlafen meine grosse Mutter und ich auf der Veranda unserer Hütte mit Blick auf die Reisfelder am Südhang unseres Grundstücks. Ihr Körper ist warm, ihre Brüste sind weich, ihre Arme halten mich fest.
"Ich muss nach Trichur fahren. Du musst mit mir kommen. Ausser dir gibt es niemanden, den ich um Hilfe bitten kann", flüstert sie mir ins Ohr.
Sie erzählt mir von einer Liebe, einer unerlaubten Liebe, noch vor ihrer Reise nach Malabar. Vor dreissig Jahren.
"Mein ältester Sohn, ‘der General’, war vier Jahre alt, meine erste Tochter zwei. Ashan kam selten nach Hause. Er lebte einzig für seine Kirche. Ich lebte mit seinen Eltern. Er hatte eine wunderbare Mutter. Sie strahlte so viel Wärme aus, sie war eine grosszügige Frau, eine feine Frau. Ashan habe ich nur ihretwegen geheiratet. Meine Eltern waren von der Familie Ashans begeistert. Mit zwölf Jahren konnte ich nicht anders entscheiden, als meine Eltern es wollten. Ich wusste nicht, was die Ehe sein sollte. Ich hatte keine Ahnung. Die Jahre vergingen. Ich war etwas älter geworden, älter als zwanzig, lebte ohne Ashan. Während der Ernte lebte mit uns ein jüngerer Mann, ein guter Mensch, ein gewöhnlicher Tagelöhner. Er liebte mich. Ich liebte ihn. Er war der einzige Mann, den ich je liebte. Meine Schwiegereltern merkten nichts. Niemand ahnte etwas. Es war eine kurze Zeit des Glücks. Eine sehr kurze Zeit des Glücks.”
Es regnet. Der erste grosse Regen des Monsuns. Natürlich hat es einige Male zuvor geregnet. Aber dies ist der Monsunbeginn. Der Regen trommelt auf das Dach aus Palmenblättern. Hagelkörner bahnen sich ihren Weg durch die Blätter, hinein in die Hütte. Grossmutter drückt mich enger an ihren Körper. Wir bedecken uns mit einem dünnen Tuch, schützen uns vor den Hagelkörnern, vor dem Nieselregen, den der Wind in die Hütte hineinbläst.
”Dann wurde ich schwanger. Lange konnte ich die Liebe und die Schwangerschaft nicht verheimlichen. Ich war verzweifelt. Die Eltern von Ashan schickten mich zurück zu meiner Familie. Nach der Niederkunft holte mich Ashan zurück. Aber das aussereheliche Kind wollte er nicht. Das Kind eines Moslems. Er wollte es nicht mal sehen. Seine Familie schickte den Tagelöhner mit unserem Kind fort. Sie gaben ihm etwas Geld, kauften sein Schweigen, baten ihn wegzugehen. Um meine Schandtat zu verheimlichen, wanderten wir, sobald wir nur konnten, nach Malabar aus.”
Babu, mein Bruder weint. Er hat Bauchweh, ein wenig Durchfall.
”Er will nur meine Krone”, flüstere ich meiner grossen Mutter zu.
”Er ist ein guter Schauspieler, aber wir geben ihm deine Krone nicht!” beruhigt mich meine grosse Mutter.
Wann ist Grossmutter zuletzt in Trichur gewesen? Wann hat sie dieses andere Kind zuletzt gesehen? Gehört auch dieses Kind zu unserer Familie?
"Ich war nie in Trichur, Sohn. Ich habe mein Kind nie wieder gesehen. Ich wollte ihn wieder sehen. Ich wollte sehr. Aber Ashan sagte, es sei schon Schande genug. Dein Grossvater hat stets mit Priestern gelebt. Was wissen sie denn von der Liebe? Der Vikar sagte ihm, die Liebe eines Christen zu einem Moslem sei keine Liebe. Keine wahre Liebe. Ein Christ darf niemals einen Moslem lieben, nie einen Moslem heiraten. Eine Todsünde sei das. Einundzwanzig Sonntagsmessen, eine feierliche Liturgie. So viel Geld solle er auftreiben zur Rettung meiner Seele. Ich habe meinen Sohn nie mehr gesehen. Ausserdem ist er kein Kind mehr. Er ist älter als dein Vater, hat selbst ein siebenjähriges Kind, ein Mädchen. Ich weiss nicht, wie er heute aussieht. Nur so viel, wie in diesem Brief steht. Er ist Rikschafahrer in Trichur. Wir müssen nur dahin. Ich werde ihn finden. Ich habe etwas Geld in meiner Kürbisschale gespart, ohne dass es dein Vater weiss, ohne Ashan.”
Da mein Grossvater sich seit Jahren nicht mehr um seine Familie kümmert, übernimmt Vater allerlei Verantwortung. 'Der General', der älteste Sohn meiner Grossmutter, ist irgendwo nahe Ladakh, hoch oben in den Himalayabergen. Er schreibt, er sei zweitausend Meilen fern von zu Hause. Vater und Grossmutter sind für alles verantwortlich, die Ernte, die Heirat meiner Tante Aelikochu, die Erneuerung der Hütte. Vater allein aber behält alles Geld. Auch das Geld, das 'der General' regelmässig nach Hause schickt, erhält er. Grossmutter muss einzelne Münzen von ihrem Sohn stehlen, ohne dass er dies merkt. So hat sie im geheimen Münzen auf die Seite gelegt, über Jahre hinweg, in ein winziges Taschentuch gewickelt, begraben unter schwarzen Pfefferkörnern, in der Kürbisschale.
Der Regen dauert bereits einige Tage. Unsere Reisernte droht in der Sintflut unterzugehen. Die schweren goldenen Spitzen der Reispflanzen biegen sich zur Erde. Nur ein kleiner Teil der Ernte befindet sich über Wasser. Der Rest liegt mit Schlamm vermischt darunter. Eine Horde Wildschweine ist nachts durch das kleine Reisfeld marschiert, die Pflanzen zertrampelnd, sich im Schlamm wühlend. Die Reisernte ist mit Sicheln nicht mehr herauszuschneiden. Bereits früh am Morgen sehe ich meinen Vater und die kleine Rose. Sie stehen fassungslos am Rande des Feldes im Nieselregen.
Mein Bruder Babu hat Durchfall. Immer wieder Durchfall. Er hat seit einigen Tagen Durchfall. Einen Arztbesuch kann Vater sich nicht leisten. Einen Arzt findet man erst in Iritty. Das Krankenhaus liegt nahe Kannur. Weit weit weg. Meine Mutter hat ihm Blätter eines Baumes in den Joghurt gemischt. Grossmutter gab ihm zuletzt eine Kräutermischung. Heute ist sein Durchfall besonders schlimm. Mutter muss unsere Kleider waschen. Sie hat viel zu waschen. Insbesondere die Kleidung meines Bruders. Nichts trocknet. Die Sonne scheint kaum noch. Ich bin allein zu Hause und muss auf ihn aufpassen. Es regnet und regnet und regnet.
Meine kleine Mutter wäscht unsere Kleidung beim Brunnen unterhalb unseres Hauses, denn nur im Brunnen ist noch klares Wasser zu holen. Vater, Aelikochu, meine Tante und meine grosse Mutter stehen knietief im schlammigen Wasser und schneiden mit ihren Sicheln die Reisernte. Obwohl sie zwischendurch in die Hütte kommen, sind sie mit ihrer Arbeit so beschäftigt, dass ich fast den ganzen Tag auf meinen Bruder aufpassen muss. Sein Durchfall nimmt kein Ende. Wieso hört sein Durchfall nicht endlich auf? Wenn er weint, gebe ich ihm meine Krone. Nur kurz. Ich will nicht, dass er sie beschädigt. Ich will nicht, dass er sie für sich behält.
Der Regen scheint meine grosse Mutter wenig zu stören. Auch der Schlamm nicht. Vater hat nicht so viel Geduld wie sie. Er glaubt, das, was die Schweine zertrampelt haben, sei für immer verloren. Aber meine grosse Mutter gibt nicht so leicht auf. Sorgfältig spannt sie die Reishalme einzeln im Schlamm und schneidet sie mit ihrer Sichel. Sie steht im Wasser, Seite an Seite mit unseren Nachbarinnen, Pathumma, und den zwei Schwestern Ragini und Chandini. Sie ist mit diesen Frauen befreundet. Sie sind oft bei uns zu Hause, sie helfen sogar im Haushalt. Meine grosse Mutter wiederum steht auch ihnen stets zur Seite. Es kümmert sie wenig, dass Ashan ihre Nähe zu diesen Frauen missbilligt. Denn Pathumma ist eine Muslimin, die Tochter des Lastenträgers Mustafa. Ragini und Chandini sind arme Hindus. Unberührbare[7]. Ich mag Pathumma, Ragini und Chandini. Die Freundinnen meiner Grossmutter sind auch meine Freundinnen.
Grossmutter sagt mir, dass diese Frauen mir besonders eng verbunden sind, mehr noch als meine Verwandten. Kurz nach meiner Geburt ist ein Missgeschick in unserem Hause geschehen. Beim Essen blieb meiner Mutter ein kleiner Knochensplitter im Hals stecken. Die kleine Rose musste in das Krankenhaus in Kannur gebracht werden, etwa fünfzig Meilen von zu Hause. Ich war nur zehn Tage alt. Die kleine Rose musste eine ganze Weile in Kannur bleiben. Für mich gab es keine Muttermilch. Wenn ich weinte, gab mir meine grosse Mutter ihre Brust. Aber sie hatte keine Milch. So trug sie mich zu unseren Nachbarinnen. Sie schützte mich vor der brennenden Sonne, trug mich in den Schatten der blühenden Kashewbäume zu Pathumma und Ragini. Sie haben mir ihre Muttermilch gegeben. Ich habe mit ihren Säuglingen die Milch geteilt. Ich denke, Pathumma, Ragini und Chandini sind auch meine Mütter.
Obwohl es donnert und kracht, hat der Regen deutlich nachgelassen. Meine grosse Mutter trägt den geernteten Reis hinauf zu unserer Hütte. Die nassen Bündel wiegen schwer auf dem Kopf, sind zudem nicht ganz fest, so sehr, dass ihr Gesicht unter der Last versinkt. Ihre Kleider sind nass und schmutzig vom Schlamm, sie kleben auf ihrem Leib. Meine grosse Mutter pendelt zwischen Hütte und Reisfeld, ein stiller Gang, dann eine Atempause, sie steigt erneut hinauf, ein weiteres Bündel zu tragen, soviel Last wie sie nur kann.
Am Ende des Tages ist die Familie beisammen. Vater ist zum Lebensmittelladen des ‘Kakkas’ geeilt und kommt erst zurück, wenn es Nacht wird. Mutter stillt das Baby. Meine Geschwister schreien nach Essen. Sie schreien nach Trinken. So ein Geschrei!
Nur Babu ist still. Seine Augen sind geschlossen. Meiner grossen Mutter kommt dies seltsam vor. Sie nimmt ihn in die Arme, streichelt ihn, spricht ihn an. Er öffnet kurz seine Augen. Aber eine Antwort gibt er nicht.
"Sohn, nimm Vaters Hemd und Dhoti, auch einen Schirm. Beeil dich.”
Ihre Stimme und ihr Gesicht verrät ihre Sorge. Ich sehe sie vor ihrem geheimen Kürbiskrug voll getrocknetem Pfeffer. Sie nimmt die gefalteten Rupien, auch ihre letzten Münzen, wickelt und knotet das wenige Geld an einem Ende ihrer Mundu.
"Kleine Rose, gib mir eine Hose für Babu, auch sein Hemd, schnell.”
Meine Mutter ist erschrocken. Meine Geschwister weinen. Meine Tante Aelikochu nimmt den Säugling zu sich. Mutter sucht ein Hemd für Babu, nimmt ihn in ihre Arme, ihre Lippen zittern, ihre Schreie füllen das Haus.
Meine grosse Mutter reisst Babu aus den Händen meiner Mutter, sie stürmt mit dem noch atmenden Kind den Berghang hinunter, über Pfützen und Steine, über den glitschigen Pfad zwischen den Reisfeldern, vorbei am Laden des Händlers 'Kakka', vorbei an der kleinen Kirche, den steilen Fussweg hinunter, dem dunklen trüben Fluss entgegen, dem Wald entgegen, der tiefen Nacht entgegen.
Mein Vater folgt ihr, auch ich folge ihr.
"Sohn, bleib zurück, geh zu deiner Mutter, geh zu der kleinen Rose. Geh, geh zurück!" zwingt mich meine grosse Mutter.
Ich sehe sie den Fluss durchwaten. Das Wasser ist nunmehr schwarz. Hier und dort ein silbriger Streifen. Meine grosse Mutter kann ihren Weg durch das Wasser nur erahnen. Sind ihre Schritte sicher auf den glitschigen Steinen? Ist der Wald nicht noch dunkler? Schleichen nicht Schlangen über die geteerte Strasse?
Das grelle Licht eines Lasters blitzt auf, verschwindet, erscheint wieder. Auf der kurvenreichen Strasse verschwindet es schnell wieder. Sie werden den Laster nicht aufhalten können. Wann wird der nächste kommen? Bis Koottu-Puscha sind es noch zwei Meilen. Aber ein Krankenhaus oder einen Arzt gibt es dort nicht, erst zehn Meilen weiter in Iritty. Ich kehre nach Hause zurück. Auch mein Weg ist dunkel. Nirgendwo ein Licht.
Vor Sonnenaufgang kommen sie zurück. Vater, Grossmutter und Babu. Noch vor Tagesanbruch sehen wir das schwache Licht in der Ferne. Es leuchtet auf, erlischt, leuchtet wieder auf. Meine grosse Mutter hat eine Taschenlampe kaufen müssen, gekauft in der kleinen Stadt Iritty. Vater trägt Babu in seinen Armen.
"Babu schläft", beruhigt uns meine grosse Mutter. Aber sie kann ihre Tränen nicht zurückhalten. Auch mein Vater weint. Meine Mutter fällt zu Boden.
Er schläft. Er schläft die ganze Zeit. Meine grosse Mutter hat ihn gebadet, mit Pathumma, Ragini und Chandini. Ashan wird benachrichtigt. Meine Tanten Mary, Kuttypennu, Peramma werden benachrichtigt. Sie alle werden kommen. Und während er schläft, wird er angezogen, mit einem frischen weissen Tuch bedeckt. Meine Mutter kämmt sein Haar. Vater weint, legt viele Blumen um ihn, er küsst seine Stirn. Vater gibt ihm meine Papierblumen. Babu rennt nicht weg, spielt nicht seine Streiche. Er lacht nicht mehr, er wird nie mehr lachen. Nie wieder. Niemand sagt uns Kindern, was wirklich geschehen ist. Aber ich, ich weiss es. Ich weiss es.
Hier und dort ein Niesen, ein Seufzer, ein verzweifelter Blick nach den Sternen. Meine grosse Mutter steigt auf einen hölzernen Hocker, klammert sich an ihre Kürbisschale. Plötzlich stürzt die Schale hinab, reisst ein paar weitere Krüge mit sich. Auch meine grosse Mutter fällt zu Boden. Und während ihre Freundinnen Pathumma, Ragini und Chandini die schwarzen Pfefferkörner vom Boden der Küche auflesen, während sie sich um zerstreute Nüsse und kopflose Sardinen kümmern, verbirgt Grossmutter ihren geheimnisvollen Brief, verbirgt ihren Schmerz, hüllt sich in Schweigen.
Tief in der Nacht, wenn auch die hellsten Sterne hinter Wolken begraben sind, sehe ich meine grosse Mutter neben dem leblosen Knaben. Sie nimmt den zerknüllten Brief, legt ihn unter den Kopf des Schlafenden, versteckt auch ihr leeres Taschentuch unter den Blumen. Dann nimmt sie mich beiseite und flüstert mir zu.
”Ich habe meine letzten Münzen für den Arzt ausgegeben. Aber er konnte ihm nicht mehr helfen. Babu geht auf eine lange Reise. Eine sehr lange Reise. Nun vertraue ich ihm meinen Brief an. Auch mein löchriges Taschentuch. Sie nutzen mir nichts mehr. Nichts mehr!"
Meine grosse Mutter weint leise, sehr leise.
"Kurz bevor dein Bruder starb, fragte er nach deiner Krone. Er hat sie so sehr gewünscht.”
Für einen Augenblick lausche ich dem Regen. Der Monsun ist ein schlimmer Wasserfall. Der Monsun ist ein nie endender Wasserfall, Tränen trauriger Wolken, von hochoben, vom Himmel.
"Willst du sie ihm jetzt nicht geben, deine Krone?”
[1] weisse Bluse mit längen Ärmeln
[2] weisses Tuch
[3] Vater
[4] Schnaps
[5] Palmwein
[6] Vernichtung der Stadt Lanka durch einen Brand (aus der indischen Mythologie)
[7] Menschen der niedrigsten Kaste

Alles finster. Alles feucht. Eine dunkle feuchte Küche, pechschwarze Töpfe, dorniges feuchtes Brennholz. Allein wo sich der abgemagerte Hund über Nacht hingelegt hat, in einer Ecke voller Asche ist es halbwegs warm. Der Regen ist durch das Strohdach auf die Erdwände hinuntergesickert, auf die Veranda, in die Küche, in die ganze Hütte. Das Gras auf dem Dach ist abgenutzt, einzelne Grashalme vom Wind weggetragen. Durch unzählige Spalten, durch hundert Lücken, schaut ein finsterer Himmel auf die Kleine Rose, auf ihre schlafenden Kinder herab.
Kräftigt pustet die Kleine Rose in ein kleines Feuer, bringt einzelne Holzsplitter zum Glühen. Und während ihre Kinder sich nach und nach um das Feuer versammeln, stellt sie einen Tonkrug auf den eisernen Kochherd, kocht ein Ei. Ein einziges Ei, vom Vortag aufbewahrt und nur für Vater bestimmt, weichgekocht, wie er es sich wünscht. Und sobald Vater auf seinem Bett Platz nimmt, eilen die Kleinen zu seinen Füssen. Sie scharen sich um seinen Thron, schmiegen sich aneinander, schenken einander Wärme, warten hoffnungsvoll.
Vater sticht ein winziges Loch in das weichgekochte Ei, streut eine Prise Salz hinein, eine Prise dies, eine Prise das, schliesst die kleine Öffnung mit seinem Daumen. Und während seine Kinder das tägliche Ritual bewundern, zu seinen Füssen ausharren, schüttelt er das Ei. Schüttelt es eine Ewigkeit hin und her. Dann blickt er hinauf zum Dach, hebt auch das Ei, saugt und schlürft das weiche Innere aus.
”Es ist bitter, es ist Medizin. Der Arzt hat es mir verordnet:”
Er besänftigt das kleinste seiner Kinder. Und wenn er das Ei fast völlig ausgesaugt hat, erweitert er die kleine Öffnung mit der Spitze seines Fingernagels, überlässt es den Kleinsten. Das Kleine steckt seinen Finger hinein, kostet, noch bevor seine Geschwister ihm die Schale streitig machen. Meine Geschwister schnappen nach dem Ei. Die Schale bricht. Ein neuer Tag bricht an.
Mutter Rose holt Wasser. Mutter Rose macht uns Kindern das Frühstück. Mutter Rose stillt Celine. Und noch bevor Vater sich über irgendetwas beklagt und sie beschuldigt, sie beschimpft, steht sie hoch über den nahen Hügeln, an seiner Seite. Mein Vater schneidet goldene Grashalme, meine Mutter, die Kleine Rose, macht daraus kleine Bündel. Ihre Arbeit ist hart, die Grashalme sind heimtückisch. Die Sträucher zwischen den Grashalmen sind voller Dornen. Sie verursachen Juckreiz, schneiden tief in die Haut hinein.
Trotz allem freut sich die Kleine Rose. Mit dem gesparten Geld hat Vater drei Hektar Land in einem neuen Dorf gekauft. Weg von der Familie Ashans, weg von der Schwiegermutter, weg von den hochnäsigen Schwägerinnen. Endlich hat die kleine Rose ihre eigene Hütte, ihre eigenen vier Wände, ein eigenes Dach. Zwar steht die Hütte da, mit nackten Wänden, mit gähnenden Löchern in den Wänden, mit einem Dach so löcherig wie Ashans Schirme.
Das lange Gras auf dem Dachgerüst muss dringend erneuert werden. Alles andere kann schon warten. Vater und die kleine Rose binden mehrere kleine Bündel Gras mit Seilen zu einem viel grösseren zusammen. Sie müssen mit aller Kraft an den Seilen ziehen, sonst lockert sich das grosse Bündel beim Heruntertragen. Sie binden mehrere grosse Bündel fest, sehr viel Gras ist nötig für das Dach.
Die neue Hütte befindet sich in einem Tal, etwas abseits des Flusses am Strassenrand. Sie besteht aus einem einzigen Zimmer, und einer angrenzenden Küche. Auf drei Seiten gibt es je eine gedeckte Veranda, geschützt durch dünne Wände aus grobgespaltenem Bambus. Auf der vorderen Veranda steht eine einsame Holzbank, leicht gebogen, die Ecken und Kanten abgenutzt, auf Besucher wartend. Die Axt, die Sichel, die Spaten stehen auf dem Flur der hinteren Veranda am äusseren Rand der Hütte. Unsere Ton-, Aluminium- und Kupferkrüge stehen auf der glitschigen kleinen Veranda neben der Küche. Der Regen drängt durch undichte Stellen im Dach, nässt die Wände, fliesst durch unser Wohn-Ess-Schlaf-Arbeits-Kinder-Zimmer. Auch durch die kleine Küche.
Ich beneide unseren Hund, denn er schläft in der warmen Asche neben dem Kochplatz. Vater beansprucht ein eigenes Bett. Unser einziges Bett. Mutter Rose und wir Kinder schlafen dicht beieinander auf dem rumpeligen Erdboden. Gewöhnlich decken wir uns mit einem langen Sari der kleinen Rose. Manchmal weckt uns das Quieken verängstigter Mäuse. Sie warnen uns vor Schlangen, die ihre Nester im Strohdach aufsuchen. Wenn es regnet, rücken wir enger zusammen, lassen das unaufhaltsame Regenwasser seinen Weg bahnen. Wo es nur so tropft, stellen wir einzelne Schüsseln bereit. Im Takt der Regentropfen wiegen wir uns in den Schlaf.
Die Hütte mag klein und bescheiden sein, aber sie liegt nahe an der einzigen Hauptstrasse. Eine geteerte Strasse, die die zwei Bundesstaaten Kerala und Mysore verbindet. Täglich fahren mehrere Busse diese Strecke entlang, die meisten von Koottu-Puscha nach Kannur und in die entgegengesetzte Richtung bis tief nach Mysore. Mit dem zunehmenden Verkehr steigen auch die Bodenpreise. Vater und Mutter haben vor einem Jahr das kleine Grundstück für neunhundert Rupien gekauft, und bereits spricht man von zweitausend Rupien für denselben Boden. Dreizehn Jahre lebte die Kleine Rose am Waldrand, war die letzte Stimme im Hause Ashans, war das eingeheiratete Miststück, das ohne Mitgift kam.Und nun, endlich ist sie Herrin in den eigenen vier Wänden.
Am Nachmittag tragen wir das Gras den Berghang hinunter. Man kann nicht alles Gras an einem Tag hinunterbringen. So lassen wir viele grosse Bündel unter freiem Himmel liegen. Aber niemand wird sie wegnehmen. So abgelegen und schwer erreichbar ist die Bergspitze. Vater trägt das grösste Bündel. Mutter Rose und ich tragen etwas kleinere Bündel.
Mutter Rose ist sehr klein. Mit dem Riesengrasbündel auf ihrem Kopf sieht sie noch kleiner aus als sie ist. Dabei sind Mutter und ich gleich gross. Vater behauptet, eines Tages werde ich so gross sein wie er. Vater eilt den Berg hinunter. Mutter Rose kann nicht mit ihm Schritt halten. So liegen wir zurück. Zu meinem Glück. Ich bin so selten mit meiner Mutter allein. Auch sie freut sich. Sie blickt hinunter zum Fluss, der sich durch das Dorf dahin schlängelt.
"Ich bin froh, dass du den Fluss nicht überqueren musst, um in die Schule zu gehen. Bald wirst du zwölf!”
”Kleine Mutter, wann werde ich zwölf?”
Meine kleine Mutter zögert.
”Laut unserem Kalender, am sechzehnten des Monats Kumbam. Was das für ein Datum ist, musst du Grossvater Ashan fragen.”
”Feiern wir meinen Geburtstag?”
Sie hält kurz ein, sieht mich verwundert an.
”Wie denn?”
Ich darf mir keine allzu grossen Hoffnungen machen. Denn Geburtstage feiern wir nicht. Ein Erntefest feiern wir nicht. Nur Ostern.
”Der Sohn unseres Schuldirektors hat ein neues Hemd zum Geburtstag erhalten.”
Die Kleine Rose stützt sich an einen Baumstamm, steigt eine Stufe hinunter, die Last bringt ihre Beine zum Zittern. Sie bleibt stehen, atmet tief, lächelt mich an.
”Was wünschst du dir denn?”
”Ein Ei. Eins für mich allein. Ein hartgekochtes Ei.”
Sie macht ein paar Schritte, schweigt, steigt hinunter.
”Ich schenke dir ein Ei. Aber niemandem ein Wort davon sagen. Niemandem! Ich kann unmöglich deinen Geschwistern, jedem einzelnen, ein Ei schenken. Sag deinem Vater auch kein Wort davon!”
Der schmale Pfad ins Tal hinunter ist unwegsam. Herunterhängende Äste. Herausragende Wurzeln. Herumliegende Steine. So halten wir immer wieder an. Holen immer wieder tief Luft. Unter den riesengrossen Bündeln sind wir klein. Bedeutungslos.
”Mutter, meine Freunde haben Briefe von Missionaren erhalten. Missionare, die vor einem Monat in unser Dorf kamen. Sie haben Alex und Tony Bilder geschickt. Bilder der Jungfrau Maria, auch Postkarten.”
Mutter Rose hört alles genau an, schiebt einen Ast von sich weg, weicht einem Felsbrocken aus.
”Schreib du auch den Missionaren. Vielleicht schicken sie dir ja auch Bilder. Aber schreib ein paar Zeilen in den Brief deiner Freunde hinein. Vater gibt dir keine einzige Münze für Briefmarken.”
An einem sonnigen Tag begleite ich die Kleine Rose zum Brunnen. Zwar befindet sich unsere Hütte in einem Tal, aber auf einem kleinen Hügel, ein Hügel so rund wie die obere Seite eines Regenschirms. Auf unserem Hügel gibt es keinen Brunnen. Trinkwasser, Wasser überhaupt, muss von dem Brunnen des Nachbarn geholt werden, auf dem Kopf nach Hause getragen, und das mehrmals täglich.
Auf unserem Grundstück stehen vereinzelt ältere Kaschew-Bäume, einige Mangobäume, einzelne Teakbäume. Dazwischen wächst nichtsnutziges, kopfhohes 'Kommunistenkraut'. Man kann das Land für den Ackerbau schlecht nutzen, denn es fehlt an Wasser. In den nächsten Tagen werden wir die Sträucher abhacken und verbrennen, wir werden neue Bäume pflanzen und sie bewässern. Wir müssen sie bewässern. Das Wasser müssen wir zu den kleinen Bäumen tragen, sehr viel Wasser, während der nächsten Jahre.
Kann meine kleine Mutter Rose alleine so viel tragen? Sie muss das Wasser fast alleine tragen, denn Vater muss soviel hacken und graben, und wir Kinder müssen zur Schule.
Unser Weg ist schmal, vom Unkraut hastig beseitigt, eine kleine Steigung bis zum Hügel hinauf, dann flach abfallend bis zum winzigen Bach. Der Brunnen steht neben dem Bach, eine wahre Oase in der Wildnis, im Schatten grossgewachsener Arecca-Palmen. Er steht im kühlen Schatten, die Palmen sind dünn und ragen hoch hinauf, dicht nebeneinander. Ihr Laub ist tiefgrün. Vom Himmel sieht man nur wenige kleine Flecken. Mutter Rose hat bereits mit den Nachbarinnen Freundschaft geschlossen. Der Brunnen ist ihr Treffpunkt, hier ruhen sie sich von den Sorgen des Alltags aus, hierhin flüchten sie, um zu träumen. Aber heute ist niemand da.
”Wie viele Tage sind es noch bis zu meinem Geburtstag?”
”Ich sage es dir, wenn es so weit ist!”
”Bestimmt vergisst du den Tag! Bestimmt! Wieso haben wir denn nie Geburtstage gefeiert?”
”Ich vergesse nie deinen Geburtstag”, tröstet sie mich.
”Und wieso haben wir nie einen Geburtstag gefeiert?”
“Denk mal selber nach!”
Ich betrachte sie, wie geschickt sie das Wasser aus der Tiefe des Brunnens mit einem Seil und einem Eimer herausholt.
"Vom Wassertragen wirst du sterben!”
"Nein, nein”, lacht sie.
"Das ist mein Schicksal, viel zu tragen, davon werde ich nicht sterben."
Meine Mutter ist hübsch, wenn sie lacht. Sie ist zwar kleiner und viel dunkler als Vater, aber schön und viel lustiger. Eine geborene Schauspielerin dazu! Nicht ganz. Denn sie kann ihr Lachen kaum beherrschen, wenn sie Grossvater Ashan nachmacht. Wie er die Kerzen anzündet. Wie er vor dem Vikar hinkniet. Wie er die Glocken läutet. Oder wenn sie den Vikar beim Gebet imitiert. Wie er seinen wässrigen Mund bewegt, während er mit neugierigen Augen hübschen Nonnen nachguckt.
Eigentlich gehört die Kleine Rose zu uns Kindern, denn sie spielt unsere Streiche mit, ist immer auf unserer Seite. Sie verteidigt uns gegen Vater, wenn uns Sachen verloren gehen.
"Das Heft wurde ihm gestohlen, was kann das arme Kind dafür", fragt sie, auch wenn sie weiss, dass ich das Heft in der Schule liegengelassen habe. Die kleine Rose ist ein Kind. Sie spielt wie ein Kind, lacht wie ein Kind, weint wie ein Kind. Dabei ist sie zweiunddreissig Jahre alt und hat "sechs Kaulquappen zur Welt gebracht", wie sie mir immer wieder sagt.
Den grossen Kupferkrug voll Wasser hebt sie ganz allein auf den Kopf. Dazu stellt sie ihn zunächst auf ihr linkes Knie und mit einer schwungvollen zweiten Bewegung auf ein gewundenes Tuch, das sie auf ihrem Kopf trägt. Der schwere Krug bringt ihre Adern zum Vorschein, ihr Hals und Kopf gleichen die Bewegungen des Wassers aus. Ganz allein den Krug auf den Kopf zu hieven, ist eine Kunst, denn trotz aller Mühe schwappt immer etwas Wasser über den Rand. So rinnt es über ihr Gesicht, über ihre gelbe Bluse und über ihren gefalteten Sari.
Da Mutter sehr klein ist, bedeutet der Kupferkrug voll Wasser eine enorme Last für sie. Aber um sich einen zweiten Weg zum Brunnen, Hin- und Rückweg zu ersparen, hat sie einen weiteren, kleineren Krug mit Wasser gefüllt, den ich ihr auf den ersten Krug stellen muss. Dazu kniet sie sich ein wenig nieder, erhebt sich wieder, ihre Knie zittern dabei. Sie holt tief Luft und geht den Weg zurück zur Hütte. Ich folge ihr mit einem kleineren Krug auf meinem Kopf und einem Eimer voll Wasser in der rechten Hand.
Schade, dass wir nie einen Geburtstag feiern. Oder den Hochzeitstag meiner Eltern. Schade, dass wir nicht mehr Hühner haben, nicht genügend Eier, nie das nötige Geld. Zwar züchtet die kleine Rose Hühner, Raubvögel aber lauern auf die Küken. So haben wir stets die gleiche Anzahl Hühner. Die dummen Vögel liefern meist nur ein einziges Ei am Tag. Dieses eine Ei isst Vater. Mutter Rose rechtfertigt Vaters Privileg. Er arbeite auf dem Feld. Seine Hände bräuchten viel Kraft. Er leide unter Schwächeanfällen. Allein von Tappiocca-Wurzeln und eine Handvoll Reis könne er nicht leben, den harten Boden nicht auflockern. Sieben hungrige Mäuler nicht stopfen. Wie wird Mutter Rose mir ein Ei zum Geburtstag schenken, ohne dass meine Geschwister es merken? Ohne dass es Vater weiss?
Der Aufstieg zur Hütte ist mühsam. Zwar ist der Weg nicht steil aufwärts angelegt, dafür ist er mit unzähligen Hindernissen übersät. Über Steine und Baumwurzeln geht die Kleine Rose vorsichtig hinweg. Sie muss sich bei tiefstehenden Ästen immer wieder tief bücken und sich aufrichten, was ihr mit einem schweren, sich dauernd in Bewegung befindenden Krug Mühe bereitet. Auch schwappen die kleinen Wellen im Krug hin und wieder über ihr Gesicht, nässen ihre Kleidung. Manchmal hebt sie, sofern die Kräfte ihrer kleinen Hände dafür ausreichen, einen Ast etwas höher, damit ich ihn, ohne mich zu bücken, passieren kann.
Nachdem sie den kleinen Hügel hinaufgestiegen ist, geht sie die letzte Strecke hinunter zur Hütte noch vorsichtiger. Sie wartet, bis ich ihr den kleineren Krug abnehmen kann. Sie wartet, bis ich ihr helfe, auch den grösseren Krug auf den Boden zu stellen. Danach nimmt sie das gewundene Tuch vom Kopf, entfaltet es, trocknet sich das Gesicht, setzt sich auf den Boden der Hütte. Sie holt Luft, holt tief Luft, trocknet mit ihren zärtlichen Händen mein Haar.
Die Kleine Rose hat ein rundliches freundliches Gesicht mit ein paar kleinen runden Flecken, verursacht durch Pocken aus der Kindheit. Schade, dass ihre Haut so dunkel ist, dass sie so viel kleiner ist als Vater. Ihre Schritte sind kurz, und wenn sie mit meinem Vater sonntags zur Kirche geht, befindet sie sich immer weit hinter ihm. Dann schaut Vater sie verärgert an, er beschimpft sie manchmal, doch sie gibt nie klein bei. So entstehen die meisten Streitereien. Oder auch wegen der verspäteten Mitgift.
Manchmal sagt Vater, dass ihre ganze Familie dumm sei, dass Rose gar nicht denken könne, dass im Kopf der Kleinen Rose nur Hühnermist wäre. Dabei ist sie bis zur achten Klasse zur Schule gegangen, kann lesen und schreiben und sonst so viele Dinge tun, was Vater nicht kann. Sie kann Schafe oder Affen aus nasser Erde formen, auch gut zeichnen und vor allem Leute imitieren. Vater. Grossvater Ashan. Indira Gandhi.
Ich betrachte die Kleine Rose, wie sie zum Dachboden mit Hilfe einer Bambusleiter hinaufsteigt, das kostbare Ei aus einem Korb herausholt. Kleine Ritzen sind in den trockenen Stamm hineingeschnitten, winzige Flächen, auf denen ihre Zehen ruhen, um hinaufzuklettern, herunterzusteigen. Mit der einen Hand klammert sie sich an den Baumstamm, mit der anderen umklammert sie das Ei. So wie Jesus in Ashans Kirche einen winzigen Globus umklammert. Wenn die Kleine Rose von der wackligen Leiter herabstürzen würde, wenn sie das Ei fallen lassen würde, wenn... Vater würde die Kleine Rose zu Tode prügeln, so lange bis sein Rattanstock zusammenbricht, bis unsere Hütte zusammenkracht, auch der Himmel.
Wenn die Kleine Rose nur schweigen würde! Wenn sie Vater nicht dauernd widersprechen würde! Wenn sie nur nicht streiten würde! Manchmal hat sie schon recht, aber manchmal eben auch nicht, und mit Vater sich so anzulegen, bringt nur Prügel. Wozu denn? Meistens war Grossmutter dazwischen oder die Tanten oder Ashan. Aber da wir jetzt ein eigenes Zuhause haben, wer soll Vater je aufhalten? Wer soll Vater zur Vernunft bringen? Und was, wenn er mit der kleinen Rose wieder über die Mitgift streitet?
”Ich hasse Vater, wenn er auf dich los schlägt. Ich hasse ihn, wenn er dir weh tut. Ich werde ihn..."
”Sag nie so etwas über deinen Vater! Nie! Hörst du?”
"Wieso hat dein Vater Miniaachan die Mitgift nicht früher bezahlt?”
“Natürlich hat er sie bezahlt! Mein Vater sollte sechs Monate nach meiner Hochzeit Ashan ein Kalb als Mitgift bringen. So war die Abmachung zwischen Ashan und Miniaachan, denn sie hatten die Entscheidung getroffen, wie es sich gehört. Und mein Vater hat sich an die Abmachung gehalten, obwohl die Zeiten schwierig waren.”
Miniaachan, mein Grossvater mütterlicherseits, war mit seiner Familie, zwei Jungen und fünf Mädchen, nach Malabar ausgewandert, aus dem kleinen Königreich Travencore. Kurz nachdem sein letztes Kind zur Welt gekommen war, war seine Frau plötzlich gestorben. Ich habe Grossmutter mütterlicherseits nie gekannt. Mutter ist die zweitjüngste ihrer Familie.
Die Familie meiner Mutter liess sich in Peravoor nieder, auf einem kleinen Grundstück, inmitten einem grünen Meer von Reisfeldern. Ausser ein paar Kälbern und den dummen Ochsen besass die Familie nichts. Miniaachan hatte kein Ackerland, er verdiente sein tägliches Brot damit, die Reisfelder anderer rings umher zu pflügen. Auch seine Söhne lernten mit Ochsen und Pflug umzugehen. Die älteren Mädchen säten, pflanzten und ernteten den Reis. In den Sommermonaten, wenn die Erde ganz ausgetrocknet war und die Felder breit und flach dalagen, übersät mit fischschuppenartiger Kruste, schlugen sie diese mit hölzernen Hämmern, damit Grossvater Minaachan und seine Söhne die Erde wieder bewässern, sie mit nackten Füssen kneten konnten, butterweich und empfänglich für neues Saatgut.
Die Kleine Rose hatte das Privileg, zur Schule zu gehen, noch Kind zu sein. In den schlammigen Reisfeldern zu spielen, Heuschrecken und Insekten nachzuspringen, ihre Schwestern nasszuspritzen. Auch ihren Brüdern und ihrem Vater kleine Streiche zu spielen, ohne dafür bestraft zu werden. Denn sie wuchs ohne ihre Mutter auf, sie war noch sehr sehr klein. Auch als die kleine Rose mit zwanzig heiratete, war sie kaum erwachsen.
Sie gehe, erzählte ihr Miniaachan, zur Familie Ashan, einer friedlichen Familie, eine katholische, in der niemand selbstgebrannten ‘Arrak’ trank, niemand mit gezinkten Karten spielte und niemand um Geld pokerte. Ashan war fromm, las täglich aus der Bibel, besass als Sakristan Ansehen. Darüber hinaus noch sieben Hektar Land. Die Schandtaten meiner Grossmutter, ihre "Todsünde" kannte Miniaachan nicht. Auch plagte die Familie Ashan keine Geisteskrankheiten. Gründe genug für einen Bund zwischen beiden Familien, für die Ehe zwischen Vater und Mutter Rose.
Bei der Eheschliessung einigten sich Miniaachan und Ashan auf eine kurze Frist für die Lieferung der vereinbarten Mitgift. Aber Miniaachan hatte Mühe, vier Töchter hintereinander samt Mitgift aus der Familie wegzugeben. Es dauerte mehr als ein Jahr, bis er sein Versprechen einhalten konnte. Als Miniaachan endlich ein Kalb nach Koottu-Puscha brachte, waren die Beziehungen der beiden Familien bereits arg strapaziert. Und zu allem Unglück lag das Kalb tot unter einem Baum, sieben Tage nachdem Miniaachan es zu uns gebracht hatte.
“Dein Vater nahm es ihm übel, dass mein Vater selbst zu deiner Geburt nichts brachte. Deine grosse Mutter sagte, Miniaachan habe nur Kadaver geliefert, keine Mitgift. Ashan kam selten nach Hause, aber wenn er überhaupt nach Hause kam, äusserte er sich ebenfalls abschätzig über meinen Vater. Wer Ochsen herumführe, sei selber ein Ochse, sagte er. So viele Hiebe. So viele Stiche! Jedes Mal, wenn Miniaachan mich besuchte, hörte er alle diese Beschuldigungen, sie plagten ihn mit schmerzlichen Bemerkungen, er hörte sich immer alles schweigend an. Mein Vater nahm es auf sich, meine verlorene Ehre zu retten, sparte unendlich lange, bis er deinem Vater dreihundert Rupien übergab. Dreizehn Jahre nach der Ehe. Dreizehn schreckliche Jahre!”
Mutter eilt nochmals zum Brunnen, um im Bach zu baden, ihre Kleider zu waschen, noch einen letzten Krug Wasser für den kommenden Tag zu holen. Bevor sie Wasser aus dem Brunnen holt, baden wir unter einem Wasserfall etwas abseits des Brunnens. Himmelhohe Bäume thronen über dem Wasserfall. Das kühle Bergwasser stürzt von einem Felsvorsprung auf unsere Köpfe herunter. Durch das dichte Laub der Bäume dringen kräftige Sonnenstrahlen auf die feinen Wassertropfen, sie zaubern einen kleinen Regenbogen für die kleine Rose herbei.
Mit einem kleinen Tuch bekleidet, stellt sie sich in eine Nische des nassen schwarzen Felsens unter den donnernden Wasserfall. Mutter Rose stillt ihren Durst im klaren kühlen Wasser, auch ich stille meinen Durst. Sie wäscht meine Hosen, mein Hemd, auch ihre Bluse und den Sari. Danach legt sie die Kleidungsstücke abseits der kleinen Strömung zum Trocknen auf einen Felsen. Sie faltet ihre Arme über ihre Brüste, schützt sich vor den niederprasselnden Wassermassen, vor den Blicken der Tagelöhner, die auf einem Fusspfad oberhalb der Felsen an uns vorbeiziehen.
Ich habe von den Missionaren, wie meine beiden Klassenkameraden zuvor, ein rosarotes Bild erhalten, ein Bild der Heiligen Maria. Dem Bild liegt auch ein Formular bei, ein rosarotes Gesuchsformular für die Aufnahme in eine Missionsschule. Meine beiden Freunde haben sich bereits beworben, auch die Unterschrift ihrer Väter ist gesichert. Die Missionsschule liegt irgendwo weit weg in der Stadt, in Mysore oder Madras, rosarote Missionare leiten die Schule. Wer sich meldet, erhält eine erstklassige Ausbildung, alles in englischer Sprache. Danach werden wir an guten Universitäten weitergebildet, man kann bis ins Ausland reisen. Mutter Rose zeige ich das Bild und das Formular. Ich möchte mit meinen Freunden zur Missionsschule gehen, Englisch lernen, eine Universität besuchen, Wolkenkratzer sehen.
"Stell dir vor, Mutter, ich könnte sogar Lehrer werden.”
Sie nimmt mir das Formular weg.
"Vater lässt dich nicht gehen. Auch ich lasse dich nicht gehen. Du bist noch ein Kind! Und wer sonst soll Vater auf den Feldern helfen?"
Vater kommt mit einem kleinen Sack voll Proviant nach Hause. In einer Papierpackung bringt er Reis, in einer weiteren Packung getrocknete Sardinen, dazu noch eine winzige Packung schmutziger Salzkristalle. Mutter wäscht den Reis und stellt ihn auf eine improvisierte Feuerstelle, bestehend aus drei Lateritquadern[1]. Während der Reis kocht, reinigt sie auch die Fische und legt sie in ein kleines Bananenblatt. Das Salz schüttet sie in einen Tonkrug und löst es im Wasser auf. Es ergibt eine schmutzige Lösung, braun wie unser Fluss in der Monsunzeit. Nach einer Stunde giesst sie vorsichtig etwas geklärtes Salzwasser aus dem Krug in eine kleine Flasche. Den Rest schüttet sie in den Hinterhof.
Vor unserer Hütte wachsen Chilis der Sorte Kandhari. Meine Mutter trägt mir auf, einige rote einzusammeln. Bald darauf essen wir Reis, in arg gebeutelten Aluminium Tellern serviert, mit den scharfen roten Chilis und winzigen roten Zwiebeln, die Rose mit ihrem Daumen in wenig Salzlösung flachgedrückt hat. Während wir gierig das Reiswasser schlürfen, grillt sie eine Handvoll Sardinen auf der glühenden Asche. Einzeln zieht sie die kopflosen Sardinen aus der Glut und wirft sie fest auf dem mit Kuhmist geschmierten Boden der Küche. Dann nimmt sie die Sardinen in ihren schwarz geschmierten Händen, pustet den Staub weg und schenkt uns den heissbegehrten Fisch, den wir im Nu verschlingen.
Als es dunkel wird, kann ich mich von der Veranda der Hütte kaum trennen. Lastwagen, Busse und Autos fahren an unserer Hütte vorbei. Ihre Lichter werfen seltsame Schatten auf unsere Wände, Schatten grosser Bäume, Schatten wilder Palmen, seltsame Formen, die sich langsam vergrössern oder verkleinern und auf unseren Wänden tanzen. Die leuchtenden Augen der Fahrzeuge erscheinen durch die Reihen der Bäume, immer näherkommend, direkt auf unsere Hütte zu. Die Lastwagen fahren die kurvenreiche Strasse hinauf und hinunter, tief in die pechschwarze Nacht bis zum Arabischen Meer. Es ist warm in unserer Hütte, inmitten unserer vier Wände, umschwärmt von Glühwürmchen, unter unserem eigenen Himmel.
Heute soll ich auf der Veranda schlafen, bestimmt Vater. Ich lege mich auf ein paar Säcke aus Jute, die Mutter Rose für mich bereitgelegt hat. Ein weiterer mehrmals gefalteter Sack dient mir als Kopfkissen. Lange liege ich wach. Manchmal stehe ich auf, um im Scheinwerferlicht der Lastwagen komische Schatten auf die Wand zu zeichnen. Vater ahnt, dass ich nicht eingeschlafen bin, befiehlt mir, mich hinzulegen. Es werden immer weniger Autos, immer weniger Lastwagen, der letzte Bus von Kannur nach Koottu-Puscha ist bereits an der Hütte vorbeigefahren. Mutter Rose schaut einmal vorbei, ich halte meine Augen geschlossen, atme sanft und langsam, wie ein schlafendes Kind. Sie deckt mich mit einem Sack zu und geht in die Hütte hinein.
Ich höre Vater und die Kleine Rose flüstern, dann höre ich die gläsernen Armbänder von Mutter Rose klingeln, immer wieder höre ich die gläsernen Armbänder, das Knistern ihres Sari und den schnellen Atem meines Vaters. Danach flüstern sie wieder. Was flüstern sie einander zu? Vielleicht reden sie über das rosarote Formular, über die Missionsschule. Vielleicht reden sie über den kommenden Tag, über mein Geschenk. Über das kostbare Ei?
Die Kleine Rose beschmiert die Wände mit einer Mischung aus dickflüssigem Kuhmist und pulverisierter Holzkohle. Danach beschmiert sie auch den ganzen Boden der Hütte. In wenigen Minuten trocknet der Boden, in kürzester Zeit hat er sich von Schwarzgrün in Grau verwandelt. Vater dreht vier faustdicke Schrauben in den Boden der Küche, grenzt sie auf drei Seiten mit sauber geschnittenen Lateritsteinen ein. So nimmt auch unsere Küche Gestalt an. Die dicken braunen Schrauben hat Vater in dem eingestürzten Tunnel entdeckt, an einer Bahnlinie, die die Engländer einst gebaut hatten. Die Eisenbahnbrücke in Koottu-Puscha war kurz vor ihrem Abzug eingestürzt und es gab für die Engländer keinerlei Gründe, die Linie zu retten oder sie zu erhalten. Vier rostverfallene Schrauben blieben der kleinen Rose aus jener glorreichen Zeit erhalten.
Da wir dabei sind, das Dach der Hütte zu erneuern, nehmen wir die ganze Hütte auseinander. Beinahe. Ich habe mit meinem Bruder Thankachan gestritten, wir streiten fast täglich, ich gewinne jedesmal. Ich bin doch älter! Wir streiten über Vaters Bett, einen tausendfach gelöcherten Holzrahmen mit vier Holzbeinen und einem dichtgewobenen Netz aus Kokosfasern. Ich trage das Bett auf meinem Kopf, ich darf es bis zum Flussufer hinunter tragen. Danach darf er es zurücktragen. In den tausend Löchern des Holzrahmens leben tausende blutsaugende Wanzen, die man bei Tag nie zu Gesicht bekommt. Als wir am Flussufer ankommen, stellen wir das Bett auf den Sandstrand, wir klopfen mit Ashans Spazierstöcken auf die Kokosfasern. Wanzen regnen auf den weissen feinen Sand nieder. Wir schütten sie mit glutheissen Kieselsteinen zu. Danach tragen wir das Bett gemeinsam bis zur Mitte des Flusses. Wir stellen es ins seichte Wasser und setzen uns darauf nieder. Sogleich wollen meine Geschwister alle auf dem Bett Platz nehmen, auch Mutter Rose setzt sich mit dem Kleinsten zu uns.
”Unsere Hütte ist voll Wanzen. Sie ist feucht. Sie ist düster.”
Mutter Rose lächelt.
"Dafür müssen wir uns vor niemandem mehr bücken.”
Die Kleine Rose steht sehr früh auf, um die Kühe zu melken. Die beiden Kühe zusammen liefern knapp vier Flaschen Milch. Ich bringe die Milch zum ‚Betrüger Anthony‘, der die Milch verschiedener Haushalte sammelt, mit Wasser aus dem Bach vermischt und an eine private Firma nach Kannur liefert. Das Gelobte Land ist so unfruchtbar, dass Vater gezwungen ist, die ganze Milch zu verkaufen. Wenn Vater die vier grünen Dreiviertelliterflaschen abgefüllt hat, schafft es Mutter Rose für uns Kinder, ein halbes Glas Milch in eine Tasse beiseite zu stellen, ohne dass es Vater merkt. Oder vielleicht sieht er es, sagt aber nie etwas dagegen.
Für Mutter Rose ist das Leben viel schwieriger geworden. Wenn wir zur Schule gehen, ist sie allein mit den zwei Kleinen. Vater ist immer auf dem kargen Feld, er pflanzt Tappiocca, er pflanzt Kaschewbäume, er pflanzt Kokospalmen. Dann bestellt er Gemüsebeete, Beete für Ingwer und Tumeric[2]. Beete für dies und das. Mutter Rose muss Kinder hüten, Wasser holen, kochen, putzen. Sie muss Vater, der auf dem Feld arbeitet, immer wieder etwas bringen. Reiswasser, einen Stofffetzen, um seine Wunde zu binden oder ein brennendes Stück Holz, um seine Beedies[3] anzuzünden. Streichhölzer sind uns zu teuer. Alles ist teuer. Alles wird teurer.
Die Kleine Rose hat nichts, worauf sie zählen kann. Wir müssen alles kaufen. Salz, Zwiebeln, Oel. Tausend Dinge. Wenn sie die Hütte fertig geputzt hat, wandern die Hühner und die Küken durch das Haus. Sie lassen hundert Häufchen Hühnermist zurück. Die Hütte hat keine richtige Türe, nur eine, aus Bambus gewoben. Durch die Spalten kommen die Hühner immer wieder durch. Und wenn der Reis fast fertig gekocht ist, schreit der Säugling aus seinem Tuch. Sie muss sofort hin, sonst fällt das Kind aus der Wiege. Und niemand kommt ihr zu Hilfe, weil niemand da ist, weil niemand da sein kann. Wenn sie etwas kochen will, fehlt Gemüse oder Salz oder sonst was. Auch das Geld fehlt. Immer fehlt das Geld.
Dennoch muss sie kochen, dennoch muss sie uns Kindern zu essen geben, dennoch muss Vater etwas zu essen kriegen. Wenn das Essen fehlt, ist die Kleine Rose schuld. Wenn der Säugling schreit, ist die kleine Rose schuld. Wenn der Boden wieder voll Hühnermist ist, ist sie wieder schuld. Die Kleine Rose ist an allem schuld. Dann gibt es Prügel. Es fehlen in der neuen Hütte Ashans Spazierstöcke. Also nimmt Vater einen der grossen Rattanstöcke, die er am Dachrand aufbewahrt, um giftige Schlangen zu töten. Er flucht.
„Miststück!“
Heute ist so ein Tag. Schwül, mit dunklen Wolken in der Ferne. Immer wieder gibt es Regen. Naht der Monsun? Mutter Rose und wir Kinder müssen Kaschewnüsse sammeln. Über Nacht fallen sie mit dem Wind zu Boden. Wir müssen sie täglich unter den Bäumen auflesen. Falls wir es nicht tun, nehmen unsere Nachbarn sie uns weg. Diebstahl am helllichten Tag. Aber sie tun es.
Mutter Rose hat mehr als zwei Stunden am Nachmittag am Fluss verbracht. Da wir so wenig Kleidung besitzen, muss sie die Wäsche jede Woche waschen. Da Seife so teuer ist, mahlt sie frische Früchte eines seltsamen Baums. Wir nennen ihn einfach den Seifenbaum. Die Paste ergibt reichlich Schaum. Alice, Thankachan und ich waschen unsere Sachen meist selbst. Dennoch hat Mutter sehr viel zu waschen. Unsere Bettlaken. Die vielen Stofffetzen. Vaters weisse Dhoti. Sein weisses Hemd. Er hat nur ein einziges, das er für die Sonntagsmesse braucht, auch für seine gelegentlichen Fahrten nach Iritty oder Koottu-Puscha.
Und weil sie sich so um das Kleine Sorgen macht, um die Kaschewernte, um das Abendessen, kommt sie mit noch nasser Wäsche nach Hause. Sie hängt sie auf die schlappe Wäscheleine. Sie holt Wasser aus dem Brunnen, hackt Brennholz, bereitet uns das Essen zu. Vater sammelt Gras für die Kühe, wie er dies ab und zu tut, Alice und Thankachan holen noch mehr Wasser.
Ich gehe zu den Läden an der Strassenkreuzung, um die Kaschewernte des Tages zu verkaufen. Ich muss lange warten. Es sind sehr viele Menschen mit ihren täglichen Kaschewernten vor dem Laden. Es beginnt heftig zu regnen. Heute wiegt unser Sack voll Nüsse um die sieben Kilo. Muhammed, der die Nüsse im Laden wiegt, spielt immer wieder mit seiner schweren Waage aus Eisen. Hebt die Waage mit seinen geschwollenen knolligen Fingern. Vater meint, er mogelt. Ich muss höllisch aufpassen. Ich habe Salz gekauft, aufgerollt in einer alten Zeitung. Wie soll ich ihn im Regen nach Hause tragen?
Als Vater mit dem Gras nach Hause kommt, das durch den plötzlichen Regen noch schwerer geworden ist, liegt sein einziges, weisses Hemd im Schlamm. Es liegt im rotbraunen Regenwasser, wie auch unsere ganze Kleidung und die Bettlaken. Die Wäsche ist mit dem Beginn des Regens von der Leine heruntergefallen. Zu allem Unglück ist unser dummes Kalb über den dünnen Stoff getrampelt, das fast neue Hemd ist durch seine Hufe zerschnitten. Ohne ein Wort zu sagen, sammelt Vater die restlichen Kleidungsstücke auf. Sein Hemd lässt er liegen. Es ist nicht mehr zu retten. Als ich nach Hause komme, sehe ich seine blutroten Augen.
Vater nimmt den dicken langen biegsamen Rattanstock. Er schleicht in unsere Küche. Ich traue mich nicht, in die winzige Küche zu gehen. So stehe ich auf der nassen Veranda. Auch Thankachan und Alice kommen mit ihren schweren Krügen an. Sie sind vom Regen durchnässt. Auch sie bleiben mit ihren Krügen voll Wasser wie erstarrt im Regen.
Ich fürchte die blutroten Augen meines Vaters. Ich fürchte seine Stöcke. Ich fürchte seine Schläge. Aber er schlägt sie nicht. Vater schleudert einen Tonkrug auf den Boden, stampft aus der Küche. Mein Bruder Johnny und meine Schwester Alice klammern sich an mich fest. Der Säugling schreit und schreit und schreit. Unsere Hütte ist unsere Hölle.
Tief in der Nacht weckt uns die Kleine Rose. Aus den dunklen Nischen unseres Strohdachs quieken winzige Mäuse. Ihre aufgeregten Mütter rasen über die nassen Wände dem Dachgerüst entlang. Instinktiv nimmt die Kleine Rose den Säugling aus dem Tuch. Sie zündet eine Kerosinlampe an, schützt die kleine Flamme vor dem unberechenbaren Wind, ihre Blicke nach oben gerichtet, spähend, lauschend. Vater wacht auf, auch ich werde wach, meine Geschwister schlafen noch sehr friedlich. Beunruhigt starren wir auf das abgenutzte Gras, Vater, die kleine Rose und ich. Endlich entdeckt die Kleine Rose spiralförmige längliche weisse Flächen, um ein Bambusrohr gewickelt, eine Schlange, die sich nach vorne schleicht.
"Eine Kobra", flüstert Mutter Rose.
"Solange sie die Nester der Mäuse aufsucht, droht uns keine Gefahr", beruhigt sie mich.
Aber eine Kobra ist unberechenbar, sie kann sich von dem Nest abwenden, angelockt von einer grösseren Maus, auf der Jagd kann sie herunterstürzen, auf die schlafenden Kinder. So weckt die kleine Rose Thankachan, Alice und Johnny. Sie sammelt uns Kinder, begleitet uns nach aussen auf die Veranda. Wir verstecken uns halb hinter ihrem Sari, halten sie fest, lauschen dem Quieken der kleinen Mäuse.
Vater greift im Licht der Kerosinlampe zu seinem Schlangenstock aus Rattan. Mit der Lampe in einer Hand, mit dem Rattanstock in der anderen, mit dem listigen Wind im Nacken lauert Vater auf die Schlange. Es ist ungemein schwierig von unten nach oben auf das Bambusgerüst zu schlagen. Es gelingt ihm fast immer, Schlangen so zu töten. Heute aber schleicht sich Luzifer davon, hinein ins Gras. Er hat die Schlange geschlagen, sogar verletzt. Vielleicht ist sie geflüchtet, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht schlängelt sie die Wände der Hütte hinunter.
Unser Grundstück ist voller Schlangen. Die Felder des Nachbarn sind voller Schlangen. Auch der nahegelegene Wald ist voller Schlangen. Und so kommen sie immer wieder. Vater hat sehr viele Schlangen getötet. Dennoch zittern seine Hände jedesmal. Mutter Rose setzt sich auf die nasse Veranda. Meine Geschwister wollen wieder schlafen. Thankachan und Alice lehnen sich an sie. Johnny und der Säugling finden Platz in ihrem Schoss. Ich halte an ihrem Sari fest, lausche ihrem Herzschlag. Vater legt sich auf sein Bett und raucht eine Beedi. Allmählich schläft er ein. Mutter Rose löscht die Kerosinlampe, bleibt wach, lauscht in die Nacht.
Manchmal verzerrt sich das Gesicht der kleinen Rose. Dann bittet sie mich, ihr den Rücken einzureiben. Er ist an einer Stelle blauschwarz. Vater gelingt es immer wieder, mit seinen Schlägen Rose gerade hier zu treffen. Auf den Reisfeldern, wo sie noch als junges Mädchen spielte, hat sie ein junger Stier in den Rücken gestossen, eine schmerzliche Stelle hinterlassen, und der Schmerz kommt immer wieder. Wenn sie sich bückt, um das Wasser aus dem Brunnen zu holen, wenn sie Kaschewnüsse vom Boden aufliest, wenn sie Gewürze auf unserem Granitbrocken mahlt. Wenn der Schmerz sie überwältigt, ist sie ihrer Schönheit beraubt, ihr Gesicht ist nicht mehr rund und gütig, ein hässliches Gesicht. Ist dies das Gesicht des Schmerzes?
Heute ist Mutter Rose gut gelaunt. Mutter und ich lesen Kaschewnüsse auf. Wir sind vor unseren Nachbarn aufgebrochen und sammeln die Nüsse entlang dem äusseren Rand unseres Grundstücks, bevor die Nachbarn sie uns wegnehmen können. Dabei dringt Mutter Rose auch auf das Gelände des Nachbarn, nimmt ihnen die Nüsse weg, die Ernte einzelner Bäume.
"Mutter...Mutter", mahne ich sie zur Vorsicht.
Ich will nicht, dass sie stiehlt, dass sie ertappt wird.
"Mutter!”
Aber meine Rufe lassen sie kalt. Sie ist entschlossen, geradezu besessen.
"Sie nehmen uns die Nüsse weg. Darum nehme ich ihnen auch die Nüsse weg. Soll einer kommen, der mich eines besseren belehren will.”
Die Früchte der Kaschewbäume sind von unterschiedlicher Farbe, gelb, orange oder rot, und daher ist ihre Zugehörigkeit leicht zu erkennen. Ashan hätte die Kaschewfrüchte, die auf unserem Gründstück lagen und die eindeutig den Nachbarn gehörten, ihnen zugeworfen. Meine Grossmutter hätte die Kaschewnüsse der Nachbarn aufgelesen, aber nur so lange sie auf unserem Boden lagen. Die kleine Rose aber geht auf die Felder der Nachbarn hinüber und sammelt sie, nimmt ihnen so viel weg, wie sie nur kann. Ich will nicht, dass sie ertappt wird. Ich will nicht, dass meine Mutter stiehlt. Ich wünschte, sie wäre keine Diebin.
Mutter Rose schickt mich zu Nachbars Brunnen. Dabei habe ich gerade im strömenden Regen Gras für die Kühe gebracht. Bereits früh bin ich durch das nasse meterhohe Unkraut den Berg hochgeklettert, während mein Bruder Thankachan nur die Milch zum Betrüger Anthony brachte.
”Kann Thankachan oder Alice nicht Wasser holen?” will ich wissen.
Wieso schickt Mutter Rose ausgerechnet mich? Ich soll ihr nicht widersprechen. Es seien immer die anderen, die Wasser holen. Gehen soll ich gleich, und am Wasserfall baden. Johnny, mein Bruder, will unbedingt mitkommen. Er will auch am Wasserfall baden. Mutter Rose will nicht, dass er mitkommt, obwohl ich nichts dagegen habe.
”Der Nieselregen ist nicht gut für dich."
Sie will, dass ich unbedingt alleine Wasser holen gehe. Sie bringt mir den kleineren Kupferkrug und ein Tuch für meinen Kopf.
”Es ist dein Geburtstag!”
Sie flüstert mir ins Ohr. Als sie mir das Tuch gibt, drückt sie mir auch ein warmes gekochtes Ei in die Hand, küsst mich auf die Stirn.
”Ich habe dir das hier versprochen. Iss es auf dem Weg zum Brunnen. Und lass die Schale verschwinden.”
Ich umarme sie kurz, ohne dass es jemand sieht, und laufe so schnell wie ich kann aus der Hütte.
"Komm schleunigst wieder nach Hause”, ruft sie laut hinter mir her.
Ich laufe mit dem Krug und dem kostbaren Ei weg. Mutter Rose hält Johnny zurück. Sie sieht zu, dass Thankachan oder Alice mir nicht folgen. Ich laufe so schnell ich kann bis über den kleinen Hügel.
Unser Mangobaum steht in voller Blüte, mit kleinen daumengrossen grünen Mangos. Das dichte Laub bietet mir Schutz vor dem Regen. Ich betrachte das warme gekochte Ei. Ich drücke es gegen meine nassen Wangen. Am liebsten würde ich das wunderbare Ei lange behalten, unendlich lange. Am liebsten würde ich es für immer aufbewahren, allen von meinem Glück erzählen, der ganzen Welt. Ich muss das Ei aber essen. Sonst könnten meine Geschwister es entdecken und mir wegnehmen.
Meine Freunde haben wieder Post erhalten. Nebst Bildern des Heiligen Josef sind es Ansichtskarten. Von New York. Von Rom. Von Paris. Die Missionare freuen sich über die Anmeldungen meiner Freunde. Sie wollen wissen, ob ihr Schulkamerad, ob ich, die Missionsschule besuchen möchte. Nach der Schule, nach höheren Studien können wir solche Städte sehen, Gutes für die Welt und für Gott tun, wenn es Gottes Wille sei, schreiben die Missionare. Auch ich möchte diese Welt sehen, reisen, neue Sprachen lernen, Menschen sehen.
”Geh mein Sohn, geh weg von hier, lerne etwas. Die Welt deines Vaters, die Welt deiner Mutter, sie ist klein, sie ist sündig.”
Als ich meinen Grossvater aufsuche, rät er mich, in die ferne Missionsschule zu gehen und Gott zu dienen.
Warum will, warum kann mich Vater nicht gehen lassen? Warum hilft mir Mutter Rose nicht? Nur sie kann mit ihm reden. Widerwillig zeigt Mutter Rose Vater das rosarote Formular. Er will davon nichts wissen. In den nächsten Tagen ist er gereizt. Er schlägt mich, wenn ich ihn darauf anspreche. Er schlägt mich, wenn ich von der fernen Schule träume. Er schlägt mich mit einem dünnen Ratanstock, bis meine Beine bluten.
Nach den anfänglichen Regenfällen setzt sich die Sonne durch. Der Boden ist brennend heiss, heisser als vor dem Regen. Eifrig lockert Vater die Felder für das Einpflanzen kleiner Tappioccastangen. Ihre Wurzeln müssen in luftiger Erde gedeihen. Über den roten Lateritsteinen liegt nur eine dünne Schicht roter Erde. Damit das Regenwasser die kostbare Erde nicht wegschwemmt, legt er Terrassen an. Mutter, Thankachan und ich sammeln Brocken und Steine für die Terrassen. Tagelöhner oder Fachkräfte können wir uns nicht leisten. Vater braucht uns, Vater braucht mich. Er kann mich nicht in die Missionsschule gehen lassen, auch wenn er dies wollte. Ich bin sein ältester Sohn.
Am Ende eines langen Tages warten wir sehnlichst auf das Abendessen. In der kleinen Küche sitzen wir in einem Kreis dicht beieinander. Mutter Rose hat neben Vater auf den Feldern gearbeitet, den ganzen Tag. Über Mittag hat sie Curry gekocht mit getrocknetem Fisch und frischer grüner Mango. Auch der Reis ist fertiggekocht, aber noch ruht der schwarze Tonkrug voll Reis auf den eisernen Schrauben. Mutter bückt sich, um den Krug zu heben. Die Hitze zwingt sie, ihn wieder auf die eisernen Schrauben zurückzustellen. Plötzlich fällt der Krug auseinander. Der gekochte Reis samt Wasser fällt über die noch glühende Kohle. Dampf füllt den Raum. Rauch füllt den Raum. Ein Schrei füllt den Raum.
Vater greift nach Mutter Rose. Er schlägt sie. Die Kleine Rose wehrt sich. Ihre Hände sind schwach. Aber sie wehren sich heftig. Sie flucht. Sie schreit um Hilfe. Vater kann sie nicht schlagen. So ergreift er sie am Hals. Thankachan und Johnny flüchten. Alice zittert vor Angst, der Säugling schreit. Ich kann ihn kaum beruhigen. Ich gehe mit dem Kind nach draussen, in die stockdunkle Nacht. Ich will nicht, dass meine Geschwister weinen. Ich will nicht, dass Mutter weint.
”Meine Kinder, er bringt mich um. Kinder helft mir!”
Ich will Vater aufhalten und renne in die Küche zurück. Vater würgt sie am Hals. Sie will atmen. Er würgt sie sehr lange. Ohne Luft sinkt sie zu Boden. Vater hebt seine geballte Faust über ihren gebückten Körper und hämmert auf sie los. Wild, blind, besinnungslos. "Weisst du, wie hart ich arbeiten muss? Weisst du, dass wir heute hungern müssen? Wie soll ich in die Augen meiner Kinder sehen? Dir ist alles egal! Du Miststück! Du hast alles ruiniert. Mein einziges Hemd. Unsere Handvoll Reis. Das kostbare Ei!"
Wütend, verlässt Vater unsere Hütte.
Ich möchte ihn aufhalten, ihm sagen, dass ich das Ei gegessen habe, dass sie es mir geschenkt habe, dass heute mein Geburtstag sei. Aber das Ei bleibt mir im Hals stecken. Kein einziges Wort kann ich sagen. Ich zittere. Ich sterbe vor Angst.
Die Autos werfen ihre Schatten auf unsere Wände. Schwer beladene Lastwagen brummen an unserer Hütte vorbei. Es regnet wieder. Die Mäuse schweigen heute Nacht. Mutter Rose schluchzt hin und wieder. Aber wir Kinder halten uns an ihr fest unter unserer Decke.
”Wenn ich gross bin, bringe ich Vater um.”
Ich möchte sie trösten.
”Sag so etwas nicht. Sag das nie!”
Sie drückt mich eng an ihren Körper. Lange schweigt sie. Vor lauter Schmerz kann sie kaum sprechen.
”Kurz nach deiner Geburt habe ich...habe ich...einen Knochen...Es geschah vor vielen Jahren. Deine Grossmutter gab mir nie etwas Gutes zu essen. Während der ganzen Schwangerschaft. So habe ich, kurz nachdem du zur Welt gekommen warst, ohne ihr Wissen ein Stück Fleisch zu mir genommen. Plötzlich kam sie in die Küche. Ich hatte Angst, verschluckte das Fleischstück. Ein Knochensplitter blieb mir in der Kehle stecken.”
Ich lege meine Hand an ihren Hals, streichle meine Mutter. Aber sie bringt es nicht fertig weiterzusprechen. Der Hals meiner Mutter brennt. Sie hatte versucht, den Knochen selbst herauszunehmen. Meine Grossmutter hatte versucht, ihn herauszunehmen. Dann Vater, die Tanten, die Nachbarn. Ihr Hals schwoll an. Er wurde rot. Wurde blau. Die Kleine Rose hatte Todesangst. Und sie dauert an. Die Angst hört nie auf.
Dünne schwarze Ringe aus Staub und Schweiss schmucken ihren Hals. Ihre Bluse ist geschmiert mit Kurkumagelb und Russ aus der Küche. Trockener Nasenschleim meiner Geschwister und vereinzelte Fischschuppen glänzen auf ihrer zerrissenen Sari. Die Kleine Rose vergiesst ihre Tränen und schluchzt leise, damit meine Geschwister in Ruhe schlafen können.
”Sohn, schlaf”, flüstert sie mir zu.
Aber ich kann nicht schlafen. Ihr Körper zuckt immer wieder zusammen. Irgendwann mal hört ihr Schluchzen auf. Der Schlaf ist ihr gnädig, lässt diese schlimme Nacht vergehen, wie alle anderen Nächte. Morgen wird Mutter Rose aufstehen, eine Tasse Milch für uns beiseite stellen. Sie wird Wasser holen, Holz hacken, sich zu Tode schuften. Morgen wird sie sehr früh aufstehen. Als erstes wird sie Vater ein Ei kochen, weich, wie er sich das immer wünscht.
[1] weicher Stein
[2] Gelbgewürz
[3] Zigarette aus Baumblättern und Tabak

Ein Schuss teilt die Luft. Etwas Staub entkommt der Erdoberfläche. Ein abgemagerter Hund klemmt den Schwanz zwischen seine dünnen Beine und winselt. Bruder Antoine steht oben auf dem Dach unserer Missionsschule, ein Gewehr in seiner Hand. Die Enttäuschung über den missglückten Schuss steht ihm ins Gesicht geschrieben. Er zielt wieder. Der Hund rennt nach rechts, nach links, dreht sich im Kreis. Daas, unser Dhobi[1], ist erschrocken. Er fleht mich an, Bruder Antoine abzuhalten.
"Bruder, bitte nicht. Es ist der Hund unseres Wäschers, unseres Dhobi!”
Der Missionar ist sichtlich verärgert.
"Was soll denn das? Sag dem Kerl, er soll den verdammten Hund zu Hause lassen. Wir wollen unsere Soutanen am Sonntag zurück, nicht seinen miserablen Hund.”
Er verschwindet hinter dem Betonrand des Daches, geht zurück zum Missionshaus.
"Verdammt! Verdammt", flucht er.
Das umzäunte Gelände der Mission liegt zehn Kilometer ausserhalb der Stadt Palem im Bundesstaat Madras. 1960 sind auf dem Gelände der Mission das Haus der französischen Missionare, eine moderne Schule und ein Internat entstanden. Die Schule besteht aus einem länglichen, dreistöckigen Gebäude, das in Klassenzimmer, mehrere Büros und eine Aula unterteilt ist. In jedem Klassenzimmer stehen zwanzig Stühle, zwanzig Tische. Die Zimmer haben alle Marmorböden, grosse, breite, helle Fenster. Vor dem Schulhaus ein staubiges, steiniges Feld. Hinter dem Schulhaus und an beiden Enden mehrere kleinere Felder. Am Rande des Schulareals sowie zwischen den kleineren Feldern schattige Bäume. Tamarindbäume. Mangobäume. Neembäume.
Das Haus der Missionare ist zweistöckig, rund, einen gepflegten Garten einschliessend. Hier leben die Geistlichen abseits aller Hektik. Jeder in einem Einzelzimmer, mit einem Arbeitsbereich, einer Schlafnische, einer angeschlossenen Toilette. Im klimatisierten Gemeinschaftsraum stehen bequeme Sessel, ein grosser Kühlschrank, ein Schrank voller Weingläser. Das Internat dagegen ist eine leere gähnende Halle, unterteilt in drei Lernräume. Die jüngeren Knaben des Internats schlafen in den langen leeren Gängen der Schule. Anders als sie dürfen Alex, Kumar und ich bis elf Uhr in der Nacht lernen, übernachten am Ende des Tages in der schlichten Halle, jeder in einem der Lernräume.
Die Mission steht in einem weiten grossen Tal, eingereiht zwischen Textilfabriken, inmitten braunroter Felder. Dass es sich um eine christliche Einrichtung handelt, erkennt der Aussenstehende an der rundlichen Kapelle. Sie befindet sich in einem üppigen Garten voller Bougainvillea. Neben der Kapelle steht ein reinweisser Glockenturm, mit einem spitzen, runden Ziegeldach. Gekrönt von einem schlichten, weissen Kreuz.
Weit hinter dem Missionsgelände verläuft die Eisenbahnlinie. Auf den schier endlosen Schienen hocken Kinder, Frauen und Greise und verrichten ihre Notdurft zu jeder Tageszeit. Auf der wenig befahrenen Eisenbahnstrecke herrscht ein endloses Kommen und Gehen. Mürrische Männer und genervte Frauen streiten sich Tag ein Tag aus um ihre Stammplätze. Hinter den hockenden kauernden fluchenden Menschen lauern grunzende Schweine, streunende Hunde und fettleibige Ratten. Von Norden Indiens bis tief in den Süden, vom Westen nach Osten thronen die Seligen aus den heruntergekommenen Städten und verarmten Dörfern über den silbrig schimmernden Schienen. Sie schielen nach links und rechts oder starren einander an und bilden sich ein, unsichtbar, unverwundbar, ganz allein zu sein.
Die schmalspurige Bahnlinie verbindet die Fabriken der Umgebung mit der Hafenstadt Madras. Die Sirenen der Textilfabriken heulen um Mittag, um Mitternacht und bei jedem Schichtwechsel. Weiter weg liegen breite Zuckerrohrplantagen, bewässerte, samt grüne Reisfelder. Etwa zwanzig Kilometer von der Mission entfernt ragen Berge hoch, auf deren Hänge riesige Kaffeeplantagen gedeihen. Gegenüber dieser tiefgrünen Gebirgskette stehen braune gelbe Hügel, dünn bewachsen mit Kakteen, mit herausragenden Felsen. Mächtige, bunt geschmückte Götter und Göttinnen bewachen das weite, fruchtbare Tal.
Bruder Charles, ein sehr lebhafter, exzentrischer Mann, leitet die gesamte Mission. Er steht der Niederlassung der Mission in Palem, aber auch den drei anderen Missionshäusern in Indien als deren oberster Leiter vor. Bruder Antoine ist Direktor unserer Missionsschule. Unsere Schule wird zwar von den Missionaren privat geführt, sie unterliegt aber der Aufsicht der Universität von Madras. Da die Gebühren relativ hoch sind, besuchen nur Kinder aus wohlhabenden Familien, Kinder der Fabrikbesitzer und Kinder reicher Geschäftsleute, unsere Schule. Bruder Robert, der jüngste unter den Missionaren, leitet das Internat. Im Internat sind zwanzig Schüler aus armen Familienverhältnissen untergebracht. In den Augen der reichen Kinder sind wir Internatsschüler jämmerliche Waisenkinder. Dass wir keine Waisen sind, können sie kaum glauben. Dass wir eines Tages Missionare werden sollen, ist ihnen noch weniger verständlich.
Vor drei Jahren hatte Bruder Charles meine zwei Freunde und mich an der zentralen Busstation in der Stadt Palem empfangen. Er hat mit einem kleinen Motorrad dort auf uns gewartet, uns in eine Dreiradrikscha gesetzt und zum Missionshaus geführt. Die Stadt Palem war uns fremd, die drei- und vierstöckigen Gebäude kamen uns erstaunlich gross vor. Die Stadt schien mir faszinierend und zugleich schmutzig zu sein, mit engen überfüllten Strassen, mit lärmenden Bussen und qualmenden Autos. Während Menschen sich in beiden Richtungen durch die engen Strassen bewegten, liefen Kühe zwischen Autos, Karren und Menschen umher. Ein dichter, langsamer, farbiger Fluss voller Leben.
Das Missionsgelände am Rande der Stadt schien uns dagegen eine Oase zu sein, ein Stück Paradies mit grossgewachsenen Aschoka-Bäumen, Bougainvillea und gepflegten Gärten. Vor lauter Glück übersah ich die Umzäunung und die Mauern und die Jahre der Einsamkeit, die vor mir lagen. Ich hatte, ohne dass es mir bewusst wurde, Abschied genommen von Ashan, von meiner grossen Mutter, von der Kleinen Rose. Auch hatte ich von meinem Beedie rauchenden, gewalttätigen, allmächtigen Vater Abschied genommen, für immer Abschied genommen. Vor drei Jahren hatte er mich täglich beschimpft, fast zu Tode geprügelt, zuletzt doch das rosarote Formular unterschrieben, das Gesuch um die Aufnahme in die Missionsschule.
An einem regnerischen Tag vor zwei Jahren kam Bruder Robert zu mir. Ich hatte eine Grippe mit starkem Fieber. Geschwächt lag ich in einem kleinen Nebenzimmer des Internats. Er brachte mir Tee mit Zitronensaft, deckte mich zu. Am gleichen Abend schenkte er mir ein wunderschönes grosses Buch mit farbigen Bildern von Chagall, Van Gogh, Picasso. Ich dachte an die Wälder nahe Kootu-Puscha, an die Reisfelder von Miniaachan, an die blauen Flecken Himmel, die ich durch Ashans Schirme sah. Ich dachte an die Berge hinter der Mission, die Kakteen und die felsigen Hügel. Ich sah die Gesichter der Kleinen Rose und meiner grossen Mutter, das Gesicht meines Vaters. Die Gesichter von Rembrandt. Ich sah die Wüstenlandschaften aus den Westernfilmen, ich dachte daran, wie klein meine Welt war und wie gross zugleich, ich klammerte mich an das Buch fest, liebte es, ich gelobte, alle Menschen zu lieben, gelobte, diese meine Welt zu lieben, gelobte, das Leben zu lieben, was immer geschehen würde.
Am folgenden Tag kam Bruder Robert spät in der Nacht, um mein Fieber zu messen. Es hatte deutlich nachgelassen. Da ich tagsüber viel geschlafen hatte, war ich hellwach. Ich stieg aus dem Bett und machte es mir auf dem einzigen Stuhl des Zimmers bequem. Er legte mir meine Decke über den Rücken und ging weg, um mir eine heisse Tasse Tee zu machen. Die Mitternachtssirenen heulten aus den Textilfabriken. Bruder Robert kam mit dem Tee zurück. Als ich ihm Platz machen wollte, hielt er mich zurück.
"Setz dich hier auf meinen Schoss“, sagte er mir.
Er hielt mich fest und schenkte mir Tee ein. Und während ich meinen Tee trank, streichelte er mich, küsste mich auf die Wange, erzählte mir, dass er stolz auf meine schulischen Leistungen sei, küsste mich immer wieder, trug mich ins Bett und legte sich neben mich.
"Du erinnerst mich an jemanden", sagte mir Bruder Robert ganz leise.
"Wir fuhren auf der menschenleeren Hauptstrasse zwischen Bangalore und Mysore. Bruder Antoine, Bruder Charles und ich. Ich sass am Steuer, war viel gefahren in den letzten Tagen. Wir suchten Kinder für das Internat, in Mangalore, in Coimbatore, in Mysore. Auf beiden Seiten der Strasse lagen Felder brach. Dörfer mit vereinzelten Hütten, unter den Banyanbäumen ruhende Viehherden. Plötzlich rannte ein Kind auf die Strasse. Ich weiss nicht, wo es herkam. Alles ging so schnell. Ich...Ich hörte einen Knall, ich habe das Kind fallen sehen, sein Körper zuckte auf der geteerten Strasse.”
Bruder Robert schwieg lange. Seine Augen waren feucht. Er schluchzte wie ein Kind.
"Ich hatte das Kind überfahren. Aber es lebte noch. Ich wollte aussteigen und nach ihm sehen. Ich wollte unbedingt nach dem Kind sehen. Aus einem nahegelegenen Dorf kamen Menschen angerannt. Bruder Antoine zwang mich zurück ins Auto. Nahm das Steuerrad in die Hand. Er liess mich nicht mehr aussteigen.
”Sie werden dich lynchen”, redete er auf mich ein.
”Verdammt, verdammt”, fluchte er, fuhr los.
Wir flüchteten. So grub ich mein Gesicht in meine Hände.”
Lange lag er still.
"Vielleicht hast du es nicht getötet", wollte ich ihn trösten.
Aber er sagte nichts. Er umarmte mich, er küsste mich immer wieder, berührte mich. Er führte meine Hand zwischen seine Beine, das erste Mal vor zwei Jahren.
Nach dem ersten Jahr an der Missionsschule, als ich meine Familie während der Sommerferien besuchte, fiel mir auf, wie sehr die Mission, die Missionare und die Internatsschüler meine neue Familie geworden waren. Unser kleines Zuhause kam mir finster und eng und dreckig vor. Am meisten ekelten mich die vielen dickflüssigen Hühnermisthäufchen auf dem Boden unserer Hütte. Auf einem Seil entlang der Veranda war Wäsche aufgehängt, saubere wie schmutzige. Und das Innere der Hütte schien mir viel düsterer zu sein als zuvor, eine finstere Welt, in der das kleine farbige Tuch mit dem Säugling der einzige Lichtblick war.
Meine Euphorie über das Wiedersehen war einer tiefen Trauer gewichen, so dass ich mich nicht so sehr über den Zuwachs meiner wirklichen Familie freuen konnte. Als ich meine Schwester Molly, kaum vier Monate alt, in meinen Armen hielt, war ich glücklich und traurig zugleich. Hier und dort war ich, hin- und hergerissen zwischen meiner vertrauten, armseligen Welt und der neuen, bezaubernden Welt der Missionare. Und während Freude und Ekel, Trauer und Verständnis in mir aufkamen, sassen meine Geschwister, die kleine Rose und mein Vater um mich herum, bewunderten mein sauberes, langärmliges Hemd, meine gebügelte tiefblaue Hose, meine Krawatte.
Für meine Eltern und meine Geschwister war ich kein gewöhnliches Familienmitglied mehr. Vater konnte kaum glauben, dass ich nun Englisch sprach, dass ich in der Mission mit Messer und Gabel ass, dass ich schwarze, polierte Schuhe trug. Sie starrten mich unendlich lange an, von meinen Lippen ablesend, allen meinen Bewegungen folgend. Ich war ihnen ein Stück weit fremd geworden, vertraut und fremd zugleich.
Am gleichen Abend nahm Vater mich mit in die Kirche, um mich dem neuen Dorfvikar vorzustellen. Er drängte mich, meine lange Hose anzuziehen, meine Krawatte sowie die schwarzen Schuhe zu tragen.
”Sprich mit dem Pfarrer auf Englisch. Geh langsamer. Halte dein Kinn hoch. Begrüsse den Händler Mustafa. Auch den Betrüger Anthony. All die anderen Dorfbewohner!"
Den neugierigen Menschen entlang unseres Weges lächelte er freundlich zu.
”Mein ältester Sohn. Er ist bei den Missionaren. Er ist der Beste in seiner ganzen Schule. Die Missionare werden ihn nach Amerika schicken und nach England. Eines Tages wird mein Sohn Doktor oder Ingenieur!”
Allein das Tragen langer Hosen und glänzend polierter Schuhe waren in den Augen meines Vaters Zeichen einer höheren Stellung, ähnlich der Stellung gutbezahlter Regierungsbeamte. Denn niemand in unserem Dorf, niemand weit und breit, trug Hosen. Schuhe und Krawatten waren Luxusartikel, Symbole der reichen, weltgewandten Stadtmenschen, die man manchmal in noblen Autos vorbeifahren sah.
Mein Vater war hemmungslos in seinen Träumen. Seine Phantasie führte ihn in die ferne Zukunft, seine Hoffnungen kannten keine Schatten. Auch keine Fragen. Und obwohl ich ihn daran erinnerte, dass einzelne Internatsschüler die Missionsschule abrupt verlassen mussten, dass die Missionare immer wieder Knaben entliessen, weil sie ihre Erwartungen nicht erfüllten, verschloss er seine Augen gegenüber den Realitäten meiner neuen Welt. Doch wollte ich ihm etwas Wichtiges mitteilen, ich wollte mich zu meiner Schande bekennen. Ich fühlte mich unglücklich, schmutzig, schuldig. Doch ich konnte ihm nicht mehr sagen als das, was er zu hören wünschte. Seine Welt war voller Niederlagen. In meiner Welt räumte er ihnen keinen Platz ein.
Die freundliche Begrüssung des Dorfvikars raubte mir jede Hoffnung, dass ich wenigstens ihm meine schwere Last mitteilen könnte, dass ich spätestens bei meiner langersehnten Beichte Erlösung finden würde. Auch er zeigte sich so sehr erfreut über meine Leistungen in der Missionsschule, dass ich es nicht über meine Lippen brachte, ihm meine schwere Bürde anzuvertrauen.
Bruder Charles treffe ich eines Tages wie gewohnt in seinem Arbeitszimmer. Als er mich sieht, bittet er mich, Platz zu nehmen. Er hat mich zwar erwartet, hat dennoch einen Brief begonnen, ein Schreiben an die Zentrale der Bruderschaft in Paris. Er möchte ihn nun zu Ende tippen. Seine Schreibmaschine spuckt immer wieder und völlig unerwartet rote Buchstaben aus. Der Missionar knirscht mit den Zähnen. Wenn er sich nicht mehr beherrschen kann, schreit er "Merde" und tippt rastlos weiter bis zum nächsten roten Buchstaben. Die Schreibmaschine ist alt, hat ein rot-schwarzes Band, ist genauso unberechenbar wie der fluchende Missionar. Und obwohl französisch nicht in unserer Schule unterrichtet wird, weiss ich von den Missionaren, was "Merde" bedeutet. Ich spüre auch, dass Bruder Charles nicht sonderlich gut gelaunt ist.
Ich hätte Bruder Charles, dem Leiter der Mission, meinen Kummer anvertrauen können. Vielleicht hätte er mir zugehört, vielleicht hätte er mir helfen können. Bruder Charles ist ein Wirbelwind, dem ich nicht ganz trauen kann. Er ist vergesslich, ordnet an, dass wir die Aussenwände der Kantine hellgrün streichen, ist am darauffolgenden Tag empört, dass sie hellgrün gestrichen worden sind. ”Welcher Schwachkopf hat dies nun angeordnet”, will er dann wissen. Hinzu kommen seine Wutausbrüche, das Zittern seines bärtigen Kinns, die Rötung seines faltenreichen Gesichts. Seine Fluche, die in den langen Korridoren des Missionshauses widerhallen.
Nachdem er sich von der Schreibmaschine abgewendet hat, holt er seine grosse Mappe hervor, in der er unsere Bilder aufbewahrt. Bruder Charles liebt Bilder. Oftmals ermutigt er uns zu malen. Nach der Sonntagsmesse hält er für gewöhnlich eine kurze Ansprache, ermuntert uns, einen biblischen Text in eigenen Bildern wiederzugeben. An jenem Tag holt er mein Bild hervor, das Bildnis unseres Wäschers, legt es auf den Boden seines Zimmers. Bruder Charles bezieht hinter mir Stellung, betrachtet schweigend das seltsame Bild. Daas, unser Dhobi, streckt seinen Körper in die Höhe, um seine Wäsche an die Leine zu hängen. Der Körper des Wäschers leuchtet heller als die gewaschene Soutane, die er zum Trocknen aufhängt. Dieses Bild habe ich 'Die Auferstehung' genannt. Bruder Charles starrt dieses Bild lange an, dann legt er seine Hände auf meine Schultern, umarmt mich.
"Das ist sie! Das ist sie, die wahre Auferstehung! Es ist ein wunderbares Bild, mein Junge.”
Er küsst mich, kratzt mich mit seinem bärtigen Kinn. Presst mit seiner kräftigen Umarmung die Luft aus meinen Lungen.
”Ich habe etwas Schlimmes gemacht, sehr Schlimmes, ich bedaure es zutiefst.”
”Na, Junge, du kannst gar nichts verbrochen haben.”
Ich stelle mir dieses vertrauliche Gespräch vor, ich stelle mir vor, wie Bruder Charles darauf antwortet, ich stelle mir vor, wie enttäuscht er sein wird. Oder wie er mich vielleicht in Schutz nimmt. Aber wird er überhaupt verstehen? Wenn nicht, muss ich an diesem Tag die Mission nicht verlassen? Und wie kann ich dies meinem Vater, der kleinen Rose oder meiner grossen Mutter erklären?
Bruder Charles unterbricht meine Gedanken. ”Ich muss dich mit einem wunderbaren Künstler bekannt machen. Du kannst was von ihm lernen, mein Junge. Ein grossartiger Maler, dieser Mann. Die Farben, die Phantasie, die Kunst! Sie sind neue Welten." Er legt eine Schallplatte auf, greift meine Arme, zwingt mich zu tanzen, schwingt mich im Kreis herum. Bruder Charles schliesst seine Augen, begibt sich in eine andere Welt. Dann bricht er plötzlich ab. ”Merde. Ich muss meinen Bericht schreiben. Mein Junge! Hier. Diese Farben schenke ich dir.” Er gibt mir eine kleine Schachtel Aquarellfarben, begleitet mich zur Tür.
"Mein Bericht. Mein Bericht. Merde!"
Die Missionare legen Wert darauf, von uns Kindern getrennt zu essen, sich in ihrer Muttersprache auf französisch zu unterhalten. Sie legen Wert darauf, bedient zu werden. Ein uniformierter Diener bringt ihnen eine Vorspeise, dann die gewünschte Hauptspeise, Dessert und Kaffee. Die Schüler des Internats dagegen bekommen eine Schüssel voll gekochtem Reis. Lauwarm. Eine wässrige lauwarme Sauce dazu, eine dünne Brühe, auf deren Oberfläche ein paar verirrte Gemüsereste umhertreiben.
Bruder Charles tanzt an unserer Kantine vorbei, die weisse Soutane herumschwingend, fröhlich, verspielt, zerstreut. Bruder Antoine trägt stolz sein Gewehr, geht an uns vorbei. Er zeigt mit seinem Daumen nach oben, sein Grinsen verrät seinen Sieg. Der Triumph eines winzigen Stück Bleis über das Leben eines Hundes. Bruder Robert kommt zu uns in die Kantine, setzt sich neben mich, unauffällig berührt er meine Hände.
”Am Samstag gehen wir ins Kino. Oliver Twist”, flüstert er in mein Ohr. Aber auch er geht letztendlich zu den anderen Missionaren hinüber.
Bruder Antoine kommt nach dem Essen vorbei.
”Es ist eure Schule. Ihr habt eine freie Ausbildung. Die Mission zahlt eure Kleidung. Eure Schuhe. Eure Bücher. Also erwarte ich von euch, dass ihr etwas für eure Schule tut. Die Böden müssen gereinigt werden. Auch die Tische und die Stühle. Marsch!”
Bruder Antoine spielt gerne Soldat. ”Marsch” ist sein Lieblingswort. Nebst seiner Arbeit als Leiter der Schule ist er auch mein Klassenlehrer. Er erteilt uns Englischunterricht. Es sind zwei Bücher, die er mit uns bespricht. ”Pride and Prejudice” von Jane Austen und ”A Tale of Two Cities” von Charles Dickens. Er führt uns in turbulente Zeiten, in die Jahre der Französischen Revolution, die Zeit der vielen Hinrichtungen. In der Schule spricht er von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Mit uns Internatsschülern spricht er von Nächstenliebe, Keuschheit und Gehorsamkeit. Das Leitbild der Mission. Danach sollten wir leben. Er spricht von der christlichen Liebe, von einer absoluten Liebe, von der Liebe Gottes.
Liebe? Die Missionare sprechen oft davon. Nur kann ich nicht daran glauben, dass sie einander lieben. Denn Bruder Antoine missbilligt, wie Bruder Robert das Internat führt, wie er uns Knaben ‘viel zu häufig’ ins Kino mitnimmt. Er missbilligt auch, dass Bruder Robert die Heilige Messe nicht täglich besucht. Bruder Robert seinerseits muss sich in schulischen Belangen dem ‘Hundehasser’ Bruder Antoine unterordnen. Er möchte, dass Bruder Charles ein Machtwort spricht, dass er den Diktator Antoine zurechtweist. Bruder Charles wiederum ist ein Feigling, ein Träumer, der die Spannungen in der Gemeinschaft nicht wahrnehmen kann oder wahrnehmen will. So geben sich die Missionare während der Heiligen Messe die Hand, sprechen sich gegenseitig mit Bruder an, um hinterher dem anderen aus dem Weg zu gehen, einander zu verfluchen und einander zum Teufel zu wünschen.
”Wer sind deine Freunde in der Schule?”
Vater kann kaum glauben, dass meine Klassenkameraden sehr reich sind, so reich, dass sie uns ‘Waisen’ stets ausgrenzen, dass sie uns verspotten, auf uns spucken.
”Alex und Kumar sind meine Freunde. Kumar ist ein wenig neidisch, dass ich die besseren Noten habe. Und Alex lügt mich immer wieder an.”
“Wieso lügt er dich an?” will Mutter wissen.
”Vor einer Woche habe ich ein gelbgestreiftes Hemd bei ihm gesehen, eins wie ich es mir wünschte. Er sagte, sein Vater habe ihm das neulich gekauft. Aber auf dem Kragen steht 'Fun Tailors Palem‘. Das ist ein Schneiderladen in der Nähe der Mission. Ich weiss nicht, warum er mich belügt!”
Mutter Rose sieht mich verwundert an.
”Ihr seid Knaben im gleichen Alter.“
„Alles bloss Kinderkram”, urteilt Vater.
”Beende deine Schule. Und wenn du irgendwie kannst, besuche eine Universität. Von einer guten Ausbildung können deine Geschwister nur träumen.“
”Trau den Missionaren niemals”, sagt Mutter Rose.
Die Kleine Rose kennt Missionare. Einige ihre Cousinen sind Nonnen.
”Ich will nicht, dass mein Sohn ein bärtiger Missionar wird, mit einer dämlichen Soutane. Mit einem schwarzen Gurt und Rosenkranz dazu. Tu, als ob du fromm wärest. Geh so oft in die Kirche, wie du nur kannst. Das freut die Missionare bestimmt. Aber werde niemals einer wie sie. Sonst habe ich zwei Ashans in meiner Familie.”
Sie wischt Hühnermist vom Flur der Hütte, bückt sich immer wieder, geht von Häufchen zu Häufchen.
"Je weisser die Soutane, desto schwärzer die Seele.”
Die meisten Missionare leben für die Schule, für sich, kümmern sich wenig um uns Internatskinder. Bruder Antoine erschreckt uns mit seinem ”Marsch”, mit seinen vielen Befehlen. Mit seinem Gewehr und seiner Frömmigkeit. Bruder Charles schätzt meine Bilder, schenkt mir Pinsel und Farben. Aber er wird oft wütend. Und er erzählt alles Bruder Antoine. Sie sind oft zusammen. Fromme Männer halten dicht zusammen. Sie waschen stets ihre Hände in Unschuld.
Das Internat hat einen strengen Zeitplan. Aufstehen um Punkt sechs, Messe um Punkt sieben. Schule um Punkt neun. Ein eiserner Tagesrythmus, der nur an Wochenenden etwas durchbrochen wird. Bruder Robert verdanken wir, dass wir unsere Stunden flexibler gestalten. Er drückt ein Auge zu, wenn wir etwas beschädigen, wenn wir länger spielen, wenn wir in unserer Sprache miteinander reden. Und obwohl den Internatsschülern im Monat nur ein einziger Film zugebilligt ist, nimmt er Alex und Kumar und mich öfters ins entlegene Kino mit.
Gesang, Geplauder, Gelächter. An einem Sonntagnachmittag fahren wir, auf drei Schulbusse verteilt, zum fernen Sandstrand von Goa. Es ist unser langersehnter Jahresausflug. Unter den drei Buschauffeuren entsteht ein freundlicher Wettstreit. Wir Schüler heizen sie mit stürmischem Beifall an, immer schneller zu fahren, keinen der anderen vorbeifahren zu lassen, einander wenn möglich zu überholen. Bruder Antoine, Bruder Charles und Bruder Robert mahnen sie mit ihren Blicken, mit ihren Gesten zur Vorsicht, bis sie wieder der Abenteuerlust und den ohrenzerreissenden Schreie der Schüler nachgeben und es schweigend hinnehmen, dass das Wettrennen nie ganz aufhört. Drei Tage wollen wir am Strand von Goa verbringen, alle Klassen, drei volle Tage unter Kameraden, unter Freunden. Mehr als über die Stadt Goa oder den feinen Sandstrand, mehr als über das endlos blaue Meer freuen wir uns über die Zeit des Zusammenseins, ohne die strenge Internatsordnung, ohne Unterricht, ohne lästige Prüfungen.
Ein geplatzter Reifen zwingt uns anzuhalten. Während die drei Chauffeure einen Reifen auswechseln, verweilen wir Schüler am Ufer eines halb ausgetrockneten Sees. Einige Schüler werfen einen Kameraden ins Wasser, andere folgen ihrem Beispiel und bald ist auch der kräftige Bruder Antoine besiegt, er fliegt widerwillig ins Wasser. Fröhlich spielen wir im kleinen See, bespritzen einander mit Wasser, werfen einander Schlamm und giftgrüne Klumpen aus Algen zu.
Kurz nachdem wir losgefahren sind, hält der vorderste Bus plötzlich an. Bruder Antoine winkt den anderen Chauffeuren zu. Auch sie halten an. Bruder Antoine steigt aus dem vordersten Bus. Sein Gesicht wirkt blass. Er flüstert Bruder Robert und Bruder Charles etwas zu. Auch sie zeigen sich bedrückt, beordern uns, wieder in die Busse einzusteigen. Eifrig zählen sie die Kinder in den jeweiligen Bussen, befehlen uns, sitzenzubleiben, fragen uns nach einem unauffälligen Schüler. Anup, ein kleiner Knabe aus der fünften Klasse, wird vermisst. Wir haben ihn zuletzt am Seeufer gesehen, im Wasser, auch er hat fröhlich mit uns gespielt. Hastig fahren wir zurück. Bruder Antoine eilt zum Seeufer. Auch Bruder Robert und Bruder Charles.
Am Rand des verlassenen Sees ein paar Socken. Ein weisses Hemd schwimmt auf der Wasseroberfläche. Wo wir uns kurz zuvor ausgetobt haben, ist das Wasser getrübt, der Rest des Sees leuchtet grün, spiegelt den klaren Himmel wieder. Bruder Antoine, Bruder Robert und die erfahrensten Schüler unter uns springen in das Wasser hinein, tauchen unter, tauchen auf, tauchen immer wieder.
In der Abenddämmerung befreit Bruder Robert das vermisste Kind vom schlammigen Seegrund, vom Würgegriff listiger Algen. Er legt den zierlichen Knaben auf das steinige Ufer, kniet sich neben das Kind, presst das verschmutzte Wasser aus den Lungen. Dann klebt er seine Lippen auf die Lippen des Knaben, beatmet ihn, holt tief Luft ein, beatmet das regungslose Kind bis zur Erschöpfung. Dann legt Bruder Robert sich hin auf das staubige Ufer. Sein Körper, von der Sonne verbrannt, vom Schlamm halbbedeckt, zuckt zusammen. Bruder Antoine wäscht ihm das Gesicht, wäscht ihm seine Hände, seine Füsse.
In den frühen Stunden dieser Schicksalsnacht fahren wir zurück zur Schule. Bruder Robert und ich reisen im hintersten Bus, die Lichter im Innern des Busses gelöscht, sprachlos starren wir vor uns hin. Ich bewundere ihn. Was er alles auf sich nimmt, um uns zu schützen! Was er alles mitmacht, damit wir weiterkommen! Wie er die besten Jahre seines Lebens für uns opfert! Ich lehne meinen Kopf an seine Brust. Er hält mich fest, spendet mir Trost.
Aber ich hätte mich Bruder Robert nicht nähern dürfen. Ich hätte ihm nicht trauen dürfen. Nie lieben dürfen.
Bruder Antoine macht seine Runden entlang des langen Schulkorridors. Das Licht seiner Taschenlampe flackert über die weissen leeren Wände. Eine Weile später ist alles still, die Schule, die Textilfabrik, die Bahnlinie. Bruder Robert schleicht sich in unseren Lesesaal. Er legt sich auf meine Matte, knöpft seine Hose auf, drückt seinen Körper an meinen. Seine Hände führen meine Hände. Ich will ihn nicht berühren. Sein Atem widert mich an. Bruder Robert drückt meine Beine auseinander. Er verspricht mir Freundschaft, verspricht mir Wärme, verspricht mir Liebe.
”Ich wünschte, Bruder Antoine würde keine Hunde abknallen. Ich wünschte, du würdest ihn davon abhalten."
Bruder Robert presst seine Hand auf meine Lippen, lauscht in die Nacht.
”Du weißt, warum er sie abschiesst.”
Die Kinder aus dem Internat wie auch die Missionare essen in der Kantine der Mission. Aber für die mehr als hundert Knaben aus der Stadt Palem ist in unserer Missionskantine kein Platz. So essen die Knaben unserer Schule aus mitgebrachten Behältern unter den schattigen Bäumen. Sie lassen Essensreste auf dem Gelände liegen, was die Hunde aus der Umgebung auf das Spielfeld vor der Schule lockt. Und weil sie scheinbar niemandem gehören und niemand sich um sie kümmert, weil sie mit allen möglichen Krankheiten umherlaufen, erschiesst Bruder Antoine so viele wie er nur kann.
”Ein Hund ist ein Hund. Haut, Haar, Knochen. Hunderte von verdammten Flöhe dazu!”
”Aber auch sie sind Lebewesen!”
”Ohne Seele! Tiere sind nicht wie wir. Was ist mit dir bloss los?”
Er presst seinen Körper gegen meinen, nimmt meine Hand in seine.
Irgendwann donnert ein Zug durch die Nacht. Irgendwann heulen die Sirenen. Sie heulen voneinander zeitlich leicht versetzt, das Jaulen tollwütiger Füchse im Rudel, ihr Geheul aufbauend, ein Chor im Wettstreit, ein hoher Ton, ein beharrlicher Ton, eine Disharmonie der Klänge, unendlich schmerzlich, unendlich lang, unerträglich. Irgendwann flaut das Klagelied ab, ein Geheul nach dem anderen, die Töne geschwächt, ihre Dringlichkeit erlahmt, bis ein einziges Summen übrigbleibt, ein Jammern, ein Wimmern, das sanft in den Tod wiegt, in den Weltuntergang. Bruder Robert knöpft seine Hose zu, schleicht wieder lautlos hinaus, zurück in sein Zimmer.
Alex, mein Freund, wird seit letzter Nacht vermisst. Die Missionare wollen die Polizei nicht benachrichtigen.
”Es ist zu früh dafür”, meint Bruder Robert.
Bruder Antoine sucht nach dem Knaben in allen Winkeln der Schule. Bruder Charles ist sehr verunsichert. Als Leiter der Mission trägt er für das verschwundene Kind die Verantwortung. Mehrmals geht er zu den entlegenen, tiefen, dunklen Brunnen, in denen es keinen Tropfen Wasser gibt. Er lässt uns entlang der Eisenbahnlinie suchen, in den Zuckerrohrfeldern, in den Reisfeldern.
Kurz vor Sonnenuntergang hören wir sein Weinen. Er hat sich ins Dickicht einer Bougainvillae geflüchtet. Er ist verwirrt, steigt nur zögernd aus seinem Versteck. Er hat sich an den Dornen der Kletterpflanze verletzt. Kreuz und quer zeigen sich dünne geronnene Blutstriche auf seiner Haut. Sein Gesicht wirkt bläulich. Alex verweigert das Essen, lehnt das Trinkwasser ab, spricht mit niemandem. Ich nehme seine Wäsche entgegen. Für Devadas, den Dhobi. Bruder Robert bringt ihn zu seiner Familie zurück. Entlassen aus dem Internat. Er wird nie mehr zurückkehren.
Nachts, als alle anderen schlafen, lege ich seine besudelte Wäsche auf die Seite. Sein gelbgestreiftes Hemd ist gerissen, seine Socken voller Dornen, seine Hose dreckig. Auf der tiefblauen Hose sind Flecken, seltsame Flecken. Nun verstehe ich. Ich verstehe sein beharrliches Schweigen. Bruder Robert hat ihm womöglich das Hemd geschenkt, auch andere Sachen geschenkt, sich nachts neben ihn gelegt, hat seine Hände dorthin geführt, wo Bruder Robert sie hinführt, hat ihn geküsst, hat ihn berührt, hat sein Glied zwischen die Beine des Knaben gelegt, vielleicht ihm zugeflüstert, dass er nichts zu fürchten braucht, dass alles ein Geheimnis bleibt, dass er ihn liebt, wie er mich liebt.
Wie erkläre ich meinem Vater, dass ich nach Hause kommen möchte? Wie sage ich ihm, dass ich nie mehr in die Missionsschule zurückkehren will? Was erzähle ich dem Dorfvikar? Oder den neugierigen Nachbarn? Wie geht es weiter mit meiner Schule? Was wird aus meinen Träumen, einmal eine Universität zu besuchen? Muss ich alles für immer aufgeben? Die Filme, die Bilder, meine Bücher?
Die Briefe meines Vaters beunruhigen mich sehr. Ich freue mich, dass er mir regelmässig schreibt. Ich will alles wissen. Wissen, ob Thankachan seine Prüfungen bestanden hat. Ob Alice sich von ihrer Krankheit erholt hat. Ob Molly bereits sprechen kann. Welche Worte spricht sie? Was sagt sie? Was sagt sie, wenn sie ein Foto von mir sieht?
Vater beschreibt mir alles sehr detailliert.
"Vor einer Woche hat ein Feuer alle unsere Kashewbäume vernichtet. Nicht nur wir, sondern viele Familien haben alle ihre Bäume verloren. Es war Alice, die den roten Himmel auf der anderen Seite des Hügels sah. Zunächst dachten wir, es müsse ein kleines Wildfeuer sein. Wir sahen keine Flammen, nur die Rötung am Horizont. Im Laufe der Nacht brannte die gesamte Ostseite des Hügels. Später griffen die Flammen auf unsere Hütte über. Mein geliebter Sohn, alle unsere Bäume sind verloren. Unsere Hütte ist niedergebrannt. Auf unserem Boden stehen nun nur noch die Felsen. Auch die Teakbäume, die wilden Bäume, haben wir verloren. Wir wollten in ein paar Jahren unsere Hütte neu bauen, ein Haus daraus machen. Ein einziger Teakbaum hätte uns für alle Türen und Fenster gereicht. Was machen wir jetzt? Mein einziger Trost ist, dass du eine Ausbildung geniesst. Ich möchte, dass wenigstens eines meiner Kinder eine Schule beendet. Ich weiss nicht, ob ich in der Lage bin, deine Geschwister nächstes Jahr noch in die Schule zu schicken. Ich brauche sie, um die Kashewbäume zu pflanzen. Alles muss neu bepflanzt werden. Ich kann meine Familie kaum ernähren..."
Es gibt nichts anderes auf der Welt, das ich so sehr schätze wie meine Ausbildung. Ich möchte nicht mehr zurück auf die engen Bänke unserer Dorfschule. Ich möchte nicht mehr so leben, um das Schicksal meiner Geschwister zu teilen oder das der Eltern zu wiederholen. Ich möchte meine Schule beenden, eines Tages ein Diplom besitzen. Eine Arbeit. Ein Einkommen. Ich möchte meinem Vater nicht zur Last fallen, ich möchte nicht seine Träume zerstören. Mit jedem Jahr komme ich meinem Ziel näher. Aber es liegt nicht alles in meiner Hand. Bruder Robert kann mich entlassen. Er könnte mich jederzeit entlassen. Einen Grund dafür muss er nicht nennen. Er ist der Leiter des Internats. So muss ich es hinnehmen, wenn er mich berührt. Und wenn ich mich ihm widersetze, wenn ich alles Bruder Charles oder Bruder Antoine erzähle, wem würden sie glauben? Wen würden sie dann entlassen? Ich muss lange schweigen. Ich muss für immer schweigen.
Es ist mein vierzehnter Geburtstag. Im Internat findet eine Geburtstagsfeier statt. Bruder Robert überreicht mir eine Leinwand und Pinsel als Geschenk. Danach singen und essen wir. Glücklicherweise fällt mein Geburtstag auf einen Samstag. So kann mein Geburtstagsfest in unseren gemeinsamen Abend mit den Missionaren eingebaut werden. Die Missionare zeigen uns neue Spiele, die sie aus französischen Schulen kennen. Wir singen Lieder in malayalam, tamil und kannada. Obwohl wir im Internat unsere Muttersprache nicht sprechen dürfen, lernen wir alle diese Lieder auswendig. Und die Missionare singen französische Lieder, englische Lieder, andere Lieder. Bruder Robert ist ein sehr guter Sänger und spielt dazu auch noch auf der Gitarre.
"How many roads must a man walk down....before they call him a man?” [2]
Alle Lichter sind gelöscht, meine Klassenkameraden schlafen fest. Bruder Robert kommt an meinem Bett vorbei.
"Komm in mein Zimmer!“
Dann dreht er sich, geht rasch weg. Ich mache mir Sorgen. Wissen meine Schulkameraden, was mit mir geschieht? Wer alles weiss davon? Nachdem Alex von uns gegangen ist, hat es unter den Knaben des Internats Gerüchte gegeben. Manche wissen es. Sie wissen, dass es weitere Fälle gibt, aber sie nennen keine Namen. Wissen sie von mir? Und was kann ich dagegen machen?
Ich gehe in sein Zimmer. Er sitzt auf seinem Sessel, hält ein Geschenk in seinem Schoss.
"Für dich.”
Ich will das Geschenk nicht haben. Er öffnet die Packung für mich. Es ist ein gelbes gestreiftes Hemd. Er übergibt mir das Hemd, zieht mich auf seinen Schoss.
”Ich will nicht. Nie mehr! Nie!”
Bruder Robert sieht mich verletzt an. Die Packung mit dem Hemd lege ich auf sein Bett.
”Willst du es nicht haben? Ist es nicht schön, nicht gut genug?”
Mein Schweigen erträgt er nicht.
”Aber ich liebe dich!”
”Du liebst mich nicht. Du liebst niemanden.”
”Doch!”
”Nein, nein!”
”Wie bist du so sicher?”
Er presst seinen Mund an meinen, drückt mich an seinen Körper.
”Bitte, bitte lass mich gehen. Ich werde es niemandem sagen, wenn du mich gehen lässt, wenn du mich nie mehr berührst...”
Er knöpft seine Soutane auf, zwingt meine Hand zwischen seine Beine. Plötzlich dreht er mich um, wirft mich auf sein Bett. Er presst seine Hand auf meinen Mund, sodass ich ihm nicht widersprechen kann, nicht schreien kann. Nicht atmen.
Sonntag. Unser Wäscher Daas zählt die gewaschenen und gebügelten Soutanen der Missionare. Ein Schuss teilt die Luft. Ich sehe vorsichtig aus dem Fenster. Der Hund des Wäschers steht angebunden unter dem 'Neem' Baum. Er ist unversehrt. Diesmal trifft es zwei streunende Hunde. Sie taumeln auf dem Spielfeld vor der Missionsschule, ohne sich voneinander lösen zu können. Bruder Antoine zielt ein zweites Mal. Schiesst. Nur einer der Hunde wird vom Schuss getroffen. Die Hündin steht auf, will fliehen. Aber sie kann nicht. Das Glied des erschossenen Hundes steckt in ihr. Die Hündin dreht sich im Kreis herum, einen toten Hundekörper mit sich schleppend, hilflos. Sie bewegt sich ein Stück, fällt zu Boden, steht mühselig wieder auf. Sie bellt, jault, wimmert. Bruder Antoine schiesst wieder. Ein zweites Mal. Ein drittes Mal. Die Körper der Hunde zucken auf dem staubigen Spielfeld. Bedeutungsloses Leben. Minderwertiges Leben. Eine Weile später ist alles still. Nur der Hund des Wäschers wimmert weiter. Hundeleben.
[1] Berufswäscher
[2] Aus einem Lied von Bob Dylan. Wie viele Wege muss ein Mensch begehen...bis man ihn ein Menschen nennt?

Zwei Männer nehmen demonstrativ unter zwei verschiedenen Bäumen Stellung. Der eine steht, siegessicher, sein Hemd offen. Er wirkt kräftig, seine Brust voller Haare, seine Lungen gefüllt mit Luft. Er hat nichts zu verlieren. Er hat eine kleine Schar um sich gesammelt. Sie sind alle betrunken. Ihre Loyalität hat er gekauft, mit frischem hausgebrannten Schnaps, zu viel Schnaps, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihm zu helfen. Nun muss er allein kämpfen, der einsame Soldat bei seinem letzten Krieg. Karna[1] gegen Ardchuna[2]. Kain gegen Abel. Bruder gegen Bruder. Er ist bereit zu sterben. Denn er hat alle Kriege gesehen, alle Scharmützel überlebt, nichts kann ihn bezwingen. Stolz steht er, zu vorderst auf dem Kriegsplatz, Kurukschethra[3]. Er ist ein Kind der Sonne, der Erstgeborene, seine betrunkene Armee hinter sich. Wahrheit und Gerechtigkeit sind auf seiner Seite. Wer kann dies bestreiten?
Der andere Mann hockt auf dem Erdboden. Auch dies demonstrativ. Denn er hat hart gearbeitet. Sein Rücken ist gebeugt, seine Lungen sind leergepresst, seine Haut voller Falten. Er hustet immer wieder. Möglicherweise hat er Tuberkulose. Wenn seine Zeit gekommen ist, dann geht er. Keinen Augenblick früher. Er kämpft gern allein. Er braucht keine betrunkene Armee. Er fürchtet keine Armeen, nicht die der Engländer, nicht die der Grossgrundbesitzer, nicht die seines Bruders. Auch braucht er keinen Schnaps. Seine Worte sind scharf wie Messer, sein Blick tödlicher als jede Kugel. Das Recht steht auf seiner Seite. Auch er hat alle Kriege gesehen, alles überlebt. Nur der Allmächtige kann ihn bezwingen. Wer wagt wohl, dies zu bezweifeln?
Mein Onkel Joseph ist aus der Armee entlassen. Auf eigenen Wunsch. Seine Pension, hundertfünfzig Rupien monatlich, ist lächerlich. Nach zwanzig Dienstjahren in der indischen Armee ist er zurückgekehrt. Er hat keine Ersparnisse, keinen Flecken Boden, kein Zuhause. Nichts hat er, ausser Narben. Und seinen Stolz. Er steht immer sehr gerade, aufrecht, sein Blick nach vorne gerichtet. Er kann nicht anders. Er ist nicht viel grösser als Vater, aber er wirkt viel grösser, kräftiger. Er ist der geborene Krieger. Er hat die helle Haut meiner Grossmutter und die Grösse Ashans geerbt. Nur geht er nie gebückt, er marschiert stets mit wachsamen grossen Augen. Und wenn er Menschen begegnet, lächelt er kurz, geht an ihnen vorbei ohne allzu viele Worte. Worte sind nicht seine Stärke. Worte sind ihm suspekt. Autoritäten verachtet er. Er hat lange genug gehorcht.
Ashan, sein Vater, hat ihm mit der Spitze seines Regenschirms angedeutet, wo er seine Hütte bauen soll. Auch erhält er drei Hektar Boden, seinen Anteil aus Ashans Besitz. Mein Vater soll ebenfalls drei Hektar erhalten. Ashan hat eine Trennlinie zwischen den beiden Teilen gezeichnet, mit seinem Regenschirm. Eine Linie in der Luft. Danach hat sich Ashan zurückgezogen. Er dient als Sakristan weit weg von seiner Familie. Jahrelang hatte mein Onkel, den wir respektvoll Perappan[4] oder spöttisch 'den General' nennen, an die Familie meines Grossvaters Ashan Geld geschickt, einen Teil seines Solds, Monat für Monat. Zwanzig gottverdammte Jahre!
"Die Hälfte des Grundstücks gehört mir! Ich habe mein Blut für diesen Boden geopfert!Jeden Monat die Hälfte meines Solds nach Hause geschickt."
Davon will mein Vater nichts wissen. Hat er seinen Sold an Ashan geschickt, dann soll er sein Klagelied vor Ashan singen. 'Der General' gibt nicht nach. Mit dem Geld, das er nach Hause geschickt habe, habe Vater seine zehn Hektar Boden am Berghang gekauft. Behauptet er. Hätte mein Vater nur eine Ahnung von Gerechtigkeit, solle er die Hälfte dieses Grundstücks an ihn abtreten. Mein Vater schmunzelt. Wenn sein älterer Bruder die Hälfte seines Bodens haben will, soll 'der General' ihm die Hälfte seiner Pension abgeben. Und die Hälfte der einmaligen Abfindung, die der Soldat bei seiner Pensionierung erhalten hat. Der in Ruhestand getretene Soldat ist empört. ”Geld, das ich mit meinem Blut verdient habe!” Der kleinere Mann kontert. Er habe geschwitzt, er habe als Tagelöhner gearbeitet, seit seinem sechsten Lebensjahr kämpfe er mit der Erde. Er erhalte keine Pension, keine Privilegien für seine Kinder. Keine Handvoll Erde werde er an seinen älteren Bruder abtreten. Auch wenn alle Panzer dieser Welt ihre Kanonen gegen seine Brust richteten.
"Es ist mein Grundstück. Es ist allein auf meinen Namen eingetragen. Die Steuern dafür zahle ich! Der General kriegt nichts von mir! Nichts!"
Die allmächtige Instanz, die diesen Streit unter Brüdern richten soll, ist der Dorfvikar. Vor weltlichen Gerichten hätte mein Onkel gar keine Chance. Alle Dokumente des Bodenerwerbs sind von Vater unterzeichnet. Er hat den Boden am Berghang rechtmässig erworben. Das Recht spricht eine eindeutige Sprache. Der Priester soll zwischen den Brüdern vermitteln. Aber der ehemalige Soldat, 'der General', traut keinem Priester. Keinem Vikar auf Erden, keinem Bischof, keinem Papst. Er wollte den Priester für sich gewinnen. Nur deshalb hat er auch dem Vikar seinen Schnaps angeboten. Auch der Vikar ist leicht betrunken. Um seine Betrunkenheit zu verbergen, genehmigt er sich einen Mittagsschlaf. Er lässt durch seinen Diener ausrichten, die Brüder mögen bitte warten. Priestersprache. Mein Vater traut ebenfalls keinem Priester. ”Hätten sie nichts zu verbergen, bräuchten sie nicht so weisse, so lange Soutane.”
Metzger Mani und Betrüger Anthony haben das Gespräch unter Brüdern eingefädelt. Der Vikar soll den Bruderzwist zugunsten des zurückgekommenen Soldaten schlichten. Metzger Mani und Betrüger Anthony tun das Menschenmögliche für den Frieden. Auch der Priester will nur den Frieden. Das versteht sich von selbst. Die Vermittler gewinnen jedenfalls. Schnaps oder Geld oder beides von unserem 'General‘. Von meinem Vater erhoffen sie ähnliches. Mani und Betrüger Anthony werden darauf drängen, dass mein Vater die Hälfte unseres Bodens an meinen Onkel abgebe. Auch wenn 'der General' nur einen einzigen Hektar Land von ihm bekäme, hätten sie Grund zum Jubeln. Sie dürfen sehr lange hoffen.
Perappan will kein Wort mit seinem Bruder wechseln. Mein Vater hat ihm ebenfalls nichts zu sagen. 'Der General' hat nur wenig von dem Schnaps getrunken. Er will einen klaren Kopf bewahren. Er schnappt sich einen trockenen Ast des Mangobaumes, unter dem er steht. Mit einem Kraftakt bricht er den Ast entzwei. ”Ich breche seine Knochen”, droht er, damit mein Vater dies hören kann. Mein Vater behält die gegnerische Armee im Auge. Er gibt sich selbstbewusst. Niemand kann ihn vernichten.
”Du kannst China und Pakistan, auch deine Schwiegermutter besiegen. Aber nicht einmal meine Haare kannst du krümmen”.
Schreit Vater 'dem General' ins Gesicht.
Der Priester ist betrunkener, als die verfeindeten Brüder zunächst angenommen haben. Mein Onkel ruft mich beiseite. Ich will nicht ins feindliche Lager wechseln. Ich sehe meinen Vater an. "Darf ich zu ihm hinüber?” Vater liest meine Frage von meinem Gesicht ab. ”Geh doch, mal sehen, was er dir zu sagen hat.” Metzger Mani und Betrüger Anthony will ich nicht begegnen.
Die Vorlesungen an der Universität von Madras sind wegen eines Streiks der Studentenschaft unterbrochen. So befinde ich mich wieder in meinem Dorf, inmitten verhärteter Fronten. Mein Onkel glaubt, ich könnte meinen Vater zum Umdenken bewegen. Er setzt sich auf eine Schulbank im Schatten der kleinen Gebäude.
”Vor zwanzig Jahren...”
Er greift weit zurück, der Soldat in den Wolken.
”Nachdem alle eingeschlafen waren, hatte ich mich aus unserer Grossfamilie weggeschlichen. Lange vor deiner Geburt. Ich hatte ein Bettlaken mitgenommen. Ich hatte das Laken nur mitgenommen, um das sechs Monate alte Kalb damit einzuwickeln, dessen Kopf, damit es keinen Lärm verursacht."
Seine Geschichte ist mir nicht unbekannt. Aber ich freue mich auf seine Schilderungen. Er, der einzige Bruder meines Vaters, ist vor meiner Geburt aus der Familie Ashans durchgebrannt. Ashan hat sich nie um die Familie gekümmert, und Perappan, der einen ausserordentlichen Appetit hatte, bekam selten genug zu essen. Die Arbeit auf den Feldern schien ihm äusserst hart und nutzlos. Wieso Reis anpflanzen, wenn Elefanten und Wildschweine alles niedertrampeln? Wie lange erträgt es der Mensch, den Naturgewalten ausgeliefert zu sein? Wie lange an die Barmherzigkeit Gottes glauben, wenn er die Menschen Krankheiten, Hungersnöten, Katastrophen aussetzte?
So hatte er sich dazu entschlossen, mit einem Kalb von zu Hause wegzuschleichen. Geld konnte er nicht mitnehmen, denn die Familie hatte gar keines. Er war durch die Nacht gelaufen, hatte den Fluss durchquert. Vor Tagesanbruch hatte er sich vor ein Militärkamp am Ufer des Flusses gestellt. Mein Onkel wollte einen Offizier sprechen. Er konnte dem Militärkoch das Kalb verkaufen. Der Mann gab ihm kein Geld, nahm ihn dafür nach Mysore mit. Unterwegs polierte er die Schuhe der Soldaten, hatte auf diese Weise etwas Geld verdient, verbrachte Monate in der Nähe der Militärschule in Mysore.
Ein freundlicher Soldat gab ihm den Tipp, sich ebenfalls beim Militär zu bewerben. Die Armee brauchte dringend junge Männer. Als Schuhpolierer in der Umgebung der Militärkaserne verdiente er nur so viel, wie zum Überleben notwendig war. Auch sah er noch zu dünn und abgemagert aus für eine Aufnahme ins Militär. So liess er sich als Lastenträger bei der grössten Metzgerei der Stadt Mysore anstellen. In Fabriken ausserhalb der Stadt Mysore wurde Knochenmehl produziert. Er trug die Knochen geschlachteter Tiere, stellte sie bereit für den Transport. Aber Knochenstücke mit dem geringsten Anzeichen von Fleisch legte er, ohne dass es jemand merkte, beiseite.
Spät in der Nacht, in einem leeren heruntergekommenen Haus ohne ein Dach, schnitt er die dünnen Fleischstücke zusammen. Ein junges molliges Mädchen kochte für ihn die Fleischreste. Sie war ebenfalls aus dem Bundesland Kerala, war ebenfalls von ihrer armen Familie weggezogen. Der ältere Mann, der Zwiebelverkäufer Mathai, dem sie aus Liebe gefolgt war, liebte sie nicht. Statt dessen zwang er sie, betrunkenen Soldaten gegen ein paar Geldscheine Liebesdienste zu leisten.
Onkel Joseph hatte sieben Jahre lang eine Schule besucht. Dazu war er ein Meter fünfundsiebzig gross, hatte den gewünschten Brustumfang, gute Augen, war gesund. Dies waren damals die Anforderungen für die Aufnahme als Soldat bei der Armee. 'Sepoy', der Fusssoldat, war der letzte Rang des indischen Militärs. 'Der General' wurde Sepoy, marschierte Tag und Nacht, polierte Offiziersschuhe. Er machte Botengänge für Offiziersgattinnen, steckte Prügel ein, lernte zu prügeln. Er wurde verachtet. Er lernte zu verachten. Er hatte keinen Vater mehr, keine Mutter, keine Geschwister.
Er lag tagelang im Sand, eingegraben in der Wüste Rajasthans, mehr als zweihundert Kilometer von der Wüstenstadt Jaisalmer. Am Tag kochte sein Körper, wie eine in glühende Asche gesteckte Kartoffel. Er war von Kopf bis Fuss mit Sand eingedeckt, lag stundenlang, ohne sich zu bewegen. Nur sein mit Kakteen geschmückter Helm und sein nutzloses Gewehr blieben oberhalb der Sandfläche. Er lag in der brennenden Sonne, der Sandsturm blies ihm ins Gesicht. Er rechnete damit, jederzeit von den Panzern der pakistanischen Armee oder, noch wahrscheinlicher, der eigenen Armee überrollt zu werden.
Er war kurz nach seiner Rekrutierung zu der pakistanischen Front beordert worden. Kurz nach der Teilung Indiens brachen die Jahrhunderte alten Animositäten aus. Muslime schlachteten Hindus zu Ehren von Allah, Hindus schlachteten Muslime zu Ehren ihrer Götter. Indien war gerade sechs Monate alt, aus der Kolonialherrschaft Britanniens entlassen, gespalten in ein mehrheitlich muslimisches Pakistan und ein mehrheitlich hinduistisches Indien. Beide Länder stellten ihre Armeen auf. Soldaten ohne Waffen. Manche Truppengattungen bloss mit Schlagstöcken ausgerüstet, mit Funkgeräten, die nicht funktionierten, mit Offizieren, die die Lebensmittelrationen ihrer Soldaten auf offenen Märkten verkauften. Mit Generälen, die bei Nacht sich selbst bereicherten und bei Tag in ihren Festungen sassen, Tee tranken und Bridge spielten, wie die Engländer es sie gelehrt hatten. Dafür marschierte ihr Soldatenvolk links rechts links rechts, Tag und Nacht hindurch, schwerbeladen, mit Gewichten in den Rucksäcken, mit schweren Bolzen. Anstelle von Granaten übte man mit rundlichen Steinen.
Einen Moment lang denke ich an unsere Spiele am Flussufer. Meine Geschwister und ich bastelten Gewehre aus Bambus. In den Hosensäcken trugen wir trockene Kugeln aus Ton. Am Fluss spielten wir Krieg. Wir krochen über Sanddünen, versteckten uns in den Sträuchern und kletterten auf hohen Bäumen. Wir bauten Schiffe aus den Stämmen von Bananenbäumen und segelten über Teiche und Seen. Wir eroberten Festungen aus Fels und Gebiete aus Wasser. Wir stürzten unseren Gegnern von einem Felsen in der Mitte des Flusses und hissten selbstgebastelten Fahnen. Und wenn jemand sein Knie oder Ellbogen verletzte und leicht blutete, trugen wir ihn stolz auf unseren Schultern und zeichneten ihn mit Papiersternen und Tapferkeitsmedaillen aus.
„Unsere Gegner waren Fanatiker. Sie glaubten, dass sie in einem muslimischen Staat glücklicher sein könnten als in einem demokratischen. Und fanatische Hindus wollten nicht mehr mit den Moslems zusammenleben. Wir Soldaten hatten keine Waffen und wir wollten auch keinen Krieg.“
Der ‚General’ weckt mich aus meinen Träumen.
Während entwurzelte Menschenmassen von Pakistan nach Indien und von Indien nach Pakistan strömten, lag 'der General' eingegraben im Sand. Noch gab es keinen Krieg, noch blieben die Panzer der beiden jungen Nationen auf Kasernenarealen stehen. Am Tage vergewaltigten tollwütige Muslime Hindu-Frauen, durchschnitten ihre Kehlen, stopften ganze Züge mit Leichen voll. Nachts schickten sie die Züge in Richtung Indien. Aufgebrachte Hindu-Fanatiker taten ebenso, vergewaltigten und mordeten, schickten blutüberströmte Leichenzüge nach Pakistan. Familien liessen Grund und Boden, Nachbarn und Verwandte zurück, um mordenden Banden zu entkommen. In den Tälern von Kashmir und an den Ufern des Indus kämpfte man bereits erbittert, ohne dass weder Indien noch Pakistan den Krieg erklärt hatten. Ein Sturm des Hasses fegte über die Wüste von Rajasthan.
Eines Tages rollten die Panzer, verirrt in Sandstürmen, wild umherschiessend. Hier jubelten pakistanische Soldaten, wenige Kilometer entfernt jubelten die indischen Soldaten. Während des ganzen Krieges hielt er seine Stellung. Eingegraben im Sand, liess die eigenen Panzer an sich vorbeirollen. Er hoffte, dass sie nicht über seinen Leib rollten, sehnte sich nach den Ruhestunden, nach dem rationierten Whisky in den Kasernen, sehnte sich nach dem Duft der Prostituierten ausserhalb der Kasernen. Er lebte für sich, nur für sich allein, er lebte für den Tag, nur für den einen Tag vor sich. Ob er lebend aus dem nächsten Gefecht kommen würde, war ungewiss. Am ersten Tag in der Wüste Rajasthans holte er sich die Gonorrhoe. Am letzten Tag des Krieges bohrte sich eine Kugel in seinen Schenkel.
Nachdem die Kugel entfernt worden war, wachte er auf in einem Feldlazarett in der Wüste und sehnte sich nach seiner Mutter, nach meiner Grossmutter. Er schrieb ihr, schickte ihr Geld, zwanzig Rupien, seinen ganzen Sold. Ashans Familie hatte geglaubt, der Junge sei tot. Grossmutter wusste, dass er durchgebrannt war, aber wohin er gegangen war und ob er noch lebte, wusste sie nicht. Dazu ahnte niemand, dass er so weit entfernt von der Familie war, in einer Wüste, wo die Menschen eine ganz andere Sprache sprachen. Bei der Armee gab es Menschen aus allen Teilen Indiens. Sie sprachen tamil oder kannada, oder bengali, sie hatten sehr unterschiedliche Muttersprachen. Er musste, wie auch jeder andere Soldat, Hindi lernen. Seit der Genesung hatte er der Familie regelmässig geschrieben, dazu noch Geld geschickt, mal weniger, mal mehr, alles, was er nur sparen konnte. Erst nach zwei Jahren wurden ihm Ferien genehmigt, knapp zwei Monate. Dann reiste er zweitausend Meilen in den Süden, schwerbeladen mit seinem Armeekoffer, mit seiner khakifarbenen Uniform, mit seinen ersten Narben.
Sieben Tage nach seiner Ankunft heiratete 'der General'. Meine grosse Mutter hatte ihm eifrig eine junge Frau ausgesucht. Ashan hatte ihr dazu freie Hand gegeben. Die Frau stammte aus Iritty. Grossmutter und der Vater der jungen Frau einigten sich auf eine Mitgift von vierzig Gramm Gold. Dazu dreissig Silbermünzen.
Dass sich der junge Soldat knapp zwei Monate nach der Vermählung in der Kaserne zurückmelden musste, dass er zweitausend Meilen zurück nach Nordindien fahren würde, ohne seine Frau, störte den Vater der jungen Frau nur wenig. ”Schicksal aller Soldatenbräute”, scherzte er darüber. 'Der General' sah sich die scheue Frau an, kurz vor der Hochzeit. Ein einziges Mal, wie es der Brauch war.
Beim formellen Besuch des künftigen Bräutigams bei der Familie der Frau brachte sie dem jungen Soldaten Tee. Sie zeigte sich scheu, schön gekleidet, ihr Mund bedeckt mit der Spitze ihres seidenen Saris. Er fragte nach ihrem Namen. Sie antwortete mit leiser Stimme, verschwand alsbald im Hinterhof des elterlichen Hauses. Am Hochzeitstag ging mein Onkel, wie es Sitte war, zur Familie der Braut. Er blieb drei Tage dort. Am vierten Tag kehrte er zur Familie Ashans, zu seiner Familie zurück, die scheue Braut hinter ihm her trödelnd.
Die junge Frau, die 'der General' heiratete, war im fünften Monat schwanger. Als der Soldat dies feststellte, weckte er meine Grossmutter, sie weckte meine Mutter und meinen Vater. Die junge Frau weinte. Grossmutter packte ihre Kleider zusammen, ihren Schmuck, Vater zündete eine Fackel an, sie begleiteten die junge Frau noch in derselben Nacht über den Fluss. Bei Tagesanbruch brachten sie die Frau zu ihren Eltern zurück. Ein beschädigter Tonkrug, den man nicht brauchen konnte. Meine Grossmutter regelte die Finanzen, hielt dreissig Rupien zurück, Umtriebskosten einer missglückten Ehe. Den Verwandten sagte man, die Frau sei geisteskrank, sei um Mitternacht aus dem Ehebett weggeschlichen, habe den Fluss überquert. Eine Schlafwandlerin, die man vergessen sollte. Bis die Tragikomödie in aller Munde war, hatte der frischverheiratete Soldat seinen Koffer gepackt, seine lange Reise zurück zur Kaserne angetreten. Während seiner langen Fahrt schrieb er der jungen Frau aus Mysore, mit der er seinen Hunger geteilt hatte, auch seine Einsamkeit. Er hatte die Frau des Zwiebelverkäufers aus den Augen verloren, aber nicht aus dem Sinn. Eine Antwort bekam er nicht.
Zwei Jahre später wurde er 'Haveldhar'. Er hatte eine winzige Stufe der Militärhierarchie erklommen. Mit seiner Primarschulbildung konnte er kaum weiterkommen. Er wurde Assistent eines Ausbildners, hatte Macht über junge Rekruten, liess sie links rechts links rechts marschieren, schwere Gegenstände hin- und hertragen. Auch nahm er ihnen ihre Rationen an Whisky weg, ihre Konservendosen, liess sie für sich schuften. Im Gegenzug drückte er, bei geringeren Abweichungen, bei mangelnder Pünktlichkeit oder bei Nichteinhaltung festgesetzter Normen ein Auge zu.
Nach zwei Jahren Dienst bei der Armee hatte der ‚General’ wieder Anrecht auf Ferien. Meine grosse Mutter suchte eine junge Frau aus, regelte die Mitgift, setzte das Datum fest. Sie nahm die Frau beiseite, um diskret ihren Bauch zu berühren, um festzustellen, dass sie nicht schwanger war. Eine zweite Tragödie konnte sie ihrem Sohn nicht zumuten. Kurz nach seiner Ankunft sah Onkel Jose die Braut an. Sie servierte ihm Tee, in einen seidenen Sari gekleidet, scheu, schweigend, wie es Sitte war. Nach zehn Tagen fand die Hochzeit statt. Der ,General’ verbrachte die ersten drei Tage bei der Familie der Braut, kehrte mit der Frau am vierten Tag zurück. Sie war scheu, sie schwieg, sie trödelte hinter ihm her.
Noch in der ersten Nacht bei der Familie Ashans wurde die Ehe vollzogen. Die Frau stand früh auf, bereitete ihrem Mann einen Tee. Sie brachte auch der Schwiegermutter, dem jungen Bruder ihres Mannes und seinen Schwestern Tee. Dann zog sie sich in die Küche zurück, um die Erlaubnis ihrer Schwiegermutter abzuwarten, bevor sie etwas zu sich nahm. Meine Grossmutter eilte in die Küche, bat ihre 'neue' Tochter, mit ihr Tee zu trinken. Die junge Frau trank Tee, bereitete danach das Frühstück, bediente ihren Mann und dessen Familienangehörige, nahm die Wäsche ihres Mannes mit, auch die der Schwiegermutter. Sie eilte zum Bach hinunter, die besudelte Wäsche zu reinigen, bevor sie Brennholz sammelte, das Mittagesssen kochte, ihrem Mann sein Essen brachte, immer auf ihn wartend.
Sie war eine wunderbare Frau, so wunderbar seltsam, mit einem seltsamen scheuen Lächeln. Man hätte es an ihren Augen ablesen müssen. Drei Tage bevor 'der General' sich zurück in die Kaserne melden musste lag sie tot im Bett. Es gab keine Anzeichen von Schlangenbissen oder Gewalteinwirkungen von aussen. Und obwohl alle sich wunderten, was mit der jungen Frau geschehen war, gab es keine Möglichkeit, die Tote medizinisch zu untersuchen. Die weit entfernten Krankenhäuser waren sogar für Lebende schwer zugänglich. Sie war ein Engel und nicht für diese Welt bestimmt, sagte der Pfarrer bei ihrem Begräbnis.
An einem lichtüberfluteten Morgen begleiten wir Onkel Jose zur Bushaltestelle am Flussufer. Vater hatte es auf sich genommen, den schweren Militärkoffer zu tragen. Er ging uns voraus. Der ‚General’ trug sein Militäruniform. Onkel Jose trug mich auf den Schultern, er liess mich seine Mütze tragen. Grossmutter hatte nachts zuvor allerlei Gebäck für ihren Sohn vorbereitet. Sie lief hinter uns. Niemand sprach. Am Flussufer liess er mich hinunter. Wir warteten auf den Fährmann, sahen ihm zu, wie er über den leicht geschwollenen Fluss zu uns hinüber ruderte. Onkel Jose drängte uns, am unseren Ufer zu bleiben. Er wollte alleine fort fahren. Bevor er in das kleine Boot einstieg, umarmte Onkel Jose Vater. Er umarmte auch Grossmutter, flüsterte ihr ein paar Worte zu. Dann beugte er sich zu mir hinunter und gab mir seinen Füller.
„ Schreibst Du mir, wenn Du etwas grösser bist? Ein Soldat trägt Kugeln in seiner Tasche. Keine Füller.“
Er küsste mich auf die Wange und stieg in das kleine Boot. Nach drei Tagen und zwei Nächten war er zweitausend Meilen entfernt, ein Soldat in den Wolken.
Er wurde von Kaserne zu Kaserne beordert, marschierte in den kargen dornigen Feldern Zentralindiens, überquerte die Teeplantagen von Darjeeling, überlebte die Wälder von Assam. Immer wieder schrieb er an die Frau des Zwiebelverkäufers, ohne eine Antwort zu erwarten, ohne zu wissen warum. Er trank viel, kämpfte mit betrunkenen Soldaten, verbrachte seine freien Tage in den Bordellen Indiens, holte sich einen Tripper, Gonorrhoe und Syphilis, steckte sich immer wieder an, bis die Chinesische Armee in Assam und Ladakh einmarschierte und ganz Indien in Schrecken und Panik versetzte.
Mao Tse Tung und Tschu En Lai hatten mit dem nichtsahnenden Ministerpräsidenten Indiens, Pandit Nehru, ihre Freundschaftshymnen gesungen "India China Bhai Bahi", Inder und Chinesen sind Brüder, um plötzlich Abertausende von Soldaten über den Himalaya zu schicken und so Indien unerwartet vor vollendete Tatsachen zu stellen. Onkel Joseph wurde nach Ladakh beordert, fünftausend Meter über dem Meer. Er grub sich ins ewige Eis, lag von Nebel umhüllt, lauschte dem Knall der Gewehre, lauschte dem Widerhall der Gebirge, wartete auf den Angriff der Gelbgesichter. Er fror sich fast zu Tode.
Er träumte von den wunderbaren warmen Tagen in der Wüste Rajasthans, von dem Siegeszug indischer Panzer, vom weichen Fleisch wolllüstiger Dirnen, von ihrem Duft, von der Wärme ihrer Brüste. Von der sanften Stimme des molligen Mädchens, das er im fernen Mysore einst kannte, mit dem er seinen Hunger und seine Einsamkeit geteilt hatte, und zu der er lebend zurückfinden wollte.
Er lag im Eis, seine Finger tot, seine Füsse tot, sein Glied gefroren. Kugeln zischten an ihm vorbei. 'Der General' wusste nicht sicher, ob es seine eigenen Offiziere waren oder ob es die Chinesen waren, die ihn ins Jenseits befördern wollten. Er hätte gerne die Fronten gewechselt. Er hatte zu viel Hunger und zu viel Armut gesehen, er hatte die Nase voll vom Gehabe der Mächtigen, von den oberen Kasten. Er hatte in Bombay und Kalkutta und Delhi die Abgründe der Hölle gesehen. Er war Kindern begegnet, Sieben-Acht oder Neunjährige, Göttern geweiht. 'Devadasi'. Liebesdienerinnen, Sklavinnen der Priester.
Das Freie Indien unter Nehru und Patel, unter den korrupten arroganten Feudalherren der Kongresspartei, dieses Indien hätte er gerne geopfert, für Brot und Zuhause, für die Möglichkeit, erhobenen Hauptes zu gehen, ohne dass ein Brahmane[5] ihn für dreckig und unberührbar hielt. Indien mit seiner Armut und der Schande des Kastenwesens war für ihn wertlos, er wollte für dieses Indien nicht sterben. Er wollte nicht sterben und im ewigen Eis begraben liegen, ohne dass er je gelebt hatte. Er war von Zweifeln geplagt, wusste nicht, wofür er kämpfte, wofür er lebte und wofür es sich lohnen würde, überhaupt noch zu leben. Auch diesmal traf ihn eine Kugel, am letzten Tag des Krieges.
Er verfluchte den Krieg. Er verfluchte die Brahmanen und die Kommunisten, alle Politiker und Priester. Er verfluchte Kennedy und den Papst.
An einem verregneten Monsunmorgen stand 'der General' vor dem überschäumenden braunen Fluss, der die Bundesstaaten Mysore und Kerala trennte, eine Meile entfernt vom Hause Ashans. Er hatte seine Ankunft seit langem angekündigt, war aber mehr als zehn Tage verspätet. Meine grosse Mutter hatte sich täglich beim Fährmann Kochunni erkundigt und war jedes Mal enttäuscht nach Hause zurückgekehrt. An jenem Tag sass der Fährmann neugierig am Flussufer. Der Fluss hatte den Höchststand erreicht, brachte entwurzelte Bäume, abgeschwemmte Hütten und Tierkadaver aus den angrenzenden Wäldern mit. Als Kochunni den Soldaten am gegenüberliegenden Ufer sah, mit seinem schweren Militärkoffer und noch dazu die dicke unbekannte Frau an seiner Seite, signalisierte er dem Soldaten, dass eine Flussüberquerung am gleichen Tag unmöglich sei. Statt mit dem winzigen Kanu eine Flussüberquerung zu riskieren, rannte er eine Meile zur Familie Ashans, um Grossmutter die Ankunft ihres Erstgeborenen bekanntzugeben.
Als Grossmutter die fremde Frau an der Seite des Soldaten sah, sank sie zu Boden. Es war unerhört, dass ein Mann seine eigene Frau auswählte, auch wenn seine zwei vorherigen Ehen missglückt waren. Zudem war die unbekannte Frau so dick, dass meine Grossmutter nicht nur die bevorstehende Kanufahrt über den geschwollenen Fluss fürchtete, sondern auch die spöttischen Bemerkungen ihrer Nachbarn, vor allem die der Frauen. Kochunni riskierte sein Leben, um die beiden seltsamen Erscheinungen, den Soldaten in voller Uniform und das voluminöse Weib, herüberzurudern.
Noch lebten wir in der Grossfamilie Ashans, kurz nach meiner Erstkommunion, nach dem Tode Babus. Ashan kam herbeigeeilt, bat den Vikar um eine nachträgliche kirchliche Verehelichung, einen Wunsch, den er dem zuständigen Bischof vortrug. Der Bischof exkommunizierte den Soldaten, exkommunizierte auch die Frau. Denn sie hatten zusammengelebt ohne kirchlichen Segen, ohne das Sakrament der heiligen Ehe. In Todsünde. 'Der General' und seine Frau waren in aller Ewigkeit verdammt.
Mir wurde daraufhin strengstens verboten, die Frau 'Peramma', Tante, zu nennen. Ich durfte sie 'Chedathi', ältere Schwester, nennen, respektvoll genug, aber unter ihrer familiären Stellung und Würde. 'Der General' hatte das einst mollige Mädchen, die Frau des Zwiebelverkäufers Mathai, in Mysore ausfindig gemacht, vor einem Standesbeamten geehelicht, sie von ihrem Schicksal als Prostituierte befreit. Aber Ehen vor dem Standesamt hatten keine Gültigkeit vor der Kirche, ihre Machthaber hatten ihre eigenen Gesetze, Sakramente himmlischen Ursprungs, zu deren Beachtung sie verpflichtet waren.
Am Ende seines zweimonatigen Militärurlaubs musste der Berufssoldat in die Kaserne zurück, wieder verübten muslimische Fanatiker Terrorakte im Kaschmirtal, wieder bildeten sich Kriegswolken über der Wüste Rajasthans und tausend Meilen entfernt, im Osten Indiens, an der Grenze zu Ostpakistan. Der Soldat nahm seine, in der eigenen Familie verschmähte Frau mit. Er war dank seiner Narben in der Militärhierarchie noch eine Stufe hinaufgeklettert, durfte in den Soldatenvierteln in einer subventionierten Mietwohnung in Kalkutta wohnen. In der Hölle.
Ein junger Mann kommt zur Kirche geeilt, lässt den schlafenden Vikar wecken. Ein älterer Dorfbewohner sei in Ohnmacht gefallen. Die Familie rechne mit dem Tod des alten Mannes. Der Vikar steht erschrocken auf, sein Kopf noch schwer vom hausgebrannten Schnaps, er kann unmöglich dem alten Mann die Letzte Ölung verweigern. Er stülpt sich in Eile seine festlichen Gewänder über, schleicht sich aus dem Pfarrhaus, wandert würdevoll durch das Dorf.
Metzger Mani und Betrüger Anthony reden auf meinen Vater ein, bitten ihn, noch zu bleiben, bis der Priester zurückgekehrt sei. Vater sagt mir, dass er zum nahegelegenen 'Teeshop' gehe. Ein armer Mensch habe auf Priester zu warten, das sei sein Schicksal, fügt er hinzu. Er verschwindet mit dem Versprechen, zur Verhandlung zurückzukommen, sobald der Vikar sich wieder meldet. Auch 'der General' fühlt sich verschaukelt, dass der Priester ihn warten lässt. "Mao hätte solch einen Parasiten geköpft", schimpft er. Aber er hat keine Wahl, auf irgend eine Art muss er sein Anrecht auf einen Teil des Berghangs geltend machen, den sich Vater während seiner Zeit bei den Militärs angeeignet hatte.
"Mon[6], meine drei Kinder haben nur die gemieteten Käfige des Militärs gekannt. Ich muss meiner Frau und meinen Kindern ein Zuhause bieten. Dein Grossvater sagt mir, ich soll da oder dort eine Hütte bauen. Aber wovon sollen meine Kinder leben?” Er blickt hinauf zu den felsigen Boden am Berghang, zu den vereinzelten Hütten inmitten nutzloser Palmen, verwelkter Tappioccafelder. ”Mein Vater hat ebenfalls Kinder, sechs Kinder. Keine Pension, keine Renten. Auch er erhält vom Grossvater Ashan keinen Flecken Erde mehr als Perappan.” - “Schau mal hier!” Er unterbricht mich. Er muss seine Geschichte zu Ende bringen, auch wenn dies niemand begreifen kann. "Schau mal hier, diese Narbe in der rechten Handfläche und diese in der linken Handfläche. Die unter meiner Brust. Die Narben Christi! Aber Jesus hatte das Glück, früh zu sterben. Er musste niemandem Essen oder Kleidung oder ein Dach über dem Kopf besorgen. Nie an der Front dienen. Nicht wie meine Frau das eigene Fleisch verkaufen. Sind nicht die Lebenden die Gekreuzigten?"
"Mudschibur Rahman hatte die Wahlen gewonnen, aber die Militärs in Westpakistan wollten keinen Politiker aus Ostpakistan als Präsidenten dulden.” 'Der General' will seine lange Geschichte zu Ende führen. ”Nicht nur stammte Mudschibur Rahman aus dem östlichen Flügel Pakistans, er sprach noch dazu Bengali und war mit Indien befreundet. Als die Militärs sich weigerten, ihn als Staatsoberhaupt und somit als Oberbefehlshaber der Pakistanischen Streitkräfte zu akzeptieren, erklärte er Ostpakistan für unabhängig. Rief den Staat Bangladesch aus. Ferner bat er Indira Gandhi, den jungen Staat zu schützen, da er noch keine eigene Armee besass.”
Onkel Joseph wurde nach Bangladesch beordert. Diesmal lag er im Wasser, mit seinem Helm und seinem Gewehr, umringt von Abschaum, um ihn herum braune unendliche Wassermassen. Er war nahe Chirapundschi, dem nassesten Ort auf Erden. Der Ganges vereinigte sich in der Nähe mit dem Brahmaputra. Von Norden und Westen brachten die beiden Flüsse Unmengen von schmutzigem Wasser über die Landmassen herbei. Vom Süden überrollten hohe Meereswellen aus der Bucht von Bengalen das Land. Wie jedes Jahr war dieses Land überflutet. Die Hütten von Millionen von Menschen standen abgesunken im Wasser. Mensch und Tier, Soldaten und Viehherden durchquerten die schlammigen Felder, versanken in den Fluten. Menschliche und tierische Fäkalien, Kadaver und Leichen, aller Dreck dieser Erde staute sich vor ihm. Überall schwamm der Abfall dieser Erde. Überall lauerte der Tod.
Er sehnte sich nach den eisigen Höhen des Himalaya, wo die Luft noch rein war und wo der Himmel voller Sterne leuchtete. Als ihn eine Kugel gleich in den ersten Tagen des Krieges traf, war er ausser sich vor Glück. Denn die Kugel bohrte sich zwar in den linken Arm, machte ihn aber für eine Weile kriegsuntauglich. Auch war der Krieg nach sechzehn Tagen schnell beendet. Pakistan hatte vor dem indischen General Aurora eine bedingungslose Kapitulation unterschrieben und Bangladesh war als unabhängiger Staat aus den schlammigen Sümpfen von Ostpakistan hervorgegangen.
'Dem General', meinem Onkel, wurde ein weiterer Rang zugebilligt. Er hätte seinen zwanzigjährigen Vertrag mit den Militärs verlängern können. Nun wollte er nicht mehr. Er hatte die Sandstürme von Rajasthan überlebt, die ewigen Eismassen der Himalayagebirge und die Sintflut von Bangladesh. Er war kriegsmüde, sehnte sich nach einem Leben in Frieden, am Waldrand, er sehnte sich nach seinen Kindern, nach den weichen warmen Brüsten seiner molligen Jugendliebe, der Frau des Zwiebelhändlers Mathai, die nun seine Frau geworden war, und Mutter seiner Kinder.
Der Dorfvikar kommt zurück, seine Mission vollendet, erschöpft von den Anstrengungen des Tages. Auch mein Vater kommt zurück. Er nimmt mich beiseite. "Wenn dein Onkel mir sagt, er kann nicht mit bloss drei Hektar unfurchtbarem Boden überleben, wenn er um meine Hilfe bittet, dann geben wir ihm zweieinhalb Hektar am Berghang. Es stimmt, auch er hat für unsere Familie gelitten. Aber wenn er mir droht, wenn der Metzger, der Betrüger und seine Heiligkeit der Vikar mich auf die Knie zwingen wollen, dann erhält er nichts. Nichts.”
"Fangen wir mit einem kleinen Gebet an", schlägt der Priester vor. "Der Vikar soll ruhig beten, wenn er will. Aber ohne mich", hält 'der General‘ entgegen. "Die Kirche hat mich ja exkommuniziert. Was soll das Gebet dann? Reden wir lieber von Tatsachen.” Auch mein Vater hält wenig von einem Gebet, nachdem alle so lang auf den Vikar gewartet haben. "Herr Pfarrer, ich habe ein wenig Boden. Ich habe dafür hart gearbeitet. Ich habe auch sechs Kinder und meine Frau zu ernähren. Die Regierung gibt mir keine Pension. Keine Rente.” - “Du hättest bei unserer Armee dienen sollen!" - "Und du, hättest du mit dem Berg gekämpft, dann hättest du auch deine Handvoll Erde.”
Der Priester steht sprachlos zwischen den Fronten. Er schliesst die Augen, stützt sich den Kopf mit beiden Händen. Seine Theologie bereitet ihn keineswegs für irdische Belange vor. Seine vielen Sakramente kennt er. Die Kommunion. Die erste Ölung. Die letzte Ölung. Aber was tun, wenn sich zwei Brüder gegeneinander kämpfen? Wie einen Streit um Brot, Boden und Wasser schlichten? Er dachte an die Beichte. An die Kommunion. Er hätte gerne eine Absolution erteilt. Aber wer hat hier gesündigt? Schliesslich nimmt er Stellung zu Gunsten des ‘Generals’. Zu Gunsten des Schnaps.
"Es gibt nichts zu verhandeln, ausser unter Betrunkenen,» Sagte Vater, und stürmte vom Nebenzimmer des Pfarramtes.
Zwei Wochen später kommt Onkel Joseph, 'der General', zu unserer Hütte. Er kommt auf die Veranda und setzt sich auf das Bett, ohne dass man es ihm anbietet. Die kleine Rose fragt ihn, was er trinken möchte, höflich, wie es der Stellung der Frau des jüngeren Bruders entspricht. Er will nichts. Mein Vater will ihm nicht begegnen und geht aus der Hütte hinaus. Er will von den Bäumen unterhalb unserer Hütte Cashewnüsse sammeln.
"Ich will nicht deine vertrockneten Erdklumpen. Ich bin bloss gekommen, um mich von deinem Sohn zu verabschieden.” Ruft ihm der General zu.
Kurz bevor er weggeht, ruft mich Vater beiseite. "Sag du ihm, wir geben ihm zweieinhalb Hektar, von dem Felsbrocken oben bis zu unserem grössten Teakbaum. Den Baum behalten wir. Sag ihm, ich schulde ihm nichts. Es ist ein Geschenk. Er ist mein einziger Bruder. Nur deshalb.”
”Mon, kommst du mal her?” Mutter Rose bestellt mich in die Küche. Ihr Benehmen ist seltsam. Sie legt ihre Finger auf meine Lippen, zieht mich ganz eng an sich, flüstert in mein Ohr. ”Wir geben ‚Perappan‘ nichts Schriftliches.” Ich verstehe nicht. ”Aber wir geben ihm doch die zweieinhalb Hektar am Berghang?” - ”Nicht so leicht. Es ist Boden, den wir nach sehr viel harter Arbeit gekauft haben. Alle Bäume habe ich nach dem Brand eigenhändig neu gepflanzt. Ich gebe nicht alles so einfach ab.” - ”Und Vater? Habt ihr zwei das nicht abgesprochen?” - ”Dein Vater ist viel zu nachgiebig. Er will 'dem General' den Boden geben, alles bereits schriftlich festlegen. Ich bin dagegen.”
Ich setzte mich zu Füssen meines Onkels auf dem mit Kuhmist gestrichenen dunklen Erdboden der Hütte.
"Dein Grossvater Ashan hat uns im Stich gelassen. Hätte er bloss die Hälfte des Geldes, das er für Kerzen, für Medaillons, für Heilige Messen ausgab, für uns verwendet! Dein Vater ging nur vier Jahre zur Schule. Ich hatte etwas mehr Glück. Sag deinem Vater, es ist meine Schuld. Ich hätte auch etwas Boden kaufen können. Aber damals lebte ich nur in den Tag hinein. Ich will nichts für mich. Ich möchte, dass meine Kinder zur Schule gehen. Ich will keinen Regenschirm von deinem Grossvater, keinen seiner Schlagstöcke, keine heiligen Messen nach meinem Tod. Ich will den Boden nicht für mich. Ich will nur, dass meine Kinder in dieser Hölle überleben.”
"Rose, könnte ich bitte einen Tee haben", fragt er demütig. Mutter Rose bringt ihm kurz daraufhin einen Tee. Er bittet um ein zweites Glas. Der Tee ist ihm zu heiss. Er giesst den Tee von einem Glas in das andere. Mutter bringt ihm ein Stück Fladenbrot, aus gemahlenem Reis und Kokosnuss, eingewickelt in ein Bananenblatt.
Während dem er den heissen Tee schlürft, berichte ich ihm vom Angebot meines Vaters. Er hört zu, ich sage ihm alles so genau, wie es mir mein Vater gesagt hatte. Zweieinhalb Hektar, aber ohne den grossgewachsenen Teakbaum. Onkel Joseph hatte damit nicht gerechnet, dass Vater jemals auch den winzigsten Flecken seines Bodens preisgeben würde. Lange schweigt er. Plötzlich wirkt er geschlagen. Er lässt den Kopf hängen, lässt die kräftigen Arme auf den Knien ruhen. Die Luft ist aus seinen Lungen gewichen. Er ist nur zweiundvierzig Jahre alt, aber sitzt da wie ein alter Mann. Er ähnelt Ashan, atmet sehr langsam, blickt stur auf den Boden. Ich sehe seine Augen, seine Augenringe, seine Hände. Ich sehe keine Wut, keine Bitterkeit, nur seine Trauer über den unaufhaltsamen Lauf der Jahre.
Vater kommt nach Hause, schaut mich fragend an. "Vater, es gibt frischen Tee.” - "Meine Mutter ruft noch lauter aus der Küche. "Ich habe keinen Tee mehr. Muss welchen kochen.” Der ‘General’ will nicht, dass Mutter nochmals Wasser aufstellt. "Du musst dich nicht bemühen. Wir teilen einfach, was ich habe. Zwei Gläser habe ich bereits." Vater legt die gesammelten Nüsse auf den Boden, wäscht sich die Hände. Onkel Joseph giesst etwas Tee in eines der Gläser, übergibt es Vater. Er masst sich nicht an, auf der gleichen Ebene zu sitzen wie sein älterer Bruder, setzt sich auf den Boden. "Willst du nicht ein Stück Brot?" fragt Onkel Joseph seinen Bruder. "Nein, danke!” Lange schweigen sie.
"Ich möchte unterhalb des Baches Reis anpflanzen. Aber ich weiss nicht, welche Sorte. Du weisst, ich habe keine Ahnung. Ich habe gekämpft, aber meine Hände!” Er zeigt mir seine Hände. Sie sind nicht die Hände eines Bauern. Vater zögert lange. ”Letztes Jahr habe ich eine viel bessere Ernte gehabt als je zuvor. Die Regierung gab mir das neue Saatgut. Sie nennen es die Grüne Revolution. Du kannst welches von mir haben. Ich benötige nicht alles."
Angeregt sprechen Onkel Joseph und Vater über den Reis, über das neue Saatgut, über die Grüne Revolution. Für einen Augenblick sind sie wieder Brüder, keine Kriegshelden. Weder Kain noch Abel, weder Karna noch Ardchuna. Plötzlich sind sie gleichaltrig, sie reden vom Monsun, von den seltsamen Wegen des Windes, von der Mondlandung. Sie reden über Mars und Jupiter, über Breschnew und Kennedy, über den Krieg mit Atomwaffen. Sie denken laut über den ewigen Krieg nach, ihren Krieg gegen Heuschrecken, Ratten und Vogelscharen, alles was ihre Ernten, ihr Leben gefährdet.
Onkel Joseph bricht ein Stück von seinem Brot ab, bietet Vater die Hälfte an, und Vater nimmt, bevor sein Stolz ihm widerspricht, ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, ein kleines Stück entgegen.
[1] Krieger aus dem Epos Mahabharata
[2] Karnas Gegenspieler
[3] Der grosse Krieg aus dem Epos Mahabharata
[4] Onkel
[5] Angehörige der höchsten Kaste
[6] liebevolle Anrede an einem Knaben

Ein schriller Schrei. Eine lautstarke Warnung. Ein Donner wie der Urknall. Silbrige Granitklumpen schiessen in den Himmel empor, sie regnen auf die Erde nieder. Und noch bevor ein einziger Stein den Boden berührt, bringen weitere Explosionen die Oberfläche der Steingrube zum Beben, sie lassen die kauernden, hungernden, halbnackten Arbeiterleiber zusammenzucken, lassen Unmengen von Granit aus der Tiefe der Grube in die Luft fliegen. Splitter, Steine, monströse Brocken stürzen auf die rauchbedeckte Hölle nieder. Wenn die Dutzend Explosionen vorbei sind, wenn auch das Echo des allerletzten Knalls abgeklungen ist, hört man nichts. Nichts. Doch dann ein leises Weinen, ein Wimmern, das aus einer gottverlassenen Ecke stammt. Irgend jemand ist verletzt, irgend jemand verwundet, irgend jemand. Ein Mensch blutet.
Ein Kleingewachsener trägt einen kantigen Granitbrocken auf seinem Kopf, bringt ihn zu einem Haufen am Wegrand. "Eine Frau", sagt er. "Sie hat einen Stein auf den Fuss abgekriegt." Der Halbwüchsige mustert mich von Kopf bis Fuss. Er betrachtet mein weisses Hemd, die schwarzen Schuhe, meinen bleiernen Koffer. "Schlimm", fährt er fort, "schlimm. Dennoch hat sie Glück gehabt. Auf den Kopf und sie wäre ..." Er blickt zum Horizont, erinnert sich. "Wie die anderen." Seine Augen schweifen über ein seltsames Loch, fünfhundert Meter lang, fünfzig Meter tief, ein Grab, in dem die Toten noch leben.
Die schrillen Pfeifen ihrer Peiniger zwingen die unzähligen Arbeiter in die Niederungen der Grube. Auf schmalen windigen Treppen, auf tödlichen Leitern klettern sie wie Ameisen hinunter. Bevor noch der Rauch entwichen ist, packen sie die kantigen Brocken mit blossen Händen, sie hämmern und bohren und spalten wieder Steine. Der Granit wird mit Hammerschlägen in tragbare Brocken zerlegt. Kräftige Männer tragen die schweren Steine auf ihren Köpfen, klettern aus der Tiefe heraus. Am Rande der Grube befinden sich improvisierte Blechbehausungen, in denen Frauen und Kinder den Granit weiter zerkleinern. Sie hämmern auf Granitbrocken von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, füllen Blechkanister um Blechkanister mit zerstückelten Steinen, stellen sie für den Transport bereit.
Einige Tagelöhner tragen die verletzte Frau zu einem Geländewagen, der sie in ein staatliches Krankenhaus bringen soll. Der Laster holpert über den Landweg, fährt in die nahegelegene Stadt. Der Kleingewachsene deutet in Richtung des wegfahrenden Lasters.
"Die geteerte Strasse liegt weiter westlich. Es kommen keine Busse hier vorbei. Wartest du etwa auf einen Bus?"
"Ich warte auf jemanden."
Er schaut in die öde, karge, hügelige Landschaft. Er sieht mich mit seinen kindlichen Augen an.
"Ich warte auf einen Künstler."
"Einen Künstler?"
Er lächelt, schüttelt seinen übergrossen Kopf.
"Ein Künstler!"
Er sieht mich perplex an.
"Der Künstler wohnt in einem Dorf in der Nähe. Er sagte mir, ich soll bei der Steingrube am Stadtrand auf ihn warten."
Der Kleingewachsene verlässt mich, um erneut einen Brocken Granit zu holen. Er dreht sich um und lächelt mich an.
"Das nächste Dorf ist weit weg, zwanzig Meilen, so weit ist es. Ja, mindestens so weit."
Zwei Landstrassen kreuzen sich nahe der Steingrube am Rande der Stadt Mysore. Die eine, eng gewunden, verläuft entlang des Stadtrands, schlängelt sich zwischen hohen Bäumen, biegt links und rechts um eine riesige Militärkaserne. Die andere, steinig, staubig, geradlinig, führt stadtauswärts, verliert sich dort, wo der klare, gewölbte, hellblaue Himmel die karge, felsige Erde berührt. Hohe Strommasten, zehn, zwanzig, dreissig Eiffeltürme, ragen entlang der staubbedeckten Strasse empor, metallene Gerüste, schwere, hängende, summende Kabel, die ins Unendliche führen, silbrige Türme, gleich gross, gleich schwer, hier in der flimmernden Hitze glänzend, mächtig, dort klein und zerbrechlich, im Staub verschwommen, am fernen, fernen Horizont.
Nahe der Kasernenmauer wühlt ein Wirbelwind Staub auf. Als dieser sich legt, taucht in der Ferne ein Motorrad auf, das sich der Steingrube nähert. Das lärmige Gefährt springt über den steinigen Weg auf und ab. Auf einmal erkenne ich den Künstler. Seinen grauschwarzen Bart. Sein schulterlanges Haar. Sein loses Hemd. Ich freue mich, ihn zu sehen. Ich freue mich sehr, ihn wieder zu sehen.
Der Künstler hat sich reichlich mit Proviant eingedeckt. Auf dem stählernen Gestell hinter dem länglichen Sitz stehen drei, vier Einkaufstaschen aus Jute, mit dünnem Seil festgebunden, durch den Höllenritt auf der holprigen Strasse bereit zu bersten. Er stellt den lärmigen Motor ab, steigt ab, schüttelt kurz meine Hand. Dann setzt er sich an den Strassenrand, sucht heftig in allen seinen Taschen, nimmt eine kleine blaugraue Flasche heraus, hält sie vor dem Mund umklammert. Er saugt tief Luft, saugt immer wieder, sein kleiner Körper schwillt auf, schwillt ab.
"Geht es Ihnen gut? Könnte ich was für Sie..."
"Ich habe Asthma."
Dann nimmt er die Brille ab, trocknet seine wässrigen Augen mit dem losen Ende seines weissen Hemdes.
"Es tut mir leid, wenn ich dich habe warten lassen. Diese Strasse hier ist holprig. Aber du kannst wenigstens auf ihr fahren. In der Stadt dagegen! So viele Rikschas, so viele Menschen! Es ist jedesmal dasselbe. Mühsam, alles sehr mühsam!"
"Als ich Sie und Ihre Frau vor einem Jahr kennenlernte, da hatten Sie einen Jeep."
"Das war ein wundersames Gefährt. Mitten in den Menschenmassen, lief der Motor. Er lief so gut, dass die Polizei kein Tränengas brauchte, um die Leute von der Strasse fernzuhalten. Aber hier auf dieser leeren Strasse, da blieb er meist stecken! Du konntest ihn anflehen, du konntest ihn verfluchen, ihn stossen. Aber alles nutzte nichts. Wenn etwas unbrauchbar geworden ist, dann muss es weg. So!"
Der Künstler nimmt die Einkaufstaschen vom Motorrad herunter, stellt meinen Koffer an deren Stelle auf das Gestell.
"Könntest du sie halten?"
Die Taschen mit dem Proviant wiegen schwer.
"Wir müssen alles in Mysore einkaufen, Reis, Zucker, Früchte. Gemüse bringt uns unsere Antonamma, aber nur während der Saison."
Antonamma ist ein mir unbekannter Name. Ich sehe ihn fragend an.
"Antonamma hilft im Haushalt. Sie wohnt im benachbarten Dorf, kommt zu uns am Morgen, geht abends heim zu ihrer Familie. Eine junge Frau. Eine gute Frau."
Weitere Explosionen, aus der Ferne, dumpf, harmlos. Links und rechts von der Landstrasse liegt das Land brach, rotbraune Felder, die auf die Ankunft des Monsuns warten. Hier und dort ragen Felsen aus der vertrockneten Erde heraus. Hier und dort Ansammlungen von Bäumen, von grossen Banyanbäumen, mit dichtem Laub und weit ausgestreckten Verästelungen. Mit verschlungenen, herausragenden, herunterhängenden Wurzeln. Hier und dort einzelne seltsame Tische aus Granit, einzelne Säulen aus Granit, einzelne Götter aus Granit. Unendliche Erde, unendlicher Himmel.
Den Künstler halte ich mit einem Arm umschlungen. So sehr hüpft das Motorrad über die steinige Strasse. In seinem Haar, auf seiner Hose, auf seinem Hemd vereinzelte winzige, zum Teil grobe Farbflecken. Unübersehbare Spuren seiner Arbeit. Fünf Jahre lang hat er in London eine Kunstschule besucht, er hat eine Engländerin geheiratet, sein erstes Kind ist knapp zwei Jahre alt, die Frau hochschwanger. Seit bald einem Jahr lebt er ausserhalb der Stadt Mysore in Südindien. Weit ausserhalb der Stadt. Die Landstrasse führt uns ins Unendliche. Weit und breit kein Vieh, keine Dörfer, keine Menschen.
Mitten in einer flachen Landschaft steht das einsame Haus des Künstlers. Seine Frau Christine begrüsst uns herzlich, nimmt meinen Koffer vom Motorrad herunter, führt mich in ein freistehendes Zimmer am Ende des Hauses. Der zweijährige Sohn des Künstlers schaut kurz in das Zimmer herein, flüchtet sich hinter seine Mutter. Antonamma bringt mir einen Tee, sieht mich neugierig an. Gelbe Blüten schmücken ihr tiefschwarzes Haar, ein gelber Sari umschlingt sie wie eine Kletterpflanze, sie trägt einen gelben Punkt auf ihrer Stirn. Eine junge Frau. Eine hübsche Frau. Eine verheiratete Frau.
Der kleine Fleck Erde, der dem Künstler und seiner Frau gehört, ist in Beete unterteilt. Einige wenige Bäume gedeihen auf dem Grundstück. Der Künstler führt mich in sein Atelier, ein längliches, einfaches Gebäude am Rande des umzäunten Feldes. In den Räumlichkeiten des Ateliers stehen unzählige Rahmen, unzählige Dosen, Pinsel. Farben an den Wänden, auf dem Flur, an den Fensterscheiben.
"Hier arbeite ich. Auch du kannst hier bald deine Bilder malen. Ich bringe dir alles, was ich kann, bei. Aufträge haben wir für das ganze Jahr."
Er stellt einige umgefallene Rahmen wieder gerade, räumt den grössten Raum etwas auf. Der Künstler sucht nach einem angefangenen halbfertigen Bild, eine in einen roten Sari gekleidete Maria Magdalena, umzingelt von lynchfreudigen, indischen Dorfbewohnern. "Es ist eine andere Welt als eine Missionsschule. Ich hoffe, du wirst dich hier nicht allzu einsam fühlen. Er überlegt kurz und holt tief Luft.
"Antonamma könnte dir am Abend das Dorf zeigen. Wir sind von drei Dörfern umgeben, die von hier aus nicht zu sehen sind. Das eine liegt etwa drei Meilen von hier entfernt hinter den Felsen. Ein anderes befindet sich dort, östlich hinter den Bäumen. Ein sehr altes schönes Dorf mit einem uralten Tempel. Das Dorf von Antonamma ist nicht weit weg von hier, es liegt verdeckt hinter den kleinen Hügeln."
Entlang einer Wand stehen mehrere Bücherregale, mit Büchern über Kunst, Theologie, Philosophie. Der Künstler reicht mir ein dickes teures Buch in Grossformat, eine Einführung in die Welt der Kunst.
"Ich schenke dir das hier."
Das Deckblatt zeigt ein Bild Marc Chagalls. Ausgehend von den Höhlenmalereien führt das Buch den Leser in die Welt der Bilder. Es verführt.
"Hier ein anderes Buch...über Anatomie. Wir werden viele solcher Zeichnungen machen. Dieser Band hier könnte dir behilflich sein. Und überhaupt, du sollst möglichst viele dieser Bücher einmal in die Hand nehmen."
Gegenüber den Büchern unter einem länglichen Fenster steht das Ehebett des Künstlers und seiner Frau. Am Kopfende des Bettes ein Ölgemälde des Künstlers: Jesus in strahlendem Weiss am Tag des Jüngsten Gerichts, im Himmel schwebend, unter ihm die braungebrannten, halbnackten, ruhenden Arbeiter. Am Fussende des Bettes die Jungfrau Maria, die Augen geschlossen, die Arme ausgestreckt, ihren rechten Fuss auf den Kopf einer leblosen Schlange gedrückt. Auf dem Fenstersims kleine eingerahmte Ikonen der Heiligen. Der heilige Joseph. Der heilige Petrus. Augustinus. Eine Welt der Frommen, der Märtyrer, der Rechtschaffenen.
Das benachbarte Dorf, Antonammas Dorf, ist eine Ansammlung von wenigen verfallenen Häusern, Lehmhütten, aneinandergeklebt, mit engen Fusswegen zwischen nackten Erdwänden. Ein Haufen elender, dicht nebeneinander stehender Häuser inmitten brachliegender Felder. Unter den Ziegeldächern weilen Vieh und Mensch, in dunklen, rauchdurchzogenen Räumen nebeneinander. Am äusseren Rand Kühe, Ochsen und Schafe, im Innern Männer, Frauen, Kinder. An den Wänden die allmächtigen Götter, Krischna, Christus, Kali. Urinspuren, beinahe ausgetrocknete Flüsse, schlängeln sich hinaus auf die rote staubige Strasse. Der Gestank bleibt in den Räumen haften, er vermengt sich mit dem Rauch aus der Küche. Der Kuhmist wird in einer Ecke eingesammelt, später von Hand geknetet und platt gedrückt, schwarzgrüne Monde, auf die äussere, einst weisse Wand geklebt. Getrocknet dient er als Brennstoff. Seit Jahrhunderten lebt man so. Mensch und Tier. Götter, Blumen, Fäkalien.
Antonammas Mann bittet mich in sein Haus.
"Sie haben einen seltsamen, starken Husten."
Ich will ausserhalb des Hauses bleiben.
"Ich ha...habe den Hu... Hu..Husten seit Jahren. Aber ko ko...komm doch herein. An...An Antonamma, mach Tee!".
Er befiehlt seiner Frau.
"Nein Antonamma, ich habe gerade Tee getrunken, nicht wahr?"
Antonammas Mann stellt das Kind auf die uringetränkte Strasse, die auch den Vorhof zu seinem Lehmhaus bildet. "Nimm das...das.. das Kind von hier weg", lautet sein nächster Befehl. Das Kind steht auf wackligen Beinen, sieht mich mit grossen dunklen Augen an. Sein Körper ist voller Wunden, seine Nase läuft, sein Bauch ist aufgebläht. Es macht ein paar Schritte, stolpert, fällt auf seinen nackten Hintern. Antonammas Mann hustet, er brüllt das kleine Kind an. Auch seine Frau brüllt er an.
"Nimm es... nimm es... weg!"
Dann wischt er den Staub von einer länglichen Bank aus Granit, bittet mich, darauf Platz zu nehmen, setzt sich neben mich. Er lehnt sich zurück an die Wand seines Hauses.
"Letztes Jahr ha..ha..hatten wir...hatten wir... eine magere 'Ragi' Ernte. Und dieses Jahr wa...wa...wa..warten wir...immer noch...noch auf den Monsun. Nicht dass ich...dass ich auf eine bessere...bessere Ernte hoffe. Wir hä...hä...hätten wenigstens Trink...Trinkwasser im Brunnen."
Antonamma bringt ihrem Mann Tee, nimmt das kleine Kind in den Arm, wischt ihm den Schleim von seiner Nase.
"Nach meiner Arbeit bei der Familie des Künstlers muss ich Wasser holen gehen. Noch gibt es etwa eine halbe Meile von hier Wasser in einem Brunnen. Aber wenn diese Trockenheit andauert!"
"Könntest du nicht Wasser vom Brunnen des Künstlers..."
"Einen Krug voll vielleicht, eben weil ich dort arbeite. Aber die Nachbarn sind meine Verwandten. Auch sie wollen zum Brunnen des Künstlers. Und dann käme das ganze Dorf. Ich wünschte, mein Mann könnte arbeiten. Aber er ist immer krank. Niemand will ihn als Tagelöhner beschäftigen."
Kinder spielen auf der schmalen Strasse Kricket. Alte Männer ruhen im Schatten eines mächtigen Baumes, sie schlafen auf ausgebreiteten Bastmatten. Frauen werfen mir neugierige Blicke zu. Ertappt ziehen sie sich scheu zurück, verschwinden hinter verfallenen Mauern. Eine Nachbarin Antonammas legt eine Blumengirlande auf eine Schlangenskulptur, die auf einer erhöhten Ebene zu Füssen eines Banyanbaums steht. Auf der Granitplatte sind zwei Schlangen herausgemeisselt, ineinander verschlungen, Symbole der Fruchtbarkeit.
"Bäume sind nicht bloss Wolken, die auf zwei wundersamen Strichen ruhen."
Der Künstler nimmt das grosse Brett mit dem Zeichenpapier aus meinen Händen, setzt sich neben mich. Seine Hand schwebt über dem Blatt, kritzelt Linien, deutet auf Schatten, zeichnet die über dem Boden freiliegenden Wurzeln. "Der Boden rund um den Baum ist nicht leer. Siehst du die Ameisenhaufen hier und die Schatten der Wolken auf den Feldern dort? Der Baum ist dreidimensional, der Stamm, die Äste, die Wurzeln. Und das Laub ist eine Masse aus Licht und Schatten. Nicht etwa eine Sprechblase in einem Komikheft. Es ist nicht einfach grün. Es ist rotgrün hier, gelbgrün hier oben, beinahe braun hier auf dieser Seite. Fast blau dort. Er zeichnet eine Weile, zaubert eine lebendige Landschaft hervor. Dornen, Felsen, Schatten.
„Es ist Aufgabe des Künstlers sehr genau zu sehen. Er soll Dinge und Farben und Ereignisse wahrnehmen, die andere vielleicht nicht sehen können. Er muss darüber nachdenken, und sie wiedergeben. Er muss das Göttliche in allem suchen."
Antonamma erledigt die Wäsche. Antonamma kocht das Mittagessen. Antonamma steht dem Künstler Modell. Seit jenem Tag, an dem Antonamma mich mitnahm, mir ihr Dorf zu zeigen, sind wir Freunde. So etwas wie Freunde. Sie begutachtet meine Bilder, ab und zu borgt sie ein paar Rupien von mir, sie teilt mir ihren Kummer mit. Ihre Kinder sind fast immer krank, das Geld ist knapp, ihr Mann liebt sie nicht. Er droht ihr täglich, beschimpft sie, schlägt sie manchmal. Den Mann, den sie liebte und immer noch liebt, sieht sie, wenn der Zufall dies erlaubt, ein- oder zweimal im Jahr. Sie treffen sich heimlich, reden über vergangene Zeiten, über ihre Kinder. Sie reden. „Bloss reden?" Antonamma lacht.
Sie hatte den Künstler vor drei Jahren kennengelernt. Sein Jeep war in der Hitze der Strasse steckengeblieben. Beim Versuch, das Gefährt eigenständig zu reparieren, hatte der Künstler sich seine Hände verletzt. Von einem Asthmaanfall geschwächt, sass er am Strassenrand, dem Staub hilflos ausgeliefert, nach Atem ringend, auf vorbeigehende Menschen hoffend. Antonamma kam mit ihrer jüngeren Schwester vorbei, von weit her, einen schweren Krug voll Trinkwasser tragend. Sie gab dem Künstler zu trinken. Sie wusch ihm die Hände. Sie gab ihm auch das Restwasser, um den erhitzten Motor zu kühlen. Dann ging sie den Weg zurück zum Brunnen, dachte, sie würde ihn nie wieder sehen. Zwei Jahre später, als sein Haus in der Einöde fertiggestellt war, hatte er sie als Gehilfin eingestellt.
Antonamma schleicht sich in mein Zimmer, sie gibt mir die fünf Rupien zurück, die sie vor einer Woche geliehen hatte. Sie drückt mir den gefalteten, schmutzigen Schein in die Hand.
"Die Frauen, die auf den Feldern arbeiten, haben jetzt einen höheren Tageslohn. Ich habe immer noch den gleichen wie früher. Kannst du für mich mit der Frau des Künstlers sprechen?"
"Ja, ich tue, was ich kann. Aber solltest du nicht einmal selber mit ihr sprechen?"
Sie überlegt es sich eine Weile, blickt zu den Feldern hinaus.
"Ah, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich komme aus einer bitterarmen Familie. Nichts, nichts haben wir."
"Auch ich komme aus einer Familie wie deiner."
"Du hast eine Schule besucht, du spricht ihre Sprache!"
Sie traut sich diese Aufgabe selber nicht zu, zu sehr gilt sie als eine einfache Frau aus dem Dorf, eine Analphabetin, eine Geschlagene. Ich betrachte sie, wie sie respektvoll nahe einer Ecke meines Zimmers steht, auf die nötige Distanz bedacht.
"Ich mag deinen gelben Sari, deine Blumen im Haar, wie du nach Hause gehst nach der Arbeit."
"Lass das.“
Sie begegnet meinem Blick mit einem tadelnden Lächeln.
"Ich habe genug Ärger zu Hause! Ich weiss, du meinst es liebevoll, aber... Sprichst du bald mit Christine?"
Sie bleibt in der Tür stehen, leicht angelehnt an eine Seite des Türrahmens, die linke Hand an die gegenüberstehende Planke gedrückt, den Zipfel ihres Saris zwischen die blutroten Lippen gepresst, hinter ihr die lichtüberfluteten Felder, eine Göttin, eine Gefangene des Lebens.
Christine, die Frau des Künstlers, vermisst ein Kleidungsstück. Das gelbe, gestreifte Hemd ihres Sohnes ist spurlos verschwunden. Vielleicht ist dies das dritte oder vierte Mal, dass so etwas passiert, seitdem ich vor zwei Jahren hier eingezogen bin. Mehrmals fragt sie Antonamma, ob sie es nicht vielleicht vor ein paar Tagen gewaschen habe. Ob sie das Hemd nicht sonstwo verlegt habe, ob sie... Beim Abendessen, nachdem Antonamma bereits zu ihrer Familie heimgekehrt ist, spricht Christine wieder aufgeregt über das vermisste Hemd. Der Künstler sagt ihr, sie solle besser auf Antonamma aufpassen. Vielleicht sei das Hemd beim Waschen beschädigt worden. Vielleicht beim Bügeln, und Antonamma traue sich nicht, ihr dies einzugestehen. Vielleicht verdächtige sie Antonamma zu unrecht.
Der Künstler malt im Auftrag christlicher Einrichtungen: Klöster, Kirchen, kirchlicher Institute. Er ist auf sie angewiesen. Er bildet Jesus so ab, als sei dieser ein Meister, ein Priester, ein indischer Guru. Jesus im Schatten eines Banyanbaums sitzend, seine rechte Hand erhoben, wie die eines Königs, die linke in seinem Schoss ruhend. Zu seinen Füssen seine Jünger. Jesus, der einen Blinden heilt, Jesus beim Abendmahl, Jesus, der Auferstandene. Ölbilder, biblisch inspiriert, in die indische Landschaft versetzt. Jesus, der Weise. Jesus, der Mächtige. Jesus, der Ohnmächtige?
Leere Landschaften hat er zum Leben erweckt, seine Felder sind in Licht gebadet. Im Schatten eines Banyanbaumes ruht sich ein Knabe im Schoss seiner Mutter aus. Hübsche Frauen baden in einem rundlichen Teich, legen ihre bunten Saris in die Sonne zum Trocknen. Ein alter Mann hütet seine Schafherde, weit verstreut über ein brachliegendes, dorniges Weideland. Staub legt sich auf die grossen Ölgemälde, aufgestapelt stehen sie auf feuchtem Boden. Einige wenige sind aufgehängt, bleiben unbeachtet im hintersten Raum des Ateliers. Hinter den grossartigen Landschaftsbildern ruhen die Eidechsen.
Seit einer Woche fahren wir zu der immer grösser werdenden Steingrube am Strassenrand. Vierzehn Bilder, die Stationen des Kreuzes, soll ich im Auftrag einer ausländischen Kirchgemeinde anfertigen. Der Künstler hat diesen Auftrag für mich angenommen, betraut mich mit der Arbeit. Die Steingrube, das Leben der Arbeiter darin, soll als Leitmotiv für die Bilderreihe dienen.
Der Kleingewachsene kreist um mich herum, betrachtet meine Skizzen mit grösster Bewunderung. Seine Neugier ist grenzenlos.
"Wie lange braucht man, um ein solches Bild zu malen? Kommen Farben hinzu? Warum verändert man die Grösse der Felsen? Wo werden die Bilder verkauft? Wer will sie haben? Für wie viel? Wieso zeichnet man alles so mühsam, wenn man die Steingrube mit einer Kamera ablichten könnte?"
Er versteht die Welt nicht, schüttelt den Kopf.
"Jesus trägt sein Kreuz wie der Arbeiter einen länglichen Brocken Granit. Die schwere Last soll das Leiden Christi symbolisieren."
Der Künstler liefert den Auftraggebern seine theologische Argumentation.
Ist es nicht so, dass das Leiden jedes einzelnen Arbeiters in der Steingrube hundertfach, tausendfach grösser ist als das von Jesus? Trägt nicht der Arbeiter seine Last ein ganzes trostloses Leben lang? Müsste nicht das Leiden Christi das Leiden jener Arbeiter symbolisieren und nicht umgekehrt? Ich würde mich gerne mit dem Künstler über diese Gedanken aussprechen.
Theologie ist mir suspekt. Die Religionen sind mir suspekt. Die ganze Priesterbande ist mir suspekt. Ein grosses Ölgemälde des Künstlers mit der Überschrift 'Frau und Mann am Brunnen' blieb so lange im Atelier hängen, bis der Künstler ihm einen anderen Titel gab. Er nannte das Bild 'Jesus begegnet Maria' und schon kaufte ein Doktor der Theologie das Bild. Jesus und Maria sind mir auch suspekt. Aber sie verkaufen sich gut.
"Wieso verwendest du Kohle und nicht Farben?"
Der Kleingewachsene steht wieder bei mir.
"Ich bin dabei zu lernen. Als ich das erste Mal diese Steingrube sah, war sie rechteckig, so lang, so tief, alles war grau. Aber jetzt sehe ich die Grube etwas anders, nicht geradlinig, nicht grau, ja farbig! Siehst du, da kommt das Licht her, und hier sind Schatten, und hier ist der Granit so hell, dass er spiegelt. Ich zeichne bloss Skizzen, viele kleine Skizzen, später male ich ein Bild, mein ganz persönliches Bild von der Steingrube, es wird dieser vielleicht ähneln, vielleicht aber auch nicht."
Der Kleingewachsene nickt.
"Wenn du mal Zeit hast, würdest du mir ein Bild von meiner Frau zeichnen? Sie arbeitet dort unten."
Ich würde gerne jeden einzelnen hier zeichnen, die Menschen, die Felsbrocken, die ganze Hölle. Ich würde gerne alles farbig malen, den ganzen Schweiss, die ganze Kraft, die unendliche Geduld der Arbeiter, wie sie immer wieder hinuntersteigen, wie sie immer wieder heraufsteigen, ihren täglichen Höllenabstieg, ihre tägliche Auferstehung.
Auf dem Markt am Stadtrand herrscht hektische Betriebsamkeit. Grosse blutende Fleischstücke hängen an metallenen Haken, locken Fliegen aller Art an, die laut das Halleluja summen! Nonnen in makellosem Weiss, den Ekel in ihren Gesichtern festgeschrieben, wandern über den blutverschmierten Boden.Mädchen hinter pechschwarzen Schleiern flüstern einander zu. Von den Fliegen unbehelligt gleiten sie durch den Rindermarkt. Männer, dünn, dick, dreckig, schreien einander an. Sie sind schwer beladen mit Proviant, mit Gemüse und Früchten in der einen Tasche, in der anderen Reis oder Weizen, darin begraben Flaschen voller Schnaps. Eine junge Frau, arm und reich zugleich, thront über Rosen, weissen Jasminblüten und goldgelben Sonnenblumen. Die Bienen, die um sie kreisen, können ihr nichts anhaben. Girlanden schmücken ihren farbenreichen Thron, ihre Augen sind voller Melancholie, ihr Lächeln göttlicher als jede Blumenpracht.
Eine fette Hausfrau liebäugelt mit dem haarigen Sardar[1]. Der Mann steht wie eine Säule da, dreht die Spitze seines Schnurrbarts messerscharf, brüllt die Preise für Tomaten in die Menge.
"Mein letztes Angebot".
Der Gemüsehändler schreit, er wendet sich ab, widmet sich seiner nächsten Kundin. Als sie weg ist, verkauft er dem Sardar seine Tomaten etwas billiger.
"Weil Sie es sind!"
Als der Künstler Tomaten aus dem gleichen Korb kaufen will, sind die Preise wieder nach oben geklettert. Er nimmt Tomaten, Bohnen, Auberginen, lässt alles wiegen, macht seine eigene Rechnung, streckt dem Händler eine Zwanzig-Rupien-Note entgegen. Der Muslim weigert sich, das Geld anzunehmen, wirft einen Blick gen Allah, widmet sich dem Künstler wieder.
"Das hier reicht nicht, Bruder."
Seine Stimme ist sanft, sein Blick beschwichtigend.
"Aber ich kaufe jede Woche bei dir, Bruder."
"Gib mir dreissig Rupien, Bruder."
"Zwanzig sind mehr als nur gerecht."
"Wollen Sie etwa meine Kehle durchschneiden, Bruder?"
Freundlich seine Anklage.
"Nächste Woche kaufe ich anderswo, Bruder!"
Noch freundlicher die Drohung.
"Bruder, mach es fünfundzwanzig."
"Bruder!"
Im Hause des Künstlers herrscht helle Aufregung. Eine Hundert-Rupien-Note fehlt im Portemonnaie des Künstlers. Das Haus wird durchkämmt, Leinwände hin- und hergetragen, Matratzen umgedreht. Der Künstler, überwältigt von all dem Staub, ringt nach Atem. Laut flucht die Frau des Künstlers. Antonamma schöpft Wasser aus dem tiefen Brunnen, seift Unmengen von Wäsche ein, sie muss ihre Arbeit unterbrechen. Hergerufen beteiligt sie sich an der Suche nach dem verlorenen Schein, der die Familie in Unruhe stürzt, der allen den Verstand raubt. Finstere Blicke, heimliches Geflüster, tödliche Verdächtigungen. Antonamma weint.
Am nächsten Tag fehlt Antonamma. Sie erscheint auch an den folgenden Tagen nicht zur Arbeit. Auch ist sie nicht zu Hause. Ihr Mann sitzt vor seiner schäbigen Hütte, hustet, kann sich das Verschwinden seiner Frau nicht erklären. Er schweigt, schüttelt den Kopf, schimpft mit seinen Kindern. Seine gebrechliche Mutter kommt aus dem Haus heraus, altersschwach, grollend, schimpft über Antonamma, beschuldigt sie, mit einem Nachbarn durchgebrannt zu sein. Das habe sie auch schon mal getan, vor der arrangierten Ehe allerdings, es habe keinen Sinn, nach ihr zu suchen. Ihr eigener Sohn sei ein Feigling, ein schwanzloser, schrecklicher Schwächling, er strafe Antonamma nicht hart genug. Sie biegt ihren Zeigefinger krumm, deutet auf die Genitalien ihres Sohnes, spuckt ihren giftigen Schleim auf die staubige Strasse. Diesmal werde sie Antonamma selbst verprügeln, sie prügeln, bis ihr dreckiger Körper im Kot auf dem Boden vor ihrer Hütte läge. Antonammas kränklicher Ehemann leidet, auch seine Kinder leiden. Sie heulen nach Essen, nach Trinken, nach der Mutter. Nach Antonamma.
Eine Woche später sucht mich die ältere Frau auf, bittet mich, mit der Frau des Künstlers zu reden. Alles, was sie zu sagen habe, sei wahr, so wahr wie sie vor mir stehe, Gott im Himmel möge sie mit einem Schlangenbiss bestrafen, liesse sie auch nur ein einziges unwahres Wort fallen. Antonamma, ihre liebste Schwiegertochter, sei eine gute Frau, eine ehrliche, eine tüchtige Frau, sie musste zu ihrer Familie und käme gerne wieder arbeiten. Das Geld habe sie nicht mitgenommen, so etwas würde Antonamma niemals tun, man verdächtige sie zu Unrecht. Ihr Sohn habe den gesamten Besitz, eine Handvoll vertrockneter Erde, dem listigen Grossgrundbesitzer Malappa verpfändet, alles nur wegen seiner nie endenden Krankheit. Er huste täglich Blut. Ihr Sohn, seine Kinder, ja selbst sie sei auf die Arbeit ihrer Schwiegertochter angewiesen. Antonamma sei keine Diebin. Keine schlechte Frau. Kein wolllüstiges, zügelloses, sündiges Weib.
„Leihst du mir hundert Rupien?“
Antonamma arbeitet wieder, bereitet den Kindern das Essen zu. Der Künstler und seine Frau sind in die Stadt gefahren, ihre Kinder haben sie in meiner Obhut gelassen.
"Ich brauche das Geld dringend, ich kann nur dich um so viel Geld bitten, ich stecke in einer schrecklichen Klemme, bitte glaub mir.“
Antonamma wirkt verzweifelt, ihre Stimme flattert.
"Ich gebe dir das Geld in zwei, in drei Raten wieder. Du weisst ja, mein Lohn beträgt gerade achtzig Rupien.“
Sie knöpft ihre Bluse auf, nimmt meine Hand und legt sie auf ihre Brust. Eine Weile steht sie still, in Gedanken versunken, schweigend, unergründlich.
Drei Tage später findet der Künstler einen Hundert-Rupien-Schein, zerknittert, die Farben verblasst, in der Seitentasche seiner frisch gewaschenen Hose. Christine, die Frau des Künstlers, entschuldigt sich bei Antonamma, sie fälschlicherweise verdächtigt zu haben, schenkt ihr zwei alte Saris und ein paar Kinderkleider. Lange reden sie miteinander, wie zerstrittene und nach langer Zeit wieder versöhnte Schwestern.
Einige Tage verbringe ich bei meiner Familie, bei meinen Geschwistern, bei der kleinen Rose, bei meinem Vater. Der Monsun, der endlose Regen, prasselt vom Himmel herab, trüb, leicht braun fliesst das Wasser über Berghänge, hinein in unsere Hütte. Ringsum sprudelt das Wasser, es quillt aus unzähligen Löchern heraus, bildet kleine und grössere Bäche, rauscht durch tiefe Schluchten. Der Fluss schwillt an, trägt entwurzelte Bäume mit sich, einzelne Hütten, verendete Tiere. Überall lauert der Tod.
"Kannst du nicht irgendwie dein Studium fortsetzen? Du weisst, ich habe immer davon geträumt, dass du, wenigstens du, studieren könntest. Ich wünschte, eines meiner Kinder würde eine Arbeit finden, irgend eine Arbeit. Zum Überleben."
Mein Vater blickt besorgt auf das riesige Loch, das eine wassergesättigte, eingestürzte Wand in unserer Hütte hinterlassen hat. Das Regenwasser fliesst in Unmengen vom Strohdach herunter, breitet sich im einzigen Zimmer der Hütte aus. Ich betrachte meine Geschwister, wie sie auf dem wackligen Bett meines Vaters zusammengepfercht kauern, mit einem dünnen Stoff umwickelt, wie sie darauf warten, dass der Regen endlich aufhört.
"Du hast jetzt fünf Jahre bei diesem Künstler verbracht. Wozu reist du zurück? Wieso bleibst du nicht hier? Wozu taugt die Kunst?"
Fernab mein wasserdurchtränktes Dorf, auf der Hochebene nahe Mysore sind die Felder zu neuem Leben erwacht. Die Steingrube hat sich in einen künstlichen See verwandelt, zierliche Fische schwimmen im klaren Wasser, sie verstecken sich in den silbrigweissen Wolken, die darin gleiten. Auch der Granit hat sich in die Wolken geflüchtet, liegt in den Wolken verborgen, birgt in sich alles Leid und alles Leben, die Glut der Erde, die Tränen der Arbeiter, alle ihre Hoffnungen. In den weiten Feldern tanzen leuchtend gelbe Sonnenblumen, ein unendliches Blumenmeer, das bebt und ruht, Brüste einer grosszügigen Göttin, die schläft und leise atmet.
Der Künstler arbeitet erneut an einer Bilderreihe. Jesus wandert durch ein leeres Feld. Jesus spricht zu den Arbeitern in der Steingrube. Jesus segnet das Fladenbrot. In seinen Bildern lebt Jesus unter den Armen. Aber er lebt nicht wie sie. Er wandert. Er lehrt. Er predigt. Aber er arbeitet nicht. Er schwitzt nicht. Er hungert nicht. Er muss nicht seine Frau ernähren, seine Kinder ernähren. Er muss keine sinnlosen Kriege führen. Er muss nicht täglich in die Niederungen einer Steingrube. Keine Lasten tragen. Nicht unter den Augen geldgieriger Vorarbeiter. Nicht für einen Hungerlohn. Er muss nicht schummeln. Nicht betteln. Lebte er? Liebte er?
Jeden Abend verlässt Antonamma früh das Haus, auch die Familie des Künstlers zieht sich recht früh zurück. Nachts quäle ich mich mit Skizzen, mit misslungenen, unfertigen Bildern, mit Büchern über Kunst, ich ringe mit Van Gogh, Picasso, mit Chagall. Fünf Jahre lebe ich nun in der Einöde. Fünf Jahre Jesus. Fünf Jahre Maria. Was hat die Kunst mit dem Leben zu tun? Mit den Lebenden? Was hat die Kunst mit meinem Vater, mit Antonamma oder mir zu tun? Mit Krankheiten, Enttäuschungen, Entbehrungen?
"Jeder Künstler ist ein armer Hund. Würde er ganz frei malen, wäre er vielleicht in der Lage, Vermittler zu sein. Zwischen Kulturen, zwischen mythischer Vorstellung und realer Begebenheit, zwischen Welten. Aber wäre er wirklich frei, dafür aber nicht berühmt genug, dann würde er hungern. Und wenn er, wie ich, als Auftragsmaler sein Brot verdienen würde, dann wären ihm Schranken auferlegt, er hätte dies und jenes zu vermitteln, er hätte Dinge und Ereignisse als Wahrheiten zu verpacken, eine Aussage zu machen. Ich persönlich liebe die Gottheit Krischna. Er ist ein liebenswürdiger Kindsgott, verbindet das Kindliche mit dem Göttlichen. Es ist nur natürlich, dass Menschen in ganz Indien diese Gottheit lieben. Ich wurde christlich erzogen und bin mit dem Bild Christi vertraut. Als Künstler versuche ich in meinen Bildern Krischna und Christus zu verschmelzen. Meinen Auftraggebern ist dies meist ein Rätsel. Also sagen sie mir, nimm diese Geste in diesem Bild hier weg, diese Farbe hier weg, stell die Frauen im Bild des Abendmahls beiseite. Natürlich versuche ich, die Kunst mit dem Leben zu versöhnen. Ich habe keine Antworten auf deine Fragen. Du musst sie selbst beantworten, für dich, nur für dich."
Nachts liege ich wach. Manchmal sehe ich die Frau des Künstlers nackt an ihrem Fenster vorbeigehen, ich lausche hinein in die ruhige Nacht. Lieben sie sich? Streiten sie sich? Weinen die Kinder? Ich sehne mich nach Menschen. Ich sehne mich nach Augen und Lippen und Brüsten. Ich träume von Antonamma.
Spät in der Nacht klopft sie an meine Tür, ihre Lippen sind blutrot, die billige schwarze Tinte ihrer Augenlider auf dem Gesicht verschmiert. Atemlos stürzt sie in mein Zimmer herein, presst ihre Hand auf meinen Mund. Sie löscht das Licht mit der einen Hand, hält mich mit der anderen umklammert. Sie atmet schnell und heftig, legt ihren Kopf auf meine Schulter. Ich spüre die Glut ihrer Brüste.
"Was ist...?"
Sie presst ihre Hand erneut auf meine Lippen, zwingt mich zum Schweigen. Im gegenüberliegenden Schlafzimmer des Künstlers geht ein Licht an, erlischt wieder. Antonamma hält mich fest, presst ihre Lippen gegen meinen Mund. Brennend sind ihre Tränen.
"Hilf mir", fleht sie mich an. "Hilf mir."
Antonamma ist nicht zur Arbeit erschienen, seit Tagen fehlt sie. Die Mutter ihres Mannes kommt zum Haus des Künstlers. Sie setzt sich in den Schatten eines Baums, will unbedingt mit mir reden. "Bitte erzähl das, was ich dir sage, nicht dem Maler und seiner Frau. Antonamma hat nur Gutes von dir erzählt, so vertraue ich dir dies an. Letztes Jahr, als sie eine Woche nicht zur Arbeit gekommen war, da war sie schwanger. Aber noch ein Kind konnte sie nicht ernähren. So habe ich sie für ein paar Tage weggeschickt. Mein Sohn ist dahintergekommen. Er glaubt, sie habe nur deshalb abgetrieben, weil sie das Kind eines anderen trug. Nun weisst du es. Vor ein paar Tagen hat mein Sohn sie geschlagen. Wohin sie gegangen ist, weiss ich nicht. Aber sie kommt wieder. Sag dem Künstler, Antonamma sei krank, sie komme bald wieder. Bitte, Sohn, hilf uns."
"Wir können nicht ewig auf sie warten. Die junge Dame ist bei uns zu verwöhnt. Sie glaubt, sie kann kommen und gehen, wann sie will. Wir finden schon eine andere!"
Der Künstler möchte Antonamma gleich entlassen, seine Frau möchte ihr noch eine Chance geben.
"Die Wäsche, die Kinder, das Essen...! Am Wochenende haben wir sogar Besuch. Was wollen wir ohne Antonamma dann machen?"
Christine sieht mich fragend an.
"Antonamma ist von ihrem Mann geschlagen worden. Sie ist zu ihren Eltern geflüchtet, sie kommt bestimmt wieder."
Die Frau des Künstlers ist tief erschüttert, besorgt fragt sie mich nach dem Grund.
"Irgendwelche Familiengeschichten."
"Mühsam, alles sehr mühsam."
Der Künstler zuckt seine Schultern. Er bleibt einen Moment stehen.
"Dein Bild von der Bergpredigt gefällt mir, ja, das könnte etwas werden," sagt er mir.
Der flache weite See, der nah am Haus des Künstlers entstanden ist, trocknet allmählich aus. Sein Umfang schrumpft, es entstehen einzelne, kaum metertiefe Teiche, umgeben von tiefrotem, teils gelbschwarzem Schlamm. Von weit her werden Arbeiter herbeigeführt, harte Knochen, nackte Haut, tüchtige Hände. Dazu aufgeblähte allmächtige Vorarbeiter, regelrechte Mannschaften, aus umliegenden Dörfern zusammengetrommelt, in dreckigen auseinanderfallenden Lastern hergekarrt. Sie streiten sich um Gebiete, um Pfützen, um tränengrosse Teiche, um Fäkalien von Mensch und Tier, um eine Handvoll klebriger Erde. Pausenlos tragen sie den noch dickflüssigen Schlamm zu trockeneren, mit einer feinen Schicht Sand bestreuten Parzellen. Sie lassen ihn ein paar Tage liegen, dann kneten und pressen und drücken sie die noch feuchte feinkörnige Erde in Formen hinein, stellen unzählige Ziegelsteine her, lassen die wohlgeformten Steine weiter trocknen, tragen sie dann zusammen zu Haufen. In den folgenden Tagen entstehen Würfel, Türme, Pyramiden, haushohe Bauten mit Schächten und Nischen, man füllt sie mit Holzkohle, deckt den riesigen Haufen mit einer dünnen luftdichten Schicht Schlamm zu, zündet ihn an.
Tage- und nächtelang brennt ein unsichtbares Feuer, brennt eine seltsame namenlose Stadt. Rund um die mächtigen rauchenden Monster herum verweilen halbverhungerte Männer, lachende, weinende, verzweifelte Frauen, ausgenutzte Tagelöhner. Sie essen, sie trinken den Schlamm, sie schlafen im Schlamm, sie paaren sich, führen Schlachten im Schlamm, sie gehen, tanzen durch den Schlamm, sie fallen in den Schlamm, sie ruhen sich im Schlamm aus, vielleicht sterben sie im Schlamm, vielleicht können sie wieder stehen, können wieder gehen, vielleicht lachen, vielleicht... Vielleicht werden sie wieder Menschen, nicht Würmer, vielleicht haben sie wieder etwas zu essen ausser Schlamm, wieder etwas zu trinken. Selig die Armen, selig, die nach Gerechtigkeit dürsten, nach Wissen, selig die Hungernden, die Trauernden, die Träumenden, selig die Zweifelnden, selig die Kinder, denn ihnen gehört der Schlamm.
Schuf nicht Gott Adam aus diesem wertlosen Schlamm? Wer hat wen erschaffen? Gott Adam oder Adam Gott? Schuf der Mensch nicht Krischna und Schiva und Allah? Schafft er nicht selbst seinen Himmel und seine Hölle?
Die Kinder des Künstlers kommen mir entgegengerannt, auch Christine, seine Frau. Der Künstler umarmt mich, Christine, die Kinder. Antonamma scheint nirgendwo zu sein. Mir fehlt ihre vertraute Stimme, ihre wohlbedachten Mahnungen an die Kinder, ihre neugierigen freundlichen Blicke. Mein letztes Jahr habe ich an der Westküste Indiens verbracht, habe unter Fischern gelebt, mehrere Bilder gemalt. Vor sieben Jahren hatte der Künstler mich bei sich aufgenommen, er hat mir vieles beigebracht, das Zeichnen, das Malen, er hat mich mit Aufträgen versorgt. Ihm verdanke ich meinen Sinn für Farben, für Formen, meine Bilderwelt. Ihm verdanke ich auch ein grosszügiges Stipendium. In wenigen Tagen reise ich nach Singapore, dann weiter nach Australien. Ich kann meinen Traum von einem Studium endlich verwirklichen.
Fünf Jahre später sehe ich den Künstler wieder. Wir plaudern über das Leben der Fischer, über ihre wundersamen Katamarane, über den Leuchtturm von Muttom. Über Licht. Zwanzig grosse Bilder hat er fertiggestellt, Ölgemälde in leuchtend fröhlichen Farben. Er hat Frauengestalten aus der Bibel indisches Leben eingehaucht, aus dem Alten Testament Eva, Sarah, Ruth, aus dem Neuen Testament Maria, Elisabeth, Maria Magdalena. Ich erkenne Antonamma wieder in seinen Bildern. Ich sehe sie, wie sie die Wäsche auf die Leine hängt, wie sie das Wasser aus dem Brunnen holt, wie sie das kleinste Kind des Künstlers füttert.
Wir verlassen das Atelier. Um uns herum die roten kargen Felder, ein wolkenloser Himmel, einige herausragende Banyanbäume. Auf der einen Seite des Ateliers ein paar Schafherden, auf der anderen Seite der ausgetrocknete See. Eine mir unbekannte Frau schlägt die eingeseifte Wäsche der Familie auf einen flachen Granitbrocken. Zögernd frage ich den Künstler nach Antonamma.
"Arbeitet Antonamma nicht mehr bei uns?"
Er nimmt seinen Asthmaspray, saugt aus einer kleinen Medikamentenflasche.
"Antonamma, ah, ja...mühsam, alles sehr mühsam. Ich musste sie wegschicken. Sie loswerden."
Der Kleinwüchsige kommt zu mir gerannt, sein Gesicht strahlt, er legt den Granitbrocken, den er auf dem Kopf trägt, zuoberst auf einen Haufen.
"Wo bist du gewesen? Wo gehst du hin? Seit fünf Jahren habe ich dich nicht mehr gesehen!“
Ich erzähle ihm von meiner Arbeit unter Fischern, ich berichte ihm von meinem Stipendium an der Universität von Canberra. Er sieht mich erstaunt, traurig an.
"Du kommst und gehst schon wieder. Ein toller Freund bist du!"
Er scherzt, klagt an.
"Ich sehe den Künstler jede Woche hier vorbeifahren."
Der kleine Mann blickt hinauf zum Himmel, schützt seine Augen. Alles ausser der geteerten Strasse ist wie vor sieben Jahren, die mächtige Steingrube, der Geruch von Schiesspulver, Hammerschläge.
"Jetzt gibt es eine direkte Verbindung vom Dorf des Künstlers in die Stadt. Darum arbeiten auch viele vom Dorf hier in der Steingrube. Bestimmt kennst du Antonamma, die früher beim Künstler gearbeitet hat!"
"Antonamma? Arbeitet sie hier?“
Der kleine Mann führt mich zu einem Blechdach. "Antonamma war vor einem Jahr hierhergekommen und wollte Arbeit. Steine von unten in der Grube nach oben tragen, weil sie damit am meisten verdienen würde. Dann hat sie was Dummes getan. Was sehr Dummes. Als der Vorarbeiter die Explosionen vorbereitet und alle gewarnt hatte, lief Antonamma die Treppen dort hinunter. Die schmalen Treppen. Sie legte sich flach auf jenes Stück Fels. In letzter Sekunde sprang ein Arbeiter zu ihr, konnte sie ein Stück weit wegziehen, bevor die Explosionen losgingen. Boom! Boom! Boom! Antonamma war wild geworden, als habe der Teufel sie besessen, sie hat gekämpft wie ein Tiger.“
Der Kleinwüchsige führt mich zu einer Frau unter einem Blechdach. Laut ruft er ihren Namen.
"Antonamma, Antonamma!“
Eine alte Frau blickt hinauf zu mir, nimmt den Rand ihres verschmutzten löchrigen Sari um ihr Gesicht, sie verdeckt ihren Mund. Ich erkenne sie nicht wieder. Fassungslos starrt sie mich eine Weile an, lässt den schweren Hammer neben sich fallen. Ein merkwürdiger Schrei entflieht ihrer verwundeten Seele. Ihre perlweissen Zähne hat sie verloren, Ihre Augen sind tief eingesunken. Nur wenige kurze, vom Staub ergraute Haare sind noch auf ihrem Kopf. Dann ruft sie meinen Namen, starrt mich an, findet keine Worte.
"Antonamma, Antonamma, bist du es wirklich?“
Ihre Worte sind kaum verständlich.
"Du bist zurückgekommen. Wärst du nur da gewesen! Vielleicht hätten sie mich nicht so rausgeworfen, so wie eine elende Hündin!“
Die Worte des Künstlers stürzen vom Himmel herab, schwerer als alle Wolken, schwerer als der Granitregen, schwerer als tote herabfallende Sterne.
" Ich musste sie wegschicken. Sie loswerden! Antonamma war, du weisst es ja..., eine unmoralische Frau."
[1] Mann aus der religiösen Gemeinschaft der Sikhs

Dornen. Entwurzelte, weisse, dornige Sträucher fegen über eine blutrote Erde. Eine geteerte Strasse führt von einem dornigen Hügel zu einem entfernten, noch dornigeren Hügel, eine dunkle gewundene Linie inmitten roter Erde. Silbrig schimmernde Steine liegen zerstreut auf der flachen Ebene, sie glitzern im Licht der Sonne. Entlang der schwarzen Spur stehen mächtige weisse Baumstämme. Ihre Wurzeln ragen heraus und berühren in Tausenden von Strängen die dunklen kleinen Schluchten brachliegender Felder. Die Äste der kräftigen Bäume auf der einen Seite ringen mit den Ästen kräftigerer Bäume auf der anderen Strassenseite. In der menschenleeren Landschaft stehen Vogelscheuchen, stumme Zeugen eingesammelter Ernten. Sie ähneln Menschen, mit Köpfen aus Tonkrügen, hohlen Augen und weisser Kleidung. Vom Strassenrand bis hin zum Horizont sind die Felder in kleine Parzellen unterteilt, in jeder Parzelle steht eine Vogelscheuche. Der Wind peitscht durch die Baumkronen, wirbelt über die kargen Felder, bewegt die ausgestreckten Arme und Beine der seltsamen Gestalten. Wenn ein kleiner Wirbelwind eine Vogelscheuche erfasst, dreht sich diese plötzlich um die eigene Achse, schüttelt den Kopf und flattert mit den Armen. Sie bewegen sich unbändig, unabhängig voneinander, an Ort und Stelle stehend, jede in einem eigenen Feld, entflohene Insassen einer Irrenanstalt, aufgespürt und festgebunden, bis die Wächter kommen, um sie in Gewahrsam zu nehmen.
Unser Auto, Marke 'Ambassador', mehr ein Relikt als ein Auto, schleicht über eine Hauptstrasse, kracht, stottert, fährt, wie es dies seit fünfzig Jahren getan hat. Das Auto haben wir samt Fahrer in Iritty gemietet. Der Fahrer Chandu ist mir fremd, wir kennen uns nur von dieser einen Fahrt, auch Mutter Rose kennt ihn nur flüchtig. Chandu und ich befinden uns vorne im Auto. Celine, meine Schwester, schläft im Schoss der kleinen Rose auf der hinteren Sitzbank des 'Ambassadors'. Das Dröhnen des Autos und die Hitze verleiten uns einzuschlafen, die vielen Unebenheiten und Krater in der Strasse wecken uns aus unserem Schlummer. Celine, die drei Jahre lang eine Pflegerinnenschule in Guntur besucht hatte, ist erkrankt, und wir müssen sie nach Hause zurückholen, die achthundert Meilen kann sie schlecht allein reisen.
Die Fahrt von Guntur nach Hause wird drei oder vier Tage in Anspruch nehmen. Wir befinden uns im Bundesstaat Andhra Pradesch, ein Land mit mehr als fünfzig Millionen Menschen. Bis nach Koottu-Puscha in Kerala müssen wir durch Andhra selbst, aber auch durch Tamilandu und Karnataka fahren, durch drei verschiedene Bundesstaaten, durch drei Sprachgebiete, jedes Land so gross wie Deutschland. Wir fahren an einigen Dörfern vorbei, an dichten Behausungen am Horizont, an Menschen, deren Sprache und Kultur uns fremd sind. Seltsame Schriften, sonderbare Bauten, unbekannte Welten.
Plötzlich setzt sich Celine auf, starrt uns erstaunt an. Meine Mutter berührt sie sanft, zieht sie eng an ihren Körper, legt ihre Arme um sie. Celine beobachtet den Fahrer und mich sehr misstrauisch. Dann flüstert sie etwas ins Ohr meiner Mutter. "Chandu, bitte können Sie kurz anhalten?" Der Chauffeur verlangsamt das Auto und befolgt den Wunsch meiner Mutter. Mutter Rose hilft Celine aus dem 'Ambassador' heraus. Sie begleitet sie hinter einen Strauch.
"Eine schreckliche Hitze, nicht wahr?"
Ich versuche, mit dem Fahrer ins Gespräch zu kommen, ihn wach zu halten.
"Es wird von Jahr zu Jahr wärmer", antwortet er mir. "Wird es nicht so heiss in Deutschland?"
"Vor zwei Wochen, als ich München verliess, war es gerade null Grad. In der Nacht sogar minus sieben Grad."
Chandu kann sich diese Kälte gar nicht vorstellen. Auch er freut sich über das Gespräch.
"Mutter sagte mir, Sie studieren Film. Ist das nicht sehr teuer?"
"Ich habe Glück gehabt, ich habe ein Stipendium erhalten. Ich liebe das Kino. Gehen Sie manchmal ins Kino?"
Chandu schmunzelt.
"Ich bin immer im Kino. Der Blick durch die Autoscheibe...."
Chandu und ich finden eine gemeinsame Sprache.
"Als kleiner Knabe habe ich die Welt durch die Löcher im Regenschirm meines Grossvaters gesehen. Ich liebe diesen Blick auf einen Ausschnitt."
Chandu denkt laut nach.
"Unsere Welt besteht aus lauter Ausschnitten, Bilder, die wir mit unsichtbaren Fäden zusammenhalten, persönliche Welten."
"Das ist ein wahres Glück, die Welt so zu sehen. Eine eigene Welt zu haben."
Mutter kehrt zurück zum Auto. Aber sie bleibt draussen und wartet auf Celine. Während der Fahrer wegsieht, winkt sie mich aus dem Auto heraus zu sich. Ich verstehe sie nicht. Sie nimmt mich zur Seite.
"Celine kann nicht Wasser lassen."
Wir beschliessen, noch eine Weile zu warten. Mutter zieht mich vom Auto weiter weg, ausser Hörweite des Fahrers.
"Celine ist sehr krank. Welch ein Unglück! Eine unheilbare Krankheit."
Plötzlich kommt Celine zu uns und starrt mich an. Mutter fragt sie, was los sei.
"Ich kann nicht, wenn fremde Männer mich anstarren."
"Aber niemand starrt dich an. Der Fahrer sitzt im Auto und wartet auf die Weiterfahrt."
"Er hat mich angestarrt. Er."
Celine beschuldigt mich."
Er hat mich durch den dünnen Strauch angegafft."
Celine zeigt sich empört, dass ich sie noch ansehe.
"Aber Celine, er hat dich nicht durch den Strauch beobachtet."
Celine bleibt stur.
"Ausserdem ist er dein Bruder. Was soll das?"
Meine Mutter will sie beruhigen. Sie bringt Celine näher zu mir, stellt sie mir gegenüber. Ich will ihre Hand nehmen, aber sie zieht ihre Hand blitzartig zurück. Sie fixiert mich mit ihren grossen runden Augen. Sie sieht mich lange an. Dann zischt sie ins Ohr meiner Mutter.
"Er ist nicht mein Bruder."
Mutter Rose will mich beruhigen.
"Sohn, geh zurück ins Auto, nimm, was sie sagt, nicht so ernst. Sie ist nicht ganz wach."
Nach einer kurzen Weiterfahrt halten wir nochmals an. Wieder das Flüstern zwischen Mutter und Tochter. Mutter Rose begleitet Celine hinter einen Strauch. Wieder das lange Warten. Celine hat grosse Mühe Wasser zu lassen. Sie kann nicht Wasser lassen. Celine schaut mich immer wieder an. Mutter scheint wirklich besorgt zu sein. Sie spricht sie leise an.
"Er ist kein Fremder. Erinnerst du dich nicht? Dein ältester Bruder!"
Dass Celine mich nicht erkennt, ist verständlich. Celine ist vor zwanzig Jahren, kurz nach meinem Eintritt in das Internat geboren. Sie hat mich nur alle paar Jahre einmal gesehen. Ich bin für sie eigentlich ein Fremder, einer, der weder das Essen noch die Bettlaken mit ihr geteilt hat, einer, den sie als junges Mädchen auch zu Hause nur versteckt beobachtet hatte. Celine ist mir ebenfalls fremd. Ich weiss, dass sie meine Schwester ist, ich weiss, dass sie zur Familie gehört, ich weiss, ich weiss, ich weiss. Ich habe sie als Säugling gesehen, dann immer wieder in längeren Abständen, jeweils zwei oder drei Jahre, die Jahre hatten uns Geschwister zu Fremden gemacht. Meine Begegnungen mit ihr waren stets kurz. Bis sie ihre Scheu, ihre Angst überwunden hatte, musste ich sie verlassen, zurück zum Internat, zum Haus des Künstlers, nach Manila. Plötzlich steigt Celine wieder ins Auto, drängt den Chauffeur weiterzufahren. Ihr Ton ist gehässig. Wieso gaffe er sie dauernd an? Sei er denn taub? Wozu habe er überhaupt angehalten?
Wir fahren durch eine kleine Stadt und halten an einer Strassenkreuzung an. Trotz der Mittagshitze befinden sich viele Menschen auf der geteerten Strasse. Der Fahrer steigt aus, um Früchte zu kaufen. Neugierige Menschen sammeln sich um das Auto herum. Ihre penetranten Blicke scheinen Celine zu beunruhigen. Celine spricht leise vor sich hin. Mutter drängt Chandu, so schnell wie möglich von der Kreuzung wegzukommen.
Kurz nachdem wir die Stadt verlassen haben, spricht Celine den Chauffeur in schroffem Ton an.
"Anhalten. Dummkopf! Halt an!“
Befiehlt sie. Es ist unerhört, dass eine junge Frau einen Mann so anspricht, einen älteren Mann dazu, auch wenn der Angesprochene bloss ein Fahrer ist, jemand, der gewöhnlich anderen immer nur dient. Chandu wirft einen fragenden Blick auf mich und dann auf meine Mutter. Sie bittet ihn höflich anzuhalten. Celine steigt rasch aus. Mutter Rose bleibt eine Weile zurück, um den ratlosen Fahrer zu beruhigen.
"Meine Tochter ist etwas nervös. Ich bitte um....."
"Es ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung."
Der Mann unterbricht Mutter Rose.
“Es macht wirklich nichts."
Auch ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass unser Fahrer bei guter Laune bleibt. Ich berühre seine Hand.
"Bitte entschuldigen Sie. Sie meint es nicht so.“
Plötzlich steht Celine mitten auf der Strasse vor unserem Auto und starrt uns an. Ihr Gesicht verkrampft sich. Sie hebt ihren Rock. Der Urin fliesst ihr die Beine hinunter. Mutter springt aus dem Auto heraus und will Celine weg von der Strasse bringen. Sie stösst Mutter weg und schreit sie an.
"Lass mich in Frieden! Lass mich in Ruhe! Lass mich!“
Danach dreht sie sich um und geht in Fahrtrichtung des Autos. Celine spricht vor sich hin, spricht aufgeregt und ununterbrochen. Sie spricht mit jemandem, jemandem, den sie in ihrer Fantasie ausgemalt hat, oder mit einem Menschen aus ihrer Erinnerung, mit einem, der uns fremd und unbekannt bleibt, der für uns unsichtbar bleibt, der aber für sie sehr real sein muss. Sie bittet ihn, ihr nicht mehr zu folgen, sie streitet heftig mit ihm, sie stösst ihn immer wieder weg.
Celine wollte Krankenschwester werden. Für junge indische Frauen ist die Krankenpflege die einzige Lehre mit realen Berufschancen. Sowohl in Indien als auch im benachbarten Mittelosten sind indische Krankenschwestern sehr gefragt. Solche Lehrstellen sind im Bundesland Kerala äusserst schwierig zu finden, schon der Eintritt in eine Schule kostet ein Vermögen. Deshalb war Celine so weit gereist, nach Guntur im Bundesstaat Andhra Pradesch, wo katholische Nonnen ihr eine Lehrstelle in einer ihrer Pflegerinnenschulen angeboten hatten. Aber auch sie hatten eine Eintrittsgebühr für die Lehrstelle verlangt, eine 'Spende' von dreissigtausend Rupien.
Dreissig Silbermünzen ohne Quittung.
Das Schreiben der Leiterin der Pflegerinnenschule, Schwester Angelina, hätte nicht dringlicher sein können. "Wir bedauern, Celine frühzeitig entlassen zu müssen. Bitte holen Sie sie sofort aus unserer Schule ab. Sie ist krank und kann nicht allein reisen." Das 'sofort' hatte die gütige Nonne zweimal mit rot unterstrichen. Dabei hatte Celine bereits drei Jahre in der Schule verbracht, stand kurz vor den Abschlussprüfungen.
Meine Eltern leben allein, alle meine Geschwister sind fort, führen ihr eigenes Leben. Mutter Rose war erleichtert, dass ich in den Ferien nach Hause gekommen war, dass ich mit ihr zu Celine reisen konnte. Wir waren vor vier Tagen aus Iritty abgereist, sofort, wie die Nonne von uns verlangt hatte. Mutter Rose hatte darauf bestanden, Celine mit dem Auto abzuholen, eine Fahrt mit der Bahn kam für sie überhaupt nicht in Frage. Dabei ist mir die lange Hin- und Rückfahrt mit dem unbequemen 'Ambassador' ein Greuel. Bei diesem seltsamen Gefährt bläst die Hitze aus dem Motorraum unweigerlich ins Innere des Autos. Es ist mehr als vierzig Grad heiss auf der geteerten Strasse, die Feuchtigkeit geradezu erschlagend.
Mit einem Teil meines Stipendiums, mit hundert Mark im Monat, unterstütze ich meine Familie. Nur so konnte Vater für Celine die dreissigtausend Rupien aufbringen und ihr eine Lehrstelle bei den Nonnen sichern. Da Celine endgültig aus der Pflegerinnenschule entlassen wurde, ist diese ungeheure Summe nun verloren. Dreissigtausend Rupien sind etwa soviel wie drei Jahreseinkommen meiner Eltern. Schwester Angelina hatte eine Rückerstattung auch nur eines Teils des Geldes abgelehnt. Sie war sichtlich verärgert. Wie könnte Mutter Rose die Rückgabe einer Spende verlangen? Meine Mutter Rose kann den Verlust gar nicht verkraften. Der Nonne gegenüber die ‘Spende’ bloss zu erwähnen, war für sie bereits eine Demütigung. Ich sehe sie im Rückspiegel des Autos. Sie stützt ihr Kinn mit der Hand, ihr Gesicht ist schweissgebadet, ihre Augen sind voll Kummer.
Allmählich begreife ich, warum die Nonnen uns aufgefordert hatten, Celine schleunigst abzuholen, warum sie aus der Pflegerinnenschule entlassen wurde, warum sie ihre Lehre nicht fortsetzen kann. Ich kann es kaum fassen. Celine, meine jüngste Schwester ist krank, sehr krank. Als wir sie am frühen Morgen abgeholt hatten, war sie noch freundlich, distanziert, aber immerhin freundlich. Auch zeigte sie keinerlei Anzeichen einer Erkrankung, weder Fieber noch Kopfschmerzen.
Meine Mutter Rose steigt aus dem Auto heraus und folgt Celine auf der Strasse aus sicherer Entfernung. Nach mehr als einer Stunde gelingt es Mutter, Celine wieder einzuholen. Behutsam führt sie Celine zurück zum Auto.
Entlang der Hauptstrasse von Hyderabad nach Madras übernachten wir in einem Drei-Sterne-Hotel. Drei Sterne! Auf den Wänden lauern kleine Eidechsen und jagen Fliegen aller Art. Ein staubbedeckter Ventilator kracht die ganze Nacht hindurch, macht so den Schlaf unmöglich. Und wenn der Strom unterbrochen wird und der Ventilator schweigt, plagen uns die Mücken. Wo einst die Klimaanlage eingebaut war, gähnt ein riesiges Loch. Der Karton, mit dem das Loch zugedeckt war, ist heruntergefallen und erlaubt uns so einen Blick auf den klaren Himmel, auf die Milchstrasse. Man sieht mehr als drei Sterne.
Celine ist in tiefen Schlaf gesunken. Sie und meine Mutter Rose teilen einen grosszügigen Raum miteinander. In ihrem Zimmer funktioniert die Klimaanlage. Sie dröhnt ähnlich wie das Ambassador-Auto, monoton über ihren Köpfen. Chandu, unser Fahrer, hat sich dafür entschieden, in seinem Auto zu übernachten, wie es seine Gewohnheit ist auf so langen Reisen. Das Auto ist nicht sein Eigentum, und er ist verpflichtet, es immer im Auge zu behalten. Dass er zwei Stockwerke tiefer im Auto auf dem Hinterhof des Hotels schläft, ist Mutter Rose gerade recht. "Ich kann dir nicht alles im Auto sagen. Chandu wird die ganze Sache in unserem Dorf verbreiten. Dann weiss die ganze Welt davon, und es wird unmöglich sein, für Celine später einen Mann zu finden."
Ehen werden in Indien immer noch von den Eltern arrangiert. Junge Menschen, insbesondere in den Dörfern, haben keinerlei Möglichkeit, ihren Partner selbst zu wählen. Die Trennung der Geschlechter ist allgegenwärtig, so selbstverständlich, dass niemand, nicht einmal die Intellektuellen des Landes, sie für anormal halten. Die Trennung wird durch die Religionen noch zementiert, die einzelnen Religionen verbieten ihren Gläubigen, Menschen anderer Religionen zu ehelichen. Meine Eltern glauben immer noch daran, dass Ehen ausserhalb der Religionsgemeinschaft Todsünden seien und dass sie mit der Exkommunikation bestraft werden können. So hat es sie die Katholische Kirche gelehrt. So lehrt sie die Kirche auch heute noch.
Mutter Rose ist sehr um die Zukunft von Celine besorgt, und diese Zukunft ist für junge Frauen im patriarchalischen Indien nur unter der Obhut der Eltern und später im Schutz der Ehe gesichert. Deshalb verheimlicht Mutter Rose, dass Celine psychisch gestört ist, dass sie seit Jahren an einer seltsamen Krankheit leidet, dass ihre Krankheit nach Phasen scheinbarer Gesundheit immer wieder ausbricht, dann, wenn man sie am wenigsten erwartet, für alle unerklärlich und unheilbar.
"Wieso hast du mir gegenüber die Krankheit von Celine nie erwähnt? Warum habt ihr mir nie darüber geschrieben?"
Meine Mutter will Celine nicht aufwecken. Sie kommt aus dem Zimmer heraus und setzt sich auf den Flur des Hotels. Sie lässt die Zimmertür einen kleinen Spalt offen, traut sich nicht einmal, meine schlafende Schwester einen Augenblick allein zu lassen.
"Es ist nicht schlimm, nicht so schlimm, wie du denkst. Ab und zu, nur ab und zu benimmt sie sich etwas seltsam. Ich habe ihr eine Tablette gegeben. Morgen wird sie ganz normal sein."
"Was für eine Tablette? Wie lange ist sie schon krank? Was heisst ab und zu?"
Meine Empörung kann ich kaum verheimlichen. Mutter denkt nach, erinnert sich.
"Es hat vor etwa fünf Jahren angefangen. Ein plötzliches Erwachen in der Nacht, ein Weinen ohne einen Grund, Schwierigkeiten beim Wasserlassen. Du warst weit weg. Es hätte auch nichts genutzt, dich zu informieren. Du hättest dir bloss Sorgen gemacht. Wenn Celine so einen Anfall hatte, brachten wir sie zum Dorfvikar. Er hat seine Hand auf ihren Kopf gelegt. Er hat für sie gebetet. Sie gesegnet."
"Was für Tabletten, was für Tabletten gibst du ihr?"
Meine Mutter steht auf und holt mir eine kleine Packung aus ihrer Reisetasche. Mutter kann die englische Schrift nicht lesen und gibt sie mir. Es sind Schlaftabletten.
"Wer hat dir diese Tabletten gegeben?"
"Es sind meine. Ein Arzt hat sie mir vor ein paar Jahren verschrieben. Damals konnte ich nicht schlafen. Diese Tabletten sind gut. Sehr gut. Wenn Celine richtig durchgeschlafen hat, wird sie wieder normal. Dann erinnert sie sich nicht mal an all das, was sie durchgemacht hat. Oder getan hat.“
Wir befinden uns wieder auf der Strasse und fahren an kleinen Dörfern vorbei. Die Gegend entlang der Küste ist grün. Die Reisfelder liegen brach in der Sommerhitze, hier und dort sieht man Anhäufungen von Heu. Unter Palmen am Strassenrand verkaufen Menschen Kokosnüsse, Zuckerrohrstangen und frische grüne Mango. Unter schattigen Banyanbäumen ruhen Ochsen und Kühe, magere Tiere, die wie ihre Besitzer auf die Ankunft des Monsuns warten.
Celine ist aus ihrem tiefen Schlummer aufgewacht. Sie sitzt unbeweglich da und starrt in die Ferne. An die Ereignisse des gestrigen Tages kann sie sich nicht erinnern. Immer wieder legt sie sich auf den Schoss der Kleinen Rose, erschöpft von den Anstrengungen der Reise. Wenn ich sie ansehe, blickt sie weg. Ich kann es kaum glauben, dass dies meine Schwester ist, die ich vor meiner Reise nach Australien gekannt habe. Damals war sie knapp vierzehn, ihr pechschwarzes Haar mit bunten Haarbändern geschmückt, ihr Gesicht schmal und länglich, ihre Hände zart. Ihr fröhliches Gelächter erfüllte unsere Hütte. Sie war schlank und hübsch, das hübscheste Mädchen im ganzen Dorf. Nun sind ihre Arme und Beine geschwollen, sie wirkt blass und kraftlos. Auch ihr Gesicht ist rundlicher geworden, ihr Haar braun und schmutzig, voller Knoten. Sie hat an Gewicht zugelegt, ihre Augen leuchten nicht mehr.
Das lange Sitzen im unbequemen Gefährt macht uns allen zu schaffen. So halten wir jede Stunde an.
"Sobald wir zu Hause ankommen, müssen wir Celine nach Potta bringen"
Flüstert mir Mutter Rose zu. Meine Mutter nimmt mich zur Seite. Weg von Celine, weg vom neugierigen Fahrer Chandu.
"Der Teufel hält Celine gefangen. Sie braucht Ruhe und Gebet."
Ich höre Mutter gespannt zu, von den täglichen Pilgerfahrten von Tausenden von Gläubigen, von einem besonders fähigen Priester.
"Er ist kein böser Guru, sondern ein katholischer Geistlicher, ein sehr sanfter Pfarrer, der durch blosses Handauflegen Celine beruhigen kann. Er bewirkt Wunder, hat Hunderte von Menschen geheilt. Er heilt alles, Tuberkulose, Krebs, Besessenheit. Nur er kann Celine heilen."
"Mutter, das ist Schwachsinn. Dieser Priester ist ein Scharlatan!"
Protestiere ich.
"Wie könnt ihr so etwas glauben?"
Meine Empörung verunsichert sie keineswegs. In den letzten fünf Jahren habe der Priester sie mit Handauflegen behandelt, das Handauflegen habe Celine immer beruhigt, nur so könne man den Teufel besiegen.
"Kein Arzt kann Celine je helfen. Nur das Gebet. Nur Jesus."
"Mutter!"
Die Fahrt entlang der Ostküste Indiens, durch dichtbevölkerte Städte, durch dichter werdende Menschenströme verursacht dem nicht ortskundigen Fahrer Chandu etliche Unannehmlichkeiten. Schlecht bezahlte Polizisten schreien ihn an, ebenso bedrängte Lastenträger und zurückgewiesene Bettler. Rauch aus den Dieselmotoren der Lastwagen mischt sich mit dem Staub der Strasse. Der Lärm laut krachender Dreirad-Rikschaws vermengt sich mit dem Gesang der Priester, die Schreie der Händler gehen in den feurigen Reden lautstarker Politiker unter. Filmmelodien in Telugu verbinden sich mit Schlagern in Tamil und Hindi. Rockmusik indischer Prägung wetteifert mit Rock aus der westlichen Welt. Schwachsinn übertönt Schwachsinn.
Mutter will Celine mit Schlaftabletten beruhigen, solange, bis sie ihre Tochter zu ihrem Wunderheiler bringen kann. Dann wird Mutter eine grosszügige Spende hinterlegen, der eine Teufel wird den anderen austreiben, er wird sie ‘heilen’ und zurückschicken, bis die Symptome nach wenigen Monaten oder nach einem Jahr erneut ausbrechen. Dann wird Mutter Rose Celine wieder zum Vikar bringen, eine noch grosszügigere Spende leisten, sich trösten mit ihrem Glauben und ihrem Aberglauben. Der Priester wird sie heilen, den Teufel besiegen, zum Ruhm der Heiligen Römischen Kirche, zur Ehre Gottes, bis noch mehr verzweifelte Menschen bei ihm Zuflucht suchen, immer mehr, immer wieder.
Celine schläft, ihr Gesicht gepresst an die schmutzige Glasscheibe des 'Ambassadors'. Schweissperlen bilden sich auf dem unförmigen Gesicht. Schleim entweicht ihrem umformten Mund. Eine hässliche leblose Masse gehorcht den Bewegungen des Autos, schwingt mit, wird hin und her geschüttelt, ein hilfloses Lamm im Schoss der Mutter auf dem Weg zum Altar, zur Opferung.
Ich sehe das kleine Kind Celine, ein verletztes Küken in den Händen, Tränen in den Augen. Mutter Rose hatte vier Eier beiseite gelegt, vier Küken waren aus den Eiern geschlüpft, drei davon waren Raubvögeln zum Opfer gefallen. Nur das eine Küken, das Küken der dreijährigen Celine, hatte überlebt. Nun war auch dieses angegriffen worden und lag sterbend unter einem Mangobaum. Celine hatte ihr Küken im letzten Augenblick, kurz bevor der schwarzgraue Raubvogel es mitnehmen konnte, unter den verwelkten Blättern gefunden. Bald darauf stand Celine auf dem Hof vor unserer Hütte, das noch atmende Küken in ihrer Hand. Sie war verzweifelt und untröstlich, ihre Tränen fast so gross wie ihre Augen. Meine grosse Mutter legte das Küken unter eine bronzene Schüssel. Während sich meine Geschwister um die alte Schüssel sammelten, nahm sie ein Stück Holz und klopfte sanft darauf, lang und rhythmisch. Ich war am Ende meiner Internatszeit nach Hause gekehrt, und obwohl mir dieser Augenblick des Wunders aus der eigenen Kindheit vertraut war, schaute auch ich neugierig zu. Meine Grossmutter hob eine Kante der Schüssel hoch und das Küken rannte triumphierend heraus, mit zarten weissen Federn, die Flügel ausgebreitet, lebensfroh. Celine nahm das Küken in ihre kleinen Hände, die Schatten in ihren Augen waren verflogen, sie strahlte vor Glück.
Ich sehe noch das wunderbare Mädchen Celine, wie sie lachend aus der Hütte meiner Eltern heraustritt, bunt gekleidet, fröhlich,stets zu einem kleinen Streich aufgelegt, allen anderen auf ihrem Weg zur Schule vorauseilend, oder wie sie mit einem Kupferkrug auf dem Kopf durch das gesättigte Grün der Kaschewfelder zum Brunnen geht, singend, tanzend, träumend, halb Kind halb Frau, wie sie nach Hause kommt, Wasser tragend, ihr Gesicht durchnässt und rot, eine Knospe im Zauber der morgendlichen Sonne, wie sie im Beisein der Mutter den Boden mit Kuhmist schmiert, oder Getreide mahlt oder Brennholz spaltet, ohne Kummer und ohne Klagen, ohne ein einziges Wort der Bitterkeit.
Celine wacht auf, bleibt stumm, schliesst ihre Augen wieder. Sie wacht erneut auf, lehnt sich an Mutter Rose, nimmt ihre Hand. Sie betrachtet mich mit ihren grossen neugierigen Augen. Hat sie mich angelächelt? Oder habe ich mich nur getäuscht? Manchmal streckt sie ihren Kopf aus dem Fenster des Autos hinaus, um Affen am Strassenrand nachzusehen. Wenn das Auto an einem Dorf vorbeifährt, beobachtet sie spielende Kinder, winkt den Kindern zurück, lacht, spricht mit Mutter Rose. Wir fahren durch weite Sonnenblumenfelder, das Gelb der Blumen erregt ihr kindliches Gemüt, sie spricht, sie spricht ununterbrochen, scherzt, kichert, lacht. Mutter Rose und Celine flüstern mieinander, tauschen Geheimnisse aus, fröhlich wie zwei kleine Kinder. Ich sehe die Erleichterung in den Augen meiner Mutter. Ich würde Celine gerne ansprechen, aber Mutter winkt ab. Allmählich schlafe ich ein, die Anspannung der letzten Tage hat mich meiner Kräfte beraubt, auch die unerträgliche Feuchtigkeit.
Ein plötzliches Bremsen weckt mich aus tiefem Schlaf. Ein Hund taumelt auf der Strasse, von einem entgegenkommenden Jeep überfahren, ein blutiger Anblick, den man nicht vermeiden kann. Chandu verlangsamt das Auto, weicht dem überfahrenen Tier aus, fährt vorsichtig über den Strassenrand, wirbelt Staub auf. Celine wendet sich zurück, starrt den sterbenden Hund an. "Schau nicht hin, Celine." Mutter Rose legt ihre Arme um sie, will ihr den schrecklichen Anblick ersparen. Celine stösst sie zurück, ihr Blick auf den Hund genagelt, der nun hinter uns liegt, umhüllt vom Staub und Rauch der Strasse.
Plötzlich dreht Celine sich um, schreit unseren Fahrer Chandu an, beschuldigt ihn, den Hund überfahren zu haben. Sie beschuldigt ihn, betrunken zu sein, sorglos zu fahren, sie dauernd anzugaffen, anstatt sich auf die Strasse zu konzentrieren. Chandu fährt weiter, aufs offene Feld, hält an, steigt aus dem Auto und zündet sich eine Zigarette an. Nun redet Celine sehr erregt, ihr Gesicht wird rot, ihre Augen glühen. Ich versuche, sie zu beruhigen. "Celine, der Hund ist von einem Lastwagen überfahren worden. Chandu hat nur versucht, dem bereits angefahrenen Hund auszuweichen."
Celine will nichts davon wissen. Sie wendet sich nun gegen mich. "Du hast geschlafen. Du hast es gar nicht gesehen. Du hast gar kein Recht, etwas zu sagen.“ Celine spuckt mich an. Ich will nicht, dass sie mich anschreit, mich anspuckt. Ich erhebe ebenfalls meine Stimme. "Celine!" Plötzlich ohrfeigt sie mich, sie ringt mit mir, ihre Nägel bohren sich tief in meine Haut. Mutter Rose und ich bemühen uns, Celine unter Kontrolle zu bringen. Sie lässt nicht nach, wütet, ihre Hände greifen nach meinem Hals. Mutter Rose steigt aus dem Auto heraus, ein Stoss mit dem Ellbogen hat sie empfindlich getroffen. Vom hinteren Sitz des Autos greift mich Celine an, ihre Zähne fletschend, ihre Krallen vor meinen Augen.
Von einem nahegelegenen Dorf sind Menschen herbeigeeilt, in Erwartung einer Komödie, einer kostenlosen Vorstellung, eines nicht alltäglichen Dramas. Chandu hat mich aus dem Auto herausgezerrt, die Türen versperrt, das Auto gegen einen Baum geschoben, damit Celine gefangenbleibt, damit sie auch geschützt bleibt, bis ihre Wahnvorstellungen ausgelebt sind, und niemand, auch sie selbst nicht, zu Schaden kommt. Besinnungslos kämpft sie mit Händen und Füssen, sie wirft sich gegen die geschlossenen Türen, sie schreit das Leben aus ihrem Hals heraus. Blut strömt über ihr Gesicht. Aus ihrem Käfig beobachtet sie die Dämonen, die um sie versammelt sind. Alle sind ihr fremd, alle sind ihr feindlich gesinnt, alle sind ihr überlegen. Ängstlich und erschöpft legt sie sich hin, ihr Mund schäumend, ihre Augen offen, ihr Körper zitternd. Die Anwesenden flüstern einander zu, auch sie betrachten Celine ängstlich, auch sie sehen nur den Dämon, der leidende Mensch scheint ihnen bedeutungslos zu sein. Sie sammeln Schlagstöcke, die Kinder graben in der trockenen Erde nach Steinen, die Frauen heben ihre Sichel hoch, nach Blut dürstend.
Die Gelassenheit meiner Mutter verstehe ich nicht. Sicher hat sie das sonderbare Benehmen ihrer Tochter bereits erlebt, vielleicht weiss sie, wie der Anfall sich entwickeln wird, wann der Höhepunkt erreicht ist und wann und wie er ausklingen mag. Wieso fürchtet sie nicht um das Leben ihrer Tochter? Sind die herbeigeeilten Dämonen nicht gefährlicher und bedrohlicher als die, die Celine in den Wahnsinn treiben? Ist Celine nicht der Mordlust und dem Aberglauben dieser Menschen ausgeliefert? Wie können wir, Chandu, meine Mutter und ich, sie vor so einer unberechenbaren Menschenmasse schützen?
Ich spreche eine ältere Frau an, ich versuche ihr klarzumachen, dass meine Schwester krank ist, dass der Anfall vorüber sei, dass wir nun weiterfahren würden. Meine Sprache ist ihr fremd, sie versteht meine Worte nicht, aber sie teilt meinen Kummer. "Devi", flüstert sie ehrfurchtsvoll, "Devi", Göttin. Sie lächelt mich an. "Eine Göttin?" - "Kali, Mutter aller Götter, Ursprung allen Lebens, Gott und Teufel zugleich."
Chandu schiebt das Auto wieder auf die Strasse. Mutter nimmt Platz auf der vorderen Sitzbank, zwischen dem Fahrer und mir. Celine scheint fest zu schlafen. Wir fahren vorsichtig los, ohne Celine zu wecken. Wir fahren weg von den schaulustigen Dorfbewohnern, bevor es zu spät wird, bevor Celine mit weiteren Anfällen die Anwesenden beunruhigt, bevor ihre Krankheit fantasielosen Priestern Anlass bietet, unschuldige Menschen gegen sie aufzuhetzen. Bevor die Wahnvorstellungen der Priester sie dazu treiben, die Hilflosigkeit eines kranken Menschen auszunutzen. Bevor der Glaube oder der Aberglaube uns den Verstand vernebelt, uns unserer Menschlichkeit beraubt. Bevor die Nacht für immer über uns hereinbricht.
Ich bewundere die Weisheit der alten Frau, die Leichtigkeit ihrer Worte, die Klarheit ihrer Erkenntnis, die das Göttliche mit dem Teuflischen vereint, Gesundsein und Kranksein, Himmel und Hölle, Leben und Tod. Ich wünschte, ich könnte Mutter Rose überzeugen, dass Celine keiner Teufelsaustreibungen bedarf, dass sie nicht besessen ist, dass weder sie noch sonst jemand vom Teufel geritten wird, ich möchte meine Mutter überzeugen, dass es das Gute und das Böse nicht gibt, dass es sich stets um Schwächen und um Stärken, um Triumphe und um Niederlagen handelt.
Um menschliche Höllenabstiege. Um menschliche Auferstehungen.
Erschöpft erreichen wir ein kleines Hotel nördlich von Madras. Chandu wäre bereit weiterzufahren bis nach Madras, aber der gute alte ‘Ambassador’ zeigt Ermüdungserscheinungen, stottert, raucht vorne und hinten. Während unser Fahrer sich um das Auto kümmert, möchte Mutter Rose sich von den Strapazen des Tages erholen.
Das Hotel ist fast ausgelastet, und wir sind gezwungen, die zwei noch verfügbaren angrenzenden Zimmer im obersten Stockwerk zu beziehen. Zwar hat das Hotel einen Aufzug, aber wegen Wartungsarbeiten ist dieser ausser Betrieb. Dafür habe das Hotel andere Qualitäten.
"Keine Mücken!"
Versichert mir der Hoteldirektor.
„Nur fünfzig Meter vom Meer und immer ein starker Wind. Keine Mücken."
"Kakerlaken?"
Der Direktor ist sichtlich amüsiert. "Zeigen Sie mir ein einziges Hotel in der Welt ohne Kakerlaken."
Ich möchte ihn davon überzeugen, dass es in Deutschland Hotels gebe, in denen kein Ungeziefer vorkommt. Ich erzähle ihm von meinem Studienaufenthalt in München, er hört alles mit Neugier und Bewunderung an, wir reden herzlich miteinander. Aber dass es keine Kakerlaken in deutschen Hotels gibt, kann er nicht glauben, will er nicht glauben. Sein Stolz lässt Hotels ohne Kakerlaken nicht zu.
Nach Mitternacht wacht Celine auf. Sie steht am Fenster und summt eine Melodie. Ich betrete das halbdunkle Zimmer und flüstere ihr zu, sie solle sich wieder hinlegen und versuchen zu schlafen. Aber sie ignoriert mich und setzt ihr beunruhigendes Summen fort. Mutter Rose schläft so tief, dass sie davon nichts wahrnimmt. Eine Weile steht Celine still, das unruhige Meer betrachtend. Unten auf einer Strassenseite steht unser gemietetes cremefarbenes Auto. Dahinter am Strand liegen umgekippte Fischerboote, auf Bahren aufgereiht, in kleinen Ansammlungen. Immer wieder scheint der Mond auf das dunkle Meer, erhellt die weiss aufschäumenden Wellen, verschwindet anmutig hinter schwerbeladenen Wolken. Celine lauscht dem Brausen des Meeres, den dumpfen Schlägen der Wellen, gebannt betrachtet sie das Erscheinen und Verschwinden des Mondes in kurzen Abständen, bis eine geschlossene Wolkendecke ihr den Mond raubt, bis auch der hellste Stern erlischt.
Wutentbrannt trommelt Celine gegen die Wand. Ich schalte das grelle Neonlicht an, es leuchtet, erlischt, leuchtet wieder. Ich wecke meine Mutter. Mutter Rose versucht, auf Celine einzureden, sie zur Vernunft zu bringen, sie zu besänftigen. Aber Celine ist nicht zu beruhigen. Sie kreist um das Bett wie ein gejagtes Tier, sie schreit, sie stampft auf den Fussboden, sie tobt umher, in allen Zimmern flackern die Neonlichter auf. Ich werfe sie auf das Bett. Mutter will, dass ich sie auf dem Bett festhalte, während sie ihr Beine und Arme festbindet. Mutter will Celine fesseln, damit die anderen Hotelgäste nicht geweckt werden, damit kein Unglück geschieht, Mutter muss sie fesseln, um zu verhindern, dass wir mitten in der Nacht aus dem Hotel hinausgeworfen werden.
Den Hoteldirektor kann ich beruhigen. Ich muss ihn belügen. Auf Mutters Geheiss erzähle ich ihm, dass Celine einen Epilepsieanfall hatte, dass sie sich beruhigt habe, dass sie nun tief schlafe. Aber es schmerzt mich, dass ich sie festgehalten habe, dass ich sie geschlagen habe, dass ich sie, mit einem Bettlaken über den Mund gepresst, zum Schweigen gebracht habe. Es entsetut mich, dass meine Mutter sie so oft mit Schlafmitteln beruhigt, dass wir keinen Arzt zu Hilfe geholt haben, dass Mutter Rose alles verheimlicht. Es empört mich, dass Priester kranke Menschen für ihre Ziele missbrauchen.
"Warum willst du nicht, dass Celine von einem Arzt untersucht wird? Warum können wir nicht den Arzt anrufen, den uns der Hoteldirektor vorgeschlagen hat? Warum benimmt Celine sich so?"
In den frühen Morgenstunden sammeln sich dunkle Gestalten am Strand. Waghalsige Fischer stossen ihre Boote und Katamarane aufs offene Meer. Der Mond, auch er ein tollkühner Fischer mit einem billigen Katamaran, eilt zwischen den lumpigen Wolken, er segelt zum Horizont. Auch er ist dem Irrsinn verfallen und wirft sein Netz nach den Sternen.
Mutter Rose setzt sich auf einen Stuhl auf dem geräumigen Balkon und bittet mich, neben ihr Platz zu nehmen.
"Da ist etwas, was nur dein Vater, Celine und ich wissen."
Ihr langes Nachdenken und Schweigen ist schier unerträglich.
"Was denn?"
"Erinnerst du dich an den Jungen Kumar, einen Tagelöhner?"
"Aus welcher Familie?"
"Er war nicht aus unserem Dorf. Er war aus dem Süden gekommen, hatte etwa zwei Jahre bei einer benachbarten Familie gearbeitet. Vor fünf Jahren ist er gestorben."
"Warum erzählst du mir von ihm?“
"Du sollst diese Geschichte für dich behalten, nicht mal deinen Geschwistern etwas davon sagen, es gibt Dinge, die man nicht wiedergutmachen kann."
Der Mond verschwindet hinter dem Horizont. Die Wolken schliessen sich zu einer grauschwarzen Decke zusammen, auch der kleinste Silberstreifen schwindet dahin.
"Celine war dreizehn Jahre alt. Du warst auf den Philippinen... Es war Hochsommer. Vater, Alice und Thankachan lasen die Kaschewnüsse auf. Wir hatten kaum Trinkwasser zu Hause. Ich hätte mit ihr zum Brunnen gehen sollen. Celine war so oft allein zum Brunnen gegangen, dass ich dabei keine Bedenken mehr hatte.“
Mutter wischt sich eine Träne von ihrem Gesicht, sie bedeckt den Kopf und das halbe Gesicht mit dem Zipfel ihres Sari. Wieder ihr unerträgliches Schweigen.
"Hat dieser Kumar Celine vergewaltigt? “
"Nein, nein! Als Celine nicht rechtzeitig vom Brunnen zurückkam, bin ich ihr zusammen mit Alice nachgeeilt. Ich dachte, Celine hätte sich mit ihren Freundinnen getroffen, hätte sich nur deshalb verspätet. Ich sah sie unter einem Baum, versteckt im Dickicht stehend, zitternd. Sie brachte kein einziges Wort heraus. Ihr Hals war rot . Eine Schlange wand sich ihren Weg durch das vertrocknete Laub ins Gebüsch. Ich dachte sofort an einen Schlangenbiss. Alice schickte ich weg, um Vater zu holen. Er trug Celine nach Hause. Mein Sohn, die Schlange, die ich sah, war ungiftig, eine harmlose Kreatur, die aufgeschreckt davongeschlichen war. Es war Kumar. Er hatte Celine in das Dickicht gezerrt, ihr sein dünnes Badetuch fest um den Hals gezogen, bis sie, ohne atmen zu können, zu Boden fiel.“
Mutter behauptet, dass Kumar Celine nicht vergewaltigt habe, dass Celine sich erfolgreich wehren konnte, dass sie in den folgenden Tagen keine Anzeichen von Depression oder Krankheit gezeigt habe.
"Einige Monate später hatte sie einen Alptraum, stand mitten in der Nacht auf, weinte, konnte aber bald beruhigt werden. Wir nahmen sie zu unserem Dorfvikar. Er legte seine Hände auf ihren Kopf, betete für sie und segnete sie. Aber immer wieder hat sie solche Anfälle."
"Mutter, ich will Celine zu einem Arzt bringen, zu einer Ärztin wenn möglich, sie braucht dringend ärztliche Hilfe.“
Mutter Rose sieht mich schweigend an. Da ich seit Jahren meine Familie finanziell unterstütze, da ich ihr ältester Sohn bin, da Vater alles mit mir bespricht, schweigt sie. Wie Priester mit angeschlagenen Menschen umgehen, wie sie mit Gebeten, Handauflegen, Teufelsbeschwörungen hilfesuchende Menschen entmündigen, wie sie die Krankheit oder die Not armer Menschen für ihre Wahnvorstellungen missbrauchen, empört mich zutiefst.
"Sohn, der Priester will uns nur helfen."
"Kein Handauflegen mehr. Hörst du? Keine Teufelsaustreibungen mehr! Wo es keine Priester gibt, gibt es auch keine Teufel!"
Celine hat so lange tief geschlafen, dass wir erst gegen Mittag unsere Reise fortsetzen. Merkwürdigerweise hat sie sich beruhigt, was uns alle sehr entlastet. Dennoch wirkt sie erschöpft, zusätzlich geschwächt durch einen verdorbenen Magen. Wir befinden uns auf einer wenig besiedelten Strecke. Von der Hafenstadt Madras steigt die Strasse bis nach Mysore allmählich auf über tausend Meter. Entlang der Strasse stehen grossartige tropische Bäume, mit leuchtend grünen Blättern, mit knallroten Blüten. Eine grosszügige Sonne strahlt durch das Laub der Banyanbäume, leuchtet über magische Seen, vergoldet die weiten Zuckerrohrfelder. Auf den Feldern stehen Landarbeiter. Männer pflügen Felder, säen Saatgut. Frauen, aber auch Kinder beseitigen Unkraut. Vogelscheuchen tanzen mit dem Wind.
Im Auto unterhält sich Celine mit Mutter Rose, als ob nichts gewesen wäre. Wenn sie eine kurze Pause einlegen will, bittet sie den Fahrer höflich darum. Auch mir gegenüber benimmt sie sich nicht ungewöhnlich, nicht vertraut, aber auch nicht unfreundlich. Noch traut sie sich nicht, mir direkt in die Augen zu sehen, noch spricht sie mich nicht direkt an, aber sie fragt Mutter Rose danach, wann ich nach Hause gekommen bin. Was ich für Mutter Rose mitgebracht habe. Was ich Vater mitgebracht habe. Was ich ihr mitgebracht habe.
Ihr Durchfall verschlimmert sich, und unsere Reise gerät zunehmend ins Stocken. Trotz ihrer misslichen Lage, oder gerade deshalb, will Celine weiterfahren, auf keinen Fall will sie im Hotel Sunrise übernachten, in dem wir am späten Nachmittag zwei Zimmer bezogen haben. Entlang unserer Route, ausser in den grossen Städten Bangalore und Mysore, fehlen saubere Hotels überhaupt, so dass die Weiterreise Celine, aber auch Mutter Rose, willkommen ist. Noch vor Mitternacht setzen wir unsere Reise fort. In der Nacht können wir überall anhalten, es fällt Celine leichter, im Schutz der Dunkelheit die Unannehmlichkeiten, die der Durchfall mit sich bringt, zu ertragen. Auch Chandu will lieber die ganze Nacht hindurch fahren. Nachts fahren fast keine Busse, nachts sind keine Kinder mehr auf den Strassen, keine schaulustigen Menschenmassen.
In den frühen Morgenstunden fahren wir eine Gebirgskette hinunter in die hügelige Landschaft von Malabar. Der Staub bläst uns förmlich ins Gesicht, wieder begegnet uns der Rauch und der Gestank, wieder der unerträgliche Lärm aus den Lautsprecheranlagen, Protestmärsche, Leichenzüge, Strassenschlachten. Aufgebrachte Muslime setzen einen überladenen Heuwagen in Brand. Im Gegenzug zünden fanatische Hindus einen Laster vollbeladen mit Holz an. Ein Mullah ruft zum Gebet. Die Tempelglocken läuten. Ein eifriger Pfarrer lässt seine Predigt mit aufgedrehten Lautsprechern über den Köpfen einer versammelten Masse donnern.
Um Mittag wecken wir Celine aus ihrem tiefen Schlummer, wir tragen sie in unser Haus, sie will sich hinlegen. Mein Vater muss irgendwohin gegangen sein, das Haus steht leer, einzig der Hund wedelt mit dem Schwanz. Mutter will mit Chandu gleich nach Iritty fahren, die genauen Fahrtkosten berechnen, den restlichen Betrag bezahlen. Der Fahrer würde sie anschliessend wieder nach Hause bringen, was ihr das mühsame Warten auf einen Bus in der Mittagshitze ersparen wird. Sie ist die Strecke hin- und zurückgefahren, auch sie ist erschöpft, am Ende ihrer Kräfte.
Dass Celine nicht vergewaltigt wurde, kann ich kaum glauben. Warum sollte Mutter Rose mich belügen? Vielleicht macht sie sich Vorwürfe, dass sie Celine nicht genügend beschützt hatte? Vielleicht fürchtet sie um die Zukunft von Celine? Vielleicht hat sie alles zu lange verheimlicht, dass sie jetzt nicht mehr darüber sprechen kann? Warum vertraut sie so sehr diesem verdammten Priester? Wird Celine je wieder gesund? Wird sie jemals so sein, wie sie einmal war? Welche Zukunft hat sie vor sich?
So neugierig war sie als Kind, aber auch so scheu und distanziert, jedes Mal, wenn ich nach Hause zurückgekehrt war. Es hatte Tage und Wochen gedauert, bis sie offen zu mir sprach, bis sie mich ab und zu berührte, bis sie sich auch danach sehnte, mit mir zu spielen, mit mir an den Fluss zu gehen, getragen zu werden oder in der Nacht unter einer gemeinsamen Decke zu schlafen. So allmählich und zögernd die Annährungen waren, so schmerzhaft und unerträglich waren unsere Abschiede. Jedesmal versteckte sie meinen Reisekoffer, innig bat sie mich, nie wieder wegzugehen, jedesmal brach sie in Tränen aus, wenn der unausweichliche Zeitpunkt gekommen war. Dann weinte sie untröstlich, ihr Gesicht wurde rot, ihre Augen waren geschwollen. Niemand konnte sie trösten. Und auch jetzt, wenn ich mich nach einem Zeichen unserer Verbundenheit sehne, fürchte ich ebenso sehr diesen Augenblick der Trennung. Vielleicht sollte ich Celine so bald wie möglich verlassen, bevor sie sich an mich gewöhnt, bevor sie sich an mich wendet, bevor sie mir ihre kindliche Hand entgegenstreckt.
Der Hund jault. Der Wind pfeift durch dichte Bambuskolonien. Rroter Staub fegt über die Kaschewbäume, verwandelt das Sattgrün des Laubs in dreckiges Braun. Abermillionen von feinen Knospen, die verwelkten Blüten der Kaschewbäume, regnen vom Himmel herunter. Aus meinem Schlummer erwacht, höre ich Celine wimmern. Sie hat sich hinten im Feld verirrt, steht in den Dornen eines Strauches gefangen. Ihr Nachthemd ist zerrissen, ihr Haar zersaust, ihre Augen sind blosse Schatten. Blut fliesst ihr die Beine hinunter. Sie flattert mit den Armen, stösst mit den Beinen, sie schreit und flucht und tobt. Ich zerre sie aus dem Dickicht, sie wehrt sich mit Händen und Füssen, sie kratzt, sie beisst, wir ringen miteinander. Der Wind verstümmelt ihre Hilferufe. Ich bringe sie zum Hof, ich zwinge sie vor das Haus, sie widersetzt sich all meinen Bewegungen. Ich hole Wasser, ich reisse ein dünnes Badetuch von der Wäscheleine, versuche, sie von ihrem Schmutz zu befreien. Der Hund kreist um uns herum. Ich versuche, auf sie einzureden, sie zu beruhigen, ich flehe sie an, stillzustehen. Irgendwann sinkt ihr Körper zu Boden. Lange liegt sie still, ihr Körper bleich, tief atmend. Irgendwann öffnet sie die Augen, ruft meinen Namen. Ihre Stimme ist schwach, der Wind übertönt alles, trägt alles fort. Aber alles kann er nicht verwehen.

Ich wünschte, Vater wäre tot. Sehr oft im Leben, besonders in der Kindheit hatte ich diesen Wunsch, leise ausgesprochen oder nur erdacht, damals aus Verbitterung, aus Schmerz, aus Ohnmacht, damals, weil ich die Qualen nicht ertragen konnte, die er meinen Geschwistern oder meiner Mutter oder mir selbst zufügte, psychisch mit seiner ätzenden Zunge, mit seinen Erniedrigungen, mit seinen Beschimpfungen, physisch mit der Schärfe seiner Nägel, mit der Kraft seiner rauen Bauernhände, mit der Blutrünstigkeit seiner Rattanstöcke. Ich wünschte, Vater wäre tot.
Vierzig Jahre sind vergangen, seitdem ich die Schreie meiner Mutter zum ersten Mal wahrgenommen habe. Mehr als vierzig Jahre hat die Kleine Rose an seiner Seite verbracht, alle seine Launen ertragen, seine unzähligen Schläge, seine abgrundtiefe Verachtung. Vater beschimpft Mutter, spricht aufgeregt vor sich hin. Sie steht in seinem Schatten, sie hört und hört nicht hin, sie nickt uns beruhigend zu. Mutter Rose, mein Bruder Thankachan und ich verharren in unserem Schweigen. Vater kann seine Verbitterung nicht verbergen, er lässt seinen Frustrationen freien Lauf, alles, was wir tun, ist ihm nicht recht. Wer hat ihn damals dazu verführt, die fruchtbaren Reisfelder aufzugeben, wenn nicht Mutter Rose? Wer hat ihn dazu verleitet, Bananen anzupflanzen, wenn nicht Mutter Rose? Wer hat sein Leben zur Hölle gemacht, wenn nicht Mutter Rose? Er klagt Mutter an, er klagt meinen Bruder an, auch mich klagt er an. Fieberhaft reisst er die letzten Bananenstämme aus der noch feuchten Erde. Sie liegen zerstreut über dem Feld, gefallene Soldaten, mit rotbraunem Schlamm bedeckt, ihre breiten Arme von der Sonne verwelkt.
Die verwilderten Reisfelder hatte Vater vor Jahren in Beete aufgeteilt, das Wasser aus dem Bach in winzige Kanäle umgeleitet, auf dem trockengelegten Boden Bananenbäume gepflanzt. Zu jener Zeit war Reis, unser Hauptnahrungsmittel, relativ billig, Bananen dagegen brachten Geld ein. Aber die Zeiten haben sich geändert. Sogar die Affen spucken auf Bananen. Dass der Preis für Bananen je wieder steigen wird, glaubt er nicht mehr. Und auch wenn dies geschehen sollte, müsste er vieles noch einkaufen. Reis, Gemüse, Früchte. Fast alles. Vater will wieder Reis anbauen, er muss wieder Reis anbauen, wie zu Grossvater Ashans Zeiten.
Die alten Reisfelder wieder herzurichten, ist keine leichte Arbeit. Die Baumstämme müssen weggetragen werden, die Erde muss aufgelockert werden, Wurzeln und Steine müssen entfernt werden. Aus den vielen Beeten sollen auf drei Ebenen spiegelglatte Felder entstehen, die Erdklumpen mit Wasser vermischt, butterweich zermalmt. Landwirtschaftliche Geräte gibt es nirgends, die schwere Arbeit muss mit primitivsten Instrumenten erledigt werden. Mit Händen und Füssen. Er hat die Bananenbäume eigenhändig gefällt, die Stämme in kleinere Stücke zerlegt, er trägt die ersten Blöcke beiseite. Die Knollen der Bäume wiegen schwer, sind von unzähligen Wurzeln umgeben, Köpfe ohne Gesichter, ohne Augen.
Vater hebt die Hand gegen Mutter, beisst die Zähne zusammen, senkt seine geballte Faust. Er droht uns, aber er prügelt uns nicht mehr. Umso häufiger beschimpft er Mutter Rose, er quält uns mit seinen Worten, mit seinen Blicken. Mit seinem tödlichen Schweigen. Jetzt, wenn ich nicht lauthals schreien kann, wenn mich seine hasserfüllten Augen vernichten, erinnere ich mich an all die Pein, alle seine Schlagstöcke, seine Brutalität. Einst schnitten seine spitzigen Fingernägel tiefe Wunden in meine Haut. Er fasste mich, aber auch meine Geschwister, mit seinen Krallen am Schenkel, er liess uns vor Schmerz tanzen, er liess uns schreien, bis unsere Stimmen erstickten, bis meine Grossmutter oder Mutter Rose sich zwischen uns und ihn warf, bis seine Glut ausgebrannt war. Er prügelte uns täglich, schlug uns fast zu Tode, er folterte uns für die kleinste Unterlassung. Wenn wir von der Schule spät nach Hause kamen. Wenn wir zu lang am Flussufer spielten. Wenn wir bloss laut lachten.
"Mutter, erinnerst du dich, wie Vater mich damals geschlagen hat, nur weil ich meinen Bleistift verloren hatte?"
Die kleine Rose, mein Bruder und ich trampeln im Schlamm. Eine Wolke verdunkelt das Gesicht meiner Mutter.
"Erinnerst du dich, wie Vater mich auf dem Hof unserer Hütte zwang, niederzuknien und auf mich losschlug? Wie seine Rattanstöcke, einer nach dem anderen auf meinem Rücken zerbrachen? Erinnerst du dich?"
Meine Mutter schweigt. Ich hebe mein Hemd hoch, zeige ihr die Narben auf meinem Rücken. Nach mehr als dreissig Jahren sind sie noch da, unvergängliche Spuren meiner Kindheit. Lebenslinien.
Mein Bruder hebt seine Dhoti hoch, zeigt ebenfalls seine Narben.
"Auf meinem Rücken habt ihr keine Narben gesehen."
Der grosse Triumph meiner kleinen Mutter!
"Er hat mich meist mit seiner geballten Faust geschlagen. Erinnerst du dich daran, wie du einst gelobt hattest, Vater umzubringen?"
Mutter fragt mich lächelnd.
"Du warst aus dem Internat zurückgekehrt. Es war bevor du zu diesem Künstler gegangen bist. Erinnerst du dich jetzt?"
Mutter steht knietief in schlammiger Erde, steht einen Moment still, reisst Wurzeln heraus.
"Er hat mich so oft geschlagen. Für dies und jenes. Für nichts! Ich kann mich nicht mehr...."
Sie erinnert sich nicht warum. Vielleicht will sie sich nicht mehr daran erinnern.
Vater hatte Mutter mit Füssen traktiert, sie in den Unterleib getreten, sie lag auf dem Küchenboden. Sie hatte kaum schreien können, kauerte auf dem Boden, weinte leise. Vater stand über ihr mit gespreizten Beinen, beschimpfte sie, befahl ihr zu schweigen, drohte ihr mit weiteren Schlägen. Meine Geschwister waren um mich versammelt, die kleine Celine zitterte. Molly zog mich am Arm.
"Bruder, tu etwas, halt Vater an!"
Ich hatte es ihr damals versprochen. Ich hatte mich zwischen Vater und Mutter gestellt, er hatte auf mich losgeschlagen, sich von Mutter abgewendet.
"Ja, ich erinnere mich daran. Damals hatte ich es Molly versprochen. Auch dir, Mutter."
Vater steht eine Weile still, blickt hinauf zu den Kautschukbäumen. Sie stehen am Berghang, in Reihen gegliedert, ein Joch, das er nicht ablegen kann. Die Bananenbeete kann er wieder zu Reisfeldern umgestalten, die Kautschukbäume aber kann er nicht mehr herausreissen. Ihre Wurzeln sind kräftig, sie haben den Boden tief durchbohrt, ihn für Jahre nutzlos gemacht. Als kleiner Mann, der kaum lesen und schreiben konnte, hatte er so gehandelt wie seine Nachbarn, wie alle anderen. Flache und leicht bewässerbare Flächen hatte er zu Bananenplantagen umgestaltet, steile und trockenere Landflächen mit Kautschukbäumen bestellt.
Alle Regierungen der letzten Jahre, hatten die Menschen irregeführt, den Anbau von exportfähigen Produkten subventioniert, die Selbstversorgung vernachlässigt. Vaters Verbitterung kennt keine Grenzen. Laut flucht er auf die Kapitalisten. Noch lauter flucht er auf die Kommunisten. In einem Vierteljahrhundert ist der ganze Bundesstaat Kerala, einst selbstversorgend, von Kautschuk- und Bananenplantagen überwuchert. Verrauchter Kautschuk füllt die Lagerhallen, die Bananen verfaulen in den Häfen. Die Monokulturen haben nichts als Elend gebracht. Reis, Oel und Zucker sind rationiert, der Preis für Gemüse klettert unaufhaltsam in die Höhe. Wer kein Familienmitglied im Ausland hat und regelmässig Geldzahlungen erhält, verarmt allmählich, hungert im stillen.
Es schmerzt mich, Vater, aber auch die kleine Rose und meinen Bruder so arbeiten zu sehen. Ich habe mein Studium an einer Filmhochschule in Deutschland beinahe beendet, mein Stipendium ist aufgebraucht, aber ein wenig Geld habe ich Vater mitgebracht.
"Vater, wieso heuerst du keine Tagelöhner an? Du bist nicht mehr der Jüngste.“
"Fünfundsechzig Jahre habe ich gelebt, entweder auf den Bäumen oder im Schlamm. Wäre ich doch noch etwas jünger! Ich finde keine Arbeitskräfte mehr. Alle sind Sklaven von diesen verdammten Kautschukbäumen geworden. Die Arbeit in den Plantagen hat den Tagelöhnern den Kopf verdreht. Die klebrige Milch von den Bäumen herauszuschneiden braucht etwas Geschicklichkeit, dafür aber ist die Arbeit besser bezahlt und bis zum Mittag beendet. Für einen ganzen Tag Arbeit zu einem vernünftigen Lohn finde ich keinen einzigen Hund mehr. Mit drei oder vier Hektar haben wir zu wenig Boden zum Leben und zu viel zum Sterben. Wäre der Mensch bloss Affe geblieben!“
Es ist nicht erstaunlich, dass Vater so von den Affen spricht. Noch vor einem halben Jahrhundert lebte er auf Bäumen. Damals nannte man ihn ‘den kleinen Affen’. Liebevoll und mit einem Hauch von Bewunderung. Stets lobte meine grosse Mutter ihren jüngeren Sohn über den Klee.
"Keiner kletterte so hoch wie dein Vater. Er konnte bereits mit vier Jahren auf hohe Bäume klettern, eine Kunst, die im Land der Palmen von vielen beherrscht wurde. Von Männern. Aber Kinder, die so sicher klettern konnten wie dein Vater, waren äusserst selten. Er konnte noch auf Areccapalmen klettern."
Anders als die Kokospalme hat der Stamm der Areccapalme einen viel kleineren Umfang, die fast dreissig Meter hohen Bäume biegen sich stark unter dem Gewicht. Gewöhnlich liess man die Nüsse jener Palmen mit Hilfe dressierter Affen pflücken.
Der Knabe hatte es den Affen genau nachgemacht. So kletterte er eine Areccapalme hoch, riss die orangefarbenen Nüsse herunter, packte einen der wippenden Äste eines nahestehenden Baums, schwang sich von einer Baumkrone zur nächsten, sammelte Nüsse, warf sie zu seiner Mutter hinunter, zog weiter, sich von einer Baumkrone zur anderen schwingend, die Ernte eines ganzen Palmengartens einsammelnd, ohne dazwischen die Erde ein einziges Mal zu berühren. Er erledigte seine Arbeit spielend, stets eine Melodie pfeifend oder ein frohes Lied singend. Während der mutige Knabe zwischen Himmel und Erde schwebte, sass meine Grosse Mutter zu Füssen der Palme, folgte seinen Bewegungen, rief ihm zu, warnte ihn vor Fehleinschätzungen. Vor waghalsigen Sprüngen.
„Dein Grossvater schickte mich zur Schule. Aber nur bis zur dritten Klasse. Ich konnte mit Mühe lesen und schreiben. Dann hat er uns im Stich gelassen, deine Grossmutter und mich. Ich musste bereits mit fünf auf Palmen klettern. Wie sonst konnten wir überleben?“
Es quält ihn, die Bananenstämme mit den Knollen wegzutragen, die einst mühsam angelegten Beete wieder einzuebnen, lieber flüchtet er sich in seine Erinnerungen.
"Mit dem Klettern verdiente ich einen Viertel 'Chakram' pro Tag. Erinnerst du dich an die alte Kupfermünze mit dem runden Loch in der Mitte?"
Vater sieht mich fragend an. Wenn er seine Geschichte mir nicht anvertrauen kann, wem dann?
"Seit der Unabhängigkeit von den Briten gibt es sie nicht mehr.Aber die Arecca-Ernte dauerte nur wenige Tage im Jahr. So kletterte ich auch auf Kokospalmen, auf Mangobäume, auch auf Kaschewbäume. Auf die Stirn des Teufels."
Er setzt sich am Rande des Feldes hin und trinkt einen Schluck Reiswasser.
"Ich hab' Hunger, hast du es gehört?"
Vater wendet sich an die kleine Rose. Er nimmt einen alten Kupferkrug, trommelt darauf, singt ein altes Lied, seine Stimme noch so kräftig, wie vor Jahren:
Ein elender Wurm in einem Nest aus dornigen Sträuchern, ein wankender Grabstein über dem ruhenden Kopf. Dazwischen, auf den Schultern, die Last des Lebens. Was ist der Mensch? Was wohl? Ein Opferlamm auf dem Altar eines blutrünstigen Gottes. Ein zusammenzuckender Leib, der langsam verendet. Nichts mehr. Nichts weniger!
Mutter steigt aus knietiefem Schlamm hinaus, wäscht sich an einem kleinen Wasserfall am oberen Rand des Feldes die Hände. Auch wir steigen aus dem Schlamm hinaus, setzen uns im Schatten eines Mangobaums nieder. Wenn wir auf dem Feld arbeiten, essen wir im Schatten der Bäume, essen von Bananenblättern. Das Haus meines Bruders befindet sich in Sichtweite, aber Vater weigert sich, es zu betreten, dort auch nur ein Glas Wasser zu sich zu nehmen.
Mutter Rose bringt uns gekochtes Tappiocca und gegrillte Sardinen.
"Meinen Vater, Ashan, kümmerte es wenig, ob ich auf eine Areccapalme kletterte oder auf eine Kokospalme, ob ich etwas zu essen bekam oder hungerte. An dem Tag, als Indien unabhängig wurde und junge Männer in meinem Alter auf den Strassen tanzten, sass ich auf den Bäumen."
"Vater, du hättest dort auch bleiben können, hoch auf den Bäumen! Dann hätten wir alle deine Launen nicht ertragen müssen."
Die Worte meines jüngeren Bruders Thankachan sind Salz auf Vaters Haut.
"Heute ebnen wir den Boden, legen Reisfelder an. Morgen häufen wir die Erde in Beete, pflanzen Bananen. Übermorgen willst du wieder deine Reisfelder."
"Hüte deine Zunge!"
Vater brüllt zurück.
"Du brauchst mich nicht zu belehren. Mit meinem Boden mache ich, was ich will. Mach du mit deinem Boden, was du willst. Begrabe deine Frau darin. Begrabe deine Schwiegermutter darin. Begrabe dein Glied darin!"
Mein Bruder sieht mich verletzt an, wendet sich wieder Vater zu.
"Mit meinem Boden! Wenn es mein Boden wäre, hätte ich die Bananenbäume stehenlassen, zur Abwechslung Ingwer angepflanzt oder Gemüse. Aber alles, was du kannst, ist mich beleidigen. Meine Frau begraben. Meine Schwiegermutter begraben. Du willst bloss mich begraben!"
Vater nimmt eine gegrillte Sardine aus seinem Bananenblatt und gibt sie mir, legt sie in die Mitte meines Blattes. Dann isst er in aller Stille weiter. Er will nicht auf das Klagelied seines zweiten Sohnes eingehen, lächelt zynisch, nickt hin und wieder, lässt ihn vor sich hinreden. Er hört sich alle seine Vorwürfe an, Anschuldigungen, die er lange kennt, die der vernachlässigte Sohn alle Jahre wieder vorträgt, ohne dass er sie je ernstnimmt. Wenn ihn das Klagelied seines Sohnes nervt, macht er Mutter Vorwürfe.
"Zu viel Salz drin. Zu wenig Salz drin. Nur Salz drin!"
Dass Vater mir eine gegrillte Sardine gibt, dass er sein Essen nur mit mir teilt, ist keine unbedeutende Geste. Den Fisch gebe ich meinem Bruder weiter, er will ihn aber nicht berühren, lieber würde er hungern.
"Vater, iss du nur. Ich brauche ihn nicht."
Ich lege den salzigen, halbverbrannten Fisch auf das Bananenblatt vor Vater. Aber er rührt ihn nicht an. Er steht auf, raucht seine aus Blättern und Tabak gedrehte Beedie, nimmt seine Arbeit wieder auf.
"Als wir Kinder waren, assen wir in der kleinen Küche unserer Hütte. Erinnerst du dich daran?“
Mein Bruder sieht mich neugierig an. Er sieht Vater ähnlich, nur etwas jünger und schwächer, seine Rippen ragen aus seiner dunklen Haut heraus. Er hat stets an Vaters Seite gearbeitet. Seit seiner Hochzeit lebt er mit seiner Frau und seinen Kindern auf dem einstigen Boden Ashans. Vater hat ihm dieses Grundstück zugewiesen, ohne ihm allerdings den Boden rechtmässig zu übertragen. Mein Bruder hofft, dass Vater ihm dieses Erbstück überlassen wird. Er hat früh die Schule verlassen, besitzt nichts ausser einer winzigen Hütte, er ist auf den Boden angewiesen. Aber Vater zögert, ihm den Boden zu überlassen, Vater will ihm noch nichts abtreten, er will ihn solange warten und zweifeln lassen, bis der Stolz seines Sohnes gebrochen ist. Er hofft. Zweifelt. Wartet.
"Was habe ich bloss getan, dass er mich so behandelt?"
Als wir Kinder waren, hat er jedem aus seinem Teller etwas gegeben. Oft gab er uns Tappiocca. Manchmal etwas Reis. Eine Sardine. Mutter gab ihm stets das beste. Auch am meisten. Denn er arbeitete tagtäglich auf den Feldern. Aber uns Kindern gab er immer etwas, er liess uns immer etwas übrig, auch wenn er selbst noch Hunger hatte. Damals hat er uns alle gleich behandelt, er gab jedem etwas von seinem Teller, auch Mutter Rose.
"Aber jetzt spielt er dich gegen mich aus!"
"Du bist nicht ganz unschuldig!“
Mutter Rose beendet sein Selbstmitleid.
"Vater hat die Bananenbäume gepflanzt, aber geerntet hast du. Ich weiss, du hast Kinder. Aber du hättest uns fragen können. Dein Vater hat bereits einen Fuss im Grab und muss sich immer noch um alles kümmern. Hast du dich je um Vater gekümmert? Um mich? Wo warst du, als Celine krank wurde? Wo warst du?"
Mutter zählt seine grossen und kleinen Unterlassungssünden auf, sie kann nicht mehr zwischen ihrem Mann und ihrem Sohn vermitteln. Mutter Rose steht resigniert auf.
"Sie sind nicht zu versöhnen. Sie ähneln sich zu sehr. Stur sind sie beide. Stur!“
Ich betrachte Vater, wie er sich zu Tode schuftet, sein Körper in Schweiss gebadet, seine Haut im Licht der Sonne glänzend. Verbittert gräbt er die Erde um, ohne auch nur einmal zu lächeln. Ohne Hoffnung. Wie sehr hat er sich verändert! In meiner Kindheit arbeitete er Tag für Tag auf den Feldern. Mutter Rose brachte ihm Reiswasser, wenn er sie darum bat, mein Bruder oder ich brachten ihm brennende Holzstücke, wenn er seine Beedie anzünden wollte. Eifrig steckten wir Kinder vertrocknetes Unkraut in Brand, fröhlich spielten wir im Fluss zusammen. Am Abend sassen wir dann in einem Kreis, Vater nahm einen kleinen Kupferkrug, klopfte auf die runde Öffnung mit einer Hand, schnippte mit seinen harten Fingernägeln auf die Kante, sang für uns seine wunderbaren Lieder. Damals wartete er auf uns nach der Schule, begleitete uns nach Hause, schützte uns mit einem breiten Bananenblatt, das er über unsere Köpfe hielt, während er selbst im Regen stand.
Vater, Mutter und ich waten durch den Fluss, wir gehen nach Hause zurück. Der Fluss ist fast ausgetrocknet, das Wasser trübe, kein einziger Fisch kann darin leben. Am linken Ufer, wo einst das Gras wuchs, wo der Wald seine seltenen Blüten preisgab, stehen nutzlose Kautschukbäume. Sie stehen stramm, das Laub mit aschefarbigen Pestiziden bespritzt, die hochgewachsenen Stämme weiss bemalt, Geister, die man einst rief und nicht mehr vertreiben kann. Am rechten Ufer, auf der geteerten Strasse, fahren unzählige Lastwagen und Autos. Die Laster transportieren Holz von den Wäldern zu den Häfen. Sehr oft in meiner Kindheit bin ich in Begleitung meiner Grossmutter diesen Weg nach Koottu Puscha gegangen. Die Strasse ist nun etwas breiter, auf den hohen Bäumen weilen keine Affen mehr. Die Bäume haben ihr Laub verloren. Sie stehen nackt am Strassenrand, ihre Stämme vertrocknet, die Äste kraftlos.
"Nicht ein einziger Affe! Gibt es überhaupt noch Tiere in diesem Wald?“
Ich kann es kaum glauben, dass der Wald so still ist, dass alles Leben aus ihm entschwunden ist.
"Was für eine Frage! Du bist mehr als fünfundzwanzig Jahre weg gewesen. Darum fragst du nach den Affen. Heute gibt es im Wald so viele Wächter wie damals Affen. Aber sie beschützen den Wald kaum, gehen Hand in Hand mit den Holzfällern. Mit Politikern. Mit Teufeln.“
Voller Trauer blickt er in den Wald, lichterfüllt, die Bäume nackt , mit dürren Ästen. Noch vor dreissig Jahren war der Wald undurchdringlich, die Baumkronen dicht, sattgrün. Die Stämme kräftig, von seltsamen Pflanzen umschlungen, von duftenden Blüten umgeben. Vögel zogen über die Bäume, sie liessen sich auf fruchtbeladenen Zweigen nieder. Wilde Tiere wanderten im Dickicht, weideten in den Lichtungen, sie ruhten sich in den dunklen Schatten aus.
"Tiefer im Wald, nahe der wilden Bäche, gab es Hirsche. Du warst noch sehr klein. Wir hatten selten Fleisch im Dorf. Manu und ich sind oft dorthin auf die Jagd gegangen. Früher lebten hier nur wenige Familien, allesamt aus Travencore kommend, Einwanderer am Ende der Welt, ohne Schulen, Strassen, Brücken, den Hungermonaten des Sommers ausgeliefert, den Hungermonaten des Monsuns ausgeliefert, den Hungermonaten aller Zeiten ausgeliefert. Um einmal ein wenig Fleisch zu essen, musste ich in den Wald. Auch damals gab es einige Dutzend Wächter im Wald, sie hatten Gewehre bei sich, besonders in der Nacht zögerten sie nicht, auf Eindringlinge zu schiessen. Erinnerst du dich an Manu, den Eisenschmied? Er hatte ein selbstgebasteltes Gewehr, Pulver und Blei, das er bei sich versteckt hielt. Manu kam einmal im Monat, wenn alle eingeschlafen waren, stand am unteren Rand der Reisfelder, pfiff seine Melodie, ich folgte ihm in den Wald, einem Bach hinauf. Wenn wir einen Hirsch erschossen hatten, zogen wir ihn schleunigst zum Fluss hinunter. Weisst du, wie schwer so ein Hirsch sein kann? Wie konnten wir zwei so einen Hirsch mitten durch den Wildwuchs tragen, mitten durch all die dornigen Sträucher? Manu trug sein Gewehr auf der Schulter, lief im schwachen Licht der Sterne entlang des Ufers, seelenruhig, still."
Wieder steht Vater still, er blickt ehrfurchtsvoll in den Wald, seine Augen schweifen den Fluss entlang.
"Ab und zu pfiff er einen Ton, gab sich zu erkennen, wartete meinen Ton ab, lief weiter. Ich hielt den Hirsch umklammert, liess mich mit dem toten Tier den Fluss hinuntertreiben, begab mich in die Strömungen. Ich steuerte fernab von Felsen, wirbelte und überschlug mich im pechschwarzen Wasser, stürzte hinab in die wilden Schlüchte. Es kam auch vor, dass ich ein Tier verlor, dass wir bis in die Morgenstunden an den Ufern nach ihm suchten, nach all den Anstrengungen mit leeren Händen nach Hause kamen. Aber meist waren wir erfolgreich, es gab Fleisch für einen ganzen Monat. Wir gingen in den Wald, jedesmal, wenn der Hunger uns dazu zwang oder wenn wir Brennholz sammelten oder Bambus brauchten. Wenn die Not uns dazu trieb."
In den nächsten Tagen tragen wir Steine und Felsbrocken zusammen, errichten Trennwände, die Umrisse dreier Reisfelder. Vater steht im untersten Feld, drückt ein breites Brett schräg in die gelockerte Erde hinein, mein Bruder und ich ziehen das Brett mit dem Haufen Erde bis hin zur Trennwand. Die rauhen Seile, mit denen wir das hölzerne Brett herunterziehen, schneiden tief in unsere Hände. Anstelle von Ochsen ziehen mein Bruder und ich die schwere Last, unsere Körper gebückt, unsere Beine wankend. Uns fehlt die Kraft, aber Vater treibt uns an, er drückt auf das Brett wie auf einen Pflug, er treibt uns zur Verzweiflung. Seine Befehle peitschen über unsere Köpfe. Seine Worte schneiden sich tief in unsere Haut, knallen über das Reisfeld.
"Nach links! Nach rechts! Nach links! Zieht doch, ihr verdammten Ochsen!"
Vater leitet Wasser aus dem Bach ins unterste Feld, bis die rechteckige Parzelle durchtränkt ist, der Durst der Erde gestillt. Mutter Rose zerrt er auf das unterste Feld, sie soll nicht herumsitzen, sie soll dort weitermachen. Mutter Rose steckt knietief im Schlamm, trampelt die Erde mit ihren nackten Füssen, tanzt unter der Glut der Sonne, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.
„Wenn doch die Erde mich verschlingen würde, wie einst Sita![1]"
Mutter flüstert mir zu.
Sie sammelt Kieselsteine, Baumwurzeln, Glassplitter. Alles was im Schlamm nicht verfaulen kann.
"Nach rechts! Nach links! Du dumme Kuh!"
An einem Ende des länglichen Sees fliesst das Wasser über runde glitschige Steine, bildet eine wellige Strähne, mündet in einen zweiten See. Das Wasser fliesst gemächlich von einem leicht höher gelegenen See in den nächsten hinunter mit welligen Strömungen zwischen den Seen. Silbrige Wolken gleiten im scheinbar stillen Wasser, auch der blaue Himmel, nur entlang des Ufers streiten sich Menschen und Wolken um einen Platz. Männer baden im oberen See, Frauen im unteren See, ihre Brüste halb verborgen hinter welligem Haar. Mutter Rose steht im unteren See am Ufer, hinter hochgewachsenen Sträuchern, erledigt ihre und Vaters Wäsche, schlägt die nassen Kleidungsstücke auf einen flachen Stein. Ihre Schläge hallen von den nahen Bergen wider.
"Du hättest deine Wäsche Mutter geben sollen."
Vater steht vor mir, auf mich wartend, während ich meine Kleidungsstücke im Fluss wasche.
"Mutter schuftet genug. Findest du nicht? Du hättest deine eigene Wäsche erledigen können."
Ich blicke hinauf zu Vater. Er missbilligt meinen Vorschlag, zieht an seiner widerlichen 'Beedie', raucht, blickt weg, stösst einen runden Stein mit seiner Fussspitze weg.
"Komm endlich!"
Er befiehlt, seine Ungeduld kann er nicht verbergen, auch seine Verlegenheit nicht.
"Du könntest zur Abwechslung einmal die Kleider von Mutter waschen?"
"Ein guter Witz.“
Vater lächelt. Er wirft den Rest seiner Beedie ins Wasser.
"Ich bin nicht fertig. Ausserdem will ich auf Mutter warten. Geh du nur voraus, Vater."
Er nimmt sein dünnes Badetuch von einem Strauch, macht einige Schritte, bleibt stehen.
"Du hast recht. Ich sollte die Kleider meiner Frau waschen. Aber so etwas macht niemand hier im Dorf. Niemand, den ich kenne, seit Menschengedenken. Alle werden mich auslachen."
"Lass sie doch!"
"Du hast gut reden. In einem Monat gehst du wieder weg. Ich mache weiter, wie ich es gelernt habe."
Vater setzt sich auf einen Fels. In Gedanken versunken starrt er auf das Spiegelbild einer dunklen Wolke im See, auf ihre silbernen Umrisse, auf die kräftigen Strahlen am Wolkenrand. "Ich habe deiner Mutter viel Unrecht getan. Ich habe sie so oft geschlagen. Ich wünschte, ich könnte sie um Vergebung bitten. Aber ich kann nicht." Ich sehe ihn an. Er wirkt klein und zerbrechlich. Geschlagen.
„Denk von mir, was du willst. Aber ich kann nicht die Füsse meiner Frau berühren."
"Warum nicht, warum kannst du dich nicht bei Rose entschuldigen? Warum nicht Vater?"
Er schweigt. Er muss mir keine Antwort geben. Seine Antwort kenne ich bereits. Ashan, mein Grossvater ist tot. Auch Grossmutter Aeli ist tot. Er ist nun das Familienoberhaupt. Er bricht das ungesäuerte Brot am Pessach. Er sorgt für uns. Er ist unser Herrscher. Der sichtbare Gott, der uns ernährt.
Noch bevor die Sonne über den fernen Hügeln aufsteigt, steht Vater auf einer wackligen Bambusstange, den linken Fuss auf einem abgehackten Ast, den rechten auf dem nächsthöheren Ast, er liest die Pfefferernte auf. Die Pfefferpflanze klettert bis zu zehn Meter in die Höhe, Hunderte von roten Pfefferkörnern reifen auf einem fingerlangen Stiel. Mit einer Hand hält Vater die Bambusstange fest, mit der anderen liest er die Ernte auf. Er sammelt die Körner samt deren Stiel, trennt ihn von der Pflanze mit seinem Daumen, legt sie einzeln in ein gefaltetes Tuch, das er auf dem Rücken trägt. Die lange Bambusstange ist bloss an den dünnen Baum angelehnt, mit jedem Windstoss schwingen der Baum und die Stange von Seite zu Seite.
"Vater! Bist du etwa verrückt?"
Vater kann sich auf dem dünnen Bambus schlecht umdrehen. Er fühlt sich so sicher wie in seiner Jugend.
"Wenn ich die Körner nicht einsammle, wer dann? Mach dir keine Sorgen. Ich stürze nicht hinunter."
Die Pfefferpflanze teilt sich in mehrere Stränge, sie wächst auf dornigen Bäumen, die sie umschlingt, auf Tausenden von kleinen Strängen reifen die grünen Körner, bis sie blutrot sind. Wenn Vater sie nicht binnen Tagen aufliest, fressen die Vögel alles, der Rest fällt zu Boden. Die einzelnen Körner sind viel kleiner als Erbsen, kein Mensch kann sie je wieder einsammeln.
"Aber Vater, ein Windstoss und du fällst..."
"Ach was!"
Er unterbricht meine besorgten Mahnungen.
"Und wenn ich mir das Genick breche, bist du doch noch da! Du kümmerst dich um Mutter. Um deine Geschwister. Ich vertraue dir!"
Nach einem Monat ist ein einziges Reisfeld ganz fertig, auf allen vier Seiten mit Erdwänden befestigt, die Erde mit Grasspitzen bewachsen. Gelbbraunes Wasser bedeckt das Feld, der butterweiche Schlamm liegt fingertief unter der Oberfläche. Mutter Rose, mein Bruder und ich stehen im zweiten Reisfeld, terrassenförmig an leicht erhöhter Lage angelegt, wir trampeln im Morast. Immer wieder bücken wir uns tief, tragen Steine, Wurzeln und Splitter aus dem Feld hinaus. Unsere Rücken sind wie gebrochen. Unsere Füsse sind wund gelaufen, mit zerrissenen Stofffetzen umwickelt, unermüdlich stampfen wir links, stampfen wir rechts, schleppen die schwergewordenen Füsse weiter.
Vater hat sich in den Kopf gesetzt, das oberste Reisfeld gleich gross wie die zwei anderen zu gestalten, die Umrisse der alten Reisfelder Ashans zu erweitern, eine leicht erhöhte Stelle einzuebnen und hinzuzufügen. Vaters Ansinnen, den natürlichen Verlauf des Bodens streng geometrischen Formen zu unterwerfen, erweist sich als blanker Unsinn. Er gerät an einen Felsbrocken, einen in Stein erstarrten Fluch seiner Untertanen, an einen Granit gewordenen Teufel. Mutter Rose rät ihm, den Stein stehenzulassen, aber ein Gestein mitten im Reisfeld kann sich Vater nicht vorstellen. Stur greift er den Felsen an, spaltet kleinere Brocken ab, er hämmert und meisselt. Er verdammt meinen Bruder, verdammt mich. Er flucht auf Mutter Rose. Auf Ashan. Auf das Leben. Er flucht auf seinen blinden, grausamen Gott.
Tief in der Nacht höre ich Mutter Rose weinen. Vater hat eine Kerosinlampe angezündet, Wasser erhitzt, mit einem dampfenden Tuch fährt er über ihren gebeugten Rücken, massiert sie sanft. Ich erinnere mich an vergangene Zeiten. An Vater. An Vater, der uns vorsichtig aus der Hütte trug, wenn sich nachts eine Schlange eingeschlichen hatte. An Vater, der mit uns sein halbgekochtes Ei teilte. An Vater, der meinen Bruder und mich mit einem breiten Bananenblatt vor dem Regen schützte. Im warmen Licht der Lampe sehe ich sein gütiges Gesicht, die Schatten unter seinen Augen, die kleinen Falten. Alles steht ihm ins Gesicht geschrieben, die Entbehrungen seiner Kindheit, die Erniedrigungen seiner Jugend, seine vielen Enttäuschungen.
"Schlaf weiter, Sohn.“
Er flüstert mir zu.
Ich betrachte ihn, sein Körper gebückt über Mutter, ich sehe, wie seine Hände sie sanft berühren, dort, wo vor Jahren seine Faust eingeschlagen hatte, ich sehe ihn, wie er ihr Haar streichelt, Haar an dem er vor Jahren fest zog, um Mutter Rose auf die Knie zu zwingen, ich sehe die unermessliche Trauer in seinen Augen, einst vor Glut berstend.
"Vater, gib Thankachan diesen Flecken Boden."
Er nimmt ein dünnes Tuch, knotet beide Enden zusammen zu einem Kreis, stellt seine Füsse in die Schlinge. Er sieht mich befremdet an, spannt das Tuch zwischen den Füssen, fasst den Stamm eines Mangobaums mit beiden Händen an.
"Ich werde seiner Frau den Boden übertragen und ihr die Papiere auf einem goldenen Tablett bringen. Oder wie stellst du es dir vor?"
Sein Zynismus kennt keine Grenzen.
"Vater, wie soll er seine Kinder ernähren? Wie lange soll er auf seinen Anteil warten? Ist er nicht dein Sohn?"
Er lässt mich unter dem grossgewachsenen Baum stehen. Vater zieht seinen zierlichen Körper in die Höhe, sein Bauch voller Wut, seine Zähne fletschend.
Vater klettert hoch hinauf auf den Mangobaum, er versucht, den vielen Ameisennestern auszuweichen, ein Entkommen scheint ihm unmöglich. Wie grosse Bälle hängen diese auf jedem Ast, aus verwelkten Blättern bestehend und mit silbrigen Fäden zusammengenäht, mit Tausenden von schneeweissen Eiern gefüllt. Die bissfreudigen winzigen Bestien wandern über seinen ganzen Körper, rote Ameisen spritzen ihr Gift in seinen Leib, versetzen ihn von einer misslichen Lage in eine andere. Mit seinen dünnen Beinen krabbelt er von Ast zu Ast, klettert bis zur Baumkrone, böswillig pflückt er einzelne nicht ganz reife Mangos, kämpft mit den selbstmörderischen Ameisenscharen. Die Mangos sammelt er in einem kleinen Sack, den er zwischen zwei Ästen aufbewahrt, er darf sie nicht fallen lassen. Er hängt sich an die Unterseite eines Astes, umklammert ihn mit seinen Beinen, schleicht zu dessen Spitze vor. Er hält einen Zweig mit einer Hand, kneift seine Augen vor den bisswütigen Kamikaze-Ameisen zusammen, tastet nach der runden Frucht. Wie ein tollwütiger Affe schleicht und kriecht und tanzt er. Er springt von Ast zu Ast, flucht auf Mutter Rose und auf uns, seine Söhne. Er steht auf einem dünnen Ast, seine Arme ausgestreckt, sein Körper am Stamm festgenagelt. Von hoch oben auf seinem Baum schreit Vater.
"Ich habe Durst!“
Er will, dass wir ihm Reiswasser bringen, dass wir ihm stets zu Diensten stehen. Stets ihm zu Füssen fallen.
"Lass ihn an seinem Kreuz hängen, er soll verdursten, es soll ihm schwindlig werden, lass ihn von hoch oben auf den Felsen hinunterstürzen!"
Mein Bruder schimpft.
Vater lässt den Sack voller Mangos mit einem Seil gebunden zum Boden hinunter. Er steigt hinab, reibt den Rücken gegen den rauhen Baumstamm. Die Ameisen hängen noch auf seinem Rücken, bis zur Selbstaufopferung haben sie Vater gebissen, ich entferne ihre kleinen toten Insektenkörper, pflege seine verletzte Haut.
"Vater, ist es nicht unsinnig, in deinem Alter auf so einen Baum zu klettern? Die Mangos sind nicht mal reif! Was willst du dir beweisen?“
Inmitten von Kautschukbäumen stehen einige Mangobäume. Ihre Früchte sind sehr gefragt, man kann sie leicht in der benachbarten Stadt Iritty zu einem guten Preis verkaufen. Gewöhnlich kommen Händler aus der Stadt auf der Suche nach besonderen Mangosorten, sie bringen ihre Kletterer mit, lesen ganze Ernten auf.
"Letztes Jahr habe ich keine einzige Mango gesehen. Die gnädige Frau meines zweiten Sohnes hatte alles verkauft. Es sind Bäume, die ich angepflanzt habe. Ich habe sie in diese Erde gesteckt! Ich! Ich! Mit meinen Händen.“
Warum er die Frau meines Bruders hasst, verstehe ich nicht. Aber alles, was sie tut, alles, was sie nicht tut, alles erntet sein Missfallen.
"Sie hätte ja fragen können. Seit dem Tag, an dem diese Hure ihren Fuss in unsere Hütte gesetzt hat, habe ich keinen Frieden mehr, unser Niedergang hat an diesem Tag begonnen.“
Leela, die Frau meines Bruders, ist keineswegs demütig. Aber Arroganz kann man ihr auch nicht vorwerfen. Sie will ihr Leben und das ihrer Familie so führen, wie sie und mein Bruder es für richtig halten, sich nicht den Zwängen der Grossfamilie unterwerfen, wie dies für Generationen der Fall war. Vater kann den gesellschaftlichen Wandel nicht gutheissen, nichts fürchtet er mehr als die Unabhängigkeit einer Frau, auch die seines Sohnes.
Der erste Regen nach der Glut des Sommers lockt mich auf den Hof unseres Hauses. Auch Vater steht dicht bei mir im Regen.
"Was sind das für Linien auf deinem Rücken?“
Mein Schweigen macht ihn neugierig. Meine Mimik verrät nichts, weder Zuneigung noch Hass, weder Vergebung noch Verbitterung. Lange prasselt der Regen auf uns nieder, lange spricht der Donner, vielleicht versteht er mein Schweigen. Er ahnt Schlimmes, begreift nichts, seine Untaten hat er aus dem Gedächtnis verbannt.
"Musstest du operiert werden?"
"Nein, niemals. Ich war nie krank."
Er betrachtet die Narben genauer, streichelt meine Haut mit seinen Fingerspitzen.
"Sie liegen kreuz und quer! Was sind denn das für Narben? Sag, was sind das für Narben?"
"Es sind...Es sind deine Schläge, Vater!“
Vater kreist unruhig um mich herum, zeigt mir meine Briefe, Briefe, die er über dreissig Jahre gesammelt hat, liest mir ein paar Zeilen vor. Ich bügle meine Hemden, bald muss ich meine Familie verlassen, auch unsere Reisfelder. Schnee und Kälte liegen vor mir, aber auch die Welt der Bilder. Zauberhafte Welten. Ich bin halb hier, halb dort, in der Gegenwart, in der Vergangenheit. Bewegte Bilder laufen sturm in meinem Kopf, vermischen sich mit den Spiegelungen in den Reisfeldern. Ein Kind hoch auf einer Palme, Napalm über den Palmen von Vietnam, Padre Padrone, das Gesicht meines Vaters.
Er stellt sich hinter mich, kämmt mein Haar, seine Stimme flattert wie vor dreissig Jahren.
"Ich verkrafte es nicht. Diese Trennungen. Immer wieder ein Abschied. Früher tröstete ich mich, dachte mir, du bist ja im Land, kommst einmal im Jahr. Aber jetzt!“
Er steht hinter mir, klein, gebückt. Weint er? Lange kämmt er mein Haar, verwuschelt alles wieder, fängt erneut an.
"Ich wünschte, wir wären alle wieder zusammen, wir alle im Kreis sitzend, vor uns Reis auf Bananenblättern, gegrillte Sardinen dazu, so viele Sardinen, dass ich jedem meiner Kinder eine geben könnte! Es gab Zeiten, da hatte ich solche Sorgen. Ob ich euch am Abend zu essen geben könnte. Ob ich euch Schulbücher kaufen könnte. Kleidung! Alles, was ich getan habe, habe ich für euch getan. Aber nun kann ich nicht mehr. Deine Mutter und ich sind bald nicht mehr da. Ich muss dich bitten, für Celine zu sorgen. Eine psychisch angeschlagene Frau will niemand nehmen. Niemals kann sie heiraten. Niemand wird für sie dasein.“
"Du erwartest von mir, dass ich mich um deine Familie kümmere, um meine Mutter und Geschwister. Ja! Dann gib meinem Bruder wenigstens einen Teil des Bodens. Gib ihm diese Reisfelder. Eines Tages wird er sich wohl um dich kümmern müssen.“
Lange denkt er nach. Er ruft Mutter Rose zu sich. Sie soll ihm seine 'Beedie' anzünden. Meine Mutter bringt ihm ein glühendes Stück Holz aus der Küche, zündet seine 'Beedie' an. Er zieht an seiner grässlichen Zigarette, entfernt sich, geht aus dem Haus hinaus.
"Die Kautschukbäume, nur die zwei Hektaren Kautschukbäume. Diesem Ochsen die Reisfelder überlassen? Nur über meine Leiche!"
„Sohn, seit zwanzig Jahren redet Vater davon, deinem Bruder seinen Anteil am Boden zu überlassen. Aber er wird das nie machen. Er wird ihm nicht eine einzige Handvoll Erde geben. Warum nimmt dein Vater seine Reisfelder nicht in die Hölle mit?“
„Wer hat dich um deine Meinung gefragt?“
„Ich habe wohl auch ein Wort mitzureden. Thankachan ist in dieser Familie geboren. Er ist mein Sohn.“
„Hör auf, mich zu belehren! Ich weiss, wer deine Kinder sind.“
„Aber Vater, Thankachan sollte ernst genommen werden. Er hat auch Anrecht auf einen Teil des Bodens, wie alle deine Kinder. Er ist bald fünfzehn Jahre verheiratet und hat selbst zwei Söhne. Er hat keine Schulen besucht und keine Arbeit. Wovon soll er seine Kinder ernähren? Hast du ihm nicht die Reisfelder versprochen? Einmal sagtest du, alle drei Hektaren Boden seien für Thankachan. Dann sagtest du, nur zwei. Jetzt sagst du, vielleicht nur einen Hektar. Mal dies. Mal das. Du spielst mit ihm seit Jahren Katz und Maus!“
„Jetzt kommst auch du noch mit deinen Vorwürfen.“
„Vater, das sind Tatsachen!“
„Lass ihn seine Reisfelder mitnehmen. Wir füllen seinen Sarg mit Erde. Hauptsache er hat seinen Schlamm bei sich. Was kümmert ihn, wenn seine Söhne hungern? Dein Vater will drei mal am Tag essen, er will, dass ich ihm Reiswasser bringe, dann wieder Tee, dass ich ihm die Füsse küsse. Nach aussen hin benimmt er sich wie ein ehrenwerter Gentleman. Und zu Hause der böse Hund.“
Vater steht auf und holt Grossvater Ashans Spazierstock. Er richtet seine Spitze gegen die Kleine Rose.
„Wie viele Jahre habe ich an der Seite dieses Weibs gelitten? Wie viele Jahre habe ich deine Beleidigungen ertragen müssen? Provozier mich nicht noch mehr, du Miststück!“
„Wer provoziert wen? Glaubt ihr, ich fürchte mich vor eurem Stock? Erschlag mich! Töte mich doch!
Vater kreist um sie, zwingt sie in eine Ecke. Ich fasse ihn bei der Hand und halte ihn zurück. Er reisst die Hand frei.
„Vater, leg den Stock weg!“
„Seit wann erteilst Du mir Befehle? Ich behandle meine Frau, wie ich es für richtig halte!“
„Die Zeiten sind vorbei. Wirf den Stock weg. Wenn du meiner Mutter bloss ein Haar krümmst!“
„Du wagst es, mir zu drohen? Seit wann bist du hier der König? Und ich soll dir gehorchen?“
Vater schwingt den Stock gegen mich. Ich kann seinen Schlag abwenden. Er drischt auf mich, schlägt wild um sich, trifft mich am Kopf. Einen Augenblick lang sehe ich Sterne. Der nächste Schlag trifft mich am Oberschenkel. Er schmerzt mich, rüttelt mich wach. Mutter Rose wirft sich zwischen uns und versucht Vater den Stock wegzureissen.
„ Sohn, ich fürchte mich nicht vor diesem Stock. Ich kenne ihn nur allzu gut. Lass ihn Sohn, lass ihn seine Männlichkeit beweisen. Dieser Stock kann nur meiner Haut etwas antun. Meiner Seele nicht!“
Plötzlich wendet sich Vater von mir ab und greift Mutter an. Ich kann seinen Schlag im letzten Augenblick abwehren. Ich schlage ihm heftig auf die Schulter, sodass der Stock zu Boden fällt. Wutentbrannt wendet er sich mir zu und packt mich mit seinen kräftigen Händen am Hals. Mutter schreit um Hilfe, verzweifelt bemüht sie sich, uns zu trennen. Ich drücke Vater gegen die Wand aber er lässt mich nicht los, er erstickt mich. Ich schlage ihm kräftig mitten ins Gesicht. Entsetzt sieht er mich an, lässt nicht locker, er hält mich im Würgegriff gefangen. Mit einem kräftigen Schlag befreie ich mich von ihm. Er springt nach mir und packt mich wieder. Ich ringe mit ihm und werfe ihn zu Boden. Ich nehme den Stock und versuche ihn über dem Knie zu brechen. Aber der harte Rattanstock biegt sich nur leicht, er lässt sich nicht bezwingen. Ich schleudere ihn fort. Er prallt gegen die Wand und fällt zu Boden.
Auch den letzten Felsbrocken zieht Vater aus dem oberen Reisfeld, ein Granitbrocken geformt wie ein Messer, tief in die Erde gestochen. Die rotbraune Erde ist schnell verteilt, in ein paar Stunden durch Wasser gesättigt, das trübe Wasser fliesst zum zweiten Reisfeld hinunter. Mit einer letzten gemeinsamen Anstrengung wollen wir die übrigen Steine und Wurzeln aus dem obersten Feld herausholen, unser Werk vollenden, die Schöpfung unserer Erde.
Der Fels hat reichlich Splitter hinterlassen, scharfe Brocken verborgen im Schlamm, klein, gross, grösser, Tausende von Messern. Wir stampfen im obersten Reisfeld, Vater, Mutter, meine Geschwister, unsere Füsse wund, unsere Körper voller Narben, Kummer und Erschöpfung in den Gesichtern. Vater singt alte Lieder, Lieder aus meiner Kindheit, aus der Erntezeit. Er setzt sich an den Rand des Reisfelds, auch wir steigen aus dem Schlamm heraus, summen seine Lieder mit. Eine weisse Wolke gleitet von einem Reisfeld ins nächste, wandert von Feld zu Feld, verliert sich in der Erde. Ein sanfter Wind kräuselt Geschichten ins Wasser, Worte des unaufhörlichen Leidens, Silben unseres flüchtigen Glücks.
Eine Woche später begebe ich mich ins Dorf Ashans, gehe an seinem Grab vorbei, am Grab meiner Grossmutter, hin zu den Reisfeldern. Die Sonne wirft ihre kräftige Strahlen durch das Laub, Libellen kreisen über die noch leeren Felder, knapp über der dünnen Schicht Wasser stehen sie verzaubert still, fliegen weiter. Krebse, Kaulquappen, kleine Fischarten schwimmen im kristallklaren Wasser. Weisse Kraniche verweilen an den Trennwänden, versunken in Träume, breiten sie ihre Flügel wieder aus. Alles ist so friedlich, alles scheint so zu sein wie noch vor dreissig, vierzig Jahren. Ich laufe entlang einer Trennwand, betrachte das Leben in den Feldern, breite meine Arme aus, um mich auf dem glitschigen Boden zu bewegen. Alles spiegelt sich im Reisfeld, Bäume, Wolken, Libellen.
Plötzlich sehe ich das Gesicht meines Vaters, dunkel, mächtig, zornig. Eine Krabbe eilt aus dem Wasser, flieht vor dem hässlichen Bild, gräbt sich in den Schlamm. Vater ragt vor mir empor, er schreit mich an, er erschreckt mich zu Tode.
Bereits zwei Jahre stehen die Reisfelder ungenutzt, die Oberfläche ausgetrocknet, schuppenartig verformt. Vater hatte am Berghang wieder Pfeffer angepflanzt, er war auf einen dornigen Baum geklettert, der dünne Stamm ist eingeknickt, unsanft zu Boden gestürzt. Wie dumm von Vater, auf einen solchen Baum zu klettern! Seinen Willen hat er durchgesetzt, sein sturer Kopf ist gegen einen Stein geschlagen.
Seit bald drei Jahren liegt er im Sterben, seine Haut ist voller Wunden, seine Augen blind. Er hört alles, riecht alles, spürt alles. Schleim fliesst aus seinem Mund, seine Kleider sind von Urin durchnässt, seine Hände sind kraftlos. Er schreit, er schreit die ganze Zeit, schreit nach der kleinen Rose. Für alles ist er auf Mutter Rose angewiesen oder auf seinen 'Hundesohn' oder auf seine verhasste Schwiegertochter.
"Vater, ich bin es. Erkennst du mich, deinen Sohn?"
Er strengt sich an, sich umzudrehen, sein Gesicht voll Schmerz, leise weint er.
"Ich bin es. Ich bin nach Hause gekommen."
Er richtet seine Augen nach meiner Stimme, umsonst spähen sie in die Finsternis, er schliesst seine Augen wieder. Sein Körper ist geschrumpft, ist nur noch Haut und Knochen, mein sichtbarer Gott, einst so mächtig.
Ich nehme seine Hände, seine Hände, die mein Haar kämmten, die mir das Bananenblatt über meinen Kopf hielten, seine Hände, die mich oder Mutter schlugen. Hände, die uns fütterten, Hände, die uns folterten. Seine Stimme ist gebrochen, ein leises Wimmern, das mich schmerzt. Muss das Leben so enden? Muss ein Leben so verwelken? Muss Schmerz das Leben krönen?
Heute, und das weiss er nicht, ist er fünfundachtzig geworden, seine Kinder und deren Kinder sind um ihn versammelt. Sie knien vor seinem Bett nieder, berühren seine Hände und flüstern ihm ihre Wünsche zu. Alle wünschen ihm Glück. Alle wünschen sich seinen Tod. Ich wünschte, dass er endlich stirbt, dass seine Qualen nun enden, dass sein Leiden aufhört. Aber noch klammert er sich an einen dünnen Ast, noch klammert er sich ans Leben.
Ich wünschte, Vater wäre tot.
[1] Verstossene Ehefrau des Königs Rama

Die Ereignisse der letzten Tage lasten schwer auf meinen Schultern. Noch schwerer wiegen sie auf den Schultern meiner geliebten Frau. Wenn ich allein in der Fabrik stehe, auf das Hop-Hop-Kommando des Vorarbeiters warte, wenn die Dämpfe des grünen Gebräu zu meinen Füssen oder den Nikotinegestank in den Fabrikfluren mir das Atmen vermiest, denke ich an sie. Ich würde sie gerne gleich anrufen und fragen, ob sie etwas gegessen habe, ob sie getrunken habe, ob sie Schmerzen spüre, ob sie heute unter Schwindel leide, wie gestern und vorgestern der Fall war. Ich würde sie gerne in irgendeinem Gespräch verwickeln, nur so, dass sie nicht mehr weint, so dass sie sich an etwas anderes, an Morgen denkt.
Ein Telefon steht uns Arbeitern nicht zur Verfügung, nicht in der Galvanik, nicht in der Halle, wo sie den metallenen Streifen bürsten und in Gefässe bereitstellen, nicht in der noch grösseren Halle, wo die weibliche Belegschaft tags die galvanisierten Stücke auf Mängel prüfen und nach Grösse sortieren und in Kästen für den Transport bereit stellen. In den schmalen Gängen zwischen den einzelnen Hallen stehen zwar Telefonapparate, aber sie verbinden den Anrufer einzig mit dem Büro des Nachtwächters und sind nur für Notfälle vorgesehen.
Allein der Vorarbeiter Qurban hat einen Schlüssel zum Büro seines Vorgesetzten Hermann, des stets freundlich lächelnden aber knallharten Chefs der Galvanik. Nachts darf der gütige Herr nicht gestört werden, ausser in absoluten Notfällen, bei Brände etwa. Aber sie passieren nie. Der Flur der Galvanik ist stets nass, die grüne giftige Flüssigkeit aus Nickel und kein-Mensch-weiss-was-sonst, strömt in den Gedärmen der dreissig monströsen Galvanisierungs-Maschinen, die Mischung schwappt hinunter, fliesst über den Boden, unter ihn, durch die ganze Fabrikhalle und durch Röhren unter dem Fabrikgebäude bis hin zu einer Schlammpresse zwei hundert Meter entfernt, am Rande der Anlage.
Hop Hop!
Der Befehl des Vorarbeiters ist kurz und unmissverständlich. Während sechs Mitarbeiter der Nachschicht die bereits mit Nickel überzogenen Streifen aus der dunklen, dämpfenden Brühe herausfischen, hängen sechs weitere Mitarbeiter frisch polierte, dünne, hängende, metallene Streifen samt ihren Rahmen auf fest montierten Haken in die Behälter hinein. Dazu benutzen sie silbrig glänzende metallene Stücke, die wie riesige Angelhaken aussehen.
Die dutzend Arbeiter bewegen sich im Takt, hastig, konzentriert, stumm. Sie tragen kniehohe Stiefel, dunkelbraune, stark verschmutzte, lange Lederschürzen und extra lange Gummihandschuhe. Kupfer- und nickelhaltige Salzkristalle zeichnen seltsame Landschaften auf die Kleidung, den Schürzen und Stiefel der Fabrikarbeiter. Die Nickellösung, in der sie den sonst rostanfälligen Metallstreifen tauchen, ist säurehaltig und brennt auf der Haut. Trotz grösster Sorgfalt reissen die Handschuhe häufig, denn die hauchdünnen Metallstreifen sind kantig und schneiden scharf wie Rasierklingen.
Yalla, yalla. Hey!
Der Vorarbeiter Qurban hetzt mich, treibt uns alle zur Arbeit. Mit seiner rechten Hand dirigiert er seine Untertanen.
Etwas schneller, bitte!
Wenn alle dreissig Bäder geleert und mit neuen Streifen gefüllt sind, wenn die Maschinen mit einem Knopfdruck wieder brummen und die Streifen, montiert auf Schienen hin und her schwingen, dürfen wir uns einen Augenblick ruhen.
Wer rauchen will, rauchen muss, darf seine Zigarette anzünden. Alle saugen gierig an ihren dünnen Zigaretten, die sie zwischen ihren aufgeschwollenen nassen Fingern halten. Der Gestank von Nikotin reizt mich. Mein Vater ist ein Kettenraucher. Sein Atem hat mich stets angewidert. Ich nehme eine kleine Flasche aus der tiefen Tasche meiner dunkelblauen, säureresistenten Fabrikjacke, öffne sie und trinke einen Schluck Wasser.
Ich denke an Rosie, meine Frau. Schläft sie? Sind ihre Brüste noch geschwollen? Hat sie Blutungen heute Nacht?
Ahammed Abe schreitet an mir vorbei. Er ist ein Koloss von einem Mann, sanftmütig und schweigsam, wie der Indianer im Film „Einer Flog Übers Kuckucks Nest“ von Milos Forman. Er spricht kein einziges Wort. Ahammed Abe nimmt die frisch vernickelten Streifen auf Rahmen und hängt sie auf den Haken der Borst-Maschinen. Das Konstrukt sinkt einen halben Meter zwischen entgegengesetzt rotierenden, mit feinen metallenen Nadeln bedeckten Röhren, und taucht aus dem dampfenden Spalt wieder auf. Ahammed Abe schnappt den Rahmen und kehrt ihn um, kurz bevor sich das Gerüst mit den Streifen wieder in den kochenden Bauch der Maschine abtaucht.
Ahammed Abe aber auch die anderen Arbeiter, haben kräftige Arme. Ahammed Abe ist, wie unser Vorgesetzter Qurban, aus der Türkei. Der kurzgewachsene, bärenstarke Rotgesicht Hassan ist Kurde. Der breitschultrige Chakyung ist Tibeter. Sanchez stammt aus Spanien, Alvarez behauptet stolz, er stamme aus dem Baskenland. Der kleine Antonio, den wir Pavarotti nennen, stammt aus Sizilien. Vukic stammt aus Yugoslavien, Izmir aus Albanien. In der Galvanik sind Bürgerkriege vorprogrammiert.
Bürste..Bürste! Yalla, yalla, brüllt Qurban. Dann wird seine Stimme etwas milder, höflicher. Er fleht seine Mannschaft leise, förmlich an. Hey, Brüder! Brüder!
Es ist vielleicht Zufall, dass kein Schweizer bei der Nachschicht dabei ist. Tagsüber arbeiten einzelne junge Schweizer in der Galvanik. Die Mitarbeiter der Fabrik sind meist gelernte Arbeitskräfte: Metallarbeiter, Maschinenmonteure, Metallbauer. Der Chef der Galvanik Herr Hermann ist ein Schweizer, auch der Chemiker Bürki, der sich ein bis zwei Mal die Nickellösung kontrolliert, manchmal bloss mit seinem Zeigefinger, den er in die Lösung kurz eintaucht und gegen eine Neonröhre hoch hält.
Ich denke an meine Frau. Verkraftet sie den Schmerz? Wenn sie bloss jemanden hätte, um bei ihr zu sein! Um mit ihr zu reden!
Was du denken, Bruder?
Qurban nähert sich mir. Er bittet mich, ihm zu folgen.
Ich bin neu hier. Ich versuche mein Bestes. Ich lass meine beiden Haken an einem Fenstersims ruhen und schiebe eine badewannengrosse Kiste mit Metall, die in einer trüben alkalischen Lösung aufbewahrt ist. Mit einem festen Griff vorne zieht Qurban die schwere Kiste wie ein Ochse und ich schiebe sie von hinten bis an die breite Eingangstüre der Galvanik.
Du studiert, ich weiss. Du nicht Arbeiter, wie wir. Deine Hände, zart.
Während dem er zu mir spricht, wirft er einen Blick auf die Belegschaft.
Hey, Hassan Abe! Hallo Chakyang, Schneller. Bitte nicht bla, bla.
Weisst Du? Chef Herman kommt heute Nacht. Kontrolle! Ich denke.
Qurban heisst in der Tat Byram Davitiogulu. Aber stets spielt er den Leidtragenden, weshalb ihn seine türkischen Mitstreiter spöttisch Qurban nennen.
Aslan, Hassan Abe, Cemil und Sanchez, alle faul. Alle Arschlöcher. Du guter Kollege. Du verstehen: Er schmeichelt mir.
Ich habe meine Frau verlassen. Anatolien. Keine gute Frau. Was machen? Hier ich lebe allein. Nacht arbeiten, Tag schlafen. Kein Alkohol, kein Rauchen. Nur ein bisschen Spass am Abend, mit Magdalena. Und du, Kollege?
Meine Frau arbeitet, hier in Horgen. Ich wohne in der Nähe. Die Nachtschicht passt mir. Bevor ich in die Galvanik kam, habe ich zwei Jahre lang in einem Filmlabor gearbeitet, acht Stunden in einem dunklen Raum. Filme kopiert. Spielfilme. Werbefilme für Zigaretten. Die gleiche Schlaufe mit deutschem Ton, dann italienischem, dann französischem.
Wo Kollege?
In der Nähe des Flughafens, in Zürich. Zwanzig Minuten zu Fuss bis zum Bahnhof Horgen, dann nochmals zwanzig Minuten bis zum Hauptbahnhof Zürich, dann fünfzehn Minuten mit dem Tram bis nach Oerlikon. Anschliessend Bus 63. Dann noch einige hundert Schritte bis…bis zur Dunkelkammer.
Eineinhalb Stunden Arbeitsweg!
Und am Abend, erschöpft, einsam, nach Hause. Nochmals neunzig Minuten.
Horgen ist gut. Hier gibt es vier Textilmaschinen Fabriken. Weisst du? Genügend Arbeit. Schöner See. Oben Wald.
Kennst du viele Menschen hier?
Nur die Leute von der Fabrik. Friseur Bettoni aus Italien. Magdalena. Du kennst Magdalena? Blondine. Etwas alt aber hübsch.
Ja. Ich sehe sie fast jeden Morgen. Sie kommt immer als eine der ersten Frauen zur Frühschicht.
Qurban und ich leeren die Badewanne mit den schweren Metallteilen.
Magdalena, gute Frau. Sie hat keinen Mann. Sie hat dich gern.
Wirklich? Wieso? Warum mich?
Sie hat dich gern. Du gut aussehen. Höflich. Ja, glaub mir. Du einmal bring ihr eine Tasse Kaffee vom hier, vom Automat. Sag, guten Morgen, schöne Frau. Dann alles klar! Sie sagt mir, bring dein Freund, den Inder mit. Wir können zusammen…Spass machen. Du weiss, was ich meine?
Aber sie ist deine Freundin!
Nein, nein. Ich mach…nur Sex. Zwei, drei Mal die Woche.. Das ist alles. Mein Herz vielleicht tot. Ich kaputt. Aber sie will mehr. Sie will jeden Tag!
Ist das warum deine Kollegen dich Qurban, das Opferlamm nennen?
Ei…Ei… Eifersucht! Magdalena ist gute Frau. Freundlich. Schöne Lippen. Schöne Brüste. Alles schön, weich. Sehr lieb!
Er sieht sie vor seinen Augen, wird kurz nachdenklich und schweigt. Dann schaut er hinauf wie ein wachsamer Hahn.
Kollegen! Wechseln! Hop, Hop, Hop!
Wir arbeiten von zehn Uhr nachts bis fünf Uhr früh. Wir schieben Kisten herum, waschen, bürsten, trocknen. Um Mitternacht ruhen wir kurz. Wir trinken einen Kaffee um vier. Jede Stunde füttern wir unsere dreissig Maschinen mit Metall. Alles läuft nach Plan. Was gibt es für Herrn Hermann hier in der Nacht zu kontrollieren? Er darf ruhig schlafen.
Bruder, er muss kontrollieren. Sein Job! Abteilung Direktor Hämmerli, sein Chef! Er verdienen gut, muss kontrollieren. Sein Job. Alle Chefs verdienen gut. Viele tausend Franken.
Du bist auch ein kleiner Chef.
Ich bekomme vielleicht fünfzig Franken mehr als Du.
Nicht mehr?
Kannst denken, was du willst. Ich bin kein Chef. Nur ein Esel...Treiber. Wie sagt man? Ein Kameltreiber.
Er legt seine, mit der Nickellösung tropfenden Handschuhe auf meiner linken Schulter und schreit aus lauter Gewohnheit.
Yalla, yalla, Komaraden!
Die Arbeit in der Textil-Webmaschinen Fabrik raubt mir den Schlaf. Ich arbeite nachts und bin dankbar dafür, dass ich mit knapp sechs Stunden Arbeit gleich viel verdiene, wie ein Arbeiter am Tag, der acht und halb Stunden schuftet.
Doch es schmerzt mich, dass meine Frau Rosie allein ist, dass sie sich Vorwürfe macht. Es schmerzt mich, dass ich keine bessere Stelle finden konnte. Für eine Stelle bei einer Bank fehlt mir die Banklehre. Für eine Stelle als Verkäufer fehlt mir das Handelsdiplom. Einen Filmregisseur will niemand. Unbewusst trampe ich in die sachte giftgrüne Brühe unter meinen Füssen, schwinge die metallenen Haken die ich bei mir stets trage wie ein Roboter, schleiche in die Haut von Charlie Chaplin und denke an seinen Film „Modern Times“.
Hop Hop Hop!
Qurban zeigt auf sein linkes Handgelenk, auf seine nicht vorhandene Uhr.
Schweigend bürsten wir, die flinken schweigsamen Arbeiter der Nachtschicht, rostbefallenen Metall, tauchen die dünnen Streifen in die Nickelbäder, kehren sie zur Halbzeit, nehmen die silbrig glänzenden Stücke stündlich heraus und ersetzen sie mit neuen Streifen. Qurban, Ahammed Abe, Hassan Abe, Antonio und Vukic und alle anderen spucken Schleim in die fliessende Nickellösung. Der gelbweisse Schleim mischt sich schlecht mit der abscheulichen Flüssigkeit und fliest gemächlich über den Fussboden bis hin zur nächsten Röhre und verschwindet in die Gedärme der Metallfabrik. Die Arbeiter sind dauernd erkältet. Sie husten laut und fluchen leise. Die Metallstreifen glänzen, die Arbeiter rosten.
Um Mitternacht tönt eine Sirene. Hastig entledigen wir unsere braunen knöcheltiefen Lederschürzen und stürzen die seitlich angebrachten Treppen hinunter zu den Umkleidekabinen und Toiletten. Antonio der kleine, kahlköpfige Sizilianer ist uns vorausgeeilt und singt mit voller Kraft „Finiculi, Finicula, Finiculi, Finiculaaa!“. Seine Stimme ist gewaltig, das pure Gegenteil seiner Statur.
Jammo, jammo, 'ncoppa jammo ja',
jammo, jammo, 'ncoppa jammo ja'.
Funiculí - funiculá, funiculí - funiculá,
'ncoppa jammo ja', funiculí - funiculá.
Er leidet unter einer Blasenschwäche und muss seinen Gesang unterbrechen. Er strengt sich an, Wasser zu lassen und sein Gesicht verdunkelt sich. Als ich mit dem Wasserlassen fertig wird, ehe er einen einzigen Tropfen Urine lassen kann, lächelt er mich wehleidig an. Er deutet auf sein kraftloses Geschlechtsteil und flucht.
Porca miseria!
Nimm dir viel, viel Zeit. Viel Zeit, betone ich. Ich berühre ihn sanft auf die Schulter und kehre zurück zu den anderen.
Die Belegschaft der Galvanik steht in kleinen Gruppen, die Türken unter sich, die Kurden unter sich, Männer aus Jugoslawien in einer Ecke, die Albaner in einer anderen Ecke, die Portugiesen unter sich, der Tibeter allein, und verschlingen ihre mitgebrachten Brote. Hassan Abe hat einen mittelgrossen Glasbehälter mitgebracht. Darin schwimmen eingelegte Gurken und Stücke von Weisskohl, die er mit seiner kurzen dicken Fingern herausfischt und unter seine Kameraden grosszügig verteilt. Er streckt mir eine Gurke entgegen. Kollege, du nicht essen? Fragt er mich.
Doch, doch, aber keine sauren Gurken. Danke.
Ich nehme einen, in Küchenpapier umgewickelten und bereits geviertelten Apfel von einem Fenstersims.
Du nur Frucht?
Ich nicke.
Du nicht nicken wie andere Inder! Inder machen so…oder so. Was bedeuten? Ich nicht verstehe!
Ich auch nicht, mein Freund.
Türke Qurban, nicht guter Mensch. Flüstert Hassan, der Kurde, in mein Ohr.
Warum nicht?
Er Qurban…Opfer…Opfer…Opfer. Er arbeit hart. Sicher. Aber er, Tilki.…ein Fux! Er redet mit dir, Freund, Freund, nachher gehen und Chef sagen, du machen immer Pause. Vielmal Pause.
Er beisst in eine Gurke, isst ein Stück Brot dazu.
Früher Qurban arbeiten Tag. Er immer reden mit Magdalena. Immer diese Frau. Der Chef ruft Qurban. Du machen Nachtarbeit.
Ha.. Ha…Ha!
Hassan kann seine Schadenfreude kaum verbergen.
Sex gut, Kollege. Aber nicht gut bei Arbeit.
Bist du verheiratet Hassan Abe?
In Erzurum. Ich Frau, sieben Kinder.
Er zeigt mir sieben seiner geschwollenen, blassen Finger.
Wann siehst du deine Familie?
Sommer ich gehe, Winter ich gehe. Mit Auto. Ich bisher kaufen sieben Auto. Sieben Kinder, sieben Auto.
Er strahlt vor Freude, freut sich wie ein Kind.
Immer Mercedes. Gut Auto. Fahren bis Erzurum. Ich bring immer Geschenke. Du Kollege?
Meine Frau ist hier. Sie arbeitet als Hebamme.
Du Kinder?
Nein. Wir sind erst zwei Jahre verheiratet.
Du Auto?
Ich lerne Auto fahren.
Auto lernen teuer! Du auch kaufen Mercedes?
Ich glaube nicht.
Audi gut. BMW auch gut. Opel nicht gut. Qurban kein Auto. Er nicht fahren in Türkei. Er nie Geld. Alles Geld für Magdalena.
Vielleicht liebt er sie.
Liebe nicht gut. Nicht gut, Kollege. Heiraten gut, Kinder gut, Liebe nicht gut.
„Twenty Love Poems and a Song of Despair“ von Pablo Neruda trage ich ständig in der Innentasche meines Hemds, der nun in der Umkleidekabine hängt. Intuitiv lege ich meine Hand auf die Brust und spüre mein Herz schlagen.
Ich lehne mich an den Rand eines Metallbehälters und betrachte meine Arbeitskollegen. Ahammad Abe ist der einzige, der sich ebenfalls ein wenig zurückzieht, um sich ein Bild zu machen. Eisern schweigt er. Er lächelt kaum, ist stets in tiefer Trauer versunken. Hassan Abe behauptet, Ahammad Abe habe seinen Nachbarn umgebracht, bevor er in die Schweiz geflüchtet ist. Blutrache, munkeln seine Kollegen.
Manchmal schmerzt es mich, hier in dieser mit Neonröhren hell beleuchten nassen Fabrikhölle zu arbeiten. Es ekelt mich jedes Mal, wenn der abscheuliche Schleim, der meine Kameraden irgendwo auf den Boden gespuckt haben, an mir vorbei fliesst. Es ist traurig, nach einem mit Auszeichnung abgeschlossenen Studium an einer der renommiertesten Filmakademien der Welt, hier im Bauch einer Metallfabrik zu schmoren.
Dennoch denke ich stolz, ich bin ein Mensch, ein Arbeiter, Fleisch und Blut. Ich bin kein Kaffeehaus Revolutionär, der Kampf und Gerechtigkeit predigt und Fleiss und Solidarität und Märtyrertod des Anderen meint. Ja, ich bin stolz ein Arbeiter zu sein, flüstere ich mir selbst oft zu. Ich bin stolz die Ausbildung meiner Geschwister in Indien bezahlen zu können, stolz, meinen Eltern ein Leben in Würde zu ermöglichen, ich bin stolz, meiner Frau in schweren Stunden bei zu stehen, ihrer Trauer, meiner Trauer, das flüchtige Glück mit ihr zu teilen.
Warum ist das alles so geschehen?
Meine Kollegen haben ihre mitgebrachten Brote, Schinken, Käse, die eingelegten Gurken und Weisskohl verschlungen. Sie rauchen, legen sich auf umgekippten Metallbehältern und ruhen sich einen kurzen Moment aus. Die Arbeiter der Morgen -und Nachmittagsschicht haben Pausenplätze und für ihre Mahlzeiten, eine Kantine mit Bedienung. Sie dürfen sich bei der Mahlzeit und in den Pausen hinsetzen. Wir, die armen Teufel der Galvanik, müssen stets stehen, dürfen sich niemals hinsetzen, nirgends anlehnen. Chef kommt! Kontrolle! Hop Hop Hop, brummt Qurban ständig in den Fluren, in der Halle der Galvanik, ja sogar in den Umkleidekabinen.
Qurban kommt zu mir hinüber, bückt sich und flüstert in mein Ohr.
Kollege. Morgen früh, bring Magdalena eine Tasse Kaffee. Hier, nimm es. Fünfzig Cents. Du schenken ihr Kaffee und machen ihr ein Kompliment. Sie hat dich sehr gern. Sie immer sagt. Bring dein indischer Freund mit. Kommt mit mir am Samstag. Sie hat gerne zwei Männer. Wir sie glücklich machen!
Hey Qurban! Ruft in Antonio.
Fertige, fertige, fertige. Finito Pause!
Vaffanculo, du kleiner Italiener! Schimpft Qurban mit einer deutlichen Geste.
Qurban wendet sich mir wieder zu.
Du niemand hier trauen, Kollege. Er ist mit Renato zusammen. Qurban fasst seine linke Hand mit seiner Rechten und warnt mir vor der Kumpanei des kleinen kahlköpfigen Möchte-Gern-Pavarotti mit dem Chef des Personalbüros.
Antonio geht morgen und sagt Renato, du und ich reden die ganze Nacht, nicht arbeiten. Er will meine Stelle haben, er will Chef der Nachtschicht werden. Schlappschwanz!
Hop, Hop, Hop, ruft er in die Gavanik und schreitet zur Arbeit.
Es schneit, es schneit, freut sich Vukic.
Porca miseria, flucht Antonio.
Nicht gut, Kollege, nicht gut. Hassan Abe wirkt besorgt und schüttelt den Kopf.
Ich blicke Hassan fragend an.
Was meinst du?
Kein Winterreifen mein Mercedes, seufzt er. Vier Reifen. Viele Geld. Viele, viele Geld.
Die Arbeiter der Galvanik leben zwar in der Schweiz, aber ihre Gedanken sind von der Heimat. Auch das Geld fliesst dorthin. Sie sind schlecht oder gar nicht ausgebildet, eine Aussicht auf Integration haben nur wenige. In Horgen gibt es sehr viele Italiener, recht viele Jugoslawen und Portugiesen. Niemand hat einen Anreiz, Deutsch zu lernen. Es gibt auch eine recht grosse Gemeinschaft der Tibeter, eine recht geschlossene Gesellschaft, die auf den Dalai Lama hoffen und von der Befreiung Tibets träumen.
Wohin führt uns Ronald Reagan mit seinen „Star Wars“? Wohin führt Gorbatschov’s Glasnost und Perestroika? Was will der kleingewachsene Deng Xiaoping?
Ich denke an die Millionen von Arbeitern, die in Büros und Fabriken, auf den Feldern und in den Stein- und Kohlegruben der Welt schuften. Ich denke an die Millionen Kinder Asiens, ich sehe ihre kleine Hände, die Teppiche Weben, Abfall sammeln, schlicht betteln.
Der Kapitalismus saugt Menschen das Blut aus, protestieren lauthals die Möchtegern-Revolutionäre. Sie kriegen einen Hungerslohn! Arbeiter der Welt, vereinigt Euch!
In den kommunistischen Staaten schuften Menschen ebenfalls. Die glücklicheren, gut gelaunten, ja, befreiten Kameraden steigen tief in die Erde, graben Kohle und Eisenerz heraus. Sie arbeiten für das sozialistische Vaterland, für die kommunistische Partei, fürs noble Politbüro. Sie kriegen einen Leninorden, einen Stalinorden und einen mickrigen Lohn dazu. Arbeiter der Welt, vereinigt Euch!Vereinigt Euch und werdet Sklaven!
Der Kapitalismus macht uns Menschen zu Hühnern, denke ich. Nur die Anzahl gelegter Eier zählt. Es gilt immerhin die Freilandhaltung. Der Kommunismus macht uns Menschen ebenfalls zu Hühnern. Hier gilt die marxistisch-leninistische-wissenschaftliche Batteriehaltung. Die Dialektik, verstehen Sie? Wenn ich nicht nur hier in der Galvanik arbeite sondern auch die metallenen Streifen und die giftige Nickellösung dazu selbst besitze, dann wäre ich Herr über mein eigenes Lebens und folglich ein emanzipierter Mensch! Wie grossartig ist der Sozialismus! Nur unser Fleisch zählt, Genossen! Unser Blut! Auch unsere Suppenknochen.
Wie lässt sich Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit unter einen Hut bringen? Wie kann man den Menschen ihre Ängste nehmen, sie von ihrer Naivität und dem Aberglauben befreien? Wie befreien wir uns von einer Welt voller Waffen?
Künstler, Schriftsteller, Studenten protestieren und dies zu recht. Aber was heisst es, allen Menschen Zugang zum sauberen Wasser zu beschaffen? Zur Bildung und zur Nahrung? Was kostet das? Wie sollen die elementaren Bedürfnisse finanziert werden? Und wie sollen wir Strassen, Schulen und Staudämme bauen, ohne die Natur all zu sehr zu belasten? Wie Menschen ermuntern, ihr Leben selbst zu gestalten?
Vor einem Monat bin ich dem britischen Filmregisseur Terence Davies in Locarno begegnet. Sein Film „Distant Voices, Still Lives“ hat mich tief berührt. Terence Davies und ich sind Freunde geworden. Er hat einen gewalttätigen Vater, eine sanftmütige, gutherzige Mutter, sagt er mir. Ich erzähle ihm von meinem zornigen Vater und meiner kleinen, kämpferischen Mutter, der kleinen Rose. Terence Davies ermutigt mich, meinen ganz persönlichen Film zu drehen.
Vor einem Monat war ich Präsident der Ökumenischen Film Jury in Locarno, davor Präsident der Drittwelt Filmjury in Mannheim und davor Mitglied der OCIC Jury bei den Internationalen Filmfestspielen von Berlin. Nun trage ich eine dunkle Jacke, eine dicke Lederschürze, ich trage schwarze Gummistiefel, Gummihandschuhe, halte Metallhaken in beiden Händen und hocke in einer nassen giftigen Scheissbrühe.
Porca miseria!
Leise fluche ich. Ich denke an das kleine Buch, "Der Fabrikaffe und die Bäume" von Tomasso di Ciaula und muss laut lachen..
Wie galvanisierte Metall werde ich eines Tages glänzen, ich werde hier herauskommen, dessen bin ich sicher. Ich weiss noch nicht wie. Ich bin ein Glückskind! Aber wie hole ich meine Frau Rosie aus ihrer tiefen Trauer?
Hop, Hop, Hop Kameraden!
Während ich Metallstreifen bürste, sie in die Nickellösung eintauche, bei der Halbzeit die Rahmen mit den Streifen kehre und zur vollen Stunde wieder herausnehme, denke ich an unser flüchtiges Glück.
Während den Studienjahren bin ich jedes Wochenende von München zu meiner Frau in die Schweiz gefahren, hatte hunderte von Grenzkontrollen über mich ergehen lassen, alle drei Monate ein Besuchsvisum für die Schweiz eingeholt und vier Jahre durchgehalten und bin 1985 in die Schweiz eingereist. Ich habe einen B-Ausweis! Ich darf in der Küche, im Ökonomiebereich eines Spitals, oder in einer Fabrik arbeiten, schrieb mir die Fremdenpolizei.
Schweigend betrachte ich Schneeflocken, die an den Glasfenstern der Galvanik landen und teils flüssig, nach unten gleiten. Ich sehe die geschwollene Brüste meiner Frau, wie sie mit Hilfe eines quiekenden Geräts die Milch herauspumpt und mir in einem Behälter überreicht. Ich bringe ihn weg, leere die Milch in das Waschbecken und lausche wie alles durch die Röhren unter der Wohnung hinunter fliesst.
Sie ist allein. Allein und schwach und trostlos.
Vor einer Woche bin ich neben drei fremden Menschen, zwei Gärtnern und einem Geistlichen, gestanden. Es schneite heftig. Immer wieder wischte ich den Schnee von dem weissen kleinen Sarg, der auf dem schneebedeckten Zementboden lag.
Ihre Tochter hatte überhaupt keine Chance. Es kommt wirklich selten vor. Sehr selten. Leider gab es zu wenig Fruchtwasser in der Gebärmutter.
Der Arzt war freundlich, korrekt, sachlich.
Leider kann das Kind nicht bei der Geburt mithelfen, wir müssen es mit einer Zange herausholen. Es tut mir sehr leid. Ihre Frau ist Hebamme. Sie weiss, wie das geschieht. Was das bedeutet. Ich weiss, sie werden schwach, wenn sie Blut sehen aber ihre Frau braucht sie jetzt.
Ich halte sie fest, lege meinen Kopf auf ihre Brust.
Ich mag keine Friedhöfe, mag weder Kreuze noch Gebete. Kein Gesang und keine Rede können mich trösten. Der Priester verabschiedet sich ohne viele Worte. Die Gärtner lassen den kleinen Sarg in die Erde gleiten, sie füllen das Loch mit Erde. Auch sie verabschieden sich.
Es ist windig und kalt. Meine Frau ist viel zu schwach und erholt sich von den Strapazen der Fehlgeburt, in unserer Arbeiterwohnung, allein. Auch ich bin allein.
Es schneit unaufhörlich. Hunderte grau schwarze Kreuze ragen über einem schrägen rechteckigen Berghang, der auf Ebenen gelegt und mit einer Mauer begrenzt ist. Der Friedhof ist gut gegliedert: Alte Gräber. neue Gräber, der Bereich der Kinder. Kreuze, Grabsteine, Klagelieder. Alle Kerzen sind ausgebrannt. Alle Blumen, die Trauernde in den letzten Tagen hier hingelegt haben, liegen unter einer dichten weissen Decke begraben. Nur ihre Stiele ragen hier und dort heraus. Reglos starrt ein Engel aus Sandstein am Eingangstor des Friedhofs auf das schneebedeckte Boden.
Meine Augenlider wiegen schwer, die Arme schmerzen, meine Hände sind beinahe gefroren. Trauer und Schlaf überkommen mich. Sehnlichst blicke ich zur Uhr auf einer Seitenwand der Galvanik hinauf, warte auf die letzte Sekunde. In der benachbarten Halle gehen die Lichter auf, uniformierte Frauen nehmen ihren Platz, sie schweigen. Magdalena entdecke ich in ihrer Mitte. Stolz sitzt sie vor glitzernden Metallstreifen, Kopf hoch, schön, voller Hoffnung.
Um fünf Uhr früh stehen wir, die Handschuhe ausgezogen, die Lederschürzen abgezogen und über den Arm gefaltet, die Metallhaken in Schubladen hingeschmissen, bereit für die Arbeitsübergabe an die Frühschicht. Bereits hat der bucklige Chemiker Bürki seine Finger in die Nickellösung getaucht, bereit steht Chef Hermann stramm wie ein Soldat zwischen zwei Werkhallen. Bereit steht auch die Sonne, irgendwo hinter dem Horizont versteckt, um der herzzerreisenden Nachtschicht ein Ende zu setzen.
Ich stecke meine Personalkarte vorsichtig in den schmalen Spalt oberhalb einer Stempeluhr und warte auf den erlösenden "Klick". Als ich die Karte wegnehme und mich umdrehe, sehe ich Ahammad Abe, der mit seiner Karte wartet.
Schlaf gut, Ahammed Abe!
Er bricht sein nachtelanges Schweigen und sagt mir mit seiner traurigen, tiefen, rauen Stimme:
Gute Morgen Nacht.

Stumme Ziegen
Kochu steht gebückt auf dem kleinen Vorhof ihrer bescheidenen zwei Zimmer Behausung und kämpft mit dem Atem. Mit dem roten Staub, dem Rauch und dem Geruch vom Blut. Wenn sie ein- und ausatmet pfeift sie leise, unkontrolliert. Ab und zu spürt sie auch ein leichtes Stechen in der Herzgegend, wo genau, weiss sie selbst nicht. Der bärtige Arzt, den sie kurz nach der Pensionierung aufgesucht hatte, sagte ihr, es sei nichts mehr zu machen, nicht mit den finanziellen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen. Mit ihrer bescheidenen Pension. Ausser dem kleinen vergrauten, verfallenen Haus, das nach dem Bau vor bald zwanzig Jahren nie wieder bemalt oder instand gesetzt wurde, hat sie nichts. Ihr einziger Sohn, der verhasste Sohn, befindet sich im Ausland. Er ist ein Billiglohnarbeiter in der Wüste von Qatar, ein moderner Sklave, wie so viele Hunderttausende aus dem ah! so fortschrittlichen Bundesstaat Kerala.
Kochu hat niemand. Niemand, den sie liebt. Niemand, der sie liebt.
Aufgeregt blickt sie immer wieder die kleine Landstrasse hinauf. Sie führt zu einer geteerten Hauptstrasse, die die wenig bekannte Stadt Mananthawadi in den Bergen mit der etwas bekannteren Küstenstadt Calicut, verbindet. Bekannt deshalb, weil der Portugiese Vasco Da Gama im Jahr 1492 auf der Suche nach Indien just hierhin verirrt und an Land gegangen war. Zur linken Seite der schmalen Landstrasse, wo diese in die Hauptstrasse mündet, steht ein Fleischladen, dessen vordere Seite mit gehäuteten, ausgenommenen und mit dem Kopf nach unten gehängten Ziegen, gerupften Hühnern und Gockel blutig geschmückt ist. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich der staatlich sanktionierte Alkoholladen. Vor dem mit verrostetem Metall gänzlich vergitterten Laden und entlang der schmalen namenslosen Verbindungsstrasse stehen verarmte, arbeitslose Männer, ein paar verwahrloste Frauen dazu und warten sehnlichst auf Erlösung.
Hühner. Ziegen. Menschen. Verdammt in aller Ewigkeit. Kochu führt Selbstgespräche.
Die Menschenschlange ist heute besonders lang, denn der Wochentag fällt zwischen einen Feiertag und einen Streiktag, was so viel bedeutet wie Zwangsschliessung aller Läden, Behinderung aller Transport und offener Konfrontation zwischen militanten politischen Gegnern. Gewalt und Stillstand. Die Menschen müssen sich reichlich mit Alkohol eindecken, denn die meisten sind dem, mit dreihundert Prozent Steuern belegten Elixier ganz verfallen, unheilbar süchtig. Sie sind ungepflegt. Ihre Häute sind runzelig, die Zähne verfault. Sie fristen ein sinnloses Dasein in einem Land, das jedes Unternehmertum mit dem Ruf nach Revolution und blinder Gewalt unterbindet und die Jugend so in die Sklaverei treibt. Nieder mit dem Kapitalismus! Es lebe die Diktatur des Proletariats! Neue Sklaven braucht das Land, für den Mittleren Osten.
Wer zurückbleibt, lebt von der Güte der Wanderarbeiter oder verfällt dem diskreten Charme des Alkohols. Die Meisten, die hier anwesend sind, sind dick und zuckerkrank, andere ganz abgemagert. Ihre dunkle Stirne und ein gutes Dutzend Glatzen blinken in der prallen Sonne und der Schatten verdeckt gänzlich ihre tief traurigen Augen.
Direkt hinter dem Fleischladen und näher bei der Wohnung der ehemaligen Postangestellten Kochu befindet sich ein halb versteckter Raum. Versteckt, denn er ist von der Hauptstrasse gar nicht zu sehen, wohl aber von der steilen Landstrasse. Auch vom Vorhof von Kochu. Hier werden die Ziegen und die Hühner in den frühen Morgenstunden geschlachtet, alltäglich ausser am Freitag, denn der Fleischladen und der Schlachthof gehören einem frommen Moslem, den man selten zu Gesicht bekommt. Das Klagelied der verängstigten Tiere hallt oft ganze Nächte lang. Nur Gewitter und heftige Regengüsse können das Geschrei je übertönen. Kochu glaubt, die Anklagen, Hilferufe und Flüche der Tiere trotz des Donners zu hören. Der Donner ist ein Klagelied aller gequälten Geschöpfe dieser Erde, davon ist Kochu überzeugt.
Ihre Eltern, Ashan und Aeli und ihr ältester Bruder, der General, sind längst gestorben. Ihre drei Schwestern sind etliche Jahre älter als sie, zwei davon leben eine Stunde entfernt, verarmt. Ihr liebster Bruder, Kunjunj, hat sie vor vierzig Jahren beim Schopf gepackt und aus dem gemeinsamen Elternhaus bis hin zum Fluss gezerrt. Er hat sie blutig geschlagen, fortgejagt und ihr die Rückkehr ins Haus ihrer gemeinsamen Eltern für immer verboten. Trotz der Bitte der erschöpften Mutter. Trotz dem Flehen ihres hilflosen Vaters. Was ihren herzlosen Bruder Kunjunj veranlasst hat, sie nach vierzig Jahren aufzusuchen, darüber kann sie nur rätseln. Vielleicht ist er, wie sie selbst, dem Tod geweiht.
Hat er etwa Krebs?
Mary, ihre ältere Schwester, die den anstehenden Besuch vermittelt hat, weiss von nichts. Es ist der Wunsch der Kleine Rose, sagte ihr Mary. Auch ihr ältester Sohn kommt mit.
Kochu freut sich.
Der älteste Sohn? Baby? Ich dachte er lebt im Ausland.
Doch, doch! Aber er ist im Moment da und wünscht sich ebenfalls, Dich wieder zu sehen.
Nach so vielen Jahren?
Für den heutigen Tag hat sie sich heraus geputzt. Nicht dass sie Wert auf Äusserlichkeiten legt. Aber so ein Besuch kommt nicht alle Tage vor. Vielleicht wird dies der wichtigste Tag ihres Lebens seit der Geburt ihres Sohnes vor bald vierzig Jahren. Jedenfalls, ist es der wichtigste Besuch ihres Lebens. Ein zurückgezogenes Leben. Die Augenlider hat sie mit tiefschwarzer Mascara etwas betont. Sie ist ganz in weiss gekleidet, dezent, einfach. Ein weisses Sari mit dunkelblauem Rand, dazu eine passende weisse Bluse. Baumwolle. Billig.
Soll sie sich wirklich freuen? Soll sie trauern? Als sie noch jung war, war sie vernarrt in Blumen, hat welche im Haar getragen. Roter Hibiscus, und Jasmineblüten, auch wilde Blumen, deren Namen sie nicht kannte. Für Blumen ist in ihrem Herzen kein Platz. Wozu Blumen? Wozu Farben?
Kochu lebt in der Obhut ihrer Schwiegertochter Daisy, Lehrerin einer nahen Privatschule. Die fünfunddreissig jährige junge Frau hat zwei kleine Kinder, beides Mädchen. Sie sind sieben und neun Jahre alt und häufig krank. So auch heute. Dennoch hat Daisy das Mittagessen für die ankommenden Verwandten vorbereitet, ihre Kinder aus dem Schlaf gerissen und in die Schule gebracht und Kochu versprochen über den Mittag nach Hause zu kommen, um auch noch den Reis zu kochen und alles aufzutischen und zu servieren, wie es angebracht ist.
Daisy ist schweigsam. Mit ihrem Hungerlohn, den ständigen Erkrankungen ihrer beiden Kinder und der jahrelangen Abwesenheit ihres Mannes ist sie völlig überfordert. Daisy ist erschöpft. Sie kauft ein, sie führt den Haushalt, sie hilft ihren Kindern bei ihren Hausaufgaben. Sie hat kaum Zeit für die Kinder. Kaum Zeit für sich. Keine Zeit für ihre eigensinnige Schwiegermutter Kochu. Auch kein bisschen Mitleid.
Manchmal glaubt Kochu, die junge Daisy hasst sie sogar. Aber was soll’s. Der Hass ihrer Schwiegertochter kann ihr nichts anhaben. Der Hass ist Kochus Schatten. Dabei wollte sie lieben. Nur einmal im Leben. Vielleicht auch nur an einem einzigen Tag. Ohne Wenn und Aber.
Aber dieser Traum ist für immer verträumt. Kochu kennt nur noch Albträume, die immer wiederkehren. Dunkler Wald. Kräftige Arme. Die Atemnot.
Und Blut.
Sie ist, wie sie selbst glaubt, eine blutende Ziege, mit weit aufgerissenen Augen, gehäutet und ausgenommen, mit dem Kopf nach unten gehängt. Eine tote, lebende Ziege.
Auch so stehen Bäume aufrecht. Auch so wird sie von Albträumen geplagt.
Was wenn der Bruder Krebs hat? Und nicht viel länger zu leben hat? Soll sie ihm alles sagen? Kochu flüstert und führt Selbstgespräche.
Er ist bestimmt um die achtzig. Mary und Kuttipennu, ihre beiden Schwestern haben ihr immer wieder von ihm berichtet. Von seinen kaputten Lungen, von seinen Wutanfälle, von den vielen Jahren der Armut.
Dabei hat Kochu etwas mehr Glück gehabt. Sie war ein ganzes Leben lang Angestellte der Post, ein Unternehmen der Zentralregierung in Neu Delhi und zuletzt gar eine leitende Postbeamtin. Sie denkt an ihre Pension. Gott sei Dank!
Kochu freut sich, die Kleine Rose wieder zu sehen. Sie ist neugierig, was den Jungen betrifft. Ihren Bruder will sie ohne Groll empfangen. Sie kehrt in das Haus zurück und betrachtet den kleinen gedeckten Tisch. Die gerösteten Bananen und die gedämpften Moringa-Blüten schmecken fein, die fertiggekochte Fischcurry ist etwas scharf. Zu scharf? Ob ihr Bruder so viel Schärfe erträgt? Ob ihrer Schwägerin Rose dies gefällt? Und dem kleinen Jungen?
Klein? Baby, ihr Neffe muss etwas mehr als fünfzig sein, ein Mann in den besten Jahren. Wie wird er wohl aussehen? Wird er sie wohl wieder erkennen? Seine Tante mit dem knielangen welligen Haar? Mit der dünnen spitzigen Nase?
Kochu begibt sich wieder nach Aussen, blickt gebannt auf die Ebene, wo die schmale Landstrasse die geteerte Hauptstrasse berührt. Autos, Rikschas, Laster. Menschen, Menschenmassen, die vorüberziehen. Auch die Schlange der zwanghaften Säufer ist in Bewegung geraten. Die Alkoholsüchtigen schaukeln sich nach vorn, spucken herum, senken ihre Köpfe. Sie bleiben lange stehen und schaukeln sich nach vorne wieder.
Kochus Lungen pfeifen. Auch das Herz meldet sich mit einem seichten, leichten Stechen wieder. Mit ihrer linken Hand drückt sie heftig auf die tiefsitzenden Muskeln, hinter die letzte Rippe unter der noch jugendlich wirkenden Brust.
Warum besucht mich mein Bruder?
Sie blickt auf den weit entfernten Hügeln hinauf. Die Teeplantagen sind hellgrün, die breiten, unbeständigen Oberflächen der einzelnen Stauden sind von tiefdunklen Schatten umrissen. Wie samtgrüne Schuppen leuchten die Hügel von Wayanad. Tiefer unten und zwischen den Hügeln ragen einsam stehende, blütenbedeckte Bäume in den hellblauen Himmel empor. Hier und dort schleichen vereinzelt Wolken über das leuchtende Firmament, sie werfen Schatten, spenden hunderten von buntgekleideten Arbeiterinnen Trost in der brennenden Sonne.
Warum kommt er wohl?
Ein mächtiger breiter Felsen, vielleicht dreihundert Meter breit und zweihundert Meter hoch, ragt von einer dunkelgrünen Gebirgskette heraus, gewölbt wie der Leib eines gewaltigen Elefanten. Die hellgraue Wölbung erinnert sie an Koottu-Puzha, an die kleine Stadt, aufgebaut wie ein Nest in einem horizontalen Spalt halbwegs hoch auf einer Felswand. Kochu erinnert sich an das kleine Postamt, bei dem sie in jungen Jahren als Postangestellte diente. Als die einzige Angestellte.
Ihr Postamt war ein winziger Raum, zwei Meter breit, drei Meter lang. Es stand am Ende einer länglichen, mit Moos befallenen und mit Ziegelsteinen bedeckten Bruchbude. Es war ein Käfig mit einer einzigen Tür vorne, zu Strasse hin, und einem einzigen fünfzig Zentimeter lang und zehn Zentimeter hohen Spalt hinten, durch welche die Schlucht unterhalb des Postamts und die aus dem kleinen Fluss herausragenden Felsbrocken und die Bambuswälder am anderen Ufer zu sehen waren. Der kleine Sitzplatz vor der Tür war mit einer breiten gewellten Asbestplatte bedeckt, aber es gab weder Stühle noch Bänke dort, worauf man Platz hätte nehmen können. Auf einer mit porösen Laterite-Steinen errichteten Säule war ein knallroter Briefkasten angebracht und vor dem Käfig mit einem vergitterten Schalter wurde ein gelbes Schild befestigt, das „Postamt“ liess.
Soll sie ihren Bruder an das verfluchte Postamt erinnern?
Immer wieder blickt sie hinauf zur Strasse. Die Schlange der Süchtigen schleicht sich nach vorn, die vorderen Greise und Glatzköpfe verschwinden, andere rücken ihnen unentwegt nach. Hinter dem Metzgerladen sammeln Hirten und Händler noch ein Dutzend Ziegen und einige wenige Schafe zur Erlösung.
Kochu schreckt sich an den Gedanken: Die guten Hirten und ihre ahnungslosen Schafe! Warum braucht es Blut zur Erlösung? Warum liebt Gott Blut?
Ihr Herz rast. Auch ihre Gedanken. Der Albtraum kehrt wieder.
Sie verlässt wie gewohnt die mit Strohdach bedeckte Lehmhütte Ashans, verlässt den bloss nur einen Fussbreiten Pfad unter wild gewachsenen Cashew-Bäumen und erreicht einen etwas breiteren Gehweg, der von dem neu gegründeten Dorf bis nach Koottu-Puzha führt. Nebst der länglichen Scheune, die sowohl als Schule als auch als Kirchgebäude dient, stehen ein paar kleine Läden. Weit und breit keine Häuser, keine Menschen. Links und rechts nur Wald. Der Weg führt sie entlang des Flusses, der zu ihrer Rechten etwas tiefer liegt. Er schlängelt sich nach Westen, nach Koottu-Puzha. Ihr Blick streift über vom Wind und Regen polierte Felsbrocken, über weissen Sand und blühende Sträucher. Ein unberührter Fluss mit kristallklarem Wasser, kleinen, grünen Inseln und bunten Kieselsteinen.
Alle hundert Meter sieht sie eine Hütte, ein kleines Haus, etwas Rauch aus der Küche. Manchmal begegnet sie einer Frau, eine aus dem neu gegründeten Dorf. Sie reden über ihre bunte Sari, über den Fluss, über ihren langen Fussmarsch zum Postamt, das bloss zwei Stunden vormittags und zwei Stunden nachmittags geöffnet ist. Sie sprechen über die gefährliche Strömung, durch sie sie jedes Mal waten muss, um an das andere Ufer und an die geteerte Strasse zu gelangen. Auch diese führt durch den Wald.
Der einsame, verfluchte Wald.
Anfänglich hat ihr Bruder Kunjunj sie bis zum Fluss begleitet, ihre Hand festgehalten, als sie den breit fliessenden Fluss überquerte. In den Sommermonaten konnte sie die seichten Gewässer mühelos durchwaten, sie konnte über die glitschigen Steine gehen, der oft starke Strömung trotzen. Aber mit dem zunehmendem Regen musste sie Risiken eingehen, bis der Fluss sich veränderte, sich gelb braun verfärbte und schäumte. Er war dann zehnmal breiter, auch tiefer. Er brachte tote Tiere und umgestürzte Bäume mit sich und Unmengen der roten aufgelösten Erde. In den Regenmonaten brachte der Fährmann Mahmmad, Kochu über den Fluss.
Der einsame, verfluchte Wald wurde noch dunkler, noch gefährlicher. Die Ureinwohner, halbnackt, dunkel, schweigsam, versteckten sich in den tief im Wald gelegenen Siedlungen. In Baumkronen. In Höhlen.
Aufgeregt blöken die Ziegen von nebenan. Sie sind hungrig, durstig und unruhig. Vielleicht riechen sie das noch triefende Blut ihrer Artgenossen? Vielleicht sind es die Federn der Hühner und Hähne, die der Wind über die ausgetrockneten Felder fegt und die Tiere in Angst und Schrecken versetzen? Vielleicht verängstigt sie Yama, der Gott des Todes, der über seine Herde wacht?
Ist er der „Gute Hirte“?
Kunjunju, ihrem Bruder will sie alles sagen. Sich mit ihm versöhnen. Sich von dieser Wald voller Monstern befreien.
Sie flüstert vor sich hin.
Lieber, unendlich lieber Bruder! Ich habe dich sehr enttäuscht. Auch meinen teuren Vater Ashan, meine geliebte Mutter. Ich habe Vasu vertraut. Ja, ich habe diesem Ungeheuer vertraut und euch verletzt. Verraten.
Bruder…
Kochu setzt sich in den Schatten des Mangobaums, faltet die Hände über den Kopf. Was soll sie ihrem Bruder sagen? Womit soll sie anfangen? Mit welchem Satz. Welchem Wort?
Vergib!
Vergib mir!
Vergib mir, lieber Bruder! Vergib mir, liebe Kleine Rose!
Lange schweigt sie und lauscht sie den Lärm der Strasse. Das Hupen und Fluchen. Das Geschrei und das Gackern. Inquilab Zindabad! Lang lebe die Revolution.
Lieber Bruder, erinnerst du dich? Dieser Vasu war bloss ein Hilfsangestellter. Ich habe ihm Zutritt zu dem kleinen Postamt gewährt. Er sortierte die Briefe. Brachte Telegramme zu den weit entlegenen Hügeln. Hin und wieder steckte er das Geld, das für einen ahnungslosen Empfänger bestimmt war, in die eigene Tasche. Für ein paar Tage bloss. Er war dem Alkohol verfallen. Stets brachte er das Geld zurück, um es in letzter Minute den rechtmässigen Empfängern zuzustellen. Aber manchmal gelang ihm dies nicht. Zur Not habe ich ihm dann Geld geliehen...Mein Geld. Unser Geld. Als Frau dürfte ich meinen Lohn nicht für mich behalten. Oder?
Kochu blickt auf ihre Uhr. Bald wird es Mittag. Wo bleiben sie?
Liebe Rose, glaub mir! Dieser Vasu verdiente wahrlich kein Mitleid. Er war kein Mensch. Stets wusste er, mich um den Finger zu wickeln. Er war gut aussehend. Hatte kräftige Arme. Aber keine Bildung. Und kein bisschen Menschlichkeit.
Mit der Zeit nahm er was er wollte. Er berührte mich…zunächst unauffällig, wie durch puren Zufall, unbeabsichtigt, wie ich glaubte. Aber dann….Dann wurde er mutiger. Er berührte mich, selbstsicher, zärtlich…. unsittlich.
Liebster Bruder…glaub mir. Bitte, glaub mir!
Ich wehrte mich. Mit Worten. Mit Gesten. Wieder mit Worten. Eines Tages presste er seinen Körper…seinen…an mich fest. Was hätte ich nun tun sollen? Mein Vater Ashan war weit weg, irgendwo, ein Kirchensklave ohne ein Dach über dem Kopf. Der General war irgendwo in den Himalayas. Wem hätte ich mich anvertrauen sollen?
Dir, lieber Bruder? Dir? Du warst ein Hitzkopf. Du hättest ihn niedergestochen. Du hättest seine Eingeweide mit blossen Händen herausgerissen. Dein Leben, das Leben der Kleinen Rose, euerer Kinder aufs Spiel gesetzt. Unser aller Leben. Du hättest ihn mit einer Machete zerstückelt, wenn Du es gewusst hättest!
Ich habe sodann einen Brief verfasst, einen ruhig verfassten sachlichen Brief und ihn meinem Vorgesetzten in Kannur persönlich ausgehändigt. Seine Zukunft war damit entschieden. Vasu wurde fristlos entlassen. Auf eine Anklage verzichtete der Postbeamte, vorausgesetzt, Vasu verschwinde aus meinem Leben. Für immer.
Und ich? Ich habe dieses Ungeheuer geheiratet. Ungeheuer!
Warum? Warum? Warum?
Ihr Mund ist ausgetrocknet. Sie fasst einen tief liegenden Ast des Mangobaums und richtet sich auf. Leicht gebückt geht sie in das heruntergekommene Haus hinein und schlürft mit Hilfe eines Kokoslöffels Wasser aus einem Tonkrug. Trinkwasser aus dem eigenen Brunnen, der ein Stück tiefer liegt als die Hauptstrasse, als der Metzgerladen und der versteckte, primitive Schlachthof.
Ist das Wasser mit dem Blut und dem Urin der Tiere verseucht? Mit Dung? Und wenn schon, wohin soll sie ziehen?
Als sie zum Vorhof zurückkehrt, schleppt sie einen rundlichen Stuhl mit sich und stellt ihn in den Schatten. Kochu setzt sich hin und nippt das lose Ende ihres hellblauen Saris. Ihr Haar wird allmählich grau. Ein paar Strähne flattern schräg nach unten über ihr Gesicht, von links nach rechts, über die stolze Nase. Die feinen Haare kleben sich fest auf der feuchten Wange und fallen hinunter über ihre makellos weisse Bluse. Sie muss sich beherrschen.
Stumme, sinnlose Tränen!
Liebster Bruder…Ich war endlich frei. Und unbesorgt. Du hast junge Männer ins Haus gebracht, sechszehn junge Männer, einen nach dem anderen. Du hast sie alle feierlich empfangen. Mit Festessen, mit Trank und Gebäck. Was für eine teure Brautschau! Wie sinnlos! Alle habe ich abgelehnt. Alle.
Ich wollte jemanden ehelichen, der mindestens die Sekundarschule besucht hatte. Unter den sechszehn waren es ein paar, gewiss. Erinnerst du dich? Einer lispelte. Der andere war mittellos. Ein dritter erschien mir sehr grob, haarig. Er hatte faule, dunkle Zähne. Einen üblen Schweissgestank!
Ich war bloss fünfundzwanzig. Ich dachte, ich habe Zeit.
Du hast mich zur Ehe gedrängt. Du wolltest mich loswerden. Ich sollte irgendjemanden nehmen. Irgendjemanden! Dann hättest Du den kleinen Grundstück Ashans zwischen Dir und dem General aufteilen können, ohne mir einen Antgeil geben zu müssen. Es ging Dir um …bloss um den Besitz.
Für dich war meine Entscheidung merkwürdig. Ein Akt des Ungehorsams. Ich habe einen eigenen Willen, Bruder! Ich hatte einen eigenen Willen. Hatte…ja, ich hatte. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Rose, du verstehst das.
Und du, mein Junge? Du bist ja weit gereist. Hast viele Länder gesehen. Andere Menschen und Sitten kennengelernt. Wir Frauen haben Rechte! Stimmt?
Ich war schwanger. Mit dem Kind dieses Ungeheuers. Und du liebster Bruder, hast mich aus der Familie verbannt. Ohne mich nur einmal anzuhören. Vasu war ein Unberührbarer, wir dagegen Christen. Auserwählt! Das war es. Dein barmherziger Gott liebt nur seine auserwählten Kinder.
Die Verbannung, das war der Preis der Freiheit.
Eine Nachbarin kehrt mit einer Flasche billigen Schnaps von der Hauptstrasse zu ihrer armseligen Hütte zurück, die noch weiter weg von der Stadtmitte und zu Füssen eines Hügels, nah bei den Teeplantagen liegt. Kalyani schwingt von einer Seite zu der anderen Seite. Sie trägt eine zerfetzte dunkelgrüne Sari. Ihr Oberkörper ist nackt, die verdorrten, hängenden Brüste sind mit dem Stoff nur teils bedeckt. Kalyani gehört zu den Ureinwohnern von Wayanad. Zur Adivasi. Ihre Söhne und Töchter leben im Wald, in armseligen Hütten, sie schuften sich zu Tode und betrinken sich zur Besinnungslosigkeit. Geregelte Arbeit ist ihnen fremd. Ein geregeltes Leben ist ihnen fremd. Auch der Konkurrenzkampf.
Du befindest dich genau an jener Stelle, wo ich dich vorhin gesehen habe als ich zum Alkoholladen ging. Woran denkst Du? Warum diese Unruhe? Bist du krank?
Meine beiden Enkelkinder sind krank. Fieber und Übelkeit. Auch mir geht es nicht gut, Kalyani.
Dein Sohn soll nicht mehr im Ausland schuften. Ich sage es ihm, wenn ich ihn wieder sehe. Wo ist er denn?
Wo denn? In Qatar. In Qatar. Wo denn sonst?
Zwei kränkliche Frauen, zwei kränkliche Kinder und kein Mann im Haus. Es ist eine Tragödie!
Das ist nicht schlimm. Gar nicht so schlimm, Kalayni!. Es ist ein Segen!
Na, also, wenn du meinst. Ich lass dich allein.
Qatar, Qatar,!
Flucht Kalayni.
Qatar, mein Arsch!
Kochu sieht Kalayani nach. Selig schaukelt sie vor sich hin. Wie alt ist sie? Fünfunddreissig? Vielleicht vierzig? Mit vierzig wirkt sie wie achtzig. Sie ist alt und abgenutzt. Ein paar Jahre hat sie noch. Die Adivasi sind schnell erwachsen. Mit zwölf oder dreizehn gebären sie Kinder. Nach zehn oder zwölf Geburten sind sie nur Haut und Knochen. Sie kauen Tabak, sie trinken viel, sie vermehren sich wie Karnickel. Die Ureinwohner sterben früh. Sie kennen weder Himmel noch Hölle. Der Alkohol ist ihr Trost.
Ich hätte trinken sollen. Früh sterben sollen.
Feige bin ich nicht. Nicht ich! Du flüchtest in die Religion. Umklammere den Sankt Sebastian mit all den Pfeilen in seiner Brust. Weine nur aus im Schoss der Heiligen Jungfrau. Wirf dein Geld, deinen Besitz in den Schoss der Mutter Kirche. Kaufe deinen Seelenfrieden mit den Tränen deiner Kinder! Wie erbärmlich!
Wie satanisch, so eine Kirche!
Hättest du mir nur einmal zugehört! Ich war im vierten Monat schwanger. Und du hast mich genau zum Ort meines Albtraums gezerrt. Genau dorthin, wo das Ungeheuer auf mich gelauert hat.
Weisst du wie bedrohlich, wie fruchterregend der Wald dort ist?
Mächtige Bäume umschlungen von seltenen, dichtgrünen Kletterpflanzen, mit Strängen so stark und so verbogen wie gigantische Pythons. Ein Wald überwuchert mit Dickicht voller Dornen. Dieser Wald war ist ein dunkles Königreich… mit Blutegeln, Skorpionen, Flughunden und Schlangen.
Du schwärmst von Bison. Von Hirschen und Wildschweinen. Du denkst an die Jagd. An Fleisch.
Ich war ängstlich. Der Weg, erst entlang des Gehwegs, rechts durch den Wald und dann, nach der Flussüberquerung, links, auf geteerter Strasse, durch dichteren Wald, dieser Weg war für mich eine Qual. Versetz dich an meine Stelle, vierzig Jahre zurück. Kein Mensch weit und breit. Nur der Regen. Der trommelnde Regen und der brüllende Fluss.
Vasu hat mir aufgelauert. Viele Tage. Viele Abende.
Oft war ich nicht ganz allein. Ab und zu gab es einen Nachbarn, eine Nachbarin, Menschen mit Provianten aus der kleinen Stadt Koottu-Puzha, die nach Kacheri Kadavu zurückkehrten. Manchmal waren es Jugendliche, Sekundarschüler auf dem Weg zurück nach Hause. Sie waren meine Schutzengel. Aber manchmal war ich ganz allein.
Matthy, Kera, Matthy…Sardinen! Sar….dinen…Sar…dinen.
Ein Mann schiebt seinen verrosteten Fahrrad und ruft, Sardienen…Kera, kera, Kera…Er hält mit dem Fahrrad und einem Korb aus Rattan vor dem Haus von Kochu. Sie drückt auf beide Knie und steht mühsam auf und bewegt sich zum Tor.
Was hast du?
Die Sardinen sind soeben eingetroffen. Ganz frisch. Sehen Sie?
Er nimmt eine Handvoll und hält sie vor ihre Augen. Die Fische sehen zwar frisch aus, die Kiemen sind aber mit tief dunklem Blut beschmiert. Von unter den spärlich angebrachten Eiswürfeln starren tote offene Augen.
Vermutlich mit Ammoniak behandelt!
Nein, nein. Alles ganz frisch.
Was noch?
Ich hab‘ Kera! Bester Thunfisch. Erste Qualität. Das hier geht gewöhnlich ins Ausland. Import.
Du meinst, Export?
Import-Export !
Oho! Und wie viel kostet dieser hier?
Vierhundertfünfzig, das Kilo.
Schwindler!
Vierhundert.
Ich feilsche nicht um den Preis. Aus Prinzip. Hören Sie, meine Schwiegertochter sollte jeden Moment da sein. Wenn Sie auf diesen Weg zurückkehren…dann vielleicht?
Also gut. Kera, Kera, Kera….Mathiye….Mathy. Mathiyee …Mathy. Er steigt auf das klapprige Gefährt und radelt los. Kochu blickt wieder zu Hauptstrasse hinauf.
Hinter dem kleinen Haus gackert eine Henne aufgeregt.
Iescho!
Kochu eilt nach Hinten, wo sich eine Henne mit ausgebreiteten Flügeln gegen einen grauweissen Greifvogel stellt. Der hungrige Jäger hat sich auf einen, zur Erde hin biegenden Ast einer Kokospalme gesetzt und beobachtet die alarmierte Henne und ihren zehn Tage alten Küken mit grösster Aufmerksamkeit. Kochu scheint ihn nicht aus der Fassung zu bringen. Sie nimmt einen Stein und schleudert diesen gegen den Vogel. Der Vogel stürzt nieder, wendet sich ab im allerletzten Augenblick. Kochu schreit mit aller Kraft.
Schoo! Schoooo…Verschwinde!
Sie nimmt einen zweiten Stein in die Hand und noch bevor sie ihn gegen den Vogel schleudern kann, fliegt der einsame Jäger fort.
Kochu lässt den Stein fallen und betrachtet ihre Hände. Sie sind zart und knochendürr. Harte körperliche Arbeit ist ihr, war ihr fremd. Ihre Hände sind schwach, sie waren schwach. Wie hätte sie sich wehren können?
Liebster Bruder…Ich habe dir nichts zu sagen. Ich mache dir auch keine Vorwürfe. Ich bin eine Frau. Ich muss schweigen. Ich werde schweigen.
Kochu kehrt ins Haus und setzt sich vor ihren kleinen Schreibtisch. Mit grösster Mühe öffnet sie eine Schublade, nimmt einen Zettel und einen Füller, streift über das leicht gebogene unlinierte Blatt.
Lieber Junge, mein lieber Junge, Baby, wir sind verwandt, doch. Jedoch… Fremde sind wir. Wie du vielleicht weiss, hat dein Vater, mein liebster Bruder, mich aus unserem gemeinsamen Elternhaus gezerrt…mich verstossen. Als ich dann im siebten Monat schwanger war, hat er zusammen mit dem General, mit meinen zwei Schwägern, mich gezwungen, den Mann zu ehelichen, der mich vernichtet hat. Ich bin nicht mehr Kochu, nur ihr Schatten. Kochu ist vor vielen Jahren gestorben. Vor vielen, vielen Jahren.
Wie bin ich gestorben?
Ich war stets schwach, kränklich. Ich hatte lange dünne Arme. Nutzlose Arme. Und einen eisernen Willen. Verstehst du? Du bist, wie ich höre, weit gereist. Du bist Menschen begegnet, bist unter Ihnen aufgewachsen. Menschen mit Bildung und Anstand und Kultur. Ich jedoch bin ich unter Bestien gross geworden…Unter blutrünstigen Menschen.
Ich habe einen Sohn. Er schuftet irgendwo. Ich vermisse ihn nicht. Gar nicht. Überrascht dich das? Ich fürchte den Tag, wenn er zu mir kommt. Ich will ihn nicht sehen. Wäre ich blind, hätte ich ihn vielleicht lieben können. Wäre ich nur blind!
Nein, er hat mir nicht wehgetan. Nie. Nur, ich bin schwach. Mein Sohn erschreckt mich. Mit seinen Händen. Mit seiner Stimme. Er kann nichts dafür. In seinem Gesicht sehe ich seinen Vater Vasu wieder. Ich sehe einen Mann, den ich nie liebte, nie lieben konnte. Ich sehe das Ungeheuer, das mich ruiniert hat. Ich sehe seine Hände, seine Augen, sein Hass erfülltes Gesicht.
Was mir widerfahren ist? So etwas geschieht alle Tage. Tausendfach. Stell dir vor!
Seit vierzig Jahren schweige ich. Mein Sohn ahnt nichts. Auch Daisy nicht. Sie halten mich für ein bisschen verrückt. Eigenwillig. Sonderlich. Und dein Vater?
Er glaubt, ich habe diesen Vasu geliebt. Er glaubt, ich habe unsere ehrbare christliche Familie in den Dreck gezogen. Dein Vater denkt: Wie konnte sie nur einen Hindu lieben? Einen Unberührbaren? Einen Dreckskerl?
Sag deinem Vater nichts davon. Auch der Kleinen Rose nicht. Lass sie glauben, was sie glauben wollen. Aber du, mein Junge, mein liebster Junge, Du sollst wissen, was geschehen ist. …Was wirklich geschehen ist.
Dieser Wald…Dieser von Dämonen besetzter Wald.
Was Kochu anschliessend schreibt ist mit ihrenTränen genetzt. Sie schreibt über ihre spindeldürren Arme, ihre Schreie, die niemand hört, ihre zarte von Dornen geritzte Haut. Sie schreibt lose Wörter, ohne Zusammenhang: Verwirrung, Nachhall, Ohnmacht.
Sie schreibt… Nirbhaya.
Nirbhaya, die junge Medizinstudentin, die nach einem Kinobesuch in Delhi am sechszehnten Dezember 2012 von sechs Männern im fahrenden Bus vor den Augen ihres Freundes vergewaltigt und gefoltert wird.
Nirbhaya, die Furchtlose. Nirbhaya, deren Vergewaltigung und Tod friedliche, überwältigende Proteste auslöst und Millionen, ja, ein ganzes Land in Aufruhr versetzt.
Nirbhaya, die Angst besiegt und das Schweigen Millionen gequälter Mädchen und Frauen bricht.
Ich bin kein Nirbhaya. Ich war ängstlich. Ängstlich bin ich noch heute.
Das Brummen eines Fahrzeugs lockt sie nach vorne. Kochu faltet das Blatt mehrmals, versteckt es in ihrer Bluse, oberhalb ihrer linken Brust, unter den Falten ihrer Sari. Sie begibt sich zum Vorhof und hält sich an einem Ast des Mangobaums fest. Atemlos betrachtet sie, wie ihr Bruder aus dem Auto heraus steigt. Seine tiefschwarze Lockenpracht ist gänzlich verschwunden, stellt sie fest. Stattdessen schimmern wenige seidenweisse Strähne oberhalb seiner markanten, breiten Stirn. Seine Arme sind lang und kräftig, sein Körper leicht gebückt. Als er auf sie zukommt, füllen sich ihre Augen mit Tränen, ihr Atem stockt.
Sie fällt ihm in die Arme. Er umarmt sie zärtlich. Ihm fehlen die Worte.
Eine Minute lang stehen sie versteinert vor dem kleinen verlotterten Haus. Dann traut sich die Kleine Rose, sich Kochu zu nähern und ihre rechte Hand in ihre beiden Hände zu nehmen. Rose drückt sie fest. Kochu löst sich von ihrem Bruder und wendet sich an die Kleine Rose.
Ente ponnu Nathooney! Liebste Schwägerin. Kochu schluchzt wie ein Kind.
Tante!
Kochu sieht mich an. Erschrocken sieht sie mich einen Moment an. Sie umarmt mich und streichelt mein welliges Haar. Bist du es wirklich? Bist du es mein Junge? Deine Augen sind mir vertraut…diese langen, grossen Augen. Oh mein Junge, ich hätte dich nicht erkannt. Nein. Wie viele Jahre trennen uns?
Kommt herein! Kommt!
Wie du siehst, lebe ich allein.
Lebst du ganz allein, Tante?
Na, ja! Die Frau meines Sohnes kommt bald. Wie viel Uhr ist es?
Sie wischt ihre Tränen weg und schaut auf ihre Uhr.
Es ist zehn nach eins, Tante.
Sie sollte jede Minute eintreffen. Bitte setzt euch. Ihr habt bestimmt Durst…und Hunger. Wollt ihr, dass ich den Deckenventilator einschalte? Er macht einen fürchterlichen Krach.
Setz dich, Kochu. Setz dich hierhin. Wir brauchen den Ventilator nicht. Es war kühl im Auto, fast zu kühl für mich. Hier in Wayanad ist es angenehm. Komm hier.
Die Kleine Rose nimmt Tante Kochu bei der Hand und lässt sie zwischen Vater und sich Platz nehmen.
Habt ihr den Weg leicht gefunden? Fragt sie ihren Bruder. Er nimmt erneut ihre Hand und nickt. Er hört ihre Lungen pfeifen.
Was hast Du?
Du weisst, ich hatte die Tuberkulose. Dieses stetige Pfeifen ist aber neu. Seitdem Vasu gestorben ist, höre ich es.
Woran ist Vasu gestorben?
Will Mutter Rose wissen.
Krebs. Wir brachten ihn in ein Zentrum für …ja…ich hab’s… Ein Zentrum für Palliativmedizin. Er war fast fünf Jahre dort. Ich hatte aber keinen Kontakt mehr zu meinem Mann.
Verwundert sehe ich meine Tante Kochu an.
Eine junge Frau kommt ins Haus und nimmt die Hand meiner Mutter.
Ammayi, willkommen!
Du bist Daisy, nicht wahr?
Am Nachmittag konnte ich frei kriegen. Es gibt nur wenige Lehrer, die mein Fach unterrichten. Habt ihr alle etwas zu trinken bekommen?
Was unterrichtest du, Daisy?
Wirtschaft. Ja und Computer.
Während sie das Reis kocht, wärmt Daisy die vorgefertigte Bananen- und Moringablüten kurz auf. Aus dem Kühlschrank holt sie zwei Sorten Chutneys und stellt alles auf den Tisch. Meine Eltern waschen sich die Hände. Kochu reicht ihnen ein weisses, sauber gefaltetes Tuch.
Meine Eltern und ich nehmen am Tisch Platz.
Tante, bitte setz Dich. Iss mit uns!
Ich habe keinen Hunger. Wirklich! Esst ihr. Ich hoffe, es ist nicht zu scharf für dich.
Während wir essen, streichelt sie mein Haar, reicht mir dies und das.
Kocht ihr auch Reis und Curry und Moringa-Blüten?
Ich liebe diese weissen Blüten. Ich habe sie viele Jahre nicht mehr gegessen. Seit dem ich Koottu-Puzha verlassen habe. Ich habe zwar die Früchte des Meerrettichbaums in ein paar exotischen Läden gesehen…aber die Blüten…nein, Tante.
Das graue Betondach speichert die Hitze der Sonne und strahlt sie über unsere Köpfe. So setzen wir uns im Schatten des Mangobaums für eine Weile und warten, dass Daisy etwas isst und sich uns anschliesst. Niemand will reden. So betrachten wir die fernen Hügeln und den langsam sich verdunkelnden Himmel.
Vater schweigt. Eisern. Er zündet seine grässliche Beedie an und raucht, seelenruhig. Bald erleidet er einen Hustenanfall, der lange andauert. Irgendwann beruhigt er sich, bückt sich nach vorne und liest ein Dutzend Kieselseine auf. Vielleicht will er etwas sagen, vielleicht auch nicht. Wo soll er beginnen? Wie soll er eine Frau, seiner um Jahre jüngeren Schwester, um Vergebung bitten? Und wofür? Er wirft die kleineren Steine weg, behält drei davon, er jongliert wie ein Kind. Warum die Bürden der Vergangenheit in Erinnerung rufen? Warum alte Wunden aufreissen? Was nützen wohl Worte?
Vielleicht habe ich Fehler gemacht. Vielleicht. Ich bin bald achtzig. Ich bin ein Mann. Und viel älter als sie. Unser Vater Ashan hat die Familie im Stich gelassen. Ich habe mich um dich gekümmert. Ich! Habe dir Kleider gekauft, das Essen besorgt. Deine Stelle beim Postamt. Zuletzt warst Du eine leitende Postbeamtin. Du erhältst eine staatliche Pension! Ich dagegen habe nichts! Nichts! Ich habe meine Gesundheit ruiniert. Auch deinetwegen! Ich habe mich zu Tode geschuftet. Um dir eine Sari zu kaufen habe ich meinen Kinder Kleidern verweigert. Weisst du, was es bedeutet, in der prallen Sonne zu stehen? Was es bedeutet, mit einem Beil Steine auszureissen? Mit einer Axt Bäume zu fällen? Einen Wald urbar zu machen? Mit blossen Händen den Boden zu ebnen? Schau dir meine Hände an!
Er lässt die Kieselsteine zu Boden fallen und betrachtet seine rauen Hände.
Kochu betrachtet ihren Bruder. Bald verliert sie jegliches Interesse an ihm, an seinem hilflosen Trauerspiel. Ihre Augen schweifen über die fernen Hügel und ruhen auf einem prächtigen Baum, mit einer purpurnen Blumenpracht. Ab und zu sieht sie die Kleine Rose an, dann mich und seufzt. Warum soll sie ihren Bruder ansprechen? Was nutzt eine Anklage? Wie soll sie ihren eigenen Willen rechtfertigen? Und was hat sie im Leben falsch gemacht? Wofür sich entschuldigen? Mit fünfundzwanzig wollte sie nicht in die Ehe, niemand um den Hals haben. Na und? Ist das nicht ihr gutes Recht? Ihre Eltern, aber auch ihr Bruder Kunjunj wussten, dass sie Vasu nicht liebte. Er hat ihr Unrecht angetan. Er. Er soll reden, wenn er will. Wozu ist er überhaupt her gekommen?
Ich bin aus Fleisch und Blut. Ich bin ein Mensch. Ich bin eine Frau. Ich bin nicht eine armselige Kreatur, die man abschlachtet und ausstellt. Einfach so! Ich mag dünne Arme haben, einen verwelkten Körper. Ich bin zwar nur Haut und Knochen, aber ich habe meinen Stolz. Ich bin im strömenden Regen zur Schule gegangen. In Fetzen. Ohne Bücher, ohne Schuhe, ohne Schirme. Wie oft habe ich mein Leben aufs Spiel gesetzt und den geschwollenen brüllenden Fluss überquert, um in das einsame Postamt zu gelangen? Wie viele Kriege habe ich mit Mitarbeitern und Vorgesetzten geführt, um mich zu behaupten? In einer Welt der Männer! In einer Welt, die uns Frauen mit Erniedrigung und Verachtung und Gewalt belohnt? Mit dem Tod? Es gibt Erinnerungen, die nie verblassen. Wut, die nie verglüht. Stolz, ja Stolz, der nie nachgibt.
Ein Krieg ohne Worte. Das Schweigen als Waffe. Ein zeitloser Krieg.
Was geschehen ist, ist geschehen. Ihr seid Bruder und Schwester! Ihr solltet miteinander reden!
Die Kleine Rose spricht energisch. Bestimmt. Sie sieht Vater fragend an. Vater schweigt. Auch Tante Kochu.
Tante, willst Du nicht mit uns kommen?
Als das Schweigen unerträglich wird, frage ich Tante Kochu.
Für ein paar Tage, Tante?
Wie denn Junge? Ich kann unmöglich Daisy mit zwei kleinen Kindern allein lassen.
Kochu, komm doch mit uns. Wir haben viel Platz im Auto. Komm mit uns. Und nach ein paar Tagen begleite ich dich hierhin zurück.
Nathune…Rose, ich kann unmöglich hier weg.
Komm doch mit uns, Kochu. Baby bleibt mit uns noch zehn Tage.
Mutter fleht Kochu an.
Vielleicht ein anderes Mal, Rose. Ich bin gar nicht vorbereitet. Meine Kleider. Medizin. Wenn Daisy und die Kinder Schulferien haben und sie zu ihren Eltern gehen will… Vielleicht dann.
Ein leichtes Donnergrollen setzt Vater in Unruhe. Er steht auf und will nun gehen. Es fällt ihm schwer, das Schweigen seiner Schwester Kochu zu ertragen. Auch er findet keine Worte. Er zündet eine Beedie an und qualmt, zieht den giftigen Rauch ein und hustet. Resigniert steht auch die Kleine Rose auf.
Daisy, Kommst du mal mit den Kindern? Und bring Kochu bitte mit. Unbedingt!
Ja, Ammayi. Ich besuche euch gern.
Schade, dass wir deine Kinder nicht sehen konnten.
Es wird fünf, bis sie zu Hause sind.
Wiedersehen!
Vater und Mutter steigen ins Auto.
Fährt ihr doch vor! Es ist zwar kurz, aber ein steiler Aufstieg. Ich komme zu Fuss bis zur Hauptstrasse. Ja, fahr doch!
Wiedersehen, Daisy!
Wiedersehen…Babychetta.
Als die weisse Grossraumlimousine wegrollt, bleiben Tante Kochu und ich einige Schritte zurück. Als der Staub sich legt, gehen wir die schmale Verbindungsstrasse hinauf. Tante Kochu nimmt das gefaltete Blatt von den Falten ihrer Bluse und drückt sie in meine Hand.
Lies ihn, wenn du allein bist. Wenn du ganz allein bist.
Tante…komm mit mir. Bleib so lange Du willst. Rede mit Vater.
Junge, du weisst es…Der Mensch hofft und vergibt und liebt. Dennoch…dennoch…es gibt Wunden, die nie heilen.
Ich umarme sie, spüre den herausragenden Knochen am Rücken mit meiner Hand, spüre ihre zarte Haut, ihre Tränen auf meiner Brust. Ich wische ihr die triefende pechschwarze Mascara vom Gesicht, küsse sie sanft auf die feuchte Wange und gehe die letzten paar Schritte zur Hauptstrasse hinauf. Die Alkoholsüchtigen starren mich an, fast feindselig, ich bin für sie ein Fremder. Oben bei der geteerten Strasse angekommen, bleibe ich einen Moment stehen und lausche dem Donnerknall. Als ich ins Auto einsteige fallen die ersten Regentropfen. Sie sind gross, wuchtig, schmerzlich. Durch die verschmierte Fensterscheibe sehe ich Tante Kochu allein am Wegrand ausharren, ihr Blick nach unten gerichtet, still, neben den stummen Ziegen.
tumme Ziegen
Kochu steht gebückt auf dem kleinen Vorhof ihrer bescheidenen zwei Zimmer Behausung und kämpft mit dem Atem. Mit dem roten Staub, dem Rauch und dem Geruch vom Blut. Wenn sie ein- und ausatmet pfeift sie leise, unkontrolliert. Ab und zu spürt sie auch ein leichtes Stechen in der Herzgegend, wo genau, weiss sie selbst nicht. Der bärtige Arzt, den sie kurz nach der Pensionierung aufgesucht hatte, sagte ihr, es sei nichts mehr zu machen, nicht mit den finanziellen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen. Mit ihrer bescheidenen Pension. Ausser dem kleinen vergrauten, verfallenen Haus, das nach dem Bau vor bald zwanzig Jahren nie wieder bemalt oder instand gesetzt wurde, hat sie nichts. Ihr einziger Sohn, der verhasste Sohn, befindet sich im Ausland. Er ist ein Billiglohnarbeiter in der Wüste von Qatar, ein moderner Sklave, wie so viele Hunderttausende aus dem ah! so fortschrittlichen Bundesstaat Kerala.
Kochu hat niemand. Niemand, den sie liebt. Niemand, der sie liebt.
Aufgeregt blickt sie immer wieder die kleine Landstrasse hinauf. Sie führt zu einer geteerten Hauptstrasse, die die wenig bekannte Stadt Mananthawadi in den Bergen mit der etwas bekannteren Küstenstadt Calicut, verbindet. Bekannt deshalb, weil der Portugiese Vasco Da Gama im Jahr 1492 auf der Suche nach Indien just hierhin verirrt und an Land gegangen war. Zur linken Seite der schmalen Landstrasse, wo diese in die Hauptstrasse mündet, steht ein Fleischladen, dessen vordere Seite mit gehäuteten, ausgenommenen und mit dem Kopf nach unten gehängten Ziegen, gerupften Hühnern und Gockel blutig geschmückt ist. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich der staatlich sanktionierte Alkoholladen. Vor dem mit verrostetem Metall gänzlich vergitterten Laden und entlang der schmalen namenslosen Verbindungsstrasse stehen verarmte, arbeitslose Männer, ein paar verwahrloste Frauen dazu und warten sehnlichst auf Erlösung.
Hühner. Ziegen. Menschen. Verdammt in aller Ewigkeit. Kochu führt Selbstgespräche.
Die Menschenschlange ist heute besonders lang, denn der Wochentag fällt zwischen einen Feiertag und einen Streiktag, was so viel bedeutet wie Zwangsschliessung aller Läden, Behinderung aller Transport und offener Konfrontation zwischen militanten politischen Gegnern. Gewalt und Stillstand. Die Menschen müssen sich reichlich mit Alkohol eindecken, denn die meisten sind dem, mit dreihundert Prozent Steuern belegten Elixier ganz verfallen, unheilbar süchtig. Sie sind ungepflegt. Ihre Häute sind runzelig, die Zähne verfault. Sie fristen ein sinnloses Dasein in einem Land, das jedes Unternehmertum mit dem Ruf nach Revolution und blinder Gewalt unterbindet und die Jugend so in die Sklaverei treibt. Nieder mit dem Kapitalismus! Es lebe die Diktatur des Proletariats! Neue Sklaven braucht das Land, für den Mittleren Osten.
Wer zurückbleibt, lebt von der Güte der Wanderarbeiter oder verfällt dem diskreten Charme des Alkohols. Die Meisten, die hier anwesend sind, sind dick und zuckerkrank, andere ganz abgemagert. Ihre dunkle Stirne und ein gutes Dutzend Glatzen blinken in der prallen Sonne und der Schatten verdeckt gänzlich ihre tief traurigen Augen.
Direkt hinter dem Fleischladen und näher bei der Wohnung der ehemaligen Postangestellten Kochu befindet sich ein halb versteckter Raum. Versteckt, denn er ist von der Hauptstrasse gar nicht zu sehen, wohl aber von der steilen Landstrasse. Auch vom Vorhof von Kochu. Hier werden die Ziegen und die Hühner in den frühen Morgenstunden geschlachtet, alltäglich ausser am Freitag, denn der Fleischladen und der Schlachthof gehören einem frommen Moslem, den man selten zu Gesicht bekommt. Das Klagelied der verängstigten Tiere hallt oft ganze Nächte lang. Nur Gewitter und heftige Regengüsse können das Geschrei je übertönen. Kochu glaubt, die Anklagen, Hilferufe und Flüche der Tiere trotz des Donners zu hören. Der Donner ist ein Klagelied aller gequälten Geschöpfe dieser Erde, davon ist Kochu überzeugt.
Ihre Eltern, Ashan und Aeli und ihr ältester Bruder, der General, sind längst gestorben. Ihre drei Schwestern sind etliche Jahre älter als sie, zwei davon leben eine Stunde entfernt, verarmt. Ihr liebster Bruder, Kunjunj, hat sie vor vierzig Jahren beim Schopf gepackt und aus dem gemeinsamen Elternhaus bis hin zum Fluss gezerrt. Er hat sie blutig geschlagen, fortgejagt und ihr die Rückkehr ins Haus ihrer gemeinsamen Eltern für immer verboten. Trotz der Bitte der erschöpften Mutter. Trotz dem Flehen ihres hilflosen Vaters. Was ihren herzlosen Bruder Kunjunj veranlasst hat, sie nach vierzig Jahren aufzusuchen, darüber kann sie nur rätseln. Vielleicht ist er, wie sie selbst, dem Tod geweiht.
Hat er etwa Krebs?
Mary, ihre ältere Schwester, die den anstehenden Besuch vermittelt hat, weiss von nichts. Es ist der Wunsch der Kleine Rose, sagte ihr Mary. Auch ihr ältester Sohn kommt mit.
Kochu freut sich.
Der älteste Sohn? Baby? Ich dachte er lebt im Ausland.
Doch, doch! Aber er ist im Moment da und wünscht sich ebenfalls, Dich wieder zu sehen.
Nach so vielen Jahren?
Für den heutigen Tag hat sie sich heraus geputzt. Nicht das sie Wert auf Äusserlichkeiten legt. Aber so ein Besuch kommt nicht aller Tage vor. Vielleicht wird dies der wichtigste Tag ihres Lebens seit der Geburt ihres Sohnes vor bald vierzig Jahren. Jedenfalls, ist es der wichtigste Besuch ihres Lebens. Ein zurückgezogenes Leben. Die Augenlider hat sie mit tiefschwarzer Mascara etwas betont. Sie ist ganz in weiss gekleidet, dezent, einfach. Ein weisses Sari mit dunkelblauer Rand, dazu eine passende weisse Bluse. Baumwolle. Billig.
Soll sie sich wirklich freuen? Soll sie trauern? Als sie noch jung war, war sie vernarrt in Blumen, haben welche im Haar getragen. Roter Hibiscus, und Jasmineblüten, auch wilde Blumen, deren Namen sie nicht kannte. Für Blumen sind in ihrem Herzen keinen Platz. Wozu Blumen? Wozu Farben?
Kochu lebt in der Obhut ihrer Schwiegertochter Daisy, Lehrerin einer nahen Privatschule. Die fünfunddreissig jährige junge Frau hat zwei kleine Kinder, beides Mädchen. Sie sind sieben und neun Jahre alt und häufig krank. So auch heute. Dennoch hat Daisy das Mittagessen für die ankommenden Verwandten vorbereitet, ihre Kinder aus dem Schlaf gerissen und in die Schule gebracht und Kochu versprochen über den Mittag nach Hause zu kommen, um auch noch den Reis zu kochen und alles aufzutischen und zu servieren, wie es angebracht ist.
Daisy ist schweigsam. Mit ihrem Hungerlohn, der ständigen Erkrankungen ihrer beiden Kinder und der jahrelangen Abwesenheit ihres Mannes ist sie völlig überfordert. Daisy ist erschöpft. Sie kauft ein, sie führt den Haushalt, sie hilft ihren Kindern bei ihren Hausaufgaben. Sie hat kaum Zeit für die Kinder. Kaum Zeit für sich. Keine Zeit für ihre eigensinnige Schwiegermutter Kochu. Auch kein bisschen Mitleid.
Manchmal glaubt Kochu, die junge Daisy hasst sie sogar. Aber was soll’s. Der Hass ihrer Schwiegertochter kann ihr nichts anhaben. Der Hass ist Kochus Schatten. Dabei wollte sie lieben. Nur einmal im Leben. Vielleicht auch nur an einem einzigen Tag. Ohne Wenn und Aber.
Aber dieser Traum ist für immer verträumt. Kochu kennt nur noch Albträume, die immer wiederkehren. Dunkler Wald. Kräftige Arme. Die Atemnot.
Und Blut.
Sie ist, wie sie selbst glaubt, eine blutende Ziege, mit weit aufgerissenen Augen, gehäutet und ausgenommen, mit dem Kopf nach unten gehängt. Eine tote, lebende Ziege.
Auch so stehen Bäume aufrecht. Auch so wird sie von Albträumen geplagt.
Was wenn der Bruder Krebs hat? Und nicht viel länger zu leben hat? Soll sie ihm alles sagen? Kochu flüstert und führt Selbstgespräche.
Er ist bestimmt um die achtzig. Mary und Kuttipennu, ihre beiden Schwestern haben ihr immer wieder von ihm berichtet. Von seinen kaputten Lungen, von seinen Wutanfälle, von den vielen Jahren der Armut.
Dabei hat Kochu etwas mehr Glück gehabt. Sie war ein ganzes Leben lang Angestellte der Post, ein Unternehmen der Zentralregierung in Neu Delhi und zuletzt gar eine leitende Postbeamtin. Sie denkt an ihre Pension. Gott sei Dank!
Kochu freut sich, die Kleine Rose wieder zu sehen. Sie ist neugierig, was den Jungen betrifft. Ihren Bruder will sie ohne Groll empfangen. Sie kehrt in das Haus zurück und betrachtet den kleinen gedeckten Tisch. Die gerösteten Bananen und die gedämpften Moringa-Blüten schmecken fein, die fertiggekochte Fischcurry ist etwas scharf. Zu scharf? Ob ihr Bruder so viel Schärfe erträgt? Ob ihrer Schwägerin Rose dies gefällt? Und dem kleinen Jungen?
Klein? Baby, ihr Neffe muss etwas mehr als fünfzig sein, ein Mann in den besten Jahren. Wie wird er wohl aussehen? Wird er sie wohl wieder erkennen? Seine Tante mit dem knielangen welligen Haar? Mit der dünnen spitzigen Nase?
Kochu begibt sich wieder nach Aussen, blickt gebannt auf die Ebene, wo die schmale Landstrasse die geteerte Hauptstrasse berührt. Autos, Rikschas, Laster. Menschen, Menschenmassen, die vorüberziehen. Auch die Schlange der zwanghaften Säufer ist in Bewegung geraten. Die Alkoholsüchtigen schaukeln sich nach vorn, spucken herum, senken ihre Köpfe. Sie bleiben lange stehen und schaukeln sich nach vorne wieder.
Kochus Lungen pfeifen. Auch das Herz meldet sich mit einem seichten, leichten Stechen wieder. Mit ihrer linken Hand drückt sie heftig auf die tiefsitzenden Muskeln, hinter die letzte Rippe unter der noch jugendlich wirkenden Brust.
Warum besucht mich mein Bruder?
Sie blickt auf den weit entfernten Hügeln hinauf. Die Teeplantagen sind hellgrün, die breiten, unbeständigen Oberflächen der einzelnen Stauden sind von tiefdunklen Schatten umrissen. Wie samtgrüne Schuppen leuchten die Hügel von Wayanad. Tiefer unten und zwischen den Hügeln ragen einsam stehende, blütenbedeckte Bäume in den hellblauen Himmel empor. Hier und dort schleichen vereinzelt Wolken über das leuchtende Firmament, sie werfen Schatten, spenden hunderten von buntgekleideten Arbeiterinnen Trost in der brennenden Sonne.
Warum kommt er wohl?
Ein mächtiger breiter Felsen, vielleicht dreihundert Meter breit und zweihundert Meter hoch, ragt von einer dunkelgrünen Gebirgskette heraus, gewölbt wie der Leib eines gewaltigen Elefanten. Die hellgraue Wölbung erinnert sie an Koottu-Puzha, an die kleine Stadt, aufgebaut wie ein Nest in einem horizontalen Spalt halbwegs hoch auf einer Felswand. Kochu erinnert sich an das kleine Postamt, bei dem sie in jungen Jahren als Postangestellte diente. Als die einzige Angestellte.
Ihr Postamt war ein winziger Raum, zwei Meter breit, drei Meter lang. Es stand am Ende einer länglichen, mit Moos befallenen und mit Ziegelsteinen bedeckten Bruchbude. Es war ein Käfig mit einer einzigen Tür vorne, zu Strasse hin, und einem einzigen fünfzig Zentimeter lang und zehn Zentimeter hohen Spalt hinten, durch welche die Schlucht unterhalb des Postamts und die aus dem kleinen Fluss herausragenden Felsbrocken und die Bambuswälder am anderen Ufer zu sehen waren. Der kleine Sitzplatz vor der Tür war mit einer breiten gewellten Asbestplatte bedeckt, aber es gab weder Stühle noch Bänke dort, worauf man Platz hätte nehmen können. Auf einer mit porösen Laterite-Steinen errichteten Säule war ein knallroter Briefkasten angebracht und vor dem Käfig mit einem vergitterten Schalter wurde ein gelbes Schild befestigt, das „Postamt“ liess.
Soll sie ihren Bruder an das verfluchte Postamt erinnern?
Immer wieder blickt sie hinauf zur Strasse. Die Schlange der Süchtigen schleicht sich nach vorn, die vorderen Greise und Glatzköpfe verschwinden, andere rücken ihnen unentwegt nach. Hinter dem Metzgerladen sammeln Hirten und Händler noch ein Dutzend Ziegen und einige wenige Schafe zur Erlösung.
Kochu schreckt sich an den Gedanken: Die guten Hirten und ihre ahnungslosen Schafe! Warum braucht es Blut zur Erlösung? Warum liebt Gott Blut?
Ihr Herz rast. Auch ihre Gedanken. Der Albtraum kehrt wieder.
Sie verlässt wie gewohnt die mit Strohdach bedeckte Lehmhütte Ashans, verlässt den bloss nur einen Fussbreiten Pfad unter wild gewachsenen Cashew-Bäumen und erreicht einen etwas breiteren Gehweg, der von dem neu gegründeten Dorf bis nach Koottu-Puzha führt. Nebst der länglichen Scheune, die sowohl als Schule als auch als Kirchgebäude dient, stehen ein paar kleine Läden. Weit und breit keine Häuser, keine Menschen. Links und rechts nur Wald. Der Weg führt sie entlang des Flusses, der zu ihrer Rechten etwas tiefer liegt. Er schlängelt sich nach Westen, nach Koottu-Puzha. Ihr Blick streift über vom Wind und Regen polierte Felsbrocken, über weissen Sand und blühende Sträucher. Ein unberührter Fluss mit kristallklarem Wasser, kleinen, grünen Inseln und bunten Kieselsteinen.
Alle hundert Meter sieht sie eine Hütte, ein kleines Haus, etwas Rauch aus der Küche. Manchmal begegnet sie einer Frau, eine aus dem neu gegründeten Dorf. Sie reden über ihre bunte Sari, über den Fluss, über ihren langen Fussmarsch zum Postamt, das bloss zwei Stunden vormittags und zwei Stunden nachmittags geöffnet ist. Sie sprechen über die gefährliche Strömung, durch sie sie jedes Mal waten muss, um an das andere Ufer und an die geteerte Strasse zu gelangen. Auch diese führt durch den Wald.
Der einsame, verfluchte Wald.
Anfänglich hat ihr Bruder Kunjunj sie bis zum Fluss begleitet, ihre Hand festgehalten, als sie den breit fliessenden Fluss überquerte. In den Sommermonaten konnte sie die seichten Gewässer mühelos durchwaten, sie konnte über die glitschigen Steine gehen, der oft starke Strömung trotzen. Aber mit dem zunehmendem Regen musste sie Risiken eingehen, bis der Fluss sich veränderte, sich gelb braun verfärbte und schäumte. Er war dann zehnmal breiter, auch tiefer. Er brachte tote Tiere und umgestürzte Bäume mit sich und Unmengen der roten aufgelösten Erde. In den Regenmonaten brachte der Fährmann Mahmmad, Kochu über den Fluss.
Der einsame, verfluchte Wald wurde noch dunkler, noch gefährlicher. Die Ureinwohner, halbnackt, dunkel, schweigsam, versteckten sich in den tief im Wald gelegenen Siedlungen. In Baumkronen. In Höhlen.
Aufgeregt blöken die Ziegen von nebenan. Sie sind hungrig, durstig und unruhig. Vielleicht riechen sie das noch triefende Blut ihrer Artgenossen? Vielleicht sind es die Federn der Hühner und Hähne, die der Wind über die ausgetrockneten Felder fegt und die Tiere in Angst und Schrecken versetzen? Vielleicht verängstigt sie Yama, der Gott des Todes, der über seine Herde wacht?
Ist er der „Gute Hirte“?
Kunjunju, ihrem Bruder will sie alles sagen. Sich mit ihm versöhnen. Sich von dieser Wald voller Monstern befreien.
Sie flüstert vor sich hin.
Lieber, unendlich lieber Bruder! Ich habe dich sehr enttäuscht. Auch meinen teuren Vater Ashan, meine geliebte Mutter. Ich habe Vasu vertraut. Ja, ich habe diesem Ungeheuer vertraut und euch verletzt. Verraten.
Bruder…
Kochu setzt sich in den Schatten des Mangobaums, faltet die Hände über den Kopf. Was soll sie ihrem Bruder sagen? Womit soll sie anfangen? Mit welchem Satz. Welchem Wort?
Vergib!
Vergib mir!
Vergib mir, lieber Bruder! Vergib mir, liebe Kleine Rose!
Lange schweigt sie und lauscht sie den Lärm der Strasse. Das Hupen und Fluchen. Das Geschrei und das Gackern. Inquilab Zindabad! Lang lebe die Revolution.
Lieber Bruder, erinnerst du dich? Dieser Vasu war bloss ein Hilfsangestellter. Ich habe ihm Zutritt zu dem kleinen Postamt gewährt. Er sortierte die Briefe. Brachte Telegramme zu den weit entlegenen Hügeln. Hin und wieder steckte er das Geld, das für einen ahnungslosen Empfänger bestimmt war, in die eigene Tasche. Für ein paar Tage bloss. Er war dem Alkohol verfallen. Stets brachte er das Geld zurück, um es in letzter Minute den rechtmässigen Empfängern zuzustellen. Aber manchmal gelang ihm dies nicht. Zur Not habe ich ihm dann Geld geliehen...Mein Geld. Unser Geld. Als Frau dürfte ich meinen Lohn nicht für mich behalten. Oder?
Kochu blickt auf ihre Uhr. Bald wird es Mittag. Wo bleiben sie?
Liebe Rose, glaub mir! Dieser Vasu verdiente wahrlich kein Mitleid. Er war kein Mensch. Stets wusste er, mich um den Finger zu wickeln. Er war gut aussehend. Hatte kräftige Arme. Aber keine Bildung. Und kein bisschen Menschlichkeit.
Mit der Zeit nahm er was er wollte. Er berührte mich…zunächst unauffällig, wie durch puren Zufall, unbeabsichtigt, wie ich glaubte. Aber dann….Dann wurde er mutiger. Er berührte mich, selbstsicher, zärtlich…. unsittlich.
Liebster Bruder…glaub mir. Bitte, glaub mir!
Ich wehrte mich. Mit Worten. Mit Gesten. Wieder mit Worten. Eines Tages presste er seinen Körper…seinen…an mich fest. Was hätte ich nun tun sollen? Mein Vater Ashan war weit weg, irgendwo, ein Kirchensklave ohne ein Dach über dem Kopf. Der General war irgendwo in den Himalayas. Wem hätte ich mich anvertrauen sollen?
Dir, lieber Bruder? Dir? Du warst ein Hitzkopf. Du hättest ihn niedergestochen. Du hättest seine Eingeweide mit blossen Händen herausgerissen. Dein Leben, das Leben der Kleinen Rose, euerer Kinder aufs Spiel gesetzt. Unser aller Leben. Du hättest ihn mit einer Machete zerstückelt, wenn Du es gewusst hättest!
Ich habe sodann einen Brief verfasst, einen ruhig verfassten sachlichen Brief und ihn meinem Vorgesetzten in Kannur persönlich ausgehändigt. Seine Zukunft war damit entschieden. Vasu wurde fristlos entlassen. Auf eine Anklage verzichtete der Postbeamte, vorausgesetzt, Vasu verschwinde aus meinem Leben. Für immer.
Und ich? Ich habe dieses Ungeheuer geheiratet. Ungeheuer!
Warum? Warum? Warum?
Ihr Mund ist ausgetrocknet. Sie fasst einen tief liegenden Ast des Mangobaums und richtet sich auf. Leicht gebückt geht sie in das heruntergekommene Haus hinein und schlürft mit Hilfe eines Kokoslöffels Wasser aus einem Tonkrug. Trinkwasser aus dem eigenen Brunnen, der ein Stück tiefer liegt als die Hauptstrasse, als der Metzgerladen und der versteckte, primitive Schlachthof.
Ist das Wasser mit dem Blut und dem Urin der Tiere verseucht? Mit Dung? Und wenn schon, wohin soll sie ziehen?
Als sie zum Vorhof zurückkehrt, schleppt sie einen rundlichen Stuhl mit sich und stellt ihn in den Schatten. Kochu setzt sich hin und nippt das lose Ende ihres hellblauen Saris. Ihr Haar wird allmählich grau. Ein paar Strähne flattern schräg nach unten über ihr Gesicht, von links nach rechts, über die stolze Nase. Die feinen Haare kleben sich fest auf der feuchten Wange und fallen hinunter über ihre makellos weisse Bluse. Sie muss sich beherrschen.
Stumme, sinnlose Tränen!
Liebster Bruder…Ich war endlich frei. Und unbesorgt. Du hast junge Männer ins Haus gebracht, sechszehn junge Männer, einen nach dem anderen. Du hast sie alle feierlich empfangen. Mit Festessen, mit Trank und Gebäck. Was für eine teure Brautschau! Wie sinnlos! Alle habe ich abgelehnt. Alle.
Ich wollte jemanden ehelichen, der mindestens die Sekundarschule besucht hatte. Unter den sechszehn waren es ein paar, gewiss. Erinnerst du dich? Einer lispelte. Der andere war mittellos. Ein dritter erschien mir sehr grob, haarig. Er hatte faule, dunkle Zähne. Einen üblen Schweissgestank!
Ich war bloss fünfundzwanzig. Ich dachte, ich habe Zeit.
Du hast mich zur Ehe gedrängt. Du wolltest mich loswerden. Ich sollte irgendjemanden nehmen. Irgendjemanden! Dann hättest Du den kleinen Grundstück Ashans zwischen Dir und dem General aufteilen können, ohne mir einen Antgeil geben zu müssen. Es ging Dir um …bloss um den Besitz.
Für dich war meine Entscheidung merkwürdig. Ein Akt des Ungehorsams. Ich habe einen eigenen Willen, Bruder! Ich hatte einen eigenen Willen. Hatte…ja, ich hatte. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Rose, du verstehst das.
Und du, mein Junge? Du bist ja weit gereist. Hast viele Länder gesehen. Andere Menschen und Sitten kennengelernt. Wir Frauen haben Rechte! Stimmt?
Ich war schwanger. Mit dem Kind dieses Ungeheuers. Und du liebster Bruder, hast mich aus der Familie verbannt. Ohne mich nur einmal anzuhören. Vasu war ein Unberührbarer, wir dagegen Christen. Auserwählt! Das war es. Dein barmherziger Gott liebt nur seine auserwählten Kinder.
Die Verbannung, das war der Preis der Freiheit.
Eine Nachbarin kehrt mit einer Flasche billigen Schnaps von der Hauptstrasse zu ihrer armseligen Hütte zurück, die noch weiter weg von der Stadtmitte und zu Füssen eines Hügels, nah bei den Teeplantagen liegt. Kalyani schwingt von einer Seite zu der anderen Seite. Sie trägt eine zerfetzte dunkelgrüne Sari. Ihr Oberkörper ist nackt, die verdorrten, hängenden Brüste sind mit dem Stoff nur teils bedeckt. Kalyani gehört zu den Ureinwohnern von Wayanad. Zur Adivasi. Ihre Söhne und Töchter leben im Wald, in armseligen Hütten, sie schuften sich zu Tode und betrinken sich zur Besinnungslosigkeit. Geregelte Arbeit ist ihnen fremd. Ein geregeltes Leben ist ihnen fremd. Auch der Konkurrenzkampf.
Du befindest dich genau an jener Stelle, wo ich dich vorhin gesehen habe als ich zum Alkoholladen ging. Woran denkst Du? Warum diese Unruhe? Bist du krank?
Meine beiden Enkelkinder sind krank. Fieber und Übelkeit. Auch mir geht es nicht gut, Kalyani.
Dein Sohn soll nicht mehr im Ausland schuften. Ich sage es ihm, wenn ich ihn wieder sehe. Wo ist er denn?
Wo denn? In Qatar. In Qatar. Wo denn sonst?
Zwei kränkliche Frauen, zwei kränkliche Kinder und kein Mann im Haus. Es ist eine Tragödie!
Das ist nicht schlimm. Gar nicht so schlimm, Kalayni!. Es ist ein Segen!
Na, also, wenn du meinst. Ich lass dich allein.
Qatar, Qatar,!
Flucht Kalayni.
Qatar, mein Arsch!
Kochu sieht Kalayani nach. Selig schaukelt sie vor sich hin. Wie alt ist sie? Fünfunddreissig? Vielleicht vierzig? Mit vierzig wirkt sie wie achtzig. Sie ist alt und abgenutzt. Ein paar Jahre hat sie noch. Die Adivasi sind schnell erwachsen. Mit zwölf oder dreizehn gebären sie Kinder. Nach zehn oder zwölf Geburten sind sie nur Haut und Knochen. Sie kauen Tabak, sie trinken viel, sie vermehren sich wie Karnickel. Die Ureinwohner sterben früh. Sie kennen weder Himmel noch Hölle. Der Alkohol ist ihr Trost.
Ich hätte trinken sollen. Früh sterben sollen.
Feige bin ich nicht. Nicht ich! Du flüchtest in die Religion. Umklammere den Sankt Sebastian mit all den Pfeilen in seiner Brust. Weine nur aus im Schoss der Heiligen Jungfrau. Wirf dein Geld, deinen Besitz in den Schoss der Mutter Kirche. Kaufe deinen Seelenfrieden mit den Tränen deiner Kinder! Wie erbärmlich!
Wie satanisch, so eine Kirche!
Hättest du mir nur einmal zugehört! Ich war im vierten Monat schwanger. Und du hast mich genau zum Ort meines Albtraums gezerrt. Genau dorthin, wo das Ungeheuer auf mich gelauert hat.
Weisst du wie bedrohlich, wie fruchterregend der Wald dort ist?
Mächtige Bäume umschlungen von seltenen, dichtgrünen Kletterpflanzen, mit Strängen so stark und so verbogen wie gigantische Pythons. Ein Wald überwuchert mit Dickicht voller Dornen. Dieser Wald war ist ein dunkles Königreich… mit Blutegeln, Skorpionen, Flughunden und Schlangen.
Du schwärmst von Bison. Von Hirschen und Wildschweinen. Du denkst an die Jagd. An Fleisch.
Ich war ängstlich. Der Weg, erst entlang des Gehwegs, rechts durch den Wald und dann, nach der Flussüberquerung, links, auf geteerter Strasse, durch dichteren Wald, dieser Weg war für mich eine Qual. Versetz dich an meine Stelle, vierzig Jahre zurück. Kein Mensch weit und breit. Nur der Regen. Der trommelnde Regen und der brüllende Fluss.
Vasu hat mir aufgelauert. Viele Tage. Viele Abende.
Oft war ich nicht ganz allein. Ab und zu gab es einen Nachbarn, eine Nachbarin, Menschen mit Provianten aus der kleinen Stadt Koottu-Puzha, die nach Kacheri Kadavu zurückkehrten. Manchmal waren es Jugendliche, Sekundarschüler auf dem Weg zurück nach Hause. Sie waren meine Schutzengel. Aber manchmal war ich ganz allein.
Matthy, Kera, Matthy…Sardinen! Sar….dinen…Sar…dinen.
Ein Mann schiebt seinen verrosteten Fahrrad und ruft, Sardienen…Kera, kera, Kera…Er hält mit dem Fahrrad und einem Korb aus Rattan vor dem Haus von Kochu. Sie drückt auf beide Knie und steht mühsam auf und bewegt sich zum Tor.
Was hast du?
Die Sardinen sind soeben eingetroffen. Ganz frisch. Sehen Sie?
Er nimmt eine Handvoll und hält sie vor ihre Augen. Die Fische sehen zwar frisch aus, die Kiemen sind aber mit tief dunklem Blut beschmiert. Von unter den spärlich angebrachten Eiswürfeln starren tote offene Augen.
Vermutlich mit Ammoniak behandelt!
Nein, nein. Alles ganz frisch.
Was noch?
Ich hab‘ Kera! Bester Thunfisch. Erste Qualität. Das hier geht gewöhnlich ins Ausland. Import.
Du meinst, Export?
Import-Export !
Oho! Und wie viel kostet dieser hier?
Vierhundertfünfzig, das Kilo.
Schwindler!
Vierhundert.
Ich feilsche nicht um den Preis. Aus Prinzip. Hören Sie, meine Schwiegertochter sollte jeden Moment da sein. Wenn Sie auf diesen Weg zurückkehren…dann vielleicht?
Also gut. Kera, Kera, Kera….Mathiye….Mathy. Mathiyee …Mathy. Er steigt auf das klapprige Gefährt und radelt los. Kochu blickt wieder zu Hauptstrasse hinauf.
Hinter dem kleinen Haus gackert eine Henne aufgeregt.
Iescho!
Kochu eilt nach Hinten, wo sich eine Henne mit ausgebreiteten Flügeln gegen einen grauweissen Greifvogel stellt. Der hungrige Jäger hat sich auf einen, zur Erde hin biegenden Ast einer Kokospalme gesetzt und beobachtet die alarmierte Henne und ihren zehn Tage alten Küken mit grösster Aufmerksamkeit. Kochu scheint ihn nicht aus der Fassung zu bringen. Sie nimmt einen Stein und schleudert diesen gegen den Vogel. Der Vogel stürzt nieder, wendet sich ab im allerletzten Augenblick. Kochu schreit mit aller Kraft.
Schoo! Schoooo…Verschwinde!
Sie nimmt einen zweiten Stein in die Hand und noch bevor sie ihn gegen den Vogel schleudern kann, fliegt der einsame Jäger fort.
Kochu lässt den Stein fallen und betrachtet ihre Hände. Sie sind zart und knochendürr. Harte körperliche Arbeit ist ihr, war ihr fremd. Ihre Hände sind schwach, sie waren schwach. Wie hätte sie sich wehren können?
Liebster Bruder…Ich habe dir nichts zu sagen. Ich mache dir auch keine Vorwürfe. Ich bin eine Frau. Ich muss schweigen. Ich werde schweigen.
Kochu kehrt ins Haus und setzt sich vor ihren kleinen Schreibtisch. Mit grösster Mühe öffnet sie eine Schublade, nimmt einen Zettel und einen Füller, streift über das leicht gebogene unlinierte Blatt.
Lieber Junge, mein lieber Junge, Baby, wir sind verwandt, doch. Jedoch… Fremde sind wir. Wie du vielleicht weiss, hat dein Vater, mein liebster Bruder, mich aus unserem gemeinsamen Elternhaus gezerrt…mich verstossen. Als ich dann im siebten Monat schwanger war, hat er zusammen mit dem General, mit meinen zwei Schwägern, mich gezwungen, den Mann zu ehelichen, der mich vernichtet hat. Ich bin nicht mehr Kochu, nur ihr Schatten. Kochu ist vor vielen Jahren gestorben. Vor vielen, vielen Jahren.
Wie bin ich gestorben?
Ich war stets schwach, kränklich. Ich hatte lange dünne Arme. Nutzlose Arme. Und einen eisernen Willen. Verstehst du? Du bist, wie ich höre, weit gereist. Du bist Menschen begegnet, bist unter Ihnen aufgewachsen. Menschen mit Bildung und Anstand und Kultur. Ich jedoch bin ich unter Bestien gross geworden…Unter blutrünstigen Menschen.
Ich habe einen Sohn. Er schuftet irgendwo. Ich vermisse ihn nicht. Gar nicht. Überrascht dich das? Ich fürchte den Tag, wenn er zu mir kommt. Ich will ihn nicht sehen. Wäre ich blind, hätte ich ihn vielleicht lieben können. Wäre ich nur blind!
Nein, er hat mir nicht wehgetan. Nie. Nur, ich bin schwach. Mein Sohn erschreckt mich. Mit seinen Händen. Mit seiner Stimme. Er kann nichts dafür. In seinem Gesicht sehe ich seinen Vater Vasu wieder. Ich sehe einen Mann, den ich nie liebte, nie lieben konnte. Ich sehe das Ungeheuer, das mich ruiniert hat. Ich sehe seine Hände, seine Augen, sein Hass erfülltes Gesicht.
Was mir widerfahren ist? So etwas geschieht alle Tage. Tausendfach. Stell dir vor!
Seit vierzig Jahren schweige ich. Mein Sohn ahnt nichts. Auch Daisy nicht. Sie halten mich für ein bisschen verrückt. Eigenwillig. Sonderlich. Und dein Vater?
Er glaubt, ich habe diesen Vasu geliebt. Er glaubt, ich habe unsere ehrbare christliche Familie in den Dreck gezogen. Dein Vater denkt: Wie konnte sie nur einen Hindu lieben? Einen Unberührbaren? Einen Dreckskerl?
Sag deinem Vater nichts davon. Auch der Kleinen Rose nicht. Lass sie glauben, was sie glauben wollen. Aber du, mein Junge, mein liebster Junge, Du sollst wissen, was geschehen ist. …Was wirklich geschehen ist.
Dieser Wald…Dieser von Dämonen besetzter Wald.
Was Kochu anschliessend schreibt ist mit ihrenTränen genetzt. Sie schreibt über ihre spindeldürren Arme, ihre Schreie, die niemand hört, ihre zarte von Dornen geritzte Haut. Sie schreibt lose Wörter, ohne Zusammenhang: Verwirrung, Nachhall, Ohnmacht.
Sie schreibt… Nirbhaya.
Nirbhaya, die junge Medizinstudentin, die nach einem Kinobesuch in Delhi am sechszehnten Dezember 2012 von sechs Männern im fahrenden Bus vor den Augen ihres Freundes vergewaltigt und gefoltert wird.
Nirbhaya, die Furchtlose. Nirbhaya, deren Vergewaltigung und Tod friedliche, überwältigende Proteste auslöst und Millionen, ja, ein ganzes Land in Aufruhr versetzt.
Nirbhaya, die Angst besiegt und das Schweigen Millionen gequälter Mädchen und Frauen bricht.
Ich bin kein Nirbhaya. Ich war ängstlich. Ängstlich bin ich noch heute.
Das Brummen eines Fahrzeugs lockt sie nach vorne. Kochu faltet das Blatt mehrmals, versteckt es in ihrer Bluse, oberhalb ihrer linken Brust, unter den Falten ihrer Sari. Sie begibt sich zum Vorhof und hält sich an einem Ast des Mangobaums fest. Atemlos betrachtet sie, wie ihr Bruder aus dem Auto heraus steigt. Seine tiefschwarze Lockenpracht ist gänzlich verschwunden, stellt sie fest. Stattdessen schimmern wenige seidenweisse Strähne oberhalb seiner markanten, breiten Stirn. Seine Arme sind lang und kräftig, sein Körper leicht gebückt. Als er auf sie zukommt, füllen sich ihre Augen mit Tränen, ihr Atem stockt.
Sie fällt ihm in die Arme. Er umarmt sie zärtlich. Ihm fehlen die Worte.
Eine Minute lang stehen sie versteinert vor dem kleinen verlotterten Haus. Dann traut sich die Kleine Rose, sich Kochu zu nähern und ihre rechte Hand in ihre beiden Hände zu nehmen. Rose drückt sie fest. Kochu löst sich von ihrem Bruder und wendet sich an die Kleine Rose.
Ente ponnu Nathooney! Liebste Schwägerin. Kochu schluchzt wie ein Kind.
Tante!
Kochu sieht mich an. Erschrocken sieht sie mich einen Moment an. Sie umarmt mich und streichelt mein welliges Haar. Bist du es wirklich? Bist du es mein Junge? Deine Augen sind mir vertraut…diese langen, grossen Augen. Oh mein Junge, ich hätte dich nicht erkannt. Nein. Wie viele Jahre trennen uns?
Kommt herein! Kommt!
Wie du siehst, lebe ich allein.
Lebst du ganz allein, Tante?
Na, ja! Die Frau meines Sohnes kommt bald. Wie viel Uhr ist es?
Sie wischt ihre Tränen weg und schaut auf ihre Uhr.
Es ist zehn nach eins, Tante.
Sie sollte jede Minute eintreffen. Bitte setzt euch. Ihr habt bestimmt Durst…und Hunger. Wollt ihr, dass ich den Deckenventilator einschalte? Er macht einen fürchterlichen Krach.
Setz dich, Kochu. Setz dich hierhin. Wir brauchen den Ventilator nicht. Es war kühl im Auto, fast zu kühl für mich. Hier in Wayanad ist es angenehm. Komm hier.
Die Kleine Rose nimmt Tante Kochu bei der Hand und lässt sie zwischen Vater und sich Platz nehmen.
Habt ihr den Weg leicht gefunden? Fragt sie ihren Bruder. Er nimmt erneut ihre Hand und nickt. Er hört ihre Lungen pfeifen.
Was hast Du?
Du weisst, ich hatte die Tuberkulose. Dieses stetige Pfeifen ist aber neu. Seitdem Vasu gestorben ist, höre ich es.
Woran ist Vasu gestorben?
Will Mutter Rose wissen.
Krebs. Wir brachten ihn in ein Zentrum für …ja…ich hab’s… Ein Zentrum für Palliativmedizin. Er war fast fünf Jahre dort. Ich hatte aber keinen Kontakt mehr zu meinem Mann.
Verwundert sehe ich meine Tante Kochu an.
Eine junge Frau kommt ins Haus und nimmt die Hand meiner Mutter.
Ammayi, willkommen!
Du bist Daisy, nicht wahr?
Am Nachmittag konnte ich frei kriegen. Es gibt nur wenige Lehrer, die mein Fach unterrichten. Habt ihr alle etwas zu trinken bekommen?
Was unterrichtest du, Daisy?
Wirtschaft. Ja und Computer.
Während sie das Reis kocht, wärmt Daisy die vorgefertigte Bananen- und Moringablüten kurz auf. Aus dem Kühlschrank holt sie zwei Sorten Chutneys und stellt alles auf den Tisch. Meine Eltern waschen sich die Hände. Kochu reicht ihnen ein weisses, sauber gefaltetes Tuch.
Meine Eltern und ich nehmen am Tisch Platz.
Tante, bitte setz Dich. Iss mit uns!
Ich habe keinen Hunger. Wirklich! Esst ihr. Ich hoffe, es ist nicht zu scharf für dich.
Während wir essen, streichelt sie mein Haar, reicht mir dies und das.
Kocht ihr auch Reis und Curry und Moringa-Blüten?
Ich liebe diese weissen Blüten. Ich habe sie viele Jahre nicht mehr gegessen. Seit dem ich Koottu-Puzha verlassen habe. Ich habe zwar die Früchte des Meerrettichbaums in ein paar exotischen Läden gesehen…aber die Blüten…nein, Tante.
Das graue Betondach speichert die Hitze der Sonne und strahlt sie über unsere Köpfe. So setzen wir uns im Schatten des Mangobaums für eine Weile und warten, dass Daisy etwas isst und sich uns anschliesst. Niemand will reden. So betrachten wir die fernen Hügeln und den langsam sich verdunkelnden Himmel.
Vater schweigt. Eisern. Er zündet seine grässliche Beedie an und raucht, seelenruhig. Bald erleidet er einen Hustenanfall, der lange andauert. Irgendwann beruhigt er sich, bückt nach vorne und liest ein Dutzend Kieselseine auf. Vielleicht will er etwas sagen, vielleicht auch nicht. Wo soll er beginnen? Wie soll er einer Frau, seiner um Jahre jüngeren Schwester, um Vergebung bitten? Und wofür? Er wirft die kleinere Steine weg, behält drei davon, er jongliert wie ein Kind. Warum die Bürden der Vergangenheit in Erinnerung rufen? Warum alte Wunden aufreissen? Was nützen wohl Worte?
Vielleicht habe ich Fehler gemacht. Vielleicht. Ich bin bald achtzig. Ich bin ein Mann. Und viel älter als sie. Unser Vater Ashan hat die Familie im Stich gelassen. Ich habe um dich gekümmert. Ich! Habe dir Kleider gekauft, das Essen besorgt. Deine Stelle beim Postamt. Zuletzt warst Du eine leitende Postbeamtin. Du erhältst eine staatliche Pension! Ich dagegen habe nichts! Nichts! Ich habe meine Gesundheit ruiniert. Auch deinetwegen! Ich habe zu Tode geschuftet. Um dir eine Sari zu kaufen habe ich meinen Kindern Kleidern verweigert. Weisst du was es bedeutet in der prallen Sonne zu stehen? Was es bedeutet mit einem Beil Steine auszureissen? Mit einem Axt Bäume zu fallen? Einen Wald urbar zu machen? Mit blossen Händen den Boden zu ebnen? Schau dir meine Hände an!
Er lässt die Kieselsteine zu Boden fallen und betrachtet seine rauen Hände.
Kochu betrachtet ihren Bruder. Bald verliert sie jegliche Interesse an ihn, an sein hilfloses Trauerspiel. Ihre Augen schweifen über die fernen Hügel und ruhen auf einem Prächtigen Baum, mit einer purpurnen Blumenpracht. Ab und zu sieht sie die Kleine Rose an, dann mich und seufzt. Warum soll sie ihren Bruder ansprechen? Was nutzt eine Anklage? Wie soll sie ihren eigenen Willen rechtfertigen? Und was hat sie im Leben falsch gemacht? Wofür sich entschuldigen? Mit fünf und zwanzig wollte sie nicht in die Ehe, niemand um den Hals haben. Na und? Ist das nicht ihr gutes Recht? Ihre Eltern aber auch ihr Bruder Kunjunj wusste, dass sie Vasu nicht liebte. Er hat ihr Unrecht angetan. Er. Er soll reden, wenn er will. Wozu ist er überhaupt her gekommen?
Ich bin aus Fleisch und Blut. Ich bin ein Mensch. Ich bin eine Frau. Ich bin nicht eine armselige Kreatur, die man abschlachtet und ausstellt. Einfach so! Ich mag dünne Arme haben, einen verwelkten Körper. Ich bin zwar nur Haut und Knochen aber ich habe meinen Stolz. Ich bin in strömenden Regen zur Schule gegangen. In Fetzen. Ohne Bücher, ohne Schuhe, ohne Schirme. Wie oft habe ich mein Leben aufs Spiel gesetzt und den geschwollenen brüllenden Fluss überquert, um in das einsame Postamt zu gelangen? Wie viele Kriege habe ich mit Mitarbeitern und Vorgesetzten geführt, um mich zu behaupten? In einer Welt der Männer! In einer Welt, der uns Frauen mit Erniedrigung und Verachtung und Gewalt belohnt? Mit dem Tod? Es gibt Erinnerungen, die nie verblassen. Wut, der nie verglüht. Stolz, ja Stolz, der nie nachgibt.
Ein Krieg ohne Worte. Das Schweigen als Waffe. Ein zeitloser Krieg.
Was geschehen ist, ist geschehen. Ihr seid Bruder und Schwester! Ihr solltet miteinander reden!
Die Kleine Rose spricht energisch. Bestimmt. Sie sieht Vater fragend an. Vater schweigt. Auch Tante Kochu.
Tante, willst Du nicht mit uns kommen?
Als das Schweigen unerträglich wird, frage ich Tante Kochu.
Für ein paar Tage, Tante?
Wie denn Junge? Ich kann unmöglich Daisy mit zwei kleinen Kindern allein lassen.
Kochu, komm doch mit uns. Wir haben viel Platz im Auto. Komm mit uns. Und nach ein paar Tagen begleite ich dich hierhin zurück.
Nathune…Rose, ich kann unmöglich hier weg.
Komm doch mit uns, Kochu. Baby bleibt mit uns noch zehn Tage.
Mutter fleht Kochu an.
Vielleicht ein anders Mal, Rose. Ich bin gar nicht vorbereitet. Meine Kleider. Medizin. Wenn Daisy und die Kinder Schulferien haben und sie zu ihren Eltern gehen will… Vielleicht dann.
Ein leichtes Donnergrollen setzt Vater in Unruhe. Er steht auf und will nun gehen. Es fällt ihm schwer, das Schweigen seiner Schwester Kochu zu ertragen. Auch er findet keine Worte. Er zündet eine Beedie an und qualmt, zieht den giftigen Rauch ein und hustet. Resigniert steht auch die Kleine Rose auf.
Daisy, Kommst du mal mit den Kindern! Und bring Kochu bitte mit. Unbedingt!
Ja, Ammayi. Ich besuche euch gern.
Schade, dass wir deine Kinder nicht sehen konnten.
Es wird fünf, bis sie zu Hause sind.
Wiedersehen!
Vater und Mutter steigen ins Auto.
Fährt ihr doch vor! Es ist zwar kurz, aber ein steiler Aufstieg. Ich komme zu Fuss bis zur Hauptstrasse. Ja, fahr doch!
Wiedersehen, Daisy!
Wiedersehen…Babychetta.
Als die weisse Grossraumlimousine wegrollt, bleiben Tante Kochu und ich einige Schritte zurück. Als der Staub sich legt, gehen wir die schmale Verbindungsstrasse hinauf. Tante Kochu nimmt das gefaltete Blatt von den Falten ihrer Bluse und drückt sie in meine Hand.
Lies ihn, wenn du allein bist. Wenn du ganz allein bist.
Tante…komm mit mir. Bleib so lange Du willst. Rede mit Vater.
Junge, du weisst es…Der Mensch hofft und vergibt und liebt. Dennoch…dennoch…es gibt Wunden, die nie heilen.
Ich umarme sie, spüre den herausragenden Knochen am Rücken mit meiner Hand, spüre ihre zarte Haut, ihre Tränen auf meiner Brust. Ich wische ihr die triefende pechschwarze Mascara vom Gesicht, küsse ihr sanft auf der feuchten Wange und gehe die letzten paar Schritte zur Hauptstrasse hinauf. Die Alkoholsüchtigen starren mich an, fast feindselig, ich bin für sie ein Fremder. Oben bei der geteerten Strasse angekommen, bleibe ich einen Moment stehen und lausche den Donnerknall. Als ich ins Auto einsteige, fallen die ersten Regentropfen. Sie sind gross, wuchtig, schmerzlich. Durch die verschmierte Fensterscheibe sehe ich Tante Kochu allein am Wegrand ausharren, ihr Blick nach unten gerichtet, still, neben den stummen Ziegen.

"Ich werde dich nie wieder sehen".
Ihre Stimme bebte. In ihren traurigen Augen glänzten die Weltmeere. Sie lächelte. Mit ihren erschöpften Armen hielt sie mich umschlungen. Sie hielt mich eine Weile fest, ohne auch nur ein einziges Wort zu sagen.
"Möglich, dass wir uns nicht mehr begegnen, nicht hier jedenfalls."
Ihre Stimme war schwach, ein kleines zärtliches Flüstern, das bald von einem gütigen warmen Windstoss erfasst in die weite Welt hinausgetragen für immer verloren ging und doch noch heute widerhallt.
"Weine nicht... Weine nicht, mein Sohn."
Chandu, unser vertrauter Taxifahrer aus Iritty, wartet auf mich am Flughafen von Calicut. Hinter einer Glasscheibe erkenne ich auch meine Tante Ammayi, die älteste Schwester der kleinen Rose. Ich sehe sie nach zehn, vielleicht zwanzig Jahren. Sie müsste achtzig, nein neunzig Jahre alt sein. Bis auf die kleinen Grübchen im Gesicht gleicht sie meiner Mutter. Ihre Gesichtszüge haben sich in all den Jahren kaum verändert. Sie lächelt kurz, betrachtet voll Staunen die Reisekoffer, wie sie auf dem für sie nicht sichtbaren Fliessband nach vorne gleiten. Einen Augenblick später hält sie die Ohren bedeckt, schneidet eine Grimasse wie ein Kind. Sie betrachtet ein Flugzeug, das gerade startet, starrt gespannt in die Ferne. Dann fasst sie das Kinn mit beiden Händen, die Finger leicht gespreizt, den Mund halb offen. Mit ihren neugierigen Augen nimmt sie alles auf, die wundersamen Vögel, ihre lärmenden Abflüge, die Ankünfte.
Chandu begrüsst mich, nimmt mir meine Tasche aus der Hand und trägt sie zum Auto hinüber. Ammayi fasst meine beiden Hände, betrachtet mich.
"Erkennst du mich noch."
Ich frage sie etwas verlegen.
"Dich erkennen? Dich? Bei deiner Geburt fielst du direkt in meine Hände!"
Sie schlägt mich auf die Wange, sieht mich gespannt an, entschuldigt sich. "Habe ich dir weh getan? Ich bin der kleinen Rose bei deiner Geburt beigestanden. Schau her! Du bist in diese Hände hinein geboren!"
Sie hält ihre beiden Hände offen, lacht. Sie sieht die Trauer in meinen Augen, die Anstrengungen der langen Reise, führt mich zum wartenden Auto von Chandu.
"Sie hat uns verlassen, sie hat uns allein gelassen, die kleine Rose.“
Lautstarkes Krähen. Aggressives Hupen. Das Rauschen des Weltalls. Dazwischen eine Milliarde Menschen, die alle zugleich und in den unterschiedlichsten Sprachen und Tonlagen miteinander redeten. Um drei Uhr früh nahm ich den Anruf meiner Schwester Molly aus dem fernen Indien entgegen. Das All verschlang manche ihrer Worte.
" Eine traurige Nachricht.... Komm sofort nach Hause.... Wir warten auf dich."
Einen Flug von Zürich nach Bombay konnte ich für den folgenden Tag buchen. Der Weiterflug von Bombay nach Calicut an der Südwestküste Indiens schien unmöglich. Drei Tage nach dem Tod der kleinen Rose, sass ich im Auto von Chandu, fuhr dort hin, wohin mich Ammayi führte.
"Du hast kein Zuhause mehr."
Ammayi schien in der Lage zu sein, meine Gedanken zu lesen.
"Dein Vater..."
Ammayi denkt nach, spricht in Metaphern.
"Dein Vater...der Baum ist lange vertrocknet, von Ameisen befallen, er hat sich zur Erde gelegt. Nun hat der Wind auch das Nest fortgefegt. Das ist der Lauf des Lebens."
Ammayi blickt aufs offene Meer hinaus, betrachtet das Schäumen der Wellen, das Treiben der Fischer, die Spiele der Kinder im Wasser.
"Kaum ist die kleine Rose weg, da streiten sich deine Geschwister um den Boden. Sie warten auf dich, warten darauf, dass du den Streit für sie regelst. Dass du das Chathom[1][1] gestaltest. Du bist der älteste!"
Nach einer Weile will sie mich trösten.
"Ich kenne deinen Kummer. Lass dich nicht von diesen Dingen bedrücken. Lass andere nicht dein Leben bestimmen."
Chandu betrachtet mich im Rückspiegel des Autos, erinnert sich an alte Zeiten.
"Wir waren einmal mit Ihrer jüngsten Schwester von Guntur bis hierhin gereist, nicht wahr?"
"Ja, mit Celine. Sie war krank. Sie ist immer noch krank."
"Ich weiss. Es tut mir sehr leid, dass sie krank ist. Aber hören Sie auf Ammayi. Sie können nicht alles regeln. Ist es nicht dreissig, vierzig Jahre, dass Sie von hier weggegangen sind?"
"Ja, Chandu."
Der Fahrer lächelt, erinnert sich an Geschehnisse, als ob alles sich vor nur wenigen Tagen ereignet hätte.
"Damals haben Sie mit Ihrem Vater in einem Theaterstück mitgespielt. Er spielte Ardchuna[2] und Sie spielten Abhimanyu[3]. Erinnern Sie sich? Erinnern Sie sich an Krischna[4]?"
Ich sehe sie alle vor meinem inneren Auge wieder. Die Götter. Die Dämonen. Die Apsaras[5]. An die Namen meiner Lehrer oder Lehrerinnen kann ich mich nicht mehr erinnern. Dafür erinnere ich mich an die Rollen, die sie einst spielten.
"Ja, Chandu. Ich werde das nie vergessen."
Entlang der Meeresküste stehen die Lehmhütten der Fischer dicht beieinander. Die grau gewordenen Palmblätter auf den Dächern sind teils mit gelben oder blauen Plastikfolien überzogen und mit Seilen festgebunden. Platten aus Wellblech oder Aluminium bilden die unteren Ränder der schräg stehenden Dächer. Die Flächen zwischen den Hütten sind mit Netzen überspannt. Auf dem Felsboden stehen alte, teils durchlöcherte Boote aufeinander gestapelt. In den kleinen schattigen Nischen zwischen Hütten und Booten verbrennen die Fischer ihre Abfälle, häufen sie die Schalen der Meerestiere, verrichten Menschen ihre Notdurft.
Eifrig schliesst Chandu die Fenster seines Autos, flucht.
"Gottes eigenes Land!"
Er zitiert einen Werbespruch der bundesstaatlichen Tourismusbehörde, lächelt müde. Die einzige Verbindung zwischen dem Flughafen und dem Dorf meiner Eltern verläuft entlang der stinkigen Meeresküste. Die Strasse ist stark befahren, sie verläuft mitten durch die gewundenen Reihen der Fischerhütten, parallel zur Küste. Der Lärm und der Fischgestank benebeln unsere Sinne, trüben unsere Wahrnehmung. Auf offener Strasse sitzen ein Lastwagenfahrer und sein Gehilfe, ihr Laster liegt mitten auf der Strasse, die Räder in die Höhe gerichtet, die Töpfe und Krüge auf dem heissen Teer zerschellt. Etwas weiter weg frohlocken Götter in Stein und in Marmor in der glühenden Sonne. Die Menschen brennen auf offener Strasse. Im Gottes eigenen Land.
Als wir aus einer Rauchwolke herauskommen, steht mitten auf der Strasse ein schwarzer Büffel. Ein halbnackter, grossgewachsener Mann reitet das Tier. Seine Haut, pechschwarz, schweissgebadet, glänzt im prallen Licht der Sonne. Auf seiner linken Schulter ruht ein Fischernetz.
"Dieser Idiot glaubt, er sei Yama[6]!"
Chandu schimpft leise. Er hupt, will an dem dickschädeligen Büffel und seinem sturen Reiter vorbeifahren.
"Sind Sie etwa taub, Mann?".
Er hupt wieder. Der seltsame Reiter bleibt von dem ungeduldigen Fahrer und dem Hupen unbeeindruckt, dreht sich nicht einmal um. Er reitet seelenruhig weiter.
"Chandu, wir wissen nicht, was das für ein Mensch ist. Vielleicht kriegen wir Ärger. Bitte nicht mehr hupen. Bald wird er uns bestimmt vorbeifahren lassen."
Chandu widerspricht mir, höflich, aber bestimmt.
"Einst gehörte die ganze Meeresküste den Fischern. Aber nun sind sie zwischen den Plantagen der gierigen Grundbesitzer und dem tobenden Meer gefangen. Eine einzige Welle und dann haben die Fischer keine Hütte mehr. Keine Boote, keine Netze mehr. Nichts! Der verdammte Fischer bleibt so lange auf der Strasse, wie es ihm passt."
Ihr zierlicher Leib ist mit Eisklumpen bedeckt, nur das Gesicht der Kleinen Rose vermag ich zu betrachten, ein einziges Mal berühren. Meine Geschwister haben auf meine Ankunft gewartet, drei Tage lang den Sarg mit Eiswürfeln gekühlt, drei glühend heisse Tage lang. Als wir, die vier Söhne der Kleinen Rose, den Sarg auf unsere Schultern hieven, füllt ein Geheul und Gejammer das kleine Haus meines Bruders. Celine, meine Schwester, fällt ohnmächtig zu Boden. Alice und Molly, meine Schwestern, tragen sie ins Bett. Ammayi bittet eine Nachbarin, sich um Celine zu kümmern, begleitet die kleine Rose auf ihrer letzten Reise. Aus dem kleinen düsteren, mit Tränen getränkten Raum schlängelt ein namenloses Rinnsal, fliesst auf den offenen Hof, verliert sich in eine ewig dürstende Erde.
Auf unseren Schultern tragen wir, meine drei jüngeren Brüder und ich, den Sarg den sanft abfallenden Berghang hinunter. Die tief liegenden Äste der Mango- und Kaschewbäume streifen unsere Gesichter, ihre Blüten regnen sanft auf den Sarg der kleinen Rose nieder. Von den Erdmauern entlang des schmalen Pfades beugen sich Hunderte von Ästen der Hibiscuspflanzen hinunter, das Grün leicht rot verfärbt, die roten Blumen berühren den Sarg. In den weiten gewässerten Feldern stehen Reishalme gebeugt, im Schatten rabenschwarzer Wolken stehen sie still, das Grün verdunkelt, auch sie tragen Trauer, nehmen Abschied von der kleinen Rose.
Wir tragen sie die hundert Stufen zum Hauptportal der Kirche hoch. Ein abgemagerter dünner Sakristan steht auf der obersten Stufe und betrachtet uns mit Staunen. Er stützt sich auf einen Spazierstock, schickt sich an, herabzusteigen, uns auf halbem Wege auf den Stufen zu begegnen. Er stolpert, weicht zurück, bleibt stehen. Stumm betrachtet er den Sarg. Er betrachtet die Trauernden dahinter, eine Reihe Männer, eine Reihe Frauen, vierhundert, fünfhundert Menschen, einen stillen Umzug der Trauernden. Ammayi blickt hinauf zum Sakristan, bleibt einen Augenblick fassungslos stehen. "Ashan", höre ich Ammayi sagen. "Ashan, dein Grossvater."
Ich sehe seinen ausgelaugten Leib, seine leicht gekrümmte Haltung, seinen krummen Spazierstock. Ich stelle mir seine Augen vor, seine seltsamen Buchstaben, seinen Ozean der Bitterkeit.
"Der Vikar ist nicht da. Er kommt erst in fünf Tagen wieder. Erst am Sonnabend."
Berichtet uns der Sakristan. Ich sehe Bestürzung in seinen Augen. Seine Stimme zittert. Sein Oberkörper ist nackt, er trägt eine unübersehbare Narbe auf der Brust. Der Sakristan ist viel jünger, als man von weitem vermutet, kaum dreissig. Er könnte niemals mein Grossvater sein. Nur seine Haltung ähnelt der des verstorbenen Ashan.
"Sie sind der älteste Sohn, auf den alle gewartet haben, nicht wahr? Auch der Pfarrer hat bis zum Mittag auf Sie gewartet. Danach musste er zum Bischofspalast."
Er sieht mich an, sieht meine Geschwister an, sieht Ammayi an.
"Lassen wir den Sarg auf der obersten Stufe ruhen"
Schlägt mir mein Bruder Thankachan vor.
"Den Rest regeln wir später."
Ein kleiner Schrei der Empörung geht durch die Reihen der Trauergemeinde. Ratlos setzen sich die älteren Menschen auf den Stufen nieder. Die engsten Verwandten der kleinen Rose drängen sich nach vorn, steigen die weiteren Stufen zum Haupteingang der Kirche hoch. Ich sehe Bhima und Krischna und die Apsaras unter den Trauernden. Engel und Dämonen. Aufgeregt fragen sie alle nach dem abwesenden Priester. Sie flüstern mir ihre Ratschläge ins Ohr.
"Den Leichnam zurück nach Hause tragen."
"Warten, bis ein anderer Priester herbeigeholt werden kann!"
"Beerdigen wir sie ohne den Priester!"
Zur späten Stunde liegen ihre Nerven blank, sind die Menschen erschöpft, die Kinder gereizt und hungrig.
Auf den fernen Hügeln verdunkelt sich der Wald, spiegeln sich die glatten Oberflächen hochragender Granitbrocken, ihr Glanz vergeht in der kurzen glücklosen Abenddämmerung. Weisse Kraniche fliegen zu fernen Nestern, auch Krähen, am Horizont tragen dunkle Wolken eine erloschene Sonne in ihr endlos weites Grab hinunter.
Ich betrachte meine Geschwister, den anwesenden Nachbarn, die wartenden Friedhofsgärtner.
"Eine Beerdigung ohne einen Priester? Kommt gar nicht in Frage".
Bekunden meine Geschwister ihren Standpunkt fast einstimmig.
"Beerdigen wir Mutter morgen. Babu soll einen Priester aus Peravoor holen."
"Den Sarg könnt ihr nicht in der Kirche aufbewahren. Dazu haben wir keinen Platz."
Sagt mir der Sakristan bekümmert. In der kleinen Dorfkirche werden keine Särge aufbewahrt, auch beim kleinen Friedhof nebenan gibt es dazu keine Einrichtung.
"Wenn ihr wollt, könnt ihr neben dem Pfarrhaus warten".
Schlägt der kranke Sakristan uns halbherzig vor. Dann blickt er hilflos zu mir hinüber, widerspricht sich, schlägt vor, dass wir den Sarg wieder mit nach Hause nehmen.
"Ich bin nicht dazu befugt, solche Entscheidungen zu treffen. Was wird der Pfarrer wohl dazu sagen? Ich bitte euch um Verständnis für meine Lage."
Danach schweigt er ehern.
"Ich kann nicht länger warten."
Mein Bruder Thankachan ist verärgert, er will nicht die ganze Nacht auf den Stufen vor der Kirche ausharren.
"Könnte einer von euch den Sarg mit sich nach Hause nehmen?"
Seine Frage ist zynisch, sein Ton voll Bitterkeit. Er allein hat eine kleine Hütte in der nahen Umgebung, Johnny und Babu leben in entfernten Dörfern, auch meine Schwestern Molly und Alice.
Die Kleine Rose hatte zuletzt bei Thankachan gewohnt, auch meine kranke Schwester Celine. Aber nun will er die 'verrückte' Schwester nicht mehr, er hat nichts, nichts, was er sein eigen nennen kann. Thankachan trifft der Tod meiner Mutter am härtesten, nun muss er für seinen Anteil Erde kämpfen. Vater hat ihm nichts Schriftliches hinterlassen, er hatte drei Hektar bis zu Mutters Tod in Anspruch genommen, auch alle drei beackert. Vater hatte mich beauftragt, einen Teil des einstigen Bodens Ashans unter meinen Schwestern aufzuteilen, Thankachan nur den Rest zu überlassen. Der Zorn meines Bruders richtet sich gegen sie, auch gegen mich.
"Beerdige du sie. Sie ist deine Mutter. Deine! Ich habe keinen Vater gehabt. Keine Mutter. Ich kenne keine Geschwister."
Thankachan kehrt uns den Rücken, steigt die Stufen vor der Kirche zur Strasse hinunter, verlässt die Trauergemeinde.
"Sag den Leuten, sie sollen morgen wiederkommen, wenn die grossen Glocken der Kirche läuten. Sag du es ihnen"
Schlägt mir Ammayi vor.
"Wir finden einen Ort, wo wir den Sarg bis morgen aufbewahren können"
Tröstet mich mein Bruder Babu. Johnny und Babu begleiten die Trauernden nach unten, zur Strasse hinab.
Erschöpft und verzweifelt setze ich mich an einem Ende des kleinen Sargs nieder. Ammayi nimmt am anderen Ende Platz. Die hellsten Sterne erscheinen am Firmament, auch ein kleiner blasser Mond, nach und nach weitere Sterne. Molly und Celine und Alice legen sich auf einer Seitenveranda der Kirche nieder. Auch die Kleinsten ihrer Kinder.
"Ammayi, geh hin zu meinen Schwestern. Auch du sollst dich hinlegen", schlage ich meiner Tante vor. Ammayi berührt den Sarg, lässt die erschöpfte rechte Hand auf ihm ruhen. "Du bist lange gereist, leg du dich mal hin. Ich bleibe wach. In meinem Alter brauche ich sehr wenig Schlaf. Ich bleibe bei der Kleinen Rose."
Wir betrachten die Kinder am unteren Ende der Stufen, wie sie vor der Statue der Jungfrau Maria Kerzen anzünden, zu ihren Füssen Blumen niederlegen, sich niederknien. Der Sakristan steigt die Stufen vor der Kirche hinunter, leert die kleine Kasse bei der Statue, schaltet die automatische Beleuchtung der Jungfrau Maria ein. Gelb und rot und grün leuchten die kleinen künstlichen Sterne, sie leuchten eine Weile, schalten kurz aus, leuchten wieder. Zwischen der Statue und dem Portal der Kirche schlagen pechschwarze Fledermäuse seltsame Bahnen, geräuschlos fliegen sie unter einem stets finsterer werdenden Firmament hin und her.
In den ersten Stunden der Nacht fahren die letzten Ortsbusse an der kleinen Kirche vorbei, nur die schwerbeladenen Laster brummen noch durch die Dunkelheit. Sie bringen Pfeffer oder Ingwer oder Kardamom zu den nahen Häfen an der Westküste. Manchmal quält sich ein überladener Laster vorbei, befördert wuchtige, heimlich abgeholzte Baumstämme von den finsteren Winkeln der Wälder zu den noch finstereren Winkeln ferner Städte. Hin und wieder höre ich die Stimmen einzelner Menschen. Nach getaner Arbeit kehren Tagelöhner zu ihren Hütten zurück, sie haben sich mit Proviant für den kommenden Tag eingedeckt, sind betrunken, sie singen oder pfeifen oder fluchen vor sich hin. Die Nacht verschlingt ihre Lieder, ihre Flüche, ihren Kummer.
Ein verrosteter alter Jeep hält bei der Statue der Jungfrau Maria am Strassenrand an, weckt mich aus meinem Schlummer. Bald tragen wir den Sarg der kleinen Rose zum Jeep hinunter, wir bringen ihn zu einem leerstehenden Laden am äusseren Rand von Iritty. Wir stellen den Sarg auf einen länglichen Tisch in einem kleinen Raum. Im angrenzenden grösseren Raum legen wir uns auf Bastmatten nieder. Bald schlafen meine Geschwister ein, auch Ammayi.
Auf einem offenen unebenen Feld hinter dem Laden sehe ich den seltsamen Reiter und seinen Büffel wieder. Der Mann sitzt unter einem grossgewachsenen Baum auf einer Granitplatte, reglos starrt er auf das dunkle, weite Feld. Das Tier steht dicht neben ihm, den Hals mit einer verwelkten Girlande aus Marigold geschmückt, seine Hörner im schwachen Licht einer Strassenlaterne glänzend. Zwischen den dunklen verschlungenen Ästen des vertrockneten Baums leuchten unzählige Sterne, schimmert ewig die Milchstrasse.
Ich schliesse meine Augen, lausche dem Stampfen des Büffels. Das Tier wandert frei auf dem staubigen Areal umher, kreist um den leerstehenden Laden, nähert sich uns, entfernt sich. Ich höre seine Schritte dumpf auf der staubigen Erde, hell auf der geteerten Strasse. Ich höre sie von fern, von nah und wieder aus der Ferne. Manchmal werden sie durch das Brummen und Krachen eines Lasters, manchmal durch menschliche Stimmen übertönt. Wenn das Brausen und Dröhnen und Knattern vorbei ist, höre ich seine schweren Schritte wieder, höre ich sie rhythmisch widerhallen. Einmal. Mehrmals. Hundertmal.
Der schmerzliche Knall einer Peitsche weckt mich aus meinem Schlummer. Ein halbnackter Hohlkopf quält ein erschöpftes Tier fast zu Tode. Ein Büffel hat sich auf den staubigen Boden hingelegt, sein Mund voll Schaum, seine Rippen ragen zum Himmel empor. Der ebenfalls abgemagerte Mann hebt seine Peitsche, schlägt auf die hungrige, armselige Kreatur nieder. Auf dem ganzen Areal stehen, liegen, leiden Hunderte von Büffeln, aneinandergekettete Tiere, ihre Häute gebrannt, mit Nummern und Zeichen und Narben versehen. Die Büffel werden in Lastern herbeigekarrt, abgeladen, auseinandergetrieben und wieder neu versammelt. Das weite leere Feld hat sich über Nacht zum Viehmarkt verwandelt, der Staub durch Urin getränkt, mit grünem, teils flüssigem Mist vermengt. Zwischen den Tieren bewegen sich Kinder. Sie sammeln den Mist, weichen den Peitschenhieben der Viehtreiber aus. Hunderte von Tieren stehen stumm, von Fliegen genervt, von Hunden belästigt, vom Hunger verstummt. Menschen, Metzger richten über sie, kranke, erschöpfte Arbeitstiere aus fernen, vertrockneten Feldern, sie verhandeln über ihr Fleisch, ihre Knochen, ihre Häute, über den eingesammelten Haufen Mist.
Über Leben.
"Bald werden deine Geschwister wach. Du solltest ein Bad im Fluss nehmen, dich frisch machen, etwas essen."
Ich sehe sie mit halb offenen Augen an. Wie sehr Ammayi meiner Mutter ähnelt!. Ihre Stimme ist der der Kleinen Rose ähnlich, auch ihr Lächeln.
"Ammayi, ich habe keinen Hunger."
"Hörst du etwa auf zu atmen?”
Sie unterbricht mich. Aus einer mitgebrachten kleinen Handtasche nimmt sie einen Kamm, streicht durch ihr grauweisses Haar.
"Das Leben geht weiter!"
Sie sieht mich an, ihr Gesicht sanft und gütig, ein kleines Lächeln schenkt sie mir. Sie legt den Kamm in die Tasche zurück, glättet ihre Mundu, richtet sich zu recht. "Vielleicht ist der Tod nicht das Ende des Lebens. Vielleicht ist das Leben eines Menschen eine Blume unter vielen auf einem prächtigen unsichtbaren Baum. Müssen nicht verwelkte Blumen fallen, damit die Knospen blühen?"
Celine sitzt aufrecht, betrachtet Ammayi, betrachtet mich, bleibt eine Weile reglos. Mit offenen Augen starrt sie uns an, erkennt uns nicht, auch ihre Umgebung nicht, sie blickt verwundert auf das offene Feld. Sie sieht die vielen Büffel und die Händler, den Staub, den die Herde aufwirbelt.
"Dämonen",.
Sagt sie zu sich.
"Dämonen."
Ammayi steht auf, berührt ihre Stirn, drückt ihren Oberkörper sanft auf die Bastmatte.
"Die kleine Rose steht inmitten der Herde und weint. Siehst du sie?"
Fragt sie mich.
"Schlaf weiter, Celine. Bleib noch eine Weile liegen."
Ammayi sieht mich an.
"Sie hat im Schlaf gesprochen. Sie ist noch nicht wach. Sie muss immer noch Medikamente nehmen, nicht wahr?"
Ammayi deckt sie mit ihrem dünnen Schal zu, bleibt eine Weile neben ihr sitzen.
"Alles musst du nicht alleine regeln. Sprich mit deinen Geschwistern. Auch sie müssen Verantwortung tragen."
Chandu fährt Molly und mich zur Hütte von Thankachan. Seine Frau Lissy bietet uns süsses Gebäck an, bereitet uns einen Tee zu. Sie übergibt Molly einen Korb voll warmen Idli[7] eingepackt in verwelkte Bananenblätter. Auch einen selbstgemachten Kranz aus Marigold und Jasminblüten.
"Kommt heute der Priester?"
Fragt sie uns.
"Wenn nötig, fahre ich heute noch zum Bischofspalast und zerre unseren Pfarrer aus seinem Versteck heraus"
Antwortet ihr Molly.
Meine Augen schweifen über die brachliegenden Reisfelder, zum grossgewachsenen Mangobaum, den Vater einst gepflanzt hatte, hinüber zum grossen Felsbrocken. "Wir sind beide von dem grossen Felsen drüben in den Teich hinuntergesprungen. Wir haben in dem kleinen Bach gebadet. Erinnerst du dich?" Mein Bruder schmunzelt.
"Damals gab es Wasser, soviel klares Wasser. So heftige Regenfälle wie damals haben wir nicht mehr. Keinen richtigen Monsun mehr. Jetzt pinkelt der Himmel auf uns nieder!"
Ich erinnere mich an die heftigen Regengüsse, an unseren tosenden Wasserfall, an unseren friedlichen Bach, der sich zwischen Felsen dahinschlängelte, mit kleinen bunten Kieselsteinen, mit grünen länglichen Blättern, die unter der Wasseroberfläche tanzten, ich erinnere mich an die leuchtend grünen Pflanzen an den Ufern, mit grossen gewölbten Blättern, mit silbrig schimmernden Wasserlachen, in den Blättern gefangen, weisse Wolken widerspiegelnd, den unendlich weiten Himmel widerspiegelnd, auch die Gesichter neugieriger Kinder.
Ich stelle mir meine Kleine Mutter vor, wie sie uns Kinder im Bach badet, wie sie die Reishalme schneidet, wie sie zwischen samtgrünen Reisfeldern ruhend dem Säugling die Brust gibt.
Thankachan zieht sich eine saubere Mundu an, ein sauberes, weisses Hemd. Seine Rippen ragen heraus, seine Haut ist voller Falten, seine Augen tief eingesunken.
"Wie lange kannst du bei uns bleiben?"
Will er wissen.
"Wie lange?"
Ich muss ihn enttäuschen.
"Vierzehn Tage. Wenn ich anfangs Juni nicht zurück bin, müsste ich mir eine neue Stelle suchen."
Thankachan sieht mich mit Bestürzung an. Eine Weile bleibt er sprachlos stehen. Er sieht mich fast flehend an.
"Kannst du nicht mit deinem Arbeitgeber reden?"
"Habe ich. Habe ich getan!"
Ich sehe die Erschöpfung in seinen Augen. Die Verzweiflung. Seine Ängste.
"Unsere Schwestern leben weit weg von hier. Wir brauchen ihre Zustimmung, ihre Unterschrift. Und unsere Behörden! Alles schleppen sie unendlich vor sich hin. Bis zum Jüngsten Gericht!"
Sein Blick schweift über die hundert Kokospalmensetzlinge, die er eigenhändig gepflanzt hat.
"Für eine Bewässerungspumpe brauche ich Dokumente über den Bodenbesitz. Für Strom. Für verbilligten Reis!"
Er wischt eine Träne aus dem Augenwinkel, nimmt einen Schirm und tritt aus seiner Hütte.
"Ich beanspruche nicht mehr den ganzen Boden"
Stottert er vor sich hin.
"Ich komme dir soweit entgegen. Und wie sollen wir das Chathom-Fest nach vierzig Tagen feiern, ohne dich?"
Brennende Reifen, wehende Fahnen, blutrünstige Menschen. Steine pflastern unseren Weg, eilig auf die geteerte Strasse geworfen, oder mutwillig in der Mitte angehäuft. Ein Knall erschreckt uns zu Tode. Ein Stein zerschmettert die Windschutzscheibe, zwingt unseren Fahrer Chandu anzuhalten. Weitere Steine fliegen. Schreie. Des Jubels. Der Angst.
"Nichts soll sich hier rühren. Keine Hunde bellen. Kein Grashalm sich bewegen!"
Zehn, vielleicht fünfzehn Männer treten hervor, mit Schlagstöcken und Messern bewaffnet, sie zerren Chandu aus seinem Auto heraus. Sie spucken ihn an, treten ihn, bedrohen ihn mit Messern. Ich möchte aus dem Auto steigen, mit den Menschen reden, sie zur Vernunft bewegen. Molly hält mich zurück, auch Thankachan. Wieso quälen sie Chandu?
Ein mir unbekannter Mann zerrt mich aus dem Auto heraus.
"Wieso? Wieso tun Sie das?"
Der Fremde erhebt seine Faust. Ich schreie ihn an.
"Wieso?"
Thankachan springt aus dem Auto heraus, wirft sich zwischen den Fremden und mich. Ein zweiter Fremder erkennt meinen Bruder, überredet den ersten, zurückzuweichen.
"Ihr dürft nicht weiterfahren. Und wer ist der hier?"
Er zeigt auf mich, brüllt seine Kumpel nieder.
"Schluss! Schluss! Hört auf!"
Thankachan klärt ihn auf, erzählt ihm von der toten Mutter. Der Fremde bittet Molly und Lissy auszusteigen.
"Ihr könnt nicht weiterfahren. Wir lassen heute gar keine Autos durch. Keine Busse. Keine Laster. Wir streiken."
Chandu steht auf. Die wild wütende Horde zwingt ihn zurück ins Auto.
"Wieso streiken Sie?Warum lassen Sie uns nicht weiterfahren?"
"Blöder Hund! Wohnst du nicht auf diesem Planeten?"
In wenigen Sätzen kann ich ihm den Verlauf meines Lebens samt den seltsamen Wendungen nicht schildern.
"Ich wohne nicht mehr hier. Meine Mutter..."
"Blöder Hund!"
Er unterbricht mich.
"Du willst dich um eine Tote kümmern? Kümmerst du dich etwa um uns Lebende? Einer von uns ist umgebracht worden. Kümmert dich das etwa?" Er heizt seine Anhänger mit Schlachtrufen an. "Inqulab Zindabad[8]. Inqulab Zindabad. Inqulab Zindabad!"
Lang lebe die Revolution! Sie werfen Steine gegen einen sich nähernden Laster, zerren den Fahrer und den Beifahrer aus der Lastwagenkabine.
"Geht zu Fuss",
Schreit uns der Mann an.
"Geht zu Fuss, wenn ihr eure Kinder lebend wiedersehen wollt!"
Die Läden entlang der Hauptstrasse sind alle zu, auch der Gemüse- und Lebensmittelmarkt bleibt geschlossen. Randalierer schleudern Steine gegen geschlossene Läden, schubsen und stossen Autos von der Strasse weg, zünden angehäufte Reifen an. Am Rande des offenen Markts, inmitten der kleinen Stadt Iritty, stehen sieben Polizisten. Vergnügt blicken sie zu den brennenden Reifen hinüber. Friedfertige Menschen stehen ratlos herum, sie warten auf das Ende des Aufruhrs. Sie blicken hinüber zu den herumstehenden Polizisten und hoffen, dass diese für Recht und Ordnung sorgen, hoffen umsonst.
Der leitende Polizeioffizier, seine Mütze mit drei Sternen geschmückt, ruht auf dem vorderen Sitz eines khakifarbenen Jeeps. Er öffnet seine Augen kurz, schliesst sie alsbald wieder. Auf dem Viehmarkt nebenan hungern die zusammengetriebenen Tiere, sie dürsten, die schwächsten unter ihnen verenden qualvoll. Einzelne Händler treiben ihre Büffel auf glühender Strasse, führen sie ins Paradies unter Palmen zu den Schlachthöfen an der Küste.
Gottes eigenes Land!
Mitten auf dem Viehmarkt steigt ein Fremder auf einen verwaisten Ameisenhaufen, trauert den misshandelten Tieren und den glücklosen Menschen nach. Der Staub fliegt ihm ins Gesicht. Er erntet den Spott der Viehtreiber, die Verachtung der Polizisten, den Ekel der versammelten Menschen. Er ist spärlich gekleidet, fast nackt, sein Leib abgemagert, das Haar voll Knoten. Er schreit seine Worte in den Wind.
"Mensch, sei menschlich! Liebt eure Bäume. Liebt die Tiere. Liebt eure Kinder!"
In der Mittagshitze steht er allein inmitten Hunderter von Tieren, teilt ihren Hunger, ihren Durst, bettelt. Ein Händler wirft ihm ein paar Münzen zu, bittet ihn wegzugehen. Ein anderer gibt ihm etwas zu trinken. Ein dritter bedroht ihn mit seiner Peitsche. Hin und wieder steigt der Bettler von dem verlotterten Ameisenhügel herunter, kratzt sich den Rücken, entfernt Läuse aus seinem Haar, behandelt seine Wunden.
"Du hast dieses Land sehr früh verlassen. Die Fanatiker geben heute den Ton an. Sie lassen uns Lebende nicht leben, sie lassen die Toten nicht ruhen. Die Christen rufen zur Konversion aus. Die Hindus zum Swaraj[9]. Fanatische Moslems zur Jihad[10]. Und die Kommunisten verkünden unbeirrt die Revolution. Alle bieten dir den Himmel an. Weisst du welche Hölle das bedeutet? Du konntest weit weg von hier gehen. Du hast Glück gehabt."
Klagt Thankachan.
Ammayi hört alles gespannt an, blickt unentwegt auf das Feld, auf dem die Tiere dicht beieinander stehen.
"Wir sind nicht stumme Tiere!"
Ammayi erhebt ihre Stimme, will das Jammern meines Bruders nicht hinnehmen.
"Wenn die Sonne etwas abgeschwächt ist, tragen wir die kleine Rose zu Fuss zum Friedhof. Niemand wird es wagen, uns auch nur einmal aufzuhalten!"
Ein halber Hektar umzäunter Erdboden, darin einhundert, vielleicht zweihundert dicht nebeneinander liegende, unebene Stellen mit schräg stehenden, von Ameisen befallenen Kreuzen. Ein frisch ausgegrabenes gelbrotes Loch inmitten teils verwelkten, teils vertrockneten Unkrauts. Ein vor langer, langer Zeit weiss bemalter, ergrauter Engel, von wildwachsenden Kletterpflanzen umschlungen, die Zementflügel halb zerfallen, wacht über die Toten. Ein herbeigeeilter Hilfspfarrer stottert, singt, spendet uns seinen Segen. Verschwitzt und ausser Atem ringt er nach Trost spendenden Worten, beschwichtigt uns mit Bildern eines uns liebenden Gottes, Metaphern einer uns versprochenen Ewigkeit, bemüht sich, die eigene Trauer, seine Zweifel zu verdrängen, seine Tränen zurückzuhalten. Wir senken den kleinen Sarg in das gähnende, armselige Loch, werfen der kleinen Rose weisse, gelbe und rote Blumen nach, kleine zittrige Hände voll Erde nach, flüchten in die Blicke, in die Arme uns nahestehender, uns liebender Menschen, blicken still, verwundet zur Erde.
Die winzigen Blüten der Kaschewbäume vertrocknen in der gnadenlosen Hitze. Mit jedem Windstoss regnen sie tausendfach, millionenfach auf die glühend heisse Erde nieder. Der Staub bedeckt jedes Blatt, alles Laub, färbt die Bäume gelb oder rotbraun. Auf den fernen Hügeln entstehen täglich neue Waldbrände. Ausgetrocknete meterhohe Grashalme brennen lichterloh, setzen Bäume in Brand, auch dichte Ansammlungen von Bambus. Nachts glüht der Horizont, leuchtet der Himmel. Asche schwebt über den Feldern weit und breit. Am Tag ziehen sich die Händler in Iritty vom offenen Markt zurück, kämpfen um schattige Plätze und Nischen am Marktrand, harren unter mit Tüchern und Stofffetzen überspannten Bäumen aus, blicken hoffnungsvoll zum Himmel.
Ammayi schlichtet den Streit zwischen meinen Geschwistern, spricht Celine Mut zu, erzählt mir Geschichten aus ihrem bewegten, sinnerfüllten Leben. "Schau mal hier", ruft sie mir immer wieder zu. "Schau dir diese Wolken an!" - "Schau dir den Fluss an!" - "Schau dir diesen Vogel an!" Sie betrachtet alles mit der Neugier und der Begeisterung eines Kindes, begegnet den Menschen um sich mit Achtung, mit Zuneigung, gar mit Liebe. Die kleinen, die grossen Spannungen, die Unglücksfälle des Alltags erschrecken sie wenig, bringen sie kaum aus der Fassung. "Alles wird gut", höre ich sie oft sagen. Oder "alles wird sich so entwickeln, wie es sich entwickeln muss."
Manchmal glaube ich, sie sei wieder ein Kind, unschuldig, neugierig, bloss naiv. Ich denke, sie nimmt alles nur hin, erduldet alles, betrachtet alles als Schicksal. Dann sehe ich ihre Trauer, ihren Zorn, wie sie alles abwägt, wie differenziert und menschlich sie über alles urteilt. Wie sie handelt, wie sie die kleinen Dinge des Alltags verändert, wie sie Grosses träumt und in die Wege leitet. Wie sie versagt oder sich täuscht, auch mal ein harsches Wort fallen lässt. Und es bereut. Ich sehe die Geduld und die Zuversicht, mit der sie allem entgegenblickt. Dem kommenden Tag. Der drohenden Dürre. Dem unausweichlichen Tod.
Das veraltete Kino 'New India', von dem ich als Kind einst nur träumte, steht am Rande eines fast ausgetrockneten Flusses leer. Das hohe Dachgerüst ist mit stockdunklen, teils schrägstehenden Teakbaumstämmen gestützt, die in drei Reihen aus dem breiten langen Saal emporsteigen und das grauschwarze Dach noch immer tragen. Noch heute blickt man durch die unsäglichen Stämme hindurch auf die Leinwand. Das Dach, aus Palmblättern gewoben, ist löchrig, so auch die aus Bambusfasern gewobenen Wände. 'New India', ein Relikt aus glorreichen Tagen, steht abseits des Viehmarkts, umgeben von verwelkten Palmen. Im Schatten des riesigen alten Gebäudes ruhen sich Büffel und Kühe aus, spielen kleine Kinder Cricket.
Die Dutzend Lautsprecher, die einst von hoch über dem Dach über die Palmspitzen hinweg Filmmelodien ins Landesinnere trugen, hat der alte Kinobesitzer allesamt entfernen lassen, die im Inneren des Kinos jedoch stehengelassen.
"Der Saal wird rege benutzt, bei Hochzeiten etwa."
Erklärt mir der stolze, reiche Mann.
"Wir haben ihn mit neuen Stühlen und vielen länglichen Tischen bestückt. Sie dürfen den Saal frei gestalten. Wir stellen auch Blumen zur Verfügung. Rosen, Marigold, Jasmin. Was Sie nur wollen!"
Dass meine Geschwister den finsteren Saal mit Unmengen von Papierblumen schmücken, ist der geringe Preis dafür, dass ich alle unsere Nachbarn einschliesslich der Muslime und der Hindus, sogar die Unberührbaren zum Chathom einladen darf. "Die Ehrung der Toten findet gewöhnlich unter 'uns' statt, meckert der eingeladene Pfarrer. "Sie alle waren Freunde und Bekannte meiner Mutter", entgegne ich. "Die Rose hätte niemanden ausgeschlossen!" Ammayi nimmt mich in Schutz. Der Pfarrer gibt nach. Er sucht sich eine Stelle an einem Tisch direkt neben der Leinwand. Allmählich treten sie alle in den Saal ein, alle, die der kleinen Rose nahegestanden hatten oder verwandt waren und zum Fest vorbeikommen konnten. Ich begrüsse unsere Nachbarn. Ich begrüsse die Geschwister meiner Mutter, ihre Kinder und deren Kinder. Die Geschwister meines Vaters, den bald hundertjährigen gebrechlichen 'General', auch seine Schwestern und deren Kinder.
Schweigend essen die Anwesenden aus Bananenblättern. Meine Schwestern servieren unseren Gästen Reis, Linsen, Pappad[11] und fünf verschiedene Gemüsegerichte. An den Enden der Bananenblätter stellen sie Früchte hin. Mangos, Ananasscheiben, purpurrote Bananen. Ich sehe den alten Metzger Mani, den Betrüger Anthony, den schweigsamen Sakristan. Ich sehe den Sohn des alten Moslems Mustafa, die Kinder von Pathumma und Ragini, auch Nonnen und Novizinnen aus einem benachbarten Kloster. Ich sehe Dämonen und Engel und die Gespielinnen der Götter versammelt.
Ich sehe viele unserer Verwandten, unserer Nachbarn, Freunde und Freundinnen, die Rose und Ammayi, aber auch mich durchs Leben begleitet hatten, Menschen, die wir aus den Augen verloren hatten und die heute, nach vielen, vielen Jahren zusammengekommen waren. Sie wagen es kaum, miteinander zu reden, lieber flüstern sie einander zu, unterdrücken ihre Worte und Gesten, um meine verstorbene Mutter zu ehren. Auf einmal kichert ein Kind, bringt die neben ihm sich befindenden Menschen zum Schmunzeln. Allmählich reden sie miteinander, leise zunächst, dann lauter. Irgendwann einmal lachen die Kinder laut. Ohne Hemmungen rennen sie um die Tische herum, spielen ihre Streiche.
"Wir waren in der Primarschule zusammen. Erinnerst Du dich?"
"Wir sind beide einmal mit dem Boot des Fährmanns Kochunni den Fluss hinuntergefahren. Ob Du mich noch erkennst?"
"Ich bin der Sohn des Schneiders Raman. Mein Vater war ein enger Freund deiner Grossmutter."
Die Männer, die mich ansprechen, haben alle graue Haare. Einer hat keine Zähne mehr. Ein anderer hat sehr viele Falten im Gesicht. Der dritte ist abgemagert und sieht sehr alt aus. Doch in den Gesichtern der verarmten Tagelöhner entdecke ich die Gesichter der Kinder wieder, die ich einst kannte und die meine Freunde waren. Nach mehr als vierzig Jahren sind ihre Worte herzlich, jedoch karg.
"In welchem Land lebst du jetzt?"
"Ist es dort nicht schrecklich kalt?"
Ich frage sie nach ihren Kindern, nach ihren Ernten, nach der Verspätung oder dem Wegfall des Monsuns. Sie antworten mir in knappen Worten, bejahen, verneinen, nicken mit den Köpfen. Bald fehlen uns die Worte und sie verlassen mich, kehren mir den Rücken. Und ich verstehe sie. Sie tragen noch ihre Mundu, kämpfen täglich mit der rauhen Erde, leben von der Hand in den Mund. Ich trage Hosen. Ein gebügeltes Hemd. Ich bin nicht mehr von hier, teile nicht ihre Not. Meine Hände sind weder durch Arbeit verhärtet noch durch die Jahre verwelkt. In ihren Augen bin ich reich, habe das Land verlassen, die Fronten gewechselt. Ich bin ein Ausländer. Ein Fremder. Ein Verräter.
Ich sehe Ammayi, wie sie sich unter die Menschen begibt, mit ihnen plaudert, den einen oder anderen berührt. Ich sehe, wie sie einen Jungen hier, ein Mädchen dort umarmt. Ein Kind tröstet. Manchmal blickt sie zu mir herüber und lächelt. Manchmal nimmt sie die Hände eines vertrauten Menschen in ihre Hände, verleitet mich zu glauben, sie nehme meine Hände, schenke mir Kraft und Zuversicht. Und obwohl das mit Girlanden geschmückte Bild meiner Mutter in der Mitte des Saals mich an der Gewissheit ihres Todes nicht zweifeln lässt, sehe ich die kleine Rose lebend vor mir, sehe ich sie in Ammayi, in den Menschen um mich weiter leben.
Und wenn alle den Raum verlassen haben, wenn auch die Stühle und Bänke weggeräumt und die grossen Lichter gelöscht sind, stehe ich im düsteren Saal einen Augenblick still. Erschöpft und wehmütig betrachte ich sie von mir fortgehen, meine Nachbarn, meine Geschwister, Freunde. Ein Mann reitet auf einem Büffel, gleitet wie ein Schatten zwischen den Palmen an dem Kino vorbei. Auf den Feldern unweit des Kinos werfen Palmbätter im Mondlicht ihre Schatten. Rund um die Baumstämme entstehen tief dunkle Flecken. Zwischen ihnen, auf sandigem Boden, breiten sich Netze aus Licht und Schatten aus, ein geheimnisvolles Labyrinth. Das Leben ruht. Erinnerungen und Träume ruhen.
An der Schwelle des Kinos ruhend, betrachte ich Ammayi. Sie begibt sich ein Stück auf das offene Marktgelände, verabschiedet sich von ihren Schwestern, winkt ihnen nach. Und ich denke, dass ich derjenige bin, der hier Abschied nimmt. Nicht die kleine Rose. Auch nicht Ammayi. Ich verlasse meine Geschwister. Ich verlasse mein Land. Meine Götter. Ein Fremder bin ich. Hier, von wo ich weggezogen bin. Dort, wo ich angekommen bin. Mein Verlust schmerzt, die Einsamkeit erdrückt mich. Meine Hände, meine Lippen zittern. Ich falle. Ich spüre keinen Boden mehr unter den Füssen, greife nach dem wackligen Türrahmen, nach verwelkten Palmblättern, nach der weiten leeren Leinwand.
Doch dann berührt mich Ammayi. Hält mich. Zieht mich zu sich. Vereinzelte, grosse Regentropfen peitschen auf die Palmblätter nieder, schmerzen auf meiner Wange.
"Nichts geht dir verloren, solange du es in deinem Herzen trägst",
Tröstet mich Ammayi.
"Du hast diese Welt, wo immer du bist. Und du gewinnst eine neue dazu, andere dazu, wenn du für sie offen bist. Weine nicht, mein Sohn...Lebe!"
[1] Fest zur Ehrung eines Toten (in der Regel nach vierzig Tagen)
[2]] Kriegergestalt aus Mahabharatha
[3] Sohn Ardchunas
[4] Figur aus Mahabharatha, Krieger
[5] Gespielinnen der Götter
[6] Gottheit, der die Toten ins Jenseits begleitet
[7] Knödel aus Reis
[8] Parole der Kommunisten
[9] Selbstverwaltung unter Herrschaft der Hindu Mehrheit
[10] Heiliger Krieg gegen Feinde des Islams
[11] Einheimische gewürzte Chips

Einsam, kaufte er für sich eine Katze.
Das erste Mal, das ich meinen Bruder Jimmy das Leben rettete, war er knapp zwei Jahre alt. Er spielte im Wasser, das sich durch den Dauerregen milchig verfärbt, durch einen mit bunten Kieselsteinen gesäten Bach friedlich dahin floss. Er spielte im Wasser unter den wachsamen Augen der Kleinen Rose, die Knie tief im Wasser stehend unsere Kleider wusch. Von den bunten kleinen Fischen vernarrt, wagte er sich in die Mitte des knapp drei Meter breiten Gewässers, verlor seinen Halt und taumelte in Richtung eines kleinen, felsigen Wasserfalls.
Als junger Mann rief er mich eines Tages aus Bombay an. Er sei des Diebstahls bezichtigt, sässe seit zwei Wochen unschuldig im Gefängnis, wo er täglich von Polizisten malträtiert und geschlagen wird, log er mich an. Eilig flog ich von Zürich nach Bombay, wo ich ihn in einer heruntergekommenen Einzimmerwohnung mit schimmligen, feuchten, Wänden fand. Er kroch vor Schmerz auf dem ekeligen Zementboden einer winzigen Toilette, ein dreckiges Loch im Boden, er hatte Gonorrhö und keine einzige Rupie in der Tasche.
Filou habe ihn verlassen, wimmelt er am Telefon. Er sei leicht betrunken gewesen, es sei ein sinnloser Streit zwischen ihnen entflammt, sie habe ihn zu Boden geschlagen. Seine Frau habe alles Geld mitgenommen und die gemeinsam geführten Konten gesperrt und sei seit vier Wochen spurlos verschwunden. Er wimmelt und flucht, fleht mich an, ihm per Post dringend etwas Bargeld zu schicken, hundert Dollar etwa. Wenigstens hundert Dollar. Ich rufe Celine an. Ja, es gehe ihm schlecht, er sei Mittel los, die Frau habe ihn verlassen, bestätigt meine Schwester. Zu Recht meint sie. Er habe sie geschlagen, immer wieder, Jahre lang.
Bloss hundert Dollar!
Chetta!
Ja, Jimmy?
Seit Tagen bin ich krank. Oft bewusstlos. Ich habe Wunden am ganzen Körper. Ich weiss nicht mehr welcher Tag, welche Woche oder Monat. Meine Katzen fressen mich beim lebendigen Leib.
Was erzählst Du da?
Ich flehe dich an! Bitte hilf mir! Kannst du nicht für ein paar Tagen nach Indien kommen? Für eine Woche?.
Immer wieder ruft er mich an mit seinem Mobiltelefon, bittet mich ihn zurückzurufen. Wie soll ich ihm glauben?
Du spinnst!
Meine Frau hat die Nase voll.
Geh doch hin, wenn du es nicht lassen kannst! Dein Bruder weisst ganz genau, dass er dich um die Finger wickeln kann. Wie oft hat er dich angelogen? Wie viele Tausend Franken hast du ihn geschickt? Seinetwegen in den Wind geschmissen?
Schau. Die Flüge dorthin kosten sieben hundert, acht hundert Franken. Es ist nicht viel. Und ich mache das zum letzten Mal. Ich kenne meinen Bruder Jimmy. Sicher hat er seine Schwächen. Aber er steckt wirklich in Schwierigkeiten. Wenn nicht wir, wer soll ihm überhaupt noch helfen? Sei nicht so …Du weisst, ich bin der Älteste meiner Familie. Er ist mein eigener Bruder.
Bist du seinen Hüter?
Ich schweige.
Bin ich meines Bruders Hüter?
Die Stewardess lächelt mich an.
Was hätten Sie gerne zum Trinken? Bier? Wein? Whiskey?
Einen Orangensaft, bitte!
Ich hätte Lust auf Whiskey, aber irgendetwas nagt mich. Soll ich mir so ein Luxus gönnen, wenn mein Bruder in Armut lebt? So ein Mist, denke ich. Warum bloss habe ich nicht einen Whiskey bestellt? Ich habe für den Flug bezahlt, damit auch für den Drink. Und was soll sich ändern, wenn ich statt den Whiskey einen Orangensaft trinke?
Idiot.
Fluche ich.
Ich sehe die zarten, biegsamen Stiele der Zehrwurz, mit kristallklaren Wasserlachen, gefangen in den Vertiefungen der breiten, graugrünen, herzförmigen Blätter. Jimmy taumelt in der Strömung. Kleine Hände, kleine zarte Füsse, ein wehrloser Körper, der Felsen und Fällen und Höhlen naht, den sicheren Tod. Ich laufe entlang der samtgrünen Reisfelder, schreie, laufe immer schneller und stürze mich in den nun tosenden Bach und fange ihn auf. Ich ziehe ihn ans Ufer und sehe zu, wie die Kleine Rose ihn in den armen nimmt, ihn mit hunderten von Küssen zudeckt und beruhigt. Atemlos schaue ich zu.
Sir, Orangensaft.
Vielen Dank!
Als mein Bruder Babu mit zwei Jahren starb, war Jimmy gerade geboren. Als ich zur Missionsschule ging, war er knapp drei Jahre alt. Habe ich mit ihm noch gespielt, als er ein Kind war? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Bloss darauf, dass er sonntags immer auf Vater gewartet habe, bis er mit etwas Fleisch, gebunden in Teakblättern nach Hause kam. Er hasste es, Reis oder Tapiocca nur mit Gemüse zu essen. Er brauchte Fleisch oder Fisch dazu. Lieber blieb er hungrig als nur ein wenig Linsen oder Bohnen oder bittere Gurken zu essen. Eine verfaulte, wurmige, gegrillte Sardine war ihm viel lieber.
Isst doch! Isst doch, du Idiot! Komm frisst!
Eine verfaulte rohe Sardine habe ich ihm eines Tages ins Maul gedruckt, als wir beim Essen waren, um ihn von seinem andauernden Heulen abzuhalten. Er hatte uns allen genervt. Wir Kinder sassen am Fussboden unsere Lehmhütte, stopften Reis und Tapiocca in den Mund und genügten uns mit scharfer Kandhari, gepresst in eine Salzlösung. In der Regenzeit hatte die Kleine Rose nichts anderes uns Kindern und auch Vater anzubieten als scharfer Chilli mit ihrem Daumen gepresst in Tränen.
Immer wieder erinnere ich mich an diesen Vorfall. Ich schäme mich,immer noch.
Jimmy war sonderbar. Wir Kinder kämpften, schlugen uns mit Händen und Füssen, spielten unsere Streiche. Er schaute uns zu, freute sich und lächelte. Er vermied das Spiel, vermied den Kampf. Er behauptete von sich, er sei Vaters liebstes Kind. Blieb in seiner Nähe. Und Vater behandelte ihn behutsam, schonte ihn von der harten Arbeit auf den Feldern, von allen Entbehrungen. Stets blieb Jimmy abseits. Er war oft allein. Er hatte meistens Pech. Immer wieder stolperte er über dies und das. Oft fiel er zum Boden.
Haben Sie sich entschieden? Veg oder Nonveg?
Entschuldigung. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Was haben Sie?
Chicken oder Pasta?
Chicken.
Und Sie?
Meine recht mollige Sitznachbarin, will ebenfalls Chicken. Noch schaut sie einen bunten Bollywood Film an, der sie köstlich amüsiert. Als die Hauptdarsteller, die Frau in eine bunte rosarote Sari und der Mann in einem hellweissen Anzug, auf einer blumenbewachsener Wiese in einem Schweizerischen oder Österreichischen Tal zum Tanz ansetzen, beginnt sie fröhlich mit zu schwingen. Sie hebt ihre Hände bis auf die Brusthöhe und schnipst ungeniert mit den Fingern. Dann schaut sie zu mir hinüber und lächelt.
Ich hoffe, ich störe sie nicht.
Nein, im Gegenteil. Tanzende Frauen sind mir auf einem Langstreckenflug eine willkommene Abwechslung. Normalerweise begegne ich unruhige Menschen. Sonderbare Gestalten.
Unruhig?
Das letzte Mal als ich nach Mumbai flog sass ich unglücklicherweise neben einem etwa fünfzigjährigen Mann. Er schaute einen amerikanischen oder italienischen Klamauk mit Bud Spencer und Terrence Hill, zitterte seine rechte Knie permanent und haute auf den Oberschenkel wenn ihm ein Spruch komisch klang oder eine Szene lustig erschien. Und als der Film dann endete, spielte er den gleichen Film wieder ab und haute auf seinen Oberschenkel.
Ich muss beim Bollywood-Filmen tanzen.
Bitte, bitte machen Sie nun weiter.
Sie schien völlig zufrieden mit sich. Sie hatte ein recht hübsches Gesicht, dunkle grosse Augen, tief schwarzes Haar und einen dutzend schimmernde Armreifen. Ich schätzte sie um die dreissig, unverheiratet. Sie trug eine türkisblaue Sari und eine ebenfalls türkisblaue bluse, deren kürzen Ärmel reichlich mit goldenen Stickereien versehen waren. Sie hatte eine leicht knollige Nase und einen leichten Doppelkinn. Wenn sie sich nach vorn bückte offenbarte sich ihre helle Haut, ihre kraftlose Brüste und das Quäntchen extra Fett unter ihrer Blusenrand.
Nachdem wir mehr oder weniger schweigend gegessen hatten, wagte ich sie anzusprechen.
Leben sie in Europa?
Bis jetzt. Ich habe in Sorbonne studiert und kehre nach Neu Delhi zurück.
Oh, wie schön! Was haben Sie studiert, wenn ich fragen darf?
I habe meine Doktorarbeit geschrieben. PhD.
Und das Thema?
Michael Foucault und Sexualität.
Wie aufregend! Ich verstehe, warum sie so fröhlich und selbstsicher sind.
Ich bin glücklich weil ich nach Hause fliege. Nächste Woche, heirate ich.
Gratuliere!
Danke. Ich bin so aufgeregt, meinen Künftigen zu sehen. Zum ersten Mal!
Kennen sie ihn nicht? Eine arrangierte Ehe?
Natürlich!
Michael Foucault, Sexualität und eine arrangierte Ehe, wie passen diese Dinge denn zusammen?
Kein Problem für mich.
Was halten Sie von Selbstbestimmung?
Daran glaube ich nicht. Wen ich heiraten soll, ist vorbestimmt.
Sie wählte noch einen kitschigen Bollywood Streifen. Schaukelte sich hin und her. Schnipste mit den Fingern.
Jimmy führte eine arrangierte Ehe. Alle meine Geschwister waren mehr oder minder zwangsverheiratet. Sie hatten alle ihre jeweiligen Partner drei oder vier Wochen vor der Vermählung getroffen, ein einziges Mal, in einem recht feierlichen Rahmen und unter den wachsamen Augen meiner Eltern. Sie alle lebten ‚glücklich‘ und zufrieden. Die Männer bestimmten, die Frauen dienten. Christliche, hinduistische, muslimische Ehen.
Wenn eine Kuh brünstig ist, muss man sie halt zu einen Stier führen. Höre ich Vater sagen.
Filou, die Frau von Jimmy war eine zarte Seele. Schweigsam und fleissig, widmete sie sich ganz dem Wohl ihres einzigen Kindes. Sie war Kassiererin bei einer lokalen privaten Bank, arbeitete gleich viel wie bei einer staatlichen Einrichtung, verdiente jedoch nur einen Bruchteil dessen, was eine Angestellte der staatlichen Banken verdiente. Militante kurzsichtige Kräfte hatten einen halben Jahrhundertlang jegliche Industrialisierung und Innovation, damit alle Entwicklung und die Entstehung von Arbeitsplätzen mit Gewalt verhindert, sodass Filou keinen Ausweg sah, als sich bis zum bitteren Ende, bis zur Pensionierung, mit einem lausigen Einkommen auszuharren. Jimmy, der Ein Studium der Sozialwissenschaften mit Auszeichnung absolviert hatte, war gar Vollzeit arbeitslos. Tag ein Tag aus lebte er in den vier Wänden seiner heruntergekommener Behausung mit dem schrägen, löchrigen Zementdach.
In seiner Einsamkeit, kaufte er für sich eine Katze.
Sie war schwarz und mit weissen Flecken übersehen. Sie kreiste um ihn herum, legte sich zu seinen Füssen. Wenn er sich hinlegte, schmiegte sie sich an ihn und liess sich streichen. Sie knurrte dann in Dankbarkeit. Ihr Fell roch wie das Haar eines Säuglings. Sie hatte zwar ihre Launen aber meistens war sie freundlich und gnädig bestimmt, kam wenn er sie rief, verschwand, wenn er dies befahl. Sie war klein und zerbrechlich und dennoch oder gerade deshalb, nannte er sie Kali, Muttergöttin aller Götter.
Manchmal rief er sie Badhra Kali. Kali, die Fruchtlose. Die Schreckliche.
Jimmy war ein feiner Junge. Wie er aussah mit neun oder zehn oder zwölf, davon habe ich keine Bilder. Habe ich jemals mit ihm gespielt? Haben wir gemeinsam im Fluss gebadet? Sind wir je unter einem Regenschirm zusammen zur Schule gelaufen?
Als ich zum ersten Mal ein Flugzeug bestieg, kam er zum Flughafen, um einen Flieger zu sehen aber auch sich von mir zu verabschieden. Die Maschine faszinierte ihn nur kurz. Er stand vor mir, verzweifelt, sein Gesicht Tränen überströmt. Ich hatte Mühe ihn zu trösten.
Jimmy, hör zu! Jimmy, ich gehe nicht für immer weg. Bestimmt komme ich zurück. Was sind fünf Jahre? Bis dann hast du dein Studium beendet. Bestimmt. Ich sorge dafür, dass Vater dir dein Studium bezahlt. Falls nötig zweige ich etwas Geld von meinem Stipendium ab und schicke es dir. Auf den Philippinen sind die Lebenskosten gleich gross wie in Indien. Ich werde dir alle drei Monate was schicken. Na, was sagst du?
Wer beschützt die Kleine Rose, wenn nicht du?
Sie hat Thankachan, Alice, Molly und Celine. Sie hat Babu. Ausserdem, sie ist stark genug.
Wir Geschwister haben immer auf dem Fussboden geschlafen. Unter einer Decke. Eng umschlungen.
Du bist fünfzehn! Bestimmt willst du das nicht mehr. Und du wirst noch älter.
Fünf Jahre ist eine sehr lange Zeit. Und Philippinen….Wo sind diese Inseln überhaupt?
Er schluchzte wie ein Kind.
Briefe von der Silliman Universität auf den Philippinen benötigten drei bis vier Wochen bis nach Bangalore. Weder er noch meine Familie besass ein Telefon. Ich umarmte ihn, küsste ihn auf die Stirn und zog mich zurück. Ich wusste, dass er mir zuwinkte aber ich drehte mich vor lauter Trauer nicht zurück. Er war fünfzehn und dennoch bloss ein Kind.
Fünf Jahre später war er nicht mehr wieder zu erkennen. Er war viel kleiner als ich, etwas molliger, zerbrechlicher. Er hatte kleine Ohren und er bemühte sich sehr, diese mit langem Haar zu bedecken, was ihm oft misslang, da es genauso wellig waren, wie mein. Sein Hals schien stets geschwollen, wie auch seine Finger. Er hatte schwere rundliche Beine und seine Füsse waren viel zu klein, um sein Gewicht zu tragen. Er hatte ein rundliches Gesicht und wenn er lächelte, strahlten seine tief dunklen, stechenden Augen.
Er hatte sein sozialwissenschaftliches Studium mit Auszeichnung abgeschlossen und hatte Aussicht auf eine Stelle bei der staatlichen „Social Welfare Department“ des Bundesstaates Kerala. In heller Aufregung schrieb mir Vater einen langen Brief.
Es ist eine sehr gute Stelle mit einem unerhörtem Lohn, grossem Ansehen und vielen Privilegien. Aber, der betreffende Minister will viel Geld, na du weisst schon, wie so eine Stelle vergeben wird. Mein lieber Sohn, wenn ich nur könnte, würde ich unser ganzes Grundstück verkaufen, um so eine Stelle zu sichern. Stell Dir vor! Einen höheren Lohn als der eines Arztes! Beamtenstatus! Dies wäre die Rettung unserer ganzen Familie. Schrieb er mir. Liebe Tochter Rose, bitte hilf uns.
Meine Frau und ich rechneten, rechneten und rechneten. Nächte lang dachten wir über diesen unerwarteten Glücksfall. Vor meiner Frau schwärmte ich über Jimmy, wie talentiert er sei, wie fleissig, wie diszipliniert. Dass er sein Studium mit dem ersten Rang der ganzen Universität von Baroda abgeschlossen hatte, sei der Beweis dafür, dass er zum Höheren berufen sei, pflichtete ich meiner Frau bei.
Innerhalb einer Woche schickten wir Vater, die Ersparnisse eines ganzen Jahres. Das Geld wurde Vater von einer indischen Bank nach Abzug einer kleinen Bearbeitungsgebühr bar ausbezahlt. Vater und Jimmy verpackte das Bargeld fein säuberlich in unauffälligen Päckchen und reisten fünf hundert Kilometer nach Trivandrum. Im Nebenzimmer des Ministers trafen sie auf seinen Bediensteten. Unter grösster Geheimhaltung händigten sie ihn hundert tausend Rupien. Anschliessend bedankten sie sich bei dem gutmutigen, grosszügigen Minister für Soziales für die versprochene gutbezahlte Stelle und kehrte als strahlende Sieger nach Hause zurück.
Jimmy wartete drei Tage, drei Monate, drei Jahre auf die Stelle. Vergeblich.
Der stets flüsternde Minister war inzwischen ins Finanzministerium gewechselt, sein persönlicher Mitarbeiter jedoch blieb beim Sozialministerium zurück. Als Jimmy das viel Geld zurück haben wollte, wurde ihm versichert, der Minister habe alles entgegengenommen und das der Personalassistent selbst, völlig machtlos sei. Der Assistent versicherte meinem Vater, dass Jimmy sehr bald eine ebenbürtige, wenn nicht bessere Stelle im Finanzministerium zugesprochen wird. Ob Jimmy den Minister persönlich sprechen könnte? Doch doch…aber der Minister habe Termine im Inland. Termine im Ausland. Lauter Termine.
In drei Wochen hätte er Zeit.
In drei Jahren, vielleicht!
In dreissig Jahren!
Jimmy heftete sich an den Fersen des christlichen, menschenfreundlichen Ministers, verpulverte noch mehr Geld, um die verlorene Summe zurückzufordern. Er wurde zunächst nur weggeschubst, später mit Fäusten hantiert und zuletzt mit dem Tod bedroht. Nicht direkt und nicht wirklich aber unmissverständlich.
Belästigen Sie nie den Minister! Ansonsten hat ihr Verhalten schwerwiegende Konsequenzen! Verstanden?
Gegen Ende desselben Jahres, wandte sich das Blatt. Jimmy hatte endlich Glück. Eine von der Zentralregierung in Neu Delhi finanzierte private Stiftung zur Wahrung der Interessen von minderjährigen bot Jimmy eine Stelle an, einen bescheidenen aber vernünftigen Lohn dazu und vor Allem, grössere Sicherheit. Er hätte somit eine lebenslange Tätigkeit, mit jährlichen stattlichen Lohnerhöhungen und einer ordentlichen Pension mit fünfundfünfzig Jahren, wie dies bei allen Stellen der staatlichen Verwaltung der Fall war.
Jimmy lebte bescheiden. Er hatte eine kleine, günstige Mietwohnung in einem lebendigen Viertel von Bombay, hatte Freunde und alles was er zum Leben brauchte.
Er hätte ein sicheres, rentables Arbeitsleben! Hätte…
Jimmy betreute Waisenkinder. Sorgte für ihr Wohlbefinden. Kümmerte sich um ihre Kleidun,g ihre Gesundheit und ihre Bildung. Wöchentlich brachte er adoptionswillige Kinder zum Amtsgericht, bereitete ihre Identitäts- und Ausreisedokumente vor. Er begleitete sie hin und her. Mit seinem Einkommen richtete er sich ein, kaufte Möbel ein, gönnte sich ab und zu auch einen Drink in einen der vielen Bars rund um den King’s Circle.
Er heiratete Filou, eine recht hübsche Studentin. Es war eine arrangierte christliche Ehe, wie dies bis heute in Indien üblich ist. Das Sakrament selbst kostete wenig.
Eine Zeitlang lebte das Paar in der Nähe des King’s Circle. Doch als Filou schwanger wurde und als die private Stiftung urplötzlich dicht machte, kehrte Filou zurück zu ihrem Dorf, sie lebte fortan bei ihren Eltern. Warum die Stiftung ihre Tätigkeit beenden musste, vernahm Jimmy aus der Tageszeitung. Mitglieder der Verwaltungsrat, angesehene Männer und ehrbare Frauen, hatten schamlos die öffentlichen Gelder entwendet, Eigentum für sich erworben Auslandsreisen und Hochzeitsfeste finanziert und ganze Summen für Alkohol und Geldspiele und Sex ausgegeben.
Drei Jahre nach seiner Anstellung war Jimmy arbeitslos. In den Bars von Bombay trank er bis hin zur Bewusstlosigkeit. Eine hübsche Prostituierte aus dem verarmten Nepal schenkte ihm Schmerzen im Genitalbereich. Es schmerzte ihm beim Wasserlassen. Er hatte Halsschmerzen. Entzündungen. Fieber.
Er rief mich an. Er log mich an. Älterer Bruder hilft mir!
Er zeigt mir den ärztlichen Befund. Er schäme sich zu tiefst, versichert er mir. Er sei schliesslich ein Mann und kein Asket. Wie hatte er mir alles am Telefon beichten können. Er pflegt mich an, diese peinliche Geschichte niemanden zu erzählen, auch nicht meiner Frau.
Weisst du wie riskant ungeschützter Sex sein kann! Hast du nichts von AIDS gehört? Wie konntest du nur!
Es tut mir leid! Ich schäme mich so sehr! So etwas kommt nie wieder vor.
Du musst mir keine Rechenschaft über dein Sexualleben ablegen. Ich bin kein Moralist und kein Richter. Ich bin dein älterer Bruder aber das gibt mir kein Recht über dich zu bestimmen. Ich glaube an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Aber, eines musst du dir im Klaren sein. Ich bin auch nicht verpflichtet dich aus jedem Dreckloch herauszuziehen. Also, wenn du das nächste Mal in der Klemme bist, ruf mich nicht an. Ich werde dich fallen lassen.
Chetta, ich bin dir dankbar für alles was du für mich getan hast. Ich werde nie wieder…Ich verspreche es dir!
Versprich mir nichts. Versprich niemanden etwas. Hörst du?
Während er sich über Tage erholte, putzte ich seine sieben Quadratmeter Wohnung gründlich, rieb ich den Schimmel von den Wänden ab und schleuderte jede Menge Kleinkram, das er in seinen vier Wänden angesammelt hatten vom fünften Stock hinaus. Er hatte Schuhe, die er nicht mehr tragen könnte. Bücher, die er gelesen hatte und nie wieder lesen würde. Er besass allerlei Gegenstände, einen Bügeleisen, einen Ventilator, einen Regenschirm, die er benötigte aber nur selten brauchte, die den Raum in eine Deponie verwandelte. In der winzigen Toilette mit dem knapp zehn Zentimeter Durchmesser Loch im Boden, in der Toilette, die ihm auch als seine Dusche diente, war auch seine ganze dreckige Wäsche untergebracht. Aus einem leckgeschlagenen Blecheimer, mit einem irgendwie festgeschraubten Wasserhahn, tropfte ständig Wasser, das seltsam roch. Als ich den riesigen Eimer herunter nahm, entdeckte ich darin das Skelett einer lange zuvor verfaulten Schlange.
Wie kannst Du hier nur leben? Hast Du nie den Eimer geleert? Womit ist dieser Scheisswasserhahn hier angeklebt?
Hilflos schaute er zu mir hinauf.
Wohin führt dieses Dreckloch im Boden? Wohin fliesst all die Scheisse?
An den Aussenwänden hat es Röhre. Sie sind nicht dicht. Nicht überall.
Hat der Vermieter diese Wohnung je angeschaut? Waren die Wände frisch gestrichen als du hier einzogst?
Ich habe alles vom Vormieter übernommen.
Auch diese schimmeligen Wände?
Alle Wohnungen dieses Typs sind so. Auch der Vermieter kann nichts dafür. Alle Häuser hier sind so gebaut.
Das glaube ich nicht!
Doch! Irgendwelche Firma hat dies für seine Mitarbeiter gebaut. Für schlecht bezahlte Arbeiter, die null Ahnung von städtischen Wohnungen haben. Die keine Toiletten kennen. Aber die Arbeiter sind inzwischen etwas wohlhabender als die Slumbewohner. Deshalb ziehen sie allmählich in bessere Wohnungen ein und vermieten ihre stark subventionierten Wohnungen an Neuankömmlinge. An anspruchslosere Menschen.
Und was zahlst du für so eine Wohnung?
Eintausend Rupien!
Es waren nicht die Kosten für Antibiotika, die ihm Schulden verursachten, es waren die Gelder, die er für das nackte Überleben benötigte. Er brauchte Geld für seine Nahrung, seine Kleidung, seine Gesundheit. Schlicht für ein Dach über den Kopf. Jimmy war wie Millionen anderer Bewohner dieser monströsen Grossstadt, ein bedeutungsloser Mensch, der wenn er Glück hatte, aufsteigen würde, und wenn er Pech hatte, in den Mühlen der Grossstadt zum Abfall, zum Staub zermalmt würde.
Der Mittelschicht, Menschen mit Bildung und Arbeit, lebten wohlbehütet in sicheren Häusern und Wohnungen. Die Slumbewohner lebten in Familien, in grösseren Gruppen, in Arbeitsgemeinschaften zusammen. Bettler hatten ihre Banden. Taschendiebe ihre Sippen. Die Huren der Stadt hatten ihre Mitstreiterinnen, ihre Zuhälter, ihre barmherzige „Mütter“. Nur wenige Menschen waren in der immensen Menschenmasse von Bombay auf sich ganz allein gestellt.
Jimmy war einer.
Wäre er krank, gebrechlich, kein Mensch würde dies wissen, keiner würde ihm zu Hilfe eilen. Würde er auf einem Gehweg tot umfallen, würde kein Hund nach ihn umdrehen, würde kein Mensch ihm kennen, niemand ihn vermissen. Die Stadtverwaltung würde seine Leiche eine Zeitlang aufbewahren, in irgendwelcher lokalen Zeitung eine Annonce aufgeben, einmal. Dann würden sie ihn irgendwo entsorgen, kein Mensch würde wissen wann und wo.
Komm, wir schauen wo dieses verdammte Loch hinausführt.
Wir liefen entlang meterhohen Mauern aus Abfall rund um das Haus. Der Boden war vom Regenwasser gesättigt, das Gelände mit Pfützen belegt. Die Gehwege der heruntergekommenen Siedlung waren mit Blech, Beton und Brettern trocken gehalten. Entlang der äusseren Wände befanden sich Röhre aber auch Treppen und lose herumhängende Kabel. Stofffetzen, Fetzen aus Jute und Plastik klebten an den Wänden oder flatterten mit dem Wind. Die grauen Wände waren mit schwarzer Schimmel überwuchert. Aus den Löchern in den Wänden flossen seltsame Geschwüre aus organischer Abfälle, menschlichem Haar und Exkrementen.
In der gesamten Siedlung waren hundert solcher Bauten. Alles grau. Alles verschimmelt. Jedes Haus war von einer verfaulenden Mauer aus Abfällen umgeben. Verschlungene Wege führten zwischen den Pfützen, den Häusern und den Abfallgebirgen. Vor jedem Haus standen schlanke Betonmasten, mit einem Wirrwarr von Kabeln und Stofffetzen. Manche diese Rippen, mit Telefon oder Stromleitungen mit einander vernetzet, waren zur Erde geneigt. Ein paar Telefonmasten standen geknickt und hofften auf Erlösung. Hier und dort taumelten von den Leitungen verirrte Papierdrachen, mit Seilen befestigten und in die Höhe geschleuderten Puppen und die verbrannten Körper von Vögeln. Aus den mit Metall barrikadierten Balkonen und Fenstern wehten farbige Blusen, Saris und Hemden. Uralte Menschen mit runzligen Gesichtern, verwelkter Häute und feuchten, tiefsitzenden Augen weilten hinter Gittern und starrten auf den Planet der Verdammten, verschwommen im milchigen Grau des Nieselregens. Hinter dem Schleier, in Dutzenden von Slums trotzten Zelte aus bunten Plastikfolien. Aus der Mitte der Slums ragten dunkelgraue Skelette künftiger Wolkenkratzer in den Himmel empor und trotzten den tollwütigen Westwind.
Jimmy, kein Mensch überlebt diese Stadt ohne Blessuren. Geh zurück nach Kerala. Ich gebe Dir das was du brauchst für den Alltag, bis du eine Stelle gefunden hast.
Was schlägst du mir vor? Es gibt überhaupt keine Arbeit in Kerala. Idioten herrschen dort. Sie lassen keine Unternehmen Fuss fassen. Ihre Schergen treiben jeden in den Wahnsinn, der es wagt, selbständig zu sein oder nur eine kleine Firma zu gründen. Diese Hurensöhne zwingen Millionen in die Sklaverei. Allein aus Kerala sind es mehr als zwei und halb Millionen Billiglohnarbeiter in den Golfstaaten. Aus ganz Indien sind es zehn oder fünfzehn Millionen!
Merken die Menschen in Kerala nicht, dass ihre Jugend Beschäftigung braucht? Dass dort Arbeitsplätze geschaffen werden muss? Dass verantwortungslose Politiker sie in die Auswanderung zwingen?
Baby, die Menschen dort halten sich für sehr gescheit. Aber du weisst, es herrscht dort immer noch das Kastendenken und die Aberglaube. Die Menschen dort glauben immer noch an den Sozialismus. Oder an die Wunder wirkende Jungfrau Maria. Priester und Politiker treiben Menschen in den Ruin. Von Religion und Politik hypnotisiert, sehnen sich viele Menschen nach Unterwerfung. Nach der Sklaverei. Die Priester versprechen Heilung von Krankheiten, Vergebung der Sünden, ewiges Leben. Politiker lobpreisen einen gerechten Staat, wo alle gleich sind. So ein Staat wird allen Arbeit, Nahrung und Bildung bieten. Aber womit soll der Staat alle Menschen beschäftigen? Woher das viel Geld nehmen, um Strassen, Brücken, Krankenhäuser zu bauen? Und wollen alle Menschen wie Fleischhühner leben? In riesigen Fabrikhallen, von einem gutmütigen Staat, einer einzigen Partei, dreimal am Tag gefüttert?
Was willst Du machen?
Ich muss hier ausharren. Eine Stelle finden. Ich schaffe es.
Seine Augen waren rot. Er war abgemagert und kraftlos aber entschlossen. Er wusste, dass das grosse Versprechen der Gerechtigkeit, die leicht über den Lippen der Revolutionäre kamen, eine Illusion war und zwangsläufig in die Sklaverei führte. Er hatte Bücher wie „Animal Farm“ und „Cancer Ward“ gelesen und hatte genügend Menschenverstand zu erkennen, dass in einem riesigen Land wie Indien, Enteignungen, Nivellierungen und Unterwerfung nur mit massloser Gewalt und Inkaufnahme von Millionen Toten durchzuführen war.
Jimmy und ich waren in sehr vielen Fragen uns einig. Wir hätten eineiige Zwillinge sein können. Wir assen vom gleichen Teller, schliefen unter der gleichen Bettlaken, gingen zur Schule unter den gleichen Regenschirm. Wir tranken von den gleichen Brüsten, jedoch unsere Wege führten uns auseinander. Mein Weg war vom Glück gesegnet. Sein Weg führte ihn in das dunkle, aussichtslose Loch der Armut.
Du darfst denken, was du willst. Aber alle meine Brüder stehen mir nah. Jeder ist anders. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und Jimmy…Jimmy ist mir sehr nah. Er ist nicht das schwarze Schaf der Familie. Er hatte nie Glück.
Meine Frau schaute mich an und schwieg.
Überleg es dir. Hast du einen Bruder, den du mehr liebst als die anderen? Oder eine Schwester, die du mehr liebst als alle anderen Schwestern?
Sie legte ihren Kopf auf meine Brust.
Aber wie lange können wir unsere Geschwister in Indien unter die Arme greifen? Haben wir nicht vielen geholfen? Haben wir nicht genug getan?
Zurück in der Schweiz dachte ich täglich an Jimmy und meine Geschwister in Indien. Irgendjemand aus meiner nahen Verwandtschaft war immer in irgendwelcher Schwierigkeiten. Meine Schwester Celine litt unter Schwindelanfälle und an ihr eigenes Körpergewicht, das hormonell bedingt stets zunahm. Der älteste Bruder meiner Frau war von seinem eigenen Sohn verstossen. Sie wusste nicht weiter. Der jüngste Bruder meiner Frau musste seinen Hab und Gut aufgeben, nachdem ein Erdrutsch sein Haus den Berghang herunter spülte.
Was sollen wir machen? Fragte mich meine Frau immer wieder.
Eines Tages rief Jimmy mich an, um mir mitzuteilen, dass er eine Stelle in Saudi Arabien angenommen habe.
Ist das nicht eine Falle?
Millionen Menschen aus Pakistan, Indien, Bangladesch, Nepal und den Philippinen arbeiten dort.
Beruhigte mich Jimmy.
Schei…
Was sagtest du?
From the frying pan into the fire… Vom Regen in die Traufe.
So schlimm kann es nicht sein. Sonst würden die Menschen nicht ihr Leben riskieren, um dort eine Stelle zu ergattern.
Hast Du ein Arbeitsvisum?
Wir sind eine Gruppe von zwanzig Männer. Wir haben eine Arbeitsvermittlungsagentur, die jeden ein Visum besorgt.
Hast Du vielleicht Geld an eine Agentur bezahlt? Im voraus?
Ja.
Wie viele Menschen arbeiten bei dieser Agentur? Wo haben sie ihre Büros? Und hast Du einen Beleg für die Einzahlung?
Vielleicht war das, was geschah, das Beste, das Jimmy je widerfahren ist. Der ominöse Agent war mit dem gesammelten Geld, mehrere hunderttausend Rupien, spurlos verschwunden. Wieviel Geld Jimmy den Agenten bezahlt hatte, darüber schwieg er eisern. Er hatte die Hälfte von dem was ich ihm gegeben hatte, für den Agenten ausgegeben. Darüber hinaus hatte er die gesamten Ersparnisse seiner Frau in den Sand gesetzt. Dennoch war ich erleichtert, dass er nicht nach Saudi Arabien reisen konnte. Die Sklaverei im Mittleren Osten, das Leben in Kartonschachteln, zwanzig, dreissig Männer zusammengepfercht, in Räumen ohne Fenstern, ohne Wasser, ohne Betten, blieb ihm erspart.
Millionen bedürftiger Menschen arbeiteten bei brütender Hitze in der Wüste von Saudi Arabien, Katar, Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Oman und Libyen. In den meisten Fällen wurden ihnen gleich bei der Ankunft ihre Pässe weggenommen. Sie bauten Strassen, Hotels, Flughäfen, ganze verdammte Inseln, schufteten bei Tag und Nacht zu miserabler Arbeitsbedingungen, oft auch ohne jegliche Rechte. Manche, vor allem Frauen, arbeiteten ohne einen Lohn. Wenn sie stutzig wurden, liess man sie einsperren oder über Nacht ausweisen.
Unter den Arbeitern gab es auch Diebe, Drogenabhängige und Dealer. Ihnen wurden die Hände abgehackt. Viele landeten in barbarischen Gefängnissen wo sie, oft jahrelang ausgepeitscht und gefoltert wurden. Einige wurden nach der Scharia geköpft, noch bevor ihre Regierungen für sie intervenieren konnten. Frauen, die als Haushaltshilfen dienten wurden zu abstrusen Sexpraktiken gezwungen. Wenn sie sich weigerten, wurden sie aus den Fenstern von Hochhäusern hinuntergeworfen oder in Stücke geteilt, in Abfallbehältern gesteckt und sang und klanglos entledigt.
Ein paar Jahre lebte Jimmy mit seiner Frau Filou zusammen in dem verlotterten Haus, das sie gemeinsam erworben hatten. Was Filou bei der Bank verdiente, gab Jimmy ohne auch nur einen Cent zu sparen aus. Bei seiner Rückkehr aus Bombay, nun Mumbai genannt, war er abgemagert. Er hatte nun einen grösseren Appetite und ass reichlich, genüsslich, sogar übermässig. Dazu trank er. Rauchte er. Er tat dies meist heimlich. Wenn er ertappt wurde, wurde er rasend vor Wut und gewalttätig.
Unser Kind Anu braucht Geld für ihre Schule.
Du verdienst ja genug!
Aber du säufst alles weg!
Ich trinke nur mässig. Ab und zu! Nicht ich bin schuld, sondern du! Du bist verschwenderisch.
Wie denn?
Wieso brauchst du diese goldene Kette? Wieso brauchst du eine glitzernde Sari? Für wen trägst du Schuhe mit hohen Absätze?
Mensch! Ich arbeite unter Menschen.
Was für Menschen? Du meinst Kerle die dich den ganzen Tag anstarren. Und du machst ihnen Hoffnungen!
Sag so was nicht!
Mit deinen hohen Absätzen, machst du mich noch kleiner als ich ohne hin bin. Du bist eine Schlampe.
Jimmy, Jimmy, sag so was nie wieder.
Ich sage was ich will. Du bist eine verdammte…eine gottverfluchte…
Eines Tages rief mich Filous Bruder an. Er war wutentbrannt.
Ich bringe dich um. Dich und deinen Bruder Jimmy. Eure ganze Familie.
Wie bitte? Wer ruft an?
Ich kannte den Bruder von Filou nur flüchtig. Vielleicht hatte ich ihn einmal gesehen. Aber ich konnte mich nicht an sein Gesicht oder Namen erinnern.
Anto.
Anto? Anto wer?
Ich bin der Bruder von Filou. Der Schwager von dem Hundesohn, Jimmy.
Was hat er dir angetan?
Mir? Mir wird er aus dem Weg gehen. Ich bringe ihn um!
Bitte, beruhige dich. Was ist vorgefallen?
Jimmy hat Filou blutig geschlagen. Und nicht zum ersten Mal. Ihr Gesicht ist blau und geschwollen. Sagst du mir! Wie soll ich mit so einem Unmensch umgehen? Sag mir! Was würdest du tun, wenn der Mann deiner Schwester sie so malträtiert? Immer wieder…immer wieder? Ruf Jimmy an…sag ihm, dass ich ihm die Kehle durchschneiden werde. Ich schwöre es!
Immer wieder versuchte ich Filou anzurufen. Sie war unauffindbar. Ich rief ihre Bank an. Der Filialleiter sagte mir, sie sei nicht am Arbeitsplatz, mehr könne er nicht sagen.
Filou war eine herzige junge Frau, hübsch, stets höflich, meist ein Lächeln im Gesicht. Es verunsicherte Jimmy, dass sie hübsch war, dass sie fröhlich war und dass sie die Blicke der Männer auf sich zog. Es reizte ihn wenn sie sich eine rote oder glitzernde Sari anzog, es kränkte ihn wenn sie Schuhe mit hohen Absätze trug, es machte ihn wütend dass Menschen sie ansprachen und nur selten ihn.
Jimmy, weisst du wo Filou ist?
Ich rief meinen Bruder an.
Nein.
Jimmy war schweigsam.
Stimmt es…?
Ich habe sie geschlagen und zu Recht! Sie hat mich dauernd provoziert. Erniedrigt.
Das gibt dir kein Recht sie zu schlagen.
Angespuckt hat sie… mich. Vor meiner Tochter. Ich bin kein streunender Hund.
Du bist auch kein Unmensch…oder bist du einer?
Hör mir zu…älterer Bruder!
Nein! Wenn du jemals wieder eine Frau schlägt…hör gut zu…jemals wieder, dann…
Schlag mich zurück, wenn du willst. Ich fürchte niemanden.
Ich werde dich nicht schlagen. Glaubst du, dass du mit Gewalt etwas erreichst? Gewalt ist für Feiglinge. Für Menschen ohne Verstand. Ohne Argumente. Für Menschen, die nicht human sind. Ein menschliches Aussehen bedeutet noch lange nicht, dass er menschlich ist. Verstehst du?
Er legte auf.
Ich rief ihn erneut an. Er ging nicht ans Telefon.
Meine Frau meinte, ich soll ihn in Ruhe lassen.
Vielleicht war er selbst krank. Paranoid. Er war leicht reizbar. Meine Schwester Alice sagte mir, dass er vermehrt trinke, ununterbrochen rauche, dass er häufig unter Atemnot leide. Genauso wie Vater.
Er braucht einen Psychologen.
Sagte ich meiner Frau.
Vielleicht. Lass ihn in Ruhe. Du kannst nichts für ihn tun. Auch nicht für Filou.
Ich sah meine Frau verwundert an.
Frauen werden geschlagen. Vergewaltigt. Mit Säuren übergossen. Indien ist nicht zu retten. Ganz Indien ist ein Irrenhaus. Ich gehe nie wieder dorthin.
Es sind Millionen von Menschen. Auf engstem Raum. Ohne Bildung. Ohne Arbeit.
Du nimmst diese Gesindel immer im Schutz.
Jimmy, Filou…sie sind Teil meiner Familie.
Du bist nur besorgt um Jimmy.
Nein! Ich bin besorgt um beide. Um Filou und Jimmy, das weisst du doch!
Ich mache mir Sorgen. Im September sind mehr als eine Million Menschen, Opfer vom Krieg und Dürre und Hungersnöte über die Balkanroute, über die Insel Lampedusa und über Spanien nach Europa eingewandert. An einigen Stränden am Mittelmeer herrscht Spannung. Ein Knabe, rotes Hemd, blaue kurze Hose, die arme eng an den Körper gedruckt, liegt tot am Strand.
Ich mache mir Sorgen. Wie viele Flüchtlinge könnten Europa aufnehmen. Zehn Millionen? Zwanzig? Wie werden alle diese Menschen beschäftigt? Wie integriert? Was wenn sie sich weigern, die jeweilige Sprache, die Kultur des aufnahmewilligen Landes, anzunehmen? Wie soll man allen Wohnungen und Schulen bereitstellen, ihnen den Existenz sichern. Renten sichern? Was wenn Roboter und Künstliche Intelligenz die noch vorhandenen Arbeitsplätze vernichten? Es entstehen Käfige. Ghettos. Dschungeln. Es entstehen unsichtbare Mauern zwischen Volksgruppen und Religionsgemeinschaften.
Ich mache mir Sorgen. Wie die Welt tickt, wer welchen Krieg anzettelt und warum, bleibt uns verborgen. Wie viele Arbeitsplätze sind von Krieg und Zerstörung abhängig? Woher dieser Wohlstand und woher diese Armut? Der Kampf um Ressourcen, um Wasser, um Land und um sensible Daten wird in den Massenmedien durch Scheinkämpfe zwischen Marionetten ersetzt und ausgeblendet. Masken gegen Masken. Testosteron gegen Testosteron. Goliath gegen Goliath.
Nachdem ich ein Zeit lang nichts mehr über Jimmy und seine Frau Filou gehört habe, rufe ich Jimmy an. Er nimmt das Telefon nicht ab. Ich rufe seine Frau Filou an.
Chetta?
Filou, wie geht es dir? Wo bist du? Wo ist Jimmy?
Es geht mir…uns… auch Jimmy geht’s gut.
Wo seid ihr?
Wir sind bei einem Seminar. Eine kirchliche Veranstaltung. Mit mehr als Eintausend Teilnehmer. Ich muss bald wieder in die Halle hinein.
Was für einen Seminar?
Ein sehr populäres Seminar. Von berühmten Priestern. Einer bewirkt Wunder!
Aus den Lautsprechern hörte ich Gesänge. Halleluja…Halleluja…Amen!
Jimmy stelle ich mir vor inmitten hunderter von Gläubigen. Ein weissgekleideter Geistlicher lobpreist Jesus. Ein anderer besingt Maria. Er dankt speziell die Jungfrau für alle Wunder, Heilungen, die sie in den vergangenen Wochen vollbracht hat. Er redet auf den Gläubigen ein, sie, die Christen, seien das wahre auserwählte Volk Gottes. Nur sie.
Jimmy hört alles zu. Schaut verwundert zu. Zweifelt alles.
Eine wild um sich schlagende Frau reisst aus von der Mitte der Gläubigen, rennt auf den Priester zu. Sie spuckt auf seine Soutane. Die Angehörigen der Frau rennen nach vorne. Sie werfen sich auf die verrückte Frau, wringen mit ihr, bodigen sie auf der Bühne. Der Priester erhebt seine beiden Hände, erhebt seine Stimme. Auch er ist besessen.
Satan, verlasse diese Frau! Satan, ich befehle Dir …hinaus zu treten. Satan…Im Namen Jesu Christi… Im Namen Jesu Christi…Im Namen Jesu Christi… Jesu Christi.
Halleluja…singen scharen von Nonnen unterstützt durch heraufgedrehte Lautsprechern.
Satan! Verlasse diese Frau…
Minutenlang dauert das Spektakel. Minutenlang kämpft die Frau mit ihren Verwandten. Sie beschimpft den Priester. Spuckt auf ihn.
Hurensohn!
Ihre Verwandten stutzen sie, zwingen sie zum Aufstehen. Sie halten die kranke Frau vor dem jugendlich wirkenden Geistlichen. Sie streckt ihre Zunge heraus und zischt wie eine Schlange. Sie brüllt und spricht in einer Wirrwarr von Tönen und Geräuschen.
Schweig, Satan! Schweig! Schweig!
Der Priester legt seine rechte Hand auf ihre Stirn und drückt sie fest nieder. Sie richtet sich mit aller Kraft zurück. Fletscht ihre Zähne. Spuckt. Flucht.
Der Priester lässt sie kurz los. Druckt erneut auf ihre Stirn. Zwingt die zierliche Frau sich nach hinten zu biegen.
Im Namen Jesus Christus. Satan, ich befehle dir…Satan, im Namen Jesus Christus, verlass diese Frau!
Wieder drückt er die Frau auf die Stirn. Drückt sie mit aller Kraft zu Boden. Allmählich kommt sie zu sich. Sie schämt sich. Erschöpft bleibt sie liegen.
Wir sind alle Zeugen von diesem Wunder, beginnt der Priester. Jeder der an den Menschgewordenen Gott glaubt, findet Erlösung. Jeder der sich zu Jesus Christus und seine heilige Kirche bekennt, kommt in den Himmel. Nur der Wahre Glaube
Junge Frauen in heller Safran Saris gekleidet, übertönen seine Predigt mit ihrem Gesang.
Halleluja… Halleluja…Halleluja!
Während Angehörige der erschöpften jungen Frau sie von der Bühne nach hinten begleiten bildet sich vor der Bühne eine Gruppe vor der Bühne. Der zweite Priester, en fünfzig jähriger Mann, bittet die Frauen auf die Bühne zu kommen, stellt sie in eine Reihe. Es sind sieben Frauen. Sie benutzen die Enden ihrer Sari als Kopftücher, stehen mit gefalteten Händen voller Demut, hoffnungsvoll vor dem Menschenschaar in der hell beleuchteten Halle.
Der Priester singt, wendet sich an die Masse. Die Gläubigen singen mit. Der Priester gebärt sich als Dirigent. Als Dompteur.
Diese Frauen hier leben seit vielen Jahren in glücklicher Ehe. Doch ihr Glück ist nicht vollkommen. Sie sind besorgte junge Frauen. Wer soll ihnen Trost spenden, wenn sie krank werden? Wenn sie alt werden? Wenn sie blind oder gebrechlich sind? Diese junge Frauen, unsere Schwestern, sehnen sich nach einem Kind. Nach Kindern. Doch dieses Glück ist ihnen bis jetzt verwehrt geblieben. Nur Der Heilige Geist kann der Traum dieser jungen Frauen nun erfüllen….Lass uns den Heiligen Geist bitten…Den Allmächtigen Gott um Gnade bitten…um einen Wunder!
Er stellt sich vor einer Frau hin, erhebt seine offene Hände gen Himmel. Dann beugt er sich nach vorne und fächert mit beiden Händen die junge Frau von unten, in Richtung ihrer Genitalien, Luft zu.
Möge der Heilige Geist seine Wunder vollbringen! In diesem Augenblick…Sie kann es spüren…Seht her, wie ihr Körper zittert! Der Heilige Geist schenkt ihr ein Kind!
Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Halleluja, mein Arsch. Diese Gott- und den Menschenverachtende Scharlatane! Denkt Jimmy.
Am Nachmittag wird speziell für Alkoholiker gebetet. Alkoholiker gibt es in südlichen Bundesland Kerala wie Sand am Meer. Mit jedem Jahr klettert die Zahl der Süchtigen, Männer und Frauen, in die Höhe. Sie sind der Beleg dafür, dass das Bundesland Kerala am Abgrund liegt. Dass dieses schönen Fleck Erde unaufhaltsam vor die Hunde geht. Die Alkoholiker, die Arbeitslosen, die Kranken, deprimierte Menschen ohne Hoffnung, ohne Perspektive, widersprechen Marx und Jesus.
Der Mensch ist bloss ein Tier. Ein verängstigtes Tier. Noch!
Am Nachmittag betet der jüngere Priester für Alkoholsüchtige. Mit zitternden Stimmen berichten Gläubige über ihre Alkoholsucht, über Armut und Gewalt. Frauen und Männer geben ihre Widersprüche, ihre Ängste, ihre Geheimnisse preis. Einige brechen in Tränen aus. Die Nonnen untermalen das Pathos mit trauriger Musik. Die Lautsprecher verstärken die Emotionen.
Der Priester hypnotisiert die Massen. Die Menschen sollen schweigen. Beten. Wieder soll es Wunder geben.
Als alle sich hinsetzen springt Jimmy auf. Erhebt seine Hände. Zittert am Körper.
Vergib mir Jesus. Vergib mir Jesus. Vergib mir!
Er beginnt laut zu beichten.
Ich hasse meinen älteren Bruder. Meinen Vater. Meine Mutter.
Ah lieber Jesus…Du siehst Alles! Jesus lebt! Er sieht alles, vergibt alles.
Der Priester kommentiert.
Ich hasse alle Menschen. Diese ganze Welt.
Jimmy lügt wie gedrückt. Er geniesst es mitten in der Seminarhalle zu tanzen. Sich gehen zu lassen. Er rennt auf die Bühne, tanzt, entledigt sich seiner Kleidung. Sein Schauspiel gefällt dem Priester. Aber Nacktheit hat keinen Platz in der Kirche. Als ein paar aufgebrachte Männer Jimmy bodigen, segnet ihm der Priester. Er legt Jimmy nahe, eine grössere Spende an die Kirche zu leisten. Sakramente gegen Bargeld. Er wird nie wieder den Alkohol brauchen. Jimmy schwört den Alkohol ab.
Lobet den Herren!
Ruft der Priester.
Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Lobet den Herren! Und der Gute Hirte ging auf der Suche nach dem verlorenen Schaf. Lobet den Herrn!
Als er wieder zu Hause ankommt, hat er eine Flasche Whiskey bei sich. Filou wundert sich.
Wann hast du diese Flasche gekauft.
Nach dem Tanz vor dem goldenen Kalb. Ich bin kein dummes Schaf. Brauche einen Trink.
Schon gut. Ich verstehe. Aber trink bitte nur wenig.
Vergib mir. Vergib mir für alles.
Er legt seinen Kopf an ihre Schulter. Sie streichelt sein Haar.
Du bekommst eine richtige Glatze.
Sagt sie und lächelt.
Als Filou ihn verlässt, kauft Jimmy eine Katze. Der Einsamkeit wegen. Jahre vergehen, ohne dass Filou sich meldet. Ihr Herz sei versteinert, sie kann nicht mehr, sagt sie mir. Jimmy sei ein Herzensguter Mensch, ein gebrochener Mensch.
Was ist geschehen? Wurde er in der Kindheit vernachlässigt? Sexuell missbraucht? Hat ihn mein Vater, die Kleine Rose anders behandelt, als uns. Als mich? Wurde er in der Schule ausgelacht? Woher seine Wut? Ich weiss es nicht.
Jimmy braucht kein Geld. Er arbeitet bei einer christlichen NGO angeführt von Nonnen. Drei der Nonnen sind in Deutschland ausgebildet. Jimmy schreibt Pläne für Entwicklungshilfemassnahmen, Projekte die die Nonnen an Bistümer in Deutschland schicken. Sie bitten um Geld, für den Erwerb von Ziegen, Saatgut, Traktoren für Bauergenossenschaften, die sie betreuen. Sie bitte um Geld für Nähmaschinen, für eine Schule, für Zentrum für unterdrückte Frauen.
Und? Werden die Menschen nicht geholfen?
Wenn die Gelder eintreffen, zweigen die Nonnen den Löwenanteil geschickt ab. Für ihre eigene Bauten, für ihren eigenen Lebensunterhalt. Sie legen den Projektgesuchen zwar die Fotos armer Menschen aber diese erhalten nichts. Es werden Unterschriften verfälscht, Summen verfälscht, stell dir vor. Wie haben die Kirchen all ihre Bauten finanziert? Woher stammen die Luxusautos der Bischöfe? All ihre gottverdammten Paläste?
Aber sie haben auch sehr viele Krankenhäuser und Schulen, die auch ärmeren Menschen dienen.
Ah! Du hast auch so ein rosiges Bild. Wozu brauchen sie teure Kathedralen in ein ah! So armes Land?
Jimmy, was soll ich dazu sagen?
Ich habe zwar einen Lohn, einen Hungerlohn, aber dazu entwerfe ich die fantasievollsten Projekte.
Was denn?
Nur eine Idee. Wir schlagen vor jedes Jahr eine Million Bäume pflanzen. Dazu suche ich einen passenden Spruch. „Make India Green Again“. Oder „Green Kerala“. Klingt gut nicht wahr? Jetzt bitten wir den Briten, den Franzosen, den Schweden uns jährlich einen Euro für jeden Baum zu spenden. Dabei ist Kerala bereits üppig grün. Wenn jemand kontrollieren würde, hätten wir genügend Bäume vorzuweisen. „Green Kerala“ klingt äusserst verlockend. Man kann mit so einem fiktiven Projekt jede Menge Geld abzweigen. Und die Menschen glauben so ein Mist.
Reiner Betrug.
Neulich fragte mich eine andere NGO ob ich etwas Ausserordentliches aber Glaubwürdiges als Projekt entwerfen könnte. An jenem Abend ist eine giftige Schlange durch ein offenes Fenster in meine Küche eingeschlichen. Der Heilige Geist ganz persönlich. Also schrieb ich Übernacht den Entwurf für ein teures Projekt zur Gewinnung von Schlangengift für medizinische Zwecke. Darin war vorgesehen alle Schlangenarten unserer westlichen Gebirgskette einzufangen, um an ihrem Gift zu kommen. Stell dir vor, was dies alles enthalten. Die Löhne für drei bis fünf hochqualifizierte Aerzte. Einen Dutzend Schlangenfänger. Gelände um die Schlangen längerfristig unterzubringen.
Wird so etwas dann von den Geldgebern nicht kontrolliert?
Was soll‘s? Wir haben hier in der Nähe einen Schlangenpark. Es gibt genügend Ärzte, die für eine kleine Summe dieses Spiel mitspielen würden. Ich werde wenn nötig Schlangenfänger. Ich bin ein guter Schauspieler. Meinst du nicht?
Wie soll ich dir je glauben?
An manchen Tagen lichtet sich der Nebel kurz nach Tageseinbruch. Das Licht zeichnet Wolken silbrige Kanten, malt Schatten, lässt Farben leuchten. Auf den Baumkronen sammeln sich Vogelscharen. Zu Tausenden verdunkeln sie das Firmament, sie schweben und stürzen sich im Flug und sammeln sich erneut, erzählen einander Geschichten vom Meer, von der Wüste und den dahinter liegenden Landschaften. Am Abend leuchtet der Himmel gelb, blau und purpurn, mit tiefbraunen Flächen zwischen den hellen Farben.
Der Herbst verzaubert mich. Das Laub verfärbt sich, wird gelb, orange und dann weinrot. Die Sonnenblumen neigen sich zur Erde. Ihre Stämme sind durch starke Windböen eingeknickt, von den riesigen Blüten sind goldbraune Blätter zu Boden gefallen. Die Samen der Sonnenblumen liegen über dem Neuschnee zerstreut. Der Nebel beraubt Gräser, Baumstämme, den Sonnenblumen ihre Farben. Der Wind verzaubert den Wald, streift Bäume ihre Kleider ab. Nackt stehen sie da und zittern vor Kälte. Auch der nahe See verliert sich unter den Augenlidern der Nebelgöttin. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Immer wieder schneit es. Vielleicht gibt es wieder Weisse Weihnachten.
Kannst Du mir irgendwie helfen?
Jimmy schluchzt. Fleht mich an. Der Arzt sagt meine Nieren sind stark beschädigt.
Was erzählst du mir bloss?
Ich brauche dringend eine Niere!
Wie bitte? Ich höre dich schlecht. Was brauchst du?
Eine Niere.
Dein Bruder will wieder Geld. Bitte leg auf. Es ist drei Uhr morgens!
Meine Frau dreht sich um, zieht die Decke über den Kopf. Von draussen dringt Licht durch die dicken, dunklen Vorhänge. Bestimmt hat es heftig geschneit. Ist Jimmy wirklich sehr krank? Wie alt ist er wohl? Nein, er ist zu jung zum Sterben.
Was machen wir bloss? Wo bekommt man eine Niere?
Schlaf weiter. Wir können um diese Zeit nichts tun.
Er ruft erneut an.
Jimmy…kann ich dich morgen zurückrufen? Es ist sehr früh hier. Zwei Uhr morgen. Ich rufe dich bestimmt zurück. Morgen…nein heute früh zurück. In vier, fünf Stunden?
Die Katzen…sie fressen mich. Meine Katzen.
Darauf falle ich nicht ein. Für wie dumm hält er mich?
Er ist bestimmt um die fünfzig. Mein Gott! Er soll endlich um sich selbst kümmern.
Meine Frau will nicht, dass ich mich mit meinem Bruder und seinem Kummer befasse. Es ist Heiligabend. Der Schnee leuchtet mit einem Hauch von Blau.
In letzter Minute kaufe ich mir eine Lichterkette, lege diese zwischen den verschlungenen, windenden Zweigen einer Kletterpflanze, die die ganze Fläche einer Wand unseres Wohnzimmers bedeckt. Die tropische Pflanze bildet immer wieder neue Triebe, wächst mit unbändiger Lebenslust, breitet ihre unzählige Zweige aus. Meine Frau weiss von der Lichterkette nichts. Auch meine beiden Kinder. Sie werfen sich mit Schneebällen, spielen ausserhalb der Wohnung, betrachten verwundert den um sie herum wälzenden Schneeflocken. Ich lege Geschenke für meine Frau und meinen beiden Kindern auf unserem Tisch und schalte die Lichter ein. Das gedämpfte warme Licht bringt das grüngelbe Laub der Efeu zum Leuchten.
Dad! Das ist ja viel schöner als jeder Weihnachtsbaum!
Ruft mein Sohn aus.
Er umarmt mich. Meine Tochter umarmt mich. Meine Frau umarmt uns alle. Wir halten einander fest.
Katzen fressen mich auf. Die Stimme meines Bruders zerstört meine Idylle. Immer wieder höre ich seinen Ruf. Hilf mir!
Katzen fressen dich auf? Katzen?
Was ist, wenn Jimmy tatsächlich eine Niere braucht? Er will bloss Geld. Er will Mitleid. Vielleicht beides.
Zwischen Weihnachten und Neujahr rufe ich alle meine Brüder, meine Schwestern, den engsten Verwandten an. Sie leben im ganzen Bundesland Kerala zerstreut. Molly bestätigt mir, dass Jimmy krank ist. Ja seine Nieren seien dahin. Die eine ganz, die andere sei nur noch bedingt funktionstüchtig.
Wann hast du ihn zuletzt gesehen?
Vor drei oder vier Monate.
Auch Celine rufe ich an.
Ja, er ist krank. Ich habe ihn vor einem Monat gesehen. Weisst du, er hat sehr viele Katzen.
Viele Katzen?
Ja! Er ist völlig mit seinen Katzen überfordert. Er hat fast hundert Katzen. Er ist nicht mehr ganz dicht!
Ich bitte Alice, Jimmy aufzusuchen. Sie lässt alles liegen, bestellt einen Taxi und fährt zu seiner verfallenen Bude hin. Vor dem barrikadierten Haus findet sie verwahrloste Katzen. Aber Jimmy ist nicht da. Auch am folgenden Tag geht sie hin. Klopft an die Tür. Vergeblich. Ein Fenster seie offen, aber niemand sei zu Hause, sagt mir Alice.
Ein paar Tage später ruft Jimmy mich an.
Gutes Neues Jahr, Jimmy.
Leise weint er.
Warum winselst du? Was hast du? Sag mir, was ist mit dir los?
Nichts…Nichts. Wann kommst du wieder?
Jimmy! Jimmy, sagt mir bloss die Wahrheit und Ich lasse dich nicht fallen. Bestimmt nicht!
Er legt auf.
Seine Haut ist voller offener Wunden. An den linken Waden, an den beiden Schenkeln hat es eitrige Stellen. Blutende Stellen. Auf einem Tisch entdecke ich einen Arztbericht. Eine seiner Nieren ist seit Jahren, vielleicht sogar seit der Geburt, verschrumpft, die andere nur noch wenig funktionstüchtig. Sein Urin sei voller Schaum, ein Beweis für Kreatinine, das sein Körper ausscheidet. Der Wert liegt über sechs Punkten. Sehr hoch. Hat der Arzt gekritzelt und mit rot eingekreist. Bluthochdruck und Diabetes, stehen gekritzelt am Rande seines Berichts. Er schreibt, eine baldige Nierentransplantation sei zwingend. ‚Baldige‘ unterstreicht er.
Ich bin fassungslos. Wer soll Jimmy eine gesunde Niere spenden? Wem kann er um eine Niere bitten?
Sein Kühlschrank steht offen, lange defekt und nutzlos. Der Ventilator der gefährlich vom Dach herumtaumelt, läuft nicht. Offensichtlich ist der Strom seit langem abgestellt. Es liegen creme- und weissfarbige Tabletten auf seinem kleinen Arbeitstisch. Auch leere Flaschen. Alkoholflaschen. Es liegen Flaschen und Tabletten und Bücher zerstreut auf dem tiefrot bemalten Zementboden. Losgelöstes Katzenhaar schwebt im dunklen, feuchten, übelriechenden Raum. Um Jimmy herum liegen nicht geöffnete Briefe, Rechnungen und Mahnungen. Papier Kramm. Um ihn herum und auf seiner nackten Brust liegen Katzen. Einige sind ganz abgemagert, andere sogar tot. Die meisten sind verfault und vertrocknet. Seit ein paar Tagen hat er nichts mehr zu essen. Nichts mehr, das er den vielen verwahrlosen Katzen füttern kann.
Wie viele Katzen hast du bloss gekauft?
Nur eine! Und dann ist noch eine zu mir gekommen. Vor vielen Jahren.
Sagt er. Seine Stimme ist schwach. Gebrochen.
Ich wische ihm das vertrocknete Blut von den Beinen. Wische sein blasses Gesicht mit einem feuchten Tuch. Sein Bauch ist aufgebläht, sein Haar dünn und früh vergraut. Er hat Ringe um die Augen und schwarze Flecken auf der Haut. Es hat einen unerträglichen Schweissgeruch. Er hat einen üblen, faulen Mundgeruch. Er riecht vom Kopf bis Fuss. Mein Bruder ekelt mich an.
Wo kommen die anderen Katzen alle her?
Sie haben sich stets vermehrt.
Konntest du sie nicht jemanden abgeben? Deinen Nachbarn, vielleicht?
Sie haben hungernde Kinder, streunende Hunde…eingezogene Katzen.
Wieso hast du sie alle behalten? Spinnst du? Ich verstehe das nicht.
Ich wollte nur eine einzige Katze. Aber auf einmal hatte ich einen Dutzend Katzen. Als unser Fluss Hochwasser führte, nahm ich sie alle mit in einem Sack aus Jute. Ich wollte sie alle dem Fluss, dem trüben Wasser übergeben. Aber ich brachte es nicht über mich. Einige Tage später, beim heftigen Monsunregen, setzte ich sie in der Abenddämmerung im Wald aus. Aber kaum waren sie ausgesetzt, gab es einen fürchterlichen Geschrei, ein herzzerreissendes Klagelied der Katzen. Sie kamen alle zu mir zurück, kletterten über mich, liess mich nicht mehr los. Ich dachte an einen Veterinärarzt…auch daran dachte ich. Ich dachte immer wieder daran. Aber…du kennst mich. Ich konnte es nicht. Ein Feigling bin ich. Ein Feigling.
Nun liegen sie tot zu deinen Füssen! Weisst du wie viele Katzen du hattest? Fünfzig? Hundert?
Ich war immer allein. Viele Jahre. Sehr viele Jahre.

„Morgen.“
Einen Tag später.
„Der Kassierer ist heute nicht da. Kommen Sie morgen.“
Am folgenden Tag.
„Der Sachbearbeiter hat die Schlüssel zum Dokumentenschrank verloren. Was nützt das Warten, wenn wir die Dokumente nicht vor uns haben? Kommen Sie nächste Woche.“
Eine Woche später.
„Heute heiratet die Tochter unseres Chefbeamten. Bestimmt wird er morgen da sein. Aber was erzähle ich Ihnen für eine Dummheit. Morgen ist ja ein Feiertag, nicht wahr? Endlich ein freier Tag. Wie wäre es mit...?“
„Nächste Woche? Nächsten Monat? Warum sagen Sie mir nicht gleich nächstes Jahr?“
„Wissen Sie, wir müssen die Richtigkeit aller Angaben prüfen und ihre Dokumente mit jenen der Zentralstelle in Kannur vergleichen. Das braucht seine Zeit. Sie selbst haben keine Originale... oder täusche ich mich? Ausserdem sind Sie nicht der einzige, der Grundstückeintragungen machen will. Wir tun unser bestes.“
„Wissen Sie, ich lebe nicht mehr hier. Ich müsste längst zurückfliegen. Helfen Sie mir!“
“Warum machen Sie es sich so schwer? Sie könnten bereits Morgen die nötigen Stempel und Unterschriften haben. Begreifen Sie denn nicht? Es liegt in Ihren eigenen Händen!“
Der Schriftführer faltet seinen Dhoti, lässt seine Sandalen zurück, steigt die paar Treppen zum Vorhof des kleinen kolonialen Bungalows hinauf und schreitet zu seinem Pult in der hintersten Reihe. Aus der Schublade seines Tisches entnimmt er ein runzeliges grünes ‚Vettila[1], beschmiert das verwelkte Blatt mit einer weissen Kalkpaste, rollt darin ein paar vertrocknete Tabakblätter und ein Stück harte Arecca-Nuss, nimmt das ganze in seinen Mund, schiebt die Schublade zu. Mit heftiger Bewegung zerdrückt er die harte Nuss zwischen seinen Stockzähnen, zieht dabei eine Grimasse nach der anderen. Er atmet tief und kaut genüsslich. Er öffnet eine zweite Schublade, entnimmt ihr eine gelbgrüne, leicht verblichene und mit einer roten Schnur zugebundene Papierrolle, löst den Knoten. Gemächlich kaut er, hält kurz inne, glättet die Dokumente. Dann hebt er die Papiere mit der linken Hand, hält sie, wie einen verschmutzten nassen Lumpen vor die Nase, schüttelt sie hin und her. Er legt die Dokumente auf den hintersten Haufen auf seinem langen Tisch. Einen faustgrossen Stein legt er obendrauf. Sein Mund quillt vor Schaum. Er steht auf, kommt zum Rand des Vorhofs, spuckt eine rote Ladung knapp an den wartenden Menschen vorbei. Mit dem linken Handrücken wischt er seine verschmierten Lippen trocken. Er wirft mir einen kalten Blick zu.
„Kommen Sie morgen.“
Morgen wird er mir die Dokumente nicht aushändigen. Der Leiter des Grundbuchamts wird sie keines Blickes würdigen. Keine Unterschrift darunter setzen. Keinen Stempel. Auch nicht übermorgen oder nächste Woche oder im nächsten Monat. Nie. Ich sei naiv, sagt mir Thankachan, mein Bruder. Ich sei stur, ergänzt meine Schwester, Molly. Naiv. Stur. Dumm. Aber ich will nicht nachgeben. Ich kenne meine Rechte. Meine Pflichten. Meine Grenzen. Der Schriftführer will Geld. Der Abwart will Geld, der Sachbearbeiter, der Aktuar. Auch der leitende Beamte will Geld. Schmiergelder, ohne welche es keine Dokumente, keine Stempel, keine Unterschriften gibt.
„Aasgeier!“
Mein Bruder nennt sie beim Namen.
„Der Schriftführer empfängt seine Kundschaft heimlich, bei sich zu Hause. Er nimmt das Geld entgegen, dreissig oder vierzig tausend Rupien, manchmal mehr, verteilt sie Tage später. An den Hausmeister einen Hunderter. An den Sachbearbeiter einen Tausender. An den Aktuar ein paar Tausender mehr. An den Kassierer das Doppelte. Dem Leiter des Grundbuchamts das Vierfache. Sie werden keinen Finger krümmen, bis wir zahlen. Selbst Gott, der Allmächtige muss vor dem Steueramt niederknien. Wir haben keine andere Wahl.“
„Ich zahle kein Schmiergeld. Keine einzige Rupie. Niemals!“
Spät in der Abenddämmerung trommeln dicke Regentropfen auf das ausgetrocknete Strohdach unserer Hütte. Endlich ist der Monsun da. Oder war dies nur sein Vorbote? Meine Geschwister stellen grosse Schüsseln direkt unter den Dachrand, um das Regenwasser aufzufangen. Und während sie die trockene Wäsche von der Leine holen und das Brennholz in die Küche tragen, renne ich wie ein Kind auf dem Hof hin und her. Ich werfe mein Hemd und meinen Dhoti in den Wind. Berauscht vom Duft der feuchten Erde, von der Frische des Regens, tanze ich hemmungslos vor der Hütte. Ich lege mich auf den flachen Erdboden, breite die Arme aus und lasse den ersten Regentropfen des Jahres auf mein Gesicht, auf meinen Körper fallen. Immer ausgiebiger fällt der Regen. Das Regenwasser vermischt sich mit dem roten Staub, es staut sich, schäumt und fliesst seitlich von der Hütte weg. Ich betrachte die Regentropfen, wie sie auf der Wasseroberfläche tanzen. Eiergrosse Luftbläschen schwimmen auf dem braunen Wasser, sie kullern um mich und platzen. Blitze schlagen auf dem nahen Hügel ein. Sie lassen alles um mich kurz erhellen, sie lassen den Donner nachhallen. Mal kracht er kurz, wie ein Peitschenhieb, mal hallt er lange nach. Auf einmal heult der Himmel, als gebäre er unter unerträglichen Qualen einen Ozean. Riesige Wassermassen fallen von den Wolken nieder, als verflüssige sich das weite Firmament vor meinen Augen. Hinter den Regengüssen verschwimmt alles, verschwinden Bäume und Felsen und Hügel. Auch alles in meiner Nähe löst sich im Regen auf: die Hütte, die Krüge, die Hibiscus-Blüten, sie alle verschwinden hinter einem Vorhang aus Wasser.
Der Regen hört allmählich auf, es rieselt, dann setzt er wieder ein. Rotbraunes Wasser strömt von den Hügeln herab, es überflutet die brachliegenden Felder, wäscht ganze Strassenabschnitte weg. In wenigen Stunden schwillt der Fluss. Er tobt und schäumt und breitet sich aus, er fliesst, staut sich, wirbelt, wird immer grösser, immer mächtiger, er schlängelt und wütet durch das weite Tal. Er reisst weggefegte Strohdächer, ausgerissene Bäume, Unmengen von Laub und lockerer Erde mit sich, er trägt tote Vögel, abgenutzte Sandalen und altgediente Gegenstände weg, er nimmt selbstgebastelte Papierboote, Schlösser und Türme aus Sand, die Träume kleiner Kinder mit sich.
Der Leiter des Grundbuchamts blickt zu mir auf. Er lächelt freundlich, bittet mich, Platz zu nehmen. Den Schriftführer schickt er mit einer Geste fort, bestellt ihm die Türe hinter sich zu schliessen.
„Tee? Kaffee?“
Durch ein Fenster ruft er den Hausmeister. Der ältere, etwas übergewichtige Herr sagt dem Abwart, er solle uns zwei Tassen Tee servieren. Dann lächelt er mich erneut an. Aufmerksam liest er den Brief, den ich verfasst habe. Er nimmt auch zur Kenntnis, dass ich je eine Kopie an seinen Vorgesetzten und eine an den Minister der Finanzen richten wolle.
„Eine Beschwerde?“
Der kleine dicke Mann denkt nach. Er betrachtet die amtlichen Dokumente, die der Schriftführer ihm Minuten zuvor auf das Pult gelegt hat, prüft auch die bereits begutachteten Zeichnungen und Originale. Er wirft mir einen erzürnten, besorgten Blick zu. Er denkt eine Weile nach. Der Hausmeister bringt uns den Tee, nimmt das Servierbrett und verlässt augenblicklich das Büro.
"Sind ihre Geschwister anwesend? Die betroffenen Nachbarn? Was ist mit den Zeugen?"
Ich berichte ihm von all meinen Bemühungen, von den tausend Hindernissen und von den immerwährenden Ausreden seines Schriftführers. Ich nenne die Beweggründe meiner Beschwerde, trage alles höflich vor, ohne den Leiter oder den Schriftführer persönlich anzugreifen. Er hört mir aufmerksam zu.
„Ich werde alles noch heute unterschreiben. Sie können ihre Dokumente gleich mitnehmen. Na, wie finden Sie das?“
Er trinkt Tee und fragt nach meinen Geschwistern. Sollte er nicht auch für sie Tee bestellen? Dann mustert er mich von Kopf bis Fuss.
„Glauben Sie bloss nicht, dass ich mich vor einer Beschwerde fürchte.“
„Eine Beschwerde ist nicht mehr nötig. Ich hätte gleich zu Beginn bei Ihnen vorsprechen sollen. Ich nehme den Brief zurück. Die Kopien an ihren Vorgesetzten und an den Minister nehme ich ebenfalls zurück.“
„Aber ihr Brief ist sachlich und treffend formuliert. Es wäre schade, ihn nicht wegzuschicken. Diesen hier lege ich zu meinen Akten. Wie lange sind Sie schon weg von hier?“
Der kleine Mann lächelt zynisch.
„Gewiss wird mein Vorgesetzter aus Kannur Ihnen schreiben. Aber einen Brief werden Sie nie erhalten. Er wird seinen Brief nie zur Post bringen. Er wird bloss eine Kopie zu den Akten legen, um einmal belegen zu können, dass er Ihnen geantwortet hat. Es steht nirgends geschrieben, dass eine öffentliche Stelle eine Beschwerde mittels eingeschriebenem Brief beantworten muss. Falls Sie jedoch ihre Beschwerde an den Minister richten, wird der Sekretär des Ministers Ihren Brief wohl lesen. Er wird Ihnen auch bestimmt antworten. Ein paar Zeilen. Wir leiten eine Untersuchung ein, wir sind Ihnen sehr dankbar, wir loben Ihren Einsatz für die Demokratie und Ihren Kampf gegen die Korruption. Wir sind, wir tun, wir bemühen uns, mit freundlichen Grüssen, mit den besten Wünschen, im Auftrag des Ministers der Finanzen, datiert, signiert, gestempelt und zum Friedhof der Akten gelegt für immer und ewig, bis die Ameisen des Steueramts auch diese Kopie vernichten. Irgendwann einmal räumt der Minister seinen Sessel, zieht er sich gealtert zurück, stirbt, wird verbrannt und wird zu Asche, die in irgendeinen Fluss gestreut wird. Was hätten Sie von Ihrer Beschwerde? Sie hätten aufgegeben und wären resigniert, sie hätten diesem Land längst den Rücken gekehrt. Wären Sie standhaft und würden einmal das Steueramt anklagen, wird Ihre Klage bei der ersten Instanz bereits abgewiesen. Wie würden Sie überhaupt beweisen, dass Sie ein Gesuch zur Handänderung eingereicht haben? Haben Sie es nicht gemerkt? Wir haben nicht einmal ein solches Gesuchsformular! Wissen Sie, wie lang sich so ein Prozess hinziehen würde? Es würden Jahre vergehen. Jahrzehnte!“
Während ich über den desolaten Zustand dieses Landes nachdenke, überrascht er mich mit der Bemerkung:
„Doch. Ich bin bedrückt.“
„Sicher nehme ich meinen Brief zurück. Ich bitte um Verständnis. Ich wollte Ihnen nicht persönlichen Schaden zufügen.“
„Sie verstehen mich falsch.“
„Doch, ich verstehe Sie.“
„Nein, nicht wirklich.“
Er steht auf, begibt sich zum Fenster. Er betrachtet meine Geschwister auf dem Korridoor des kleinen Bungalows. Dann blickt er zu mir hinüber.
„Nicht ihr Bruder, auch nicht ihre Schwester, aber Sie! Sie sind der Kleinen Rose sehr ähnlich.“
„Haben Sie meine Mutter gekannt?“
„Iritty ist noch keine grosse Stadt. Ja, ich habe sie gut gekannt. Wissen Sie, vor etwa zehn Jahren lebten meine Frau und ich in einer kleinen Mietwohnung am Strassenrand. Wir hatten weder Strom noch ein Telefon. Meine Frau hatte kurz nach Mitternacht, zwei Wochen vor dem eigentlichen Termin, Geburtswehen. Das Kind lag quer im Mutterleib. Meine Frau verlor Blut. Haben Sie solche bange Minuten im Leben erlebt? Ich war völlig hilflos. Wissen Sie, nachts um zwei fahren keine Busse mehr hier durch, keine Autos. Ihre Mutter wohnte in unserer Nähe. Während ich in der Nacht auf der Suche nach einem Transportmittel herumirrte, stand sie meiner Frau bei. Als ich dann mit einem gemieteten Jeep nach Hause kam, hörte ich mein Kind schreien. Und meine Frau vor Glück weinen. Vor einem Jahr hatte ihre Mutter mich aufgesucht. Sie wollte, dass ich den Boden zwischen ihren Kindern aufteile, wie es der Vater in seinem Testament gewünscht hatte. Ich konnte ihr aber nicht helfen. Ihnen, dem ältesten Sohn, hatte der Vater alle Vollmachten erteilt. Erst als ich durch diese Dokumente blätterte, wurde mir bewusst, dass Sie der Sohn der kleinen Rose sind. Ich möchte nun alles so rasch wie möglich erledigen. Und nicht der Beschwerde wegen.“
Wir versammeln uns im Büro des leitenden Beamten. Meine Geschwister nehmen neben mir Platz. Die Zeugen stehen respektvoll, schweigend ganz hinten im Raum. Der Schriftführer tritt ein. Er legt den Handänderungsvertrag auf das Pult seines Vorgesetzten. Auf Geheiss des Leiters nimmt er direkt vor seinen Augen Platz. Mürrisch liest er aus den Dokumenten, die er auf Druck des kleinen Mannes nur Minuten zuvor fertig geschrieben hat. Er listet zunächst die Ortsnamen auf. Dann Personennamen. Personalien. Weil die Anwesenden keine amtlichen Ausweise besitzen, erwähnt er bei allen Betroffenen auch die Namen ihrer Väter. Familiennamen. Vornamen. Mittelnamen. Dazu auch die Rufnamen. Dann beschreibt er das Grundstück und erwähnt alle Grenzen. Er liest die Geschichte des halben Hektars Boden vor, die mein verstorbener Vater an meine Schwester vererbt. Der Schriftführer, Dichter ohne Namen, Diener des Bundeslandes Kerala, murmelt alles vor sich hin. Er stottert, wie eine zur Fahrt ansetzende Dampflokomotive, hustet und pustet. Bald kommt er in Fahrt. Er liest alles laut vor, übertönt den Regen, übersieht da ein Komma, dort das Satzende. Stolz trägt er seinen Singsang vor, ohne dazwischen auch nur Atem zu schöpfen.
„Payam Gemeinde, im Bezirk Aaralam, im Malabar, an diesem Tag, in diesem Jahr, betreffend einem halben Hektar Boden, im Norden angrenzend an das Grundstück des Lebensmittelhändlers Mahmood Ahmed Kakka, genannt Mammooty,....hmm...angrenzend im Süden an den und den, im Westen an den und den, im Osten an den und den,....hmm... Teil jener Ländereien, die sich 1800 zur Zeit des grossen Tippu Sultans, Fürst von Mysore und Malabar im persönlichen Besitz seiner Majestät befanden und seine Jagdgründe waren,...hmm... betreffend den Teil desselben Bodens, der nach dem Niedergang des Sultans von einem Sahib, von Major John Stanley in Anspruch genommen wurde und im Jahr 1902 von seinen beiden Söhnen, Herrn William Stanley und Herrn Antony Stanley verwaltet wurde,.. betreffend jenen Teil des Bodens, der von Herrn Antony Stanley, Tony genannt, an den Grossgrundbesitzer Herrn T. Shankaran Krishna Menon, genannt Shankaran Kutty, für den Preis von sechzig Elefantenstosszähnen und einem Dutzend Tigerfelle überlassen wurde,..ja, hmm...abzüglich der hundert Hektaren Blumenwald, an deren Mitte sich der Fussabdruck des Gottes Hanumans befindet und der dem Tempel des Affengottes geschenkt wurde,...hum..hum..hrrum... betreffend jenen Teil, der Shankaran Kutty Herrn Mustafa Mohammed Mustafa, genannt M.M. Musa für den Preis von fünf goldenen Münzen 1935 überliess, zuzüglich jener Wälder rechtsseitig des Flusses, die Thampuran Perumal Herrn Emmem Musa für nicht näher genannte Dienste übertrug,..hum...ha...hum... betreffend jenen Teils des Bodens, das Em..Em....Emmem Musa seiner vierten Ehefrau Ayisha Begum Suleika, geborene Devi Perumal, Tochter des Herrn Tampuran Perumal und genannt Ayisha, bei der Scheidung überliess,..ha..ha...betreffend sieben Hektaren des Grundstücks, das Ayisha Begum nach ihrer gescheiterten Klage gegen Herrn Emmem Musa übrig blieb und welcher Ayisha Begum, nun wieder Devi genannt Herrn...Herrn Mathai Verghees Mathai, genannt Ashan im Jahr 1940 kurz vor ihrem Selbstmord für zwölf Rupien verkaufte,..ho... ho... betreffend den drei Hektaren nördlich des Baches, den Ashan an seinen zweiten Sohn, George Mathai George, genannt Vergheese 1980 nach einem verheerenden Brand und dem Verlust der ganzen Ernte übertrug, huh...huh...Ja... betreffend einem halben Hektar Boden, Klammer auf, dessen Grenzen oben auf Seite zwei dieses Dokuments erwähnt wurden, Klammer zu, den er vor seinem Tod im Jahr 1990 für seine Tochter Mary George Mariyam, genannt Molly bestimmt hatte, siehe Dokument Nummer zwei strich neun strich neunhundertneunzig, hum...betreffend des oben erwähnten Grundstückes, dessen Wert wir wie folgt einschätzen, zwölf tausend Rupien, Klammer auf, in Zahlen die oben genannte Summe, Klammer zu,...ja, betreffend die Vollmacht, die er seinem, im Ausland lebenden ältesten Sohn...hmm...hrummm...Uhh!“
Nach Aufzählung aller Fakten, nach der Schilderung aller Handänderungen, Grenzänderungen, Teilungen, Schenkungen, nach Bekanntgabe aller Ansprüche, Klagen und Verfechtungen, nach Aufzählung aller Glücksfälle und aller Katastrophen, schmückt der Schriftführer sein Gedicht mit den nötigen Floskeln und endet seinen Gesang.
Er atmet tief und schreitet zur Tat. Er beschmiert die Daumen meines Bruders und meiner Schwester mit schwarzer Tinte, nimmt ihre Fingerabdrücke. Er nimmt auch den anwesenden Zeugen Fingerabdrücke, haucht allem seinen Atem ein und bittet mich und den Leiter, die Eigentumsurkunden und je zwei Kopien zu unterschreiben. Dann drückt er den Papieren die nötigen Stempel auf. Er übergibt mir eine Kopie und verlässt schweigend das Büro.
Dies ist denn das Vermächtnis meines Vaters: ein handgeschriebenes und mit Fingerabdrücken verschmiertes Dokument, das die Geschichte eines halben Hektars Bodens erzählt. Es ist die Chronologie eines Niedergangs und eines Aufbruchs zugleich, ein Requiem auf ein Königreich, das nicht mehr ist und eine Hymne an ein Land, das das Licht der weiten Welt erblickt. Ich werde diese Chronik mit mir tragen, die Geschichte eines unbedeutenden Stück Erde, die Erinnerung an eine Handvoll Staub, an Menschen und Landschaften, die mir das Leben schenkten und nie mehr sein werden. Am Schalter bezahle ich die nötigen Gebühren. Als ich das Grundbuchamt verlasse, gebe ich dem Schriftführer ein Fünfhundert-Rupien-Schein. Er nimmt die Note, ohne mich nur eines Blickes zu würdigen, hält sie gegen den Himmel. Ein verblasster Mahatma blickt ihn gütig an.
Ein stürmischer Wind peitscht mir die ersten Regentropfen des Monsuns ins Gesicht. Ob es tatsächlich regnen wird, steht in den Sternen geschrieben. Der Himmel ist von schweren aschegrauen Wolken bedeckt, die Gipfel der westlichen Gebirgskette sind gänzlich verschollen und leiden unter der Last der Wolken. Die Blätter der nahen Bananenbäume flattern und rascheln wie Flügel sterbender Vögel. Die Baumkronen tanzen.
Ich stehe auf der halben Hektare Erde, die mein Vater mir überlassen hat. Ich weile hier, vielleicht ein letztes Mal. Es ist, obwohl ihr Name nirgends auf den Eigentumsurkunden steht, ihr Land, der legale Besitz meiner Mutter. Gewiss, die Ersparnisse Ashans, eines Kirchendieners, haben den Bodenerwerb erst möglich gemacht, gewiss, der Schweiss meines Vaters hat den Boden gepflügt und geebnet, aber erst die Tränen der Kleinen Rose, haben ihn fruchtbar gemacht.
Ja, diese Erde ist mit ihrem, mit unserem Schweiss, Blut und unseren Tränen getränkt, mit unserer Spucke, mit unseren Träumen und Exkrementen. Hier liegen begraben unsere Milchzähnen. Hier ruhen auch die Tränen derer, die vor uns auf diesem Boden gelebt haben, hier liegt begraben, die abgestreiften Häute der Schlangen, die sich hier durch gewunden haben, die Knochen der Tiere, die hier verendet sind, die Überreste der Glühwürmer, die hier nachts Sträucher und Bäume mit ihrem Licht zum Leben erweckt haben. Hier auf diesen nackten Felswänden sind die Gelächter und Schreie jener Frauen, Hindus, Moslems und Christen verhallt, die mich gestillt haben, als ich noch ein Säugling und ohne einen Namen war.
Nur Menschen, die auf Erden gelebt haben, Menschen, die barfuss die Erde berührt haben und die, die mit Steinen und Dornen und Schlamm gekämpft haben, kennen das Gefühl der Ergebenheit, der Dankbarkeit und des Schmerzes, das einen Menschen aufwühlt, wenn man von der gelebten, ja, geliebten Erde Abschied nimmt.
Der Regen zwingt mich zum Auto zurück zu laufen. Er hilft mir auch meine Tränen zu verbergen. Ich muss dich verlassen, dich verrücktes Land, verfluchtes Land, Land der Fürsten, Dämonen und Götter, Land der Sehnsucht und des Versprechens, Land der Kleinen Rose.
Ein überdimensionales Bildnis der „Grossen Seele", Mahatma Gandhi, hängt in der Abfertigungshalle des Flughafens von Mumbai. Entlang der langen Gänge befinden sich Bilder weiterer Landesgrossen: Rajiv Gandhi, Indira Gandhi und Pandit Nehru. Auch ihre Sprüche sind auf Tafeln verewigt, erinnern den Reisenden an den Freiheitskampf oder an die Visionen, die sie einst hatten. Auf einer verstaubten Tafel entdecke ich auch die Eingangszeilen einer Rede von Premierminister Pandit Nehru um Mitternacht, am Tag der indischen Unabhängigkeit im Jahre 1947.
„Long years ago we made a tryst with destiny....At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes rarely in history, when we step out of the old into the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance.”
In Gedanken versunken stehe ich in einer Kolonne vor der Zollkontrolle. Ein uniformierter, hochrangiger Zollbeamter und seine Assistentinnen kontrollieren das Gepäck der Reisenden. Der Mann winkt mich zu sich, bittet mich, mein Handgepäck auf dem langen Tisch vor ihm hinzustellen. Er kontrolliert meine Bordkarte und meinen Pass. Er blickt zu mir hinauf und lächelt freundlich. Er spricht mich auf Hindi an.
„Bestimmt gehen sie auf eine lange Reise.“
„Ich habe eine lange Reise hinter mir. Eine ebenso lange Reise vor mir.“
„Many, many miles to go.“ Er spricht in akzentfreiem Englisch.
„Miles to go and promises to keep“. Ich zitiere Robert Frost, den amerikanischen Dichter, ebenfalls auf Englisch.
„Was haben Sie da?“
„Eine Handvoll Erde.“
„Wofür denn?“
„Das ist alles, was mein Vater und meine Mutter mir überlassen haben.“
„Das ist aber sehr viel. Ich weiss nicht, ob Sie beim Zoll ihres Landes damit durchkommen. Aber nehmen Sie sie ruhig mit.“
Der freundliche Beamte schiebt mir meine Handtasche zurück.
„Kennen Sie die Geschichte vom Gott Krishna? Als dieser noch ein Kleinkind war und draussen spielte, hatte er ein wenig Erde in den Mund genommen. Alarmiert öffnete die Mutter seinen Mund. Und was sah sie in seinem Rachen? Unsere ganze Erde!“
„Es ist eine sehr schöne Geschichte. Ja, wenn wir Menschen auch die ganze Erde sehen würden!“
"Auf Wiedersehen! How do you say in German? I know...Guten Flug!"
"Thank you! Good Bye!"
Mitternacht. Flieger landen, andere heben ab. Sie bilden Brücken zwischen Ländern und Kontinenten, zeichnen imaginäre Linien zwischen den Himmelskörpern. Die Sterne sind auf dem dunklen Himmelboden gestreut. Eine unsichtbare Stimme fordert mich auf, nach Buchstaben und Wörtern zu suchen, mit meinen Fingern im Sternenmeer zu schreiben.
Das Leben.
[1] Blatt einer Kletterpflanze

„Sannyasa“, die Zeit des Geistes. Zeit, los zu lassen, zu staunen, weiter zu gehen und zu ruhen. Wie lange lebe ich noch? Was bleibt noch übrig? Was kann ich noch tun?
Bruder, hilf mir!
Meine Geschwister, auch die Geschwister meiner Frau, kämpfen um ihre Existenz, um die Zukunft ihrer Kinder. Sie machen sich Sorgen um ihr tägliches Brot, um die Gesundheit, um ihre Ernten. Sie machen sich Sorgen um ihr Leben inmitten fanatischer Menschen. Der Kampf ums Wasser und Land spaltet das Land. Die Teilung in Arme oder Reiche, Hindu oder Moslem, lassen alte Vorurteile festigen, uralten Instinkten freien Lauf. Die Flammen des Hasses lodern hoch.
In Indien werden fast einhundert Frauen täglich vergewaltigt. Noch mehr Kinder täglich entführt. Politische Gegner mit Macheten zerstückelt. Alte, gebrechliche Menschen werden von den eigenen Kindern geschlagen, gedemütigt und am Wegrand liegen gelassen. Heimlich entsorgt!
In Afrika und Asien wachsen die Flüchtlingsströme. Die Wüsten weiten sich aus. Tiere verenden. Menschen verhungern, verdursten. Die erschöpften Kinder knien im Wüstensand, sie bewegen sich auf allen Vieren, die Aasgeier wittern ein Festmahl. Sie lauern. Die verwelkten Blumen fallen.
Ich sehe meine Geschwister unter den Flüchtenden.
Bruder, hilf mir!
Wie viele werden in Libyen gefoltert? Wie viele Menschen sind im Mittelmeer ertrunken? Was, was bitte kann ich tun?
Dad, die Bienen sterben. Haie werden für ihre Flossen gefischt, nur für ihre Flossen. Die noch lebenden Tiere werden danach von Bord geworfen. Weisst Du, Dad?
Ich weiss.
Die Zeit des Geistes. Los lassen. Los….lassen! Diese Welt ist nicht zu retten.
Doch!
Nein!
Doch!
Ich habe ein Dutzend Obstbäume gepflanzt und freue mich, dass die Früchte, Birnen, Kirschen und Äpfel nun reifen. Die Rosen, die Geranien und die Hortensien blühen. In Sturm und in der Stille gedeihen die Äste der Glyzinen. Unaufhörlich wächst das Gras. Das Unkraut schiesst in die Höhe. Das Laub der Bäume raschelt und singt mit dem Wind. Maikäfer, Hummeln und Erdwürmer bevölkern meine Welt. Kraniche, Seemöwen und Graureiher verweilen sich im hellen Licht der Schatten und lassen mein Herz höher schlagen.
Vielleicht…vielleicht wird alles gut. Die Natur heilt alte Wunden. Vielleicht.
Das reicht nicht, Dad. Wir alle müssen weniger konsumieren. Viel weniger! Wir sollten auch die vorhandene Arbeit besser teilen.
Du hast Recht. Drei Tage bezahlte Arbeit, zwei Tage unentgeltliche Arbeit in der Natur, in der Landwirtschaft, ein Tag, um die eigenen Talente zu entfalten und ein Tag zum Ruhen… und Nachdenken.Wäre das nicht sinnvoll?
Ich bin stolz auf meine Kinder. Beide wollen keine Autos, keinen Schmuck und keine Reichtümer. Ich beneide sie. Sauberes Wasser, Sonnenschein, eine intakte Erde, was will man mehr?
Liebe. All you need is love. Love is all you need.
Meine Frau Rose wirft mir einen fragenden Blick. Habe ich aufrichtig geliebt?
Ja! Ja…Ich schweige.
Wenn ich diese Welt verlasse, was hinterlasse ich Euch?
Wir brauchen gar nichts, Dad.
Doch hier ist mein Vermächtnis. Aber ihr teilt alles. OK?
Sicher, Dad.
Usha, ich überlasse Dir „Früchte des Zorns“, „Hundert Jahre Einsamkeit“ und „Die Asche meiner Mutter“.
Was bekomme ich?
„Moderne Zeiten“, „Lebe wohl, meine Konkubine“ und „ Amarcord“.
Amarcord? Nie gehört. Was heisst das?
Ein Film von Federico Fellini. Heisst, so etwas wie… Ich erinnere mich.
Bekomme ich nur Filme? Keine Bücher?
Ja…“und trotzdem Ja zum Leben sagen“. Von Viktor Frankl. Er war wie Du, Psychologe.
Danke, Dad.
Ich kann es nicht anders sagen.
Trotz Allem…trotz Allem…JA zum Leben sagen.
.............................................................................................................................

Nun gleite ich über sanfte Wellen. Es ist November, Mitten im Herbst, das Wasser bitterkalt. Am linken Seeufer leuchten tausende von Fenstern in gelb warmen Farbtönen, das rechte Seeufer leuchtet ebenfalls, hat aber zwischendurch weite dunkle Flächen. Vor mir erkenne ich noch die tief dunklen Alpen, denn der Himmel ist übersät mit Sternen und leicht heller als die pechschwarze Gebirgskette. Entlang des Seeufers, links und rechts, schleichen lange, hell beleuchtete Nachtzüge.
Ich bin allein weit und breit. Es herrscht, so scheint es mir jedenfalls, absolute Stille. Kein vernünftiger Mensch schwimmt im See um diese Jahreszeit, dazu weit, weit weg vom Ufer, um Mitternacht. Ich lege mich auf den Rücken, Arme ausgebreitet, meine Füsse bewege ich sanft auf und ab. Ich gleite auf dem Wasser, klein, leicht wie ein Schiff, von Kinderhand aus Papier gebaut.
Du spinnst Dad.
Ich höre die Stimme meines Sohnes, weiss, dass er am Ufer auf mich wartet. Ab und zu sucht er die Wasseroberfläche mit grellem Licht seiner Taschenlampe ab. Aber ich bin sehr weit weg vom Ufer. Hier inmitten des Wassers, umringt von den Bergen, unter einer von Sternen geschmückten Decke bin ich unauffindbar, ein winziger Punkt, unbedeutend.
Ich habe meinen Sohn, einen angehenden Psychologen, um den Finger gewickelt, verständlich gemacht, dass ich Zeit brauche, allein zu sein und mit einer festen Umarmung beschwichtigt.
Wie oft bin ich so weit geschwommen? Ich bin jedes Mal ans Ufer zurückgekehrt. Du weisst es.
Trotzdem. Du spinnst Dad. Wirklich!
Stumm bewegt sich ein Nachtzug entlang des linken Seeufers, geradlinig, dicht am Wasser. Der helle, warme Strahl mit dunklen, vertikalen Streifen scheint mir bloss einen Zentimeter hoch und etwas mehr als einen Meter lang zu sein. Über der Wasserlinie ruht sich der Zimmerberg, wie eine schlafende Jungfrau, mit kleinen schimmernden Städten zwischen pechschwarzen Wiesen. Am rechten Seeufer stehen vereinzelt die Villen der Reichen. Auch hier leuchten kleine Städte und Dörfer, dünn gesät zwischen stummen dunklen Weingärten.
Ich stelle mir vor, das linke Ufer sei Indien, das rechte Europa. Hier wie dort gibt es Armut und Reichtum, Aberglaube und Vernunft, Gewalt und die Sehnsucht nach Frieden. Hier wie dort bestimmt der Alltag das Leben. Ja, „the pursuit of happiness“. Das Streben nach Geld, Macht und Anerkennung bestimmt beinahe alles. Der erbarmungslose Konkurrenzkampf, der das Glück oft verunmöglicht.
Mehr als ein Vierteljahrhundert war ich Filmredaktor und habe tausende von Filmen gesehen und die Geschichten anderer Menschen verfolgt. Mit dieser Tätigkeit habe ich Geld verdient, meine Familie ernährt und Familienangehörigen in Indien geholfen. Nun habe ich mein schönes Joch niedergelegt und gehe meinen eigenen Träumen nach. Jetzt bin ich wieder ein Künstler. Ich schätze das Privileg, mit Farben zu spielen, meine Neugier zu stillen und ein unbeschwertes Kind zu sein.
Einsam segle ich, jedoch bin ich nicht ganz allein. Meine Frau ist stets bei mir. Meine Kinder, alle Menschen, die ich geliebt habe, die mich geliebt haben sind bei mir. Ashan, mein Grossvater ist bei mir, meine Grossmutter, die Kleine Rose, mein Vater, der Künstler, der schweigsame Ahammed Abe, alle meine Freunde, alle Menschen, die ich kennengelernt habe und alle, ohne die meine Welt eine andere wäre.
Was wäre ich ohne Gesang, ohne Filme und Bücher? Was wäre ich ohne "Old Man River"? Ohne Bob Dylan's "How Many Roads Must a Man Walk Down"? Ohne Chaplins Song "Smile"? Ohne Akira Kurosawa und seinen Film "Die Sieben Samurai"? Was bin ich ohne "People Mountain, People Sea", "In the Mood for Love" oder "Beasts of the Southern Wild?" Ohne Bücher wie "Früchte des Zorns" oder "Krebsstation", ohne "Hundert Jahre Einsamkeit"?
Ein Meteorit verglüht vor meinen Augen. Ist das nicht zauberhaft? Ja, ich bin hier, um zu staunen, um wieder ein Kind zu sein, um meine geliebten Sterne zu sehen. Wo bleibt der Stern Sirius? Wo bleibt der Orions Gurt? Ist das nicht ein Arm unserer Galaxie, der Milchstrasse?
Seitdem ich weiss, dass unser Universum sich aus einem winzigen Punkt ausbreitet, dass er unsichtbare Partikel, Atome, Materie, Zeit und Raum bildet, ist mein kleines Herz in heller Aufregung. Denn dies macht mich, uns alle, mit Allem verwandt! Dieser Punkt, der aus dem Nichts entstammt, bist du, bin ich. Ist dieser Punkt nicht Gott? Dieser Punkt birgt Chaos und Ordnung. Er ist "Brahm", ewig, Alles und Nichts, wie der Upanishads vor beinahe zehntausend Jahren beschrieb. Dieser winzige Punkt, soweit ich weiss, ist das Fundament der Bergkette, die vor mir liegt. Er bildet die sanften Wellen, auf denen ich nun ruhe. Er ist der Baustein aller Sterne, die mein Herz erwärmen.
Hier in der Finsternis bin ich eins mit den Wellen, mit der Erde und den Sternen. Hier bin ich in "Colour Heaven", in meinem unergründlichen Farben Himmel. Hier bin ich eins mit der Quelle aller Harmonie, mit dem winzigen Punkt, mit Millionen von Namen, mit einem einzigen Namen, ohne einen Namen.
Stille.


Danksagung
Meine Autobiographie ist nicht die ausführliche Schilderung meines Lebenslaufs. Ich halte mein eigenes Leben für unwichtig, für einen Augenschlag des Universums im Verlauf der Zeit. Dennoch bin ich dankbar für die sonderbaren Wendungen und den aussergewöhnlichen Verlauf meines Lebens. Auch dankbar, dass ich einen Teil dieses Lebens mit meiner Frau Rose und meinen Kindern Usha und Sajiv verbringen durfte.
Viele illustre Menschen ausserhalb meiner Familie haben meinen Weg beeinflusst: Bro. Ferdinand Madore (Kanada), Dr. Jyoti Sahi (Indien), Dr. Toshitsugu Arai, Christian Conference of Asia (Japan), Dr. Edilberto Tiempo (Philippinen), Dr. Cornelio Lagerwey, Communication Foundation for Asia (Niederlande), Dr. Philip Ludwig, Staatsminister A.D (Deutschland) und Dr. Lothar Kraft, Konrad-Adenauer-Stiftung (Deutschland), Prof. Wolfgang Längsfeld, Hochschule für Fernsehen- und Film, München (Deutschland), Dr. Ambrose Eichenberger OCIC (Schweiz), u.A.
Ich bin meiner Studienkameradin Dr. Biljana Mojsilovic (Serbien) sehr zum Dank verpflichtet. Sie hat mich ermuntert, meine erste Geschichte über meinen Grossvater weiter zu entwickeln und zu einer Familiensaga zusammen zu fassen. Ich danke meinen langjährigen Freund und Filmemacher Felice Zenoni (Schweiz) für seine Unterstützung und Prof. Ute Vagnard (Frankreich) für die Korrekturen.