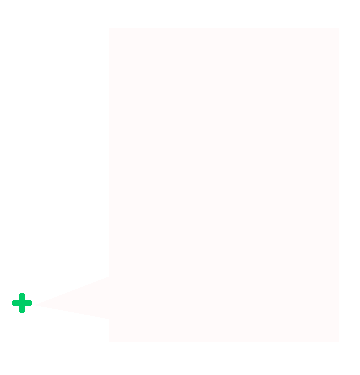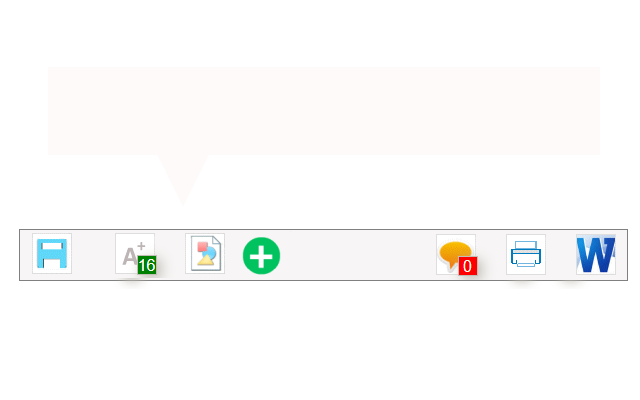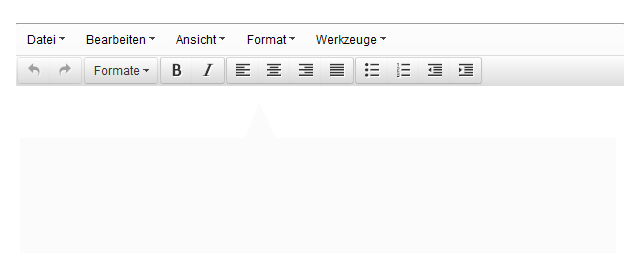Zurzeit sind 519 Biographien in Arbeit und davon 290 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 176

Ich verzichte auf ein Vorwort und lade den geneigten Leser ein, mit der Lektüre des ersten Kapitels zu beginnen. Das ist nach meiner Meinung Vorwort genug.

Frühe Jahre
Mein Erdendasein begann an einem Sonntag, unter eigentümlichen Vorzeichen. Währenddem ich nämlich meine ersten Laute von mir gab, dröhnten auf der Rennstrecke im Berner Bremgartenwald die Formel-I-Boliden. Das Motorengeräusch sei vernehmlich bis in den Michelsforst gedrungen und habe sich mit meinen ersten akustischen Lebensäusserungen vermischt. So hat man es mir später erzählt – wohl in der Annahme, dass in dieser Gleichzeitigkeit von Geburt und Autorennen mein Interesse für Sport vorprogrammiert worden sei.
Meine beiden Schwestern, Frieda und Madeleine, waren an diesem denkwürdigen Tag ins Nachbarhaus verbannt worden. Als Josefine, die Jumpfer aus Deutschland, die Mädchen wieder zurückholte, erzählte sie, das neue Brüderchen sei ganz schwarz. Wie waren die Schwestern enttäuscht, als sie in die Wiege blickten. Nichts von einem kleinen Negerlein war zu erblicken, nur ein kleines Würmchen mit einem schwarzen Haarschopf.
Über meine ersten Lebensjahre weiss ich natürlicherweise bloss durch die Erzählungen von Eltern und Geschwistern Bescheid. Offenbar ist ihnen besonders eindrücklich in Erinnerung geblieben, dass mein Leben oftmals bedroht war – sei es durch äussere Ereignisse, durch Zufälle oder durch meinen unbändigen und unvorsichtigen Tatendrang. Die erste schreckliche Gefahr drohte mir, als ich noch im Kinderwagen lag und überhaupt nichts Böses ahnte. Man hatte mich zwischen Haus und Garten an die Sonne gestellt, als im Oberacker zwei unserer Pferde wild wurden und durchbrannten. In gestrecktem Galopp rasten sie dem Hause zu. Am Pferdegeschirr war noch die Waage befestigt, ein schwerer, eisenbeschlagener Holzkloben zum Ziehen von Wagen und Fuhrwerken. Die Pferde schleiften diese Waage hinter sich her. Es schlug sie hin und her und just in dem Augenblick, als die Rosse zwischen Haus und Garten hindurch galoppierten, flog die Waage durch die Luft und traf den Kinderwagen. Zum Glück nicht mit voller Wucht, sondern nur am Rand. Der Kinderwagen wurde um die eigene Achse gedreht. Er stürzte nicht einmal um. Ob ich wenigstens ein bisschen gebrüllt habe, entzieht sich meiner Kenntnis.
Später, im Jahre 1936, liessen meine Eltern das alte, äusserst baufällige Wohnhaus abbrechen und durch einen Neubau ersetzen. Die mächtige Vorderfront war noch eingerüstet. Lange Leitern führten hinauf bis zum obersten Gerüstboden. Welche Verlockung für einen wissensdurstigen jungen Mann von zwei Jahren! Offenbar bin ich meinem Wissensdrang und meiner Neugier erlegen. In einem Moment, in dem meine Bewacher unaufmerksam waren, begann ich die Leiter hochzuklettern. Zuoberst angekommen tastete ich mich mit einem Beinchen auf das Gerüst und erlebte, was viele Menschen auch in reiferen Jahren zu durchleiden haben: ein echtes Dilemma. Vorwärts konnte ich nicht, rückwärts aber auch nicht. Was anderes blieb mir übrig, als derart in luftiger Höhe zu verharren, in einem schrecklichen, unfreiwilligen Spagat. Ein Zimmermann aber, der alte Wieland Fritz, entdeckte mich in meiner ungemütlichen Lage. Leise und, wie er später gestand, selber schlotternd, stieg er die Leiter hinauf, packte mich und brachte mich zurück auf die bergende Mutter Erde.

In die Zeit des Hausbaues fällt auch meine allererste Erinnerung. Ich sitze auf einem Stühlchen auf der neu betonierten Terrasse hinter dem Haus. Über mir balancieren Zimmerleute über die Balken der Holzlaube. Sie nageln die Bodenbretter auf die Balken und blicken zu mir herunter. Ob sie etwas zu mir sagten, weiss ich nicht mehr. Das Erinnerungsbild ist klar, aber stumm.

(2) Wir vier Geschwister
Ein drittes Mal geriet ich in akute Lebensgefahr, weil ich auf den Brunnenrand kletterte, das Gleichgewicht verlor und kopfüber in den Brunnentrog eintauchte. Über meine Rettung sind zwei Versionen überliefert. Die erste besagt, ich hätte im Wasser selber aufstehen können und meinen herbeigeeilten Vater mit der Bemerkung begrüsst: Gäu, i bi i Brunne gheit. Die andere Version weiss nichts von solcher Kaltblütigkeit und schreibt meinem Vater die Retterrolle zu. Er sei beim Melken gewesen und habe sein Milchkesseli voll Milch zufälligerweise in dem Augenblick in die Kanne geleert, als das Unglück geschah. Er sei wie der Blitz zum Brunnen geeilt und habe mich herausgezogen. Der glimpflich abgelaufene Zwischenfall erschütterte meine Eltern besonders, weil sie Jahre zuvor ihr erstgeborenes Kind, ein Büblein, auf ähnliche Weise verloren hatten – Tod durch Ertrinken im Brunnentrog.
Die vierte akute Gefährdung meines jungen Lebens ereignete sich ein paar Jahre später. Von ihr wird noch zu reden sein. Zunächst blicke ich zurück auf die dreimalige wunderbare Rettung aus Todesgefahr während meinen ersten beiden Lebensjahren. Wahrlich kein Pappenstiel. Ob Zufall oder Schickung, das lassen wir mal offen. Auf jeden Fall erklären die drei Ereignisse hinreichend, warum diese Aufzeichnungen überhaupt zustande kamen.
Memoiren unterscheiden sich in der Regel deutlich von einem Kriminalroman. Wer erwartet, ein dramatischer Höhepunkt würde den andern jagen, kommt nicht auf seine Rechnung. Meine Jugenderinnerungen jedenfalls haben auch ihre mehr besinnlich-ruhigen Seiten. Zum Beispiel ist der grosse Bauernhof zu beschreiben, wo aufzuwachsen ich das Glück hatte. In einem offenen Wiesengrund lag und liegt heute noch der Hof, den mein Urgrossvater, Bauer und Viehhändler, gekauft hatte. Hof, Matten und Äcker sind eingerahmt von drei Wäldern, dem Fluhholz, dem Spiel- und dem Forstwald. Das Wohnhaus mit der mächtigen Ründe ist mit den Stallungen zusammengebaut. Rings herum gruppieren sich weitere Gebäulichkeiten, Schweinescheuer, Holzschopf, Stöckli, Hühnerhaus und das altehrwürdige Ofenhaus. Vor den Stallungen, zwischen Kastanienbaum und Linde, prangt der mächtige Miststock. Hinter dem Haus steht eine imposante Eiche. Sie ragt weit über die First hinaus Auf dem Wiesland hinter dem Haus, der sogenannten Hofstatt, gruppieren sich die Obstbäume – Apfelsorten, die heute verschwunden sind: Croncelles, Jakob Lebel, Bonäpfel, Berner Rosen, Goldparmänen, Roggenäpfel und so weiter. Birnen gedeihen weniger gut, Kirschen schon gar nicht – das Klima ist zu rau. Besser vertragen es die Zwetschgen verschiedener Sorten. Durch den Hühnerhof fliesst ein Bach, an dem es sich wunderbar spielen lässt. In einer Ecke des blumenreichen Gartens steht ein halb zerfallenes Gartenhäuschen. Kurz und gut: eine unglaublich vielfältige Welt, in der man spielen und sich verstecken konnte. Hielt man es aus irgend einem Grund zu Hause nicht mehr aus, lockte der nahe Wald oder der Bach unten im Tälchen.
Fremde Menschen sah man nicht sehr häufig. Am Sonntag etwa einen Besuch oder Spaziergänger, die bewundernd über den Gartenzaun blickten – meine Mutter war eine grosse Blumenliebhaberin. Am Werktag erschienen gelegentlich Hausierer, manchmal auch Vagabunden, die im Stall übernachten wollten. Im Winter tauchte zwei mal der Störenmetzger auf, um eine fette Sau umzubringen und zu allerlei Wurst- und Fleischwaren zu verarbeiten. In der wärmeren Jahreszeit kam Sattler Aeberhard vom Riedbach auf die Stör. Der leutselige, ungemein hagere Mann flickte die Pferdegeschirre und alles Lederzeug, das im Betrieb gebraucht wurde. Er war sehr lieb mit den Kindern und flunkerte gerne allerlei unglaubliche Geschichten vor. Einmal durfte ich während der Arbeit auf seinen Schultern sitzen und zuschauen. Ungemütlich wurde es aber, als er sagte, ich müsse den ganzen Tag hoch dort oben auf seinen Schultern verbringen. Nicht zu vergessen ist Frau Iseli, welche auf ihrem schwer beladenen Fahrrad jeden Tag und bei jedem Wetter die Post und gelegentlich auch mündlich Neuigkeiten brachte. Sie hatte ein Glasauge, was mich stets ausserordentlich faszinierte.

Nachbarn
Meine Aussenbeziehungen zur nächsten Nachbarschaft waren recht erfreulich. Vor allen andern ist Frau Aeschbacher zu erwähnen. Sie wohnte in Mosers Stöckli, kaum hundert Meter von unserem Haus entfernt. Zwar existierte irgendwo auch ein Herr Aeschbacher. Doch der arbeitete als Kaminfeger auswärts und kam nicht einmal an jedem Wochenende nach Hause. Er war ein kleines Männchen mit stets geröteten, triefenden Augen. Das eheliche Verhältnis muss sehr kühl und sehr distanziert gewesen sein. Meine Freundin nannte ihren Ehemann nur „dr Aeschbacher“ und schien sich über seine gelegentlichen Besuche nicht sonderlich zu freuen. Meine Schwestern nannten ihn despektierlich „Chnöichräbu“, weil er einer von ihnen mal das Knie betatscht hatte.Hier geht es allerdings nicht um „den Aeschbacher“, sondern um sie, die ich jede Woche zwei- oder dreimal besuchte. Vermutlich hat sie mich sehr verhätschelt. Sie erzählte mir allerhand Geschichten und – das lockte mich am allermeisten – sie fütterte mich mit Butterbroten, die mit einer dicken Schicht Melasse bestrichen waren. Zu Hause gab es nur Konfitüre, Honig und unser Bauernbrot, das ein paar Tage nach dem Backen recht ausgetrocknet war. Frau Aeschbacher hingegen kaufte immer das herrliche Bäckerbrot. Ach, nie vergesse ich dieses einmalige Geschmacks-Gemisch: das leicht angesäuerte Bäckerbrot mit der fremdartigen Süsse von Melasse! Trotz guter Freundschaft mit Frau Aeschbacher musste sie mir gelegentlich als Handelspartnerin dienen. Im Frühling etwa sammelte ich eben verblühte Söiblumen. Diese Pinsel verkaufte ich Frau Aeschbacher als Rasierpinsel. Manchmal erzielte ich mit meiner Ware Einnahmen bis zu zehn Rappen. Frau Aeschbacher hatte zwei Söhne. Der Jüngere, Fritz, war im selben Alter wie mein Bruder. Von ihm wird noch die Rede sein. Der Ältere hiess Otti und hatte eine Stelle irgendwo auswärts. Als Schwerkranker kehrte er eines Tages in die elterliche Wohnung zurück. Seine Pflege wurde von Monat zu Monat mühsamer. Mutter, die der Nachbarin manchmal aushalf, berichtete, Rücken und Gesäss des Patienten seien eine einzige offene Wunde. Arzt und Gemeindeschwester konnten nicht helfen. Ottis Zustand verschlimmerte sich. Schliesslich begann es ihm auch „im Kopf zu fehlen“. Die Krankheit zerstörte Körper und Geist. Otti starb, als ich in der vierten Klasse war.
Die allernächsten Nachbarn waren die Bewohner des Stöckli. Dieses Gebäude hatte meine Grossmutter in unmittelbarer Nähe des Bauernhauses erbauen lassen als Altersitz. Nach ihrem Tod bewohnten es die Familien des Karrers oder des Melkers. Die Löhne der Angestellten waren vor dem Weltkrieg bescheiden. Dafür hatten sie Wohnung und Naturalien (Milch, Kartoffeln, Obst etc) gratis. Wie wurden die Angestellten gefunden? An einem bestimmten Markttag in Bern, dem sogenannten Knechtenmarkt, versammelten sich stellensuchende Landarbeiter und Bauern. Beide Parteien hielten Umschau, knüpften Gespräche an und wenn sie sich gefunden hatten, wurde die Anstellung mit Handschlag bekräftigt. Mein Vater verfügte offenbar über gute Menschenkenntnis. Die meisten Angestellten, Karrer oder Melker, blieben mehrere Jahre bei uns. An die Frauen und Kinder im Stöckli habe ich nur vage Erinnerungen. Ein Ereignis jedoch hat sich in meinem Gedächtnis tief, sehr tief eingeprägt.Von Fritz Vollenwyder, dem Melker, wird auch noch später zu berichten sein. Mein Vater war des Lobes voll über diesen Mitarbeiter, der das anvertraute Vieh so behandelte, als wäre es sein Eigenes. Eines Tages – ich war damals etwa zehn Jahre alt – hatte Frau Vollenwyder grosse Wäsche. Auf der Terrasse vor dem Stöckli standen das Waschbrett zum Schrubben der Wäsche und verschiedene Zuber. Einer davon war mit kochend heissem Wasser gefüllt. Hansruedeli, der etwa zweijährige Bub, spielte in der Nähe. In einem unbeaufsichtigten Moment fiel er rücklings in den Zuber mit dem heissen Wasser. Dabei erlitt er schwere Verbrennungen. Sofort brachte man ihn ins Kinderspital nach Bern. Tagelang kämpften die Ärzte um sein Leben. Die armen Eltern und wir mit ihnen wurden hin- und hergerissen zwischen Hoffen und Bangen. Ein paar Tage später, als ich eben von der Schule heimkam, stand Anna Vollenwyder in der Küche bei meiner Muter. Beide hatten verweinte Gesichter. Als ich zur Türe hereinkam, sagte Mutter: „Denk nur, der Hansruedeli ist gestorben.“ Ich war erschüttert. Doch völlig entgegen meinen Gefühlen brachte ich nichts über die Lippen als ein trockenes „Hm.“ Es muss schrecklich gleichgültig geklungen haben. Das war mir sofort bewusst. Ich wandte mich ab, stürzte in mein Zimmer und weinte lange und bitterlich. Jedes Mal, wenn ich in der folgenden Zeit Frau Vollenwyder begegnete, verspürte ich ein tiefes Unbehagen. Was war ich doch für ein gefühlloser Wicht, der nicht imstande gewesen war, echte Anteilnahme zu zeigen! Als sich der Melkersfamilie nach ein paar Jahren die Gelegenheit bot, im Gürbetal ein kleines Heimwesen zu übernehmen und selbständig zu werden, hat sie mein Vater kräftig unterstützt.
An Mosers, im Bauernhaus nebenan, wagte ich mich nie so recht heran. Sie hatten zwar damals noch keinen bösen Hund, sondern nur einen gutmütigen, faulen und triefäugigen Bernhardiner. Dafür aber empfand ich heilige Scheu gegenüber der alten Frau Moser. Ich habe sie wohl nie lächeln oder gar lachen gesehen. Ich wusste nur, dass sie am Morgen in aller Herrgottsfrühe zu arbeiten begann und bis in die Nacht hinein tätig war, im Haus, im Hof und vor allem auf ihren ausgedehnten Pflanzplätzen. Bete und arbeite, lautete ihre Devise. Am Montag und am Freitag rüstete sie, zusammen mit der ganzen Familie, das Gemüse für den Markt. Früh am folgenden Tag fuhr sie mit ihrem Mann, Moser Ernst, auf dem voll geladenen Bockwägeli nach Bern. Irgend einmal am Nachmittag kehrten die beiden Marktfahrer wieder heim. Moser Ernst sass meist gesenkten Hauptes neben seiner strengen Frau. Er schlummerte friedlich. Sie aber strickte auf dem ganzen Nachhauseweg. Sie erlaubte sich keinen Moment des Müssiggangs. Das Pferd trottete gemütlich heimwärts, es kannte den Weg und musste nicht geleitet werden.Moser Ernst war ein gutmütiges, kleines Männchen, das meistens eine krumme Pfeife zwischen die Zähne geklemmt hielt und vom Frühling bis in den Spätherbst einen Strohhut, ein helles Hemd und ein dunkles Gilet trug. Zwischen Bauernhaus und Stöckli befand sich ein grosses Bienenhaus, in das sich Ernst wohl so oft als möglich verzog. „Jede Betrieb ma e fule Hung verlide“, pflegte er etwa zu sagen. Mit seiner Frau war nicht gut Kirschen essen. Untätigkeit fand sie besonders abscheulich. Darum konnte sie nichtsnutzige, nichts arbeitende, bloss tagediebisch herumspielende Kinder nicht leiden. Man war am besten beraten, wenn man ihr aus dem Weg ging. Auch das Bienenhaus mied ich nach Möglichkeit. Ich fürchtete Bienenstiche sehr viel mehr als Moser Ernst, dem man nachsagte, er sei absolut immun und arbeite in seinem Bienenhaus meistens ohne Schleier.
Zwiespältig war mein Verhältnis zu Mäders, die einen Scheibenschuss weiter oben am Waldrand lebten, in einem alten, von der Sonne dunkelbraun gebrannten Bauernhaus. Mäders „Buben“ und „Mädchen“, damals wohl um die vierzig, grüssten immer sehr freundlich und waren fleissige, dienstfertige Leute Besonders das Liseli und Alfred waren immer zu Spässen aufgelegt. Zurückhaltender hingegen waren Kläri, Fritz, Sämu und Hans. Sie waren alle ledig. Angeblich hätten sie nicht geheiratet, weil ihre Familie von einer erblichen Krankheit belastet war. Unter ihren Vorfahren waren mehrere „Stummli“. Von Zeit zu Zeit wurde mein Verhältnis zu Mäders strapaziert. Sie besassen damals noch kein Telefon. So musste ich gelegentlich den bittern Weg hinauf zum Waldhaus antreten, um ein Telefon auszurichten. Je näher ich dem Hof kam, desto tiefer sank mein Herz in die Hosen. Denn Mäders hatten einen bösen Hund. Hundert Meter vor dem Haus wurden meine Schritte zaghafter. Vermutlich habe ich auch gebetet. Doch selten lachte mir das Glück. Stand einer von Mäders Buben zufälligerweise vor dem Haus oder erschien Liseli unter der Küchentür, was noch seltener der Fall war, dann jauchzte mein Herz. Der Hund wurde in Schranken gewiesen. Mein Gebet war erhört, das Unheil abgewendet. Meist aber war weit und breit keine Menschenseele zu erblicken und man musste sich zagend in den düstern Hof zwischen Wohnhaus und Scheune hinein wagen. Wenn der Hund an der Kette lag, die quer über den Hof gespannt war, blieb ich ausserhalb seiner Reichweite stehen, bis sein wütendes Gebell jemanden alarmierte und ich meine Nachricht überbringen konnte. Viel zu oft aber lag Mäders Kettenhund nicht an der Kette. Dann stürzte er einem schon auf dem Weg unterhalb des Hauses entgegen. Er kläffte, umkreiste einen drohend und zähnefletschend. Unter Zittern und Zagen wagte ich mich nur in ganz kleinen Schrittchen vorwärts. Dadurch wurde das Martyrium erst recht verlängert. Nie und nimmer vermochten die zehn oder zwanzig Rappen Lohn für die ausgestandenen Ängste zu entschädigen. Auf jeden Fall wird, wer diese Zeilen liest, mein zwiespältiges Verhältnis zu Mäders Buben und Meitschi begreifen.
Im untersten Häuschen an der Juchlishausstrasse, unweit des Forstwaldes, wohnte die Familie H. Frau H. war eine überaus dicke und dumme Schwatzbase. Der Mann, ein Sprenzel, arbeitete als Tagelöhner. Später war er bei der Gemeinde als Wegarbeiter angestellt. Ihre Zuneigung scheint im Laufe der Jahre gelitten zu haben. Sie sprach in ziemlich verächtlichem Ton von ihrem Angetrauten. Er nahm ihren Vornamen nie in den Mund. Meist sprach er von ihr in der dritten Person Einzahl: sie. Sie hat, sie muss, zum Beispiel: „I muess haut seie ga frage“.Zwei Söhne waren dem Paar beschert. Der Jüngere, Werner, war etwa neun Jahre älter als ich; Käru war noch einmal um ein paar Jahre älter. Wenn die Eltern bei uns arbeiteten, war der Jüngere natürlich auch dabei. Einmal durfte er, der Werner, meinen Bruder und eine Jumpfer zum Einkaufen begleiten. Währenddem die Jumpfer die Bestellung aufgab und der Krämer die Waren bereitstellte, tuschelten die beiden Knirpse miteinander. Werni H. wollte den Balmer Werni überreden, unbemerkt eine Spielzeugpuppe in der Hosentasche verschwinden zu lassen. Doch plötzlich, so wurde überliefert, habe mein Brüderchen ganz laut gesagt: „I stiehle nid!“ Ehre dem Ehrlichen! Werner H. war ein Einzelgänger, verschlossen, wohl darum auch ohne Freunde. Man wusste nie so recht, was man von ihm halten sollte. Eines Tages stürzte seine Mutter weinend bei uns in die Küche. Ihr Werner, damals etwa 18 Jahre alt, sei spurlos verschwunden. Sie schien ein grosses Unglück zu ahnen. Tatsächlich, bevor die Suche nach dem Vermissten richtig anlief, ging das Gerücht wie ein Lauffeuer von Haus zu Haus, auf der Bahnstrecke im Forstwald sei jemand unter den Zug geraten. Nebst den zur Unkenntlichkeit zerfetzten Körperteilen sei noch ein Paar Holzschuhe gefunden worden. Bald stellte sich heraus, dass dies die traurigen Überreste von Werner H. waren. Er hatte sich offenbar absichtlich unter den Zug geworfen. Niemand fand heraus, was ihn dazu getrieben hatte.Auch mit Kari hatte die Familie nicht sonderliches Glück. Er galt als wenig arbeitslustig und wechselte oft die Stellen - nach traditioneller Ansicht der Landbevölkerung - viel zu häufig. Doch dann schien ihm doch das Glück zu lächeln. Er hatte sich eine reiche Braut aus gutem Haus geangelt. Der Vater sei Bankdirektor! So jedenfalls erzählte uns Frau H. mit leuchtenden Augen. Alle paar Tage kreuzte sie mit neuen Wundernachrichten auf. Gesehen hatte die Braut allerdings noch niemand ausser Käru. Aber was tat es – Frau H. genügte es zu wissen, dass für ihren Kari eine Glanzpartie in Aussicht stand. Die Braut heisse Margritli und, man denke, sie besitze ein eigenes Auto. In ein paar Tagen werde sie zu Besuch kommen. Ob sie wohl das Auto in unserem Schopf unterstellen könne, fragte die gute Schwiegermutter in spe. Meine Mutter sagte nicht nein. Aber sie fragte Frau H. mit aller Vorsicht, ob ihr die ganze Geschichte ganz geheuer sei. Doch da kam sie übel an. Frau H. brauste auf. Das Margritli sei ein rechtes Mädchen aus bester Familie. Man möge dem Kari die Wunderbraut nur nicht gönnen. Wir bekamen weder das Auto noch die Braut je zu Gesicht. Der Besuch wurde verschoben, einmal, mehrmals, und fand natürlich niemals statt. Als sich schliesslich herausstellte, dass der Käru seiner „Braut“ mehrmals recht ansehnliche Geldbeträge vorgeschossen hatte, wurde allmählich auch für Frau H. der Fall klar. Es stellte sich heraus, dass das liebe Margritli eine notorische, polizeilich gesuchte Heiratsschwindlerin war. Später hat Kari doch noch geheiratet, keine Bankdirektorentochter, aber eine ehrliche Frau.

Mein Bruder
Der Altersunterschied von Werner und mir beträgt acht Jahre – wie der meiner Töchter Katharina und Regine. Als ich die erste Klasse besuchte, war er im letzten Schuljahr. Nach dem Schulabschluss begab er sich ins Welschland. Ein Jahr lang lebte er bei der Weinbauernfamilie Cornu in Chamblon sur Yverdon. Einmal durfte ich ihn besuchen, zusammen mit Vater und Mutter. Tief beeindruckt war ich von der unendlichen Distanz zwischen unserem Weiler und Chamblon. So weit von uns musste der Ärmste leben, und das ein volles Jahr! Auch sein Zimmerchen machte mir einen unauslöschlichen Eindruck. Es handelte sich nämlich um eine ehemalige Küche. Der Boden war mit Plättli belegt statt mit gemütlichen Holzriemen. Schlimm dünkte mich das. Wie sehr musste der arme Bruder unter Längizyt leiden!!
(1) Brüder
Nach dem Welschlandjahr kam Werner für das landwirtschaftliche Lehrjahr zu Familie Röthlisberger nach Wikartswil. Anschliessend besuchte er die landwirtschaftliche Schule auf dem Schwand. Meine Erinnerungen an gemeinsam Erlebtes beschränken sich darum vor allem auf die sieben ersten Lebensjahre.
Zu Werners Obliegenheiten gehörten zwei Aufgaben, an die ich mich besonders erinnere. Jeden Mittag hatte er die Hühner zu füttern und gleichzeitig die Eier einzusammeln. Die zweite, nicht sonderlich beliebte Aufgabe bestand im Ausmisten der Schweineställe. Das musste jeden Samstag getan werden.
Bei beiden Tätigkeiten leistete ich ihm oft und gerne Gesellschaft.
Währenddem er die Schweineställe ausmistete, pflegte ich oben auf den Trennmäuerchen zu sitzen und mich mit ihm zu unterhalten. Er erzählte mir Geschichten und allerlei Erlebnisse. So vernahm ich schon früh, wie es in der Schule zuging, was für Streiche die grössern Schulbuben verübten und was es mit dem Lehrer, dem Krummen Hans, auf sich hatte. Einmal hatten Werner und einige Kameraden auf dem Schulweg die Isolatoren der elektrischen Leitung mit Steinen bombardiert und offenbar hervorragend getroffen. Zahlreiche Glöggi (Isolatoren) gingen zu Bruch. Eine hochnotpeinliche Untersuchung kam ins Rollen. Die Sünder wurden überführt und die Väter mussten zahlen.
Diesem bedenklichen Vorbild ist es wohl zuzuschreiben, dass ich ein paar Jahre später derselben Versuchung erlag. Mein Freund Mäder Heinz und ich haben vermutlich weniger gut getroffen. Wohl las uns Lehrer Krummen die Leviten und beschlagnahmte unsere schönen Steinschleudern. Weitergehende Konsequenzen habe ich jedoch nicht in Erinnerung.
Zum Hühnerfüttern musste man entweder im Kornspeicher oder bei der Dreschmaschine, auf dem Boden über der Rosstenne, Hühnerweizen holen – magere Abfallkörner. Zur Dreschmaschine gelangte man über eine ausgetretene, sehr steile Holztreppe. Einmal, als wir uns an den Abstieg machten, sagte Werner im Spass: „Wei mer abegheie?“ Eine wahrhaft prophetische Frage. Kaum war sie ausgesprochen, stolperten er oder ich oder wir beide und landeten nach einem fürchterlichen Sturz auf dem Tennboden. Da lagen wir nun, Werner ziemlich verdutzt und ich lautstark schreiend. Zwar war ich kaum verletzt, dafür aber stinkwütend auf meinen Bruder. Dieser hatte einige Schrammen abgekriegt und bekam zusätzlich eine elterliche Schelte.
Montags mussten die sauber geputzten Eier zu Frau Marti auf die Post gebracht werden. Die Posthalterin tischte die Eier sorgfältig in Kartonkisten. Was beschädigt war, kam in den Korb zurück und musste wieder nach Hause gebracht werden. Einmal, als Werner und ich mit einem Dutzend gespaltener Eier im Korb wieder heimzu wanderten, reizten ihn (nur ihn?) die weissen, handlichen Dinger. Waren das nicht wunderbare Wurfgeschosse, genau in die Hand passend? Wir machten einen Umweg durch den Forstwald. Dort, im finstern Tann, ergriff er ein Ei um das andere und versuchte, die schlanken Stämme der Tannen zu treffen. Was für ein Erfolgserlebnis, wenn ein Geschoss das Ziel traf, am Holz zerschellte und auf der braunen Rinde eine leuchtend gelbe Spur hinterliess!
Durch Werner wurde ich früh schon ins Leben eines Hüterbuben eingeführt. Wenn im September das Jungvieh vom Berg – genauer: dem Tête-de–Ran im Neuenburger Jura – heimkehrten, trieb man sie fast bis zum Einwintern auf die Weide. Damals waren die elektrischen Hütezäune noch nicht erfunden. Je am Morgen und am späten Nachmittag hängte man den Jungtieren Glocken um, liess sie aus dem Stall und trieb sie auf dem Waldweg ins Moos. Abends, beim Eintreiben, begann es bereits zu dunkeln. Die vordersten Tiere waren kaum mehr zu sehen. Gut, dass da ein grosser Bruder die Hauptverantwortung trug und ich mich im dunklen Wald nicht allzu sehr fürchten musste.
Einmal erschraken die Tiere an der Spitze des Zuges und rannten kopflos ins Waldesdickicht. Wir hörten wohl ihre Schellen, konnten sie aber im Dunkeln nirgends sehen. Da treibst du eine ganze Herde und ahnst nichts Böses. Plötzlich, innerhalb einer halben Minute, sind alle Tiere verschwunden. Mein Bruder, sonst immer so überlegen, geriet in Panik. Wie, wenn wir eines der Tiere verlören? Was würde der Vater sagen? Nun, mit einigem Rufen und Herumrennen gelang es, die Herde wieder zu sammeln. Kein Tier ging verloren.
Die Arbeit des Hüterbuben war nicht allzu streng. Die Gusti durften nicht von Anfang an die ganze Wiese beweiden, damit sie das gute Gras nicht unnötig zertrampelten. So gab man ihnen Stück für Stück frei und achtete darauf, dass sie im abgegrenzten Weidebezirk blieben. Gegen Ende des Herbstes aber durften sie das ganze Moos beweiden. Nun genossen wir Hüterbuben ein wahrhaft königliches Faulenzerleben. Der breite Gäbelbach auf der einen und ein steiles Bord auf der andern Seite begrenzten das Moos derart, dass wir uns um die Herde kaum zu kümmern hatten. Wir konnten träge an der Sonne liegen. Wir hatten Musse, Feuer anzufachen und Kartoffeln oder Äpfel zu braten. Der Waldrand bot sich für allerlei Tätigkeiten an. Zum Beispiel erstieg man junge Buchen, bis sie sich zu neigen begannen, und rutschte dann über den gebogenen Wipfel auf den Erdboden. Im Dickicht wurden Stübchen gebaut, aber auch eine einfache Latrine. Im Waldbord am Wegrand, im Schatten einer riesigen Eiche, konstruierten wir mit Hölzchen Häuser, Brücken und ganze Befestigungsanlagen. Werner verstand das ausgezeichnet. Eines Morgens fanden wir die am Vortag so prächtig aufgebaute Anlage zerstört. Ein schrecklicher Zorn erfasste uns beide. Der Verdacht fiel sogleich auf Samis Köbu, den Lumpenkerl. Der solle nur warten! Nach dem Mittagessen lud mich Werner auf die Querstange seines alten Velos. Rachedurstig fuhren wir zur Kohlmatte, wo Samis Köbi seine Gusti zu hüten pflegte. Wie vermutet fand sich dort, am Ufer des Gäbelbaches, eine prachtvolle Anlage, die Köbi offensichtlich uns abgeguckt hatte. Mit wütenden Fusstritten beförderten wir die ganze Herrlichkeit in den Bach. Die rächende Tat verlieh uns ein eigenartiges Glücksgefühl. Nie besser als damals habe ich verstanden, dass Rache süss sein kann – entgegen aller christlichen Moral.
Einmal kam Werner weinend aus der Schule nach Hause. Er blutete aus dem Mund. Moser Fridu, Nachbars Sohn, hatte ihm bei einer Rauferei zwei Zähne eingeschlagen. Fridu war wegen seines Jähzorns bekannt. Wenig später trippelte der alte Moser Ernst unserem Haus zu. Mit meinen Eltern verschwand er in der Visitenstube. Dort sprachen sie lange, sehr lange miteinander. Endlich traten sie mit ernsten Gesichtern heraus. Wir vernahmen keine Einzelheiten. Offenbar hatte sich Moser Ernst für seinen Sohn entschuldigt und versprochen, die zu erwartende gesalzene Zahnarztrechnung zu übernehmen. Die gute Nachbarschaft wurde durch diesen Zwischenfall nicht ernstlich getrübt.
Moser Fridu war nie unser Freund gewesen, und war es nach der blutigen Untat noch weniger. Wir fanden, er sei ein übler Plagöri. Umso mehr ergötzte uns ein Zwischenfall, den wir beim Hüten im Moos beobachteten. Werner und ich spielten im Gebüsch. Durch das dichte Blätterwerk sahen wir Fridu auf dem Velo einher pedalen. Grossartig hatte er den Lenker losgelassen und radelte freihändig durch die Welt. Aber er hatte nicht mit der Tücke des Strässchens gerechnet. Unweit unseres Beobachtungspostens geriet sein Vorderrad auf einen grossen Stein. Es wurde quergestellt und der Fridu flog in hohem Bogen kopfvoran ins Waldbord. Mühsam rappelte er sich auf, fluchte in sich hinein und begann, das schuldig-unschuldige Fahrrad mit wütenden Fusstritten zu traktieren. Wir konnten ein schadenfrohes Lachen kaum unterdrücken.
Sympathischer als Fridu war uns sein älterer Bruder Ernst. Lebhaft erinnere ich mich an dessen Hochzeitstag. Für uns begann er freilich wenig erfreulich. Ein Gusti hatte sich losgerissen und rannte querfeldein davon, kopflos, ganz weit, bis nach Juchlishaus. Werner erhielt den Auftrag, das Tier wieder zurückzutreiben. Dies just zu dem Zeitpunkt, als das Hochzeitspaar von der Kirche zurückerwartet wurde und eine reiche Ernte an Täfeli in Aussicht stand. Werner weinte vor Wut über das entlaufene Tier. Bevor er sich auf den Weg machte – wohl oder übel, Vaters Befehl war Gesetz! – bat er mich, die zu erbeutenden Täfeli mit ihm zu teilen. Mein Herz floss über vor Mitleid und ich versprach selbstverständlich, die Beute zu teilen. Um das Brautpaar ja nicht zu verpassen und die Szenerie zu überblicken, setzte ich mich auf das Dach des Hühnerhauses. Richtig, bald erschien drüben, auf dem Strässchen beim Spielwald, das geschmückte Berner Wägeli. Der Bräutigam thronte neben seinem Marie und kutschierte selber. Eilends stieg ich vom Hühnerhausdach hinunter und stellte mich dem Gefährt entgegen. Es war nicht umsonst, der Täfelisegen war reichlich. Als Werner mit dem entlaufenen Gusti heimkehrte und seinen Anteil kriegte, hellte sich seine düstere Miene wieder auf.
Gelegentlich liess sich mein Bruder herab, mich zu den sonntäglichen Unternehmungen mit seinen Kameraden mitzunehmen. Es waren dies Aeschbacher Fritz und Samis Köbi, mit dem wir zeitweise durchaus im Frieden lebten. Natürlich war ich zuweilen für die Grossen ein mühsames Anhängsel. So konnten sie nicht immer so offen reden, wie sie mochten. Gewisse Geschichten oder Witze blieben unvollendet oder wurden verschlüsselt. Der Kleine hätte sie ja seinem Mueti erzählen können. Streifzüge im Wald, Tannzapfenschlachten und ähnliche Unternehmungen mussten dosiert werden, wenn ich kleiner Wicht dabei war. Ein beliebtes Vergnügen bestand darin, im Heggidorn an der Strasse zu sitzen und den vorbeiratternden Autos zuzusehen. Im Winter kam es gelegentlich vor, dass die Grossen mit Schneebällen nach den Autos warfen. Einmal schwenkte ein getroffener Wagen auf den Vorplatz der Wirtschaft Heggidorn ein, wendete und steuerte auf den Schauplatz des Verbrechens zurück. Obschon die drei Grossen bestritten, absichtlich getroffen zu haben, schimpfte der erboste Automobilist gewaltig und drohte uns mit der Polizei. Als er sich ausgetobt hatte, fuhr er grollend Richtung Mühleberg und Gümmenen davon. Eine Viertelstunde später erspähte einer von uns drüben in der Leimerenkurve den Landjäger, der auf seinem Töff anrückte. Offenbar hatte der wütende Autofahrer seine Drohung wahr gemacht. Da hielt es niemand für angebracht, das Erscheinen der Staatsgewalt abzuwarten. Gerade noch rechtzeitig zogen wir uns in den Wald zurück und hasteten davon. An diesem Sonntag hatten wir vom Autozählen genug.
Die grossen Buben waren über mein Dabeisein nur dann froh, wenn hinter Samis Haus, auf einem Betonplatz, „Eishockey“ gespielt wurde – ohne Eis und ohne Schlittschuhe. Die Ausrüstung war einfach. Die Stöcke bestanden aus krummen Aststücken, die man zurechtgehauen hatte. Als Puck diente eine von runden Scheitern abgesägte Holzscheibe. Nun gestaltete sich natürlich die Mannschaftseinteilung schwierig. Mich, den weitaus Kleinsten, nahm niemand freiwillig. Meist wurde ich schliesslich dem Aeschbacher Fritz zugeteilt. Er war der stärkste Eishockeyspieler und ich hütete sein Tor (von zwei aufgestellten Scheitern markiert), so gut es eben ging. Ob Sieg oder Niederlage: auf alle Fälle war es ein hehres Gefühl, sich im glorreichen Kampf zu wähnen mit Bibi Torriani und Beat Rüedi – damaligen Eishockeygrössen.

Die Schwestern
Meine Schwestern Frieda und Madeleine waren mehr als 10 Jahre älter als ich. Offenbar waren sie schon in ihrer Kindheit recht verschieden. Sie erzählten mir, ihre Grossmutter, die ich selber nie kannte, habe das kleine Friedeli bevorzugt. Wenn sie den beiden Mädchen Geschichten erzählte, sei das Friedeli stets fromm und still dagesessen und habe andächtig zugehört. Das Mädeli hingegen sei unruhig herumgerutscht und habe einfach nicht stillsitzen und zuhören können, was der Grossmutter sehr missfiel.
Unterschiedlich sind auch Lebensgeschichten der zwei Schwestern verlaufen. Frieda hat einen Bauern geheiratet – am Ende des 2. Weltkrieges, sozusagen beim Klang der Kirchenglocken, die im ganzen Land den Frieden einläuteten. Umsichtig hat sie einen grossen Haushalt geführt und sieben Kinder grossgezogen, geduldig, liebevoll und unaufgeregt. Madeleine, die ihren Taufnamen Magdalena zeitlebens verabscheute, zog es in die weite Welt.Ein Jahr verbrachte sie in Dänemark bei einer Pfarrersfamilie. Während des Winters besuchte sie eine Volkshochschule. Dem Dichter und Pädagogen N. Grundtvig zollte sie grosse Bewunderung. Er hatte bereits 1844 die erste Volkshochschule gegründet - eine Pioniertat. Madeleine lebte allein, bildete sich zur Bäuerin, dann zur Sozialarbeiterin und schliesslich zur Lehrerin aus. Mit grosser Hingabe wirkte sie zweieinhalb Jahrzehnte bis zu ihrer Pensionierung an der Primarschule Oberhofen am Thunersee.

(1) Schwestern
Beiden gemeinsam war die grosse Liebe zum kleinen Brüderchen. Die Zuneigung war zuweilen so bedrängend, dass ich mich dagegen zur Wehr setzte. Aber die Widerborstigkeit dauerte meist nur kurze Zeit. Wie gern lauschte ich doch den Geschichten, die sie mir erzählten, Märchen, Sagen, auch biblische Geschichten. Letztere mit Hilfe der bebilderten Kinderbibel von Schnorr von Carolsfeld. Der bärtige Gottvater beeindruckte mich allerdings weit weniger als Simson, der den Tempel der Philister zum Einsturz brachte. Auch David, der mit einer simplen Steinschleuder den Riesen Goliath erlegte, prägte sich meinem Gedächtnis ein.
Zwischen Wohnhaus und Stöckli stand in meinen Jugendjahren ein mächtiger Nussbaum. Im Herbst wurden die Nüsse gesammelt, auf dem Estrich zum Trocknen ausgelegt und – sofern nicht von den Mäusen gefressen – an langen Winterabenden aufgeknackt und den Vorräten einverleibt. Doch nicht von den Nüssen will ich hier erzählen, sondern von den seltsam und stark riechenden Blättern dieses Baumes. Mutter verwendete sie, um die Vorratsgruben auszupolstern, die im Garten zum Aufbewahren von Gemüse gegraben wurden. Nussbaumlaub sei ein probates Mittel, um Mäuse fernzuhalten. Wenn im Herbst das Laub fiel und als Teppich den Boden bedeckte, stapfte ich gerne darin herum. Der überaus starke Geruch – oder soll man sagen: Duft – der Nussbaumblätter brachte mich früh zur Überzeugung, aus Nussbaumlaub liesse sich ein wunderbarer Tee brauen. So sammelte ich die schönsten Blätter und breitete sie zum Trocknen auf dem Stubenofen aus. Meine Schwestern wies ich an, aus diesem duftenden Kraut Tee zu bereiten (im Winter gab es zum Znüni immer Tee). Frieda nahm den gebieterischen Wunsch mit unbewegter Miene entgegen und versprach, ab und zu Nussbaumlaub-Tee zu brauen. Oder mindestens Nussbaumlaub unter die übrigen Teekräuter zu mischen. Wenn ich dann beim Znüni Frieda fragte, ob sie meinen Tee gemacht habe, erwiderte sie manchmal: nein, heute gibt’s Lindenblütentee. Aber am nächsten Tag erfreute sie mich mit der Mitteilung: doch, heute trinken wir Nussbaumlaub-Tee, merkst du es denn nicht? Tatsächlich dünkte es mich dann, der Tee sei anders, würziger als sonst. Erst viel später kam ich dem frommen Betrug meiner Schwester auf die Schliche.
Frieda trug oft eine besondere Schürze, mit braunen, gelben und leuchtend orangen Mustern. Das fand ich ausnehmend prächtig. Als ich an einem Frühlingstag auf der Wiese einen ebenso farbenfrohen orange-braunen Falter entdeckte, nannte ich ihn zu Ehren meiner Schwester einfach „Frieda-Schmetterling“. Weil mir damals die Unterschiede zwischen Admiralen, Tagpfauenaugen und kleinen Füchsen absolut unbekannt waren, vermag ich den richtigen Namen des Frieda-Schmetterlings leider nicht zu nennen.
Beide Schwestern verbrachten, wie es damals üblich war, ein Jahr im Welschland – Madeleine in einem Pensionat in Neuenburg. Bei ihrem Auszug trug sie lange Zöpfe, die sie manchmal um den Kopf legte. Gretchenfrisur nannte man diese damals verbreitete Frisur. Als sie nach einem Jahr nach Hause zurückkehrte, waren die Zöpfe weg. Die neumodische Kurzhaarfrisur erschütterte meinen Vater gewaltig. Es dauerte Wochen, bis er sich mit dem Erscheinungsbild der Tochter abgefunden hatte.

Mutters Geschichten
Meine Mutter war eine vorzügliche Erzählerin. Am Abend, wenn sie irgend Zeit hatte, setzte sie sich zu mir ans Bett und begann in ihrer unnachahmlichen Art zu erzählen, Märchen, Tiergeschichten und auch biblische Geschichten. Andere Erzählgelegenheiten ergaben sich im Winter, wenn es draussen schneite oder ein eisiger Wind um die Hausecken blies. Da sassen Mutter und oft auch die Jumpfer, später die Lehrtöchter, am grossen Tisch in der Wohnstube, wo Berge von Strümpfen, Socken und Hemden darauf warteten, geflickt zu werden. Es war still, nur die grosse Pendeluhr tickte. Und in dieser Stille hob Mutter an mit ihren Erzählungen. Oft bettelte ich darum, sie möge doch von der Zeit erzählen, als sie selber noch ein Kind war. Das tat sie oft und gerne. Jahrzehnte später habe ich sie gebeten, die alten Geschichten aufzuschreiben oder auf Tonband zu sprechen. Ich erlaube mir, hier einige von ihnen zu zitieren.
«Im Oktober 1898 bekam die Familie Stooss auf der Ledi ihr fünftes Kind. Ob sie Freude hatten an ihrem Mädchen, weiss ich nicht. Damals galt Hausarbeit nicht viel und Kinder durften nicht zu viel zu tun geben. Müeti musste jedenfalls schon drei Wochen nach der Geburt beim Dreschen mithelfen. Es sei sehr kalt gewesen, hat man mir später erzählt. Müeti habe mich ins Deckbett gepackt und in der hintersten Ecke auf dem Stubenofen verstaut. Dort würde sich das Würmchen wohl stillhalten, dachte es bei sich. Doch am Mittag, als es zum Kochen die Wohnung betrat, war da ein fürchterliches Geschrei. Sie eilte in die Stube und fand ihr Roseli auf dem Boden liegend. Dieses Kind hat offenbar schon früh mit Strampeln begonnen. Es wollte nicht lange am gleichen Ort bleiben. Ob mir der Sturz geschadet hat und ob ich Beulen hatte am Kopf, weiss ich nicht. Ober offensichtlich habe ich überlebt.
Müeti war mit Arbeit überlastet, und weil es kaum nachkam mit allem, herrschte in unserem Haushalt immer eine ziemliche Unordnung. Es wurde erst besser, als wir vier Mädchen ein gewisses Alter erreicht hatten. Vater war ein kleiner, arbeitsamer Mann. Bis ins Alter waren seine Haare schön dunkel. Eine Besonderheit war seine tiefe Abneigung gegen die Franzosen. Bekanntlich haben die anno 1798 unser Land gebrandschatzt und ausgeplündert. Darum hat er sie, hundert Jahre später, von ganzem Herzen gehasst. Als im Krieg von 1871 die Deutschen den Sieg davontrugen, frohlockte er. Und als die ausgehungerten, zerlumpten Bourbaki so armselig in die Schweiz kamen, sagte er, es geschehe ihnen recht. Eine Abneigung hatte er auch gegen die Jäger. Wenn er in der Jagdzeit, im Herbst, einen Jagdhund erwischte, rieb er ihm die Spürnase mit Zwiebeln ein, damit er den Spuren des Wildes nicht folgen konnte.»
«Als ich klein war, wurde die Bern-Neuenburg Bahn gebaut (Eröffnung 1901). Für diesen Bau liess man eine grosse Zahl italienischer Arbeiter kommen. Niemand konnte so gut Tunnels bauen wie sie. Überall musste man für sie Quartier suchen. Jeder Winkel wurde mit ihnen vollgestopft, auch unser Stöckli auf der Ledi. Sie hatten eine eigene Köchin mitgebracht, eine Frau Rofferet, die nach ihrem Gusto kochte. Sie wurde als ausgezeichnete Köchin und Hausfrau weitherum gerühmt. Dass die Italiener kinderfreundlich sind, durfte ich selbst erfahren. Tag für Tag holte mich Frau Rofferet zu sich ins Stöckli und fütterte mich mit feinen Sachen. Sie nannte mich Ruseli. Ich wurde von ihr verwöhnt, wie wohl sonst nie in meinem ganzen Leben. Ich habe das erst später vernommen und war sehr stolz deswegen. Darüber habe ich in der Unterschule ein Aufsätzlein geschrieben. Sogar Frau Herren, die strenge Lehrerin, hat sich amüsiert.
Auch die Italiener hatten ihre Kehrseiten. Es kam oft zu Streit mit der hiesigen Jungmannschaft, aber auch untereinander. Schnell wurde zum Messer gegriffen, und es kam zu blutigen Auseinandersetzungen. Schär Chrigu im Heggidorn hatte einmal siebzehn Messerstiche im Bauch. Man musste um sein Leben fürchten, aber er ist schliesslich davongekommen. Schlimmer erging es dem Bruder von Marthaler Sämi. Den fand man tot im Strassengraben – erstochen.
Meine frühste Kindheitserinnerung ist, als die Italiener zu uns kamen, um Abschied zu nehmen. Noch jetzt habe ich das Bild von Frau Rofferet vor mir. Sie stand in unserer Stube, auf ihrem Kopf eine braune Kappe. Einige Italiener sind allerdings in der Schweiz geblieben. Sie heirateten Schweizer Mädchen und waren froh, auch in der Zukunft Arbeit zu haben. Das waren die Familien Rosa und Turla. Ich erinnere mich noch daran, dass sie eingebürgert wurden. Ihre Nachkommen wurden gute Schweizer Bürger.
Nun also fuhr die stolze Eisenbahn von Bern nach Neuenburg und wieder zurück, natürlich mit Dampf und viel Rauch. Dass die Bahn bei uns gebaut wurde, haben wir Nationalrat Freiburghaus aus Spengelried zu verdanken. Die Leute in der unteren Gemeinde (jenseits eines Hügelzuges, in Mühleberg und Buttenried) waren sehr unzufrieden. Sie hätten die Bahn lieber auf ihrer Seite gehabt. War das ein Ereignis, als der Vater mit den Kindern erstmals mit der Eisenbahn nach Bern fuhr. In Bern besuchten sie den Bärengraben und den Hirschenpark. Als meine jüngere Schwester Marta später auch einmal mit nach Bern durfte, kam sie weinend nach Hause. Sie sagte, sie habe Bern gar nicht gesehen. Sie meinte nämlich, Bern sei so blau.
Leider musste die Bern– Neuenburg Bahn bald schon mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfen. Die Einnahmen waren viel geringer als erwartet. Die Aktionäre, darunter auch viele Handwerker und Bauern entlang der Bahnlinie, warteten vergeblich auf eine Rendite. Dafür wurde uns jedes Jahr ein Freudentag geschenkt: der Aktionärentag. Die Hauptversammlung der Aktionäre fand immer in einem Gasthof in der Nähe einer Station statt. Mit einer Bescheinigung durfte man gratis dorthin fahren, aber dann auch während des ganzen Tages bis Bern und Neuenburg. Natürlich erste Klasse! Die Hauptversammlung interessierte eigentlich nur die Männer. Wir Frauen zogen es vor, nach Neuenburg zu fahren und die schönen Anlagen am See zu bewundern, von der Place Pury bis zur roten Kirche. Und da gab es noch eine ausgezeichnete Confiserie, wo man wunderbaren Erdbeerkuchen bekam. Die Gutscheine wurden ausgenützt. Wenn man im heimischen Rosshäusern ausstieg, wartete schon das nächste Familienmitglied, um mit dem Gutschein die gleiche Tour zu unternehmen. 1928 wurde die BN elektrifiziert. Es war ein langer Weg vom `Choli`, wie wir die Dampflokomotive nannten, bis zum TGV.»
«Auf den Schuleintritt habe ich mich sehr gefreut. Ich konnte jetzt nämlich mit dem rechten Händchen schreiben. Mit Schimpfen und manchem Klaps wurde mir der Gebrauch der linken Hand abgewöhnt. Der Vater schämte sich sehr, ein linkshändiges Mädchen zu haben. Ich habe das so sehr verinnerlicht, dass ich noch lange glaubte, minderwertig zu sein. Auch Werkzeuge habe ich immer mit der Linken gebraucht. Viele Jahre schämte ich mich, wenn jemand merkte, dass ich das Rüstmesser mit der linken Hand führte.
Links und rechts von meinem Schulweg erstreckten sich Wiesen und Wälder. Bei einem Seitenweg, der aus dem nahen Wald in meinen Schulweg mündete, fürchtete ich mich Tag für Tag. Ständig meinte ich, ein wildes Tier, ein Wolf oder ein Bär, breche hervor, um mich zu fressen. Einmal lag unter einem Baum ein Haufen Unkraut. Es dünkte mich, das sei die gelbe Mähne eines Löwen. Es brauchte viel Mut, um die gefährliche Stelle zu passieren.
Die Winter in meinen ersten Schuljahren waren streng und schneereich. Am Morgen weckte mich die Mutter. Ich solle schnell aufstehen, es habe in der Nacht stark geschneit, so hoch wie der Gartenzaun liege der Schnee. Der Vater führte uns mit dem Schlitten, weil die Strasse noch nicht geräumt war. Müeti packte uns das Mittagessen ein; eine Flasche Milch, Brot und vielleicht noch ein Wurstzipfel kam in das leinene Säcklein. Die Milch durften wir im geräumigen Ofenloch an die Wärme stellen. Man musste jedoch aufpassen, dass die Glasflaschen nicht zu viel Hitze kriegten und zersprangen. Wir gingen mit genagelten Holzschuhen zur Schule und trugen die auch in der Schulstube. Meisten waren sie durchnässt, und wir hatten `Gfrüri` an den Füssen und aufgeschwollene Zehen. Müeti hatte ein Allerheilmittel dagegen. Am Abend, wenn wir ins Bett gingen, hat sie unsere armen Füsse mit einer in Petrol getauchten Hühnerfeder einbalsamiert. Das half zwar. Dafür begann ein überaus lästiges Jucken.
Im Sommer hatte ich andere Schulwegsorgen. Mit dem Holzer Berteli hatte ich manchmal Streit. Das aber missfiel dem Holzer Müeti sehr. Wenn sie unser Geschrei hörte, packte sie eine Peitsche und rannte hinter mir her. Zum Glück hatte ich schnelle Beinchen. Frau Holzer hasste uns Schulkinder noch aus einem andern Grund. Zu ihrem Hof gehörten stattliche Kirschbäume, die dem Weg entlang standen. Niemand sonst auf der Ledi besass derartige Prachtsexemplare. Wenn die roten und schwarzen Kirschen reif waren, hingen die Äste tief hinunter und reichten fast bis zum Boden. Da konnten wir einfach nicht widerstehen und pflückten im Vorbeigehen eine Handvoll Kirschen. Das gab ein Donnerwetter, wenn sie uns erwischte! Holzer Ätti schimpfte nie. Sie aber war sehr geizig und lebte nach der Devise, man müsse nicht kaufen, sondern verkaufen. Den Kirschenpflückern verteilte sie jeweils dicke Zigarren, damit diese nicht naschen konnten. Doch da war sie schlecht beraten. Die Männer sparten die Glimmstengel auf für den Sonntag.
Die alte Schulstube war mit rohen langen Tischen und Bänken ausstaffiert. Ein riesiger schwarzer Zylinderofen wärmte im Winter den Raum. Vorne am Pult sass die Lehrerin, Frau Herren, und führte ihr strenges Regiment. Sie war gewiss eine tüchtige Lehrgotte. Man lernte viel bei ihr. Die meisten von uns schrieben schon in der Unterschule ohne Fehler. Aber sie wurde von allen gefürchtet. Mit ihrem strengen Blick dirigierte sie die grosse Klasse. Sie habe Augen gehabt wie ein Stechvogel, sagte mir später ein Mitschüler. Wenn ihre Nasenflügel flatterten, war nicht gut Wetter. Wer zu spät kam, musste eine Nachtkappe aufsetzen, einen Schnuller in den Mund nehmen und hinten in der Stube stehen, bis die gnädige Erlösung kam. Wer schwatzte, dem band sie den Wandtafellappen um den Mund oder, schlimmer, ein schmutziges Nastuch. Einmal, als ich schwatzte, fragte sie die Klasse: wer hat ein Nastuch. Einige streckten die Hand auf. Frau Herren wählte das schmutzigste Exemplar aus und band den Lappen um meinen Mund. Noch heute empfinde ich einen furchtbaren Ekel, wenn ich daran denke. Eine weitere Strafe war der Knopf in die Nase. Sie nahm dazu die Nase des Sünders zwischen zwei Finger und drehte sie um. Oder sie schlug einem mit dem Stock auf die Fingerspitzen. Keinesfalls durfte man am Morgen zu früh in die Schule kommen. Dann hätte man nämlich Frau Herren mit der Melchter (hölzernes Traggefäss fürs Schweinefutter) zur Scheune gehen sehen, um die Schweine zu füttern. Ihr Mann führte nämlich ein kleines Bauernwesen.
Die Oberschule führte Herr Leiser. Man nannte ihn den Ledi-Engländer. Er war ein älterer Herr mit einem langen roten Bart. Er hat dieses Schmuckstück immer sanft gestreichelt, wenn er vorne auf dem Lehrerpult sass. Meistens trug er einen schwarzen Kittel und karierte Hosen. Ein eleganter Mann war er, mit guten Manieren. Aber er passte überhaupt nicht in eine Schulstube, und schon gar nicht zu einer Bande Lausbuben. Man erzählte, er sei vorher in München gewesen und habe in einem grossen Geschäft die Auslandkorrespondenz erledigt. Einer näheren Bekannten hat er verraten, er habe dort seinen Lohn immer in Gold bekommen. Das war einmal! Dass Herr Leiser ausgerechnet an die Oberschule Ledi gewählt worden war, blieb ein Rätsel. Er war dem Schulbetrieb einfach nicht gewachsen. Er liess uns machen, was wir wollten. Es ging drunter und drüber. Die Buben ärgerten ihn, wie sie nur konnten. Im Frühling brachten sie Maienkäfer in die Schulstube. Als er fragte, wer denn diese Tierchen in die Schulstube gebracht habe, sah er lauter unschuldige Gesichter. Oft musste die Schulkommission einschreiten, um für Ordnung zu sorgen. Er unternahm schliesslich einen Selbstmordversuch und weilte viele Wochen im Spital. Ich war damals noch in der Unterschule. Am Vormittag nach dem Unglück, während des Unterrichts, kam endlich die Sanitätsdroschke. Bevor Frau Herren die Schulstube verliess, um den Sanitätern zu helfen, schärfte sie uns ein, niemand dürfe den Kopf drehen und zum Fenster hinausschauen. Wer das täte, werde ganz schlimm bestraft. Einen der Buben beauftragte sie, ans Lehrerpult zu sitzen und jedes Kind aufzuschreiben, das trotz des Verbots hinausschaute. Ich war schrecklich neugierig und hätte wenigstens einen ganz, ganz kleinen Augenblick hinausschauen wollen. Aber die Furcht war stärker als die Neugier.
Als Herr Leiser genesen war und wieder in die Schulstube zurückkehrte, wurde er von den Buben noch verspottet. Als ich in die Oberschule kam, waren die Zustände nicht besser. Es war einfach furchtbar. Ich war unendlich froh, die Ledischule verlassen und in die Sekundarschule eintreten zu können. Kurze Zeit darauf musste Herr Leiser die Schule endgültig verlassen. Die Situation war unhaltbar geworden.»
«Chieffer Rüedu war das Original auf der Ledi. Noch heute sehe ich ihn vor mir: einen grossen Mann mit hoher Stirn, grau melierten Haaren und grauen Bartstoppeln. Sein Lachen war ganz anders als bei andern Leuten. `Chu, chu, chu.` So tönte das. Eigentlich hiess er Mäder. Da jedoch sein Vater Küffer gewesen war, nannte man die ganze Familie Chieffers. Rüedu arbeitete als Zimmermann. Oft stand er oben auf der Ledifluh und schaute in den Forst hinunter. Dort wohnte in einem kleinen Häuschen die Beth, uneheliche Tochter der ledig gebliebenen Anni Schmid. Man munkelte, Beths Vater sei ein Berner Patrizier. Jedenfalls hatte Anni in einem vornehmen Haus in Bern gedient. Die Tochter war eine gross gewachsene, hübsche und auch kluge junge Frau. Sie verfügte über ein geschliffenes Mundwerk, weshalb sie von den Leuten gefürchtet war. Rüedu gefiel sie sehr und er pflegte zu sagen: Wenn ich in den Forst hinunterschaue, dünkt es mich, ich schaute in den Himmel. Die Heirat mit der stattlichen rothaarigen Beth kam zustande. Dem Ehepaar wurden sechs Kinder geboren. Rüedu machte zwischenhinein auch Tanzmusik und war bis ins Freiburgische unterwegs. Da begann es leider mit der Ehe zu hapern. Es kam zur Scheidung. Die Kinderschar wurde geteilt: drei hier und drei dort. Jeder Elternteil liebte nur die drei Kinder, die bei ihm lebten. Rüedu sagte, wenn er früher in den Forst hinuntergeschaut habe, sei es ihm vorgekommen wie der Himmel. Jetzt scheine es ihm die Hölle zu sein. Beth schaute gut zu seinen drei Kindern. Einer, der Hans, ist Lehrer geworden. Allerdings behauptete einer seiner Schüler, der Schulmeister habe ihm für manchen Franken Haare ausgerissen. Die Tochter Frieda hat später für verschiedenste Anlässe Verse geschmiedet. So dichtete sie zum Beispiel das Ledifluh-Lied. Als seine drei Kinder ausgezogen waren, wohnte Rüedu in einer kleinen Stube, nur durch eine dünne Wand von der Nachbarwohnung getrennt. Die Nachbarsbuben entdeckten ein Astloch, durch das sie alles beobachteten, was Rüedu so trieb. Als er es merkte, hängte er einen Eimer vor das Loch. Doch die Lausbuben schoben mit einem dünnen Stecklein den Eimer auf die Seite. Rüedu war meistens nur nachts zu Hause. Neben seiner Arbeit als Zimmermann half er den Bauern beim Heuen, oft auch den Wirtsleuten im Heggidorn. Im Winter kam er abends oft zu uns. In unserer Küche war es wärmer als in seiner Stube. Einmal, als wir alle um den Tisch sassen und Nüsse aufklopften, gab ihm das Müeti einen kleinen Hammer und ein Brett. Aber er hielt es nicht lange aus. Dieser Hammer passe ihm nicht, er hole daheim seinen Eigenen, sagte er, stand auf und ward an diesem Abend nicht mehr gesehen. In der kalten Jahreszeit machte er oft Reiswellen. Einmal, als er am Waldrand am Reiswellenbock mit dem Gertel hantierte, kam eine gut gekleidete Dame des Weges und fragte ihn freundlich nach dem Weg nach Allenlüften. Sie kam von der Bahnstation und kannte sich nicht aus. Rüedu liess den Gertel fallen, wies zum Wald und sagte: `Jetzt musst du hier in den Wald hinunter. Da kommst du über Wurzeln und Gräben und kommst auf einen Weg. Der führt dich direkt nach Allenlüften`. Da sagt die Dame, etwas indigniert, sie sei die Frau Pfarrer. Rüedu entgegnete: `Deswegen musst du trotzdem da hinunter`. Rüedu kam schnurstracks zu uns, um diese Episode zu erzählen. Er habe schon gesehen, dass die ein sauberes Weibervolk gewesen sei. Chu, chu, chu.
Die Ledi hat Rüedu sehr gefallen. Sie sei der Garten des Amtsbezirks Laupen. Seine Tochter Friede erwiderte: `Und du bist ein Nesselstock in der Gartenecke`. Sein Urteil über Unglücksvögel und Missetäter war wenig verständnisvoll. Schnell einmal sagte er, dieser oder jener sei schlechter als die Sünde auf ihrer Kehrseite. Mit Rüedu nahm es ein schnelles Ende. Im Heggidorn war zwischen Wirtschaft und Scheune ein schmaler unbeleuchteter Durchgang. Spät abends fuhr er mit einem Bockwagen durch diesen Durchgang und übersah einen Querbalken. Er prallte mit dem Kopf dagegen, brach sich das Genick und starb auf der Stelle. Das geschah 1914, am Anfang des ersten Weltkrieges. Wir haben Chieffer Rüedu, diesen alten, eigensinnigen Sprücheklopfer merkwürdigerweise sehr vermisst.»
«Im Frühling 1914 hiess es: jetzt musst du ins Welschland. Man hatte für mich eine Stelle gefunden bei einer Familie Bonjour in Lignières oberhalb von Neuenstadt. Bonjours betrieben eine Bäckerei. Die Familie bestand aus Monsieur, Madame und drei Kindern, von denen noch keines schulpflichtig war. Zwei Mädchen und Francois, der noch im Stubenwagen lag. Ich fühlte mich in der Familie gut aufgehoben. Aber sie mussten Geduld haben mit mir. Ich verstand gar nichts vom Haushalt und musste ganz unten anfangen. Daheim hatte man mir nur Putz- und Feldarbeiten zugewiesen. Niemandem war es in den Sinn gekommen, mich kochen zu lehren. Kochen durften nur die älteren Schwestern. Ich genierte mich deswegen sehr, auch wegen meinen billigen Kleidern, die mir Schwester Lina angefertigt hatte. Unmittelbar neben der Bäckerei befand sich ein Töchterpensionat, geleitet von zwei feinen Schwestern. Oft spazierten die Töchter vor unserem Küchenfenster vorbei, singend, in hübschen Kleidern. Wie ich sie doch beneidet und mich möglichst unsichtbar gemacht habe! Bei der vorzüglichen Kost, die bei Familie Bonjour auf den Tisch kam, nahm ich merklich zu. Meine Kleider wurden beängstigend eng. Zum Glück hatte ich für den Werktag Ärmelschürzen. Die waren damals Mode und ich durfte sie auch im Laden tragen. Ich musste oft im Laden bedienen und Semmeln und Brot verkaufen. Dabei lernte ich, mich französisch zu verständigen. Man sagte mir, ich lerne schnell und in einem Jahr würde ich tipptopp französisch sprechen. Auch in der Küche machte ich Fortschritte. Ich war glücklich, einfachere Mahlzeiten selbständig zubereiten zu können. Gekocht wurde auf einem Petrolrechaud. Dies musste jeden Samstag gründlich gereinigt werden – eine mühsame und unangenehme Arbeit. Sehr gern beschäftigte ich mich mit Handarbeiten. Eine grosse Hilfe war mir das in der Sekundarschule Gelernte. Die Arbeitslehrerin, Frau Jaberg, hat uns viel mitgegeben. Das habe ich ihr nie vergessen. Nicht nur das selbständige Nähen und Stricken lehrte sie uns, sondern auch moralische Lebensregeln. Sie war eine glänzende Erzieherin. Noch grösser war meine Verehrung für ihren Mann, Sekundarlehrer Jaberg. Seine Lebensweisheiten, oft in kurze Sentenzen gefasst, sind mir noch heute gegenwärtig. Auf alle Fälle spendeten mir die Meisterleute viel Anerkennung für meine Strickarbeiten und für die sauberen Flicke auf Herrn Bonjours Bäckerhosen. Meine Minderwertigkeitsgefühle konnte ich ein wenig vergessen.
Ich muss noch erzählen, wie hoch mein Lohn war. Ganze 9 Franken betrug mein Monatslohn. Als eines Tages die Waschfrau krank wurde und ich mich anerbot, auch die Wäsche zu besorgen, kriegte ich eine Lohnerhöhung von einem Franken.
Die Welschschweizer haben früher die jungen Deutschschweizer ordentlich ausgenützt. Viele wollten französisch lernen und liessen sich als Bauernknechte und bonne filles engagieren. Hermann, mein späterer Ehemann, hatte eine Stelle im Traverstal. Was hat doch der Arme dort ausgestanden! Der Meister war ein schwerer Alkoholiker, sass Tag für Tag im Wirtshaus und kam betrunken nach Hause, wo er alle beschimpfte. Hermann musste den Stall alleine besorgen und mit einem störrischen Esel in die Käserei. Im Frühling musste er fünf Wochen lang allein Steine auflesen. Madame sass derweilen auf einem Markstein, strickte und kontrollierte, ob der Junge fleissig arbeite. Der starb fast vor Heimweh. Jeder Wolke, die am Himmel heimwärts zog, sah er sehnsüchtig nach. Abends musste er im Stall oder in der Küche bleiben. In die Stube durfte er nie. Unter Tränen schrieb er, er halte es nicht mehr aus und möchte nach Hause. Aber die Mutter und die älteren Brüder sagten, der tue nur `nötlig`. Der solle sich durchbeissen. Die fromme Mutter kümmerte sich nicht. Lieber schrieb sie an alle Pfarrer im halben Kanton, und redete vom Heiland und vom Herrn im Himmel. Hier auf Erden hatte ihr Bub nicht einmal genug zum Essen. Im Winter ass er Viehfutter (Sesamkuchen), um den Hunger zu stillen. Nach einem Jahr holte ihn die Mutter heim. Was sagte sie, nachdem sie die schlimmen Verhältnisse gesehen hatte? Ums Himmels Willen, wenn ich das gewusst hätte! Längstens hätte ich ihn nach Hause geholt.
Mein Welschlandaufenthalt in Lignières dauerte leider nur dreieinhalb Monate. Ich fühlte mich wohl bei Bonjours. Doch plötzlich pfiff ein anderes Vögelchen. In Sarajewo wurde der österreichische Thronfolger ermordet und der Weltkrieg brach aus. Oesterreich erklärte Serbien den Krieg und Kaiser Wilhelm der Zweite, dieser Kriegsgurgel, brach ins unschuldige Belgien ein, um die Franzosen zu dreschen. Das hatte er ja schon lange im Schild geführt. Mein Vater schickte mir ein Telegramm: sofort heimkommen! Mit schwerem Herzen packte ich meinen Reisekorb und nahm Abschied von meinen guten Meisterleuten. Der böse Krieg verteufelte fast meine ganze Jugendzeit. Meine beiden Brüder mussten einrücken. Daheim war nur noch Vater mit seiner angeschlagenen Gesundheit, nach einer schlecht ausgeheilten Lungenentzündung. Nun mussten wir Töchter ans Werk. Ich, noch nicht ganz 16jährig, und Schwester Lina mussten nach dem Abendessen Gras mähen. Sehr früh am Morgen ging es wieder los. Wir mussten die Pferde an den Graswagen spannen, das Gras aufladen und daheim in der Tenne wieder abladen. Auch im Stall mussten wir helfen. Urlaub bekamen meine Brüder erst nach 8 Monaten. Vier Jahre lang hatte ich als Karrer die Pferde zu besorgen. So gern hätte ich etwas gelernt, Kochen, Handarbeiten, Gärtnern. Aber es gab keine Möglichkeit. Mit Lesen sammelte ich immerhin einen kleinen Wissensschatz. Im Frühling 1918 durfte ich endlich in die Haushaltungsschule Schwand. Mit Eifer machte ich mich ans Lernen, war interessiert und stellte Fragen, so dass der Herr Direktor einmal fragte: Woher haben Sie das alles? Es herrschte damals allgemeiner Mangel an Konsumgütern. Kochen konnten wir fast nur Kartoffelspeisen. Unser Kurs wurde später als Kartoffelkurs tituliert. Schlimm war der Ausbruch der spanischen Grippe. Wir durften das Haus nicht verlassen. Besuche waren nicht erlaubt. Klanglos ging unser Kurs zu Ende, ohne Examen, ohne Abschiedsfeier. Schon auf dem Weg nach Hause vernahm ich, dass in unserer nächsten Umgebung eben erst vier junge Männer gestorben waren. Und niemand durfte sie auf ihrer letzten Fahrt zum Friedhof begleiten. Menschenansammlungen waren verboten. Es drohe Ansteckungsgefahr. Der Sommer ging mit viel Kummer und Sorgen zu Ende. Auch der Krieg war vorbei. Das fürchterliche Morden hatte ein Ende. Zurück blieben aber ein schreckliches Chaos und unermessliches Elend. Kaiser Wilhelm flüchtete nach Holland und bekam dort Asyl.
Zu jener Zeit ging ich zum zweiten Mal ins Welschland, diesmal nach Colombier zu Madame Kretschmar. Dort bekam ich zu spüren, welchen Wert ein Dienstmädchen hatte. Madame Kretschmar war ursprünglich Französin. Ihr Mann war gestorben und der ältere Sohn, Pfarrer von Beruf, hatte freiwillig in der französischen Armee gedient. Irgendwo an der Front war er gefallen. Ich begriff die Trauer und die Verbitterung von Madame wohl. Obschon ich mir Mühe gab, alles recht zu machen, erhielt ich keine Anerkennung. Ich war fast immer allein, am Abend in meiner kalten Mansarde, und auch tagsüber ohne jeglichen Familienanschluss. Monsieur Luc, der jüngere Sohn, hatte eben die Maturitätsprüfung bestanden und mit dem Theologiestudium in Neuenburg begonnen. Nie hätte er das Wort an mich gerichtet, das wäre unter seiner Würde gewesen. Meine Brotration wäre eben recht gewesen fürs Frühstück. Aber es musste für den ganzen Tag ausreichen. Butter gab es wenig und meine Ration landete auf den Tellern der Herrschaft. Wenn ich am Morgen in der Küche allein am Tisch sass, durfte ich mit meinem Teller ins Esszimmer. Dort spendete Madame ein Löffelchen Konfitüre. Mit dieser grossartigen Beute musste ich zurück in die Küche zu meinem einsamen Frühstück. 1918-19 war ein sehr kalter Winter. Das Chalet du Vergée hatte 13 Zimmer, die ich alle in Stand zu halten hatte. Alle Zimmer waren vollgestopft mit kostbaren antiken Möbeln. Eines war das Napoleonzimmer, wo ich 40 Bilder von Napoleon zählte. Der Ehemann von Frau Kretschmar hatte sich als Sammler betätigt. Mit all den Kostbarkeiten hätte man im Chalet ein Museum eröffnen können. Allein in den Korridoren hingen 80 Gemälde. Die vielen Möbel waren von grossem Wert. Alles musste gepflegt werden. Das Abstauben der vielen Schnitzereien war mir eine Qual. Auch die Reinigung der Teppiche war Schwerarbeit. Staubsauger gab es noch nicht. Es wäre mir nicht möglich gewesen, die schweren Teppiche allein hinters Haus zu schleppen und an die Stangen zu hängen. Da musste sich dann doch Monsieur Luc zur Verfügung stellen, natürlich ohne ein einziges Wort an mich zu richten.
Der kalte Winter nahm ein Ende. Ich habe im ungeheizten Haus jämmerlich gefroren. Um Kohle zu sparen, ging Madame tagsüber zur Tochter, die eine Drogerie betrieb. Am Abend kam sie nach Hause, um ein wenig zu heizen. Ich litt unter einer schweren Erkältung. Die Hände schmerzten und waren aufgeschwollen. Die Einsamkeit machte mir auch zu schaffen, beinahe wäre ich schwermütig geworden. Nach einem halben Jahr packte ich meine Siebensachen und fuhr nach Hause. Fertig und Schluss.»
Zum Glück vermochte meine Mutter ihren Lernhunger ein wenig zu stillen. Sie durfte die landwirtschaftliche Haushaltungsschule im Schwand bei Münsingen besuchen. Wenig später verheiratete sie sich mit Hermann Balmer, meinem Vater.
«Die Trauung fand im Dezember 1919 in der Kirche Frauenkappelen statt. Wir beide traten allein vor den Traualtar. Die Schwiegermutter gab ihrem Sohn 70 Franken zur Hochzeit und ermahnte ihn, er solle es einfach machen. Später unternahmen wir doch noch eine Hochzeitsreise, ins Tessin. Das gab in der Verwandtschaft zu reden. Ein Schwager fand, der Tessin sei sehr weit und eine Reise dorthin übertrieben. Hermann kannte den Tessin, weil er dort als Militärtrompeter Dienst geleistet hatte. Wir wohnten im Hotel Adler in Lugano und fuhren einmal auf den Monte Generoso. Dort gefiel es mir sehr und ich würde gerne noch einmal dorthin reisen. Im Forst wurde noch ein Stöckli gebaut für die Schwiegermutter, bevor ich einziehen konnte. Für eine blutjunge Frau war das ein Wagnis. Ein grosser Betrieb, ein uraltes, baufälliges Haus. An einem Balken konnte man noch die Jahrzahl 1701 lesen. Überall herrschte Unordnung. Die Küche war rauchgeschwärzt. Im Küchenschrank angeschimmelte Speiseresten. Im Stubenboden hatte es Lücken, sodass man in den Keller sah. Und überall Flöhe. Die Schwiegermutter pflegte zu sagen; ‘Alle Leute haben Flöhe’. Einmal stand sie in der Haustür, rieb den Rücken am Türpfosten und meinte: ‘Ds Wätter änderet. D Flöh mache bös’.
Mit diesen Verhältnissen wollte ich mich nicht abfinden. In meinem Elternhaus hatte ich es anders gelernt. Was für eine Herkulesaufgabe wartete auf mich! Sieben Jahre lebte ich mit der Grossmutter zusammen. Als sie starb, atmete ich auf. Wir konnten das Heimwesen käuflich übernehmen, allerdings zu einem (zu) hohen Preis. Viele Jahre mussten wir kämpfen, um aus den gröbsten Schulden herauszukommen.»
Grosse Freude herrschte, als meinen Eltern ein Büblein geboren wurde, Wernerli. Die Freude kehrte sich in grosse Trauer, als das Kind im Alter von zwei Jahren starb. Es ertrank im Brunnentrog. In den folgenden Jahren wurden zwei Mädchen und zwei Buben geboren. 1936 wurde der Wohntrakt des 200jährigen Alemannenhauses abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt. Meine Mutter freute sich insbesondere über das Badezimmer. Das war damals fast revolutionär und gab bei Nachbarn und bei lieben Verwandten sehr zu reden.
Die Organisation des Betriebes klappte, soweit ich mich erinnere, vorzüglich. Vater war der Chef über Stall, Feld und Wald und gebot über die Knechte, wie man damals sagte.
«Wir hatten einen ganzen Trupp Knechte. Damals war ja alles noch Handarbeit. Wir beschäftigten einen Melker, einen Untermelker, einen Karrer und Erdknechte für die Feldarbeit. Es war schwierig für mich. Die meisten waren wesentlich älter als ich. Auch wenn ich nicht zu befehlen brauchte, war ich eben doch die Meistersfrau.»
«Etwa sechs Jahre nach dem Hausbau hatten wir die meisten Schulden zurückbezahlt. Hermann war eben ein guter Bauer, und er konnte rechnen. Und wir kauften nur, was unbedingt nötig war. Es ging vorwärts mit unserem Betrieb. Aber da kam die Krankheit meines Mannes. Eine sehr schwere Nierenoperation wurde nötig. Wir befürchteten das Schlimmste. Ich dachte daran, alles aufgeben zu müssen. Von den Kindern war erst Frieda aus der Schule. Witwenrente gab es damals noch nicht. Was sollte ich? Nach drei Wochen meinte der Arzt, der Patient sei jetzt wohl über den Berg. Aber er hat sich in den folgenden Jahren nie ganz erholt. Umso weniger, als später ein Magengeschwür diagnostiziert wurde. Der Professor stellte ihn vor die Wahl: entweder eine Operation oder strenge, ganz strenge Diät während eines Monats. Nur keine Operation, sagte Hermann. Man hatte ihn so schlimm verschnitten, den halben Körper. Die wüste Narbe reichte vom Bauch bis zur Wirbelsäule. Lieber Diät und hungern. Man verabreichte ihm Nahrung nur grammweise, dafür sehr häufig, auch während der Nacht. Wir durften ihm nichts bringen. Ich besuchte ihn fast jeden Tag. Ich hatte immer einen Kalender bei mir. Wenn die Angestellten fragten, was sie tun sollten und wie, schrieb ich es auf. Im Spital zückte ich den Kalender und fragte: wie sollen sie es machen? Er sagte es mir und ich ging heim, um zu befehlen. Wir hatten gute Leute damals. Nie waren sie unwillig. Mit keinem hatte ich Probleme. Alle bemühten sich. Aber ich habe halt auch mitgearbeitet. Eine schwere Zeit war es, aber wir haben sie überstanden.»
Meine Mutter gebot über Haus, Keller, Küche und Garten. Auch über das Hühnervolk. Das Eiergeld durfte sie für sich behalten. Ihr zur Hand gingen in den ersten zwei Jahrzehnten Angestellte, zum Teil aus dem Ausland. Von der fröhlichen Deutschen Joos wird noch die Rede sein. Mutter holte sich in zahlreichen Kursen die Kompetenz, Lehrtöchter auszubilden. Das waren zumeist tüchtige und fröhliche junge Damen. Jedes Jahr erschien ein neues Gesicht. Doch nicht von ihnen will ich erzählen, sondern von der vielfältigen Arbeit. Der Morgen war reserviert für die Hausarbeit. Wichtig für den Tagesablauf war, dass das Morgenessen pünktlich auf den Tisch kam. Anschliessend der Abwasch. Die Betten mussten gemacht werden, auch in den Knechtenzimmern. Dann Putzarbeiten. Am Brunnen das Milchgeschirr waschen. Um neun Uhr musste das Znüni parat sein. Im Winter Tee, im Sommer Most, dazu Brot und Käse. Und schon galt es, das Mittagessen vorzubereiten. Das Rüsten von Gemüse und Kartoffeln für eine ‘Tischete’ von zehn, zwölf hungrigen Leuten war keine Kleinigkeit. Am Nachmittag arbeiten die Frauen im Garten oder im Pflanzplätz. Meine Mutter hatte, wie man so sagt, einen grünen Daumen. Ihre besondere Leidenschaft galt den Blumen. Vor dem Haus und auf den Lauben leuchteten die Geranien. Im Garten waren fast ebenso viele Blumen- wie Gemüsebeete. Wenn Spaziergänger vor Haus oder Garten stehen blieben und die Blumenpracht rühmten, war Mutter glücklich. Übrigens kannte sie von den meisten Blumen auch die lateinischen Namen. Während der Heu- und der Getreideernte hatten die Frauen auf dem Feld anzutreten, ebenso während der Kartoffelernte. Meistens ging alles wie am Schnürlein. Jedes wusste, was zu tun war. Kaum je kam Hektik auf.
In lebendiger Erinnerung bleibt mir der Bildungshunger meiner Eltern. Anfangs der Dreissigerjahre schlossen sie sich mit einigen andern Ehepaaren zu einer Ortsgruppe der sogenannten Jungbauern zusammen. Ziel war die kulturelle und bildungsmässige Förderung der jüngeren Bauerngeneration. Einmal monatlich traf man sich reihum. Ein Mitglied der Gruppe hielt ein Referat, ein anderes Mitglied schrieb das Protokoll. Im Nachlass meiner Mutter fand sich ein Heft mit zahlreichen Aufzeichnungen. Referiert wurde nicht nur über Bauernfragen, ökonomischen, politischen, organisatorischen. Auch die Gedankenwelt Gotthelfs oder Lenins kamen zur Sprache. Die Protokolle, zumeist in schöner Handschrift geschrieben, sind praktisch fehlerfrei. Leider entwickelte sich der Führer der Jungbauern, ein Dr. Müller, zum Fürsprecher des Nazitums. Darauf zerfiel die ursprünglich so bemerkenswerte Bewegung.
(1) Unsere Familie
Später, vor allem nach dem Weltkrieg, besuchten die Eltern Vorträge der «Oekonomisch-gemeinnützigen Gesellschaft». Einmal waren sie zusammen an einem Orgelkonzert von Albert Schweitzer im Berner Münster. Das Münster sei dermassen überfüllt gewesen, dass man den Urwalddoktor fast mit Brachialgewalt durch die Menge habe geleiten müssen. Im Winter war Mutter häufiger Gast bei der Volkshochschule in Bern. Mit dem Zug fuhr sie nach Bern und kam spätabends, von der Station bis zum Hof oft durch hohen Schnee stapfend, nach Hause. Meist erzählte sie am folgenden Tag, was sie gehört hatte. Die Psychologin Frau Dr. Häberlin erschloss ihr ganz neue Welten, ebenso der Pädagoge Hans Zulliger. Historische, literarische und politische Themen haben sie ebenfalls interessiert. Intensiv diskutiert wurde in unserer Familie das Buch «Ich wählte die Freiheit» von Viktor Krawtschenko. Dieser, ein hochrangiger Sowjetdiplomat, hatte die USA um Asyl ersucht. In seinem sensationellen Buch, erschienen 1946, enthüllte er die Machenschaften des Kremls, insbesondere Stalins, und zeigte damit eine der dunkelsten Seiten Russlands auf. So kreuzten sich die Interessen der Eltern mit den Meinen.

Vaganten und Hausierer
Vaganten nannten wir sie, die Brüder der Landstrasse. Einige von ihnen kannten wir mit Namen, zum Beispiel den Grossenbacher, den Rellstab, den Zahnd. Andere zogen es vor, inkognito unterwegs zu sein. Meistens kamen sie im Herbst und winters, wenn das Übernachten unter Gottes freiem Himmel allzu unangenehm wurde. Sie kreuzten immer erst am Abend auf. Wären sie früher gekommen, hätte man ihnen wo möglich noch eine Arbeit zugewiesen. Dem aber trachteten sie zu entgehen. Nach dem Abendessen der Familie wurden die armen Teufel in die Küche geheissen. Dort wurde ihnen eine warme Suppe, Brot oder Resten serviert. Zu diesem Zweck hatten wir eigenes „Vagantengeschirr“, das ganz unten im Küchenschrank verwahrt und nur für diese besonderen Gäste hervorgenommen wurde. Diese Separierung hatte guten Grund. Fast alle Vaganten waren voller Läuse und Flöhe. Zudem stanken sie bestialisch. Es wäre unmöglich gewesen, mit ihnen am gleichen Tisch zu essen. Hatten sie sich gesättigt, nahm ihnen der Vater für die Nacht Zündhölzer und das Sackmesser ab. So war es auf den Bauernhöfen Brauch. Zuhinterst im Stallgang breitete man eine Strohbürde aus und gab den Übernächtlern eine Rossdecke. Nach dem Morgenessen, das wiederum in der Küche aufgetragen wurde, liess man sie fürbass ziehen.
Ab und zu gab es Zwischenfälle. Grossenbacher Chrigel, Insasse des Verpflegungsheims Frienisberg und alle paar Monate auf Sauftour, kannte meine Eltern noch von früher. Dieser Umstand und die notwendige Menge Schnaps machte ihn rührselig und weinerlich. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er auf meine Mutter, das Roseli, einredete und heulte wie ein Schlosshund. „Tüet mi ömu de nid verachte“, schluchzte er wieder und wieder, und liess den Tränen freien Lauf. Ich hatte vorher noch nie einen erwachsenen Mann weinen sehen. Darum machten mir Grossenbachers Tränenströme einen gewaltigen Eindruck. Das Wort „verachten“ verstand ich zwar nicht. Aber ich spürte dahinter etwas schrecklich Tragisches und Unheimliches.
Mit dem Zahnd verhielt es sich anders. Eines Morgens verschwand er noch vor dem Morgenessen – ohne irgendein Wort des Abschieds oder gar des Dankes. Später entdeckte der Melker, dass ihm der Geldsäckel fehlte. Er hatte ihn in der Tasche seiner Hose stecken lassen, die im Schöpfli aufgehängt war. Der Verdacht fiel sofort auf den spurlos verschwundenen Zahnd. Mutter meldete den Verlust dem Landjäger. Noch selbigen Tages führte die Fahndung zum Erfolg. Der Landjäger brachte den entwendeten Geldbeutel zurück.
Erwähnenswert ist schliesslich ein Vagabund namens Tröhler. Auch ihn fürchteten wir, weil er so rot unterlaufene Äuglein hatte und zu den anderen Leuten kaum je ein Wort sprach. Er war, wie fast alle Vagabunden, schwerer Alkoholiker und hatte meistens, wie wir sagten „einen bei sich.“ Dieser unsichtbare Begleiter löste seine Zunge. Tröhler redete und gestikulierte mit ihm. War das unheimlich für uns! Nur selten kam er in die Nähe. Aber wenn er im Hof auftauchte oder auch nur drüben im Spielgässli, zwischen Forst- und Spielwald unterwegs war, behaupteten die Erwachsenen, bald werde das Wetter ändern. Der Tröhler sei nämlich ein richtiges Wettermandli.
Willkommener als die Vaganten waren die Hausierer. Ihr Besuch stellte meistens eine geschätzte Abwechslung dar.
Besonders gern gesehener Gast war der Muugige-Husierer. Niemand kannte seinen Namen. Sein Köfferchen trug er an einem Lederriemen auf dem Rücken. Sobald er auf dem Hof erschien, stellte er seinen Koffer auf die Bank vor dem Haus, kramte aus seiner Rocktasche die Mundharmonika hervor und begann ein paar Melodien zu spielen, bevor der geschäftliche Teil begann. Für meine Begriffe spielte er wunderbar. Noch heute höre ich seine virtuosen Tremolos. Nach kurzer Zeit war die halbe Familie versammelt. Selbst Karrer und Melker liessen sich herbei, den Tönen zu lauschen. Nach dem Konzert öffnete der Muugige-Husierer mit ein paar witzigen Sprüchen seinen Koffer. Es war geradezu eine Freude, ihm Schuhbändel, Elastic, Seife und andere Kurzwaren abzukaufen. Manchmal kaufte man auch, ohne ein Produkt wirklich nötig zu haben. Der fröhliche Besucher wusste seine Ware mit bewegten Worten anzupreisen. Besonders pflegte er sein Haarmittel zu rühmen. Wenn man zu wenig Haare habe, wachse einem in kürzester Zeit eine mächtige Mähne. Habe man jedoch zu viele Haare, falle ganz von selber aus, was überflüssig sei. Hatte er seine Geschäfte erledigt, schloss er den Koffer, schwang ihn auf den Rücken, bedankte sich und verschwand, auf seinem Instrument noch ein paar Takte spielend, um den nächsten Rank.
Muttini hausierte mit Überkleidern. Er war mit dem Velo und einem grossen kastenförmigen Anhänger unterwegs. Obschon er sich mit seiner Ware eher ans Männervolk wandte, hörten wir Kinder und hörten auch die Frauen seinen leicht italienisch gefärbten Verkaufsgesprächen gerne zu.
Völlig anders erlebten wir den Besuch von Chachelihousi. Meistens tauchte er im Herbst auf, bevor es einwinterte. Er war einer aus dem Rüschegggraben, vermutlich ein halber Jenischer, und verkaufte Chacheligeschirr. (Gebrauchskeramik). Seine Ware führte er auf einem zweiräderigen Karren mit sich. Wie der Älteste im Lied „Ramseiers wei ga grase“ hielt er die Stangen. Links und rechts war je ein Hund vorgespannt. Chachelihousi war ein kleines, mageres Männchen. Auf dem Kopf trug er einen alten, verbeulten Hut. Ein grosser Schnauz zierte sein Gesicht. Selten sah man ihn ohne seine Pfeife, die er zwischen seinen gelben Zähnen hielt.
Mag sein, dass er mit Kindern und Jugendlichen schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Vielleicht bereitete es ihm einfach Freude, sich als Kinderschreck und Bölimann aufzuspielen. Jedenfalls verzogen wir uns, wenn er im Anmarsch war. Selbst mein älterer Bruder Werner schien einigen Respekt zu haben. Aber Furcht und Neugier halten sich oft die Waage. So guckten wir halt doch um Hausecken oder durch das um eine kleine Spalte geöffnete Tor der Tenne. Wir beobachteten, wie er den Karren vor dem Stöckli abstellte. Er befahl den Hunden, sich hinzulegen. Er selber setzte sich auf die Stange seines Karrens und ruhte sich einen Moment aus. Wenn sich die Waage Richtung Kitzel senkte, reizten wir das kleine Männchen mit Pfeifen oder mit vorwitzigen Bemerkungen. Da wurde er zornig (oder spielte er es nur?). Er griff nach seiner Pfeife, richtete sie wie einen Revolver auf uns und drohte, er werde gleich schiessen. Wir verstoben und hielten uns einen Moment versteckt. Doch wiederum besiegte die Neugier alle Furcht. Wir kehrten zurück und das Spiel wiederholte sich.
Mit meiner Mutter verkehrte Chachelihousi ganz freundlich. Wenn sie ihm etwa eine Röstiplatte oder einen Milchhafen abkaufte, bedankte er sich ganz manierlich, packte seine Ware wieder ein und zog mit Karren und Hunden weiter.
Erst viel später bedachte ich, Chachelihousi sei vermutlich gar kein böser Mensch gewesen – eher ein Einsamer, ein Enttäuschter, einer, der es im Leben wohl nie leicht gehabt habe.
Regelmässig besuchte uns Frau Blaser auf ihrer Hausier-Tour. Die kleine, unglaublich dicke Frau schwitzte mächtig, wenn sie mit ihrem gefüllten Japankorb unterwegs war. Im Sommer trug sie einen schwarzen Strohhut mit breitem Rand. Bevor sie den Korb öffnete, nahm sie auf der erstbesten Sitzgelegenheit Platz, um sich zu erholen und den Schweiss abzuwischen. Ihr Sortiment bestand aus Frottierwäsche, Kopf- und Taschentüchern sowie weiteren Kurzwaren.
Eines Tages – ich habe es allerdings nicht selber erlebt, sondern nur erzählt bekommen – stand die arme Frau ganz bleich und elend vor der Türe. Sie klagte, es sei ihr furchtbar übel und werde ihr beständig schwarz vor den Augen. Mutter hiess sie in die Wohnstube und liess sie in einem Liegestuhl Platz nehmen. Dann begab sie sich in die Küche, um der Patientin einen Tee zu brauen. Kaum hatte sie Wasser aufgesetzt, hörte sie einen schrecklichen Schrei. In der Stube bot sich ein tragikomisches Bild. Unter Frau Blasers Gewicht war der Stoff des Liegestuhls gerissen. Die Bedauernswerte hing eingeklemmt im Holzgestänge, streckte alle Viere gen Himmel und konnte sich keinen Millimeter mehr bewegen. Mutter gelang es nicht, Frau Blaser aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Sie musste Joos, die Jumpfer, zu Hilfe rufen. In gemeinsamer Bemühung, das Lachen verbeissend, schafften sie es, Frau Blaser aus der Klemme zu helfen.
Ziemlich regelmässig, etwa einmal im Jahr, tauchte ein Tuchhändler aus dem Emmental auf. Herr Frauchiger hatte ein Geschäft in Rüegsauschachen, bereiste aber den halben Kanton. Bei ihm handelte es sich natürlich um ein ganz anderes Kaliber: nicht Hausierer, sondern Reisender. Eindeutig ein Herr, mit Kravatte und schnurgerade gezogener Haarscheitel. Natürlich war er mit dem Auto unterwegs. Bei uns traf er meist im späteren Vormittag ein und man kam nicht umhin, ihn zum Mittagessen einzuladen. Man tat es gerne, denn er entgalt die Gastfreundschaft mit allerlei interessanten Geschichten. Unterwegs vom Emmental bis ins Seeland und vom Oberaargau bis ins Oberland erlebte er in einer Woche mehr als wir Sesshaften in fünf Jahren. Da war kaum eine bekannte Persönlichkeit, die er nicht kannte. Zu jeder Situation und zu jedem Stichwort wusste er ein Müsterchen zu erzählen. Recht selbstsicher, aber nie ganz unbescheiden berichtete er, wie er es diesem und jenem gezeigt oder gesagt habe. Beispielsweise habe er einen kleinen Autozusammenstoss gehabt. Der Fahrer des andern Wagens sei ausgestiegen und habe sich grossspurig als Professor W. vorgestellt. Er habe geantwortet: Sie sind der Autofahrer W. und ich der Autofahrer Frauchiger, worauf sein Kontrahent ganz manierlich geworden sei. Die moralischen Schlüsse seiner Geschichten waren meist sehr einfach und klar. Reichtum macht nicht glücklich; tugendhaft zu leben lohnt sich; manche Leute sind arm, aber trotzdem fröhlich.
Nach dem Mittagessen, beim Kaffee, und nachdem er seine Tuchmuster auf dem Stubentisch ausgebreitet hatte, folgten weitere Geschichten. Wohl gab er kompetente Auskunft über Qualität und Besonderheiten seiner Stoffe und notierte auch gerne unsere Bestellungen. Doch man hatte immer den Eindruck, das Geschäft sei für ihn bloss Nebensache. Herr Frauchiger nahm sich viel Zeit und vermittelte das Gefühl, der Mensch sei viel interessanter als ein Stück Tuch.
Viel später, als ich im Studium von anderen Kulturen hörte, den orientalischen zum Beispiel, begegnete mir die Figur des Geschichtenerzählers. Ein Leben lang ist er unterwegs, pilgert von Dorf zu Dorf und von Gehöft zu Gehöft und gibt seine Geschichten preis. Der Geschichtenerzähler ist mehr als ein Unterhalter. Er öffnet einer kleinen, begrenzten Welt einen weiten Horizont und lässt an lustigen und traurigen Erfahrungen teilhaben, die dem Sesshaften nicht zugänglich sind. Er ist ein Kulturvermittler.
Mehr oder weniger zu den Hausierern zählten wir den Troscht-Housi. Seinen Namen kannten wir nicht. Sonntag für Sonntag tauchte der seltsame Mann auf. Mit krummem Rücken sass er auf einem alten Rennvelo, das Gesicht mit der Hakennase, den zurückgekämmten Haaren und der randlosen Brille tief auf den Lenker gebeugt. Über den Schultern trug er eine Tasche, deren Inhalt er uns aufschwatzen wollte. Es handelte sich um billige Heftchen mit den Titeln „Wachtturm“ und „Erwachet“. Damit ist gesagt, dass es sich bei Troscht-Housi um ein eifriges Mitglied der Zeugen Jehovas handelte. Meistens wurde er kurz und bündig abgespeist. Hie und da gelang es ihm aber doch, ein paar Worte zu wechseln. Sehr interessante Zeitschriften, nannte er seine Heftchen, und zeigte auf die kitschigen Helgeli vom Heiland oder vom Paradies, wo Löwe und Lamm friedlich nebeneinander weideten. Angesichts des baldigen Weltendes mit der schrecklichen Schlacht von Harmageddon, sollten sich die Menschen alsogleich bekehren und so einen grossen Trost empfangen. An ungezählten Sonntagen während vieler Jahre radelte Troscht-Housi im Dienste von Jehovas Königreich in der Gegend herum. Nie hätte man gehört, dass sich auch nur ein einziger Mensch vom unermüdlichen Missionar hätte gewinnen lassen. Im Gegenteil: wo er auftauchte, erntete er Spott und Ablehnung. Sein Fleiss hätte wahrlich ein besseres Produkt verdient.

Bei Tisch
In den meisten Bauernfamilien herrschte seit je eine klare Tischordnung. Der Meister thronte oben, auf der einen Seite sassen Meistersfrau, Töchter und Jumpfern, auf der andern Söhne und Knechte. Bei uns war es anders. Grund war eine architektonische Kleinigkeit. Hinter dem Platz oben am Tisch ragte der Fenstersims unangenehm vor. Er hätte meinem Vater ins Kreuz gestossen. So opferte sich Mutter für den unbequemen Ehrenplatz. Im Nachhinein vermute ich, der Platztausch habe auch eine symbolische Bedeutung gehabt. Vater war ein kluger, arbeitsamer Bauer, der einen Betrieb durchaus zu führen verstand. Aber er war kein patriarchalischer Meister. Im Nachhinein denke ich, er habe lieber selber gearbeitet als befohlen. Mutter hatte eine andere Art. Sie wurde einmal von einer Besucherin Königin in ihrem Reich genannt. Diese Bemerkung war gewiss nicht ganz unzutreffend.
Zwischen Vater, rechts hinter dem Tisch, und der Mutter war mein Platz. Eingeklemmt, überwacht oder behütet? Neben Vater sass Werner, dann der Karrer und der Melker. An der vorderen Seite waren die Plätze meiner Schwestern und der Magd, die man "Jumpfer" nannte. Später traten an ihre Stelle die Lehrtöchter. Unten am Tisch, Mutter gegenüber, sass Chrigu. Wenn Tagelöhner und Tagelöhnerinnen mitarbeiteten, wurde ein weiterer Tisch aufgestellt und die zusätzlichen Arbeitskräfte in den unteren Bereich gesetzt. Es kam vor, dass gegen zwanzig Leute um den Tisch sassen.
Vor und nach dem Essen wurde gebetet. Immer das Gleiche in immer gleicher Betonung – und doch nie blosse Routine. Meinem Vater war es ernst, wenn er sprach: „Komm Herr Jesus, sei unser Gascht, und segne, was du uns bescheret hascht“. Oder nach dem Essen: „Gott gab uns Speis und Trank, für beides sagen wir dir Lob und Dank. Amen.“ Das gleichbleibende Ritual verlieh den Hauptmahlzeiten eine besondere Bedeutung, ja, eine Würde. Zugegebenerweise verstand ich nicht ganz, was es mit dem „Gottgabuns“ für eine Bewandtnis hatte. Oder wie Jesus, der doch vor langer Zeit und erst noch im fernen Palästina gelebt hatte, bei uns hätte eine Visite machen sollen.
Gegessen wurde einfach, aber reichlich. Jeden Morgen gab es Rösti, dazu Milchkaffee und Brot. Schon am Vorabend musste eine tüchtige Portion "Geschwellte" geschält werden. Am Morgen galt es, zuallererst im Hozherd Feuer zu entfachen, die Milch aufzukochen und in der grossen Bratpfanne das Schweinefett für die Rösti zu erhitzen.
Beim Mittagessen durfte die Suppe nie fehlen. Zum Hauptgang wurden Kartoffeln, viel Gemüse und immer Fleisch aufgetischt. Wir waren mehr oder weniger Selbstversorger. Beim Krämer kaufte man hauptsächlich Zucker, Kaffee, Teigwaren und sogenannte Spezereien. Alles andere stammte aus Garten, Keller oder Räuke. Im Winter wurden zwei grosse Schweine geschlachtet. Das Fleisch wurde auf verschiedenste Arten konserviert, geräuchert oder gepökelt. Als nach dem 2. Weltkrieg da und dort Kühlhäuser gebaut wurden und man Kühlfächer mieten konnte, gestaltete sich die Konservierung natürlich viel einfacher. Früchte und Gemüse gab es auch im Winter. Die Keller waren gefüllt mit Vorräten. In Sandbeeten wurden rote und gelbe Rübli, Lauch, Rettich, Kohl und Sellerie aufbewahrt. Grosse tönerne Standen waren mit Sauerkraut oder Sauerrüben oder Pökelfleisch angefüllt. Im zweiten Keller standen grosse Holzhurden, angefüllt mit Äpfeln verschiedenster Sorten. Ein grosses Fass war gefüllt mit saurem Most. Mehrere Korbflaschen zu 50 Liter enthielten wunderbaren Süssmost. Im dritten Keller schliesslich lagerten die Kartoffeln.
Das Abendessen gestaltete sich einfacher. Zum Beispiel gab es Hafer- oder Griessbrei mit gekochten Äpfeln. Oder Eierrösti, geschwellte Kartoffeln, „Fotzelschnitten“. Ganz besonders liebte ich Birchermüesli.
Gesprochen wurde beim Essen nicht allzu viel, meist über die Arbeit oder alltägliche Begebenheiten. Persönliche Themen waren tabu. Für mich galt die Regel, still zu sitzen und alles aufzuessen. War ich zu übermütig oder schnäderfrässig und nützte Mutters Mahnung nicht, dann schaute mich der Vater mit seinen grauen Augen an, die streng unter den buschigen Brauen hervorfunkelten. Zuweilen griff er auch nach dem Messer und klopfte damit auf den Tisch. Das genügte vollkommen, um allen Übermut zu dämpfen. Schnell glitt ich unter den Tisch und wagte mich erst wieder hervor, wenn die Tränen getrocknet waren.
Oft musste ich Dinge hinunterwürgen, die ich absolut schrecklich fand, Lauch etwa, oder Krautstiele oder chinesischen Kohl, auf den meine Mutter doch so stolz war. Als schrecklichsten der Schrecken empfand ich jedoch die Erbsensuppe. War mein Teller zu sehr gefüllt, fruchteten weder Mutters Mahnungen noch Vaters Blicke. Ich stocherte noch in meinem Teller herum, wenn alle den Tisch verlassen hatten. Doch unbarmherzig, wie nur Eltern sein können, wurde mir die unaufgegessene Erbsensuppe zum Zvieri wieder aufgetragen: kalt, dick geworden, mit einem furchtbar unappetitlichen Deckel obenauf.
An den Backtagen, ungefähr einmal in der Woche, freute ich mich besonders auf das Mittagessen. Bevor im Ofenhaus das Brot in den Ofen kam, wurden auf drei oder vier grossen Blechen die Kuchen in die Hitze geschoben: Apfel- Rhabarber- und Zwetschgenkuchen, Käsekuchen, gelegentlich auch Rahmkuchen. Schnell pflegte ich dann meine Suppe zu löffeln, damit ich an den Kuchen herankam.
Zweimal im Jahr holte der Vater Wein aus dem Keller – einen Roten und einen Weissen. Dies Aussergewöhnliche geschah an der Sichlete und am Neujahr. Weil zu diesen Festessen der Tisch mit einem weissen Linnen bedeckt war, schienen mir diese Mahlzeiten ungeheuer vornehm. Zu den beiden festlichen Anlässen buk Mutter jeweilen Körbe voll Züpfen, die zum Teil verschenkt und zum andern Teil selber verzehrt wurden.

Chrigu
Sein richtiger Name war Christian Bichsel. Alle nannten ihn Chrigu. Er gehörte zum Haus, solange ich mich erinnern kann. Mutter erzählte, er sei als Verdingbub auf den Hof gekommen, als dieser noch von der Grossmutter bewirtschaftet wurde und mein Vater ein junger Bursche war. Er scheint es bei der frommen Grossmutter nicht viel besser gehabt zu haben als viele andere Verdingkinder auch. Sein Geburtsjahr war schätzungsweise 1908. Als ich fünfjährig war, dürfte er knapp über Dreissig gewesen sein. Er arbeitete als Erdknecht, also vor allem auf dem Feld. Später avancierte er zum Karrer. Zwar hatte er zuweilen seltsame Launen und wurde dann ein richtiger Cholderi, kaum ansprechbar. Kein Wunder, dass ihm in solchen Momenten nichts gelingen wollte. Jedes Misslingen reizte ihn zusätzlich und er pflegte dann in unzähligen Variationen zu schreien: „Das isch e Souerei. Es geit eifach nid. Es geit eifach nid.“ Schlimmere Schimpfwörter vermied er allerdings. Als fleissiger Besucher der Schlachterianer-Sekte in der Salzweid, später des Brüdervereins in Bern, hütete er sich standhaft vor noch stärkeren und deshalb sündhaften Kraftausdrücken.
Mir gegenüber, dem unschuldigen Knäblein, war er fast immer freundlich, ja sogar zärtlich gestimmt. Ich begleitete ihn oft bei der Arbeit, etwa beim Blackenstechen oder Steineauflesen. Chrigu wusste sehr viel über die Tiere, insbesondere über die Vögel. Eine Zeitlang hielt er sich Enten, später Tauben und Bienen. Über ihre Lebensweise wusste er Interessantes zu berichten. Das war auch kein Wunder, standen doch in seinem Zimmer sämtliche Bände von „Brehms Tierleben“. Darin las er fleissig und teilte sein Wissen gerne mit. An Sonntagen durfte ich ihn etwa auf Spaziergängen begleiten. Diese führten meistens in dieselbe Richtung: hinauf in den Spielwald, bei der Dreiteilereiche links ab zum Heitihoger und von dort Richtung Salzweid. Schon auf halbem Weg pflegte ich zu fragen: „Chrigu, hesch ds Portemonnaie bi der?“ So behaupten es jedenfalls böse, mich des Materialismus verdächtigende Zungen. Natürlich bejahte er meine Frage. So schritt ich erwartungsfroh an seiner Hand zum Weiler Salzweid. Dort wohnte nämlich Bäcker Bichsel. Seine Backstube war auch an Sonntagen offen. Chrigu liess mich eine ganze Papiertüte voll Chrämli auswählen. Zusammen verzehrten wir sie auf dem Heimweg bis zum allerletzten Brösmeli.
Einmal, an einem heissen Sommersonntag, nahm mich Chrigu mit zum Baden in der Sense. Die Erinnerung an dieses Ereignis ist leider ziemlich verschwommen. Ich weiss nur noch, dass ich ein weiss-rot gestreiftes schlampiges Badehöschen anziehen musste. Ein Bändel um mein Bäuchlein verhinderte das Abrutschen. Ferner ist mir in Erinnerung geblieben, dass mir unzählige Bremsen das kostbare Resliblut abzapften. Obschon die Sense vor allem aus Kiesbänken und einzelnen Tümpeln bestand, flösste sie mir grosses Unbehagen ein. Ich nehme an, ich sei nicht viel tiefer als bis zu den Waden ins Wasser eingetaucht. Der Mensch ist schliesslich nicht als Fisch erschaffen worden. Chrigu meinte es gut mit mir. Aber die Expedition war für mich ein Misserfolg.
Je enger er sich dem Evangelischen Brüderverein, den sogenannten Bergerianern, anschloss, desto schwieriger wurde es mit ihm. Nicht nur, dass er jeden Sonntag Nachmittag die Versammlung im Berner Stadtbach besuchte. Das hätte an sich niemand gestört. Doch sein Verhalten am Werktag veränderte sich eben auch. Während des Mittagessens wurde häufig das Radio angedreht. Gebannt verfolgte man die Nachrichten während des Weltkrieges. Auch die Wettervorhersage interessierte. Das war für Chrigu noch knapp erträglich. Sobald jedoch der Nachrichtensprecher verstummte und ein paar Takte Musik ertönten, war das Mass voll. Chrigu hielt es in der sündigen Stube nicht mehr aus, schob den halbleeren Teller von sich, stand auf und verliess das Lokal. Ziemlich geräuschvoll schletzte er die Türe zu. Er sei nicht verpflichtet, diesen Mist anzuhören, brummte er zornig.
Da sich jedoch niemand von uns durch diese Demonstration bekehren liess, normalisierte sich die Sache allmählich. Wer will schon monatelang protestieren, wenn die Proteste wirkungslos verpuffen?
Chrigu besass einen aufziehbaren Grammophon mit allerlei Platten, volkstümlichen natürlich. Sein radikal gewordener Glaube ertrug dieses ehemals geliebte Teufelswerk nicht. Er ergriff seine Platten, trug sie hinters Haus und zerschmetterte sie im geschotterten Weg wie weiland Moses die Gesetzestafeln. In den Karrgeleisen würden sie von den Wagenrädern vollends zermalmt werden. Halleluja!
Später bedauerte er seine Zerstörungswut. Direkt zugegeben hat er es allerdings nie.
Ein anderes Kulturgut fiel glücklicherweise der radikalen Phase nicht zum Opfer. Auf Chrigus Bücherbrett standen Gottfried Kellers gesammelte Werke, in der Ausgabe des Gutenberg Verlages. Wo und aus welchem Grund er die Bücher erworben hatte, entzieht sich meiner Kenntnis. Sehr wahrscheinlich hat er sie auch gar nicht gelesen. Sonst wären ihm bestimmt sündige Figuren wie etwa die Judith im Grünen Heinrich in den falschen Hals geraten. Wie dem auch sei: die Bände blieben unversehrt. Später, als der frommen wieder eine menschlichere Lebensphase gefolgt war, machte mir Chrigu die gesammelten Werke Kellers zum Geschenk.
Jahre später, als ich Theologie studierte, gelang es mir, Chrigu zwei- oder dreimal ins Berner Münster in den Gottesdienst zu schleppen. Allerdings nur dann, wenn Walter Lüthi die Predigt hielt. Offenbar hatte sich die starre Doktrin des Brüdervereins im Laufe der Jahre etwas gelockert. Es schien, als hätten Pfarrer Lüthi wie übrigens auch Karl Barth Gnade gefunden. Auf alle Fälle war es für mich sehr befriedigend, mit Chrigu in den ehrwürdigen Gestühlen des Berner Münsters zu sitzen.Auch für ihn muss es ein besonderes Erlebnis gewesen sein. Er war als Verdingbub auf den Hof gekommen und hatte nicht viel zu lachen. Meine Grossmutter, früh verwittwet, überliess den Hof den älteren Söhnen und die haben offenbar mit dem schmächtigen Knaben - milde ausgedrückt - ihren Mutwillen getrieben. Wie schon berichtet, hatte er es besser, als meine Mutter auf den Hof kam. Da war endlich ein Mensch, der sich um ihn kümmerte. Er hat es ihr vergolten mit kleinen Dienstleistungen in Hof und Küche. Eine Genugtuung bedeutete ihm die "Beförderung" zum Karrer. Er war etwa um die fünfzig Jahre alt, als ihm die Verantwortung über die Pferde übertragen wurde. Der Hof war, nebst dem Evangelischen Brüderverein, seine Welt. Den Lohn liess er sich nie auszahlen. Er begehrte lediglich ein monatliches Taschengeld. Am Ende des Jahres wurde abgerechnet. Chrigu wünschte, dass Vater die nicht ausgezahlte Summe direkt auf ein Sparheft überwies. Obschon der Lohn bescheiden war, kamen im Laufe der Jahre doch einige zehntausend Franken zusammen. Meine Eltern ermunterten ihn immer wieder, sich etwas zu gönnen. Zum Beispiel eine Reise mit einem bekannten Carunternehmen. Es dauerte, bis sich Chrigu zu überwinden vermochte.. Die erste Reise nach Holland gefiel ihm, dem für Geografie Interessierten, ausgezeichnet. Von da an buchte er jedes Jahr eine Reise und kam immer glücklich und zufrieden wieder nach Hause. Man kann schon sagen "nach Hause". Es war eine Selbstverständlichkeit, dass er auf dem Hof blieb, als seine Arbeitskraft nachzulassen begann. Im Alter von etwa 70 Jahren ist er an einem Herzversagen gestorben, Auf wundersame Weise, wie Murmeltiere nach dem Winterschlaf, kamen plötzlich entfernte Verwandte zum Vorschein. Während seines ganzen Lebens hatten sie ihm nichts nachgefragt. Jetzt aber, da es um ein bescheidenes Erbe ging, entdeckten sie die Liebe zu ihrem vergessenen Verwandten.

Hurra – die Schule!
Schon einige Zeit vor meinem Schuleintritt konnte ich lesen. Gelernt hatte ich es vor allem dank der Berner Zeitung. Genauer gesagt: durch das beharrliche Buchstabieren der fetten Schlagzeilen.
Auf die Schule freute ich mich sehr. So war es denn eine schöne Überraschung, dass eines Tages ein Brieflein überbracht wurde, in dem auf schwarzem Papier in weisser Schrift und verziert mit einem aufgemalten Schneeglöcklein geschrieben stand: DU DARFST AM MONATG IN DIE SCHULE KOMMEN, RESLI. So lautete die freudige Botschaft des allerersten Briefes, den ich in meinem Leben erhalten habe.Mit dem zu Weihnachten geschenkten Schulsack (wir nannten dieses Objekt „Süttu“) machte ich mich an jenem ersten Tag auf den Weg. Bei jedem Schritt klapperte im Süttu das Schultruckli, ein Geschenk meines Paten Onkel Alfred. Es war dunkelbraun und mit zwei eingekerbten Vögelchen verziert.Die erste Etappe führte zu Mäder Heinz nach Juchlishaus. Zusammen sollten wir, so hatten es die Mütter geplant, das Herren Theresli mitnehmen. Dieses habe nämlich schreckliche Angst vor der Schule und solle durch unsere Gegenwart und unser tapferes Vorangehen ermutigt werden. So klopften wir denn bei Herrens im Kehr an die Haustür. Frau Herren eröffnete uns, Theresli sei noch längst nicht bereit, weder innerlich noch äusserlich. Sie führte uns in die gute Stube. Ein dunkelgrüner Vorhang schirmte den Blick ins Nebenzimmer ab. Plötzlich entstand dort Bewegung. Der Vorhang bauschte sich und es stürzte weinend ein kleines blondes Wesen in unser Zimmer, barfüssig, bloss in ein weisses langes Nachthemdchen gehüllt. So begann unsere denkwürdige erste Begegnung mit dem Herren Theresli. Als es uns bemerkte, stutzte es, machte rechtsum kehrt und wickelte sich in den grünen Vorhang. Irgendwie wird es seine Mutter geschafft haben, das arme Ding aus dem Vorhang herauszulösen, in Kleider zu stecken und für die Schule bereit zu machen. Jedenfalls sehe ich noch das Bild vor mir, wie wir drei, scheu nebeneinander her trippelnd, die Juchlishausgasse aufwärts zogen und bei der Käserei zum Schulhaus hinauf abbogen.
Die Lehrerin hiess Fräulein Zingre. Etwa ein halbes Jahr später verwandelte sie sich wundersam in eine Frau Langen. Sie war gross, von fester Statur, mit braungebranntem, rundem Gesicht und einer Gretchenfrisur (d.i. ein um den Hinterkopf gewickelter Zopf). Überaus lieb und freundlich empfing sie uns. Jedes Einzelne führte sie an seinen Platz. Auf der Innenseite des Pultdeckels hatte sie jedem von uns dreizehn Erstklässlern mit Farbkreide ein Bild gemalt. So wussten wir fortan, wo wir hingehörten. Wir waren vier Buben. Allen voran ist mein langjähriger Freund Mäder Heinz zu nennen. Dazu kamen Wieland Peter und Baumgart Paul. Letzterer begegnete mir viel später wieder als brüllender Feldweibel in der Rekrutenschule. Unter den Mädchen waren Beyeler Leni und Thomi Berthi. Dieses Berthi war ein überaus „geschicktes“ Mädchen („geschickt“ nannte man gute Schüler). Zum Beispiel durfte es einmal früher nach Hause als ich, weil es die ganze Schiefertafel am schnellsten mit perfekten Regenschirmchen vollgekritzelt hatte. Vom ersten Schultag weiss ich nicht mehr viel. Ich erinnere mich nur, dass es mir in der Pause nicht wohl war. Zu viele Grosse rannten auf dem Platz herum. Überwacht wurde die Szenerie von Fräulein Zingre und Herrn Krummen, dem Oberschullehrer. Sie standen unter der Eingangstür und begutachteten wohl die neuen Erstklässler.
Im Sommer war der dreiviertelstündige Weg hinauf zum Ledi-Schulhaus eine wahre Freude. Das taunasse Gras stand hoch, nässte zwar auf dem schmalen Feldweglein zwischen unserem Hof und dem Weiler Breite Schuhe und Hosen. Aber es duftete wunderbar herb und würzig. Lerchen stiegen trillernd in den klaren Morgenhimmel hinauf. Bei Regen muss es weniger angenehm gewesen sein. Interessanterweise erinnere ich mich kaum mehr an Regentage. Von der Breite aus bog ich nach links und traf im „Kehr“ Mäder Heinz, Herren Theresli und ein paar andere Kinder. An der Kreuzung bei der Wirtschaft „Zur Tanne“ gesellten sich die „Statiöndler“ und die Schüler aus Rosshäusern-Dorf zu uns. Am Morgen vollzog sich alles friedlich. Auf dem Heimweg hingegen, vor allem am Nachmittag, kam es öfter zu kleineren und grösseren Scharmützeln. Sie begannen mit Neckereien und steigerten sich bis zu bösen Verhöhnungen. „Statiöndler- Hoseböndler“ schrien wir den Baumgart Gielen, der Baumgart Söne und dem Herren Heinzu nach. Im Winter flogen Schneebälle hin und her, im Sommer hie und da auch Kieselsteine. Schlussendlich wurde es der einen oder anderen Partei zu dumm. Sie gab auf und wandte sich heimwärts.
Im Winter gestaltete sich der Schulweg oft recht mühsam. Durch den hohen Schnee zu waten bedeutete für meine kurzen Beinchen eine grosse Anstrengung. Solange Samis Köbi noch in die Schule ging – er war sieben Jahre älter als ich – stampfte er eine erste Spur in den Schnee und ich beinelte hinterher. Von der dritten Klasse an hatte ich keinen Vorspurer mehr. Ich musste mir den Pfad übers Feld allein bahnen. Der Umweg auf den Strassen empfahl sich nicht. Der Neuschnee wurde erst im Laufe des Tages weggepflügt. Zuweilen war ich dem Weinen nahe. Damals fiel eben noch reichlich Schnee. Wenn es ganz schlimm stürmte und der Schnee zu hohen Wächten zusammengeweht wurde, spannte mein Vater das Ross vor den Schlitten und führte mich und ein paar andere Kinder, die am Weg wohnten, in die Schule. Der Schulweg hatte noch andere Tücken. Da war vor allem der Hohlweg an der oberen Juchlishausstrasse. Im steilen Bord, leicht verdeckt von ein paar Büschen, befand sich der Eingang zu einem düstern Felsenkeller. Eine verwitterte Holztür verschloss den Eingang. Wenn man allein unterwegs war, verspürte man immer ein merkwürdiges Unbehagen. Das Unheimlichste war eine Zeichnung an dieser Tür. Aus Distanz sah das Gekritzel aus wie die Krallen einer Hexe. Wie, wenn im dunklen Gewölbe tatsächlich eine Hexe hauste, plötzlich die Türe aufrisse und mit ihren spitzen Hexenkrallen nach dem armen Knäblein griffe?!! Schreckliche Bilder drängten sich vor – genährt von sämtlichen Hexen, Zwergen, Zauberern und Menschenfressern aus der Märchenwelt. In der Sammlung Bechsteinscher Märchen, die zu Hause in einem Kasten lag, fanden sich mehrere entsetzliche Farbbilder. Man sah zum Beispiel eine hässliche, krummnasige Hexe und - noch viel schlimmer – einen Menschenfresser, der durch den Wald schritt. Seine riesigen Glotzaugen versetzten einen ebenso in Angst wie das lange Messer, das er zwischen den gefletschten Zähnen hielt. Eben diese Bilder tauchten an die Oberfläche des Bewusstsein, wenn man am Hexenkeller zu Juchlishaus vorbei musste. Man hielt sich immer dicht am entfernteren Strassenrand, streifte die Tür mit einem scheuen, ängstlichen Blick und beschleunigte den Schritt, sobald der fatale Keller hinter einem lag.Auch böse Hunde gab es auf dem Schulweg zu fürchten, zum Beispiel Herren Hanses Cäsar, der zwar noch nie einen Menschen gebissen hatte und nur bellte, aber dies laut und respekteinflössend.
Die Käserei, gegenüber der Wirtschaft „Zur Tanne“ bot eine Attraktion besonderer Art. Ab und zu wagten wir uns in die Käseküche, die von zwei mächtigen runden Käse-Kessi aus Kupfer beherrscht war. Schüchtern fragten wir Käser Scheidegger, ob es heute wohl „Chässpän“ gebe. Das waren abgeschnittene Ränder von halbfertigem Emmentaler Käse. So sie vorhanden waren, griff der Käser manchmal in eine Schublade und reichte jedem eine Handvoll dieser Leckerbissen. Die Wirtschaft „Zur Tanne“ gehörte nicht gerade zu den ersten Häusern der Gastronomie. Der Wirt, Fuchs Fridu, führte sie schlecht und recht. Ein ansehnlicher Teil der starken Getränke floss durch seine eigene Kehle. Hinter der Wirtschaft befand sich eine Kegelbahn – zwei kleine Häuschen, verbunden mit einer schmalen Bahn aus Holzbrettern. Die Kegler befanden sich im einen, die Kegeln im andern Häuschen. Dort durften wir gelegentlich für ein bescheidenes Entgeld die Kegeln stellen. Einmal erlebte die „Tanne“ einen Glanztag. Eben als wir zur Schule gingen, hielt ein Auto vor der Wirtschaft. Ihm entstieg ein Offizier. Und was für einer! General Guisan, der hoch Verehrte, nahm mit elastischen Schritten die paar Treppenstufen. Vor der Tür drehte er sich zu uns und winkte uns gnädig zu, bevor er verschwand. Das war das Erlebnis des Jahres! Ein paar Schritte oberhalb, zwischen Käserei und Schulhaus, befand sich das Spezereilädeli. Da ich nie Sackgeld hatte, betrat ich es nur, wenn ich einen bestimmten Auftrag auszuführen hatte. Zum Beispiel: „für vierzig Rappen Presshefe“ für den morgigen Backtag. Sobald man ins Lädeli trat, war man vom wundersamen Geruch verschiedener Spezereien und eben gemahlenen Kaffees eingehüllt. Das Auge erfreuten vor allem drei grosse Glasbehälter, die mit farbigen Täfeli angefüllt waren; rote Himbeeren, gelbe und orange Halbmöndchen, grüne Kugeln. Nur selten griff die Krämersfrau in eines dieser Gläser und schenkte den kleinen Kunden ein Täfeli. Im Riedbach, wo wir im grossen Laden von Herrn Reber gelegentlich einkaufen gingen, war man grosszügiger. „Wosch e Schigg?“, pflegte Herr Reber zu fragen, wenn man das Huttli mit den Kommissionen vollgestopft hatte und sich zur Türe wandte. Natürlich nickte man freudig, worauf der gute Mann, der immer eine schwarze, mit Edelweiss bestickte randlose Mütze trug, ein Papiersäckli mit einer Handvoll herrlicher Täfeli füllte und sie einem in die Hand drückte. Die grösseren Schüler versuchten manchmal, uns Kleinere hereinzulegen. Sie baten uns, für sie zum Krämer zu gehen und „Ibidumm“–Täfeli zu kaufen. Bezahlung erfolge, sobald man die Ware gebracht habe. Obschon ich den tiefen Sinn dieser Täfeli-Sorte erst später begriff, misstraute ich solchen Aufträgen und liess mich nie für dieses Spiel gewinnen.
In der Unterschule gab es jedes Jahr zwei Höhepunkte: Weihnachten und Examen. Ein besonderer Zauber lag über der Weihnachtszeit. Einmal durften wir vier Buben unserer Klasse auf der langen Wandtafel je eine Szene der Weihnachtsgeschichte zeichnen, und zwar mit kostbarer farbiger Kreide. Meine Aufgabe war es vermutlich, die Sache mit den Hirten auf dem Felde darzustellen. Jedenfalls malte ich den Himmel voller Engel. Weil ich am Busen der Natur aufgewachsen und mit der Gabe gesegnet war, logische Schlüsse ziehen zu können, zeichnete ich die Engel nach dem Muster der sichtbaren Natur. Die andern fliegenden Lebewesen, die Vögel, dienten mir als Vorbild. Bekanntlich fliegen die waagrecht und kopfvoran durch die Luft. Dem entsprachen auch meine Engel. Die andern Schüler lachten mich aus. Alle behaupteten, Engel flögen senkrecht, höchstens ein bisschen schräge, aber nie und nimmer bäuchlings. So stiess ich schon früh in meinem Leben auf heikle theologische Fragen. Für die Eltern wurde jeweils ein Krippenspiel einstudiert. Im ersten Schuljahr durfte ich einen Hirten spielen. Als Kostüm diente eine Pelerine mit Kapuze, schwarz, aus dickem haarigem Stoff. Wie nun das Schulzimmer voller Mütter war und wir im Kerzen-Halbdunkel die Ausrüstung fürs Spiel zusammensuchten, war meine Pelerine unauffindbar. Nur die abknöpfbare Kapuze war übriggeblieben. Was für eine abgrundtiefe Enttäuschung. Oder Wut? Tränen flossen. Fräulein Zingre hatte Mühe, mich zum Spielen bloss in der Kapuze zu überreden. An der zweiten Schulweihnacht machte ich Karriere. Ich durfte den zweiten König spielen. Aber eben nur den zweiten! Den ersten mit der weitaus grösseren Krone durfte Baumgart Paul darstellen. Mein heimlicher Groll wurde erträglicher, als ich der ausgleichenden Macht des Schicksals gedachte. Eben derselbe Pöilu hatte nämlich zwei oder drei Jahre zuvor, anlässlich der Sonntagsschulweihnacht, eine wenig rühmliche Rolle gespielt. Als er sein Verslein aufsagen sollte, stellte ihn die Sonntagsschullehrerin auf einen Stuhl, damit seine Rezitation besser gehört werden konnte. Doch die Dunkelheit und die vielen im Dunkel sitzenden Besucher schüchterten den Pöili ein. Noch begann er einigermassen standhaft zu leiern: „I mim Härze brönnt es Liechtli.“ Aber dann wurde das Stimmchen immer dünner und unter Schluchzen brachte er gerade noch hervor „...es brönnt u brönnt die ganzi Zyt..“ Dann war Schluss. Der Mut verliess ihn, die Stimme versagte vollends.15 Jahre später, in der Rekrutenschule, als derselbe Paul als Feldweibel auf dem Kasernenhof herumbrüllte und uns Rekruten anschrie, erinnerte ich mich schmunzelnd alter Zeiten.
Gross war meine Verehrung für die Lehrerin. Wahrscheinlich hatte aber auch ich bei Fräulein Zingre alias Frau Langen einen Stein im Brett. Mag sein, dass ich ein herziges Bübchen und als Schüler recht „geschickt“ war. Eine Episode hat die gegenseitige Zuneigung besonders zum Ausdruck gebracht. Zur Äufnung der Schulkasse veranstalteten wir einmal eine Flaschensammlung. Vorher durften wir schätzen, wie viele Flaschen die Schule insgesamt zusammenbringen würde. Meine Schätzung war der Wirklichkeit am nächsten. Als Belohnung schenkte mir die Lehrerin ein SJW-Heftchen mit dem Titel „Heini vom Waldhof“. Auf die erste Seite hatte sie die Widmung geschrieben „Du hast gut geraten, Resli.“ Die moderne, abgebrühte Menschheit mag darüber lächeln, dass mich diese Worte in den siebenten Himmel versetzten. Jedenfalls hielt ich das kleine Heftchen, Grundstein meiner im Laufe der Jahre aufgebauten Bibliothek, hoch in Ehren.Die Autorität der Lehrerin konnte aber auch zum Anlass schwerer Sorge werden. Als wir über das Griffel- und Bleistift-Stadium hinaus waren und mit Feder und Tinte schreiben durften, schärfte uns Frau Langen ein: Die Feder darf ja nicht rostig werden! Doch eben dieses schlimme Unheil traf mich. Im Laufe der langen Herbstferien entdeckte ich, dass die im Schultruckli so säuberlich aufbewahrte Feder Rost angesetzt hatte. Von diesem Moment an waren die Ferien dunkel überschattet. Es verging kein Tag, an dem mich die Sorge wegen der rostigen Feder nicht bedrückt hätte. Die bange Frage, was wohl die Lehrerin zu meiner Schand-Feder sagen würde, vergällte mir die Ferien total. Offenbar erwies sich die Sorge, wie so oft im Leben, als stark übertrieben oder gar als unbegründet. Mir ist jedenfalls nicht in Erinnerung, dass ich ausgeschimpft worden wäre. Als Fräulein Zingre eines Tages zu Frau Langen mutierte und in der Folge ein Kind erwartete – oder waren die Kausalitäten umgekehrt? – kreuzten Stellvertreterinnen auf. Ihnen galt eine womöglich noch glühendere Verehrung. Da war zum Beispiel die schöne dunkelhaarige und dunkeläugige Fräulein Flückiger. Jeden zweiten Tag pflegte sie uns, vielleicht auch sich selbst, mit ihrem Geigenspiel zu betören. Eine einschmeichelnde Melodie ging mir besonders durch Mark und Bein. Ich habe sie nie vergessen. Viele Jahre später entdeckte ich Luigi Boccherini als ihren Urheber. Zum Mythos der Fräulein Flückiger trug auch bei, dass ihr Onkel Oberstdivisionär war. Einmal soll er seine Nichte hoch zu Ross besucht haben. Gesehen habe ich es nicht, aber dem ehrfürchtigen Gerücht schenkte ich gern Glauben.Eine andere Stellvertreterin kam aus Brienz. Sie hiess Fräulein Walz und war eine mollige Blondine mit Gretchenfrisur. Mit ihr unternahmen wir eine Schulreise auf die St. Petersinsel. Wir badeten dort und sie machte mit uns schreckliche Wasser-Angewöhnungs-Übungen. Später schwamm sie selber weit, weit in den See hinaus. Ihr Kopf war nur noch als fernes Pünktchen über der Seeoberfläche zu sehen. Wir Kinder, alle des Wassers ungewohnt, litten Todesängste um die geliebte Lehrerin.Auf der Heimreise sollten wir mit dem Postauto von Erlach nach Ins fahren. Die Lehrerin hatte es wohl unterlassen, Plätze zu reservieren. Wir Erst- bis Drittklässler konnten mit Mühe und Not in das Postauto hineingepfercht werden. Mit den Viertklässlern nahm Fräulein Walz den Weg unter die Füsse. In Ins warteten wir sehnlichst auf die Ankunft der Wanderer. In allerletzter Minute, der Zug war schon eingefahren, kam die völlig erhitzte Schar angerannt. Und alles, alles ward wieder gut. Jedes Mal, wenn Frau Langen einen Urlaub verlangte, erschien sie bei uns zu Hause. Vater war Vizepräsident der Schulkommission. Auch die jeweiligen Stellvertreterinnen mussten bei uns antraben. Für mich verliefen diese Besuche nervenaufreibend. Brennend wünschte ich, die Göttinnen zu sehen, ja, sogar von ihnen angesprochen zu werden. Doch ebenso gross wie dieser Wunsch war die Schüchternheit. So versteckte ich mich meistens. Einmal schleppten mich die Schwestern mit roher Gewalt in die Visitenstube, wo sich die Verehrte mit Mutter unterhielt. Tief errötend reichte ich ihr die Hand. Sie grüsste mich freundlich, machte aber sonst kein Aufhebens. Ein wenig ernüchtert und so schnell als möglich verliess ich die gute Stube. Am Montagmorgen war immer Sauberkeitskontrolle. Wir mussten die Hände aufs Pult legen. Die Lehrerin schritt langsam durch die Reihen und kontrollierte, ob wir sie gewaschen und die Fingernägel gereinigt hatten. Anschliessend guckte sie nach, ob die Ohren sauber und der Hals gewaschen war. Schliesslich musste jedes erzählen, was es am Sonntag erlebt hatte. Meist war dies ziemlich langweilig, etwa nach dem Muster „Dann assen wir zu Mittag. Dann gingen wir spazieren. Dann gingen wir heim. Dann nahmen wir den Imbiss.“ Ich meinerseits erzählte lieber eine kleine Geschichte, die ich gelesen hatte, und erntete dafür mehr Aufmerksamkeit.
Ein Mitschüler erregte unsere besondere Aufmerksamkeit, der Schmocker Heiri. Der bekam nämlich von Zeit zu Zeit epileptische Anfälle, fiel dann wie tot um und schäumte aus dem Mund. Hilflos erschrocken umstanden wir ihn, bis die Lehrerin herbeigerufen war. Auch sie konnte nicht viel machen. Es blieb einem nur übrig zu warten, bis der Anfall vorbei war und Heiri die Augen wieder öffnete. Er blickte dann verwundert und wie verloren umher und rappelte sich auf.
Schon viele Wochen im Voraus freute man sich auf das Examen. Am Vormittag besuchten die Eltern die Schule und begutachteten die fortschreitende Weisheit ihrer Sprösslinge. Am Nachmittag stellte sich vor dem Schulhaus ein Festzug auf. An vorderster Stelle marschierte ein Handörgeler. Dann kamen die Buben der Oberschule mit prächtigen Fahnen. Ihnen folgten die grossen Mädchen mit Kränzen und Blumenkörbchen. Hintendrein wir, das Geräbel der Kleinen. Der Zug marschierte nach Allenlüften in den Gasthof „Zum Schwanen“. Im Saal – der heute übrigens noch gleich aussieht wie damals – setzten sich die Eltern in den hinteren Teil und vertrieben sich die Zeit mit Wein oder Kaffee und Kuchen. Wir tummelten uns auf dem Tanzboden und der Handörgeler brachte alle in Schwung, vom Erst- bis zum Neuntklässler. Zwischenhinein durfte man sich bei der Chramfrau, die mit einem riesigen Henkelkorb erschienen war, Makrönli oder Kringel oder anderen „Chram“ holen. Bei einem der Examen, es war wohl in der dritten oder vierten Klasse, zettelten die Mädchen eine Verschwörung gegen mich an. Alle, die ich mit der üblichen Fragefloskel „der nächste?“ zum Tanz einladen wollte, gaben mir einen Korb. Welche Schmach! Eine Ausnahme gab es freilich. Beyeler Leni hätte mir freudig zugesagt. Sie ahnte aber, dass bei mir keine Gegenliebe vorhanden war. So zettelte sie die Verschwörung an, damit ich gezwungen wäre, schlussendlich doch sie um einen Tanz zu bitten. Der Schuss ging freilich hinten hinaus. Lieber gar nicht tanzen als mit dem Leni, lautete meine Devise. Im Umgang mit Damen bin ich ziemlich wählerisch gewesen.

Mein Freund Heinz
Mit Heinz entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis. Wir waren beide die Jüngsten der Familie und beide waren wir sieben Jahre ohne Spielgefährten aufgewachsen.
Wenn ich hinter Mosers Haus ins Feldweglein einbog, das den Anfang meines Schulweges bildete, schaute ich hinüber nach Juchlishaus. Sobald ich Heinz auftauchen sah, sandte ich einen Pfiff über das weite Feld. Er pfiff und winkte zurück. Jeden Tag versuchten wir es so einzurichten, dass wir genau gleichzeitig an dem Punkt anlangten, wo unsere Wege zusammentrafen: im Kehr, beim Hof von Herren Hans. Heinz war, wie gesagt, ein Nachzügler wie ich. Der Altersabstand zu seinem Bruder war noch erheblicher als bei mir. Er war ein feines, milchhäutiges blondes Bübchen, das immer in überaus feinen Kleidern steckte. Besonders neideten (und verachteten) wir andern sein schönes dunkelblaues Sammetgewändlein, zu dem er meist ein rosarotes Hemdchen trug. So etwas war einmalig im Ledischulhaus und wohl weit darüber hinaus. Das Sammetgewand hatte allerdings auch seine Nachteile. Schmutz und Staub vertrug es weniger als unsere strapazierfähige Durchschnittskleidung. Einmal, als Heinzli arglos in seinem Pültlein sass, wurde es dem Mädchen hinter ihm schlecht. In hohem Bogen gab es sein gesammeltes Frühstück von sich. Der übel riechende Schwall traf leider auch Heinzens Sammetjäcklein. Da hatte die Lehrerin allerhand zu tun mit Putzen und Trösten. Als einziger brachte Heinz jeden Morgen zum Znüni eine Honig- oder Konfitüreschnitte mit. Wir andern begnügten uns mit einem Stück Brot. Dies trug ihm bald einmal einen Übernamen ein. Wir nannten den Ärmsten einfach „das Schnitteli.“ Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mich der Meute anschloss und meinen Freund, jedenfalls in dieser Angelegenheit, nicht verteidigte.
Heinzlis Mutter war sehr darauf bedacht, die Gunst der Lehrerin zu gewinnen. Mehr als einmal erschien während der Unterrichtszeit die Jumpfer im Schulhaus mit einem Korb am Arm. Fräulein Zingre alias Frau Langen unterhielt sich draussen im Gang kurz mit der Botin. Wenn sie ins Zimmer zurückkam, versorgte sie hastig ein umfangreiches Paket im Schrank. Die Bescherung wurde vermutlich erst wieder hervorgeholt, wenn sich die Kinderschar auf dem Heimweg befand. Wir nannten diese Aktivitäten von Heinzens Mutter und ihrer Jumpfer ziemlich abschätzig „chörbele“.
Heinz und ich hatten selten Streit, obschon er in vielen Unternehmungen vorsichtiger war als ich. Seine Weigerung, bei dieser oder jener Aktion mitzumachen, begründete er jeweils mit dem Hinweis: „Süsch brummle si de deheime“. Trotzdem liessen wir uns allerhand einfallen. Bald waren wir auf ihrem, bald auf unserem Hof. Wir bauten Strohburgen, sprangen von Balken auf den Heustock, stiegen verbotenerweise aufs Dach, gelegentlich bis zuoberst auf die Dachfirst. Später vergrösserten wir den Aktionsradius und gingen oft in den Wald. Aus Ästen bauten wir uns eine Waldhütte. Einen alten, morschen Baumstrunk höhlten wir aus zu einer Festung. Sie wurde unser Ausguck, von dem aus wir das Waldsträsschen überblicken konnten, ohne selber gesehen zu werden. In einem Dickicht von jungen Tannen, die alle etwa fünf oder sechs Meter hoch waren, stiegen wir zu den Wipfeln hoch, brachten die schlanken Bäume in Schwingung und ergriffen den nächsten Baumwipfel. So wechselten wir wie die Einhörnchen von Baum zu Baum und durchmassen in luftiger Höhe Länge und Breite des ganzen Tannendickichtes. Auf der stattlichen Tanne in unserem Hühnerhof wurde das Spiel um eine Variante erweitert. Wir stiegen hoch hinauf und liessen uns aussen über die Äste hinuntergleiten, rittlings von Ast zu Ast, in waghalsigem Tempo, bis wir auf der Erde standen.
Bei der Erforschung eines engen, felsigen Bachbettes im Spielwald waren wir im Begriff, eine finstere Vertiefung in Augenschein zu nehmen. Da erschreckte uns ein unheimliches Fauchen und Flattern. Wir traten einen Schritt zurück – und schon flatterten zwei in ihrer Ruhe gestörte Schleiereulen an unseren Köpfen vorbei.Einmal versuchten wir im Forstwald eine Höhle zu graben. Da hörten wir plötzlich über dem Abhang ein schnelles, schweres Tapp-Tapp-Tapp und das Brechen von Zweigen. Offenbar trabte ein grosses Tier durch den Wald. War es der Hirsch, der sich damals ins unsern Wäldern aufhielt? Oder ein anderes unheimliches Getier? Wir hielten den Atem an und wagten nicht nachzuschauen, bis wieder Stille eingetreten war. Der Wolfengraben im Spielwald war weitherum bekannt. Dort befanden sich zahlreiche Fuchshöhlen. Zudem stand auf der Krete die sogenannte Maienbuche. In die Rinde des mächtigen Baumes ritzten die Liebespaare der Umgebung seit Jahrzehnten ihre Initialen ein. Die grösste Attraktion des Wolfengrabens aber bildeten für junge Forscher die Felshöhlen. Zuhinterst in der Schlucht stiess man auf sie. Die erste, etwa zehn Meter tief, liess sich kriechend erforschen. Die Zweite war auch nur wenige Meter tief und mit Wasser gefüllt. Kröten und schlimmes Gewürme bevölkerten die Grotte. Am meisten faszinierte die dritte Höhle. Auch auf ihrem Grund lag Wasser. Sie verlor sich in geheimnisvollem Dunkel. Manche Leute behaupteten, sie gehöre zu einem Geheimgang, der vom ehemaligen Kloster Frauenkappelen hierher in den Wald geführt habe. Heinz und mich liess das Geheimnis nicht in Ruhe. Daher zogen wir eines Tages los, bewaffnet mit Gummistiefeln, Taschenlampen und Spaten, um die Höhle zu ergründen. Zuerst gruben wir einen Abfluss, um den Wasserspiegel zu senken. Dann konnte es losgehen. Vorsichtig tasteten wir uns den feuchten Sandsteinwänden entlang, Schritt für Schritt. Glücklicherweise reichte das Wasser nur bis zum Stiefelschaft. Nach ein paar Metern gelangten wir an eine Biegung. Hui, was für ein Moderduft erfüllte die finstere Höhle! Trotzdem drangen wir weiter. Der Forschergeist trieb uns vorwärts – allerdings nicht mehr lange. Denn plötzlich fiel der Lichtkegel auf eine glatte Wand. Hier endete die Höhle. Keine Spur von Geheimgang. Offensichtlich hatten sich die Erbauer bis hierher vorgearbeitet in der Hoffnung, Wasser zu finden. Als die Suche erfolglos war, gaben sie auf. Für Heinz und mich war der Zauber des Wolfengrabens dahin.
Auch der Gäbelbach lockte uns. Da gab es eine Menge Forellen, auch Krebse. Allerdings wagten wir beide nie so recht, in die Löcher unter dem überhängenden Bachbord zu greifen und Fische zu fangen. Wie, wenn dort ein Krebs sässe und einen mit seiner Schere zwackte? Ungleich mutiger und äusserst geschickt war da ein anderer Bursche, der Öttu, zwei Jahre älter als wir. Der griff sich Forellen, so viel er wollte. Freilich war dies streng verboten, da der ganze Bach an Fischer aus Bern verpachtet war. Öttu liess sich von diesem Verbot nicht beeindrucken. Ob er die gefangenen Forellen verkaufte oder einfach den Speisezettel seiner Familie bereicherte, entzieht sich meiner Kenntnis. Einmal sagte er Heinz und mir, wir sollten einen Kessel mitbringen. Er werde uns dann ein paar lebendige Fische mitgeben. Das liessen wir uns nicht zweimal sagen. In kürzester Zeit griff sich Öttu vier oder fünf mittelgrosse Forellen und liess sie in unsern Kessel plumpsen. Vorsichtig trugen wir die kostbare und illegale Ware heim. Dort füllten wir den kleinen Brunnentrog, in dem die Kartoffeln gewaschen wurden, mit Wasser und deponierten die Fische. Das aber war erst der Anfang eines kühnen Plans. Eine Fischzucht wollten wir nämlich beginnen und die fünf Forellen wären unser Startkapital. Im Spielwald, an einem kleinen Bach, weit abseits von Weg und Steg, fanden wir eine ideale Stelle. Mit Zweigen, Laub und Erde errichteten wir einen ansehnlichen Damm. Das Wasser staute sich und es bildete sich ein prächtiger Waldsee. Leider wurde der mutige Unternehmergeist vom Glück nicht begünstigt. Wieder zu Hause, fanden wir den kleinen Brunnentrog leer. Das Wasser war noch vorhanden, aber nirgends ein Fisch. Sie waren einfach weg, Ob wohl die Katzen sich als Fischdiebe betätigt hatten? Das Rätsel wurde nie gelöst und beschäftigt mich bis auf den heutigen Tag. Aber nicht genug mit dem Verschwinden der Fische. Als wir ein paar Tage später unsern wundervollen See aufsuchten, zeigte sich, dass der wohlgebaute Damm den Elementen nicht standgehalten hatte. Alles war fortgeschwemmt und das Bächlein rauschte unschuldig in seinem Bett, wie wenn nichts geschehen wäre. So bietet das Leben auch dem Tätigen manch herbe Enttäuschung. Es sollte nicht die letzte sein.
Etwa von der vierten Klasse an erweiterte sich unser Aktionsradius noch einmal. Dabei spielte das Velo eine wichtige Rolle. Heinz war etwas kleiner als ich und hätte die Pedale von einem normalen Sattel aus noch kaum erreicht. Darum bastelte sein Vater ein gepolstertes Holzsitzchen, das er auf der Querstange befestigte. Ich selber durfte ein uraltes Damenfahrrad mit Rücktritt benutzen. Ein richtiges, wenn auch sehr betagtes Velo bekam ich dann, als wir in der Sekundarschule Allenlüften aufgenommen wurden und auf das Fahrrad angewiesen waren. Ein beliebter Sport war das quer feldein oder noch besser: das quer waldein Fahren. Die Bäume dienten als Slalomstangen. Steile Börter erlaubten gewagte Sprünge. Unsere Fahrten waren atemberaubend und endeten nicht selten mit Stürzen. Als meinem Vater unser Tun hinterbracht wurde, war es freilich mit der Herrlichkeit vorbei. Sein strenges Verbot begründete er nicht etwa mit den Gefahren für Leib und Leben, sondern mit den Kosten für allfällige Fahrradreparaturen. Wir wagten nur selten, es zu übertreten.
An Sonntagen unternahmen wir kleinere Velotouren. Einmal waren wir im Forstwald mit seinen vielen, verwirrenden Wegen unterwegs. Vor uns zeigte sich eine Kreuzung. Sollen wir rechts oder sollen wir links? Wir waren unschlüssig. So kam es, dass Heinz, der vorausfuhr, einen Kompromiss fand. Er wählte weder das linke noch das rechte Strässchen, sondern fuhr mitten ins Gebüsch zwischen beiden. Dort lag er dann etwas verdattert und rappelte sich erst nach einigen Momenten wieder auf. An einem anderen Sonntag wagten wir uns bis zur Hauptstadt des Amtsbezirkes. Weshalb wir nach Laupen radelten, weiss ich nicht mehr. Ich erinnere mich nur, dass wir unsere Fahrräder am Ufer der Sense abstellten und dann von drei etwas älteren Burschen angeredet wurden. Sie behaupteten, wir hätten hier nichts zu suchen und sollten schleunigst verschwinden. Ich antwortete ihnen, sie hätten uns nicht zu befehlen. Das war offensichtlich zu viel. Die Drei stürzten sich auf uns und verdroschen uns kräftig, vor allem natürlich mich, der ich Widerspruch gewagt hatte. Was blieb uns übrig, als abzuzotteln. Nebst schmutzigen Kleidern trug ich ein unangenehmes Andenken nach Hause, nämlich ein hoch aufgeschwollenes blaues Auge. Als man mich daheim nach der Ursache dieses „Veilchens“ befragte, wagte ich nicht, die Wahrheit zu sagen. Ich hätte mir dieses blutunterlaufene, blaue Auge bei einem Sturz zugezogen, log ich. Die Notlüge belastete mein Gewissen nicht allzu sehr. Hingegen rätselte ich an der Frage herum, warum Menschen manchmal aus dem Nichts heraus gewalttätig werden. Diese Erfahrung war mir neu und unbegreiflich.
Wie es sich unter Freunden gehört, führten Heinz und ich viele vertrauliche Gespräche. Dabei kam auch das aufregende Thema Mädchen/Buben beziehungsweise Männer/Frauen zur Sprache. Mein Wissensstand war klein, doch derjenige von Heinz war noch dürftiger. Lexika oder Doktorbücher fanden sich in unserem Haushalt leider nicht. Das spärliche Wissen erwarb man sich hauptsächlich durch Beobachtungen auf dem Bauernhof. Man erlebte schliesslich häufig, wie der Stier den Kühen aufsprang. Man sah gelegentlich, wie es die Hunde trieben. Man erlebte die Geburt von Kälbern, Schweinchen und Schäfchen. Aus diesen Beobachtungen wurden gewisse Schlüsse in Bezug auf die Spezies Mensch gezogen.Grossartig vertraute ich meine unausgegorenen Theorien dem Heinz an, natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Doch mein Freund beging leider einen schnöden Verrat. Er erzählte alles brühwarm seiner Mutter. Diese wiederum hinterbrachte meiner Mutter, was ich für schmutzige Fantasien hätte und wie ich ihren Heinzli schlecht beeinflusse. Mutter stellte mich zur Rede. Sie war sehr verärgert. Ich vermute heute, in der Rückschau, dass der Hauptgrund ihres Ärgers weniger mein unvollständiges Sexualwissen war, nicht einmal meine schrägen Fantasien. In erster Linie muss es sie gekränkt haben, dass Mäder Berthi mich als verdorben und seinen Heinzli als unschuldig darstellen konnte. So etwas trifft ein Mutterherz schwer. Immerhin schien sie zu realisieren, dass bei mir ein Informationsbedürfnis bestand. Wenig später legte sie ein kleines, braunes Heftchen auf meinen Nachttisch: „Woher die Kindlein kommen“, von einem Doktor Hoppeler. Das Ergebnis der Lektüre war absolut enttäuschend. Was dieser Doktor erzählte, fand ich blöd. Zum Beispiel faselte er von einem kostbaren Kästchen, das Mutter unter dem Herzen trage. Der Vater besitze ein Schlüsselchen, mit dem er liebevoll dieses Kästchen zu öffnen vermöge. Nun war es an mir, mich zu ärgern. Dieses verschwommene Geschreibsel schloss wahrlich keine Wissenslücken. Im Gegenteil, die Neugierde wurde umso mehr angestachelt. Einige Zeit später, ich ging wohl in die fünfte oder sechste Klasse, versuchte Mutter noch einmal ihr Glück. Wieder legte sie mir ein Büchlein auf den Nachttisch. Der Verfasser hiess Riggenbach oder Rickenbach, und der Titel des Heftchens lautete vielversprechend: „Du sollst es wissen!“ Doch auch der gute Herr Riggenbach kam nicht weit über die Bienlein und Blümelein hinaus und liess meinen Wissensdurst ungestillt. Erst im dritten Anlauf klappte es dann besser. Ich war wohl bereits im achten Schuljahr, als meine Mutter eine Broschüre von Dr. Theodor Bovet nach Hause brachte: „Von Mann zu Mann“. Da endlich wurden die Dinge beim Namen genannt. Anatomische, physiologische und ethische Informationen waren so gehalten, dass ich mich nach der Lektüre einigermassen aufgeklärt fühlte. Es war ein langer Weg.
Ich blende noch einmal zurück. Zwei, drei Jahre nachdem mich mein Freund an seine Mutter verraten hatte, wechselten die Rollen. Mäder Heinz hatte sich nun seinerseits einen Informationsvosprung erworben. Das lag hauptsächlich daran, dass er in einer Gerümpelkammer ein paar Heftchen „Die Neue Zeit“ gefunden hatte. Erstmals bekamen wir in diesem Organ der Freikörperkultur Bilder von splitternackten Frauen zu Gesicht. War das aufregend!
Leider muss auch mir angekreidet werden, was viele Buben in Verruf gebracht hat: allerlei Schlingelein. Mancherlei schlimmere und weniger schlimme Streiche wie zum Beispiel: mit Steinen nach Hühnern, Katzen und Isolatoren auf Telefonstangen werfen (letzteres sogar mit einer Steinschleuder); Fliegen die Flügel ausreissen, Erdbeeren im Garten für persönlichen Gebrauch pflücken, die Schwestern plagen., maulen, lügen, stehlen, Arbeitsaufträge absichtlich überhören und so weiter und so fort. Ein Ort grosser Versuchung war das Vorratskämmerlein hinter der Küche. Diesen Raum suchte ich besonders dann mit Vorliebe auf, wenn in der Weihnachtszeit die vielen gefüllten Blechbüchsen mit Güezi der Dinge harrten, die da kommen würden. Sie kamen in der Regel dann, wenn sich niemand in der Küche aufhielt und ich unbeobachtet in das Kämmerlein schlüpfen konnte. Einmal ertappte ich aber auch meinen Vater auf einem Abstecher in den Vorratsraum. Punkto Süssigkeiten galt: der Apfel fällt nicht weit vom Stamme.
Selbstverständlich heckte ich zusammen mit Freund Heinz allerhand Kurzweil aus. So wollten auch wir, wie die Kinder aller Länder und aller Zeiten, den Trick mit dem verlorenen Geldbeutel ausprobieren. Der geht bekanntlich so: man knüpft ein Portemonnaie an eine möglichst unauffällige Schnur und legt es gut sichtbar auf die Strasse. Sobald ein Passant anhält und den wertvollen Fund an sich nehmen will, zieht man am Schnürchen. Unter den Händen des Finders gleitet das Objekt von dannen und verschwindet im Gebüsch. Ein geniales Spiel. Das Problem war nur, dass auf unseren Strässchen so selten Leute unterwegs waren. Aus diesem Grund verleidete uns dieses Spiel rasch.Zu schlimmeren Untaten verführte mich der Besitz eines Luftgewehrs. Mein Bruder hatte in mir die Freude am Schiessen geweckt. Mit seinem Flobert schossen wir stundelang auf Scheiben und ich brachte es in früher Jugend zu einiger Fertigkeit. Ein eigenes Flobert zu besitzen ward mir versagt. Ein Luftgewehr musste reichen. Natürlich ermahnten mich die Eltern nachdrücklich, mit dem Ding vorsichtig umzugehen. Es wäre mir auch nie in den Sinn gekommen, mit den Bolzen auf lebendige Wesen zu zielen. Doch ich ersann eine andere Technik. Ich fabrizierte kleine Kügelchen aus Silberpapier. Damit schoss ich zum Beispiel auf Spinnen, die vor meinem Fenster ihr Netz gewoben hatten. Und noch viel interessanter: ich wählte als Ziel die nackten Waden meiner Schwestern und der Jumpfern. Die Kügelchen rissen selbstverständlich keine Wunden, aber sie piekten halt doch spürbar. Gab das ein Protestgeschrei! Einmal, als meine Opfer am Brunnen beschäftigt waren, belästigte ich sie wieder in der beschriebenen Art. Da kam ein fast gleichaltriges Mädchen aus der Nachbarschaft des Weges, das wohlerzogene, überaus feine Christineli. Als sie mich Unhold bei meinem frevlen Tun erblickte, rief sie fassungslos: „Jetz ha ni ging gmeint, das syg so ne liebe Bueb, u jetz macht dä so bösi Sache.“ Hei, wie mich dieses Urteil getroffen hat!
Zu den beklagenswerten Schattenseiten meines frühen Daseins gehörte auch, dass ich gelegentlich vor ungeliebten Arbeiten floh und mich versteckte. Schlupfwinkel bot unser Hof eine ganze Menge. Der Strohschuppen, der Heustock, die Boutique unter dem Dach der Schweinescheune. Gern verzog ich mich auf den Estrich im Stöckli, wo man sich inmitten verschiedenartigen Gerümpels und uralter Bücher geradezu im Paradies wähnte. Solche Rückzüge gingen einher mit einer vorübergehenden hochgradigen Übelhörigkeit. Kein noch so lautes Rufen und Befehlen und Drohen vermochte mich zu erreichen.
Eine Tätigkeit, die ich persönlich als unbedingt legitim, ja, als nützlich einstufte, war das Herumklettern an Hausfassaden und auf Dächern. Das förderte doch die Geschicklichkeit und stählte den Mut. Die Erwachsenen waren freilich anderer Meinung. Sie sahen überall Gefahren oder, bei Kletterpartien auf den Dächern, befürchteten sie eine Beschädigung der Ziegel. Dabei bin ich kaum je abgestürzt. Und die Zahl der beschädigten Ziegel hielt sich in Grenzen. Das wollten die Grossen einfach nicht begreifen. Eines Sonntags sassen Heinz und ich fröhlich auf der höchsten First und betrachteten die Welt von oben. Die Luft war rein, weil die Eltern einen Spaziergang unternommen hatten. Leider fuhr jedoch der Sattler Röbu mit seinem Velo einher und entdeckte uns in luftiger Höhe. Er hielt an und gebot uns, den gefährlichen Ort schleunigst zu verlassen. Nicht genug damit. Als er wenig später meinen Eltern begegnete, erzählte er ihnen brühwarm, was wir Schlimmes getan hätten. Vorsichtshalber machten wir uns unsichtbar und warteten ab, dass der elterliche Zorn Zeit hatte abzuebben.
Aus einem mir nicht mehr bekannten Grund lernte ich das Velofahren erst sehr spät, nämlich in der vierten Klasse. Später jedenfalls als Freund Heinz. Mein Nichtkönnen wusste ich aber sehr wohl zu beschönigen. Zu Fuss gehen gefalle mir viel besser. Ausserdem sei es gesünder. So macht man aus der Not eine Tugend. Im zehnten Lebensjahr aber war es endlich so weit. Auf einem uralten Damenfahrrad gelang mir schon der erste Versuch. Von dem Augenblick an war kein Halten mehr. Die wunderbare Theorie von der Schönheit des Laufens war von einer Minute auf die andere vergessen. Das Velo wurde zum unzertrennlichen Gefährten. Musste ich etwas im Werkzeugschuppen holen, eilte ich zuerst hinters Haus und nahm das Velo, um den einfältigen Auftrag zu erledigen. Jeder Schritt war mir zu viel. Nur noch das Velo zählte. Am ersten Sonntag nach diesem denkwürdigen, mein Leben und Denken verändernden Ereignis versprachen meine Geschwister, mit mir eine kleine Velotour zu unternehmen. Also trainierte ich über Mittag fleissig. Ich fuhr hin und her vor dem Haus und weitete meinen Aktionsradius aus bis zum benachbarten Gehöft oben am Waldrand. Dort angekommen wendete ich und genoss die sausende Talfahrt. Leider beherrschte ich die Kunst des Bremsens noch nicht in gewünschtem Mass. Mein Velo hatte einen Rücktritt, den ich nur ungenügend zu bedienen wusste. So ging es halt zu schnell in die Kurve. Ich rutschte auf dem Kies aus und schlug mir im Knie eine tiefe Wunde. Es blutete und schmerzte heftig. Von einer Velotour war keine Rede mehr. Noch heute ziert eine Narbe mein Knie.Später steigerte sich mein Können beträchtlich. Zusammen mit Heinz fuhr ich Tag für Tag nach Allenlüften in die Sekundarschule. Unterwegs übten wir allerlei Fahrkünste und hatten quer durch den Wald einen Parcours angelegt, der heute jeden Mountainbiker vor Neid erblassen liesse.
Noch einmal später, in reiferer Jugend, kaufte mir Vater ein prachtvolles neues Velo. Unvergesslich, wie er mich nach Rosshäusern Station begleitete und bei meinem Cousin Fred (A. Stooss, Velos Motos) ein unvergleichliches Rad kaufte: Marke Allegro, 3 Gänge! Mit diesem Wundervelo habe ich nicht nur unzählige Mal die Strecke Bern-Michelsforst zurückgelegt, zur Gymerzeit täglich zweimal hin und zurück, sondern auch grosse Velotouren unternommen, nach Venedig zum Beispiel, ins Burgund und nach Lyon, oder in der Studentenzeit von Bonn aus quer durch Holland und Belgien.Der Traum Velorennfahrer blieb unerfüllt, aber den Globus habe ich, alles zusammengerechnet, mit dem Fahrrad mindestens anderthalb Mal umrundet.

Kriegsjahre
Das grosse Völkermorden in Europa begann für mich, den damals Fünfjährigen, recht aufregend. Im September 1939 wurde die Generalmobilmachung der Schweizer Armee angeordnet. Tags darauf konnten wir beobachten, wie sich eine endlos scheinende Kolonne von Soldaten, Pferden und Fuhrwerken die Juchlishausstrasse hinunter Richtung Forstwald bewegte. Mein Vater war aus gesundheitlichen Gründen dienstfrei. Chrigu als Hilfsdienstler und der Karrer als Artilleriefahrer mussten beide einrücken. Nach einigen Tagen wurde auch der Melker, Vollenwyder Fritz, bei der HD eingeteilt und eingezogen. Mein Vater war auf dem grossen Hof allein mit den Frauen und Kindern. Zudem war er immer noch arg geschwächt wegen einer komplizierten Nierenoperation, der er sich ein halbes Jahr zuvor hatte unterziehen müssen. Die Arbeit, schon nur das Melken von etwa zwanzig Kühen, war kaum zu bewältigen. Zwei Tage etwa nach dem Einrücken telefonierte Vollenwyder Fritz. Sie seien im Steinbruch bei Ostermundigen stationiert und sässen den halben Tag auf der faulen Haut. Er halte dieses Nichtstun fast nicht aus, wenn er an die grosse Arbeit auf dem Hof und an den Stall voller Kühe denke. Mein Vater entbrannte in Zorn – trotz aller Vaterlandsliebe. Kurz entschlossen setzte er sich auf den Töff, fuhr nach Ostermundigen und stritt sich so lange mit dem Kommandanten, bis dieser Fritz beurlaubte. Ich sehe die beiden noch lebhaft vor mir, wie sie in den Hof einfuhren: Vater mit immer noch grimmiger Miene, und Fritz, auf dem Rücksitz, mit einem strahlenden Lachen auf seinem guten, runden Gesicht.
Wenig später quartierten sich auf unserem Hof Soldaten ein. Hinter dem Haus richteten sie eine Feldküche ein. Auf dem Söller und in der Rosstenne breitete man eine dicke Schicht Stroh aus fürs Nachtlager. Auch ein paar Offiziere waren dabei, unter ihnen der Feldprediger, Hauptmann Wälchli. Es ging zu wie in einem Bienenhaus. Am nächsten Tag war Backtag. Im Ofenhaus wurden morgens sieben Reiswellen in den Backofen gestossen und angezündet. Im späten Vormittag wurde die Glut aus dem Ofen entfernt und die Kuchenbleche samt Inhalt hineingestossen. Um auch die Soldaten am leckeren Mahl teilhaben zu lassen, suchte Mutter die ältesten und verbeultesten Kuchenbleche hervor und füllte Blech um Blech mit Zwetschgen oder Äpfeln oder einer Käsemischung. Die Offiziere interessierten sich sehr für die ganze Prozedur. Sie halfen mit, die gefüllten Kuchenbleche ins Ofenhaus zu tragen und – nach dem Backen – wieder zurück in die Küche. Um sich an den heissen Blechen nicht die Hände zu verbrennen, trugen sie die duftende Last auf ihren umgekehrten Stahlhelmen. Es konnte in den düsteren Kriegstagen auch lustig zu- und hergehen. Nach den Kuchen kamen die Brote in den Ofen. Auch dabei machten sich die Offiziere nützlich. Sie trugen die mit dem gekneteten Teig gefüllte Holzmulde ins Ofenhaus und schauten zu, wie Mutter schwungvoll Stück um Stück des Teiges formte, den Laib auf den hölzernen „Schüssel“ legte und mit einem eleganten Schnitt versah. Vater schob dann die Brote in den Ofen. Einen oder zwei Tage später zogen die Soldaten ab und es kehrte wieder Ruhe ein.
Am Krieg nahmen wir mittels Zeitungsmeldungen und Radionachrichten Anteil. Auf einer Europakarte an der Esszimmertür veranschaulichten Stecknadeln die Truppenbewegungen auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen und den jeweiligen Frontverlauf. In den ersten Monaten des Russlandfeldzuges staunte man, wie unglaublich weit sich der Hitler nach Russland hineinwagte. Das riesige Land war mit grüner Farbe markiert, genau so übrigens die winzig kleine Schweiz. Deutschland war gelb. Diese Farbe war mir sehr, sehr unsympathisch. Offenbar hat mich die Karte ausserordentlich fasziniert. Schon bald kannte ich die Namen der Länder und Hauptstädte Europas. Wenn Besucher mit uns am Mittagstisch sassen, musste ich sämtliche Länder und ihre Hauptstädte auswendig aufsagen, von Lissabon bis Bukarest. Ich vermute stark, Mutter und, in etwas geringerem Masse, auch Vater seien recht stolz gewesen auf ihren Wundergeografen.
Bald nach Kriegsbeginn wurde die Rationierung der Lebensmittel eingeführt. Jeden Monat mussten beim zuständigen Gemeinderat, es war Herren Miggu auf der Breite, die Rationierungskarten geholt werden. Pro Person gab es so und so viel Märkli für Zucker, Reis, Oel, Schokolade und so weiter. Weil wir zu grossen Teilen Selbstversorger waren, litten wir keinen Mangel. Milch, Butter, Obst, Gemüse, Fleisch und Mehl gab es genug. Uns brachte die Rationierung sogar einen vorher kaum gekannten Luxus. Vor dem Krieg bekamen wir kaum je Schokolade zu Gesicht. Jetzt aber musste man doch die zugeteilten Rationen nützen, oder etwa nicht? Jedes Mal, wenn Mutter nach Bern fuhr, brachte sie ein paar Tafeln dieser köstlichen Materie mit nach Hause. Niemand hatte etwas dagegen.
Am Abend- und Nachthimmel sah man gelegentlich lange, weisse Scheinwerferstrahlen, die den Himmel nach feindlichen Flugzeugen absuchten. Auf der Riedern bei Frauenkappelen waren ein paar Fliegerabwehrgeschütze stationiert, die gelegentlich ein paar Salven losliessen. Getroffen haben sie meines Wissens nie. Doch manchmal klirrte es auf dem Ziegeldach unseres Hauses, wenn Splitter niederprasselten. Ganz harmlos war das Geschiesse nicht. Jedenfalls entdeckten wir in den Holzwänden der Einfahrt Spuren davon. An einigen Stellen waren die Bretter von den Splittern durchschlagen worden.
Sehr dramatisch wurde die Lage aber im Mai 1940 – auch für mich. Es war ein herrlich blauer Frühlingstag. Wir sassen beim Mittagessen und drehten das Radio an. Da teilte der Nachrichtensprecher mit, deutsche Armeen ständen im Schwarzwald bereit und warteten nur noch den Befehl ab, in die Schweiz einzumarschieren. Das bedeutete Krieg – nicht nur für die andern Völker Europas, nein, auch für uns, für die Schweiz, für den Forst, für mich. Eine unheimliche Stille lastete über der Tischgemeinschaft. Ich fühlte, dass etwas ganz Schreckliches geschehen werde und rannte vom Tisch weg in mein Zimmer. Vor dem Fenster meines Zimmers standen die Fruchtbäume in voller Blüte. Die Löwenzahnmatten leuchteten in tiefem Gelb. Der Garten war ein Blumenmeer. Beim Gedanken, all dieses Schöne, Friedvolle werde nun zerstört, verbrannt, kaputtgeschlagen, erstarrte mein Herz und ich weinte lange verzweifelt. Zum unverdienten Glück flossen die Tränen umsonst. Der drohende Einmarsch der Nazideutschen fand dann doch nicht statt. Warum oder warum nicht – darüber streiten sich bekanntlich noch heute die Historiker.
Das Flüchtlingselend, das millionenfache Sterben, der Hunger und die fürchterlichen Zerstörungen konnten einen nicht kalt lassen. Meine Mutter begann, Bekannten in Deutschland und Oesterreich Pakete zu schicken. Sie meldete sich auch für die Aufnahme von Emigrantenkindern, die das Rote Kreuz vermittelte. Eines Sommerabends erschien bei uns ein etwa zwölf Jahre altes Mädchen. Es hiess Ellen, Ellen Fuld. Tagelang sass es herum. Stumm, in sich gekehrt, verstört und abwesend. Es dauerte lange, bis es ein wenig aufzutauen begann. Nach und nach gab Ellen ihre Geschichte preis. Was sie erzählte, wurde im Laufe der folgenden Monate ergänzt durch die Briefe, die meine Mutter mit Ellens Mutter zu wechseln begann.Fulds waren Juden und wohnten in Frankfurt am Main, wo der Vater ein Juweliergeschäft besass. Viele Juden verliessen schon früh in den dreissiger Jahren Deutschland, da sie Böses ahnten. Fulds flohen nach Paris. In einer Mansarde fanden sie Unterschlupf und fristeten mit einem kleinen Briefmarkenhandel ein kärgliches Dasein. Herr Fuld meldete sich dann bei der französischen Armee, um gegen die Nazis zu kämpfen. Unter Umständen, die ich nicht kenne, wurde er verhaftet und blieb verschollen. Als die Deutschen Frankreich überfielen und sich Paris bedrohlich näherten, flüchtete Frau Fuld mit Ellen nach Zentralfrankreich, das einige Zeit noch unter einer franzöischen Regierung stand, dem sogenannten Vichy-Regime des Marschalls Pétain. In der Gegend von Lyon fanden sie Unterkunft. Das Rote Kreuz ermöglichte es, dass Ellen für einen Erholungsaufenthalt in die Schweiz reisen konnte.Im Laufe der Wochen lebte Ellen auf. Bald fühlte sie sich zur Familie gehörend. Es kam sogar vor, dass sie ab und zu wieder lachen mochte. Nach ein paar Monaten kehrte sie wohl genährt zu ihrer Mutter zurück. Beide überstanden den Krieg unbeschadet – wirklich ein Wunder. Später heiratete Ellen den Schneider Maurice Kaplan in Paris. Ihr Söhnchen, Gérard, kam von seinem 7. Lebensjahr an fast alljährlich zu uns in die Ferien. Ich brachte ihn jeweils nach dem Ende der Ferien zurück und lernte dabei die Faszination von Paris kennen.
Meine Mutter stellte sich dem Roten Kreuz noch für andere Dienste zur Verfügung. Sie vermittelte Briefe und Nachrichten von Emigranten in Frankreich an Bekannte und Verwandte, die nach Schweden emigriert waren – und umgekehrt. Mutter hat diese Tätigkeit nie an die grosse Glocke gehängt. Mir kam sie erst viele Jahre später zur Kenntnis.Auch die Aufnahme und Auffütterung schlecht ernährter Kinder pflegte sie als selbstverständliche Tradition – schon lange vor meiner Geburt. Da gab es ein Hannchen aus Deutschland und eine Trudl aus Oesterreich, mit denen sie noch viele Jahre den Kontakt pflegte. Zu meiner Zeit, wohl kurz nach dem Krieg, wurde ein mageres Wiener Bübchen namens Peter aufgepäppelt. Nach dem Ungarnaufstand 1956 beherbergten wir während Jahren den Studenten Csaba.
Je länger der Krieg dauerte, desto bewusster verfolgte ich seinen Verlauf. Man hörte und sprach viel vom Russlandfeldzug, von den strengen Wintern dortzulande und der furchtbaren Schlacht um Stalingrad. Im Sommer 1943 richtete sich die Aufmerksamkeit westwärts, in die Normandie, wo die anglo-amerikanische Invasion ihren Anfang nahm. Die Eltern sprachen ehrfurchtsvoll von Churchchill und Montgomery. Die galten sehr viel in unserer Familie. Die Stecknadeln auf der Europakarte rückten im Osten nach Westen und im Westen Richtung Osten. Es wurde allmählich eng für Hitler. Die Deutschen sprachen immer häufiger von „planmässigem Rückzug“. Es begannen die Bombardemente deutscher Städte. In der Schweiz musste nachts alles verdunkelt werden. Selbst wer zu später Stunde mit dem Fahrrad unterwegs war, musste eine blaue Kappe über die Velolampe streifen. Manchmal verirrten sich amerikanische und englische Bomber in den Schweizer Luftraum. Einmal wurde Schaffhausen schwer bombardiert. Ein anderes Mal fielen Bomben auf Riggisberg – ein ganz offensichtliches Versehen.Jede Woche sprach Professor Jean Rudolf von Salis im Radio über die Weltlage. «Weltchronik», hiess die Sendung. Die ganze Familie und oft auch die Dienstboten versammelten sich um das Radio und folgten gespannt den Ausführungen. Mit seiner hohen, näselnden Stimme – ich höre sie heute noch – kommentierte von Salis das Geschehen. Klar, überzeugend und unbestechlich, so schien es uns. Viele Jahre später erzählten mir Bekannte in Deutschland und Frankreich, auch sie hätten – verbotenerweise – von Salis’ Kommentare gehört und ausserordentlich geschätzt. Sie hätten gespürt: hier sagt einer die Wahrheit.
Die grosse Freudenbotschaft vom Kriegsende, im Mai 1945, erreichte mich, als ich auf der Bahnstation Rosshäusern auf den Zug wartete (ich hatte an jenem Tag Harmonium-Unterricht bei Haas Hans, der im Stöckacker wohnte). Plötzlich öffnete sich die Türe des Stationsbüros. Der sonst so mürrische Bahnhofvorstand Tschanz stürzte heraus und rief den Wartenden freudestrahlend zu: Der Krieg ist aus! Die Deutschen haben kapituliert!
Gelegentlich ereigneten sich auch lustige Episoden. Eine davon beleuchtete den trockenen Humor meines Vaters. Zum Verständnis der Pointe muss ich zwei Erklärungen vorausschicken. Zunächst ein Wort über die sogenannte Ortswehr. In der bösesten Zeit des Krieges wurde eine Art Heimwehr gegründet. Jünglinge und ältere Herren in Zivil, mit einer Armbinde versehen, wurden aufgeboten für die Bewachung von Brücken und andern wichtigen Bauwerken. Die Armee stand ja an der Grenze oder hatte sich – später – ins Alpenréduit zurückgezogen. Auch meine beiden Schwestern wurden zur Ortswehr aufgeboten. Sie fassten ein rassiges Käppi, eine blaue Schürze, Brotsack und Gasmaske. Die rote Armbinde mit dem weissen Kreuz durfte selbstverständlich nicht fehlen.Die Mühleberger Ortswehr, unter dem Kommando des alten Beyeler Ernst, nahm sich selber viel ernster als dies die Bevölkerung tat. Beyeler Ernst war übrigens ein guter Schütze, passionierter Jäger und, wie man munkelte, gelegentlicher Wilderer. Zweitens ist vorauszuschicken, dass damals fortschrittlichere Bauern begannen, in Regenzeiten das Heu auf Heinzen, Heuheinzen, aufzuhängen. Auf diesen Holzgestellen war es vor der Bodenfeuchtigkeit besser geschützt. Mein Vater war weit und breit einer der ersten, der solche Heinzen anschaffte. Entsprechend spöttisch waren die Kommentare der anderen Bauern – bis sie später dem belächelten Beispiel folgten.Nun machte unsere Familie an einem Sonntagnachmittag einen Spaziergang. Ziel war die Ledifluh, ein prachtvoller Aussichtspunkt. Zu Füssen lag unser Hof, der Forstwald und das ganze Mittelland. Der mächtige Alpenkranz rundete das Bild ab. Wir setzten uns auf die Bänke und freuten uns über die schöne Aussicht. Es kamen auch andere Spaziergänger, unter ihnen der alte Beyeler Ernst. Man plauderte miteinander, ganz freundlich und arglos, bis Beyeler Ernst auf die Heuheinzen zeigte, die in Reih und Glied auf einem unserer Felder standen. Mit unüberhörbarem Spott fragte er: „Was hast du denn für seltsame Toggel auf deinen Matten, Hermann?“ Ohne sich zu besinnen antwortete Vater: „Das sy kener Toggle, das isch dänk d Ortswehr.“ Beyeler Ernst, schon leicht verstimmt, stichelte weiter: „Wo hei si de ihrer Gwehr?“ Vater: „He dänk i de Hosegschlötter.“ Beyeler Ernst sagte nichts mehr und verliess bald die lachende Gesellschaft, grusslos. Er hat meinem Vater dieses Gespräch noch lange nachgetragen. Die Bemerkung vom Gewehr, das in den „Hosegschlötter“ versteckt sei, hatte er natürlich als Anspielung auf das Wildern verstanden.
Weiter in Erinnerung geblieben ist mir die wunderbare Vermehrung des Bekanntenkreises. Plötzlich kamen Leute zu Besuch, die man vorher nie gesehen hatte. Oder es tauchten entfernte Bekannte auf, die ihrerseits Bekannte mitbrachten. Meistens stammten sie aus Bern oder Bümpliz. Mit Vorliebe taten sie das am Sonntag, kurz vor dem Zvieri. Wenn dann nicht bloss Brot, Butter und Konfitüre, sondern auch eine Platte mit „Hamme“ und Wurst aufgestellt wurde, schlugen die Besucher fast unanständig zu. Ich erinnere mich, dass diese Besucher sich gegenseitig anfeuerten, ja genug auf ihre Teller zu laden. Manchmal wurde ungeniert gestohlen. Einmal versammelten sich unter einem Apfelbaum ein paar Leute, die Früchte nicht nur auflasen, sondern auch vom Baum rissen und Tragtaschen und Netze füllten. Damals weilte ein Ferienmädchen bei uns, das vorwitzige Grossenbacher Friedeli aus Burgdorf. Friedeli und ich waren auf dem Heimweg, zwischen Spielwald und Haus, als die Apfelpflücker mit ihren vollbeladenen Velos an uns vorbei radelten. Kaum hatten sie uns passiert, wandte sich Friedeli um und rief ihnen nach: Äpfelschelme, Äpfelschelme! Die Velofahrer hielten an, wendeten ihr Räder und fuhren drohend auf uns zu. Ich machte mich schleunigst aus dem Staub und rannte heimzu. Friedeli aber dachte nicht daran zu flüchten. Von sicherer Warte aus beobachtete ich, wie es tapfer mit den Apfelschelmen redete, so lange, bis sie wieder aufstiegen und sich mit ihrer Beute davon trollten.
Eines Abends, wohl kurz nach Kriegsende, tauchte tief über dem Horizont ein kleines Flugzeug auf, flog knapp über Baumkronen und Hausdächer, mit knatterndem Motor, der immer wieder aussetzte. Es flog eine Schleife und setzte auf einer langgezogenen, frisch gemähten Wiese zur Landung an. Holpernd rollte es über die Wiese und blieb wenige Meter vor dem Forstbach stehen. Diese Notlandung war weit herum beobachtet worden. In kürzester Zeit umringte eine wahre Volksmenge den gelben Vogel. Das Gras wurde derart zerstampft, dass man von der Ledifluh aus noch wochenlang die Umrisse des Flugzeugs ausmachen konnte. Der Maschine, einem Bücker – Doppeldecker, entstieg ein Offizier der Schweizer Flugwaffe, Major Frey. Er fragte nach dem nächsten Telefon und wurde zu unserem Haus geführt. Er telefoniert nach Payerne. Von dort rückte in der Nacht ein Lastwagen an, der den defekten Bücker abtransportierte. Major Frey blieb mittlerweilen sehr viel Zeit. Bis zum Nachtessen, wozu er selbstverständlich eingeladen war, sass er auf der Bank vor dem Haus und schien den Sommerabend zu geniessen. Mit gewaltigem Respekt beäugte ich den ausserordentlichen Besucher. Die schöne Uniform und die stattliche Gestalt beeindruckten mich ebenso wie seine Tätigkeit als Fliegeroffizier. Mutter nahm mich am Ärmel und schleppte mich zum Harmonium. Ich könnte doch ein wenig spielen und derart den Gast erfreuen, meinte sie. Mir stand der Sinn zwar nicht nach Kunst. Widerwillig klappte ich den Deckel auf und kämpfte mich tapfer durch verschiedene Etüden und Choräle. In der Tat mochte es sinnvoll sein, die Choräle „Wie soll ich dich empfangen“ und „Grosser Gott wir loben dich“ zu spielen. War uns doch der Gast sehr willkommen und hatte er jedenfalls dem lieben Gott zu danken für die glimpflich verlaufene Notlandung. Leider fehlte in meinem Repertoire der Choral „Vom Himmel hoch da komm ich her“. Ob meine Kunst tiefen Eindruck gemacht hat, weiss ich nicht mehr. Zu vermuten ist, dass Major Frey höflich über meine Bemühungen hinweg ging. Er gab sich übrigens sehr natürlich und menschlich. In den folgenden Monaten geschah es nicht selten, dass ein Flugzeug der Schweizer Luftwaffe tief über den Forst flog und über unserem Hof kreiste. Ob sich Major Frey für die Gastfreundschaft allgemein oder die Choräle im Speziellen bedanken wollte?

Jahreszeiten
Damals dauerten die Winter meist lange und brachten grosse Kälte. Der Schnee blieb wochenlang liegen. Um die Strassen und Strässchen freizulegen, wurde zum „Treiben“ aufgeboten. Jeder grössere Hof musste einen Zug Pferde oder einen Mitfahrer stellen. Es war ein imposantes Bild. Vier Pferdepaare waren vor den grossen hölzernen Schneepflug gespannt. Auf jedem Zurhand-Pferd sass ein Reiter. Die Mitfahrer hockten zum Beschweren auf den Querbrettern. Schon aus der Ferne scholl über die tief verschneiten Felder das Klingeln der Pferdeglöcklein. Je näher die Treibete kam, desto lustiger ging es zu und her. Denn bei jedem Hof wurde Halt gemacht und die Männer mit Kaffee samt Schnaps aufgewärmt. Letzterer pflegte ihnen im Laufe der Fahrt immer stärker in den Kopf zu steigen. Ab Juchlishaus wurden sie lustig, ab Michelsforst begannen sie zu singen. Fuchs Fritzes heisere Stimme war dann weit herum zu hören. „Wir haben den Frühling gesehen“, sang er mit Inbrunst. Der Alkoholpegel war dem Gleichgewichtsgefühl nicht eben zuträglich. Ab und zu verlor ein Mann den Halt und purzelte in den Schnee. Auf das Geschrei hin hielt der Vorreiter den Zug an. Der Unglückliche rappelte sich mühsam auf und setzte sich wieder an seinen Platz. Mit Hüh und Ho ging es weiter. In der Rückschau stelle ich fest: das waren wahrhaft Breughel’sche Bilder. Bei starker Bise wurden die Männer aufgeboten, exponierte Strassen freizuschaufeln. Die „Fröschere“ oberhalb der Station Rosshäusern zum Beispiel war ständig mit Schnee gefüllt. Trotz Schneezäunen links und rechts bildeten sich tiefe Wächten. Wären die nicht fortgeschaufelt worden, hätte die Strasse nicht mehr passiert werden können.

(1) Winter
Zum Skifahren benützte man Eschenbretter, die vorne etwas zugespitzt und gebogen waren. Die Laufflächen mussten zu Beginn jedes Winters neu mit mehreren Schichten Lack behandelt werden. Metallkanten kannte man natürlich nicht. Die Alpina-Bindungen bestanden aus einem beweglichen Lederriemen. Damit er hinten nicht abrutschte, wurden Nägel mit dicken Köpfen in den Absatz der Holzschuhe getrieben. Erst etwa im sechsten Schuljahr erhielt ich Skischuhe und eigene Skis. Ich war stolz auf die moderne Kandahar-Bindung. Sie war mit einem Federzug ausgestattet, der für Abfahrten fixiert werden konnte und den Schuh festhielt. Eine simple Windjacke und Wadenbinden vervollständigten die Ausrüstung.Das Skigebiet war mannigfaltig. Für Anfänger empfahl sich der sanfte Hang des Oberackers. Schwieriger war der Berglihoger. Doch für höchste Ansprüche stieg man zum „Loch“ hinauf, unterhalb der Ledifluh gelegen. Dort gab es zwei, drei ganz giftige Steilhänge. Wagte man sich dem Waldrand entlang auf die Abfahrt, stellten zwei Querwege die Standhaftigkeit auf eine harte Probe. Ein Nachbar stellte sich eines Sonntags oben an den Hang, schaute und wartete, wartete nochmals, bis zum späten Nachmittag. Endlich fasste er sich ein Herz und stach hinunter. Die tollkühne Fahrt endete zuunterst mit einem gewaltig stiebenden Purzelbaum. Als sich die Staubwolke verzogen hatte, sah man den Burschen langsam aufstehen und sich den Schnee abklopfen. Anschliessend ging er wortlos und grusslos nach Hause.
Eines Nachmittags hatten wir Bubenschule. Frau Langen gebot uns, die Skis mitzunehmen. Sie stammte übrigens aus Gstaad und war eine ausgezeichnete Skiläuferin. Sogar Lehrer Krummen liess sich von ihr den einen oder andern Trick zeigen.Als ich mittags meine uralten Bretter bereit machte, riss dummerweise der Riemen der Bindung. Weder mit Schnüren noch sonstwie konnte der Schaden behoben werden. Notdürftig wurden mir die viel zu langen und viel zu schweren Skis von Madeleine angepasst. Ich vermochte sie kaum zu schleppen. Zudem öffnete sich alle paar Schritte die verfluchte Bindung. Bereits der lange Weg zum Schulhaus bereitete Qualen. Als wir hinter Frau Langen den Umberg hinauf steigen sollten, vermochte ich einfach nicht zu folgen. Ich weinte Tränen des Zorns und des Selbstmitleids. Es war schrecklich. Normalerweise, mit meiner gewohnten Ausrüstung, bereitete mir das Skifahren durchaus Vergnügen. Am schönsten war es, geradeaus die Hänge hinunterzusausen, so weit, bis man von selbst stillstand. Wenden oder Kurven fahren konnten nur die Allertüchtigsten. Werner beispielsweise beherrschte den Telemark-Schwung. Ich bewunderte ihn sehr.
Im Winter hielt ich mich sehr gern in der warmen, gemütlichen Stube auf. Am Nachmittag sassen die Frauen am Tisch oder an der Tret-Nähmaschine. Es wurde geflickt und Strümpfe gestopft. Währenddessen errichtete ich mit meinen Bauklötzen auf dem grossen Esstisch ganze Burganlagen. Kleine Halma-Figürchen stellten die Soldaten dar. Mit einem Kipp-Brettchen spickte ich Marmeln von einer Burg in die andere. Die Schlacht dauerte so lange, bis die eine oder andere Armee vernichtet war. Das heisst: bis alle Halma-Soldaten umgefallen waren. Standhafter waren natürlich die Bleisoldaten. Ich besass eine Serie Trommler und eine Serie Fähnriche, alle selbst gegossen. Im Wall hinter dem Scheibenstand Allenlüften sammelten die grossen Buben Bleiklumpen. Diese legte man in eine Kelle und hielt sie ins Feuer des Küchenherdes. Das flüssige Blei goss man in ein Model, das ich mir jeweils bei Frau Aeschbacher auslieh. Spielte ich draussen, zog ich mich warm an. Ich besass mehrere gestrickte Kappen. Jede erhielt einen Namen. Besonders lieb war mir der „Fritz“, ein blaues wollenes Ungetüm. Mit diesem Fritz hatte es eine besondere Bewandtnis. Meine Schwester Madeleine hatte diese Kappe in der Arbeitsschule gestrickt. Dabei hatten sowohl Madeleine wie auch die Handarbeitslehrerin offensichtlich jedes Mass verloren. Zog ich diese Wunderkappe über meinen Kopf, reichte sie mir fast bis zum Bauchnabel. Also musste ich sie zusammenrollen und drei oder vier Litze machen. Das sah dann aus wie ein gewaltiger Turban. Fritz war alles andere als elegant. Dafür gab er schön warm. Die Arbeit auf dem Hof verlief im Winter ruhiger. Während mehrerer Wochen wurde das Getreide gedroschen, bis der mächtige Söller leer, der Strohschopf und der Getreidespeicher aber gefüllt waren. Dann gingen die Männer in den Wald zum Holzen. Die Stämme der gefällten Bäume wurden in die Sägerei geschleift, mit einem kleinen, sehr soliden Schlitten. Die Äste wurden zum Haus geführt und während des restlichen Winters zu Reiswellen verarbeitet. Deren brauchten wir viele, zum Heizen der Sitzöfen im Erdgeschoss. Die Zimmer im obern Stock blieben meistens ungeheizt. Sie dienten ja nur dem Schlafen. Viele Reiswellen frass auch der Backofen im Ofenhaus. An jedem Backtag musste man ihm sieben Stück in den Rachen schieben. Gemütlich waren die langen Winterabende. Draussen war es stockdunkel. Aus der Ferne grüssten einzelne erleuchtete Fenster. Dafür glänzten in klaren Nächten die Sterne umso heller. Gern verzog man sich in die warme Stube, besonders wenn die Bise um die Hausecken pfiff. Vater sass meistens auf dem Sofa und las. Die Frauen beschäftigten sich mit Handarbeiten. Manchmal lief das Radio. Jede Woche einmal hörte sich die ganze Familie gespannt Professor von Salis’ Weltchronik an. Er war ein unbestechlicher Kommentator des Weltgeschehens. Oft wurde gespielt. Beliebt war damals das Nünizieh. Während und nach dem Krieg befand sich im Heggidorn ein Interniertenlager. Einige der italienischen Internierten, die in den letzten Kriegsmonaten in die Schweiz geflüchtet waren, teils reguläre Soldaten, teils Partisanen aus den norditalienischen Bergtälern, halfen den Bauern. Einer, Battista Pessina, wohnte und arbeitete die ganze Zeit über bei uns. Er litt furchtbar unter Heimweh. Seine Braut Carla, von der er eine abgegriffene Foto bei sich trug, hatte er seit langer Zeit nicht mehr gesehen. Um ihm das Leben in der Fremde etwas erträglicher zu machen, lehrten wir ihn das Nünizieh. Kaum beherrschte er die Regeln, entwickelte er sich zu einem überaus leidenschaftlichen Spieler. Mit ihm steigerten auch wir uns in einen Spielrausch. Wie freute er sich, wenn es ihm gelang, eine „Figgu-Mühle“ zu errichten. „Figgu-Faggu, Figgu-Faggu“, rief er ein ums andere Mal begeistert aus. Im Laufe des Winters entwickelten wir eine derartige Geschicklichkeit, dass ein einziges Spiel oft weit mehr als eine Stunde dauerte. In den Jahren nach dem Krieg brachte das Radio Winter für Winter Hörspiele von Gotthelf, die Ernst Balzli bearbeitet hatte. Sie wurden immer am gleichen Wochentag gesendet. An diesen Gotthelf-Abenden liess es sich kaum jemand nehmen, in der Stube zu sitzen und den Lebensweisheiten Annebäbi Jowägers zu lauschen oder sich an den Tiraden des Dürluft-Eisi gegen seinen armen Ehemann, den Peterli, zu ergötzen. Literarische Puristen haben Balzlis Umdichtungen kritisiert als zu grobschlächtig. Ihre Kritik mochte berechtigt gewesen sein. In den Sendungen wurde viel gezankt, viel geflucht und gab es zahllose wüste Schlägereien. Immerhin gehörte es zu Balzlis Verdiensten, Gotthelf in weiten Kreisen bekannt und sogar beliebt gemacht zu haben.
Im Winter wurden die meisten Kälblein geboren. Wenn die Geburt tagsüber stattfand, durfte ich ohne weiteres zuschauen. Wenn die zwei Beine zum Vorschein kamen, aber der Geburtsvorgang zu lange dauerte, band man einen Strick um die kleinen Klauen und zog stetig und behutsam, um der Mutter zu helfen. Sobald die Kälbchen geboren waren, trennte man die Nabelschnur ab und rieb das Neugeborene mit sauberem Stroh trocken. Dann brachte man es zum vorbereitete Plätzchen zuhinterst im Stallgang. Allerliebst, wie sich die Kälbchen unbeholfen bewegten und gleich zu Beginn ihres Daseins auf die Beine zu kommen suchten. Oft kamen die Kälbchen nachts zur Welt. Manche Nacht hat Vater oder der Melker im Stall gewacht, um im Notfall dem Muttertier Hilfe zu leisten.
Mit der Geburt des Heilandes brachte ich Weihnachten erst in zweiter Linie in Zusammenhang. Im Vordergrund standen für mich all die geheimnisvollen Vorbereitungen, das Backen von Güezi aller Art und das Kaufen und Bereiten der Geschenke. Meine Mutter war stolz darauf, mindestens 12 bis 15 verschiedene Güezisorten zu backen. Spitzbuben, Zimtsterne und Nussstengeli waren meine absoluten Favoriten. Neben ihnen verblassten Mailänderli und Änischräbeli. Auch der Weihnachtsbaum war mir wichtig. Manchmal durfte ich mit dem Vater in den Wald, um ein Weihnachtsbäumchen zu suchen. Das war immer ein Ereignis. Durch den tief verschneiten Wald stapfen, von den Tanngrotzen gewünschter Grösse den Schnee wegschütteln, begutachten, ob er schön regelmässig gewachsen sei – das gehört zu meinen kostbaren Erinnerungen. Genügte ein Bäumchen Vaters Vorstellungen, holte er den Fuchsschwanz hervor und sägte es ab. Zufrieden klemmte er es unter den Arm und wir zogen heimwärts. Der Samichlaus hatte bei uns keine Tradition. Ein einziges Mal wurde ein Versuch gestartet. Als am heiligen Abend unverhofft ein Nikolaus auftauchte, sagte ich ihm, (fast) furchtlos in seine Masken blickend: Du bis ja der Blaser Ernst! Ich hatte unsern Karrer natürlich an der Stimme erkannt. Der Versuch mit einem Samichlaus wurde in den folgenden Jahren nicht mehr wiederholt. Am ersten Weihnachtstag schmückten Mutter oder die Schwestern den Baum in der abgeschlossenen Visitenstube. Ich hatte keinen Zutritt. Nach dem besonders guten Abendessen – zum Beispiel wurden die heiss geliebten Bratwürste aufgetragen – zogen sich alle zurück, um sich sonntäglich zu kleiden. Sobald wir alle, die Dienstboten eingeschlossen, in der grossen Stube versammelt waren, wurde der geschmückte Weihnachtsbaum hereingetragen und die Kerzen angezündet. Jahr für Jahr ergötzte ich mich am Schmuck. Insbesondere liebte ich die kleinen, ein wenig kitschigen Dingelchen. Da gab es zum Beispiel zwei rote, weiss getüpfelte Fliegenpilzchen, einen Schneemann, zwei Glöcklein, ein Vögelchen, blau und rot, mit Federschwanz. Endlich begann die Feier. Die bekannten Weihnachtslieder wurden gesungen, am Harmonium begleitet von Madeleine, später von mir (in ständiger Angst, aus dem Takt zu fallen, wenn die Akkordsuche zu lange währte). Eine meiner Schwestern las eine rührende Geschichte, beispielsweise von Elisabeth Müller. Meist blieb kein Auge trocken, am allerwenigsten das der Vorleserin. Schliesslich holte Vater aus dem Schlafzimmer die ehrwürdige Familienbibel und las die Weihnachtsgeschichte vor – in seinem unnachahmlichen Tonfall. Sobald er das Kapitel Lukas 2 zu Ende gebracht hatte, schloss er die Bibel und fügte einen Satz bei, immer den gleichen: „dass mer wüsse, warum Wiehnachte isch.“ Jetzt aber, endlich, ergoss sich der Geschenkesegen über die Anwesenden. Mutter schleppte einen grossen Korb voller Päckli herbei, ergriff eines um das andere, und las auf den Etiketten die Namen der zu Beschenkenden. Zum Abschluss erhielt jedes noch einen Bäremutz aus Bichsels Backstube. Ich gebe ohne weiteres zu: das Weihnachtsgeschenk hatte für mich eine enorme Bedeutung. Ihm hatte ich seit Tagen entgegengefiebert; seinetwegen verzappelte ich fast während den ellenlangen Elisabeth-Müller-Geschichten. Wenn ich es dann endlich, endlich in den Händen hielt und öffnen durfte, vergass ich für eine Weile die Welt. So geschah es auch an der Weihnachtsfeier jenes Jahres, in dem ich die erste Klasse besuchte. Fast brachte man mich nicht von meinem Geschenk weg zum Tisch, wo zum Ausklang Tee und Weihnachtsgüezi serviert wurden. Wie ich mich schliesslich doch dazu bequemte, stiess mich meine Mutter an und fragte: „Weißt du, was dort auf dem Boden liegt?“ Dabei deutete sie auf ein blaues Etwas, das unter dem Sofa hervorlugte. Heiss und kalt durchfuhren mich Schauer der Scham. Währenddem ich mich inbrünstig an meinen Geschenken geweidet hatte, war mir vollständig aus dem Sinn geraten, dass ja auch ich etwas für meine Mutter besorgt hatte, und zwar mit meinem höchsteigenen Geld: eine Tüte mit süssen Halsbonbons. Da lag das Geschenk unter dem Ruhebett, wo ich es sorglich versteckt hatte. Vor lauter eigensüchtigem Glück vergessen! Noch lange plagte mich die peinliche Geschichte. Zum Thema Lebkuchen ist nachzutragen, dass längst nicht alle sich über dieses Geschenk freuten. Mich dünkte der Bäremutz essbar nur, nachdem man ihn in süssen Znüni-Tee getaucht und tüchtig aufgeweicht hatte. Vater liebte dieses Gebäck noch weniger. Lachend sagte er etwa, er wolle es noch ein wenig aufheben, damit er auch an Ostern etwas zu knabbern habe. Gelegentlich schenkte mir der eine oder andere Götti einen Lebkuchen. Darüber freute ich mich nur, sofern er mit einem echten Fünfliber verziert war. Wer will da noch behaupten, Kinder seien keine Materialisten?
Wenn allmählich der Frühling einzog und es auf Ostern zuging, begann Mutter die Eier zusammenzusparen. Die Kinder begaben sich in den Wald, um für die Osternester ein ganz bestimmtes Moos, das Ostermiesch, zu sammeln. In der Nähe des Waldrandes, in einem überwachsenen Hohlweg, fand man Jahr für Jahr die wunderbaren grünen Polster. Auf den Wiesen sammelten wir Kerbelblätter und andere Pflanzen. Diese band man mit Fäden um die Eier. In einer grossen Pfanne mit aufgekochten Zwiebelhüllen wurden die Eier braun gefärbt. Entfernte man die Umschläge, kamen prachtvolle Muster zum Vorschein. Besser gefielen mir allerdings die roten, die blauen und die grünen Ostereier. Braun schien mir zu gewöhnlich. Am Ostermorgen fand sich neben jedem Teller der Erwachsenen ein Körbchen mit etwa einem Dutzend Eier. Uns Kindern machte man es nicht so leicht. Wir hatten unsere Osternester zu suchen, was auf einem Bauernhof keine Kleinigkeit ist. Man bedenke, wie viele tausend heimliche Winkel sich dem Osterhasen anboten! A propos Osterhase: den Glauben an diese Figur verlor ich recht früh. Ich erinnere mich, dass nach Ostern einer meiner Erstklässler-Kameraden verkündete, er habe den Osterhasen deutlich gehört. Der sei nämlich früh am Ostermorgen eine Leiter hochgestiegen. Und tatsächlich: das Osternest habe sich in der Dachrinne befunden, unmittelbar neben der Leiter. Ich kam mir damals mit meiner Aufgeklärtheit sehr viel besser vor als der dumme, wundergläubige Hänggeli Werner. Ich wusste ganz genau, dass Mutter oder Frieda oder Madeleine mein Osternest versteckten. Unbarmherzig suchten sie Jahr für Jahr ganz schwierige Verstecke aus. Man musste mindestens eine Stunde lang suchen, bevor die zweibeinigen Osterhasen bereit waren, ein wenig nachzuhelfen. Vorher war alles Betteln und Bitten umsonst. War man weit weg vom Versteck, meldeten sie „kalt“. Die nähere Umgebung des Objektes bezeichneten sie als lau. Erst ganz in der Nähe des Fundortes wurde es warm oder gar heiss. Zuweilen flossen Tränen, wenn die Suche trotzdem keinen Erfolg hatte. Noch heute erinnere ich mich an einige Orte, an denen der Schatz versteckt war: in einem Korb, der im Düngerkämmerchen an der Wand hing; zuhinterst auf dem Reiswellenstapel beim Ofenhaus; in der Blumenkrippe auf der Söller-Laube (wo ich als Zweijähriger beinahe ums Leben gekommen wäre); in einer Zementröhre hinter dem Holzschuppen; unter dem Deckel der Sämaschine.War das Nest einmal gefunden, musste zuallererst der Schoggi-Osterhase dran glauben. Seinetwegen hatte ich die ganze Mühsal des Suchens auf mich genommen, hatte gelitten und gehofft und schliesslich gefunden. An den folgenden Tagen wurden zum Znüni und zum Zvieri Eier getüscht. Einmal war ich stolzer Besitzer eines dunkelblauen, widerstandsfähigen Wundereis, mit dem ich alles, was rund war und Ei hiess zerschmetterte. Ein unbändiges Sieges- und Machtgefühl bemächtigte sich meiner. Wie schade, dass ich das blaue Wunder schlussendlich selber knacken musste!
Weit weniger erfreulich ist ein Ereignis in der Vorfrühlingszeit. Wen der Schnee zu schmelzen begann, mussten die übervollen Jauchegruben geleert und die wüste braune Flüssigkeit auf den Feldern verteilt werden. Eine unterirdische Leitung verband die Bschüttlöcher mit dem unterhalb des Hauses gelegenen Auslauf. Dort konnte der Karrer mittels eines Hebels die Leitung öffnen und sein Bschüttfass voll laufen lassen. Mit zwei Pferden wurde dann der stark riechende Flüssigdünger auf den Feldern verteilt. Die Bschüttlöcher waren offen, damit die braune Suppe immer wieder aufgerührt werden konnte. Derweilen versuchte ich, mich mit meinem Schlitten ein letztes Mal zu vergnügen. Ohne Erfolg – der Schnee war viel zu weich. Missmutig schleppte ich den Schlitten um die Hausecke. Beim hintern Stall stand Vollenwyder Fritz, der Melker, und plauderte mit Blaser Ernst, dem Karrer. Ich hörte den beiden zu, rückwärts gehend und den Schlitten übers Bschüttloch ziehend. Weil man hinten keine Augen hat, stolperte ich über die aufgeschichteten Bschüttloch-Bretter und stürzte rücklings in die offene Grube. Offenbar und zu meinem grossen Glück schlug ich mit dem Kopf auf den Bschüttloch-Rand. Sonst wäre ich kopfvoran untergetaucht, was mein augenblickliches Ende bedeutet hätte. So erfuhr mein Sturz eine kleine Verzögerung. Wieselflink stürzte Vollenwyder Fritz herzu und konnte mich festhalten, als nur noch mein Gesicht aus der Brühe herausschaute. Das war knapp, sehr knapp. Fritz überbrachte mich übelriechendes Bündel der Mutter. Diese steckte mich in die Badewanne und spülte und schrubbte gründlich an mir herum. Es wird überliefert, in der Waschküche und im Badezimmer habe es noch lange teuflisch gestunken.Zwei- oder dreimal verbrachte ich die Sommerferien im Stierenmoos, in einer Sennhütte ganz in der Nähe des Schwefelberg-Bades. Die Frau des Sennen, Trudi, hatte im Forst ein Praktikum gemacht. Mutter fand, die gesunde Bergluft täte mir, der ich so oft unter einem nicht diagnostizierbaren Bauchweh litt, ganz gewiss gut. In Bern bestiegen wir das Postauto, das über den Längenberg via Riggisberg ins Schwefelberg-Bad fuhr. Die Fahrt imponierte mir, besonders das Dreiklanghorn des Postautos. Einen kurzen Halt gab es beim Gurnigelbad. Mitten in den ausgedehnten Wäldern des Gurnigels erhob sich unvermittelt ein gewaltiger Gebäudekomplex, mehrere Stockwerke hoch und wohl über zweihundert Meter lang. Der einstige Glanz war allerdings vorbei. Ende des Krieges diente das Gurnigelbad als Interniertenlager und man erzählte sich allerhand Schauermärchen, wie die internierten Polen und Russen schlimm gehaust und alles kaputt gemacht hätten. Leider sind eben nicht alle Menschen so durch und durch zivilisiert und ohne jeglichen Tadel wie wir Schweizer. Später, bis zum Abbruch, stand das Grandhotel meistens leer. Als das Inventar versteigert wurde, erwarb Mutter zwei Betten. Sie ersetzten im Forst uralte Bett-Ungetüme und wurden wegen ihrer Qualität sehr gerühmt. Weiter gings auf der kurvigen Bergstrasse hinauf zur Wasserscheide und schliesslich zum Schwefelberg-Bad. Dort wartete Trudi auf uns und führte uns in die Sennhütte. Niederhäusers betreuten mehr als hundert Gusti und besassen selber ein paar Kühe und Geissen. Ich half beim Eintreiben der Gusti. Den Geissen streute ich Salz in die Leckrinne. Am Abend trieb ich sie in den Stall. Jeder gab ich einen Namen. Hörndligödu, hiess eine. Dem Trudi hatte ich in der Küche zu helfen. Zum Einkaufen schickte es mich ins kleine Lädeli beim Schwefelberg-Bad. Im Heuet galt es, die Börter abzurechen oder das Heu auf die Tragnetze zu schichten. Niederhäuser Werner zog dann die Netze zusammen, schwang sich die schwere Bürde auf den Rücken und trug sie auf die Heubühne. Das Leben in der Sennhütte kam mir wahrhaft alternativ vor. Doppelstöckige Verschläge im winzigen Stübli dienten als Betten. Das gewaltige Rauchkamin über der Feuerstelle war offen, man sah direkt in den Himmel. Das Plumpsklo, um zwei Mistlöcher herum auf einem Sumpfweglein zu erreichen, stank gewaltig. Wen wunderts, dass mich armes Büblein heftige, ja, sehr heftige Längizyti marterte? Wie oft stand ich abends auf dem Läubli, hörte von den Weiden ringsum ungezählte Glocken und Treicheln herübertönen und blickte wehmütig zur Schüpfenfluh. Hinter diesem Horeb, weit im Norden, vermutete ich meiner Heimat Haus. Niemand vermochte das Weh zu mildern, weder Trudi noch die lieben Geissen noch mein Lieblingsplätzchen, hinter einem mächtigen Steinblock, wo ein paar dunkelblaue Enzianen blühten. Endlos schienen mir diese furchtbaren Ferien zu dauern. Einmal, beim Heuen war es, fühlte ich mich besonders elend. Wie sich bald einmal herausstellte, war der Schmerz nicht bloss seelischer Art. Am Abend hatte ich Fieber. Vor Schmerzen vermochte ich das Essen kaum zu schlucken. Trudi eilte ins Schwefelberg-Bad und holte den Kurdoktor. Da sass er nun bei mir im Gaden, ein alter, vornehmer Herr, mit weissem Bart und Zwicker. In väterlichem Ton verkündete er, ich sei vom Ohremüggeli (Mumps) befallen. Nun ist es schon im trauten Daheim kein Schleck, krank zu sein und Schmerzen zu leiden. Wie viel schlimmer in der Fremde, auf hohem Bettgestell mit Strohsack liegend, in einem dunklen Gaden, der sorgenden Mutter beraubt! Schier unerträglich würgte mich das Heimweh. Sobald die Fieber nachliessen, holte mich Mutter nach Hause. Sie verpackte mich gut und schleppte mich zum Postauto. Was für ein eine Freude, endlich wieder daheim zu sein! Hier schien alles vertraut und schön. Und so sauber. Ich fragte, ob sie kürzlich eine grosse Putzete veranstaltet hätten. Gleich nach der Ankunft rannte ich überall herum, um das Zuhause richtig in Besitz zu nehmen. Doch das bekam mir nicht. Ich erlitt tags darauf einen schweren Rückfall. Unser ehrwürdiger Doktor Müller aus Laupen machte ein besorgtes Gesicht. Nur mit Glück kam ich um eine Hirnhautentzündung herum. In den folgenden Jahren verspürte ich nie mehr brennende Gelüste, die Ferien im Stierenmoos zu verbringen.
Wenn das Heugras hoch stand und das Wetter sicher schien, spannte der Karrer zwei unserer vier Pferde vor die Mähmaschine. Im dichten, vom Tau nassen Heugras schnitt er Mahd um Mahd, bis der letzte Stängel gefallen war. Später tat der Rapid-Motormäher dasselbe Werk. Er wurde von meinem Vater bedient. Bei besonders sicherem Wetter, wenn grosse Flächen gemäht werden sollten, waren sowohl Motormäher wie Pferdemähmaschine im Einsatz. Börter und Ränder wurden mit der Sense gemäht. Kein Büschel sollte verloren gehen. Damit die Sensen gut schnitten, wurden sie gedengelt. Auf einem grossen Stein war ein Eisen einzementiert. Darauf legte man die Schneide der Sense und klopfte sie mit dem Dengelhammer scharf. Noch heute höre ich das rhythmische Tok Tok Tok des Dengelhammers und verbinde in der Erinnerung dieses Geräusch mit dem Duft und dem Licht eines klaren, warmen Sommermorgens. Wenn die Jumpfer die Küche aufgeräumt, der Erdknecht die Heuwagen vorbereitet und der Melker die Arbeit im Stall beendet hatte, zogen alle mit der geschulterten hölzernen Heugabel aufs abgemähte Feld. Sie alle, dazu der Vater, die Schwestern und der Bruder nahmen, schön in einer Reihe, Mahd um Mahd in Angriff und verzetteten das schwere Gras. „Worben“ nannte man diesen Arbeitsgang. Vom hoch willkommenen Znüni (süsser und saurer Most, Brot, Käse) wurde das Worben unterbrochen. Oft dauerte diese Arbeit bis gegen Mittag. Nach dem Essen zog die ganze Schar aus, um das am Vortag gemähte Heugras zu wenden. An Spitzentagen schlossen sich einige Taglöhner an, Hänni Kari zum Beispiel, Bieri Miggu und dessen Vater Gottfried. Die lange Reihe arbeitete sich durch die Heumatte, hin und zurück, hin und zurück, bis die Arbeit getan war. Jetzt, bei der grössten Hitze, begann das „Eintun“ des zweitägigen, knisternd dürren und wunderbar duftenden Heus. Zunächst wurde das Heu in hohe Walme zusammengestossen. Dann teilten sich die Arbeitskräfte. Je zwei Ries begannen zu laden. Die beiden Wagen wurden je mit einem Pferd bespannt und zwischen die Walme gefahren. Die kräftigsten Männer steckten das Heu an die Gabel hoben es auf den Wagen, wo der Lader stand und das Heu kunstvoll schichtete. Er kam tüchtig ins Schwitzen, wenn die beiden Gabler flink waren. Je zwei Frauen oder Kinder sorgten mit ihren Schlepp-Rechen dafür, dass hinter dem Wagen kein Heubüschelchen verloren ging. War ein Fuder fertig geladen, reichte man dem Lader den Bindbaum hinauf. Der wurde vorne ins „Vürgstütz“ gesteckt und hinten mit einem Seil umschlungen. Dann galt es, dieses so genannte Wellenseil zu spannen. Eine bewegliche Welle hinten am Wagen diente dazu. Darin waren Löcher ausgespart. In diese Löcher wurden Holzpflöcke, „Scheiteln“, gesteckt und die Welle so lange gedreht, bis das Wellenseil fest angespannt war. Trotzdem kam es vor, dass die Heufuder ins Wanken gerieten. An Hängen mussten deshalb die Gabler mit ihren Werkzeugen das Fuder stützen. Wenn ein Fuder trotzdem umkippte, was allerdings selten geschah, gereichte dies nicht zur Ehre des Laders. Der Ärmste wurde noch den ganzen Tag über ausgeföppelt.Das fertig geladene Fuder wurde von meiner Mutter mit zwei Pferden heimgeführt. Mit Hü und Ho rissen die Pferde die volle Fuhre auf der Rampe hoch und donnerten mit ihren Hufen auf die Holzplanken der Einfahrt. Dort kamen Mutter die Ablader zu Hilfe und griffen beim Ab- und Anspannen zu. Mutter führte einen leeren Wagen aufs Feld zurück, wo das Spiel wieder neu begann. Auf dem Söller rollte man das Fuder zum Heustock. Ein Mann reichte Gabel um Gabel auf die „Brügi“, einen im Gebälk hängenden Holzsteg, der vom Söller bis zuhinterst über den Heustock reichte. Ein flinker Bursche – später hatte ich diese Ehre – schob die Heuhaufen auf der Brügi dorthin, wo der Verteiler sie haben wollte. Dieser stand auf dem Heustock und hatte dafür zu sorgen, dass das Heu gleichmässig verteilt wurde. Wir nannten diese Tätigkeit „fullen“. Unvergesslich bleibt mir der würzige Duft des frischen Heus. Wie eine betäubende Wolke erfüllte er die ganze Scheune.Damit alles reibungslos ablief, waren mindestens vierzehn Arbeitskräfte nötig. Deshalb war an einem strengen Tag im Heuet das hinterste Bein eingespannt. Als kleiner Junge, der sonst noch zu nichts zu gebrauchen war, oblag mir das Führen der Pferde während des Ladens. Waren die Heuwalme längs des Wagens aufgeladen, rief ich dem Lader zu „häb di“, gebot den Pferden „Hüh“ und fuhr eine Wagenlänge vor. Zwischenhinein hatte ich mit einem Zweig oder einem Rossschwanz den Pferden die Bremsen abzuwehren. Trotz stinkendem Bremsenöl und trotz rauchender Kessel, die vorne an der Deichsel befestigt waren, surrten die Bremsen in Schwärmen um die armen Pferde. Natürlich piekten sie auch mich gelegentlich in die nackten Waden. Das Schönste in diesen strengen Tagen war natürlich das Zvieri. Da durfte man sich an einem Schattenplätzchen eine Viertelstunde Ruhe gönnen. Alle sassen rund um den Zvierikorb, verzehrten Käse und Brot und löschten ihren Durst mit heissem Milchkaffee. Früher gab es süssen und sauren Most. Doch Kaffee, so glaubte man und behauptete meine Mutter, lösche den Durst wirksamer. Auch der Feierabend besass seinen Reiz. Wenn das Abendessen vorüber und alles aufgeräumt und für den morgigen Tag vorbereitet war, standen die Männer am Brunnen und wuschen sich prustend Staub und Schweiss vom Leib. Die Jumpfern sassen in sicherer Entfernung, damit sie nicht angespritzt werden, aber doch mit dem Mannenvolk schäkern konnten. Es wurde viel gelacht und hin und her geneckt. Mich hatte man bereits ins Bett gesteckt. Doch an Schlaf war nicht zu denken. Ich kletterte im Nachthemd auf den Fenstersims. Durch die Schlitze der Jalousien beobachtete und belauschte ich die Szene und lachte oft mit, selbst wenn ich den genauen Grund eines Gelächters nicht verstand.
Das Klima im Tälchen des Forstbaches war und ist rau. Kirschen konnten nicht gedeihen. Umso günstiger für diese köstlichen Früchte ist das Plateau von Mauss, oberhalb von Gümmenen. Dort lebte Tante Lina, die älteste Schwester meiner Mutter. Die Familie hiess Herren, aber man nannte sie Heiri’s. Tante Lina war eine korpulente Frau mit merkwürdig grossen Glotzaugen. Von Onkel Ernst bleibt mir nur eine physiognomische Eigenheit in Erinnerung. Seine schlaffen Wangen und die mächtige Unterlippe hingen so im Gesicht, als gehörten sie gar nicht dazu. In der Kirschenzeit waren Heiris sehr froh, wenn wir ihnen bei der Ernte halfen. Meistens war der Heuet vorbei und die Getreideernte stand noch bevor. So delegierte Vater eine stattliche Delegation nach Mauss. Der Melker, der Karrer, Chrigu, oft auch der Vater und Werner halfen, die grosse Menge Kirschen zu bewältigen. Ich durfte sie begleiten, auf den Bäumen herumklettern und nach Herzenslust Kirschen essen. Mächtige Leitern, zum Teil mit dreissig und mehr Seigeln, ragten in die riesigen Kirschbaumkronen hinauf. Die Männer pflückten um die Wette. Die Frauen sortierten die Kirschen und füllten sie in kleine Körbe ab. Die wurden auf dem Markt in Bern verkauft. Als Belohnung für geleistete Arbeit durften wir am Abend einen Korb Kirschen nach Hause mitnehmen. Meist fuhr unsere Delegation mit Ross und Berner Wägeli. Besonders glücklich war ich, wenn ich mit Vater auf dem Töff, einem alten BSA, fahren durfte. Werner sass hinten auf dem Soziussitz. Ich durfte vorne auf dem Treibstofftank Platz nehmen. Bei Heiris fühlte ich mich nie ganz wohl. Lag es daran, dass Tante Lina so unförmig dick war? Oder an der Cousine Greti? Die war „nicht normal“, wie wir zu sagen pflegten. Sie geisterte beständig im Haus herum, redete nicht und hatte einen merkwürdig abwesenden Blick. Besonders zuwider war mir die Prozedur, der ich am Ende jedes Kirschentages unterzogen wurde. Vor der Heimfahrt packte mich Tante Lina und schleppte mich zum Brunnen. Dort hing ein ursprünglich wohl weisser, vom vielen Gebrauch jedoch unappetitlich grau gewordener Waschlappen. Mit dem versuchte die Tante, meinen Kirschenmund wieder blank zu polieren. Wie ich diese erniedrigende Wascherei doch hasste! Umso schöner war es aber zu Hause, am Abend eines Kirschentages. Alle sassen um den Küchentisch und entsteinten Kirschen – mit einer in einen Korken gesteckten Haarnadel. Dazu wurden Geschichten erzählt. Mutter stand am Herd. Sie organisierte die Arbeitsabläufe und kochte Konfitüre und Einmachkirschen.
Trügerisch ist des Menschen Gedächtnis. Obschon es im Herbst häufig zu regnen pflegt, erinnere ich mich fast nur an goldene, warme Herbsttage. Beim Hüten im Moos brieten wir Äpfel und sassen müssig am Waldrand, währenddem die Jungviehherde friedlich graste. Über abgeerntete Äcker strich der würzige Geruch verbrannter Kartoffelstauden. Die Wälder begannen sich zu färben und leuchteten herrlich im Sonnenschein. Die Obstbäume waren voll behangen mit roten, gelben Äpfeln und blauen Zwetschgen. Vor der Dämmerung zogen silberne Nebelschleier über die Niederungen. Welche Buntheit, welche Lust des Lebens! Im Herbst galt es zu ernten, was das Jahr beschert hatte. Die Äpfel wurden abgelesen. Bloss ein kleiner Teil wurde verkauft. Einige Berner Familien bezogen jeden Herbst Kartoffeln und Äpfel. Mit Ross und Wagen brachte der Karrer die bestellte Ware nach Bern. Die meisten Äpfel wurden eingekellert. Auch das Fallobst wurde verwertet. Man sammelte es in Körbe und Harrassen, bis Herr Rüfenacht mit seiner fahrbaren Mostpresse erschien. Korb um Korb wurde das Fallobst in den Rachen der imposanten Maschine geschüttet. Es tuckerte und klapperte mächtig. Die Früchte wurden in kleine Stücke zerteilt und gepresst. Unten lief der süsse Saft in grosse Zuber. Von dort kam der Most in grosse Korbflaschen, wo er mit Tauchsiedern sterilisiert wurde. Garten und Pflanzplätz wurden geräumt. So viel Gemüse als möglich wurde eingekellert und in Sandbeeten gelagert. Der Kohl wurde in eine Stande gehobelt, gesalzen und als Sauerkraut konserviert. Viel Arbeit brachte die Kartoffelernte. Mit dem Kartoffelgraber, vor den zwei Pferde gespannt waren, wurde eine Furche mitsamt Kartoffelknollen, Steinen und Erde zur Seite geschleudert. Die Helfer sammelten die Kartoffeln in Körbe. Ein Korb enthielt die grossen Kartoffeln. In den zweiten Korb warf man die kleinen und beschädigten Erdfrüchte. Sie waren für die Schweine bestimmt. Die vollen Körbe wurden in eine Bänne oder in Säcke entleert. Es war eine mühsame Arbeit. Die gebückte Haltung bereitete vielen Helfern Mühe. Für mich jedenfalls war die Kartoffelernte keine Freude.Ganz anders und viel gemütlicher verhielt es sich mit den Runkelrüben. Mit einer Schippe entfernte Vater das Laub. Wir Buben rissen die Runkelrüben aus und warfen sie an grosse Haufen. Am Nachmittag versammelte sich alles um diese Haufen. Männer und Frauen sassen auf Holzkisten oder Schemeln. Mit hölzernen Messern säuberten sie die Runkeln und warfen sie auf einen neuen Haufen. Bei dieser gemütlichen Tätigkeit liess es sich herrlich plaudern. Frau Hänni und Frau Aeschbacher kannten die neuesten Klatschgeschichten. Liebschaften, künftige Heiraten, Familienfehden, Unfälle und Verbrechen kamen ebenso zur Sprache wie Gespenstergeschichten. Manchmal waren die Erzählungen derart spannend, dass die Hände unwillkürlich ruhten. Vater warf dann einen strengen Blick herüber. Das genügte meistens, um uns wieder in Bewegung zu setzen. Abends luden wir die geputzen Runkeln in Brügiwagen. Zu Hause liessen wir sie in einem Holzkännel in den Stöcklikeller rollen.
Anfangs Oktober ging die Jagd auf. Ich betrachtete die Jäger mit einer Mischung aus Abneigung, Furcht und Bewunderung. Auf alle Fälle brachte die Jagdsaison zusätzliche Spannung in mein Leben. Wenn im Wald die Jagdhunde kläfften, Jagdhörner schallten und Schüsse krachten fand ich das romantisch, aufregend. „Da ist die Jägerei, da ist das Schiessen frei!“ Allerdings kam mir immer wieder Bambi in den Sinn. Dieses wunderbare Werk von Felix Salten war - mit Abstand - mein Lieblingsbuch. Ich identifizierte mich voll mit Bambi, Geno, Faline und dem „Alten“, dem geheimnisvollen Haupt der Rehfamilie. Deshalb empfand ich die Jäger als Barbaren. Manchmal streiften sie mit ihren Hunden durch Runkeläcker und Kleefelder, auf der Suche nach Hasen. Wenn ein Hase die Gefahr früh genug erfasste und in rasendem Tempo davon pfeilte, verspürte ich reine Schadenfreude.
Zum Thema Bambi gehört noch die folgende Episode. Kurze Zeit nachdem ich die beiden Bände „Bambi“ und „Bambis Kinder“ verschlungen hatte, wurde in der Zeitung angekündigt, in Bern werde ein Bambi-Film von Walt Disney gezeigt. Wie freute ich mich, als sich Mutter bereit erklärte, mit mir ins Kino zu gehen. Erwartungsvoll sass ich im Plüschsessel des „Splendid“. Doch wie abgrundtief war meine Enttäuschung, als der Film anlief. Statt eines richtigen Rehleins erschien auf der Leinwand ein grossköpfiges künstliches Wesen, das einen mit grossen blöden Augen anglotzte und mit einer ebenso blöden piepsigen Stimme sprach. Alles war nur gezeichnet. Von richtigem Wald und richtigen Tieren keine Spur. Ich fand diesen Film unerträglich, geradezu lästerlich.

Farm der Tiere
Was es doch auf einem Bauernhof für Tiere gab, damals jedenfalls – fast so viele wie in der Arche Noah!
20 Kühe, ein Muni, 10 Gusti und Rinder und Kälblein standen im Stall. Diese kamen vor allem im Winter zur Welt. Einige Kuhkälbchen wurden zur Aufzucht behalten. Die Stierkälber gingen an die Metzger Reber in Bümpliz oder Zingg in Mühleberg. Für jedes verkaufte Tier musste man beim Kreisinspektor der Viehversicherung einen sogenannten Schein holen. Dieses Amt hielt Moser Alfred unter der Fluh inne. Mir oblag die Pflicht, diese Scheine zu holen. Das geschah ungern, aus verschiedenen Gründen. Meistens wurde man mitten im Spielen abkommandiert. Das war ärgerlich. Sodann bot auch der Weg Unannehmlichkeiten. Bei Mäders Hof vorbei wagte man sich nicht, wegen des Hundes. Es blieb einem nur übrig, den Waldweg einzuschlagen. An Winterabenden, wenn es früh einnachtete, war das wahrhaftig kein Schleck. Um die Angst zu vertreiben, pfiff oder sang ich im dunklen Tannenwald. So war das unheimliche Knacken und Rascheln weniger deutlich zu hören. Moser Alfred war meist beim Melken, wenn ich aufkreuzte. Ich musste dann am Stalleingang warten, bis er unter einer Kuh hervorgekrochen war, das Milchkesseli in die Kanne geleert und beim Brunnen die Hände gewaschen hatte. In der Stube, wo ich mich auf die Kante des Trittofens setzte, öffnete er bedächtig den Sekretär, nahm den Block mit den Formularen hervor und fragte: Für was? Ich sagte mein Verslein auf, zum Beispiel: Für ein dreiwöchiges Munikalb, falbblöschet (oder rottschägget) für ga Bärn. Bis Moser Alfred mit seiner verschlungenen Schrift die paar Worte auf das Formular gekritzelt hatte, sehr bedächtig und sehr exakt, schien es mir, ich hätte zwei Aufsätze geschrieben. Unter Hinterlassung von zwei Franken durfte ich schliesslich das Lokal verlassen und heimwärts laufen – wieder durch den unheimlich dunklen Wald. Unter den Kuhkälbern, die der Vater behielt (man nannte sie Abbruchkälber) erwählte ich mir stets einen Liebling, das Chutschi. Dem gab ich am liebsten den Milchkessel mit dem eingebauten Sauger. Im Herbst, beim Hüten, wurde das Chutschi nach Möglichkeiten gehätschelt und verwöhnt. Während der Herbstferien war man täglich mehrere Stunden mit den Kälbern und den Gusti zusammen. Man lernte den Charakter jedes Tieres kennen und schloss sie mehr oder weniger ins Herz.
Ein Nachmittag im Spätherbst ist mir in schlimmer Erinnerung geblieben. Das Gras im Moos war abgeweidet. Ich hatte meine Herde aufs Feld hinter das Gehöft des Nachbarn zu treiben. Es war kalt, die schwarze Bise strich übers Land. Der Klee auf der Wiese, dazu der austrocknende Wind waren gefährlich für die Tiere. Ich achtete genau auf ihr Verhalten. Als ich erste Anzeichen von Blähungen festzustellen meinte, lief ich sofort nach Hause und meldete es. Vater liess sich nicht aus der Ruhe bringen. Es werde kaum so schlimm sein, meinte er. Würden die Anzeichen noch deutlicher, solle ich die Herde halt nach Hause treiben. Wieder auf dem Feld stellte ich fest, dass mehrere Gusti mit Fressen aufgehört hatten und ihre Bäuche schon sehr deutlich aufgebläht waren. Ich geriet in Panik und trieb die Rinder heimwärts. Doch war es für eines der Tiere bereits zu spät. Noch auf dem Heimweg stürzte es um, was einem Todesurteil gleichkam. Vater eilte herbei und konnte dem verendenden Tier nur noch den Gnadenstoss geben. Die andern Rinder erreichten mit Mühe den Stall. Drei waren derart gebläht, dass Notmassnahmen unumgänglich wurden. Mit dem sogenannten Stachel befreite der Vater zwei von dem gefährlichen Druck. Dieses spitze Instrument wird direkt in den Pansen gestochen. Der Stachel wird zurückgezogen, seine Hülle bleibt stecken und bildet einen Kanal, durch den die gefährlichen Gase entweichen können. Beim dritten Gusti nütze nicht einmal das Stechen. Mit einem scharfen Messer musste der Vater das Tier aufschlitzen, in sein Inneres hineingreifen und einen Teil des gärenden Mageninhalts herausnehmen. Der Stall war erfüllt vom Gestank der giftigen Gase. Natürlich hörte ich keinen Vorwurf, im Gegenteil. Trotzdem erschütterte mich das Erlebnis zutiefst. Tröstlich war für mich nur, dass die beiden gestochenen ebenso wie das geschlitzte Tier die schlimme Prozedur überstanden.
Ab und zu leistete ich in den Kuhställen kleinere Arbeiten. Zum Beispiel half ich am Morgen gelegentlich, die Kühe zu striegeln oder, zur Vorbereitung des Melkens, „anzurüsten“. Das Euter und die Zitzen mussten vor dem Melken gereinigt und gut massiert werden, damit die Milch leicht zu fliessen begann. Das richtige Melken habe ich nie gelernt. Jeden Abend und jeden Morgen wurden die Kühe aus dem Stall zum Brunnen getrieben. Im leeren Stall streute der Melker frisches Stroh. Beim Brunnen musste jemand für Ordnung sorgen. „Zuchewehre“, nannten wir das. Eine Arbeit, die ich gerne übernahm. Dabei lernte man Charakter und Namen der Kühe kennen. Im Stall hing zu Häupten jeder Kuh ein schwarzes Täfelchen. Darauf hatte Vater mit weisser Farbe und in kunstvollen gotischen Buchstaben ihre Namen geschrieben: Blum, Spiegel, Freude, Stern, Blösch. Im vorderen Stall an den hintersten Plätzen standen zwei uralte, falb geblöschte Tiere: Pfau, dessen Hörner halbrund nach unten gewachsen waren, und Ursi, ein kleines, eckiges und gutmütiges Tier. Jeden Frühling durften die Kühe auf die Weide. Mein Vater war der einzige Bauer weit und breit, der diese Praxis eingeführt hatte. Ich freute mich sehr auf diese Tage. Besonders lustig anzusehen war es, wie die Kühe am ersten Tag Kapriolen machten. Sie rannten umher, vollführten Sprünge und zeigten aller Welt, wie sehr sie den Frühling begrüssten und wie gern sie sich auf einer saftigen Wiese tummelten. Am zweiten Tag ging schon alles ruhiger zu und her. Da konnte man es wagen, die Glocken vom Estrich zu holen und den Kühen umzuschnallen. War das erhebend, dieses Herdengeläute! Und wie freute ich mich für die schönste Kuh, welche die grösste Glocke tragen durfte!
In der Regel wurde auch der Muni auf die Weide getrieben. Vor ihm musste man sich jedoch in Acht nehmen. Sobald er den Kopf senkte und zu brummen anfing, wurde es ungemütlich. Ich bewunderte den Melker, der mit den massigen Burschen scheinbar ohne Furcht umzugehen verstand. 1939 fand in Zürich eine Landesausstellung statt. An dieser „Landi“ wurde das Schweizertum und die nationale Folklore besonders gefeiert – kein Wunder, angesichts der nationalsozialistischen Bedrohung. Die ganze Schweiz pilgerte nach Zürich, auch meine Eltern. Just am Tag ihres Landi-Besuchs war die Praktikantin allein zu Hause. Das Brüllen einer Kuh schreckte sie auf. Als sie im Stall nachschaute, sah sie, dass sich der Muni von der Kette befreit hatte und im Stallgang stand. Sobald er die junge Frau erblickte, setzte er zum Sprung an. Mit knapper Not konnte sie zur Seite flüchten und sich in der Tenne in Sicherheit bringen. Der Muni setzte mit einem gewaltigen Sprung über die untere Stalltür, die er völlig zertrümmerte. Wie und von wem er schliesslich eingefangen wurde, weiss ich nicht mehr. Auf jeden Fall und zum grossen Glück kam niemand zu Schaden.
Zu den Pferden hatte ich kein enges Verhältnis. Von den vier Rossen waren zwei uralt: der Fuchs, ein schwerer Belgier mit blonder Mähne, und der Freiberger Max. Zwei waren jünger. Richtige Galoppierer oder gar Reitpferde hatten wir nie. Pferde waren zum Arbeiten da, nicht zum Vergnügen. Dabei wünschte ich mir so sehr ein Reitpferd oder mindestens ein Pony. Ein prachtvolles Bild bot sich beim Pflügen (ds Acher fahre). Alle vier Pferde waren vor den schweren Pflug gespannt und legten sich mit voller Kraft in die Stricke. Einmal hatte Vater einen jungen Braunen gekauft. Es zeigte sich bald, dass das Tier krank war. Wildrössig, wie man diese Störung bezeichnete. Kriegte es einen Anfall, etwa alle ein bis zwei Wochen, dann war es einfach nicht mehr zu halten. Es schlug wild um sich, sprang und bockte. Manches Pferdegeschirr, manches Klöbli und sogar schwere Wagen-Deichseln gingen in die Brüche. Einmal hatte das Pferd einen Anfall auf dem Strässchen zwischen Garten und Haus. Es riss sich vom Wagen los und warf sein Hinterteil so weit in die Luft, dass es mit den Hinterhufen ein Brett hoch oben an der Laubenbrüstung zerschmetterte – furchterregend. Das schöne Tier war nicht zu heilen. Es musste schliesslich abgetan werden.
Meinen Kommentar zu den Schweinen will ich kurz fassen. Zugegeben, ein Wurf mit zehn oder mehr rosigen Ferkeln war ganz herzig anzuschauen. Doch im Allgemeinen interessierten mich diese Viecher höchstens in Form von Bratwürsten oder Koteletten. Zweimal im Winter wurde der Störenmetzger bestellt, einmal der Beyeler Ernst, das andere Mal Turla Miggu mit seinem Schwiegersohn, dem Clavadetscher. Das tote Tier wurde in einem riesigen Bottich heiss abgebrüht, so dass man ihm die Borsten abschaben konnte. In der Waschküche zerteilten die Metzger das Schwein. Ein Teil wurde eingepökelt. Hamme und Laffli bereitete man fürs Räuchern vor. Eine Unmenge Fleisch wurde durch die Maschine gedreht und zu Würsten verarbeitet. In der Küche wurde in grossen Pfannen das Schweinefett ausgelassen. Die Überreste wurden herausgefischt und zu „Gröibi“ gepresst – für manche Leute eine Delikatesse. Das flüssige Fett kam in irdene Töpfe. Man bewahrte es im Keller auf und brauchte es zum „schmützgen“ der Speisen, insbesondere der Rösti. In den ersten Tagen nach der Metzgete musste man Blut- und Leberwürste verzehren, bis einem die Ohren wackelten. Sie wollten einfach kein Ende nehmen. Die Bratwürste hingegen, die ich innig liebte, reichten nur für wenige köstliche Mahlzeiten. So ungleich verteilen sich Lasten und Freuden des Lebens!
Nachdem Werner ins Welschland verreist war, hatte ich seinen Posten als Hühnervater zu übernehmen. Das bedeutete, dass ich jeden Mittag die Körner streuen und das Hühnervolk mit sanftem „Chumm Bi-Bi-Bi“ zur Futterkrippe locken musste. Anschliessend sammelte ich die Eier ein. Wenn ich den Kessel halb voll Eier in die Küche brachte, fragte ich jeweils die Abwascherinnen und Abrocknerinnen: „Wie mängs Ei hets?“. Ich freute mich, wenn die wirkliche Zahl höher war als die von den Frauen geratene. Im Sommer durften die Hühner ihren eingefriedeten Hof verlassen und in Hof und Hofstatt nach Futter suchen. Am Abend galt es, das Federvieh wieder einzutreiben, in den Hühnerhof, ins Hühnerhaus. Der Schieber über dem Einstiegssteg musste unbedingt geschlossen werden. Kein Fuchs sollte sich billig Beute holen. Das Hühnereintreiben gestaltete sich manchmal sehr mühsam. Das dumme Vieh konnte einen regelrecht zur Verzweiflung bringen. Was machst du, wenn du die Hühner wohl ein Dutzend mal zum offenen Töri getrieben hast, aber sie verfehlen jedes Mal den Einschlupf und hühnern an der Öffnung vorbei. Einmal von rechts nach links, dann von links nach rechts, und so weiter. Es ist zum Davonlaufen. Einmal, als sich eine Henne besonders blöd anstellte, packte mich die Wut. Ich ergriff einen Stein und schleuderte ihn mit aller Kraft – und mit ungewollter Treffsicherheit, wie sich gleich herausstellte. Das Huhn zwirbelte nämlich zwei, dreimal rund herum, schlug mit den Flügeln und blieb dann liegen – mausetot. Wie die Verbrecher aller Zeiten folgte ich dem Urinstinkt: ich versuchte, die Spuren so schnell wie möglich zu verwischen. Nachdem ich mich versichert hatte, dass mich niemand beobachtete, warf ich die tote Henne auf den Miststock und schichtete einige Gabeln Mist darüber. Die Untat ward nie entdeckt. Es fand sich kein guter Hirte, der dieses eine verlorene der hundert Hühner gezählt oder gar gesucht hätte! Ab und zu vergnügten wir uns damit, die Hühner zu hypnotisieren. Man nahm sie in den Arm, streichelte sie beruhigend und legte sie auf die Terrasse. Kopf und Schnabel wurden sanft niedergedrückt. Dann zog man mit einer Kreide vor dem Schnabel einen geraden Strich und liess die Henne los. Sie verharrte minutenlang vollständig unbeweglich. Erst wenn man sie erschreckte oder ihren Kopf bewegte, stand sie auf und stelzte langsam davon.
Meine Karriere als Kaninchenhalter dauerte nur kurze Zeit. Mir war es schrecklich zuwider, regelmässig den Chüngelstall auszumisten. So hatten meine Tiere keinen besonders schönen und vor allem keinen hygienischen Lebtag. Ohnehin hielt man die Tiere bloss, um sie schliesslich zu metzgen. Dies besorgte auf meine Bitte jeweils der Melker. Die Mutter zahlte mir für jeden Chüngelbraten ein paar Franken ins Sparkässeli. Das aber war der allereinzige Vorteil der Kaninchenhaltung. So gab ich diesen Betriebszweig schon bald wieder auf.
Mein Bruder hielt sich während einiger Zeit Tauben. Auch ihm verleidete es eines Tages. Er machte mir das Angebot, wenn ich die Tauben auf dem Markt in Bern verkaufe, dürfe ich den Erlös behalten. Ich nahm das Angebot dankbar entgegen. Die Tauben wurden in eine Kiste gepackt und auf den Gepäckträger von Werners Velo geladen. Das lieh er mir aus, weil ich damals nur einen uralten Rücktritt-Göppel besass. Er hingegen verfügte über ein wunderbares Dreigang-Rad. Frohgemut pedalte ich gen Bern und stellte mich zuunterst in der Kesslergasse in die Laube. Nach kurzer Zeit erschien der dicke, stumpenrauchende Marktpolizist und knöpfte mir eine Gebühr von einem Franken ab. Ich wartete lange, sehr lange auf Kundschaft. Selten einmal warf jemand einen Blick in meine Kiste, machte ein paar überflüssige Bemerkungen und zog wieder seines Weges. Gegen Mittag kaufte mir ein jüngerer Mann eine Taube ab, zum Preis von 80 Rappen. Von den übrigen Tauben konnte ich kein einziges Stück verkaufen. So beschloss ich meine Karriere als Marktfahrer und Taubenverkäufer. Ich lud die Kiste wieder aufs Velo und fuhr heim. Nicht genug mit der Enttäuschung. Zu Hause trieben sie noch ihren Spott mit mir. Hättest du die Tauben in Bern wenigstens fliegen lassen und nicht heimtransportiert! So hänselten sie mich.
Als mein Vater eines Tages vom Thun-Märit nach Hause kam, legte er eine Schuhschachtel auf den Küchentisch. Wir öffneten – und waren entzückt. In der Kiste lag ein winziges, allerliebstes Hündchen, schwarz mit einem weissen Bless. Wir nannten das Tierchen „Bäri“ und schlossen es alle ins Herz. Ich wurde sein besonderer Freund, bemutterte und bevaterte ihn und, als er grösser geworden, begann ich ihn zu dressieren. Ein Pfiff – er musste herkommen. Die erhobene Hand bedeutete: sitzen bleiben bis zum Gegenbefehl. Und so weiter. Unzählige Stunden verbrachte ich mit dem Hund. Besonders wichtig war für mich später, dass sich Bäri zum ausgezeichneten Viehtreiber entwickelte. Geschickt umkreiste er die Herde und trieb sie an den gewünschten Ort. Nur eine Unart widerstand hartnäckig allen Erziehungsbemühungen. Wenn er die Kühe zusammentrieb, hängte er sich oft an deren Schwänze und liess sich von den erschreckten Tieren ziehen. Bäri war ein aufmerksamer Wächter. Ohne aggressiv zu sein, zeigte er mit seinem Bellen die Annäherung jedes fremden Menschen an. Dieses durchaus natürliche Lautgeben war nicht allen Leuten angenehm. Ein Hausierer, der sich einmal ohne Verkaufserfolg auf den Weiterweg begeben musste, schimpfte beim Fortgehen vernehmlich: „Frommi Sprüch hei si a de Hüser - u bissigi Hünd.“
Während des Krieges hielten wir ein paar Schafe. Etwa zwei Mal warf das weisse Mutterschaf zwei Lämmchen. War das köstlich, wenn die miteinander spielten und einander nachjagten! Nach der Schur wurde die Wolle zum Reinigen geschickt. Zu Hause spannen meine Schwestern mit dem altehrwürdigen Spinnrad dicke Wollfäden, die zu Pullovern und Jacken verlismet wurden. Wunderbare Wärmespender waren das, dicke und bleischwere Panzer gegen die Kälte.

Fantasiewelten
Dass mich die Geschichten vom Osterhasen und vom Samichlaus nur mässig interessierten, habe ich bereits erwähnt. Der kindliche, vom Landleben geprägte Realitätssinn erschwerte schon früh den Glauben, der Osterhase könne Eier legen. Dafür hielt man sich doch die liebe Hühnerschar. Das Eierfärben besorgte meine Mutter. Wie hätte das ein Hase mit seinen Pfoten auch leisten können? Wenn man die Erwachsenen fragte, wo denn der Samichlaus zu Hause sei, antworteten sie manchmal: Ds Nienefinge im Chutzewald im Kanton Suechguet. Diese Lügenantwort durchschaute ich bald einmal.
Meine Fantasie trieb ihre Blüten auf ganz andern Feldern. Kinder, so sollte man meinen, lebten einfach in den Tag hinein und seien sich der Vergangenheit nicht bewusst. Noch viel weniger der Vorvergangenheit. Bei mir war das anders. Ich war nämlich fest überzeugt, schon früher einmal ein Leben auf dieser Erde verbracht zu haben. Lange bevor ich zur Schule ging, behauptete ich steif und fest, schon einmal gelebt zu haben. Ich erinnere mich an diese Geschichte nur vage. Meine Schwestern sind jedoch Ohrenzeugen. Sie erzählten mir später immer wieder von diesen Fantasiegeschichten. Als Knirps musste ich beim Kartoffeln auflesen noch nicht mithelfen. Dafür unterhielt ich sie mit meinen Erzählungen. Mein früheres Leben hätte ich in Russland verbracht, in einem Haus in der Nähe eines Sees, in einer weiten Landschaft. Ich und meine Angehörigen seien Jäger und Bauern gewesen. Woher diese Vorstellungen kamen? Ich weiss es nicht. Eigenartig ist allerdings, dass ich während meines ganzen Lebens mich brennend für Russland interessierte – für die Geschichte, für die Sprache, für die Literatur, für die Menschen. Ob wohl auch mein virtueller Freund Paleschimas mit dieser Geschichte zu tun hatte? Sein Name klingt jedenfalls eher slawisch als deutsch.
Die Abgeschiedenheit unseres Bauernhofes hatte zur Folge, dass ich mit Gleichaltrigen kaum Kontakt hatte. Meine Geschwister waren acht und mehr Jahre älter, der Nachwuchs in der nächsten Nachbarschaft sogar noch mehr. So war ich bis zum Schuleintritt ohne Kontakt mit Kindern. Aber was tats. Brachte die Natur keine Spielgefährten hervor, besorgte das halt meine Fantasie. Ihr entsprossen zwei gesunde Knaben. Einer hiess Walti. Von ihm sind mir nur noch blasse Erinnerungen geblieben. Umso lebendiger ersteht vor meinem innern Auge der andere Bruder im Geiste – Paleschimas. Ich sehe ihn noch heute vor mir. Paleschimas hatte blondes, kurz geschnittenes, borstiges Haar, Sommersprossen und ziemlich weit abstehende Ohren. Zu kurzen blauen Turnhosen trug er ein quer gestreiftes Leibchen – blau/rot/weiss, sofern das Weiss nicht unter dem Schmutz verschwand. Mit Paleschimas spielte, stritt und sprach ich jeden Tag. Er half mir, wenn ich vier Stecklein in die roten Bäuche von Berner-Rosen-Äpfel steckte und derart einen ganzen Stall voller Kühe erschuf. Oben im Holzschopf standen die in Reih und Glied. Wir molken, misteten und trieben die Herde auf die hölzerne Weide. Alle paar Tage bauten wir neue Ställe. Manchmal brachten wir eine Kuh zum Metzger. Das hiess: sie landete in unserem Magen. Mit Paleschimas kroch ich ins Stroh, grub dort geheime Gänge, baute Burgen und Ausgucke, die uns erlaubten, das Treiben der Hofbewohner zu beobachten, ohne selber gesehen zu werden. Hie und da wurde uns dieses Ausgucken ein wenig peinlich, etwa damals, als der Melker unter unsern Augen nichtsahnend den Hosenlatz öffnete, den ansehnlichen Zipfel hervorkramte und sein Wässerchen abschlug. Zuweilen heckten Paleschimas und ich auch Schelmenstreiche aus, harmlose allerdings, wenn man sie mit den schlimmen Taten heutiger Jugendlicher vergleicht. Da war zum Beispiel die Sache mit der Essensglocke. Sie hing im Gebälk in der Scheune. Mit einem Drahtzug liess sie sich zum Schwingen und Klingen bringen. Sobald die Mahlzeiten bereit waren und die ganze Belegschaft des Hofes zu Tische sollte, zog meine Mutter, eine der Schwestern oder eine Jumpfer (Magd) am Glockenzug. Nun waren Paleschimas und ich eines Tages aufgebracht über irgend jemand oder irgend etwas. Aus Rache beschlossen wir, den normalen Gang der Dinge zu stören. Genau gesagt: zu verhindern, dass die weithin hallende Glocke überhaupt gehört werden konnte. Wir umwickelten den Klöppel der Glocke sorgfältig mit alten Lappen. Von unserem Versteck aus beobachteten wir mit Vergnügen, wie sich die Jumpfer bemühte, das Mittagessen einzuläuten. Alles Ziehen, Zerren und Schimpfen war umsonst. Die Glocke gab keinen Ton von sich. Vermutlich wird das Mittagessen trotz dieser Verschwörung stattgefunden haben. Verdächtigt wurde natürlich ich. Paleschimas traute man solche Streiche nicht zu.
Meine Zukunftsfantasien waren recht präzise. Ich beabsichtigte, einen sinnvollen und kontrastreichen Doppelberuf auszuüben. Kunstmaler und Jäger wollte ich werden. Beides reizte mich offenbar: das Schweifen durch Feld und Wald, und das künstlerische Gestalten. Ich würde mir ein Häuschen am Waldrand bauen, mit weit ausladendem gemütlichem Dach. In einer Ecke würde ich ein riesiges Schaufenster einbauen lassen. Dort würde ich die Früchte meiner Arbeit ausstellen, nämlich Pelze und Gemälde. Meiner Schwester Madeleine versprach ich grosszügig, sie dürfe mir dereinst den Haushalt führen. Dafür würde ich ihr ab und zu ein Bild oder einen Pelz schenken.
Später, in den ersten Schuljahren, dachte ich häufiger an die nähere Zukunft. Es war Krieg, und da so viele Soldaten an der Grenze Heldentaten vollbrachten, wollte auch ich nicht zurückstehen. Besonders reich blühte meine Fantasie, als ich etwa das vierte Schuljahr besuchte. Es musste doch, im Falle feindlicher Einfälle in die Schweiz, nicht nur die Grenze geschützt werden. Auch unsere engste und daher allerschönste Heimat durfte nicht widerstandslos dem bösen Feind in die Hände fallen. Es galt, sich beizeiten zu organisieren. Zum Beispiel brauchte es für unsern Hof und seine Umgebung einen geeigneten Kommandanten. Wer anders konnte das sein als ich? Diese Wahl war zwingend aus mehreren Gründen. Ich war geschickt in der Schule. Ich war sportlich, gelenkig und ausdauernd. Ich besass hervorragende, bis ins Einzelne gehende Ortskenntnisse. Nun gab es gewiss Menschen, die im einen oder andern Bereich an mich heran reichten. Aber alle die genannten Qualitäten miteinander – die gab es schlechterdings nirgends sonst. Also war absolut klar: ich war der General. Und entwickelte alsbald mein Verteidigungsdispositiv. Zunächst machte ich ein Waffeninventar. Wir besassen folgende Verteidigungsmittel: 1 Schrotflinte, 1 gutes und 1 schlechtes Flobertgewehr. Zur Not konnte man auch mein Luftgewehr taktisch einsetzen. Bei Samis existierte noch ein altes Langgewehr und mindestens ein Flobert, ebenso bei Mäders. Einer von Mäders Buben besass ausserdem eine Pistole. Nun konnte die Mannschaft richtig verteilt werden. Ein Vorposten, mit einem Flobert ausgerüstet, käme ans Waldbord hinter Samis Haus. Einer in die Ecke des Spielwaldes. Kommandozentrale, bestückt mit dem Langgewehr, wäre unser Strohschopf, wo eine breite Dachluke hervorragenden Überblick über das Schlachtfeld böte.
Eine Variante dieser Fantasie sah vor, dass ich General einer Knabenarmee würde. Qualifikation siehe oben. Die Buben wären blau uniformiert, ich sässe hoch zu Pferd und wir kämpften heldenhaft im Raum Forst-, Spiel – und Fluhwald. Diese Rolle malte ich mir besonders genussvoll aus, wenn ich an gewisse Mädchen dachte – das Bethli zum Beispiel, dem ich in der dürren, armseligen Wirklichkeit nur mangelhaft zu imponieren wusste.
Zu ähnlichem Zweck dachte ich mir auch noch andere heldische Taten aus. Da käme zum Beispiel eine Kutsche mit wildgewordenen Rossen. Meine Angebetete sässe auch unter den Todesängste leidenden Passagieren. Zum grossen Glück käme im allerletzten Moment ich, hinge mich nach einem tollkühnen Sprung an die Halfter der wilden Pferde und brächte das Gefährt zum Stehen. Selbstverständlich unmittelbar vor einem grausigen Abgrund. Wie da die Augen meiner heimlich Geliebten leuchten würden! Ein schönerer Lohn war gar nicht denkmöglich.
Ein weiteres Feld, auf dem sich meine Fantasien tummelten, waren die nordamerikanischen Prärien. Deren Bewohner, die Indianer, hatten schon meinen Vater in seiner Jugend fasziniert. Er und ein Schulkamerad tauschten spannende Indianerheftchen aus. Die farbige Titelseite zeigte die Helden, meist den berühmten Buffalo Bill, oder den Lassowerfer Lariat Larry. Die Grossmutter, eine überaus fromme Frau, tolerierte aber diese Lektüre nicht. Deshalb musste Vater die Heftchen verstecken. Irgendeinmal entdeckte ich in seinem Kleiderschrank etwa 20 übriggebliebene Exemplare. Mein Vater hatte nichts dagegen, dass ich mich begeistert hinter diese Lektüre machte. Fortan verwandelten sich die Felder um unsern Hof in eine weite Prärie. Auf unseren Ackergäulen sprengte ich, mit Pfeil und Bogen bewaffnet, über die Ebene, jagte verräterische Rothäute (so hiessen sie leider in diesen Heftchen) sowie ruchlose Banditen. Die Bösewichte hatten meine Freundin entführt. Schon schmachtete sie am Marterpfahl. Doch getrost. Zum Glück kam ja ich und rettete die Schöne vor Marter und Tod.

Originale
Wenn meine Mutter aus ihrer Kindheit erzählte, erwähnte sie allerlei merkwürdige Käuze, denen sie in ihrer Jugend begegnet war. Es schien mir, als habe es damals nur so gewimmelt von ungehobelten, lustigen, ungewöhnlichen und unheimlichen Menschen. Die Originale, von denen ich berichten will, sind wohl ein bisschen weniger exzentrisch. Trotzdem finde ich sie merkwürdig im Wortsinn: des Merkens würdig.
Zuerst will ich vom Bieri Gottfried in der Eggersmatt erzählen. In meiner frühen Jugend pflegte er, zusammen mit seinem Sohn Miggu, in den Zeiten grossen Arbeitsanfalls bei uns zu helfen. Als „Wärchet“ galten die Heu-, die Getreide- und die Kartoffelernte. Später, mit zunehmender Gebrechlichkeit, kam Gottfried einfach zu Besuch. Eine unvergessliche Erscheinung. Sommers und winters erschien er immer in den gleichen, mehrfach geflickten Hosen. Dazu trug er eine Kutte mit langen Rockschössen, die an seiner hageren Figur hinunterhingen wie an einer Vogelscheuche. Er trug immer den gleichen abgeschossenen, hässlichen Hut. Der Mund verbarg sich unter einem weissen Schnauz. Unter den ebenfalls weissen Augenbrauen hervor zwinkerten listige, helle Äuglein. Manchmal trug er ein Notizbüchlein bei sich, wo er sich Witze notiert hatte, die er dann gern zum Besten gab. Wenn man Bieri Grossvater so daherschlurfen oder am Waldrand Reiswellen machen sah, unterschätzte man ihn leicht. Doch aufgepasst! Das schäbig gekleidete Manndli sprach ausgezeichnet französisch und englisch. Bieri Gottfried konnte sehr schlagfertig sein. Er liess sich nicht so schnell etwas vormachen. Des Rätsels Lösung? Er hatte während vieler Jahre im damals vornehmsten Hotel in St. Moritz, dem Carlton, als Portier gedient. Wenn er bei guter Laune war, erzählte er von seinen Erlebnissen. Zum Beispiel von einem steinreichen deutschen Grafen, der jeden Tag Tausend Franken verbrauchen „musste“ – damals, vor dem ersten Weltkrieg, eine Riesensumme! Wenn es ihn ankam, zündete sich der Herr Graf die Zigaretten mit Banknoten an. Vor dem ersten Weltkrieg stiegen Könige und Präsidenten im Carlton ab. Regelmässiger Stammgast war der griechische König mit seiner Familie. Den Prinzen und späteren König Paul musste Bieri Gottfried oft spazieren führen und ihm die Gegend mitsamt der Tierwelt zeigen. Bieri Gottfried kam in der Zwischensaison immer zu seiner Frau in die Eggersmatt. Das kleine Heimwesen hatte er sich mit seinem (vermutlich guten) Verdienst erwerben können. An seiner Beerdigung sprach der Pfarrer über den Unterschied von Sein und Schein. Tatsächlich: Bieri Grossvater hatte es geradezu darauf abgesehen, weniger zu scheinen als er wirklich war.
Ein anderes, eher unheimliches Original war Beyeler Chrigu, der Bruder des Störenmetzgers und Ortswehrkommandanten Beyeler Ernst. Von Beruf war er zwar Wildhüter, aber man sagte ihm nach, er sei der grösste Wilderer weit und breit. Er sei schon öfters gesehen worden, wie er eine Bürde Tannäste zu seinem alten Häuschen auf der Ledi schleppte. Aus dem Tannenreisig sei Blut getropft und habe eine rote Spur hinterlassen. Die meisten Leute fürchteten Beyeler Chrigu. Auf frei herumstreunende Hunde schoss er unbarmherzig, ohne die Besitzer vorzuwarnen. Mehreren Leuten hatte er öffentlich gedroht, er werde sie erschiessen. In alkoholisiertem Zustand, fürchteten viele, wäre ihm dies durchaus zuzutrauen. Wegen solcher Drohungen und anderer Händel kam er mehr als einmal auf dem Schloss Laupen vor Gericht. Im Wilden Westen wäre er wahrscheinlich zum Outlaw geworden.Einmal musste ich einen Botengang auf die Ledi machen. Unter der Fluh verliess ich das Strässchen und nahm eine Abkürzung. Ein steiler, gewundener Pfad führte durch den Wald auf die Höhe. Als ich schon fast oben war, schaute ich aus irgendeinem Grund auf – und fast wäre mein Herz stillgestanden vor Schreck. Wenige Meter über mir, auf einem Geländevorsprung, erblickte ich Beyeler Chrigu. Er stand dort im grünen Jägergewand, lauernd, wie zu Stein erstarrt, Gewehr und Jagdhorn umgehängt. Offenbar hatte er mich schon länger beobachtet. Natürlich tat er mir nichts zu leide. Er erwiderte sogar meinen schüchternen Gruss. Aber der erlittene Schrecken verfolgte mich noch lange.
Ein Original völlig anderer Art war Onkel Andres. Eigentlich war er meines Vaters Grossonkel aus der Haas-Sippe. Meine Eltern scheinen ihn geachtet oder zumindest an seinem Namen Gefallen gefunden zu haben. Seinetwegen erhielt ich den Namen Andreas. Onkel Andres lebte in Madiswil, wo er als Lehrer und Organist gewirkt hatte. Nach seiner Pensionierung kam der kleine, behende Mann mit dem weissen Spitzbart jedes Jahr einmal bei uns zu Besuch. Die Verwandtschaft zu pflegen war ihm ein Anliegen. Er war stets sonntäglich gekleidet: schwarzes Gewand, weisses Hemd, schwarze Krawatte. Wenn man ihm gut zuredete, setzte er sich ans Harmonium und gab ein kleines Konzert. Er spielte, nach unserem Dafürhalten, unendlich viel besser als Haas Hans, mein Harmoniumlehrer. Übers Orgelspielen hatte er seine eigenen Ansichten. Auf Johann Sebastian Bach hielt er gar nichts. Er spielte viel lieber sentimentale Weisen, auch im Gottesdienst. „Des Sommers letzte Rose“ zum Beispiel und andere beliebte Schnulzen. Geradezu stolz schilderte er, wie er mit dem Pfarrer deswegen in einem dauernden Streit lebe. Er spiele eben lieber das, was dem Volk gefalle, nicht den Stubengelehrten. Viel später, während meines Studiums, erzählte eine Dozentin von ihren Erlebnissen in einer Landgemeinde. Sie sei eine Zeit lang in Madiswil gewesen und habe dort einen unglaublich eigensinnigen Organisten erlebt. Unschwer erkannte ich in ihm unsern lieben Onkel Andres. In Madiswil schien er nicht in jeder Hinsicht den Vorstellungen der Bevölkerung entsprochen zu haben, trotz seinem volkstümlichen Orgelspiel. Es wurde ihm angekreidet, dass er sich keine Kuh hielt. Um die Stimmung unter seinen Schülern auszuloten, liess er sie einen Aufsatz schreiben zum Thema „Wenn ich Lehrer wäre.“ Mit einem verschmitzten Lächeln erzählte er, eine Schülerin habe zu diesem Thema geschrieben: „Wenn ich Lehrer wäre, möchte ich keine Kuh halten. Ich wäre angebunden wie ein Hund wegen der Kuh.“ Onkel Andres lebte mit seiner Frau sehr zurückgezogen in seinem Häuschen, weit abseits am Waldrand. Sie waren kinderlos. Das Tanti, das ich nie persönlich kennen lernte, muss eine enorm sanfte, liebe Frau gewesen sein. Im Verwandtenkreis nannte man sie Tante Zuckerstängeli. Im Alter wurde Andres furchtbar geizig, geradezu krankhaft. Wenn zum Beispiel seine Frau krank war, was oft der Fall war, reute es ihn, zum Wärmen des Tees elektrischen Strom zu vergeuden. Darum legte er sich selber ins Bett neben das Tanti Zuckerstängeli, klemmte die Flasche zwischen die Beine und wärmte den Tee mit seiner eigenen Körperwärme auf. Kurz nach dem Tanti segnete auch er das Zeitliche. Den zahlreichen Verwandten liess er ein ansehnliches Vermögen zurück. Damit hätte er sich viele lustige Jahre gönnen können. Onkel Andres war eben ein Haas, und viele Haasen sind Menschen eigener Art, scharfzüngig oder klug oder schrullig bis verschroben. Wehe mir, auch in meinen Adern fliesst das Blut dieses merkwürdigen Geschlechtes!
In die gleiche Verwandtschaft, wohl um ein oder zwei Glieder entfernter, gehörte Haas Hans. Auch er war Lehrer gewesen wie Onkel Andres. Mehrere Jahre hatte er in Bosnien verbracht. Er erzählte gern und oft von seinem bedeutenden Wirken in jener fernen Weltgegend. Der fremdartige Name des unbekannten Landes erfüllte mich mit Ehrfurcht. Über den Grund seines Aufenthaltes im fernen Bosnien äusserte er sich jedoch nie. Viel später erst vernahm ich, Onkel Hans habe sich in seiner Klasse irgendeiner (nie genau benannten) Verfehlung schuldig gemacht. Mit Mädchen? Oder gar mit Knaben? Jedenfalls wurde er entlassen. Wahrscheinlich wurde ihm auch das Lehrpatent entzogen. Er verzog sich mit seiner Familie ins Ausland. Nach einigen Jahren kehrte er in die Schweiz zurück und arbeitete bis zu seiner Pensionierung auf einem Amt in Bern. In der Freizeit arbeitete er bei den „Radiokameraden“ mit und war stolz darauf, dass seine Stimme ab und zu über Radio Beromünster zu hören war. Haas Hans wurde mein Harmoniumlehrer. Alle vierzehn Tage musste ich mich an die Bridelstrasse begeben, mit dem Zug bis Stöckacker, dann zu Fuss bis zum kleinen Häuschen, das unmittelbar am Trassee der Gürbetalbahn gelegen war. Diese Stunden waren für mich eine Qual. Einesteils deshalb, weil ich viel zu wenig geübt hatte und beim Vortrag immer wieder stecken blieb. „Hesch di verschtuunet?“ pflegte mein Lehrer zu fragen. Nach der nicht enden wollenden Stunde offerierte Hansens Frau, die Tante Hanni, eine Tasse Tee. Mein Martyrium wurde dadurch in die Länge gezogen. Man sass am kleinen Tisch in der Küche, wo es immer penetrant nach Gas roch – ein Geruch, der für mich völlig neu und unangenehm war. Jedes Mal rieb mir die Tante unter die Nase, meine Eltern würden viel Geld ausgeben für die Harmoniumstunden. Deshalb hätte ich die Pflicht, fleissiger zu üben. Das stimmte natürlich. Doch manchmal sind Wahrheiten ärgerlicher als falsche Beschuldigungen. Am Schluss der Stunden oder auch dann, wenn er bei uns zu Besuch war, setzte sich Haas Hans selber ans Harmonium und spielte einige Glanzstücke vor. Stolz wie der grösste Pianist sass er vor der Psalmenkommode, wiegte seinen Oberkörper hin und her, warf den Kopf in den Nacken und schloss bei seinem inbrünstigen Spiel geniesserisch die Augen. Meistens spielte er fortissimo. Vermutlich fühlte sich Haas Hans zu Höherem geboren. Das sehr bescheidene Dasein muss sein Selbstwertgefühl stark beeinträchtigt haben. Deshalb spielte er sich gern auf. Was er von sich, seiner Arbeit, seiner Familie erzählte, hatte meistens etwas Grosssprecherisches an sich. Im Mai 1945 feierte meine Schwester Frieda Hochzeit. Zu diesem Anlass dichtete Hans Haas einige einschlägige Stellen des Schillerschen Liedes von der Glocke um („Drinnen wirket die tüchtige Hausfrau, lehret die Mädchen, wehret den Knaben ..“ und so weiter). Er trug mir auf, seine Umdichtung an der Hochzeitsfeier vorzutragen. Meine Mutter fand jedoch die gebrünzelten Verse schlecht. Sie schlug vor, auf ihre Rezitation zu verzichten. Mir sollte es recht sein. Nachträglich kam ich aber in eine verzwickte Lage. Bei der nächsten Harmoniumstunde fragte mich Hans Haas, ob ich das Gedicht vorgetragen hätte. „Ja“, log ich errötend. Dummerweise stellte sich heraus, dass sich Onkel Hans erkundigt und gehört hatte, dass dem nicht so war. Doppelt musste ich mich schämen. Einmal, weil ich die Dichtung des Onkels gering erachtet hatte (vom Urteil der Mutter sagte ich nichts). Sodann, weil ich gelogen hatte und bei dieser Lüge ertappt worden war. Kann man mir verdenken, dass mir die Harmoniumstunden fortan noch mehr zuwider waren?
Ein weiterer Haas-Onkel trug den Namen Fritz. Er war, zusammen mit einer beachtlichen Geschwisterschar, in Burgdorf aufgewachsen. Der Vater amtete dort als gestrenger und frommer Waisenvater. Er war bei den Zöglingen gefürchtet, weil er sie häufig mit Schlägen traktierte. Einige von ihnen sollen ihn, nach Erreichen der Volljährigkeit, vor Gericht gebracht haben. Interessanterweise entwickelten sich seine Nachkommen mehrheitlich in anderer Richtung. Onkel Fritz zum Beispiel, Sekundarlehrer in Langnau, war ein weiser und sanfter Mensch. So jedenfalls habe ich ihn kennengelernt. Im Alter wohnte er mit seiner Frau in Tägertschi. Bei meinen gelegentlichen Besuchen strahlte er mich mit seinem von einem weissen Bart umrahmten Gesicht freundlich an. Nach seinem Tod erst wurde bekannt, dass er eine seiner Schwestern viele Jahre lang unterstützt und ihr ermöglicht hatte, in Würde alt zu werden. Er war nicht nur ausserordentlich beschlagen in der Welt- und der Schweizergeschichte. Er forschte auch nach den Wurzeln unserer weit verzweigten Familie. Eine seiner Thesen lautete, die «Haasen» hätten östliche Wurzeln. Sie seien ursprünglich in Ostgalizien ansässige Juden gewesen, die dann in den Westen ausgewandert seien und sich hier christianisiert hätten. Onkel Fritz betonte, für diese These habe er keine Beweise, aber immerhin starke Indizien. Wieder so ein merkwürdiger Bezug zu meiner lebenslangen Russophilie! Leider konnte ich Onkel Fritz nicht mehr näher befragen. Er ist gestorben, ohne eine Dokumentation hinterlassen zu haben.

Die Schell-Familie
Eines schönen Tages – ich war damals wohl in der vierten Klasse – brachte mein Vater auf dem Bockwägeli einen seltsamen Burschen auf den Hof, städtisch gekleidet und mit Pomade im Haar. Er sagte „Grüezi“, „Sie“ statt „Dier“ und erwies sich als Zürihegel namens Schell Hermann. Nach dem Anschluss Oesterreichs an Nazideutschland hatte seine Familie flüchten müssen und in Zürich Aufnahme gefunden. Hermanns Vater war Schriftsteller, seine Mutter, Margarete Schell-von Noë, eine bekannte Schauspielerin. Sie wirkte am Zürcher Schauspielhaus, später als Theaterpädagogin am Berner Konservatorium. Zum grossen Kummer der Eltern war der älteste Sohn, eben Hermann Carl Maria, nicht sonderlich wohlgeraten. Jahrzehnte später behauptete Hermann in seiner Autobiografie, an der Misere sei der überstrenge, lieblose Vater schuld gewesen. Wie dem auch sei: die verzweifelten Eltern beschlossen, den schwierigen Sohn bei einem Bauern zu versorgen. Dort sollte er arbeiten und sich in eine Gemeinschaft einfügen lernen. Da hatten wir nun unsern Hermann oder, wie wir zu sagen pflegten, den Mändu. Recht bald stellte sich heraus, dass er nicht so leicht zu handhaben war. Seinen Widerwillen gegen landwirtschaftliche Arbeit dokumentierte er auch äusserlich. Er trug die allerschlampigsten Kleider, die man sich denken kann, sodass er aussah wie eine Vogelscheuche. Jegliche Handarbeit galt ihm als verächtlich. Besonders entwürdigend fand er das Kartoffelauflesen. Da müsse man sich „bücken wie ein Tier“, und das sei für „gäischtigi Mänsche“, zu denen er sich selbstverständlich zählte, absolut unwürdig. Jeden Auftrag, den er bekam, erfüllte er mit Widerwillen und mit aufreizender Langsamkeit. Am Abend führte er endlose Gespräche mit meiner Mutter. Diese Gespräche fanden in der Visitenstube statt, unmittelbar neben meinem Zimmer. Wenn ich im Bett lag, wurde ich unfreiwilliger Mithörer der Diskussionen. Mändu war der festen Überzeugung, dass die Bauern grundsätzlich dumm seien. Im Gegensatz zu ihnen fühlte er sich zu Höherem geboren. Ob dem so war, soll hier nicht entschieden werden. Eindeutig war jedenfalls, dass ihm, dem geistigen Menschen, die praktische Intelligenz fehlte. Einmal sollte er Kartoffeln transportieren. Als er die zwei Körbe vom Zweiräderkarren abladen wollte, hob er zuerst den Vorderen. Dadurch kippte natürlich der Karren nach hinten. Der zweite Korb stürzte auf den Boden. Die Kartoffeln kollerten über den ganzen Hof. Vater, der die Szene beobachtet hatte, rief Mändu zu: „So hättes de die dumme Pure nid agattiget.“ Einmal beklagte er sich bei meiner Mutter über den Melker. Der habe ihn in den Hintern getreten. Mutter ging der Sache nach und erfuhr, es habe sich nicht um einen Fusstritt gehandelt. Der Melker habe dem Hermann bloss eine Kartoffel angeworfen. Das bestritt Hermann nicht, aber er klagte, er habe das eben wie einen Fusstritt empfunden. Bevor die Eltern Schell ihren schwierigen Sohn bei einem Bauern platzierten, hatten sie offenbar allerhand Erkundigungen eingezogen. So auch bei Pfarrer Huber in Mühleberg. Jedenfalls begab sich meine Mutter eines Tages mit dem Pflegling ins Pfarrhaus. Auf dem Nachhauseweg beschrieb Mändu des Langen und Breiten sein Weltbild. Wir machten uns falsche Vorstellungen über die Welt. Die Erde sei gar keine Kugel. Wir lebten wie in einem Hohlraum, wie in einem Zimmer. Die Sonne sei oben in diesem Hohlraum angebracht. Mutter ärgerte sich. Das sei doch dummes Zeug, er solle sie mit seinem Geschwätz verschonen. Aber er hat offenbar auf dem ganzen Heimweg geredet und geredet wie ein Wasserfall. Er hat einfach nicht gemerkt, wie er auf seine Mitmenschen wirkte. Ob die fünfmonatige Erziehungskur schlussendlich Früchte getragen hat, ist schwer zu sagen.
Netter und viel weniger hochtrabend waren Mändus Geschwister. Max weilte einmal für zwei oder drei Wochen bei uns im Landdienst. Den tiefsten Eindruck machte mir die Tatsache, dass er bei den Junioren des FC Red Star Zürich Goalie war. Daher brauchte er mich am Feierabend als Goalie-Trainer. Zwei Bohnenstecken bildeten das Tor. Max wünschte, dass ich den Ball von Hand warf (meine Schüsse per Fuss gingen zu häufig daneben). Je genauer ich die Ecke traf und je spektakulärer seine Paraden waren, desto zufriedener gab er sich. Eines Sonntags nahm mich Max freundlicherweise mit zu einem Fussball-Fest im Wankdorf-Stadion. Am selben Nachmittag fanden zwei Cup-Halbfinalspiele statt: Servette - Lausanne und Grasshoppers - Young Boys. Max schwärmte im Voraus von den grossartigen Cracks des Grasshopper-Clubs: Fredy Bickel und Amado. Jedesmal, wenn sie den Ball berührten, wies er mich auf die technischen Finessen hin. Kein Wunder denn, dass die armen Young Boys den Zürchern mit 2:0 unterlagen. Ein Zwischenfall ist mir noch deutlicher in Erinnerung als das Geschehen auf dem Feld. Wir standen in einer Zuschauertraube hinter einem Tor. Da flog ein wuchtiger Schuss über die Latte in die Menge und prallte irgendwie an meine Nase. Ich sah die Sterne im Elsass scheinen und musste mich unheimlich zusammennehmen, um meine Tränen zu unterdrücken oder zu verstecken. Max war ein sehr hübscher, dunkelhaariger junger Mann. Kein Wunder, dass sich meine Schwester Madeleine in ihn verliebte. Es scheint auch auf der Gegenseite ein wenig gefunkt zu haben, allerdings nur ganz kurz.
Die Männer aller Altersstufen waren ihrerseits sehr, sehr angetan von der Dritten im Bunde: Maria. Sie nannte sich damals noch Gritli, war klein, zierlich, hübsch und von einem umwerfenden natürlichen Charme. Ein Engel in Menschengestalt! Später, in kritischer Distanz, fragte ich mich, ob die scheinbar so herzliche Natürlichkeit wirklich natürlich gewesen sei. Auf alle Fälle gab sich Gritli ganz unkompliziert. Sie ass am Tisch mit uns allen und wie wir alle (währenddem sich Engel üblicherweise doch von Ambrosia und Nektar nähren). Sie rühmte die Rösti, die jeden Morgen auf den Tisch kam. Sie schöpfte meinem Vater fürsorglich die Suppe, plauderte mit dem Melker und half in der Küche. Anlässlich eines winterlichen Waldspaziergangs schäkerte sie mit den Holzfällern und fuhr, auf einem grossen Tannenträmel sitzend, mit in die Sägerei. Wen hätte das nicht bezaubert?? Gritli war Schauspielerin und hatte damals ein Engagement im Stadttheater Bern. Zur Zeit ihres Besuches im Forst spielte sie die Hauptrolle im Weihnachtsmärchen: Aschenbrödel. Als Dank an die Gastgeberfamilie schenkte sie Mutter und mir je ein Freibillett. Als dies dem Mäder Berti, Heinzens Mutter, zu Ohren kam, wurde es von unsäglichem Neid ergriffen. Es gab keine Ruhe, bis meine Mutter das Schell Gritli um ein weiteres Freibillett bat. Das erwies sich allerdings als schwierig. Das Theater war ausverkauft. Aber Gritli war eine gute Seele und wusste Rat. Heinzli durfte mit uns kommen und es wurde ihm im Orchestergraben, auf einem erhöhten Stühlchen, ein Platz bereitet. Nun war ich an der Reihe, von Neid gequält zu werden. Heinzli hatte viel bessere Sicht auf die Bühne. Hautnah durfte er miterleben, wie das arme Gritli von seinen bösen Schwestern geplagt, aber schliesslich doch im Sinne höherer Gerechtigkeit vom Prinzen geliebt und zur Königin erhoben wurde.
Mehrmals war auch die Mutter der Schell-Kinder bei uns zu Besuch. Einmal durfte ich meine Mutter auf die Station Rosshäusern begleiten, um Frau Schell abzuholen. Auf dem Nachhauseweg – selbstverständlich zu Fuss – musste ich ihr von meiner eben bestandenen Aufnahmeprüfung in die Sekundarschule berichten. Sie lobte mich und ermunterte mich, später einmal zu studieren. Weder sie noch ich konnten damals wissen, dass ich ihr als Student wieder begegnen würde. Neben ihrem Auftrag als Schauspiellehrerin am Berner Konsi gab sie privat Unterricht in Sprechtechnik. Von diesem Angebot machte ich Gebrauch und verbrachte einige anstrengende Stunden in der Wohnung von Lola Lorme, einer fast blinden Schriftstellerin. Dort hatte Frau Schell ihre Berner Absteige. Anlässlich einer Unterrichtsstunde tauchte plötzlich Hermann auf. Er hatte sich inzwischen zu einem mittleren Schauspieler durchgemausert. Immer noch fühlte er sich als „gäischtige Mäntsch“. Aber er war umgänglicher, normaler geworden. Nach der Unterrichtsstunde verfrachtete er seine Mutter und mich kurz entschlossen in seinen Ghia Karman und fuhr in den Forst. Offenbar hatte er sein landwirtschaftliches Praktikum doch nicht in allerschlechtester Erinnerung. Die andern Schell-Kinder, Max alias Maximilian und Gritli alias Maria habe ich nie mehr gesehen – ausser im Kino und im Fernsehen.
Meine Mutter hatte zu Frau Schell ein herzliches Verhältnis. Sie sprach von ihr mit Ehrfurcht als einer «Frau von Gold». Wenn sie im Forst zu Besuch war, blieb sie nie untätig. Ganz selbstverständlich und unkompliziert legte sie überall Hand an und half etwa beim Stopfen der Strümpfe und Socken. Mehr als einmal lud sie Mutter ein nach Zürich, in ihre Wohnung im Rieterpark. Sie besuchte mit ihr Ausstellungen und lud sie zu einer Vorstellung im Bernhard-Theater ein. Eine Frauen-Freundschaft ganz eigener Art.

Freizeit auf dem Land
Mein Bruder war ein begeisterter Pfadfinder, was damals für Bauernkinder nicht ganz selbstverständlich war. Dem Pfadfinderwesen begegnete die Landbevölkerung mit Misstrauen. Das illustriert die verbreitete Verballhornung des Pfadfinder- Wahlspruchs:
Allzeit bereit
Zum Streit
Nur nicht zum Schaffen
sind die Pfadiaffen.
Werner liess sich jedoch nicht abhalten. Er steckte auch mich mit seiner Begeisterung an. So trat ich, vermutlich etwa in der 5. Klasse, in die Pfadiabteilung „Stärnebärg“ ein. Unter den Neueingetretenen waren auch meine neuen Klassenkameraden Aeschbacher Tönu und Weber Walter. Auch Freund Heinz schloss sich uns an, allerdings nur für kurze Zeit. Wir trafen uns immer am Sonntag Nachmittag. Samstag wäre nie in Frage gekommen. An einem heiligen Werktag nur herumlungern und Allotria treiben statt daheim zu helfen – das war in unserer Landgemeinde undenkbar. Wenn es regnete, verteilten sich die drei Fähnlein in verschiedenen Heubühnen und Tennen der Bauernhöfe in Mühleberg. Bei schönem Wetter begaben wir uns ins Gelände, lernten Knoten knüpfen, Feuer machen und ein paar Grundbegriffe der ersten Hilfe. Auf dem Programm stand auch Kartenlesen, den Kompass bedienen, Pflanzen erkennen oder die pfadfinderischen Grundsätze auswendig lernen. Dazu gehörte der Auftrag, jeden Tag eine gute Tat zu vollbringen. Das war manchmal schrecklich schwierig. Nur ganz selten bot sich die Gelegenheit, einem alten Müeti über die Strasse zu helfen oder ihm die Tasche zu tragen. Es gab einfach zu wenig alte Frauen und zu viele Guttäter. Das eigene Vergnügen kam freilich nicht zu kurz. Hie und da durften wir auf einem frisch abgemähten Feld dem Fussball frönen. Beliebt waren auch Spiele wie Fadenraub oder das Nummernspiel.
Drei wichtige Anlässe prägten das Pfadfinder-Jahr. Über Pfingsten fuhr die ganze Abteilung, drei Fähnlein, mit insgesamt zwei Dutzend Burschen, in ein Zeltlager. Zwar hatte ich armes Büblein immer ein wenig Heimweh. Aber die tollen Erinnerungen überwogen. Nächtliche Räuberspiele etwa, die Pfadfinderprüfung irgendwo im dunklen Wald, die angebrannten und fast nicht essbaren Spaghettis, das mühsame Putzen der kohleschwarzen Kochkessel, lange kalte Nächte im dünnen Schlafsack. Die Pfadfinderei und insbesondere die Lager waren für meine Sozialisierung von enormer Bedeutung. War ich doch fast als Einzelkind aufgewachsen, ohne gleichaltrige Spielkameraden. Erst bei den Pfadfindern bot sich mir die Gelegenheit, mich in einer Gruppe einzugewöhnen. Mein erstes Pfingstlager ging allerdings in die Hosen. Es regnete fürchterlich. Unser Venner, Neuhaus Werner, hatte keine Lust, drei Tage in der Nässe herumzupflotschen. Wir andern auch nicht. Kurzerhand lud er uns in die Wohnung seiner Eltern ein. Dort verbrachten wir zwei Tage, meistens in der Küche sitzend. Erstmals in meinem Leben wurden mir Jasskarten in die Hand gedrückt. Ich hatte keinen Hochschein. Neuhaus Werners hübsche Schwester half mir ein wenig zurecht. Als ich einmal den Trumpf Bauer zufälligerweise im richtigen Moment ausspielte, rühmte sie mich so sehr, dass für mich das verregnete Lager gerettet war.
Zweites wichtiges Datum war der sogenannte UA – Unterhaltungsabend. Die Vorbereitung erforderte viel Arbeit. Jahr für Jahr gab es eine Tombola. Die Gaben mussten wir entweder zusammenbetteln oder selber basteln, wobei das Resultat nicht immer attraktiv war. Ein von mir gebastelter Laubsägeli-Briefhalter kam Jahr für Jahr wieder auf den Gabentisch zurück: die undankbaren Gewinner des letzten Jahres hatten ihn für die neue Tombola gespendet. Stundenlang übten wir Hechtrollen über zwei, drei oder gar fünf am Boden liegende Kameraden. Auch ein paar Lieder wollten vorgetragen werden und, etwa jedes zweite Jahr, ein kleines Theäterchen. Zweck des UA war es einerseits, den Eltern zu zeigen, was alles wir gelernt hatten. Anderseits sollte der Anlass Gewinn für die Abteilungskasse abwerfen. Der Erlös des UA bildete die einzige Einnahme. Meistens fand der UA im Bahnhofrestaurant Gümmenen statt. Die dortigen Wirtsleute waren uns gut gesonnen und überliessen uns den Saal zu günstigen Bedingungen. Der Austragungsort lag allerdings um die zehn Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Einmal stand mir kein Velo zur Verfügung. Deshalb benützte ich auf dem Heimweg den mächtigen Eisenbahnviadukt, der die Saane überquert. Eine ganz beträchtliche Abkürzung. Ich wusste wohl, dass dies verboten war. Mich verlockte aber die Zeitersparnis von fast einer Stunde Fussmarsch. Als ich mich mitten auf dem Viadukt befand, sah ich plötzlich einen Zug entgegenkommen. Ich machte mich ganz dünn und kauerte ans Geländer. Schon donnerte die Lokomotive auf mich zu. Während eines Sekundenbruchteils nahm ich im Führerstand den Lokomotivführer wahr, der mir mit aufgehobenem Zeigefinger drohte. Sobald der Zug vorbei war, rannte ich ans gegenüberliegende Ufer und verdrückte mich sofort ins schützende Gehölz. Man wusste ja nie, ob die einem die Polizei auf den Hals hetzten. Zu Hause erzählte ich nichts von meinem Abenteuer.
Das dritte grosse Pfadfinderereignis fand nach Weihnachten statt. In der Altjahrswoche war das Skilager angesagt. Dafür mieteten unsere Führer jeweils eine Alphütte, auf dem Beatenberg zum Beispiel, im Diemtigtal, in der Nähe der La Berra oder in Oeschseite ob Zweisimmen. In der Regel erreichte man die Hütten nur nach einem stundenlangen, mühsamen Marsch durch den ungepfadeten Schnee. Man schlief im Heu. Weit und breit war kein Skilift. Am ersten Tag wurde eine Piste gestampft, auf der man sich eine Woche lang tummelte. An den Abenden ging es lustig zu und her. Ein Gleichaltriger, Gasser Köbu aus Gümmenen, wirkte als Alleinunterhalter. Man musste nicht nur über seine Sprüche lachen, sondern oft auch über Äusserungen, die er in vollem Ernst tat. Köbu war ein vorzüglicher Imitator von Menschen und Tieren. Vor mir sehe ich immer noch seine Nummer als Kuh, die sich aus dem Stroh erhebt, die Beine schüttelt und wiederkäuend aufsteht. Bei einer Tour auf den Gipfel der freiburgischen La Berra gerieten wir unerwartet in einen Schneesturm. Es war beängstigend und eisig kalt. Unsere Führer behielten aber klaren Kopf. Sie hiessen uns, mit Hilfe der Skier in einer grossen Schneewächte eine Höhle graben. Dort verharrten wir, eng aneinander gekauert, bis sich der Sturm ein wenig gelegt hatte. Unversehrt kehrten wir in die Hütte zurück. Im selben Skilager erlitt ich einen herben Verlust. Zu Weihnachten hatte ich wunderschöne Skistöcke bekommen, blau gestrichen, mit hellbrauner Lederschlaufe. Bei einem Sturz brach der eine Stock mitten entzwei. Die Farbschicht hatte einen Ast verdeckt. Genau dort brach der billige Tannenstock bei der ersten Belastungsprobe. Was für ein Jammer! Ich hatte mich doch so sehr gefreut über die schönen blauen Stöcke!
Mit Stolz erfüllte mich später, dass ich Jungvenner und später sogar Venner des Fähnleins „Specht“ wurde. Aeschbacher Tönu hatte die selbe Würde und Bürde bekommen. Er wurde Venner der „Kiebitze“.
Niemand aus meinem Familien- und Freundeskreis dürfte sich wundern, dass sich meine Fussballbegeisterung schon sehr früh abzuzeichnen begann.Tief im Gedächtnis eingeprägt hat sich die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft mit ihrem 1:0 Sieg gegen England. Für viele Tage hielt nach diesem Triumph meine Hochstimmung an. Der Sportseite in der Berner Zeitung galt meine beständige Aufmerksamkeit. Ich verfolgte Resultate und Tabellen der Nationalliga-Klubs. Die Mannschaften der besten Vereine kannte ich auswendig, vom Goalie bis zum linken Flügel. Irgend einmal beim Zügeln kam mir ein altes Tagebuch in die Hände. Beim Durchblättern fiel mir auf, dass die persönlichen Einträge recht spärlich waren. Dafür hatte ich jeden Montag fein säuberlich die Resultate der Young Boys und des FC Bern notiert. (A propos persönliche Einträge: über meine scheuen Liebschaften schrieb ich nur verschlüsselt. Ich hatte nämlich entdeckt, dass meine Mutter das Tagebuch zu lesen pflegte. Sie brauchte in meine süssen Geheimnisse nicht eingeweiht zu werden).
Wesentlich mehr Schwierigkeiten als mit dem passiven hatte ich mit dem aktiven Fussballsport. Selten, viel zu selten, praktizierten wir ihn bei den Pfadfindern. Von der Schule gar nicht zu reden! Fussball galt vielen Leuten, insbesondere Lehrern und andern Gebildeten, als anrüchig. Was sollte man in den langen Perioden fussballerischer Entbehrung nur tun? Wohl hatte ich mal zum Geburtstag einen richtigen Lederfussball erhalten. Meine Freude war überaus gross. Stundenlang stüpfte ich den Ball gegen Mauern und Wände. Er litt enorm auf dem kiesigen Hofplatz. Alle paar Monate waren die Nähte durchgescheuert. Ich musste den schweren Gang zum Sattler antreten. Der war nicht nur kein Fussball-Freund. Die Flickerei war ihm auch viel zu wenig lukrativ. Nie unterliess er es, irgend eine kränkende Bemerkung zu machen. Grundsätzlicher aber war ein anderes Problem. Weit und breit fanden sich keine Mitspieler. Freund Heinz war kein Fussball-Fan. Andere Kollegen wohnten nicht in der Nähe. Also musste eine Ein-Mann-Lösung gefunden werden. Hinter dem Schuppenanbau, unterhalb des Schrägdaches, rammte ich zwei Stecken ein und spannte eine Schnur – das war das Goal. Ich stellte mich ins Tor und warf den Ball aufs Dach. Auf den Kanten der Ziegel machte er unberechenbare Sprünge und flog mal links, mal rechts, mal hoch, mal tief gegen das Tor. Dort aber stand ich und versuchte ihn, mit meisterlichen Paraden zu fangen. So spielte ich stundenlang sämtliche Nationalligaspiele durch, dazu alle möglichen Länderspiele sowie Europa- und Weltmeisterschaften. Interessanterweise schnitt die Schweiz immer hervorragend ab. Der Realität nicht ganz entsprechend holte sie sich mindestens die Silbermedaille.
Zeitweise frönte ich auch dem Eishockey. Auch für diese Sportart erfand ich ein Einmann-System. Auf dem betonierten Boden zwischen den Ställen und dem Miststock markierte ich mit Scheitern zwei winzige Tore, die ich abwechselnd bombardierte. Die Ausrüstung war wie schon gehabt: ein krummer, mit dem Zügmesser präparierter Ast, und, als Puck, die von einem runden Buchenscheit abgesägte Scheibe. Einen richtigen Stock zu kaufen wäre wohl nie in Frage gekommen. Zum Spielen trug ich gern einen roten Pullover, den ich mit einem Schweizerkreuz verziert hatte. So konnte es losgehen. Hin und her wogte der Kampf, bald fiel hier, bald dort ein Tor. Wiederum spielte ich ganze Turniere durch und wiederum schnitt die Schweiz stets hervorragend ab.
Wie erinnerlich bin ich während eines Autorennens auf die Welt gekommen. Mag sein, dass dieser Umstand mein Interessen für Seifenkisten geweckt hat. Jedenfalls beschäftigte ich mich einige Zeit mit dieser Sportart. Auf dem Estrich hatte ich einen uralten Kinderwagen ausgegraben. Ich demontierte das Gefährt und befestigte zwei Räder an einem dicken Brett. Die zwei andern Räder montierte ich auf eine schwenkbare Achse, die sich mit Seilen bewegen liess. Ohne Servo-Lenkhilfe gestaltete sich dies recht mühsam. Immerhin, die Seifenkiste war fahrbereit. Leider, leider aber befanden sich die Strässchen in der Umgebung in einem beklagenswerten Zustand. Holprig waren sie allesamt, kiesübersät, voller Schlaglöcher. Die heutige Asphaltgeneration weiss gar nicht, wie paradiesisch sie es hätte, wenn sie es nur richtig zu nützen wüsste. Auf alle Fälle waren die Probefahrten kein reines Vergnügen. Ausserdem hielt meine Konstruktion den widrigen Umständen nicht lange stand. Die Halterung der Achse brach. Die lädierte Seifenkiste verschwand zuhinterst im Schuppen.

Weitere Schulgeschichten
Weil die Zahl der Oberschüler stark rückläufig war, kamen wir bereits im vierten Schuljahr zu Lehrer Krummen in die Oberschule. Die Trennung von Frau Langen löste Bedauern aus. Anderseits aber brachte ich auch Lehrer Krummen grosse Verehrung entgegen. Er war ein rassiger Mann und duftete ungemein aufregend – es war wohl eine Mischung von Pfeifenrauch und Rasierwasser. Ausserdem trug er oft helle Flanellhosen mit ganz scharfen Bügelfalten. So was an Vornehmheit! Lehrer Krummen war ein begeisterter Bauernmaler. Alle Deckenbalken des Schulzimmers waren mit roten und schwarzen Ornamenten oder mit allerlei Spruchweisheit verziert. Über meinem Pültlein prangte ein Spruch, den ich nie vergessen habe: "Edel sei der Mensch, hilfreich und gut". Rings an die Wände hatte der Lehrer Plakate mit schwierigen Wörtern geklebt. Auch die prägte ich mir ein und ich kann feststellen, dass ich das Wort „vielleicht“ seither nie mehr falsch geschrieben habe. Nie mehr! Krummen Hans war oft im Aktivdienst. Wenn er in Urlaub kam und uns in der Schulstube besuchte, bewunderten wir seine rassige Uniform als Leutnant der Schweizer Armee. Die Abwesenheiten bedingten natürlich viele Stellvertretungen. Offenbar war es nicht einfach, alle Klassen im Kanton zu versehen. Daher kamen auch Seminaristen und Seminaristinnen zum Einsatz. Da war zum Beispiel ein Fräulein Plüss vom Thuner Seminar. Auch wir Knirpse merkten bald einmal, dass die Volksbildung nicht ihr einzig Ziel und Trachten war. Sie beschäftigte sich besonders gern mit den Neuntklassbuben. Zum Beispiel ein Welscher, der Robert, schien ihr sehr zu gefallen. Da machte doch die Stellvertreterin an einem schönen Sommertag einen Spaziergang mit der ganzen Oberschule. Sie schritt an der Spitze des Zügleins, Robert an ihrer Seite. Die beiden waren so vertieft ins Gespräch, dass sie nicht merkten, wie wir andern – absichtlich – mehr und mehr zurückblieben. Schliesslich war uns das Paar wohl zweihundert Meter voraus. Als sie es bemerkten, bleiben sie stehen und warteten auf uns. Ich vermute, Roberts Verlegenheit war grösser als die der Lehrerin. Eines Tages kreuzte Herr Schmid auf, Direktor des Thuner Seminars. Mag sein, dass unsere Fräulein Plüss den Besuch nicht erwartet hatte. Jedenfalls ging ihr nach relativ kurzer Zeit der Stoff aus. So kramte sie das Buch hervor, aus dem sie uns schon sehr oft vorgelesen hatte. Sie setzte sich auf das Lehrerpult und begann zu lesen. Direktor Schmid hörte höflich zu. Nach einiger Zeit begann sich die Lehrerin immer häufiger zu räuspern. Aus dem Räuspern wurde Husten. Da wandte sie sich, in prachtvoll gespielter Verzweiflung, an den Besucher. „Herr Direktor, ich bin total heiser. Hätten sie die Güte, mit dem Vorlesen weiterzufahren?“ Herr Schmid nickte, setzte sich seinerseits aufs Lehrerpult und las, bis die Stunde um war. Selbst wir Viertklässler spürten, dass da etwas komisch gelaufen war. Was wohl Herr Direktor dem guten Fräulein Plüss erzählt hat?
Als ich in die vierte Klasse ging, wurde ich erstmals in meinem Leben vom Feuer der Liebe verzaubert. In der fünften Klasse sass ein allerliebstes Mädchen, das Bethli. Meine schönsten und besten Gefühle begannen sich auf dieses Schulschätzeli zu konzentrieren. Das Herz war so voll, dass der Mund überging. Wenigstens meinen Schwestern und auch dem Melker verriet ich meine Gefühle und, Ehre sei ihnen, sie lachten mich nicht aus. Zu der Liebsten allerdings sprach ich mit keinem Wort von meinen grossen Gefühlen. Höchst wahrscheinlich hatte sie von meiner Verehrung keine Ahnung. In jenen Jahren waren die Maikäfer eine wahre Landplage. Sie traten so zahlreich auf, dass ganze Waldränder und halbe Hofstatten kahl gefressen wurden. Die Behörden hielten die Bevölkerung an, Maikäfer zu sammeln. Auch die Schulen wurden einbezogen. An mehreren Nachmittagen zogen wir los. Meistens begleitete uns der Lehrer, ab und zu machten sich die Schüler selbständig. Unter den käferbehangenen Bäumen wurden Tücher ausgebreitet. Die kräftigsten Buben schüttelten die Bäume. Die vom Käfergewimmel braunen Tücher wurden in Säcke entleert. Spannung brachte jedoch nicht nur das Maikäfersammeln. Die Aktion erlaubte Mädchen und Buben eine prickelnde Nähe. Offenbar spürten meine Eltern etwas. Denn sie verboten mir das Maikäfersammeln, wenn keine Lehrperson anwesend war. Tatsächlich muss sich in der Folge Dramatisches ereignet haben. Die grösseren Buben versuchten, die Mädchen einzufangen und ihnen die Röcke hochzuziehen. Es wurden wilde Geschichten herumgeboten. Was wirklich geschah, was zum Beispiel der Isenschmid Housi und der Salvi mit dem Meieli gemacht haben, entzieht sich meiner Kenntnis.
Mein Zeugnis am Ende der vierten Klasse war deutlich schlechter als jenes in der Unterschule. Meine Eltern schimpften mich nicht aus. Am Ende des fünften Schuljahres hatten sich meine Noten auf wundersame Weise gebessert. Ich erhielt ein Superzeugnis. Mutter behauptete einmal im vertrauten Kreis, Lehrer Krummen habe im vierten Jahr schlechte Noten gesetzt, um der Unterstufen-Lehrerin eins auszuwischen. Die Noten sollten zeigen: seht nur, die Schüler haben ja bei dieser Madam nichts gelernt. Nach einem Jahr bei mir, dem begnadeten Pädagogen, ist alles anders und besser geworden. Im Frühjahr 1946 sollte ich in die Sekundarschule übertreten. Mit meinen Klassenkameraden fieberte ich der Sekprüfung entgegen. Wir waren über dreissig Kinder. Fest stand, dass 15 aufgenommen würden. Die Verkündigung der Ergebnisse verlief brutal. Wir mussten vor einem Schulzimmer warten, bis uns die beiden Lehrer Weiss und Schlachter sowie der Schulkommissionspräsident einliessen. Vorne an der Wandtafel prangten, von 1 bis 35 nummeriert, unsere Namen. Nach der Nummer 15 demonstrierte ein dicker Strich, wo die Guillotine gefallen war. Ein brutales Vorgehen für alle, die unter dem Strich lagen. Mehrere begannen zu schluchzen. Ich war so betreten, dass ich mich nicht einmal sonderlich über meinen ersten Rang freuen konnte. Die Sekundarschule war zweiklassig. Das heisst: wir Sechstklässler wurden zusammen mit den Siebentklässlern unterrichtet. Die Sitzordnung war entsprechend. Neben jedem Sechsteler sass ein Siebentler. In etlichen Fächern mussten die Älteren uns Jüngere unterrichten. So beispielsweise im Franzöisch. Der Ältere sprach eine Vokabel vor, wir mussten sie laut wiederholen. Noch heute klingt in meinen Ohren nach, wie Marlise mehr berndeutsch als französisch posaunte „lö greioo“ (crayon), „lö bübitter“ (pupitre). Jeden Morgen versammelte sich die ganze Schule im Oberschulzimmer. Herr Weiss setzte sich ans Klavier, und alle gemeinsam sangen einen Choral (damals war eben der Probeband erschienen zum Gesangbuch, das etwa 1950 neu herauskam). Auch in der letzten Stunde der Woche waren alle 60 Schüler beisammen fürs Chorsingen. Ein Mädchen der neunten Klasse, die Therese, gefiel mir ausnehmend. Sie erschien mir schön und überaus vornehm. Sie trug eine Brille und meistens sehr feine Kleider. Just anlässlich des Chorsingens erhielt ich aber eine eiskalte Dusche. Alle Schüler hatten sich vorne aufgestellt. Nach dem Absingen eines Liedes sollten wir uns wieder an unsere Plätze begeben. Wir, die Jüngsten, müssen wohl ein wenig gedrängt haben. Jedenfalls liess sich plötzlich die schnippische Stimme von Therese vernehmen: „Uh, das chline Gräbu (nichtsnutziger Plunder) isch fräch!“ Von da an war es mit meiner Verehrung vorbei. Diese begann sich mehr und mehr auf Annelise zu konzentrieren. Auch ihr gegenüber verriet ich nie, nicht mit einem einzigen Wörtchen, meine innigen Gefühle.
Herr Weiss war ein angenehmer Lehrer, ausgeglichen, freundlich und allen schönen Künsten ergeben. Er unterrichtete Französich und Deutsch. Er leitete das Chorsingen und war, last but not least, unser Turnlehrer. Meine Freude an diesem Fach wurde nur durch den Umstand geschmälert, dass Herr Weiss kein Freund des Fussballspieles war. Ein einziges Mal während der zwei Jahre Sekundarschule liess er sich herab, uns Buben „schutten“ zu lassen. Der zweite Lehrer hiess Samuel Schlachter. Er trug einen langen, dunklen Bart und verbreitete um sich eine Wolke der Furcht. Bei ihm hatten wir Rechnen, Schreiben und die Realfächer. Einen bequemeren (um nicht zu sagen: fauleren) Lehrer habe ich nie angetroffen. Vorbereitet hat er sich nie. Er machte Jahr für Jahr alles genau so, wie er es schon dreissig Jahre zuvor gemacht hatte. Hefte oder Proben korrigierte er niemals selbst. Wir mussten die Unterlagen austauschen und während der Stunde nach seinen Anweisungen korrigieren. Auch die Noten wurden während des Unterrichts ermittelt. Schlachter zeichnete eine Skala an die Tafel. Wer am wenigsten Punkte erzielt hatte, erhielt eine Drei oder eine Vier, die Spitzengruppe eine Sechs. Geprüft wurde nicht etwa die Intelligenz oder die Kombinationsfähigkeit, sondern nur das Gedächtnis. In den Geografiestunden teilte er Vogelschaukarten der Schweiz aus. Dann wurde Kanton um Kanton durchgenommen. Ein Schüler begann mit der Aufzählung. „Kanton Waadt. Orte sind: Lausanne, Ouchy, Pully, Lutry, Cully, Chexbres, Palezieux“, usw. Der nächste Schüler hatte die Gewässer aufzuzählen: „Gewässer sind...“. Den Dritten traf es zu den Bergen (Berge sind....). Der Vierte wiederholte wieder das Sprüchlein mit den Orten, der Fünfte das mit den Gewässern. Und so fort, die ganze Klasse durch, und dann noch einmal und noch einmal, endlos, bis zum Pausenläuten. Kommentare oder Erläuterungen gab es nie. Die Proben bestanden darin, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Orte, Gewässer und Berge aufzuschreiben. Die mechanische Art des „Lernens“ zeitigte manchmal ulkige Resultate. Bei einer Probe übers Wallis schrieb mein Freund Heinz zum Beispiel „Sälügg“. Die Nachfrage beim Korrigieren ergab, dass es sich bei diesem interessanten Ort um St. Luc im Wallis handelte. Im Rechnen legte Schlachter auf jedes Pult einen Meterstab. Bei 12 ½, 25 etc Zentimetern mussten wir Farbstifte hinlegen. Dann ging es los. Der erste musste sagen (und dazu mit dem Finger zeigen): ein Achtelmeter sind zwölfeinhalb Zentimeter oder 125 Millimeter. Der Nächste kam an die 25 cm und musste sein Verslein aufsagen. So leierte die ganze Klasse monoton und vollkommen fantasielos die Sprüchlein von den Metermassen herunter, fünfmal, zehnmal, zwanzigmal, bis die Stunde endlich um war. Damit wir in diesen tödlich langweiligen Stunden nicht allzu viel Unfug trieben, legte Sami einen langen Meerrohrstecken vor sich aufs Pult. Gewarnt wurde ein Sünder nur einmal. Beim zweiten Mal schnellte Schlachter auf wie ein Turner, durchmass mit langen Schritten das Zimmer und schon hatte der Übeltäter eins mit dem Stecken über die Ohren. Speziell erinnere ich mich an die Geometriestunden in der 6. oder 7. Klasse. Wir mussten in unsere Hefte beliebige Dreiecke zeichnen, diese messen und den Inhalt berechnen. Mit farbigen Strichlein galt es, die Umrisse zu verzieren. Alles hatte mit Tempo zu geschehen. Je höher die Zahl der ausgefärbten und berechneten Dreiecke, desto besser die Note. Diese Tempobolzerei förderte die Flüchtigkeit beim Ausfärben. Das aber liess Schlachter nicht durch. „Dein Hühnerhof ist löchrig“, rügte er, „mach den Zaun besser!“ Samuel Schlachter war ein sehr frommer Mann, Anführer und Prediger einer Sekte, die man nach ihm „Schlachterianer“ nannte. Direkt missioniert hat er nicht. Hingegen überwachte er eifrig die Sitten seiner Schüler. Das hinderte ihn nicht, sich, gelinde gesagt, grobschlächtig auszudrücken. „D Schnurre zue!“ „Häb d Scheiche stiu!“ So tönte es etwa vom Lehrerpult her. Ob er unsere Vornahmen kannte, weiss ich nicht. Angeredet hat er Buben und Mädchen nur mit dem Familiennamen. „Aeschbacher, chumm dahäre.“ „Baumer, a d Wandtafele.“ Einem überaus feinen Mädchen raunzte er zu: „Schmid, hör uf lafere.“ Schrecklich war er, wenn ihn der Jähzorn übermannte. Einmal mussten wir Buben nach dem Unterricht noch im Schulzimmer bleiben. Offenbar hatte während der Stunde einer von uns einen schlüpfrigen Ausdruck gebraucht. Nun ergriff Schlachter den Rohrstock, erhob ihn zum Schlag, und fragte einen um den andern: Bist du es gewesen? Niemand bekannte seine Schuld. Schliesslich schritt Schlachter zu Toni und hieb ihm mit dem Stock so lange auf Kopf und Schultern, bis der Rohrstock brach. Wir, vor Schrecken wie gelähmt, mussten zuschauen. Zum Dessert hatte jeder von uns 50 mal zu schreiben: „Torheit steckt den Knaben im Herzen. Aber die Rute der Zucht wird sie ihnen ferne treiben!“ Später konnte ich über einige der Müsterchen lachen. Andere wecken noch heute meinen Zorn. Geärgert hat mich vor allen Dingen, wenn bestandene Gemeindeväter den Schlachter als ausgezeichneten Lehrer rühmten. Wenn so viel Faulheit, Unfähigkeit und Unbeherrschtheit gelobt wird, dann steckt Torheit in den Köpfen der Erwachsenen – nicht in den Herzen der Knaben.
Welcher Zeitgenosse weiss heute noch, was ein Knallfix-Revolver ist? Bestimmt kaum einer! Ich kann nur sagen, dass diese Waffe des kleinen Mannes weder für das Leben noch für die Gesundheit der lieben Mitmenschen eine Gefahr darstellt. Ihre Hauptwirkung war und ist rein psychologischer Art. Zugegeben, aus der Distanz sieht ein Knallfix aus wie ein richtiger Revolver. Nimmst du ihn aber in die Hand, merkst du sogleich, dass er federleicht ist. Er besteht aus Dünnblech (heute würde man Plastic verwenden). Als Munition dient schlicht und einfach ein Korkzapfen. Allerdings handelt es sich um einen speziellen, mit einem Knallkäpsli bestückten Korkzapfen. Beim Laden drückt man ihn vorne in den Lauf. Sobald abgedrückt wird, schlägt ein Stift auf die Knallerbse. Es klepft und raucht und stinkt und der Zapfen fliegt ein paar Meter weit. Wie gesagt, harmlosere Waffen gab es kaum seit der Erfindung des Pfeilbogens. Wie ein Knallfix-Revolver in meinen Besitz kam, weiss ich nicht mehr. Auf alle Fälle hatte Mutter ihr Einverständnis gegeben zum Erwerb. Vermutlich deshalb, weil diese Waffe ungefährlich war, jedoch als wirksames Selbstverteidigungsmittel gegen böse Hunde dienen konnte. Gegen diese Gefahr wurden auch andere, natürlichere Mittel propagiert. So herrschte bei uns eine Zeitlang der Aberglauben, wenn man einem kläffenden, zähnefletschenden Hund das Hinterteil zuwende, sich niederbeuge und ihn zwischen den Beinen hindurch ansehe, gerate das Tier in eine regelrechte Panik und ergreife alsbald die Flucht. Mutter hatte von dieser Methode im „Schweizer Spiegel“ gelesen, jener Zeitschrift, die sie jeden Monat mit grosser Begeisterung verschlang. Übrigens auch mit grossem Gewinn. Der „Schweizer Spiegel“ war interessant und hatte Niveau. Mutter sprach mit grossem Respekt von Herrn Guggenbühl, dem Herausgeber und Hauptredaktor. Mit dem Hunderezept lag er allerdings falsch. Das Experiment wurde mehrmals ausprobiert. Doch der Erfolg war gering. Mäders Hund jedenfalls kläffte noch heftiger, wenn man ihm den Hintern zuwandte und ihn durch die Beine anguckte.Darum machte es Sinn, zu gröberen Verteidigungsmitteln zu greifen. Mit dem Knallfix-Revolver bewaffnet wagte ich mich eher bei Mäders Haus vorbei. Geschossen habe ich dort allerdings nie. Ich hätte mich vor Mäders Meitschi und Buben geniert. Hundefurcht und Menschenscheu hielten sich lähmend die Waage.
Mit Waffen auf Menschen zu zielen, war strengstens verboten – auch wenn sie harmlos waren. Man durfte dies nicht einmal mit einem Holzgewehr tun. Das wurde mir von frühester Jugend an eingebläut. Darum jagte mir ja auch der Chacheli Housi mit seiner verkehrt gehaltenen Tabakpfeife einen metaphysischen Schrecken ein. Manchmal gerät der Mensch allerdings in Situationen, in denen die idealsten Grundsätze ins Wanken geraten. Eine derartige Situation erlebten Freund Heinz und ich gelegentlich auf dem Nachhauseweg von der Sekundarschule. Wir wurden von älteren Buben schikaniert und gedemütigt. Rädelsführer bei diesem verwerflichen Tun waren zum Beispiel die Neuntklässler Rönu und Heinu, manchmal assistiert von Rönus Cousin Kurt. Sie hänselten uns, kommandierten uns herum, drohten mit allen möglichen harten Strafen, falls wir ihnen nicht gehorchten. Hie und da legten sie sogar Hand an uns arme Knäblein. Eine unerträgliche Situation, die sich verschlimmerte, wenn wir im Winter zu Fuss in die Schule gehen mussten. Auf dem gemeinsamen Schulweg mit den Bösewichten plagten uns die drei Statiönler noch ungenierter. Denn der wenig begangene Weg führte über weite Strecken durch den Wald. Da war weit und breit keine Menschenseele, welche die Untaten hätte beobachten oder uns gar hätte beistehen können. In unserer Not nahmen Heinz und ich, beide Besitzer eines Knallfix-Revolvers, die geladene Waffe in den Hosensack. Wie erwartet begann auf besagtem Waldweg wieder der Terror. Gleichzeitig und für die Gegner überraschend, wie im wilden Westen, zogen wir die Revolver. Als dies nichts nützte und sich die Unholde trotzdem bedrohlich näherten, drückten wir ab. Der Erfolg war prächtig. Rönu hatte ein Korkstück ans Bein gekriegt. Es schmerzte gewiss nicht sehr, aber der Schock war erheblich. Rönu zog sich kleinlaut zurück und brüllte aus sicherer Distanz, das werde er morgen dem Lehrer, dem Schlachter Sami, melden. Der werde uns dann schon diese und jene Strafe aufbrummen. Schlachter Sami erhielt nie eine Meldung. In den nächsten Tagen trugen Heinz und ich unsere Revolver noch im Hosensack. Aber man liess uns in Ruhe. Die Widersacher behandelten uns sogar mit einem gewissen Respekt. Das erlaubte uns, den Schulweg fortan wieder unbewaffnet unter die Füsse zu nehmen. Der Besitz des Knallfix-Revolvers förderte übrigens meine Begeisterung für die Indianer. Von den Buffalo-Bill Heftchen habe ich bereits erzählt, auch von Vaters Interessen für die amerikanischen Prärie- und Waldindianer. Unser gemeinsames Interessen erfuhr eine denkwürdige Krönung. In Bern wurde eine Indianer-Ausstellung eröffnet. Vater liess es sich nicht nehmen, mich an diese Ausstellung zu begleiten. Per Velo fuhren wir in die Berner Schulwarte. Man stelle sich vor: ein Bauersmann, der an einem sonnigen Werktag die Arbeit liegen lässt und seinem Jüngsten beziehungsweise den Indianern einen ganzen Nachmittag opfert! Unerhört.
Nach Abschluss der siebenten Klasse verliess ich die Sekundarschule Allenlüften. Man steckte mich ins Städtische Progymnasium Bern. Es hiess Abschied nehmen von meinen Klassenkameraden, insbesondere von meinem Schulschatz Annelies. Ich hatte nie gewagt, ihr meine Liebe zu gestehen. Ich gab mich zufrieden mit vermeintlichen oder wirklichen Mini-Signalen ihrer Zuneigung. Zum Abschied legte ich in ihr Pult ein Herz, das ich aus Holz geschnitzt, fein abgeschliffen und lackiert hatte. Und das alles ohne Abschiedsbrief, sogar ohne Initialen! Ob sie je erraten hat, wer ihr dieses Andenken zudachte, wusste ich viele Jahre nicht. Erst lange nach der Pensionierung habe ich sie gefragt. Dies auf Wunsch meiner Enkelin Hannah, der ich von meinem Liebesabenteuer erzählt hatte. Sie habe mich als Urheber vermutet, gestand Annelies. Ausgelöst hatten den einschneidenden Schulwechsel die Pfarrersleute aus Münchenbuchsee. Meine Mutter war seit ihrer Schulzeit mit der Pfarrfrau befreundet und hatte stets den Kontakt behalten. Das Ehepaar überredete meine Mutter (und damit auch meinen Vater), mich nach Bern zu schicken, weil man in der zweitobersten Progyklasse mit Latein beginne. So werde der spätere Übertritt ins Gymnasium nahtlos erfolgen können. Mutter begann, mich sanft vorzubereiten. Einmal, als wir in Bern Einkäufe machten, führte sie mich auf den Waisenhausplatz und zeigte mir ein grosses, unwirtliches Gebäude. Was ich sagen würde, wenn ich einmal hier zur Schule ginge? Ich fand diesen Vorschlag schrecklich. „Ich käme mir vor wie ein kleines Tierlein, das man in einem Holzschuh auf dem Meer aussetzte“, antwortete ich. Trotzdem musste ich die bittere Pille schlucken. Mutter hatte ein Rendez-vous mit Rektor Pflugshaupt. Sie zeigte ihm meine Zeugnisse und fragte nach den Aufnahmebedingungen. Er antwortete, Kinder vom Lande seien ihm sehr willkommen. Ich solle einfach eintreten, ohne Prüfung. Nach einem Quartal sehe man schon, wie die Sache stehe. Glücklicherweise stand sie nach dem Probequartal so übel nicht.

Stufen der Erleuchtung
Mein Weg zum Christentum begann in der Sonntagsschule unter der Fluh. Dort, in einem alten Stöckli, befand sich ein Versammlungsraum. Er diente den Zusammenkünften der Evangelischen Gesellschaft und eben der Sonntagsschule. An den Wänden prangten Plakate, auf denen mit roter und schwarzer Tinte, in grossen gotischen Buchstaben geschriebene Sprüche standen. Zum Beispiel: IST GOTT FÜR UNS WER MAG WIDER UNS SEIN. Mir war und blieb es ein Rätsel, was der liebe Gott m it einem Widder zu tun haben könnte. Als Sonntagsschul-Lehrer amtete unter anderen Herr Müller. Im Gäu oberhalb Gümmenen betrieb er eine Sattlerei. Am Sonntag aber wandelte sich das dürre Männchen zum Kindermissionar. Er erzählte mit monotoner, dünner Stimme die biblischen Geschichten. Es war sehr langweilig. Ich erinnere mich nur an ein Wort, das ihm offenbar sehr, sehr wichtig war: die Israeliten murrten in der Wüste. Der genaue Sinn dieses Wortes blieb mir verschlossen. Ich spürte allerdings, dass dieses Murren etwas ganz Wüstes war. Die Israeliten sollten sich schämen, immerfort zu murren. Um eine Spur interessanter war die Sonntagschule bei Freiburghaus Martha. Sie war sehr lieb, aber auch ziemlich langweilig. Am deutlichsten in Erinnerung geblieben ist mir ihr Gesicht beim Singen. Martha pflegte die Augen gen Himmel zu erheben und sperrte den Mund unglaublich weit auf. Noch nie hatte ich jemanden auf diese Weise singen sehen. Am liebsten war mir Marthas Schwester, das Gritli. Es war nicht nur hübscher als Martha, sondern auch fröhlicher und hatte eine gewinnende Art. Leider tauchte es nur ab und zu auf, wenn Martha verhindert war. Wichtig war natürlich die Sonntagsschul-Weihnacht. Jedes Kind bekam einen Zettel mit einem kurzen Versli, welches am Festli aufgesagt werden musste. Von der Episode mit Baumgart Päuli habe ich bereits erzählt. Natürlich hatte jedes von uns Lampenfieber, in der überfüllten, backofenheissen und im hinteren Teil völlig dunklen Stube sein Verslein zum Besten zu geben. Doch meistens schafften wir es. Jahr für Jahr gab es ein Geschenk, einmal einen Teller, ein anderes Mal eine Tasse, einmal auch ein schönes hölzernes Sparkässeli. Etwa in der dritten oder vierten Klasse weigerte ich mich, weiterhin die Sonntagsschule zu besuchen. Irgendwie widerstand mir plötzlich der süssliche und meist langweilige Ton. Meine Eltern akzeptierten meine Weigerung. Sie hatten eine unterschiedliche Distanz zur Evangelischen Gesellschaft. Vater spielte im Posaunenchor mit. Daher nahm er öfter an Versammlungen teil. Gelegentlich merkte man auch seine Prägung durch die überaus fromme Grossmutter. Dass Mädchen die Haare abschnitten, kurze Röcke oder gar Hosen trugen war für ihn lange ein Problem. Als ich während der Gymerzeit einen Tanzkurs besuchte, hatte er schlaflose Nächte. Immer wieder musste Mutter für ihre zu wenig frommen Kinder Fürsprache einlegen. In ihrer Familie war man nie in die „Stunde“ gegangen. Seit je hatte sie eine freiere, unverkrampfte Haltung gegenüber sogenannt weltlichen Sitten. In die Kirche ging sie aber recht oft und nicht ungern. Es war üblich, dass am Sonntagmorgen mindestens eine Person pro Familie den Gottesdienst besuchte. Manchmal schickte sie auch die Jumpfer oder die erwachsenen Kinder. Nach einem einstündigen Fussmarsch war man in Mühleberg. Wenn man nach der Predigt zügig heimwärts schritt, kam man gerade recht zum Mittagessen.
In die Zeit der Sonntagsschule fiel auch die Entdeckung der Kinderbibel, illustriert von Julius Schnorr von Carolsfeld. Die Bilder haben sich mir unauslöschlich eingeprägt. Wie der bärenstarke Simson den Philistertempel zum Einsturz brachte, wie der aufrührerische Absalom an seinen langen Haaren an einem Ast hängen blieb, wie das Blut in einem dicken Strahl aus der Stirne Goliats hervorschoss oder wie der Heiland die Kinderlein segnete – das war ebenso eindrücklich wie der Tanz ums goldene Kalb oder der zornige Mose, der die Gesetzestafeln zerschmetterte. Prägend war natürlich auch die Darstellung des lieben Gottes. Friedlich sass er auf einer Wolke und sandte eine Taube auf die Erde. Im Paradiesgarten wandelte der freundliche ältere Herr mit Bart und wallendem Gewand sogar persönlich auf dem Erdboden. Schade, dass Adam und Eva so dumm waren, diesen Apfel zu pflücken. Das musste ja den lieben Gott ärgern. Er schickte den Erzengel mit einem schrecklichen Flammenschwert, die beiden aus dem Paradies zu vertreiben. Damit war ein für alle Mal klar: Ungehorsam lohnt sich nicht. Ich muss der Schnorr’schen Kinderbibel zu Gute halten, dass sie bei mir keineswegs Ängste vor einem strafenden und richtenden Gott weckte. Vielmehr beflügelten die Bilder meine Fantasie und umgaben die biblischen Figuren mit einem Hauch von Romantik.
Von der siebenten Klasse an hatten wir die Kinderlehre zu besuchen. Niemand wurde gefragt, ob es ihm passte oder nicht. Eine Weigerung wäre bestimmt nicht akzeptiert worden. Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir jeden zweiten Sonntag anzutraben, und zwar bereits zur Predigt. Im zweiten und dritten Bank, alphabetisch geordnet, hatten wir uns hinzusetzen. Die Buben rechts, die Mädchen links. Den Mädchen bot sich der Vorteil, unmittelbar hinter dem Pfarrstuhl sitzen zu dürfen. Da gab es immer etwas zu begutachten, zum Beispiel die rassigen Pfarrerssöhne Paul und Kari oder den grossen schwarzen Schlapphut der Frau Pfarrer Huber. Auch sie hatte übrigens einen Tick beim Singen. Sie büschelte den Mund ganz merkwürdig und drückte die Unterlippe gegen die obern Zähne. Es sah umwerfend komisch aus. Meine Schwester Madeleine vermochte sie wunderbar zu imitieren, wenn sie etwa sang „Aus irdischem Getümmel.“ Herr Pfarrer Karl Huber erschien uns als wahrer Pfarr-Herr. Selbstverständlich war er immer schwarz gekleidet, oft trug er einen frackartigen Cutaway. Das sah besonders lustig aus, wenn er auf dem Velo sass. Sehr steif und gerade hielt er sich im Sattel und die Schwänze seines Oberkleides flatterten fröhlich im Wind. Nach der Predigt verschwand Pfarrer Huber jeweils für fünf Minuten, um die Garderobe zu wechseln. Den Talar hängte er an den Nagel. Dafür trat er mit seinem geschwänzten Oberkleid vor uns. Hinter vorgehaltener Hand nannten wir ihn etwa „die Krähe“. Nicht von ungefähr. Wenn er sich vor uns hinstellte, drückte er den Bauch nach vorne und bewegte ruckartig den Kopf, so dass seine grosse Nase wie ein Schnabel wirkte. Dazu bewegten sich die langen, rund nach hinten geschnittenen Schwänze seines Cut wie schwarze Flügel. Zu Beginn der Kinderlehre fragte er immer: „Der Text?“ Oft blieben wir stumm, da wir bei der Bekanntgabe des Predigttextes nicht genügend aufgepasst hatten. Es war schon viel, wenn jemand sagen konnte, ob dieser sogenannte Text aus dem Alten oder Neuen Testament stamme. Wenn ihm im Verlaufe des Unterrichts etwas besonders wichtig war, legte er den Finger an die Lippen und flüsterte bedeutungsschwer: Kinder, Kinder, die Stunde ist ernst! Weshalb das so war, begriffen wir nicht recht. Unsere Welt und die des Pfarrers waren unendlich weit voneinander entfernt. Anders war das nur, wenn hie und da einmal der Pfarrerssohn Paul die Kinderlehre hielt. Er studierte damals Theologie und durfte seinen Vater gelegentlich vertreten. Seine frische Art hob sich wohltuend vom gestelzten Pathos des Vaters ab. Bei Pfarrers Paul wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass der Glaube mit meinem Leben etwas zu tun haben könnte. Ab und zu wurde Pfarrer Huber durch pensionierte Pfarrer vertreten. An einen dieser Stellvertreter, Pfarrer Riesen, habe ich eine ausgesprochen schlechte Erinnerung. An jenem Sonntag war bei meiner Schwester Frieda in Hettiswil Taufe. Natürlich war ich dazu eingeladen. Ich rechnete aus, dass ich unter normalen Bedingungen und, wenn ich energisch genug pedalte, zum Mittagessen bei der Festgesellschaft sein würde. Ich hatte gewaltiges Pech. Pfarrer Riesens Predigt wollte und wollte einfach nicht enden. Mehr als ein Dutzend Mal machte er eine kurze Pause und man durfte hoffen, jetzt biege er in die Zielgerade ein. Aber nein, immer wieder kam ihm etwas in den Sinn. Es leierte und plätscherte von der Kanzel herab, ein Ende war nicht abzusehen. Nie habe ich seither in einer Kirche derartige Aggressionen entwickelt. Ich hätte den Plauderi steinigen können. Mehr als anderthalb Stunden dauerte die Predigt. Dann kam erst noch die Kinderlehre. Auch die zog Pfarrer Riesen unerträglich in die Länge. Wütend und völlig verschwitzt langte ich endlich in Hettiswil an. Zum Glück hatten sie das Dessert für mich aufgespart.
Den Konfirmandenunterricht besuchte ich bei Pfarrer Jampen in Bern. Er war anders als sein Kollege Huber. Er hatte Humor, konnte mit Jugendlichen umgehen und erzählte Geschichten, von denen ich die eine oder andere im Gedächtnis behalten habe. Konfirmiert wurde ich in der Heiliggeistkirche in Bern. Der Konfirmationsspruch, den Pfarrer Jampen mir auf meinen Lebensweg mitgab, gefiel mir viel weniger als das Konfirmationslied. Wir hatten es nach einigen Diskussionen mit grosser Mehrheit gewählt: «Ach wie flüchtig, ach wie nichtig ist des Menschen Leben! Wie ein Nebel bald entstehet und auch wieder bald vergehet, so ist unser Leben, sehet». Bis auf den heutigen Tag ist es mir rätselhaft, wie eine doch recht lebenslustige Gruppe Jugendlicher zu dieser Wahl gekommen ist.
Noch immer aber war ich auf dem Weg zur Erleuchtung nicht sehr weit fortgeschritten.

Vom Land in die Stadt
Es fiel mir schwer, sehr schwer, in eine städtische Schule einzutreten. Am ersten, schicksalsschweren Tag stieg ich in Rosshäusern in den Zug, mit sehr gemischten Gefühlen. Im Bahnhof Bern erwarteten mich Pfarrer Ludi und sein Sohn Res. Er begleitete uns zum Progy, lieferte seinen Sohn in der Klasse IIC und mich in der Klasse IIA ab. Dreissig Augenpaare starrten mich an wie den Mann im Mond. Ich war der einzige Neuling. Die Andern kannten sich seit zwei Jahren. Schon äusserlich sah man mir die ländliche Herkunft an. Alle Buben trugen damals Knickerbocker-Hosen, ich aber kam mit altmodischen langen Hosen daher, die zudem auf Hochwasser standen. In der Folge bedrängte ich meine Mutter so lange, bis sie auch mir diese Golfhosen (vulgo Gagelfänger) kaufte. Nicht nur mein Äusseres wurde sehr kritisch beurteilt.Man prüfte auch, wie dieser Neue auf Hänseleien reagierte. Konnte man ihm leicht einen Bären aufbinden? Wehrt er sich, wenn er angegriffen wird? Und wenn ja, verfügt er über einige Muskelkraft?
Anders als mit meinen Mitschülern hatte es mit Rektor Pflugshaupt keine Probleme gegeben. Er nahm mich prüfungsfrei auf. Einerseits auf Grund meiner Zeugnisnoten, anderseits aber – vor allem? –, weil er eine Vorliebe hatte für Landkinder. Seiner Meinung nach war die Landschaft so etwas wie ein Jungbrunnen, aus dem einfache, nicht verwöhnte, fleissige und von städtischer Jugendunkultur noch nicht verseuchte Zöglinge hervorgingen. In der Tat hatte ich gegenüber den Mädchen eine grosse scheue Distanz. Flirten, gemeinsam eine Party oder das Kino besuchen, schäkern oder gar knutschen – das wollte ich nicht. Besser gesagt: das wollte ich nicht, weil ich es nicht konnte. Da waren mir ein paar Klassenkameraden, Bruno B. oder Hans G. zum Beispiel, meilenweit voraus. Auf sie und ein paar Mädchen bezog sich Rektor Pflugshaupt wohl, als er der Klasse vorhielt, es sei so schwül, schrecklich schwül, und die „guten Elemente“ hielten sich zu sehr im Hintergrund. Nach einigen Wochen besserte sich das Klima und ich wurde kaum mehr ausgezählt. Den Grund für diesen Wandel kannte ich nicht. Erst viele Jahre später hörte ich rein zufällig eine Erklärung. In Erlach befreundeten wir uns mit einem Ehepaar, welches mit einem meiner ehemaligen Progy-Kameraden verwandt war. Dieser erzählte ihnen einmal, der Balmer sei seinerzeit als „Ruech“ gefürchtet gewesen. Das verwunderte mich sehr. Denn mir waren höchstens kleine Rangeleien, niemals aber echte Schlägereien oder Drohungen erinnerlich.
Öfter zeigte es sich, dass die Sekundarschule Allenlüften – damals bloss vierklassig – Bildungslücken offen gelassen hatte, beispielsweise in der Grammatik. Begriffen wie aktiv, passiv, Adverb, Prädikat, Plusquamperfekt und Attribut war ich nie begegnet. Lehrer Bühler brachte es mir handfest bei. Er rüttelte mich an der Schulter und sagte: du bist passiv, ich bin aktiv. Wie das Exempel zeigt, habe ich diese Lektion nicht vergessen. Allmählich fühlte ich mich sicherer. Bei Rektor Pflugshaupt, der Mathematik und Geografie unterrichtete, war ich gut angeschrieben. Lehrer Bühler, später Seminardirektor, rühmte einen meiner Aufsätze. Ich durfte – musste – ihn vorlesen. Einmal stellte Bühler die Frage, wer den bekannten Verfasser klassischer englischer Theaterstücke kenne. Mehrere Hände schossen in die Höhe. Einer, der die richtige Antwort gegeben hatte, musste den Namen an der Wandtafel schreiben. „Shakespeare“ kritzelte er mit Kreide auf die schwarze Fläche. Das beeindruckte mich tief. Noch nie in meinem Leben hatte ich von diesem Herrn gehört oder gelesen. Noch weniger hatte ich einer Aufführung seiner Stücke im Theater beigewohnt. Es stellte sich dann heraus, dass in den väterlichen (oder mütterlichen) Bibliotheken mancher Klassengenossen Gesamtausgaben dieses Herrn Shakespeare standen. Wahrscheinlich als goldgeprägte Luxusausgaben. Später merkte ich freilich, dass meine Kameraden wohl den Namen kannten. Doch kaum einer hatte jemals einen Band dieses Klassikers aufgeschlagen. Mein Ehrgeiz war geweckt. Wenig später, wohl im Gymnasium, erwarb ich mir nach und nach antiquarisch und billig die Gesamtausgaben von Shakespeare und Goethe. Jene von Schiller bekam ich geschenkt. Gottfried Kellers gesammelte Werke waren bereits in meinem Besitz. Chrigu, der im Forst jahrzehntelang als Knecht arbeitete, schenkte mir die von ihm nie gelesenen Bände. Ich halte sie, stockfleckig und in alter Schrift, immer noch in Ehren. Mit Ausnahme Goethes habe ich alle Gesamtausgaben während des Gymnasiums durchgeackert. Die Königsdramen Shakespeares allerdings, das sei gestanden, nur diagonal und ohne Begeisterung. Die geschichtlichen Zusammenhänge, die ewigen Intrigen und Morde, gerieten mir durcheinander und ich verspürte keine Lust, die Materie vertieft zu verarbeiten. Vom blutrünstigen Stück „Titus Andronicus“ war ich geradezu angewidert und paradoxerweise auch gelangweilt. Keinen Rückstand hatte ich im Turnen. Meine Leistungen konnten sich sehen lassen und ich sammelte ein paar Pluspunkte. Allenlüften und das Schulschätzeli Annelise gerieten mehr und mehr in Vergessenheit. Ein neuer Mädchenschwarm zog meine Verehrung auf sich. Evi Schwengeler, dunkelhaarig und dunkeläugig, Tochter aus gutem Haus, weckte meine Sehnsüchte. Die blieben freilich vor der Welt verborgen und blühten bloss in meinem Herzen. Daneben gefielen mir aber auch Cordelia Guggenheim und Linda Geiser, die später im Fernsehen und im Theater zu einiger Berühmtheit gelangten. Leider schenkte mir keine von den Dreien irgendwelche Beachtung.
Damals war es vorgeschrieben, die Progymütze zu tragen. Sie war dunkelblau mit roten Rändern und einem festen Schirm. Die Vorschrift hatte natürlich einen Grund. Man sollte, wenn irgendwo Ungereimtes oder Unanständiges geschah, die Prögeler sogleich erkennen. Mir war diese Mütze zutiefst und von ganzem Herzen zuwider. Ausser Sichtweite des Progers packte ich sie in die Mappe. Dass sie dort arg zusammengequetscht wurde und ihre Form einbüsste, kümmerte mich wenig. Im Gegenteil. Beim Anmarsch aufs Progy stülpte ich den Tschäppel wieder aufs Haupt. Allerdings erst im Sternengässchen ( vulgo „Schissigässli“, wegen dem dortigen stinkenden Pissoir). Denn dieses Gässchen mündete in die Speichergasse. Dort pflegte der Rektor, vom Falkenplatz herkommend, in die Schule zu stolzieren. Ihm wollte man wahrlich nicht unbedeckten Hauptes begegnen.
In der Pause begab man sich auf den Waisenhausplatz. Wenn ich mich richtig erinnere, war er für den Verkehr gesperrt. Es mag auch sein, dass der Autoverkehr so spärlich war, dass er uns oder wir ihm nicht in die Quere kamen. Uns gehörte allerdings nur die eine Hälfte des Waisenhausplatzes. Die andere Hälfte war für die Damen der Neuen Mädchenschule reserviert. Die hatten allerdings nie gleichzeitig Pause. Das wäre wohl viel zu gefährlich gewesen. Für sie, nicht für uns. Denn unsere Klassen, wenigstens die A- und die B-Reihe, waren gemischt.Zweimal in der Woche herrschte zusätzlicher Betrieb. An der Hodlerstrasse fanden sich die Autohändler mit ihren Gebrauchtwagen ein. Da bestaunte man natürlich sehr gerne die exotischen Modelle. Die Studebaker, vorne und hinten gleich aussehend, wurden besonders bewundert. Manchmal bot sich auch Gelegenheit, ein MG-Cabriolet oder einen hochrädrigen Bugatti zu bestaunen. Am Dienstag wurde es laut. Der Waisenhausplatz war nämlich Schauplatz des Säulimärits. Vom Klassenfenster im zweiten Stock aus liess sich das Treiben besonders gut beobachten. War das ein Kommen und Gehen und Quietschen und Schreien! Am ersten Mai paradierte der Umzug vor unseren Fenstern. Wir schauten gespannt auf die Fahnen und Transparente der Demonstrierenden. Keineswegs aus Interessen am Fest der Arbeit oder am Sozialismus. Vielmehr suchten wir den Umzug ab nach Peter Läufer, unserem Klassenkameraden. Er war der Einzige, dessen Eltern am Tag der Arbeit um Schuldispens baten. Der Vater arbeitete wahrscheinlich in irgendeiner Gewerkschaft. Wir hatten das Gaudi, wenn wir ihn als Fahnenträger entdeckten, und machten uns mit Rufen bemerkbar. Ihm selber war es ganz offensichtlich peinlich, vor der Klasse und dem ganzen Schulhaus paradieren und sozusagen ein linkes Bekenntnis ablegen zu müssen. Zwei Jahrzehnte später hörte man Peter Läufers Stimme häufig am Radio, als Sprecher im Regionaljournal, glaube ich.
Die schöne Stadt Bern war auch ein klitzekleines Sündenbabel, das mich in seinen Sog zog. Meine Hauptsünde bestand im Diebstahl oder, besser gesagt, in der Anstiftung zu demselben. In der neu eröffneten Migros an der Marktgasse wurden wunderbare Caramels feilgeboten. Einige meiner Klassenkameraden, der Benjamin Wirz zum Beispiel, machten es sich zum Sport, diese Caramels zu klauen. Ich selber wagte nicht, es ihnen gleich zu tun. Ich wäre sicher so ungeschickt vorgegangen, dass man mich beim ersten Mal erwischt hätte. Dafür beauftragte ich den Wirz und der betätigte sich, stellvertretend für mich, als Dieb. Ob er dies freiwillig tat oder aus Angst vor meiner Physis, kann ich nicht beurteilen. Die Caramels waren auf alle Fälle wunderbar süss und weich und sie hatten einen köstlichen Abgang. Auf der anderen Seite des Waisenhausplatzes, hinter der Wirtschaft Bärehöfli, hatte ein alter Schuhmacher seine Werkstatt. Glatzköpfig, runzlig, mit einer runden Stahlbrille zog er den Spott von uns Jungen auf sich. Wir näherten uns immer nur in Gruppen seiner Werkstatt und titulierten ihn als Mohammed. Das ärgerte ihn gewaltig. Wütend erschien er unter der Tür. Wir ergriffen die Flucht und hörten hinter unsern Rücken allerhand Schimpfworte. Der Kitzel dieses Rituals rief natürlich immer wieder nach einer Wiederholung.
Zwei Ereignisse der Progerjahre sind mir in besonderer und guter Erinnerung geblieben: die Aufführung des Oratoriums „Samson“ und eine Aufführung mit selber gestalteten Marionetten. Zum Thema „Samson“ gehört die Schilderung des Singlehrers Ernst Schläfli. Er hatte eine ansehnliche Karriere als Oratorien- und Konzertsänger hinter sich, verdiente aber sein Brot als Singlehrer am Progy. Er hielt sich selber für einen herausragenden Künstler und versteckte die hohe Meinung von sich selbst keineswegs. Hinweise auf erfolgreiche Konzerte und Engagements zusammen mit noch berühmteren Sängern waren nicht selten. Insbesondere war er stolz auf seine Bauchmuskulatur. Hart wie Eisen sei die. Zum Beweis rief er den Stärksten aus unserer Klasse zu sich und liess ihn kräftig gegen den Sängerbauch boxen. Schläfli hatte aber auch seine positiven Seiten. Zum Beispiel lud er seine Freunde aus dem Stadtorchester regelmässig ein, damit sie uns ihr Instrument erklärten. Einige Herren sind mir noch deutlich in Erinnerung: Herr Leibundgut, Flöte: Herr Zurbrügg, Geige; Herr Tautenhahn, Oboe; Herr Kägi, Trompete. Dankbar bin ich dem etwas merkwürdigen Paradiesvogel aber auch, dass er mit uns die Chöre des Oratoriums „Samson“ von Händel einübte und uns bis zum Konzert führte. Ein ad-hoc-Orchester und einige Solisten wurden beigezogen und in der französischen Kirche fand das Konzert statt. Für mich ein grosses Erlebnis. Noch heute höre ich den Tenor Jaussi (von Beruf Zahnarzt, aber mit Engagements weit herum) als geblendeter Samson mit der Arie „Nicht Sonn, nicht Mond, kein mi-hi-hi-hil-der Schein erhellet meinen Pfad…“ Mag sein, dass dieses Erlebnis meine spätere Hochschätzung des Händel’schen „Messias“ begründete.
Zwei andere Lehrer übten mit uns ein Marionettenspiel ein. Herr Hermann Bühler, später Seminardirektor, bearbeitete ein Märchen. War es wohl „Sechse kommen durch die ganze Welt“? Der Zeichnungslehrer Walter Schönholzer (Jahrzehnte später mein Duzfreund) fertigte mit uns die Marionetten an. Unsere Mütter schneiderten die Kostüme für die Figuren. Meine Rolle bzw. Figur war der Starke Mann. Ich hatte ihm einen mächtigen runden Schädel verpasst und meine Mutter schneiderte die Gewandung: zu den blauen Hosen ein kariertes Hemd und ein knallgelbes Halstuch. Der Bursche erntete dann auch grossen Beifall. Jedes in unserer Klasse hatte eine Aufgabe, als Spieler, Sprecher oder Kulissenschieber. Die damals noch unübliche fächerübergreifende Zusammenarbeit empfanden wir als überaus befriedigend. Natürlich nahmen wir auch den Beifall des Publikums – meistens Eltern – gerne entgegen.1948 sollte in Montevideo, Uruguay, eine Weltausstellung stattfinden. In der Ausstellung sollten unter anderem Schülerzeichnungen aus aller Welt gezeigt werden. Herr Schönholzer war eingeladen, einige Zeichnungen nach Südamerika zu senden. Für die kleine Kollektion wählte er auch ein Bild von mir. Ich war sehr stolz. Nach ein paar Monaten allerdings musste er uns mitteilen, die Weltausstellung habe gar nicht stattgefunden. Daher gebe er unsere Kunstwerke wieder zurück.
Mein Eintritt in die zweitoberste Progyklasse traf sich mit dem Beginn des Lateinunterrichtes. Mit Herrn Neuenschwander, Schweo genannt, hatten wir einen jungen, begeisterungsfähigen Lehrer. Aber auch bei ihm ging es nicht ohne unermüdliches Vokabeln büffeln und ohne trockene Grammatikübungen. Dass jemand in unserer Klasse eine besondere Liebe zum Lateinischen oder zu Kultur und Geschichte der Römer entwickelt hätte, ist mir nicht aufgefallen. Man war nun halt in dieser Klasse und hatte nun mal auch dieses Fach, das von den „Humanisten“ als einmalige Denkschule gerühmt wurde. Ich hatte weder eine besondere Freude noch eine besondere Abneigung gegen dieses Fach. Hingegen habe ich, viel später, die verherrlichende Ideologie der Latein- und Griechischlehrer in Frage gestellt. Wieso sollte man Grammatik nicht auch in andern indogermanischen Sprachen verstehen lernen? Wieso hätte Latein besonders edel und für die Menschenbildung einmalig sein sollen?
Mit den Lehrern hatte ich Glück. Rektor Pflugshaupt (Mathematik und Geografie), Bühler (Deutsch und Geschichte), Schönholzer (Zeichnen), Schläfli (Singen) und Neuenschwander (Latein) habe ich bereits erwähnt. Herr Gonzenbach war ein langweiliger, aber netter Französischlehrer. In diesem Fach hatte ich besondere Defizite. In der Sekundarschule Allenlüften herrschte ein äusserst gemächliches Lerntempo. Die Methoden waren antiquiert. Gonzenbach hatte viel Geduld mit mir. Nach einigen Monaten hatte ich den Rückstand aufgeholt. Für den Turnunterricht mussten wir mit unsern Turnsäcklein via Waisenhausplatz, Bärenplatz und Bundesrain ins Schwellenmätteli pilgern. Der Gang durch die Stadt bot natürlich willkommene Abwechslung. Im Schwellenmätteli empfing uns Georges Mischon, ein Gemütsathlet, dem nebst der sportlichen Ertüchtigung auch das Berndeutsch ein Anliegen war. Er ärgerte sich zum Beispiel über die Verwechslung der berndeutschen Artikel oder der Zahlworte und wiederholte immer wieder: zwo Froue, zwe Manne, zwöi Ching. Die Parallelklassen hatten zum Teil weniger Glück mit ihren Lehrern. Da gab es zum Beispiel den Lateinlehrer Müller, „Mule“, der nicht nur stur Grammatik büffeln liess, sondern auch berüchtigt war für seine harten Kopfnüsse. Besonders gefürchtet war aber Pfister alias Pfuschi. Ein kleines Männchen, runzliges Gesicht, stechende Äuglein, zuständig für Mathematik. Die guten Rechner hatten nichts zu fürchten. Wehe aber den Faulen und den Unbegabten. Unbarmherzig hackte er auf ihnen herum, sodass ihnen die Mathematikstunden zum absoluten Alptraum wurden. Mehrere Jahre vor meinem Eintritt hatte sich einer von Pfuschis Schülern in eine derartige Verzweiflung hineingesteigert, dass er des Vaters Armeepistole an sich nahm und in einem Moment, wo er nur Pfuschi im Lehrerzimmer wähnte, anklopfte. Als sich die Türe öffnete, schoss er. Getroffen wurde jedoch nicht Pfister, sondern der gutmütige Religionslehrer Streuli. Glücklicherweise war der Schuss nicht tödlich. Immerhin verlor das unschuldige Opfer ein Auge. Auf alle Fälle war ich tief dankbar, dass es mich nicht in eine von Pfuschis Klassen verschlagen hatte. Selbst eine zufällige Begegnung auf der Treppe oder in den Korridoren rief Schrecken hervor. Später stellte ich mir gelegentlich die Frage, ob dieses Männchen die Angst nicht kultiviert habe. „Ich bin klein, aber passt nur auf, mit mir ist nicht zu spassen! Wenn ihr mich schon nicht mögt oder sogar hasst, dann sollt ihr erst recht zittern!“
Ein besonderes Kapitel war das so genannte Schulbaden. Während des Sommers waren wöchentlich zwei Lektionen angesetzt, jeweils von 11 bis 12. Die Schwimmer begaben sich ins Marzilibad bzw. in den „Bueber“, der längst verschwunden ist. Die Nichtschwimmer hingegen hatten sich in der KaWeDe einzufinden. Aus unserer Klasse waren dies nur Beat Meyer und ich. Der rothaarige, etwas bärbeissige Herr Burri führte uns in die Grundlagen der Schwimmkunst ein. Im Laufe des zweiten Sommers hatte er uns so weit gebracht, dass wir zur Prüfung für den Übertritt zu den Schwimmern antreten konnten. 50 Meter Brustschwimmen war kein grosses Problem. Im bloss 1 m tiefen grossen Becken der KaWeDe konnte man leicht und unbemerkt abstehen und ein wenig ruhen. Auch das Rückenschwimmen gelang leidlich. Stolz meldeten sich Beat und ich in der folgenden Woche bei Herrn Michel im Bueber. Leider traf es sich, dass wir gleich mit Übungen im Rettungsschwimmen beginnen mussten. Auf dem Rücken schwimmend musste man den Kameraden abschleppen und seinen Kopf sorgsam über Wasser halten. Das gelang uns beiden miserabel. Statt den Kopf des zu Rettenden über Wasser zu halten zogen wir ihn, selber halb ertrinkend und japsend, unter Wasser, sodass der Retter und der zu Rettende miteinander untergingen und beinahe ertrunken wären. Statt Trost und Zuspruch gab es von Michel eine wüste Scheltrede. Er hatte wohl noch nie mit derartigen Nieten zu tun gehabt. Ob dieses Erlebnis ausschlaggebend war für meine mässige Begeisterung fürs Schwimmen?
Im letzten Progyjahr fand eine dreitägige Schulreise statt. Die Lehrer Gonzenbach und Bühler begleiteten uns auf der Fahrt nach Stein am Rhein, Arenenberg und Schaffhausen. Im Museum Allerheiligen in Schaffhausen war just zu jener Zeit eine grosse Ausstellung niederländischer Meister zu bewundern. Bühler hatte uns darauf vorbereitet. Insbesondere ein Mädchenporträt von Petrus Christus – es zierte die Plakate in der ganzen Schweiz – war vorgängig eingehend besprochen worden. Der Museumsbesuch weckte in mir nicht nur Interessen, sondern auch eine gewisse Ehrfurcht vor den grossen Meistern. Nach der Besichtigung des Rheinfalls übernachteten wir in der Jugendherberge Neuhausen. Es wurde eine lustige Nacht, mit Kissenschlachten, Gelächter und wohl auch Gegröle – bis ein gewaltiges Donnerwetter von Lehrer Bühler einigermassen Ruhe schuf. Unser Klassenlehrer Gonzenbach hatte offenbar den Kollegen vorgeschickt, weil sich dieser besser aufs Donnern und Blitzen verstand.
Gegen Ende des letzten Jahres am Progy stieg die Nervosität. Jetzt ging es um die Wurst beziehungsweise ums Gymnasium. Wer einen genügenden Notendurchschnitt hatte, rutschte prüfungsfrei in die Quarta des ehrwürdigen städtischen und, vor allem, humanistischen Gymnasiums Kirchenfeld. Unvergesslich der letzte Schultag, an dem das Beil endgültig fiel. Klassenlehrer Gonzenbach verteilte die Zeugnisse und verlass dann die Namen jener sechs Mitschüler, die es nicht geschafft hatten (das war etwa ein Fünftel der Klasse). Die Glücklichen verhielten sich ruhig, währenddem die Unglücklichen vor sich hin starrten oder in Tränen ausbrachen. Einzelne nahmen die Wiederholung des Schuljahrs auf sich und tauchten ein Jahr später auch im Kirchenfeld auf. Von der Mehrheit hat man später nichts mehr gehört.

Im Gymnasium
Das imposante Gebäude mit den breiten Eingangstreppen und eindrücklichen Skulpturen links und rechts war beeindruckend. Ebenso das Gewimmel von Schülern und Schülerinnen. Die Literarabteilung umfasste 6 Parallelklassen, die Realabteilung vier und die Handelsabteilung zwei oder drei. Multiplizierte man diese Zahl mit den 4 ½ Schuljahren und durchschnittlich 24 Schülern ergab dies eine ansehnliche Zahl. Von der säulenbewehrten geräumigen Eingangshalle aus erreichte man via Treppen und Korridore die Klassenzimmer. Jeder Schüler verfügte über einen kleinen Schrank im Korridor vor dem Klassenzimmer. Eine gewaltige Errungenschaft gegenüber dem Progy, eine klare Manifestation unseres Erwachsenseins – oder doch Erwachsenwerdens. Man hatte eine kleine private Sphäre und verfügte über die Schlüsselgewalt. Gleich rechts der Eingangshalle befand sich das Büro unseres Rektors, Herr Müri. Ohne Not verweilte man lieber nicht in seiner Nähe. Er wachte nicht nur über den geordneten Schulbetrieb, sondern auch über die guten Sitten. Eine junge Dame (die rothaarige Trix) erschien eines Tages mit einem etwas engen, die runden Formen betonenden Pullover. Müri bestellte sie zu sich ins Büro und verbot ihr, dieses sittengefährdende Kleidungsstück auf dem Schulgelände zu tragen. In jener Zeit kamen die buntfarbigen Hawai-Hemden auf, die man zunächst nach lockerer amerikanischer Art über dem Hosengürtel trug. Doch auch diese Mode war Herrn Müri nicht genehm. Wen er in derartigem Aufzug antraf, belehrte er mit scharfer Stimme: „Ds Hemmli ghört i d Hose!“ Der Rektor war von imponierender Gestalt, ging immer steckengerade und musterte einem mit scharfem Blick. Hatte er einen Zornanfall, glühte das an sich schon rötliche Gesicht wie eine Tomate oder, noch genauer, wie ein Berner Rosenapfel. Während der Pause beherrschte der Abwart Lüthi die Szene. Er verkaufte Brötli und Getränke und machte sich gern bemerkbar. Von seinem Geltungsbedürfnis zeugte seine von vielen Schülergenerationen überlieferte Redensart „Ich und der Herr Rektor haben beschlossen…“. Wenn es das Wetter erlaubte, begab man sich in der Pause ins Freie. Damals herrschte noch Ruhe im Quartier. Die Monbijoubrücke war noch nicht gebaut, das Strässchen vor dem Gymer daher kaum befahren. Darum wälzte sich die Menge der Gymnasiasten über Treppe und Strasse in die breite Allee, die zum Dälhölzliwald führte. Hin und zurück pilgerte man in Gruppen, gemessenen Schrittes, manchmal dumme Sprüche klopfend, manchmal kluge Reden führend und unentwegt die Lehrer kritisierend. Wir waren ja keine herumhüpfenden Kinder mehr, sondern würdige Gymnasiasten. Wir Burschen trugen Jacke und Krawatte, wie die Klassenfotos beweisen! Wer, wie ich, nur über einen Kittel und zwei Krawatten verfügte, war froh über die Sommerzeit. Da konnte man es lockerer nehmen. Nie wäre es vorgekommen, dass wir Burschen und die vier Mädchen unserer Klasse sich während der Pausenparade zusammengefunden hätten. Man sprach kaum miteinander. Die Damen, scheu, grösstenteils wenig attraktiv und von einigen Frechdachsen unserer Klasse oft lauthals bespöttelt, kuschelten sich zusammen. Wir blieben uns bis zur Matur fremd.
Auf der Rückseite des Gymnasiums erhob sich die breite Front der Schweizer Landesbibliothek. Dazwischen lag eine Rasenfläche. Unter Strafandrohung war es verboten, querüber zum Eingang der Bibliothek zu gehen. Gelegentlich gab es Klagen von Beamten der Landesbibliothek. Sie hatten offenbar Zeit, zum Fenster hinauszugucken und sich zu entrüsten, wenn jemand ein Papierchen fallen liess oder durchs Fenster auf die Brüstung stieg. Flugs wurde zum Telefon gegriffen und der Abwart in Trab gesetzt oder, im schlimmeren Fall, der Rektor alarmiert. Am besten gefallen hat mir die Halle im ersten Stock, der helle Vorraum der Aula. Der Maler Viktor Surbeck hatte ein Fresko mit Szenen aus der griechischen Mythologie hingezaubert, in leuchtenden warmen Farben, und zu immer neuem Betrachten einladend.
Ein paar Worte zu meinem Schulweg. Dank der für damalige Zeiten ausgezeichneten Zugsverbindung von Rosshäusern nach Bern konnte ich nicht nur abends, sondern auch mittags nach Hause fahren und nach dem Mittagessen wieder zur Schule. Die Zeit war allerdings knapp. Auf Rosshäusern-Station angekommen, stieg ich auf mein uraltes Rücktritt-Fahrrad und pedalte, teils über ein schmales Feldweglein, dem Forst zu. Das Mittagessen war jeweils vorbei, aber man wärmte für mich eine Portion auf. Dann ein Blick in die Zeitung und hopp, wieder aufs Velo, zur Bahnstation. Oft war der Zug bereits angekommen. Ich schob das Rad unter den Barrieren durch, spurtete die letzten hundert Meter, schmiss das Velo in den Schotter neben dem Bahngeleise und war in ein paar Sprüngen beim Zug, der sich sogleich in Bewegung setzte. Im Zug sassen immer die gleichen Leute: Bundesbeamte; Hans Rosa, der bei der BLS arbeitete; Sigu, ein Typograf. In Riedbach und Bümpliz stiegen ein paar Schüler zu. Cornelia Guggenheim zum Beispiel, mit ihren Schwestern; auch Werner Schorno, ein Jahr jünger als ich, der später als stramm rechtsgerichteter Staatsanwalt eine zweifelhafte Berühmtheit erlangte. Interessanter als der Weg zum Progy war der ins Kirchenfeld. In den Lauben der Spital- und der Marktgasse, „das Rohr“ genannt, gab es immer Interessantes zu sehen. Marktfrauen, geputzte Damen, hübsche Mädchen, Bettler, Touristen, hie und da auch die berühmte Madam de Meuron mit ihrem mächtigen schwarzen Hut. Auf der Kirchenfeldbrücke begegnete man morgens und mittags den Bundesbeamten in gehobener Stellung. Nicht jedermann verfügte über das nötige Kleingeld, um sich im vornehmen Kirchenfeld eine Wohnung oder gar ein Haus leisten zu können. Oft kreuzte ich mich auf der Brücke mit Bundesrat Philipp Etter. Er wohnte gegenüber dem Gymnasium und pilgerte gemächlich, erhobenen Hauptes und in sehr aufrechter Haltung dem Bundeshaus entgegen. Der glatzköpfige Zuger Bundesrat sass zu meiner Gymerzeit schon sechzehn Jahre im Bundesrat und zeigte auch in den folgenden Jahren nicht die geringste Lust zurückzutreten. Immer wieder forderten Politiker und Journalisten den als Sesselkleber Verschrienen auf, einem Jüngeren und Dynamischeren Platz zu machen. Scheinbar unbeeindruckt spazierte der Geschmähte Tag für Tag über die Brücke seinem Büro zu und trat erst 1959, nach 25 Jahren, von seinem Amt zurück. Ich aber durfte mich nicht aufhalten. Wenn der Zug ein paar Minuten Verspätung hatte, erreichte ich das Klassenzimmer erst nach dem Läuten – und, je nach Pünktlichkeit des Lehrers, auch nach ihm. Mit dem Tram hätte ich natürlich Zeit gewonnen. Doch kaum je benutzte ich dieses Verkehrsmittel – einerseits aus sportlichen Erwägungen, anderseits aber auch aus Gründen der Sparsamkeit. Von meinen Eltern erhielt ich pro Woche 8 Fr. Taschengeld. Davon war aber das Bahnabonnement zu berappen. Es kostete damals 15 oder 16 Franken. Da blieb im Monat nicht viel übrig. Obschon ich Schokolade über alles liebte, versagte ich mir die Schleckereien. Eher brauchte ich das übrig gebliebene Taschengeld für den Kauf von Kunstkarten (bei Hiller & Matthys an der Neuengasse) oder für antiquarische Bücher. Oft durchstöberte ich die Buchantiquariate an der Kramgasse und beim Rathaus. So gewann meine Bibliothek langsam an Kontur. Stolz war ich zum Beispiel auf die äusserst günstig erworbenen Gesamtausgaben von Goethe und Ibsen. Wiederum aus sportlichen wie aus Sparsamkeits – Gründen legte ich im Sommer den Schulweg mit dem Velo zurück. Vater hatte mir – ich glaube zur Konfirmation - ein sehr schönes dreigängiges Fahrrad gekauft, Marke Allegro, rostfreie Felgen, grün, unverwüstlich. Der Schulweg vom Forst bis zum Gymer mass 14 Kilometer. Mit Ausnahme der heissesten Sommertage, wo sich fast die ganze Klasse ins Marzilibad begab, fuhr ich über Mittag nach Hause. In normalen Wochen legte ich die Strecke 20mal zurück und legte damit ein Wochenpensum von 280 Kilometern hin. Ende des Sommers war ich natürlich überaus fit, was meinen sportlichen Bemühungen im Turnverein Mühleberg (Leichtathletik) zugute kam. Die Fahrt via Riedbach und Buch führte bis Bümpliz durch Wald und Felder. Der Verkehr war spärlich. Morgens roch es nach taufrischem Gras. In der Winterhale, wo heute Suchard-Jacobs und Coop ihre Zentren haben, grasten häufig die Rehe. In Bümpliz hörte dann die Idylle auf. Die Brünnenstrasse war recht eng. Man musste auf Fussgänger und Autos aufpassen. In der Stadt selber gab es damals erst eine einzige Lichtsignalanlage, an der Kreuzung Hirschengraben-Effingerstrasse. Ein wenig stolz war man schon, dass auch unsere Stadt über eine derartige technische Errungenschaft verfügte. Auf dem Bubenbergplatz wurde der Verkehr noch jahrelang von einem Polizisten geregelt, der in einem überdachten Fass stand und mal gnädig, mal ungeduldig oder gar ärgerlich Winksignale gab. Die Kreuzung am Hirschengraben war bei Regenwetter tückisch. Wenn man nicht höllisch aufpasste, wurde einem das Gewirr von Tramschienen zum Verhängnis. Jedenfalls bin ich auch einmal ausgerutscht und mitten im Verkehr auf dem Hintern gelandet. Der Sturz verlief glimpflich. Weder meine Glieder noch mein geliebtes Fahrrad trugen Schaden davon. Natürlich gab es Zwischenfälle. Einmal hatte ich, kaum gestartet, einen platten Reifen. Da ich Flickzeug und Pumpe immer mit mir führte, konnte ich den Schaden selber beheben. Trotzdem kam ich zu spät. Unser Mathematiklehrer, Franz Steiger, den ich übrigens enorm schätzte, war bereits in Aktion. In jenen Wochen war ich Klassenchef. Als solcher hatte man die Pflicht, die Aufgaben sorgsam im Klassenbuch einzutragen. Ausgerechnet am Vortag hatte ich dies vergessen. Steiger („Stygi“) nahm meine Entschuldigung wegen der Verspätung an, schmunzelnd, aber auch mit erhobenem Zeigefinger. „Balmer, Sie haben die Aufgaben nicht eingetragen. Sie sind ein Lappi.“ Womit die Sache erledigt war.
Ende 1953 kaufte Vater ein Auto, natürlich eine Occasion, einen blauen Opel. Er selber hatte nie die Absicht zu chauffieren. Das überliess er meinem Bruder Werner und mir. Dieses Auto war Anlass für allerhand Geschichten. Zum Thema „Schulweg“ halte ich bloss fest, dass ich während der Oberprima ausnahmsweise das Auto benutzen durfte, um zur Schule zu fahren. Etwa dann, wenn es stark regnete, oder wenn mit meiner Fahrt zur Schule noch irgendein Waren- oder Personen-Transport verbunden werden konnte. Damals hatte man keine Schwierigkeiten, einen Parkplatz zu finden. Deren gab es vor dem Gymnasium genug. Wenn ich dann meinen „Opel älteres Modell“ coram publico abstellte, wurde das natürlich bemerkt. Das weckte bei mir einen gewissen Stolz. Dieser wurde aber sofort gedämpft, weil ich mich als Angeber fühlte und eben diese Rolle zutiefst verabscheute. Auch wenn ich mit dem Auto über Land fuhr und links und rechts die Bauern ihrer harten Arbeit nachgingen, beschlich mich ein Unbehagen. Was für ein Recht hatte ich denn für solchen Luxus? Was dachten die Leute über den jungen Schnösel, der da stolz an ihnen vorbeirauschte?
Was heute absolut undenkbar ist, war damals Tatsache: 20 junge Leute wählten neben Latein als neues Hauptfach das Griechisch. Weshalb ich selbst diese Wahl traf, ist mir noch heute ziemlich schleierhaft. Zu Hause konnte und wollte man mir den Entscheid nicht abnehmen. Sowohl Mutter wie Vater sagten, das müsse ich selber wissen. Ob ich schon damals die Theologie im Hinterkopf hatte? Ich glaube es eigentlich nicht. Die Wahl war irrational. Aber aus welchen Gründen auch immer wählten damals 20 junge Leute zum Lateinischen noch eine zweite tote Sprache. Direkte Nutzniesser waren nach der Matura nur drei: Franz Furger, der katholische und Hanspeter Stähli wie auch ich, die wir protestantische Theologie studieren wollten. Vielleicht auch noch die Mediziner unter uns, die sich dank den Griechischkenntnissen zahlreiche anatomische Begriffe leichter merken konnten. Unser Griechischlehrer war Dr. Max Walther. Der gross gewachsene, schlanke Mann wirkte immer überaus gebrechlich. Die bleiche Hautfarbe und die sanfte Stimme unterstrichen diesen Eindruck. Selbst im Sommer trug er oft einen Schal. Im Winter suchte er sich mit tief über Stirn und Ohren gezogener Pelzmütze, warmem Halstuch und dickem Mantel gegen die Unbilden des Wetters zu schützen. Trotzdem war er häufig krank und musste sich vertreten lassen. So gerne hätte er uns für die griechische Sprache und Kultur begeistert. Doch das gelang nur in sehr bescheidenem Umfang. Die elende Grammatik, die halt zu jeder Sprache gehört und die für „Graekwale“ ein ständiges Anliegen war, dämpfte die bescheidenen Ansätze von Begeisterung für die Kulturgeschichte. Von der Kultur des alten Griechenlands hörten wir wenig bis nichts. Höchstens ein paar auswendig gelernte Hexameter aus Homers Odyssee blieben des Wohlklangs wegen haften. Meine Erinnerung an den Griechischunterricht beschränkt sich vor allem auf die Figur der resignierenden, dennoch geduldigen, kränklichen und bemitleidenswerten Lehrerfigur. Spannend wurde es nur einmal. Als Graekwale wieder einmal krank war, tauchte ein kleiner jüngerer Mann als Stellvertreter auf – Herr Messerli. Vom ersten Moment an hatte er mit uns seine liebe Mühe. Wir waren faul, frech, unaufmerksam und „vergassen“ die Aufgaben. Einmal bildeten wir vor seinem Auftritt mit den Pulten einen Kreis, nur zur Türe hin offen. Als er eintrat, hatte er keine andere Möglichkeit, als den Kreis zu betreten. Sofort wurde hinter ihm die Lücke geschlossen. Der arme Kerl hatte während der ganzen Lektion die Hälfte der Klasse im Rücken (was diese Hälfte natürlich für allerlei Faxen ausnützte). Zur Strafe drohte er uns auf die nächste Stunde eine Probe an. Wir vereinbarten einen Streik. Als der Bedauernswerte dann während einer ganzen Lektion Sätze diktierte, die wir hätten übersetzen sollen, sass die Klasse mit verschränkten Armen da. Mit einer Ausnahme: der brave Franz Furger schrieb alles mit. Der Streik hatte Folgen. Rektor Müri brummte der ganzen Klasse Arrest auf und hielt eine ausführliche Strafpredigt. Ob Franz Furger auch in den Arrest kam, weiss ich nicht mehr.
Der Zusammenhalt der Klasse funktionierte eigentlich nur im Negativen, wie eben beschrieben. Grosse Freundschaften oder Solidarität mit Schwächeren gab es kaum. Die Mädchen blieben, wie bereits geschildert, vollständig isoliert. Oft wurden sie auch „ausgezählt“. Beatrice alias „der Chines“ wollte später Schauspielerin werden und liebte es, Gedichte sehr barock zu deklamieren, mit pathetischer Stimme und zum Himmel erhobenem Blick. Das erntete bei uns Jünglingelchen nur Verachtung und beissenden Spott. Meieli war Tochter eines Predigers (Chrischona?). Entsprechend war ihr Aussehen: grau, eher unattraktiv, scheu. Es war, als existiere sie für uns gar nicht. Einzig Esther, die ansehnlichste, hatte in den letzten Gymerjahren eine etwas bessere Presse. Sie soll bei Nachmaturfeiern regelrecht aufgetaut oder gar aufgeblüht sein. Davon weiss ich allerdings nur vom Hörensagen. Unter uns Burschen gab es nur lose und wechselnde Seilschaften. Ich selber war faut de mieux häufig mit meinem Banknachbarn Beat zusammen. In der Klasse war er Aussenseiter. Niemand wollte neben ihm sitzen. Weil ich am Anfang des Schuljahres, wo die Plätze vergeben wurden, meistens zuletzt im Klassenzimmer eintraf, war nur noch ein Platz übrig: zuhinderst, neben Beat. Wir kamen leidlich miteinander aus. Auf meine Beziehungen zu Beat komme ich später zurück. Vor mir sassen Rolf und Reinhold. Reinhold, Arztsohn aus Huttwil und später selber Arzt, wohnte während der Woche bei seinen Grosseltern in Bern. Er schrieb ausgezeichnete Aufsätze. Jedenfalls liess ihn Lehrer Peyer fast immer seine Werke vorlesen. Streit trug die Haare immer ganz kurz geschoren. Nur über der Stirn standen sie ein paar Zentimeter in die Höhe. Gesicht und Nacken waren ständig von Pickeln bedeckt. In der Quarta war ein zweiter Landbursche zu uns gestossen, Markus Aellen. Aufgewachsen in der Nähe von Gstaad, Bauernsohn wie ich, gemütlich, seinen Dialekt treu bewahrend, fügte er sich gut und unauffällig in die Klassengemeinschaft. Sein trockener Humor war sprichwörtlich. Jahre später, bereits als Glaziologe arbeitend, war er in eine Gletscherspalte gestürzt, aber von der Rettungsflugwacht gerettet worden. An der nächsten Klassenzusammenkunft wurde er gefragt: Und, Markus, wie war es in der Gletscherspalte? „Chly chalt“. Das war alles, was er zu der Geschichte, die schlimm hätte ausgehen können, zu sagen hatte. Aellens Banknachbar, Wolfgang, entstammte einem Bernburger-Geschlecht. Da seine Eltern in Oesterreich lebten, verbrachte er die ganze Schulzeit im burgerlichen Waisenhaus im Melchenbühl. Geschadet hatte es ihm offenbar nicht. Er schien – oder war? – immer bester Laune und niemand konnte so entwaffnend, so unschuldig lächeln wie er. In der Tertia stiess wieder ein Neuer zu uns: Max Greco. Als Sohn einer Bernerin und eines neapolitanischen Anwalts war er in Neapel aufgewachsen. Als nach dem Krieg der Vater starb, zog seine Mutter mit ihm in die Schweiz. Dabei geleitete sie ein amerikanischer Offizier durch das besetzte Italien bis an die Schweizer Grenze. Des Berndeutschen war er dank seiner Mutter seit jeher mächtig. Innert kurzer Zeit eignete er sich auch das Hochdeutsche an. Trotz seinen Besonderheiten, der schrägen Nase und der für uns exotischen Herkunft integrierte er sich rasch. Neben ihm sass Werner Schneider, der es später in Uppsala zu hohen akademischen Ehren brachte. Res Ludi, den ich seit vielen Jahren kannte, suchte immer Gruppen und Grüppchen für sich einzuspannen. Und wenn er ein Rudel zusammen hatte, war es ihm wohl. Auch er brachte es an der Uni sehr weit. Mehrere Jahre amtierte er in Bern als Rektor. Jürg, der wegen seines beissenden Spottes ein wenig gefürchtet war und sich oft in Szene setzte, hatte auch seine Schwächen. Einmal nach einem Bierabend hat er offenbar nächtens die Geranien auf dem heimischen Balkon vollgekotzt. Der Vater wurde fuchsteufelswild und drohte dem Wirt der Schmiedstube, wo sich unser Kreis versammelt hatte, mit einer Anzeige. Schwäche zeigte Baltis auch in der Biologie. Als der Lehrer, Gerhard Wagner, einen Käfer oder einen Frosch sezierte, wurde der sonst so Vorwitzige kreidebleich und fiel um wie ein Mehlsack. Ironie des Schicksals: nach dem Medizinstudium arbeitete er jahrelang in Zürich auf der Chirurgie der Notfallaufnahme, wo er zerfetzte Strassenverkehrsopfer und andere Schwerverletzte zusammenflicken musste – blutigere Jobs gibt es in der Welt der Medizin wohl kaum. Hermann aus Thun verdiente sich als Barpianist ein gutes Taschengeld. Vom kleinen, witzigen Philipp Henry merkte man noch weniger. Er war ein Einzelgänger und pflegte mit keinem von uns Kontakte ausserhalb der Schule. Heute lebt er in den USA als Kardiologe und lässt nur ganz selten etwas von sich hören. Zu den Stillen im Land gehörten auch Philippe und Franz, später Jesuit und Professor in Münster. Bruno Bagnouds Anwesenheit in der Griechisch-Klasse stellte ein besonderes Rätsel dar. Nicht nur interessierte er sich keinen Deut für die antike Klassik. Er war auch zu faul zum Lernen. In all den Jahren kam er nur weiter mit Spicken. Selbständig hätte er wohl kaum einen Satz zu übersetzen vermocht. Das wurde ihm während der Maturitätsprüfung, als man ihn auf frischer Tat erwischte, zum Verhängnis. Er wurde auf der Stelle relegiert. Wie schon im Progy lagen seine Interessengebiete anderswo: bei den Mädchen und beim Sport. Immerhin hat er es weit gebracht. Als Direktor und Hauptaktionär von Air Glacier hat er unserein finanziell vermutlich weit überflügelt.
Die Jahre plätscherten ohne grosse Aufregung dahin. Als wir voller Stolz als die Ältesten und Ehrwürdigsten in die Oberprima vorrückten, begann ein wunderbar warmer und sonniger Sommer. Eigentlich hätten wir uns intensiv auf die Maturitätsprüfungen vorbereiten sollen. Deshalb hatten wir an den Nachmittagen meistens frei. Statt daheim im stillen Kämmerlein Geschichte und Sprachen zu büffeln, räkelten wir uns auf dem Rasen des Marzilibades. Wohl lagen ein paar Lehrbücher herum. Benutzt wurden sie jedoch kaum. Stattdessen palaverten wir endlos und kommentierten Badekleider und Busengrösse der weiblichen Badegäste. Ab und zu wanderten wir bis ins Eichholz oder gar bis zum Muribad und liessen uns anschliessend die Aare hinuntertreiben. So trudelten wir unaufgeregt den Prüfungen entgegen. Diese verliefen denn auch ohne grössere Schwierigkeiten. Einzig die Geschichte mit Bagnoud erregte die Gemüter für ein paar Tage. Allen Andern wurde das Reifezeugnis ausgehändigt. An die Feier selber erinnere ich mich kaum noch. Ich weiss nur noch, dass meine Eltern, wohl zum ersten und zum letzten Mal, die heiligen Hallen des städtischen Gymnasiums Kirchenfeld betreten hatten und dass ihnen Mathematiklehrer Franz Steiger sagte, ich sei ein lieber und guter Schüler gewesen, was ihnen gewiss sehr wohlgetan hat.
Wesentlich bunter ging es nachher zu. Für die Mulusfeiern (mulus = Maulesel, Bezeichnung für die Abiturienten vor Beginn des Studiums) hatten wir uns einiges einfallen lassen. Baltis hatte zur Melodie „Als die Römer frech geworden...“ eine witzige Schnitzelbank über die Lehrer verfasst. Vom Stadttheater hatten wir römische Kostüme ausgeliehen bekommen (jemand verfügte über gute Beziehungen und verwies auf die Tatsache, dass wir fast alle Mitglieder der Jugend-Thatergemeinde waren). Die Mädchen verkleideten sich als Marketenderinnen, wir Burschen als Legionäre (Baltis war Hauptmann, ich Träger des Feldzeichens: einer Heugabel mit aufgespiesstem Totenschädel). Derart zogen wir durch die Stadt, auch ins Marzili, um den Seminaristinnen zu imponieren, und schliesslich ins Kirchenfeld. Frech drangen wir in die einschlägigen Klassenzimmer, um unseren Lehrern ihren persönlichen Schnitzelbankvers vorzutragen.
(1) Mulus-Umzug
Unser Auftritt hat nicht allen gefallen. Als wir uns ein paar Minuten hinter dem Gymer aufhielten, kam von der gegenüberliegenden Landesbibliothek ein Beamter herausgestürzt und schimpfte gewaltig über unser Lärmen und über die offenen Weinflaschen, die unter uns zirkulierten. Nach dem Streifzug durch die Stadt wurden wir in der Villa von Grecos Onkel, Herr Zingg, empfangen und bewirtet. Einigen bekam das Gelage nicht. Auf einem Foto, die unsere Klasse auf der Zingg’schen Treppe zeigt, sind mehrere sehr bleiche und einige übertrieben grinsende Gesichter auszumachen. Immerhin: unsere Klasse hat ganz am Schluss ihrer Existenz doch noch eine gemeinsame Aktion zu gestalten vermocht.

Freunde, Kollegen, Reisen
Einen ganz nahen, einen richtigen Freund hatte ich während der Adoleszenz nicht. Da gab es wohl aus früheren Jahren Schulfreunde wie Heinz oder Pfadfinderkollegen wie Toni und Turnkollegen wie Köbi. Mit ihnen hatte ich es gut. Aber Freunde, mit denen man ganz offen reden und auch Schwieriges oder Geheimes hätte besprechen können, fehlten mir. Einer, den ich sehr gern als Freund gewonnen hätte, war Arnold. Leider war er in einer Parallelklasse des Gymnasiums und ich sah ihn nur in der Pause oder, selten genug, auf dem Schulweg. Was mich zu ihm hingezogen hatte, vermag ich nicht zu sagen. Er war ein stiller, freundlicher Bursche mit einer runden Drahtbrille und sanfter Stimme. Krampfhaft versuchte ich, mich ihm zu nähern. Irgendeinmal konnte ich ihn dazu überreden, mir ein wenig Englisch beizubringen (er hatte statt der griechischen die englische Sprache gewählt). Ein paar Mal sassen wir gemeinsam auf einem Parkbänklein und er sprach mir die englischen Vokabeln und Sätze vor, geduldig, freundlich, bemüht. Doch mit der Freundschaft wollte es einfach nicht klappen. Bald einmal merkte ich, dass er sich bloss aus Ritterlichkeit um mich bemühte. Nach einigen Wochen versandeten die gemeinsamen Stunden. Etwa ein Jahr später vermochte ich ihn und seinen Klassenkollegen Martin Lips zu einer grösseren Velotour zu überreden. Es sollte nach Frankreich gehen, ins Burgund und in die Bresse, vielleicht bis Lyon. Unser Geografielehrer Probst unterstützte uns beim Planen, lieferte Karten und gute Ratschläge. Unter anderem warnte er uns, auf derartigen Touren entstehe häufig Streit. Mit ordentlichen Lasten auf dem Gepäckträger machten wir uns auf den Weg. Via Genf erreichten wir Annecy, wo wir einen Tag verweilten. Dann ging es weiter in die Ebenen der Bresse. Leider hatte das Wetter umgeschlagen. Immer wieder nieselte es und ein heftiger Gegenwind machte uns zu schaffen. Nun zeigten sich die grossen Konditionsunterschiede. Arnold hatte immer mehr Mühe mitzukommen, was ich zunächst gar nicht bemerkte, da ich mich in ausgezeichneter körperlicher Verfassung befand und meine Begleiter, besonders Arnold, restlos überforderte. Als ich endlich den Kern der Sache verstanden hatte, schlug ich mehrmals vor, an der Spitze zu fahren und den Kameraden Windschatten zu bieten. Arnold weigerte sich immer wieder. Er wollte selber an der Spitzte fahren und verstand meine Argumente nicht. Aber auch ich begriff nicht, warum er sich weigerte. Die Stimmung sank in den Keller. Selbst das heisse Rührei in einer Kneipe an der Überlandstrasse vermochte uns nicht aufzuheitern. Am nächsten und übernächsten Tag besserten sich sowohl das Wetter wie auch unsere Stimmung. Aber es kam immer wieder zu kleinen Scharmützeln, bei denen Martin vermitteln musste. Via Belfort und Basel kehrten wir heim. Von einer Wiederholung ähnlicher Fahrten in gleicher Besetzung war natürlich nie mehr die Rede.
Im nächsten Jahr versuchte ich es mal allein. Wir hatten Bekannte jenseits des Bodensees, genauer: in Biberach an der Riss. Die Frau, Joos, arbeitete bis etwa 1936 in unserer Haushaltung. Sie war sehr tüchtig, hatte ein gutes Mundwerk und sehr viel Humor. Vor allem mit meinen Schwestern hatte sie es überaus lustig. Zwischen ihr und meinen Eltern kam es mehr und mehr zu Missstimmungen, weil Joos mit Hitler sympathisierte. Dafür hatten meine Eltern gar kein Musikgehör. In der zweiten Hälfte der 30er Jahre wurde vielen deutschen Staatsangehörigen befohlen, in die Heimat zurückzukehren. Joos packte die Koffern. Die Verbindung mit ihr brach ab. Kurz nach dem Krieg heiratete Joos und begann wieder einen zunächst zaghaften Kontakt mit uns. Irgend einmal stattete ihr meine Schwester Madeleine einen Besuch ab. Da ich gerne mit dem Velo in der Weltgeschichte herumfuhr, gedachte ich, ein Gleiches zu tun. An einem frühen Sommermorgen machte ich mich auf den Weg, via Bern, Olten und Zürich an den Bodensee. Mit der Fähre setzte ich über und radelte auf der allmählich, aber stetig steigenden Strasse hinauf nach Weingarten und Ravensburg. Von dort waren es nur noch etwa 30 Kilometer bis ans Ziel. 280 Kilometer hatte ich an diesem Tag zurückgelegt und war entsprechend müde, als ich in Biberach ankam. An den Aufenthalt im bayrischen Städtchen erinnere ich mich nur noch vage. Zwei Eindrücke aber blieben mir in Erinnerung. Der erste: ein Besuch bei einer Freundin von Joos, die mir sehr gefiel. Sie lebte in einem ländlichen Bilderbuchdorf. Mitten durchs Dorf schlängelte sich ein Bach, wo sich Enten, Gänse und Kinder tummelten. Beidseitig des Bachs, etwas zurückgesetzt, einfache Bauernhäuser. Hinter einem dieser Häuser, unter einer mächtigen Linde, ein Holztisch. Um den Tisch herum die Gastgeber. Vor allem die Männer fielen mir ins Auge, mit ihren kurzen Lederhosen und den grünen Hüten samt Federschmuck. Saurer Most wurde serviert, bayrisch geschwatzt und viel gelacht. Was für eine Idylle! Hatte ich so etwas schon in der Literatur angetroffen, vielleicht in Goethes "Hermann und Dorothea"? Eine ganz andere, aber nicht minder starke Erinnerung habe ich an einen Ausflug nach Ulm. Joos und ihr Mann führten mich im Auto dorthin. Da erhob sich der gewaltige Bau des Ulmer Münsters. Der weite Platz war gesäumt mit ein paar übriggebliebenen Häusern und vor allem mit Ruinen und Steinhaufen. Die Leere verstärkte die Wucht des einmaligen gotischen Kirchenbaus. Und immer wieder fragte man sich: weshalb blieb dieses Bauwerk stehen im Bombenhagel? War das Fügung? Oder Zufall? Oder das Geschick und die Pietät der Bomberpiloten?
Martin, Sohn einer Drogistenfamilie aus Steffisburg, besuchte zusammen mit Arnold eine Parallelklasse. Ich kam ihm näher, weil wir vom und zum Bahnhof den gleichen Weg hatten. Seine Eltern besassen ein Ferienhaus in Schönried. Sie luden mich ein, während der Sportferien im Februar ihrem Martin Gesellschaft zu leisten (er war wesentlich jünger als seine zwei Brüder). Damit hatte ich die Möglichkeit, eine Woche lang Ski zu fahren. Zwar befand sich die Talstation des Skilifts in unmittelbarer Nähe des Ferienhauses. Doch zu Beginn des Tages schnallten wir die Felle an die Skier und wanderten heroisch am Pistenrand bis aufs Horneggli. Erst am Nachmittag gönnten wir uns einige Skilift-Fahrten. Martin und einer seiner Brüder fuhren jeweils voraus, ich hintennach. Sowohl punkto Technik wie punkto Schnelligkeit waren sie mir überlegen. Einmal, im Bemühen, nicht allzu sehr zurückzubleiben, forcierte ich das Tempo und landete nach einem gewaltigen Sprung in einer Mulde neben der Piste. Alle meine Glieder waren unversehrt. Doch als ich mich aus den Schneemassen befreit hatte, musste ich die Skier stückweise einsammeln. Zu Fuss trug ich die Trümmer ins Tal. An eine Reparatur war nicht zu denken. Zur selben Zeit weilte die Familie meines Klassenkameraden Werner in ihrem Schönrieder Ferienhaus. Als sie Kunde erhielten von meinem Pech, liehen sie mir spontan ein paar ältere Skier. Das Skivergnügen konnte weitergehen. Ein oder zwei Mal – war es in der Gymerzeit oder während des Studiums? – mieteten Martin und seine Brüder eine Sennhütte, an der Lenk. Zusammen mit einem Freund der Familie war auch ich dabei, beim Skifahren ebenso wie beim Jassen. Es war vergnüglich, obschon der Schnee in unsere Schlafkammer eindrang und man sich für das morgendliche Waschen am Brunnen, bei 15 Grad Minustemperatur, sehr überwinden musste.
In den letzten zwei Jahren des Gymnasiums mieteten wir, fünf oder sechs Klassenkameraden, während den Sportferien eine Sennhütte in Adelboden. Obschon der Komfort fehlte, hatten wir es gemütlich, auch an den langen Abenden. Beim Kochen, Essen, Abwaschen und Jassen wurde viel gelacht. Die Hütte gehörte einer Familie mit mehreren längst erwachsenen, aber ledigen Söhnen. Sie alle gehörten zu verschiedenen Freikirchen oder Sekten. Ab und zu suchten sie uns auf und ermahnten uns eindringlich, wenn wir wüste Wörter brauchten. In einem Schrank fanden wir einen Stapel frommer Traktate. Der Titel der Heftchen lautete «Der Schäflihirt»; herausgegeben wurden sie vom Evangelischen Brüderverein. Zum Jux lasen wir einander daraus vor und ergötzten uns an den sehr simplen Geschichtlein und an den dick aufgetragenen Moralsprüchen. Als uns eines Abends einer der Brüder bei diesem frevlen Tun überraschte, war er richtig erbost und hielt uns eine lange Predigt. Gebessert haben wir uns nicht. Insgeheim fühlte ich immer ein wenig Mitleid mit diesen einfachen Leuten, die in ihrer beschränkten Lebens- und Glaubenswelt ein rechtschaffenes Leben führten.
Zu meinem Banknachbarn Beat hatte ich ein überaus komplexes Verhältnis. In der Mathematik war er froh über mich, in den Sprachen war es eher umgekehrt. Beat, der Künstler in der Klasse, war den meisten anderen fremd. Doch er gefiel sich in der Rolle des Fremd- und Andersseins. Er spielte hervorragend Klavier, verfügte über sprachliche Fähigkeiten und inszenierte einmal das Gymertheater (Der Tor und der Tod), wozu ich das bescheidene Bühnenbild lieferte. Gelegentlich machten wir miteinander Berg- und Skitouren, zum Beispiel aufs Schilthorn, als weit und breit noch keine Bahnen fuhren. Aus Sparsamkeitsgründen trugen wir die Skier von Lauterbrunnen bis zur Grütschalp und benützten verbotenerweise die Treppe der Standseilbahn. Dort schnallten wir die Felle an und stiegen zur Schilthornhütte auf. Am Abend klaubten wir einzelne Scheite aus den Holzbündeln, um diese nicht berappen zu müssen. Am folgenden Tag stiegen wir zum Gipfel auf, ohne eine Menschenseele anzutreffen. Die Abfahrt gestaltete sich zum Teil sehr mühsam. Im berüchtigten Kanonenrohr, überaus steil und eng, war Bruchharst. Wir mussten uns mit Spitzkehren und Quersprüngen behelfen. Einmal machten wir eine grosse Velotour. Bereits im Entlebuch brach Beats Gepäckträger. Die Reparatur kostete einen halben Tag Zeit. Via Gotthard gings ins Tessin. Auf einem Hügel oberhalb Luganos, heute von ummauerten Villen besetzt, schlugen wir das Zelt unter einer Pinie auf und genossen einen wunderbaren Ausblick auf See und Stadt. Wie immer auf unseren Touren herrschte auch diesmal erheblicher Mangel an Kleingeld. Deshalb schlichen wir nachts in die Weinberge und füllten Plastiksäcke mit Trauben. Aus Trauben und Brot bestand unsere Nahrung. Ab und zu kochten wir uns eine Suppe. Von Lugano ging es weiter nach Morcote. Weit und breit fand sich kein Zeltplatz. Da stellten wir die Räder unten an der Strasse ab und schleppten unser Gepäck hinauf zum Friedhof. Der war in Stufen angelegt und irgendwo fand sich ein geschütztes Grasplätzchen, wo wir eine Nacht lang friedlich kampierten. Via Como und Bergamo erreichten wir den Gardasee, genauer: die Halbinsel Sirmione und den dortigen Zeltplatz. Bei heftigem Gegenwind kämpften wir uns Richtung Venedig. Ab und zu hängten wir uns an einen Lastenzug, um Kräfte zu sparen. Dabei verlor ich einmal das Gleichgewicht und stürzte, mitten im Verkehr, auf den Asphalt. Vor Schrecken stürzte ein paar Sekunden später auch Beat. Im Strassengraben leckten wir unsere ausgedehnten Schürfwunden und versorgten sie mit Merfen. In Venedig angelangt, suchten wir wieder vergebens einen Zeltplatz. Auf dem Lido gab uns ein freundlicher Herr die Adresse einer Familie, die Zimmer vermietete. Mit dieser Familie Schiavo beziehungsweise mit deren Tochter Vanda blieb ich noch ein paar Monate in Verbindung. Sie schickte mir Briefe und schmachtende Fotos. Doch der Zauber hörte bald einmal auf. Zurück in der Schweiz herrschte garstiges Wetter. In Faido luden wir unsere Räder bis Göschenen in den Zug. Auf der Alpennordseite war es noch schlimmer. In Luzern beschlossen wir, den Rest bis nach Bern wieder im Zug zurückzulegen. Leider reichte unser Geld nicht mehr für ein Billett. Deshalb lösten wir, der Not gehorchend, bloss halbe Billetts. Der Kondukteur nahm uns diesen Betrug nicht ab, immer wieder kam er vorbei und drängte uns, unsere Ausweise zu zeigen. Unverdrossen logen wir ihm vor, wir hätten keine. Selbst auf dem Perron in Bern belästigte er uns und wir mussten uns weiteren Unannehmlichkeiten durch Flucht entziehen.
Beat wohnte bei seinen Eltern in einem kleinen gelben Häuschen am Bundesrain, unmittelbar neben dem Marzilibähnchen. Er bewohnte dort eine winzige Mansarde, sein Bruder Cornell (der sich später als Musiker Klaus Kornell nannte) hauste nebenan in einem ebenso kleinen Stübchen. Der Vater, wohl Bundesbeamter, war ein gross gewachsener, weisshaariger und sehr stiller Mensch. Gegenüber seiner resoluten Gattin hatte er vermutlich einen überaus schweren Stand. Am liebsten verzog er sich in sein nahe gelegenes Bildhaueratelier. Mit seinen künstlerischen Fähigkeiten hat er nie geprotzt. Die Mutter, mir gegenüber überaus freundlich, konnte gelegentlich sehr laut werden. In Zeiten besonders schwerer Kräche lud Beat seine Habseligkeiten aufs Velo und fuhr zu uns in den Forst, wo man ihm in der so genannten Visitenstube ein Liegebett aufstellte. Nach ein paar Tagen, wenn die Wogen sich geglättet hatten, kehrte der verlorene Sohn wieder heim. Zu seinen Utensilien gehörte auch ein elektrischer Plattenspieler. Den nahm er mit ins Exil und manchmal überliess er ihn mir für einige Tage. Die wenigen Platten hörte ich mir dann nonstop an. Insbesondere konnte ich nicht genug kriegen von Schuberts „Unvollendeter“ und von Smetanas „Moldau“. Bis auf den heutigen Tag liebe ich diese Musik innig. Nach der Matur absolvierte Beat das Sekundar-Lehramt und hielt kurze Zeit Schule. Dann aber stieg er ganz in die Musik ein, zunächst am Mozarteum in Salzburg, von wo er mir seine Verlobung mit „meiner Braut aus USA“ mitteilte. Wenige Jahre später zog er selbst in die Staaten - aber das ist eine andere Geschichte.
Die traditionelle Maturreise, so hatte unsere Klasse beschlossen (oder war es Klassenlehrer Hans Peyer?), sollte uns nach Deutschland führen. Die so genannte Romantische Strasse von Nördlingen nach Rothenburg und Dinkelsbühl sowie Heidelberg waren die Schwerpunkte. Wie das in humanistischen Gymnasien der Brauch war, bereiteten wir uns gründlich vor. In der zu besuchenden Gegend wimmelte es ja nur von Kulturdenkmälern und Dichterspuren. Mörike war in Cleversulzbach Pfarrer gewesen. Hermann Hesse war in Calw geboren und im ehrwürdigen Kloster Maulbronn Internatsschüler gewesen. Auch die Burg des „Götz von Berlichingen“ befand sich in der Zielgegend. Jeder und jede von uns referierte zu einem der vielen möglichen Themen. Ich selber wählte den Meister Tilmann Riemenschneider, den begnadeten Holzschneider und –bildhauer, dessen Altäre in Rothenburg und Creglingen besichtigt werden sollten. Unser Klassenlehrer wollte sich aber auch logistisch vorbereiten. Weil ich die Erlaubnis bekommen hatte, das Auto für ein paar Tage zu entführen, machten wir uns zu Dritt auf Rekognoszierungsfahrt: neben Lehrer Peyer und mir auch Beat. Zur Übernachtung brachten wir Herrn Peyer jeweils zu einem Hotel. Wir Jungen suchten einen Zeltplatz, wo wir übrigens – es waren kühle Herbsttage – allnächtlich jämmerlich froren. Das Zelt war morgens reifbedeckt und unsere Schlafsäcke billig und dünn. Zu den hervorstechendsten Erlebnissen auf dieser Reise gehörte die Begegnung mit einer Gymnasiastin aus Ostdeutschland, Dorothea Porsche. In Weikersheim nächtigte sie, die mit dem Rad quer durch Deutschland geradelt war, auf demselben Camping. Miteinander verbrachten wir zwei lustige Tage. Unter anderem bestiegen wir den mächtigen Turm der Weikersheimer Kirche und legten aus Jux oder Dummheit das Uhrwerk lahm. Um die Mittagszeit stellten wir uns harmlos auf den Kirchplatz, um die Reaktion der Einheimischen zu beobachten. Noch ein ganzes Jahr nach dieser Begegnung führte ich mit Dorothea eine lebhafte Korrespondenz. Jahrzehntelang habe ich nichts mehr von ihr gehört. Eines Tages – ich war bereits pensioniert – meldete sie sich bei mir. Eine Hoteldirektorin in Bern hatte ihr geholfen, meine Adresse ausfindig zu machen. Einmal haben wir uns dann in Interlaken, wo sie an einem Kongress teilnahm, getroffen und bei einem Nachtessen Erinnerungen ausgetauscht. Sie erzählte, sie sei nach dem Abitur nach Westen geflohen, habe in Berlin Veterinärmedizin studiert und habe nun einen Lehrstuhl an der veterinärmedizinischen Fakultät inne. Erinnerlich ist mir auch der Besuch in Cleversulzbach. Im Pfarrhaus läuteten wir den Nach-Nach-Nachfolger Eduard Mörikes heraus. Der gemütliche Herr war freundlich, lud uns aber nicht ins Haus. Eine dicke Zigarre rauchend begleitete er uns zu einem kleinen Rundgang in den Garten und erzählte ein paar wenige Einzelheiten über das Leben seines Vorgängers in diesem Haus und diesem Garten. Auf der Heimfahrt, in der Nähe von Winterthur, nahmen wir ein kleines Abendessen ein. In einer Ecke der Wirtsstube stand, hoch über den Köpfen, eine seltsame Kiste. Als die Wirtsleute an einem Knopf drehten oder drückten, flimmerten plötzlich weisse und schwarze Schatten über die Vorderseite des Kastens. Allmählich wurden die bewegten Bilder etwas deutlicher und die dazugehörenden Stimmen klarer. Es war meine erste Begegnung mit einem Fernsehapparat – im Herbst 1953.
Zu Beginn der Oberprima, im Frühjahr 1954, folgte dann die eigentliche Maturreise. Neben Klassenlehrer Peyer war Herr Fink – Physiklehrer – unser zweiter Begleiter. Jenseits der Grenze, unweit von Ulm, besuchten wir zunächst den sagenumwobenen Blautopf in Blaubeuren – einen stark bläulich gefärbten Weiher, wo eine Nixe ihr Unwesen getrieben haben soll. Die Sage ist von Eduard Mörike dichterisch gestaltet worden: in der Novelle von der Schönen Lau. Die Aufzählung der einzelnen Stationen erspare ich mir. Die meisten wichtigen Orte habe ich oben bereits erwähnt. In Heidelberg hielten wir uns zwei Tage auf. Am freien Abend begaben sich Beat, Philipp und ich auf einen Spaziergang. Auf der rechten Seite des Neckar, gegenüber der ehrwürdigen Altstadt, ergingen sich noch andere Spaziergänger im milden Frühjahrs-Abendlicht auf dem bekannten Philosophenweg. Unter anderen drei junge Damen, mit denen wir anbandelten. Nach einigem Hin- und Her luden wir sie ein in ein Lokal. Als wir die Getränkekarte überflogen, erbleichten wir drei Kavaliere. Im Schummerlicht mag das den Damen zum Glück verborgen geblieben sein. Die Preise waren nämlich horrend. Schliesslich wählten wir den billigsten Wein. Für etwas anderes hätte unsere Barschaft nicht gereicht. Das Geplauder und Geschäker zog sich hin. Zwischenhinein mussten wir natürlich die Toilette aufsuchen. Dort machte ich wiederum eine ganz neue Erfahrung: in einem Automaten liessen sich Präservative erwerben. Ich erstand mir ein Exemplar, da mir diese Errungenschaft der Zivilisation bislang noch nie begegnet war. Ich trug es dann jahrelang im Portemonnaie mit mir herum. Verwendet habe ich es nie. Am Schluss des Abends teilten wir uns auf. Jeder Herr sollte eine Dame nach Hause begleiten. Das heisst: zwei wollten sich weder von Philipp noch von Beat geleiten lassen. Nur die Meine, Ruth Weisskopf, erlaubte eine Begleitung. Vor ihrem Haus verabschiedeten wir uns, überaus züchtig und scheu. Nicht einmal zu einem Küsschen ist es gekommen. Als am folgenden Morgen die ganze Klasse um den Frühstückstisch versammelt war, erschien ein Kellner und fragte nach einem Herrn Andreas Balmer. Er werde am Telefon verlangt. Peinlich, peinlich. Am Apparat war Ruth, die mich gerne noch einmal gesehen hätte, was leider aus Termingründen nicht möglich war. Zurück am Frühstückstisch hatte ich für Spott nicht zu sorgen. Oder war es etwa mehr Neid als Spott? Ruth hat sich später mehrmals brieflich gemeldet. Ich habe ihr eher ausweichend geantwortet. Ich war nicht verliebt, höchstens geschmeichelt. Sodann redete mir die Mutter einen weitern Kontakt aus. Ich war ja noch so jung und unschuldig! Und Ruth war eine Deutsche! Auf der Heimfahrt trafen wir in Pforzheim auf eine Stadt, deren Ruinenfelder aus dem Krieg noch längst nicht beseitigt waren. Ein starker Eindruck! Im Schwarzwald machten wir den letzten Halt. In Erinnerung blieb weniger die Landschaft als das dubiose Verhalten unseres zweiten Begleiters, Herrn Fink. „Zufälligerweise“ nächtigte im selben Hotel eine junge Dame aus einer untern Klasse des Gymnasiums. Wir hatten sie zu Hause schon mal in Begleitung unseres Herrn Fink beobachtet. Offenbar war die Ehe unseres Lehrers am Ende und sein neuer Stern hatte sich zu einem Schäferstündchen im Schwarzwald eingefunden.
Mit Res Ludi war ich nicht eng befreundet, aber wir verstanden uns gut. Darum vereinbarten wir nach der Maturität eine grössere Italienreise. Ab Domodossola versuchten wir es mit Autostop. Das war damals noch gang und gäbe. Immer wieder fanden sich freundliche Automobilisten, die zwei Burschen samt ihren grossen Rucksäcken mitnahmen. Einige Fahrer sind mir in besonderer Erinnerung geblieben. Kurz vor Mailand lud uns ein junger Fiat-Topolino-Fahrer in sein Schächtelchen. Wir waren auf den Rücksitzen so eng, dass der Rucksack auf unserem Schoss die Sicht nach vorne versperrte. Dafür wollte uns der Chauffeur offenbar zeigen, wie routiniert und halsbrecherisch schnell er durch den grossstädtischen Verkehr zu pilotieren wusste. Wir waren froh, aussteigen zu dürfen. In Bologna mussten wir überaus lange winken und warten. Wir stünden vielleicht immer noch dort, wenn nicht ein betagter kleiner Priester in unserer Nähe einen Lastwagen gestoppt hätte und eingestiegen wäre. Auf unserer Höhe liess er den Chauffeur anhalten und hiess uns alle beide zusteigen. Es war etwas eng in der Kabine, aber lustig. Im Laufe des Gespräches bekannten wir uns zum Protestantismus. Was das schon hiesse? fragte er uns schmunzelnd. Wir hätten jedenfalls nicht dagegen protestiert mitgenommen zu werden. Ausserhalb von Bologna hielt ein Autobus an und nahm uns mit. Was für eine freundliche und lustige Gesellschaft! Es war der Leichtathletikklub Rossonero aus irgendeinem Städtchen am Rande der Poebene, auf dem Weg zu den italienischen Meisterschaften in Florenz. Oben auf der Passhöhe (damals gab es noch keine Autobahnverbindung) wurde in einer Bar Einkehr gehalten und die freundlichen Burschen luden uns zu einem Kaffee ein. In der Nähe von Siena lachte uns wiederum das Glück. Ein junges Paar auf der Hochzeitsreise nahm uns mit und liess uns an ihrem Glück teilhaben. Am trasimenischen See luden sie uns zu einem Kaffee ein und kutschierten uns nach Rom bis zu den Pforten des Zeltplatzes. Zum Dank schenkten wir ihnen die letzte (wegen der Hitze etwas formlos gewordene) Tafel Schweizer Schokolade. Der Zeltplatz befand sich auf dem Gelände der EUR. Dort sollte zu Mussolinis Zeiten eine Weltausstellung stattfinden. Nach dem Ende des Duce wurde die Weltausstellung ad acta gelegt. Immerhin standen noch imposante Gebäude, zum Beispiel das „colosseo quadrato“, das die Genialität des italienischen Volkes in einer grossen Inschrift verherrlichte: „Un popolo di eroi, di santi, di scienziati, di trasmigratori, di artisti....“ und so weiter. Der Zeltplatz war günstig gelegen. Mit dem Bus gelangte man schnell ins Zentrum. Abends sassen wir oft auf einem Bänkli unter Pinien, bewunderten die Sicht auf die ewige Stadt und genehmigten uns einen Asti spumante. Der diensthabende Polizist setzte sich gern zu uns und war einem Trünklein auch nicht abgeneigt. In einer Nacht wurde unmittelbar neben uns das Schiebedach eines St.Galler VW aufgeschnitten und Fotoapparate und Wertgegenstände gestohlen. Unser Polizist wurde abgelöst und wir waren froh, dass die Diebe unsere Rucksäcke, die vor dem Zelt gestapelt waren und unsere Portemonnaies enthielten, unangetastet blieben. Letztes Ziel war Neapel beziehungsweise Castellamare di Stabiae. Dort gab es eine kleine Pension, die zur Erbschaftsmasse unseres Klassenkameraden Max Greco gehörte. Zwei ältere Damen, Linda und Fernanda, nahmen uns freundlich auf. Es war wunderbar. Abends tafelten wir auf der Terrasse mit grossartiger Sicht auf den Golf von Neapel. Die Temperatur war ideal, die Pasta vorzüglich, aber auch der schwere Vulkanwein EstEstEst. Dass dieser Name auf einen Weinliebhaber des Fuggerschen Handelsimperiums zurückzuführen war, vernahm ich erst viel später. Jedenfalls machte dieser Wein die Gemüter fröhlich und die Zunge schwer. Res hat mir noch oft lachend vorgehalten, wie ich, als spätabends ein kühler Wind uns von der Terrasse vertrieb, der feschen Serviertochter zulallte: Mirrr gö jitz da ine. Nach ein paar Tagen gesellte sich Max Greco zu uns. Zusammen machten wir einen ausserordentlich interessanten Besuch in Pompeji und stiegen auf den Monte Faito. In unserer etwas exotischen Aufmachung fielen wir natürlich auf. In einer Metzgerei sprachen Kunden und Metzger offenbar wenig schmeichelhaft über uns merkwürdige ausländische Vögel. Das ärgerte Max, der natürlich jedes Wort verstand. Unvermittelt erhob er die Stimme und in seinem neapolitanischen Dialekt, den er seit Kindsbeinen perfekt beherrschte, tat er den Leuten seine Meinung kund. Darauf wurde es sehr still in der Metzgerei. Miteinander fuhren wir nach Capri. Die felsigen Buchten, die Bläue des Meers und die malerischen Dörfer haben sich meinem Gedächtnis unauslöschlich eingeprägt. Nicht vergessen habe ich aber auch den etwas peinlichen Zwischenfall in einem besseren Restaurant. Ein Teller voll gebratener Sepia (Tintenfisch) stand vor mir. Beim Zerschneiden rutschte mein Messer aus und der ganze Tellerinhalt ergoss sich – zum Glück – auf die Serviette. Ich brauchte diese nur hochzuheben und den Inhalt wieder ins Teller zurückzuschütten. Geniert habe ich mich dennoch. Die Rückfahrt traten Res und ich per Eisenbahn an. Das Autostöppeln über so grosse Distanz hätte zu lange gedauert. Die Bahnfahrt war natürlich auch recht mühsam, da für unser Budget ein Schlafwagenplatz nicht in Frage gekommen wäre. Wenn ich mich recht erinnere, dauerte die Rückreise gegen 24 Stunden. Immerhin: wir sind glücklich wieder in Bern angekommen, wo sich unsere Wege für viele Jahre trennten.
Die letzte grosse Reise als Gymnasiast (oder war es während meines ersten Studienjahrs?) führte mich nach England. Mich hatten zwei ältere Damen eingeladen. Sie waren anlässlich einer Schweizer Landfrauenausstellung bei uns zu Gast gewesen und wollten sich revanchieren. So trat ich in Genf-Cointrin meine allererste Flugreise an. Wie ich mich mit meinen spärlichen Englischkenntnissen vom Flughafen durch halb London zur Waterloo-Station durchschlug, ist mir heute noch ein Rätsel. Via Birmingham gelangte ich irgendwie in den Norden nach Westmoreland. Gastgeber waren Arthur und Roberta Fildes. In einem schmucken Cottage, aus grauem Schiefer gebaut und von unzähligen Rosenstöcken umgeben, verbrachte ich zwei Ferienwochen. Zahlreiche Wanderungen im überaus pittoresken Lake District, Ausflüge und Besuche liessen die Zeit im Nu vorbeigehen. Es gab etliche Höhepunkte. Eine Aufführung der Matthäuspassion in der Kathedrale von York. Eine Autofahrt auf eine Insel, wo wir von der steigenden Flut überrascht wurden und nur knapp einem Desaster entkamen. Der Besuch einer Teehalle (four o’clock), wo mich Roberta und Kathleen ins Schlepptau nahmen und mich hundert neugierigen Augenpaaren vorführten. Ich war das einzige männliche Wesen im Raum. Hui, wie das knisterte. Eine Tageswanderung mit Ann, Roberta und Arthurs Tochter. Sie war eben für zwei Ferienwochen aus dem Internat nach Hause gekommen. Robertas Mann Arthur war ein ungelenker Riese. Weiter als bis London war er nie gekommen. Alles Fremde und insbesondere alles Kontinentale war ihm zutiefst verdächtig. Brexit lässt grüssen. Immerhin hat er mich akzeptiert. Wie ich viel später vernahm, hätte er sich sogar mit mir als Schwiegersohn abgefunden. Nach Jahren musste er eine noch grössere Kröte schlucken. Ann heiratete einen Kenianer ganz dunkler Hautfarbe und erst noch Muslim! Hier muss ich zu Arthurs Ehrenrettung etwas nachtragen. Mit meiner Frau und dem kleinen Thomas, etwa zwei Jahre alt, besuchte ich die Familie Fildes in Rose Cottage noch einmal. In kürzester Zeit freundete sich Arthur mit dem Bübchen an, setzte ihn auf seine Knie und hob ihn auf seine hohen Schultern, holte Bilderbücher aus einem Schrank und spazierte mit ihm in den Garten. Absolut unvergessen bleibt das Bild, wie der grosse, grosse Mann mit Klein Thomas unter den Tisch kroch, um nach einem Spielzeug zu suchen. «Continental" hin oder her.

Junger Mann – was nun?
Da hatte ich nun also das Reifezeugnis in der Tasche. Aber wirklich reif, maturus, fühlte ich mich keineswegs. Vielerorts wird für den Abschluss der gymnasialen Ausbildung der Ausdruck «Abitur», Abgang, verwendet. Mir scheint er treffender als «Matura». So oder so musste ich aber eine Studienrichtung wählen. Das war gar nicht so einfach. Ich konnte mir einigermassen vorstellen, einmal als Förster, als Ingenieuragronom, als Architekt oder allenfalls als Arzt zu wirken. Ich konnte es mir vorstellen – aber wirklich überzeugt war ich nicht. Gar nicht vorstellen konnte oder wollte ich mir ein Theologiestudium. Zwar hätte ich mit der Latein- und der Griechisch-Matur günstige Voraussetzungen gehabt. Aber mit dem Hebräisch fehlte mir die dritte der geforderten alten Sprachen. Diese nachzubüffeln widerstrebte mir. Zudem fehlte mir ein leuchtendes Vorbild. Keinem der Herren Pfarrer, denen ich begegnet war, wollte ich ähnlich werden. Doch je näher die Maturitätsprüfung rückte, desto mehr begann ich zu schwanken. Könnte dies allenfalls doch ein Weg sein für mich? Die Unsicherheit bewog mich, bei der akademischen Berufsberatung vorzusprechen. Der Herr, mit dem ich einen Termin vereinbart hatte, empfing mich in einem Büro der Sekundarschule Belp. Neben seiner Arbeit als Lehrer wirkte er nebenamtlich als Berufsberater. Er stellte mir allerlei Fragen und machte Tests, zum Beispiel den Rorschach-Test. Zudem lotete er meine Intelligenz aus. Am Schluss gestand er mir zu, über den fürs Theologiestudium nötigen Quotienten zu verfügen. Das hatte ich allerdings vorher auch schon vermutet. Weitere Entscheidungshilfen lieferte er nicht. Zum Schluss verriet er mir, es habe sich bei ihm noch nie jemand punkto Theologiestudium beraten lassen. Was wollte er mit dieser Aussage andeuten? Vor der Wahl dieses Faches gebe es nur ein Ja oder ein Nein und Zweifel seien nicht normal?
Wie dem auch sei: zu Beginn des Wintersemesters fand ich mich mit einer Handvoll weiteren Neulingen im ehrwürdigen Hauptgebäude der alma mater bernensis ein. Ziemlich ratlos stand man in der Vorhalle der Uni vor einem Aushängekasten, wo die Dozenten auf einem Zettel ihre Vorlesungen fürs kommende Semester ausgeschrieben hatten. Eine Beratung, welche Vorlesungen belegt werden sollten, gab es nicht. So folgten wir einem Kommilitonen, der bereits zwei Semester hinter sich hatte, in den Hörsaal Nummer 5. Das war ein düsteres, treppenförmig angelegtes Lokal, in dem wohl gegen hundert Studenten Platz gefunden hätten. Wir indessen waren eine bescheidene Schar, etwa ein Dutzend Vorpropädeutiker. Die theologische Fakultät der Universität Bern umfasste damals etwa zwei Dutzend Studenten, die das propädeutische Examen noch nicht abgelegt hatten, und etwa 20 «Nachpropädeutiker», die auf das Staatsexamen hinarbeiteten. Erst nach meinem Studienabschluss wuchs die Fakultät. Grund war offensichtlich der Zuzug neuer, kompetenter Professoren.
Da sassen wir nun in den harten Holzbänken, hörten uns an jenem ersten Vormittag die Vorträge vier verschiedener Professoren an und versuchten, das Wesentliche zu notieren. Ehrlich gesagt, fand ich die meisten Vorlesungen sehr langweilig, vor allem die Fächer «Einleitung ins Alte Testament» und «Einleitung ins Neue Testament». Die beiden Dozenten ergingen sich endlos in grammatikalischen und sprachwissenschaftlichen Détails. Der Alttestamentler etwa, Professor Stamm, ein sehr liebenswürdiger Herr, hatte ein Steckenpferd: die akkadische Sprache, ihre Wurzeln in der sumerischen und ihre Verwandtschaft mit der hebräischen Sprache. Wenn er gemeinsame Wurzeln eines Ausdrucks in zwei oder gar drei dieser ausgestorbenen Sprachen entdeckte, freute er sich wie ein Kind. Indessen vermochte er diese Freude nie auf uns zu übertragen. Was sollten wir mit dem Akkadischen, wenn uns schon das Hebräische Bauchgrimmen bereitete! Seine frühsemitische und unsere postpubertäre Welt klafften planetarisch weit auseinander. Dazu kam eine weitere Mühsal. Durch die wissenschaftliche Analyse biblischer Texte geriet mein vorwissenschaftliches Verständnis in Bedrängnis. Früher war das mit dem Heiland und dem lieben Gott etwas Einfaches und Vertrautes gewesen. Nun sollte auf einmal das erste Kapitel der Bibel seine Wurzeln in der babylonischen Mythologie haben? Und die Sache mit den sieben Tagen und dem Paradies sollte man historisch-kritisch hinterfragen? Das Wandeln Jesu auf dem See: Mythus oder Legende oder Tatsachenbericht?
Später wurde mir wohl klar, dass diese Methode fundamental sei für das Glaubensverständnis eines mündigen Zeitgenossen. Doch im ersten Semester vor allem hatte ich es schwer, mit diesen Fragen und diesen Zweifeln umzugehen. Während Wochen schlug ich mich mit dem Gedanken herum, das Studium abzubrechen. Schluss mit Theologie, Schluss mit Pfarrerberuf! Was mich schliesslich hinderte zu kapitulieren, war die Wochenschlussvorlesung am Freitag um 11 Uhr. Hans Dürr, Professor für praktische Theologie und Missionswissenschaft, unterschied sich von seinen Kollegen durch das innere Feuer seines Vortrags. Er hatte viele Jahre in Indonesien verbracht, als Lehrer an einem theologischen Seminar der indonesischen Kirche. «Mission» war während Jahrhunderten eine total paternalistische Sache gewesen. Vor allem pietistische Kreise der europäischen Kirchen schickten Männer (damals ausschliesslich Männer) zu den sogenannten Heiden, um sie zu bekehren. Die Missionare lehrten, was rechter Glaube und frommes Leben sei. Die sogenannten Eingeborenen hatten das anzunehmen und dafür zu danken. Klassisches Symbol dieser Haltung: das Negerlein auf dem Kässeli in der Sonntagschule. Wenn man einen Zehner einwarf, dankte es dem Spender mit untertänigem Nicken. Hans Dürr vertrat eine andere Theologie, die im Gefolge der berühmten Konferenz von Bandung (1956) viele Kirchen zu einer Neudefinition von «Mission» führte. Dürr erzählte mit Respekt von den Menschen und der Kultur in Indonesien, von seinen Studenten und Mitarbeitern, von den durch die einheimische Kirche gegründeten Schulen und Polikliniken, von der Landwirtschaftsschule Tumbang Lahang, von der Partnerschaft zwischen Indonesiern und Europäern. Immer noch hielten die holländischen Kolonialherren an den alten Herrschaftsstrukturen fest. Dürr erzählte, wie er einmal vom Gouverneur zu einer Audienz vorgeladen worden war. Wie weiland im alten Rom vor den Kaisern musste er sich im Audienzsaal unter steten Verbeugungen dem Gouverneursthron nähern und nach gehabter Audienz rückwärts den Saal wieder verlassen. Wie anders war das Leben in der Kirche von Kalimantan! Die Ausdrücke «brüderlich» und «schwesterlich» mochten altmodisch klingen. Aber sie spiegelten offenbar das Wesen der neuen Missionstheologie. Die Begeisterung, die Hans Dürr ausstrahlte, wirkte ansteckend. So etwa könnte es in Kirche und Theologie sein, dachte ich bei mir, und verzichtete auf den Ausstieg.
Während der ersten Semester hatten wir, Klassenkameraden vom Gymer, noch recht häufig Kontakt. Einmal im Monat trafen wir uns am Stammtisch. Dabei konnten wir an einem Nebentisch die für uns merkwürdigen Bräuche der Verbindungsstudenten beobachten, insbesondere ihre zackigen Trinksitten. Wir staunten und grinsten. Keiner von uns ist meines Wissens je einer Studentenverbindung beigetreten. Interessanter waren jedoch Besuche an andern Fakultäten. Die Mediziner erzählten mit Vergnügen von den Vorlesungen ihres Physikprofessors. Houtermans hiess er, wenn ich mich richtig erinnere. Sie machten uns richtig neugierig. So kam es, dass wir einmal den grossen, mit Medizinstudenten vollgestopften Hörsaal besuchten und uns eine Stunde lang ergötzten an den Sprüchen und Faxen des Professors. Eine Physikvorlesung als Kabarett!
Auch andere Fakultäten interessierten mich. Ab dem 3. oder 4. Semester besuchte ich ziemlich regelmässig Vorlesungen über Kunstgeschichte. Vor allem hatte es mir Professor Huggler angetan, damals auch Direktor des Kunstmuseums. Sein Vortrag war rhetorisch kein Meisterstück. Er stammelte und suchte oft die Worte. Inhaltlich hingegen konnte man viel profitieren. Die klassische Moderne war ein bevorzugtes Thema. Davon zeugt ja noch heute die Sammlung des Kunstmuseums. Die Zahl der Hörer war noch geringer als bei uns Theologen. Auf alle Fälle muss das Budget für die Kunsthistoriker bescheiden gewesen sein. Für einen richtigen Assistenten reichte es nicht. Dafür ging einer der älteren Studenten dem Professor zur Hand, schleppte Bücher, richtete den Diaapparat ein, erinnerte den etwas vergesslichen Professor an Termine. Der Name dieses Studenten: Harald Szeemann, Jahre später ein weltweit bekannter und gerühmter Ausstellungsmacher. Seine letzte bedeutende Ausstellung ist heute (2017) im Museum auf dem Monte Verità bei Ascona zu bewundern.
Nach dem ersten Studienjahr musste ich, wie alle gesunden jungen Schweizer, in die Rekrutenschule einrücken. Man hatte mich zur Infanterie eingeteilt. Die Kaserne befand sich in Wangen an der Aare. Es folgten 120 Tage, die fast nicht enden wollten. Nicht die körperliche Anstrengung machte mir zu schaffen, sondern der endlose, geisttötende Drill. Wochenlang den Karabiner, das leichte Maschinengewehr und die Maschinenpistole laden und entladen, die Verschlüsse auseinandernehmen und wieder zusammensetzen, den Gewehrgriff üben und noch einmal üben, und alles zack zack. Nie im Leben habe ich mich mehr gelangweilt. Mühe machten mir aber auch einige superpatriotische Offiziere, die eine militaristische Ideologie verkörperten. Wir sollten uns fühlen wie junge Leoparden, geschmeidig, schnell, stets kampfbereit. In den Liedern, die wir singen mussten, wurde dem Blutdampf und dem Schwertkampf gehuldigt. Angeblich stünden wir Schweizer felsengleich, nie vor Gefahren bleich, Schmerz uns ein Spott! Infanterie sei die schönste aller Waffen ahoi. Und es fallen die Granaten in die Kompagnie Soldaten und gar mancher beisst ins Gras. Gegen solchen und anderen Unsinn wehrte ich mich, zusammen mit zwei Kameraden. Wir wurden alle, jeder für sich, vor den Schulkommandanten zitiert, hochoffiziell mit Stahlhelm und Karabiner. Eine sogenannte dienstliche Unterredung, kunstvoll inszeniert auf dem Kasernenhof. Es war Feierabend. Alle Kameraden drängten an die Fenster und durften zugucken, wie man uns abkanzelte.
Es spielte sich ungefähr folgender Dialog ab:
Oberst Indermühle: «Rekrut Balmer, was machen Sie, wenn Einbrecher euer Haus heimsuchen?»
«Ich alarmiere die Polizei.»
«Eben, eben. Genau darum hat die Schweiz eine Armee, um sich gegen die bösen Feinde zu verteidigen».
«Ich bin ja nicht gegen die Armee, sonst wäre ich nicht eingerückt. Ich bin gegen Militarismus und gegen die Verherrlichung von Heldentum und Heldentod. Militär ist bloss eine bittere Notwendigkeit».
Oberst Indermühle, schon ziemlich aufgebracht:
«Denken Sie an die Abertausend Amerikaner, die über den Atlantik kamen, um für uns zu sterben und die Freiheit zu retten. Das waren Helden, anders als Sie Stubenhocker».
«Ja, sie haben sich geopfert. Aber sie alle hatten Mütter, Frauen und Schwestern, die um sie trauerten».
Weiter kam ich nicht. Der Oberst bekam einen hochroten Kopf und begann, mich mit ziemlich wüsten Worten zu beschimpfen. Dann konnte ich abtreten. Weitere Konsequenzen hatte das Gespräch nicht, für keinen von uns drei harmlosen Revoluzzern. Mit einem von ihnen, Otto Wenger, bin ich bis heute freundschaftlich verbunden.
Am 19. November 1955 wurden wir entlassen. Das Datum bleibt unvergessen.
Wenn im darauffolgenden Wintersemester wieder Langweile aufkommen wollte, erinnerte ich mich an die nicht enden wollenden Stunden und Tage in der Rekrutenschule. Erinnerungen können ein probates Mittel gegen Frustrationen sein.
Immerhin zeigten sich im Dschungel langfädiger wissenschaftlicher Vorträge immer häufiger auch Lichtungen. Im Fach «Kirchengeschichte» stiess man auf Zusammenhänge, die einen zu fesseln begannen. Wenn man mehr weiss zum Beispiel über die Berner Reformation, beginnt man das Münster ganz neu zu sehen. Niklaus Manuel, früher bloss ein Name, wird auf einmal lebendig. Die Täufergeschichte verbindet man mit Gottfried Kellers Novelle «Ursula». Man ist entsetzt und fasziniert. Luthers Heiligenschein verblasst, wenn man zum Beispiel seine oftmals grobschlächtigen Tischreden liest. Doch das Bild, das unter der Firnis der Lobreden vieler Jahrhunderte zum Vorschein kommt, bekommt eine menschliche Dimension: Bruder Martin; scharfsinniger Debattierer; Ehemann der tüchtigen Katharina von Bora; zärtlicher Vater seines Hänsichen. Auch die biblischen Fächer, Altes und Neues Testament, werden lebendiger, berührender. Und schon nähert man sich der ersten Klippe, dem Propädeutikum. Da sollte man den Stoff von vier Semestern präsent haben. Der Stoff ist uferlos. Man kann unmöglich alles wissen. Nur im Mittelalter gab es so etwas wie Universalgelehrte. Vor dem Staatsexamen wird einem später dieses Gebirge an Wissen und die Unmöglichkeit seiner Ersteigbarkeit noch schärfer bewusst werden. Es ist wohl begreiflich, wenn man vor einem Examen mehr oder weniger zittert. Im Nachhinein zeigt sich dann oft, dass die Professoren selten darauf aus sind, möglichst viele Wissenslücken aufzudecken. Sie wollen lieber feststellen, was einer gelernt hat und wie er mit seinem Wissen umgehen kann. So war es denn auch in meinem Fall. Ich bestand das Propädeutikum und es eröffneten sich mir neue Welten, wie etwa die Verbindung von Theorie und Praxis. Zu den neuen Fächern gehörten die systematische Theologie, die Dogmatik und die Dogmengeschichte. Der neu gewählte Professor Gottfried Locher wusste mich zu fesseln. Ein kleines Minus sei immerhin angemerkt. Locher überzog seine Vorlesung regelmässig um mindestens 5, oft sogar 10 Minuten. Das war ärgerlich, besonders wenn man auf den Zug musste oder einem Rendez-vous entgegenfieberte. Aber er hatte eben viel zu bieten. Die Kirchenväter oder die Scholastiker wurden lebendig. Was für kunstvolle Lehrgebäude hatten die erschaffen! Zum Beispiel Anselm von Canterbury, der streng juristisch argumentierend «bewies», dass Gott Mensch werden musste, um uns vom Sündenverhängnis zu befreien. Faszinierend und oft auch sehr amüsant war es zu entdecken, wie während Jahrhunderten über zentrale Glaubenssätze gestritten wurde. Oft ging es um Spitzfindigkeiten. Bis auf den heutigen Tag noch kann ich schmunzeln, wie auf Konzilien in den ersten Jahrhunderten das Problem diskutiert wurde, wie die beiden Naturen Christi, die menschliche und die göttliche, miteinander verbunden seien: wie zwei Flüssigkeiten, die miteinander vermischt waren? oder wie zwei fest zusammengeleimte Körper? Wichtige theologische Kontroversen wurden manchmal gar nicht durch Theologen oder Diskussionen an den Konzilen entschieden, sondern durch ein Machtwort des Kaisers. Es kam auch vor, dass randalierende Mönchshorden die Konzilsväter zwangen, so oder anders zu entscheiden. Jedenfalls wuchs in mir schon während des Studiums ein gewisses Misstrauen gegenüber ehernen Glaubenssätzen und auch gegenüber Kirchenoberen oder Politikern, die vorgeben, die ganze Wahrheit gepachtet zu haben.
Neu war auch die sogenannte praktische Theologie. Wir sollten zum Beispiel in die Kunst des Predigens und in die Kunst des Unterrichtens eingeführt werden. Im Hinblick auf die Seelsorge waren minimale psychologische Kenntnisse wichtig. Von Sigmund Freud, C.G. Jung und andern Koryphäen sollte man doch eine Ahnung haben. Die Frage um die Grenzen von Seelsorge und Psychologie beziehungsweise Psychotherapie musste unbedingt bedacht werden. Hilfreich waren für uns Pfarrersetzlinge die Vorlesungen von Professor Heimann in der psychiatrischen Klinik Waldau. Einerseits war es irritierend, Patienten wie in einer Arena vorgeführt zu bekommen. Anderseits aber verdeutlichten die Gespräche, wo die Grenzen der Seelsorge lagen und wann man später einmal Klienten an Psychiater oder Psychotherapeuten weiterzuleiten hatte.
Gar keine Freude bereitete mir das Fach Katechetik (heute heisst das Religionspädagogik). Das lag fast zu hundert Prozent am Dozenten. Ausser seiner Tätigkeit als altgedienter Pfarrer in der Stadt Bern hatte er keine Qualifikationen. So bestanden seine Vorlesung aus einer Aufzählung von vorwiegend belanglosen Müsterchen und Anekdoten aus seiner Tätigkeit. Zwar organisierte er für uns Studenten Probelektionen im Brunnmattschulhaus. Aber wir mussten uns den Stoff und die Methode aus den Fingern saugen. In der anschliessenden Besprechung kam fundierte Kritik oder auch fundiertes Lob nicht von ihm, sondern von zwei klugen Mitstudenten in den letzten Semestern. Auf alle Fälle fühlte ich mich nach dem Studienabschluss absolut hilflos und inkompetent für den kirchlichen Unterricht. Vor dem Antritt meiner ersten Pfarrstelle nahm ich eine zweimonatige Auszeit, um mich vorzubereiten.
Bei Professor Dürr, von dem ich schon erzählt habe, wurden wir mit der sogenannten Homiletik vertraut gemacht. Wie erarbeitet man eine Predigt? Welches ist die Aufgabe der Predigt? Im homiletischen Seminar musste jeder mal eine Predigt vorbereiten und sie vor den Mitstudenten auswendig vortragen. Und dann, wenn man mindestens ein homiletisches Seminar besucht hatte, erhielt man die Predigterlaubnis. Wo ein Pfarrer in den Ferien oder krank war, durfte man ihn am Sonntag auf der Kanzel vertreten. Wir wurden dafür auch entschädigt, 20 oder 40 Franken, ich weiss es nicht mehr genau. Reich wurde man nicht, aber es war immerhin ein kleines Taschengeld. Sehr genau erinnere ich mich an meine erste Predigt. Ich hatte viele Stunden an der zu haltenden Predigt geknorzt und reiste an jenem Sommersonntagmorgen mit dem Zug nach Schüpfen. Je mehr sich der Zug dem verflixten Schüpfen näherte, desto schlimmer wurde das Lampenfieber. Alle möglichen Zwischenfälle malte ich mir aus. Ich könnte den Faden verlieren. Das Manuskript würde vom Kanzelbrett zu Boden fallen. Jemand könnte vorzeitig die Kirche verlassen, weil ihm meine Predigt nicht gefiel. Und so weiter. Schon setzte das Predigtgeläute ein, als ich an der Pfarrhaustür läutete. Freundlich hiess mich die Pfarrfrau eintreten und eröffnete mir beiläufig, heute seien dann noch zwei Kinder zu taufen. Was, zwei Taufen? Mich traf beinahe der Schlag. Ich hatte meiner Lebtag noch nie eine Taufhandlung vollzogen und war total unvorbereitet. Aber die Frau Pfarrer wusste Rat. Aus dem Studierzimmer ihres Gatten holte sie ein schweres schwarzes, schon ein wenig abgegriffenes Buch. Auf dem Buchdeckel war in goldenen Buchstaben das Wort «Liturgie» eingeprägt. Die Dame half mir, das einschlägige Kapitel zu finden. «Taufe vor versammelter Gemeinde». Rasch überflog ich die fünf einschlägigen Seiten. Die geschraubte Sprache gefiel mir nicht. Sollte ich Studentlein die Eltern ermahnen, ihr Kind christlich zu erziehen «in der Zucht und Vermahnung zum Herrn»? Und die Paten sollten das Kindlein «dem Herrn weihen» und es durch eine christliche Erziehung «dem Herrn, ihrem Gott, zuführen». Was hiess das? Wie ging das? Aber es blieb keine Zeit für langes Überlegen. Frau Pfarrer überreichte mir die zwei Taufscheine, die Herr Pfarrer vorbereitet hatte, und führte mich ins Empfangszimmer, wo ein ganzer Haufen schwarzgekleideter Menschen wartete. Ich grüsste, stellte mich vor, warf einen kurzen Blick auf die zwei Würmchen und führte die Schar in die Kirche. Das Geläute verstummte, die Orgel begann zu brausen und ich zitterte immer noch. Irgendwie brachte ich die Taufe mitsamt der Vermahnung zum Herrn hinter mich und kletterte auf die Kanzel.
Und merkwürdig: sobald ich die Bibel aufgeschlagen, das Manuskript geordnet und die ersten Worte gesprochen hatte, war das Lampenfieber vorbei und ich fühlte so etwas wie Genugtuung, dieser Gemeinde eine Predigt vortragen zu dürfen.
Etwas ruhiger sah ich dem zweiten Gottesdienst entgegen. Es war in Köniz, und diesmal wollten sogar drei Familien ihr Kind taufen lassen. Die Mutter eines Täuflings bat mich, ihr Töchterchen nicht als Anna zu taufen, wie es im Taufschein stand, sondern Anneli. Prompt vergass ich dann, der Bitte zu entsprechen. Es war mir sehr peinlich.
Die Mehrzahl der Studenten zwischen Propädeutikum und Staatsexamen folgten der Tradition, mindestens ein Semester an einer anderen Universität zu studieren. Heidelberg war bei den Bernern sehr beliebt. Eben darum traf ich eine andere Wahl. Mich zog es nach Bonn, damals noch deutsche Bundeshauptstadt. Unterkunft fand ich im Goebenstift. Es war etwa ein Dutzend Jahre zuvor von der «Bekennenden Kirche» gegründet worden. Zu ihren geistigen Vätern gehörte Karl Barth, auch Martin Niemöller, Dietrich Bonhoeffer und Helmut Gollwitzer. Sie hatten die von den Nazis geleiteten hitlertreuen «Deutschen Christen» bekämpft. Viele der bekennenden Christen, etwa Bonhoeffer, endeten in Konzentrationslagern. Barth wurde in die Schweiz zwangsausgeschafft. Er hatte sich geweigert, seine Vorlesungen mit dem Hitlergruss zu beginnen. Gollwitzer steckte man in eine Strafkompagnie an der Ostfront. Nach einigen Jahren kehrte er aus russischer Gefangenschaft zurück, schrieb seine Memoiren und bekam einen Lehrstuhl in Bonn. Auch seinetwegen wählte ich Bonn als Studienort.
Das Stiftsgebäude lag an einer Nebenstrasse, etwa zwanzig Gehminuten von der Universität entfernt. Auf drei Stockwerken befanden sich etwa 15 Zweierzimmer. Im geräumigen Versammlungsraum im Erdgeschoss wurde auch ein einfaches Frühstück serviert, Brot und ein aschgraues fades Getränk, das als Kaffee ausgeschenkt wurde. Konfitüre musste man selber beschaffen. Seltsam kam es mir vor, dass sich die Studenten nicht duzten. Ich war der Bruder Balmer, mein Zimmergenosse der Bruder Karallus. Das sei eben, so sagte man mir, ein Erbe des Kirchenkampfs. In der Nazizeit habe eine kumpelhafte Kameradschaft geherrscht. Davon wolle man sich distanzieren. Am Semesterende hatte ich mich immerhin mit einem Dutzend Kommilitonen so angefreundet, dass wir per Du waren. Mein Zimmergenosse Erich Karallus, ein gemütlicher, friedfertiger Mensch, war in Ostpreussen aufgewachsen und zusammen mit seinem Vater in den Westen geflüchtet, unter Zurücklassung von Hab und Gut, wie Zehn- oder Hunderttausende. Erich haderte nicht mit dem Schicksal. Er war dankbar für das grosszügige Stipendium, das ihm die Bundesrepublik gewährte. Jeden Sonntag besuchten wir, zusammen mit Franz, einem andern Freund Erichs, eine Konditorei. Franz führte uns an. Er war Spezialist, da sein Vater in Oberhausen eine Bäckerei betrieb. Am Ende des Semesters hatten wir wohl die Hälfte der Konditoreien Bonns abgeklopft, auf der Suche nach besonderen Leckereien. Am Samstag suchte dich hingegen ein Restaurant auf. Das magere Frühstück und mittags der «Frass» in der Mensa (meistens ein Teller voll verkochter Kartoffeln und darüber ein Guss undefinierbarer brauner Sosse) vermochten mich nur knapp zu sättigen. Immerhin kostete diese Mittagsverpflegung nur 80 Pfennig. Deshalb gönnte ich mir am Samstag eine währschafte Schlachtplatte – deutsche Abart der Berner Platte. Dabei ging es mir mindestens so sehr um Quantität wie um Qualität.
Mit Erich Karallus, dem Zimmergenossen, verband mich eine langjährige Freundschaft. Wir korrespondierten später ziemlich regelmässig. Auf dem Weg in die Ferien nach Südfrankreich kam er manchmal bei uns vorbei. Auch ich besuchte ihn und seine Frau Brigitte gelegentlich in Düsseldorf. Bei einem dieser Besuche führte mich das Ehepaar quer durch das Ruhrgebiet. Als ich jung war, hatte man diesen Landstrich als den schmutzigsten Winkel Mitteleuropas gemieden. Eine Kohlemine nach der andern, riesige Industriewüsten (u.a. die Krupp’schen Werke), der Himmel verhangen mit schwarzem Rauch. Nun offenbarte sich mir eine Gartenlandschaft. Die Ruhr ein sauberes Flüsschen. Überall Parks und Freizeitanlagen. Eine Metamorphose sondergleichen. Erich machte in der Kirche von Rheinland-Westfalen Karriere und wirkte zuletzt als Generalsuperintendent. Was für ein prachtvoller Titel! Erich ist jedoch dieser Aufstieg nicht in den Kopf gestiegen. Ein paar Jahre vor seiner Pensionierung zeigten sich bei ihm erste Ausfallerscheinungen. Er fand die Wörter nicht mehr. Seine Sprache wurde immer hektischer, leiser und unverständlicher. Es sei eine Sonderform von Parkinson, sagte mir seine Frau, eine praktizierende Ärztin. Bei meinem letzten Besuch in Düsseldorf musste sie mir alles «übersetzten». Noch vor seinem siebzigsten Lebensjahr ist Erich gestorben.
Unter den Professoren der evangelischen Fakultät schätzte ich besonders den Systematiker Kreck, bei dem ich nebst den Vorlesungen ein homiletisches Seminar besuchte. Und dann war da natürlich Gollwitzer. Ab und zu besuchte er unser Stift. Seinen Erzählungen, oft mit schwäbischem Witz garniert, hörte man gerne zu. Damals, 12 Jahre nach Kriegsende, wurde in der BRD heftig über die Wiederbewaffnung Deutschlands diskutiert. Adenauer und die CDU liebäugelten sogar mit der atomaren Aufrüstung. Dagegen setzte sich Gollwitzer heftigstens zur Wehr. Nach einer vielbesuchten öffentlichen Debatte durften wir im Goebenstift im kleinen Kreis noch mit ihm weiterdiskutieren. Weil damals die Armeeführung auch in der Schweiz für die atomare Bewaffnung weibelte, fragte ich ihn schüchtern nach seiner Meinung. Ich war damals – es sei geklagt – noch der Meinung, die Schweiz sei ja ein Sonderfall und neutral, deshalb wäre doch vielleicht und allenfalls eine Schweizer Atombombe denkbar. Aber da fuhr Gollwitzer auf. Im Falle dieser teuflischen Waffe gebe es nur ein Nein. Und nochmals Nein! Ich habe mich später seiner Meinung angeschlossen.
Gerne erinnere ich mich an den Russen Nikolaj Arseniew. Er war Gastprofessor und las zum Thema «Russische Geistesgeschichte». Als unverbesserlicher Russophiler wollte ich das nicht verpassen. Mit Begeisterung skizzierte er die Gedankenwelten von Berdjajew, Solowjow und Dostojekwskij. Aber wie es vielen Russen eigen ist: seine Ausführungen gerieten breit und breiter, uferten aus. Lange kreiste er um dasselbe Thema. Das widerstrebte den deutschen Studenten. Sie schätzten kurze, linear strukturierte Gedankengänge. Deshalb nahm die Zahl der Hörer Woche um Woche ab. Gegen Schluss des Semesters waren bloss etwa sechs Studenten übriggeblieben. Arseniew war sehbehindert und etwas gebrechlich. Darum begleitete ich ihn gelegentlich nach Hause und plauderte mit ihm über alles Mögliche. Er hatte auch schon die Schweiz bereist, Bern zum Beispiel. Aber diese Stadt mit ihren Lauben gefiel ihm nicht. Es sei ihm so eng vorgekommen, dunkel und freudlos. Dieses Urteil teilte ich natürlich nicht. Nachträglich fragte ich mich, ob er gar nicht die Häuser und die Mauern gemeint habe, sondern die Menschen. Viele Ausländer erleben uns bekanntlich als unnahbar, kühl, sogar als abweisend.
Während einer Ferienwoche unternahm ich mit drei Kommilitonen eine Velotour nach Holland. Via Aachen und Arnheim erreichten wir die holländischen Metropolen Amsterdam und Rotterdam, besuchten das Rijks- und andere Museen, den Käsemarkt von Volendam, die Nordseeküste. Am Meer holte sich der sehr hellhäutige Richard einen fürchterlichen Sonnenbrand. Zwei Tage lang humpelte er barfuss herum, da er den Druck der Schuhe nicht ertragen hätte. Erinnerlich ist mir auch, dass wir fröhlich ins Meer hinausschwammen und erst spät bemerkten, dass sich die Leute am Strand versammelt hatten und uns etwas zuschrien. Plötzlich merkten wir, was los war. Durch die Ebbe war ein starker Sog meerwärts entstanden Mit grosser Mühe erreichten wir das Ufer und wurden dort erst noch von der Badeaufsicht ausgeschimpft. Sehr beeindruckt hat mich die Haltung vieler Holländer gegen uns Vier. Meine deutschen Kameraden trugen natürlich Lederhosen und verrieten auch durch die Sprache ihre Herkunft. Jedenfalls kam es vor, dass wir in Dorfläden nicht bedient und einmal sogar angespuckt wurden. Die bittere Erinnerung an die Nazizeit war noch lebendig. Dazu kam, dass eben in jenem Sommer ein deutscher General zum NATO-Kommandanten Abschnitt Nord ernannt worden war. Das weckte in Holland bittere Gefühle. Meine Freunde waren sehr betroffen. Sie seien damals ja noch Kinder gewesen. Man könne doch nicht sie für die Taten der Väter verantwortlich machen. Und ich armer gemeinsam mit den Deutschen Missachteter? Konnte ich den Leuten zurufen: aufgepasst, ich gehöre nicht zu denen? Ich bin ein braver Schweizerknabe! Das ging natürlich nicht. Also ertrug ich solidarisch die Antigefühle der Niederländer. Für die letzten zwei Tage trennte ich mich von der Gruppe. Ich plante einen Umweg über Belgien. An der katholischen Universität von Löwen studierte mein Gymerkollege Franz Furger. Der Besuch verlief enttäuschend. Es wollte kein echtes Gespräch zustande kommen. Meinen Versuch, theologische Themen anzusprechen, blockte Franz ab. Auf der Rückfahrt nach Bonn überlegte ich hin und her, was der Grund für diese Zurückhaltung gewesen sein könnte. Die Uni von Löwen war bekanntlich stark jesuitisch geprägt. Waren die Studenten aufgewiegelt worden gegen Andersgläubige und «Ketzer»? Später studierte Franz am jesuitischen «Germanicum» in Rom. Wieder in der Schweiz, bekam er einen Lehrauftrag in Luzern. Zudem delegierte ihn seine Kirche häufig an Diskussionen im Fernsehen und im Radio. Da hatte ich oft das Gefühl, er rede um den Brei herum, weiche heiklen Fragen aus und sei nie ganz fassbar. Franz ist vor Jahren, als einer der ersten unserer Klasse, verstorben.
Gegen Ende des Semesters wurde die Möglichkeit geboten, für eine Gratis-Studienwoche nach Berlin zu reisen. Die Einladung war nicht ganz uneigennützig. Federführend waren die Christlich-demokratische Partei CDU und der ihr zugehörige «Bundesminister für Gesamtdeutsche Fragen», Jakob Kaiser. Der Propagandakrieg zwischen BRD und DDR war damals in vollem Gang und beeinflusste selbst die Sprache. Im Westen musste die Ostzone beispielsweise «Sogenannte demokratische Republik Deutschland» genannt werden. Kaisers Ministerium lag es sehr daran, die akademische Jugend zu gewinnen. Deshalb das tolle Angebot: freie Fahrt nach Berlin. Komfortable Unterkunft in einer CDU-eigenen prächtigen Villa am Wannsee. Ob eben in dieser Villa 15 Jahre vorher anlässlich der «Wannseekonferenz» die «Endlösung» beschlossen worden war? Wir, etwa 25 Studierende, unter ihnen zwei Französinnen und ich als einzige Ausländer, wurden sehr verwöhnt. Jeden Morgen gab es Besichtigungen und Vorträge, zum Beispiel über das Schulsystem oder die Kollektivierung und natürlich über die antiwestliche Propaganda in der DDR. Erinnerlich ist mir zum Beispiel eine Karikatur, in der Bischof Dibelius als Engel vom Himmel flog und dem Adenauer zu Weihnachten eine Atombombe überbrachte. Zwei Fliegen auf einen Schlag: der Bischof und der Bundeskanzler entlarvt als Bösewichte! Am Nachmittag hatten wir frei. Ungehindert konnte man noch durch das Brandenburger Tor nach Ostberlin spazieren. Die Strassen und Häuser in Ostberlin wirkten grau, freudlos und grau waren auch Gesichter und Kleider der Menschen. Farbe brachten fast nur die Propaganda-Spruchbänder, die überall aufgehängt waren. Einmal besuchten einige von uns ein Kino im Ostteil Berlins. Mitten im Film ging plötzlich das Licht an. Zwei Uniformierte betraten den Kinosaal, schritten zielbewusst zur hintersten Reihe und führten einen Mann ab. Alles ging gespenstisch wortlos vonstatten. Dann ging das Licht wieder aus und der Film lief weiter. Eine bedrückende Situation. Am Berliner Ostbahnhof erlebten wir einen Staatsempfang hautnah. Chruschtschew und Mikojan waren zu einem Freundschaftsbesuch hergereist. Wir beobachteten, wie per Lastwagen Arbeiter auf den Platz gekarrt wurden. Es sollten doch möglichst viele Menschen die "Freunde" aus dem Osten begrüssen. Auf den Dächern ringsum waren Maschinengewehre postiert. Dann erschienen auf dem Podium die zwei Sowjetführer, in Begleitung von Ulbricht und Grotewohl. Es folgten langfädige Ansprachen, garniert mit Freundschaftsversprechen und immer wieder von Beifall unterbrochen. Ein eindrücklicheres Erlebnis war für mich der Festakt am Abend desselben Tages. Im grossen Sportpalast musste man natürlich wieder lange Reden über sich ergehen lassen. Dabei fiel auf, wie sich die Redner immer wieder selber Beifall klatschten. So kam es mir wenigstens vor. Möglicherweise wollten sie dem Publikum ihrerseits Beifall spenden. Das Allerschönste freilich war der Auftritt des Volkschors aus Omsk. Erstmals in meinem Leben hörte ich alte russische Volkslieder, dargeboten von einem hervorragenden Ensemble. Ich war ergriffen.
Die Rückreise nach Bonn verlief reibungslos, anders als die Herreise. Unser Bus wurde in Helmstedt, dem Grenzübergang zwischen BRD und DDR, angehalten. Wir drei Ausländer mussten eine ansehnliche Summe Westmark gegen Ostmark zwangsumtauschen, zu einem Fantasiekurs, der viermal höher war als im Devisenhandel. Während der Fahrt durch die «sogenannte DDR», mitten auf der Brücke über die Elbe, erlitt unser Bus einen Defekt. Getriebeschaden! Unmöglich, ihn in absehbarer Zeit zu reparieren. Wir stiegen aus. In kürzester Zeit waren wir umringt von Volkspolizisten. Lange Verhandlungen mit der Reiseleitung. Endlich die Lösung. Die Volkspolizisten stoppten alle Privatautos, die über freie Plätze verfügten. Wir durften einsteigen, wurden aber ganz genau registriert, wie natürlich auch die Fahrer. Beim Grenzübertritt DDR – Westberlin wurde genau abgehäkelt, ob wir wirklich ausreisten und uns nicht etwa heimlich ins Arbeiter- und Bauernparadies abgesetzt hatten.
Am Ende meines Bonner Aufenthaltes erhielt ich eine Anfrage irgendeines Schlossherrn in der Eifel. Der mir unbekannte Graf oder Freiherr oder was auch immer suchte für die Herbstferien einen Hauslehrer für seine Kinder. Im ersten Moment war ich fasziniert. Das Leben auf einem Schloss. Eine mir gänzlich unbekannte Kultur. Wie interessant! Schliesslich lehnte ich doch ab. Denn in der Schweiz existierte eine hübsche junge Dame, die ich baldmöglichst wiedersehen wollte.
Für das Wintersemester schrieb ich mich bei der Basler Universität ein. Vor allem Dank Karl Barth hatte die theologische Fakultät eine starke Anziehungskraft. Seinetwegen kamen vor allem deutsche, aber auch amerikanische Studenten in die Rheinstadt. Durch Vermittlung eines Cousins fand ich ein geräumiges Mansardenzimmer am Spalentorweg. Es hatte ein einziges Dachfenster, durch das die Sonnenstrahlen während des ganzen Winters den Raum nie zu erhellen vermochten. Dafür war es gross genug, um auch meinem Gymerkollegen Hanspeter Stähli Platz zu bieten. Vermieterin und Besitzerin des grossen Hauses war eine alleinstehende Dame. Sie hatte eine Hausangestellte, das «Maitli», ein etwa siebzigjähriges kleines und etwas beschränktes Fraueli. Die Mansarde auf der anderen Seite des Hauses war an eine Seviertochter vermietet. Oft, wenn sie spätabends heimkam, brachte sie einen Begleiter mit und wir mussten durch die dünne Wand dem Liebesgestöhne und dem Quietschen der Bettfedern lauschen. Den Kaffee fürs Frühstück konnten wir in unserem Zimmer brauen. Die Brötchen holten wir in der naheliegenden Bäckerei, wo man immer freundlich und schön baslerisch begrüsst wurde: «Guete Dag Heeer». Einmal pro Tag verpflegten wir uns in der vom Blauen Kreuz geführten Wirtschaft. Da war natürlich kein gastronomischer Höhenflug zu erwarten. Dafür war es billig. Schwerpunkt unseres Studienprogramms waren das Seminar und die Vorlesungen von Karl Barth. Im Seminar, dessen Teilnehmerzahl beschränkt war, durften wir als Zuhörer dabei sein. Die meisten aktiven Seminarteilnehmer waren Deutsche. Die meldeten sich gerne und häufig zu Wort, währenddem die Schweizer sich durch Schweigsamkeit auszeichneten. Barth war sehr daran gelegen, sie nicht untergehen zu lassen. Er ermunterte sie zu Wortmeldungen und wenn er keinen Erfolg hatte, wandte er sich direkt an den Star der kleinen Schweizertruppe: «Was meinen Sie, Herr Helfenberg»? Einmal pro Semester lud er sämtliche Schweizer Studenten zu einem offenen Abend in eine Beiz. Es war schon beeindruckend, dem berühmten, und hochgelehrten Mann direkt gegenüberzusitzen. Mir fiel an jenem Abend sein Humor auf, auch seine feine Selbstironie. Gewiss hatte er in jungen Jahren, bei den heftigen Auseinandersetzungen mit Bultmann oder Emil Brunner in Zürich, auch ganz andere Saiten angeschlagen. Auch den Schweizer Superpatrioten, die ihn jahrelang als Kommunisten verteufelten, hielt er kräftig entgegen. Uns aber begegnete er nicht als der unerbittlich strenge Dogmatiker, sondern grossväterlich und freundlich. War es die Milde oder die Weisheit des Alters?
Seine Hauptvorlesung hielt Barth im Auditorium maximum. Die Hörerschaft war immer zahlreich. Sie setzte sich aus Studenten verschiedenster Nationalität und aus zahlreichen Vertretern der Basler Gesellschaft zusammen. «Man» musste doch Barth gehört haben!
Ebenfalls im Auditorium maximum lasen zwei weitere Koryphäen der Basler Universität. Da war zum Beispiel Walter Muschg, weit herum bekannter Analyst und Kritiker der (Schweizer) Literatur. Grossen Widerhall fand seine Kritik an den vielgehörten Radiobearbeitungen von Gotthelfs populärsten Romanen. Muschg fand diese Sendungen schlimm. Sie reduzierten den grossen Emmentaler Dichter auf Weibergezänk (Dürluft-Eisi, Annebäbi Jowäger), Schlägereien und Klamauk. Das hörten die Radiomacher wie Ernst Balzli und auch viele einfache Radiohörer (wie meine Eltern) für ein hochmütiges Professorengeschwätz. Ich muss zugeben, dass mir die wöchentlichen Gotthelf-Hörspiele gar nicht so übel gefielen. Eines musste man ihnen zugutehalten: sie verlockten das Publikum eher zum Lesen der Werke Gotthelfs als die elitären Ausführungen Muschgs.
Die dritte Grösse unter Basels Universitätsdozenten war – wie ursprünglich auch Karl Barth – ein Berner: der Historiker Edgar Bonjour. Ihm, einem kleinen, glatzköpfigen Mann, hörte ich besonders gern zu und ich verpasste kaum eine seiner Vorlesungen. Schwungvoll betrat er das Podium, legte seine Brille ab und begann seinen brillanten Vortrag – völlig frei, ausgezeichnet formuliert, kaum jemals auf das Manuskript blickend. Sein grosses Thema war die Geschichte der Schweizerischen Neutralität. Etwa ein Dutzend Jahre später erschien diese «Geschichte» in Buchform. Das war nun wirklich spannend. Bis anhin hatte bekanntlich in der offiziellen Schweiz gegolten, unser Land sei nur verschont geblieben, weil die Armee dem Hitler gewaltigen Respekt eingeflösst und wir politisch und wirtschaftlich absolut neutral gehandelt hätten. Bonjour hingegen begann als einer der ersten, diesen Heldenmythos in Frage zu stellen. Wie war das doch mit den an der Grenze abgewiesenen Juden? Mit den Lieferungen von Munition und Maschinen an Nazideutschland, bezahlt durch jüdisches Gold? Fragen über Fragen. Nicht alle Schweizer lieben es, wenn Fragen gestellt werden. Ein paar Jahrzehnte später erfuhren das ja auch die Verfasser des Bergier-Berichtes. Mich aber faszinierten die Vorlesungen des brillanten Historikers, weil ich den Eindruck hatte: hier spricht ein unbestechlicher Zeitzeuge.
Mir ist ein weiterer, weit weniger bekannter Basler Professor in Erinnerung geblieben: Fritz Lieb, Slavist, ausgezeichneter Kenner der orthodoxen Kirche. Selten sassen in seinen Vorlesungen mehr als zehn Personen. Aber wenn der kleine nervöse Mann auf dem Podium stand, stockend aus seinem Manuskript vorlas und zwischenhinein beidhändig in seine schlohweisse Mähne griff, musste man ihm zuhören und zuschauen. Er war Prototyp des zerstreuten Professors. Eines Abends waren einige von uns bei ihm zu Hause eingeladen. Irgendeinmal suchte er nach seiner Brille, auf dem Tisch, in der Jackentasche, überall. Da betrat Frau Lieb das Zimmer. «Suchst du die Brille, Fritz? Du hast sie ja auf der Nase!»
Für das letzte Semester vor dem theoretischen Staatsexamen hatte ich mich wieder an der Berner Uni immatrikuliert. Es verlief wenig spektakulär. Man hatte nicht viel Zeit für Allotria. Vor allem musste man ja versuchen, möglichst viel Stoff in den Schädel zu stapeln. Unspektakulär verlief auch das Examen. Gern denke ich an die Prüfung in systematischer Theologie zurück. Da war nichts von einer langwierigen Abfragerei. Professor Locher führte mit mir einfach ein angeregtes Gespräch (möglicherweise über Anselm von Canterbury?). Fast bedauerte ich, dass die halbe Stunde schon vorbei war.

Übergänge
Mein Leben war bisher in relativ ruhigen Bahnen verlaufen. Ohne besondere Schwierigkeiten »rutschte» ich von Stufe zu Stufe und brachte so auch das Studium hinter mich.
Meine früheren Kollegen von der Sekundarschule und vom Turnverein erzählten da ganz andere Geschichten, zum Beispiel von ihren ziemlich harten Lehrjahren als Schreiner, Schlosser oder Mechaniker. Wie sie jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe aufstehen, in der Werkstatt während des ganzen Tages auf den Beinen stehen, tage- und wochenlang an Metallstücken herumfeilen mussten und obendrein von den älteren Lehrlingen gehänselt wurden. Wenn nicht vom Meister wurden sie vom Vorarbeiter angeschnauzt. Ferien gab es nur zwei Wochen im Jahr. Was für ein Herrenleben führten doch wir Studierenden! Allerdings kannte ich harte Arbeit auch. Während meinen Ferien legte ich meistens auf dem elterlichen Bauernhof Hand an. Ich konnte doch nicht in meinem Zimmer sitzen und durchs Fenster den Arbeitsalltag beobachten, ohne einen Finger zu rühren. Ich erinnere mich gern, wie ich vor allem in den arbeitsintensivsten Wochen, zum Beispiel in der Getreideernte, zusammen mit meinem Bruder Wagen um Wagen mit Garben voll lud – und zwar in einem Tempo, mit dem die Knechte und Tagelöhner nicht konkurrieren konnten. Wir waren jung, wir hatten Kraft. Trotzdem denke ich, meine ehemaligen Kollegen hatten es schwerer. Ihre Lebensschule war härter als die Meinige.
Dann kam das an wichtigen Ereignissen reiche Jahr 1959. Mit dem theoretischen Staatsexamen schloss sich das Kapitel Universität. Es folgte ein erster Schritt in die Praxis – das Vikariat. Ich verbrachte es in der Kirchgemeinde Hilterfingen bei Robert Morgenthaler. Wie damals üblich hatte man ein Zimmer im Pfarrhaus und war mehr oder weniger ins Familienleben integriert. Obschon man kirchlichen Unterricht zu erteilen, regelmässig Gottesdienst zu halten und verschiedene andere Aufgaben zu erfüllen hatte, gab es keinen Lohn. Im Gegenteil. Man musste noch für Kost und Logis bezahlen. Mit dieser Situation hatte ich meine Mühe. Inzwischen zählte ich immerhin schon 25 Jahre und war finanziell stets von meinen Eltern abhängig gewesen. Wohl hatte ich in den Semesterferien etwas Geld verdient, zum Beispiel bei der Post. Die stellte in der Vorweihnachtszeit Studenten ein, um die riesige Paketflut zu bewältigen. Das reichte aber bei Weitem nicht, um das Studium zu finanzieren. Die Abhängigkeit von den Eltern blieb - ein wesentlicher Grund, das Studium in der kürzest möglichen Zeit abzuschliessen. In der Familie Morgenthaler fühlte ich mich wohl. Besonders mit der Jüngsten, dem etwa vierjährigen Brigittli, freundete ich mich an. Es besuchte mich oft in meiner Klause, und wir führten sehr interessante Gespräche über viele Lebensbereiche. Oh dieser Kindermund! Der Älteste, Christoph, hat übrigens etwa 15 Jahre später bei mir das Vikariat gemacht. Wir sind immer noch freundschaftlich verbunden. Robert, mein Vikariatsvater, begleitete mich wohlwollend bei meinen Gehversuchen als Pfarrer-Lehrling. Anderseits konnte ich ihn ein wenig entlasten, da er, Privatdozent an der Uni Bern, intensiv an einem statistischen Wörterbuch des neutestamentlichen Wortschatzes arbeitete. Während den Sommerferien, welche die Familie in Adelboden verbrachte (Brigittli sagte ‘Adiebode’), hütete ich das Pfarramt ganz allein. Da auch die Nachbarpfarrer in den Ferien weilten, bündelte sich die Arbeit enorm. Mehrere Beerdigungen fielen an, auch Taufen und Trauungen. Besonders auf dem Magen lagen mir die 1.August-Ansprachen. Ausser den Pfarrern waren anfangs August offenbar auch viele andere redegewohnte Damen und Herren im Urlaub. In ihrer Not wandten sich die Festkomitees von Hünibach und Merligen an mich. So kam ich zur Ehre, zuerst am Nachmittag und dann am Abend an den Gestaden des Thunersees, umringt von Jodlern und Alphornbläsern, feierlich des Vaterlandes zu gedenken. Leider findet sich in meinen Akten das Manuskript der Ansprache nicht mehr. Es nähme mich wunder, was ich damals den Festgemeinden erzählte. In Anerkennung meiner Verdienste als Ferienvertreter hat mir die Kirchgemeinde Hilterfingen am Ende des Vikariates 500 Franken gespendet. Eine stolze Summe. Sie reichte ziemlich genau für den Kauf eines Talars, den ich allerdings nach einem Dutzend Jahren im Pfarramt nicht mehr benützte. Dieser Verzicht gab zu reden, vor allem bei älteren Gemeindegliedern. Im Kirchenblatt erschienen kontroverse Leserbriefe. Konservative beklagten den Verlust an Feierlichkeit. Mir selber war diese «Feierlichkeit» nicht ganz geheuer. Der jüngeren Generation war dieses textile Problem nicht so wichtig. Konfirmanden meinten, ich sei ihnen in diesem schwarzen Umhang sehr fremd. Und da war noch die Geschichte mit meiner Tochter Regine. Nach einer kirchlichen Trauung schritt ich mit wehendem Talar dem Pfarrhaus zu. Auf der Strasse wartete eine grosse Kinderschar auf das Hochzeitspaar. Sie hofften auf einen Regen von Bonbons und andern Süssigkeiten. Ich kam nicht ungeschoren an den Kindern vorbei. Aus der Schar löste sich das fünfjährige Regineli, umarmte mich, griff in die Falten des Talars, schüttelte den Stoff und rief lachend: «Der Vati het es Jupe!» Dann lupfte es den Stoff und rief «Minijupe! Minijupe!» Die Szene rief grosse Heiterkeit hervor. Jedenfalls landete der Talar ein paar Jahre später im Schrank, wo er noch heute hängt und ganz selten gebraucht wird, etwa von Theatergruppen.
Das Jahr 1959 war von mehreren wichtigen Ereignissen geprägt, im privaten wie im beruflichen Leben. Im Frühjahr feierte ich die Verlobung und im Herbst die Hochzeit mit Hildegard, die ich schon als Schülerin aus der Ferne verehrt und dann immer mehr kennen und lieben gelernt hatte. Im Herbst dann, wie schon erwähnt, der endgültige Studienabschluss, mit dem praktischen Staatsexamen. Sodann feierliche Akte wie die Aufnahme in den Kirchendienst durch den Regierungsrat und die Konsekration im Berner Münster. Damit erhielt ich den Titel eines VDM, Verbi Divini Minister, oder, übersetzt: Diener am göttlichen Wort. Schon während des Vikariates kreuzten aus verschiedenen Teilen des Kantons Delegationen von Kirchgemeinderäten auf, um für ihre Gemeinde einen Pfarrer zu angeln. Es herrschte damals Pfarrermangel, deshalb war man begehrt. Auch als Greenhorn brauchte man keine Bewerbung zu schreiben. Aus verschiedenen Gründen sagte ich der Delegation aus Erlach am Bielersee zu, wurde von der Kirchgemeindeversammlung prompt gewählt und ins Amt eingesetzt. Diese Zeremonie wird in der Berner Kirche bis heute «Installation» genannt. Eine merkwürdig unspirituelle Bezeichnung. Sie erinnert mich an das Tun eines Elektro- oder Sanitärinstallateurs, der irgendwo in finsterem Gemäuer eine Leitung «installiert». Jedenfalls wurde ich an die Kirchgemeinde Erlach «angeschlossen».
Nach zehn glücklichen Jahren in der Gemeinde am Bielersee erfolgte die Berufung nach Thun. Wiederum brauchte es kein Bewerbungsschreiben. Im Herbst 1969 wurde ich in der Stadtkirche Thun «installiert», und zwar durch Münsterpfarrer Walter Lüthi aus Bern, den ich sehr schätzte. Bis zu meiner Pensionierung kurz vor der Jahrtausendwende war Thun mein Arbeitsfeld. Besser gesagt: war hier mein Dienstort. Als VDM arbeitet man nicht, sondern man dient – oder etwa nicht?
Der Start in Erlach hatte es in sich – schon aus rein praktischen Gründen. Die Pfarrer hatten Residenzpflicht. Wir mussten das imposante Pfarrhaus beziehen und einigermassen wohnlich gestalten. Die auf Kredit gekauften Möbel wirkten in den Räumen wie verloren. Das grosse Zimmer neben der Küche mass gut 35 Quadratmeter. Als einmal der Berner Kollege Hans Schädelin zu Besuch war, blieb er auf der Schwelle stehen und befand, bei uns müsse man die Möbel ja mit dem Kompass anpeilen. Die Mehrzahl der 10 Räume im 1. und 2. Geschoss blieben in den ersten Jahren leer. Im Parterre befanden sich ein Zimmer und eine durch den Heizungskessel entfremdete ehemalige Küche. Dort hatte früher offenbar der Knecht oder Pächter des Pfarrers gewohnt. Von der Strasse her konnte man auch den mächtigen gewölbten Keller betreten - einstmals Weinkeller. Denn zum Pfarrhaus gehörte ein gutes Stück Pfrundland, eine Hofstatt mit vielen alten Obstbäumen, die der Sigrist gratis nutzen konnte, und ein Weinberg, den das Erziehungsheim Schloss Erlach bewirtschaftete. Sie zahlten jährlich einen bescheidenen Pachtzins, von dem ich allerdings etwa 60% als Liegenschaftssteuer abzuliefern hatte. Jahresgewinn: etwa 40 Franken. All dies waren Überbleibsel aus einer Zeit, da der Pfarrer einen Teil seines Lebensunterhaltes mit landwirtschaftlicher Arbeit verdienen musste. Zur Liegenschaft gehörte auch eine Scheune, wo der Sigrist seine Geräte untergebracht hatte. Zudem gruppierten sich um den malerischen Hinterhof mit einem schönen Brunnen und einer mächtigen Linde ein Ofenhaus und, als Anbau ans Pfarrhaus, ein ehemaliges Trüel. Von der Weinpresse war allerdings nichts mehr übriggeblieben – nur eine runde Vertiefung im Boden. Das grösste Problem war für mich der riesige Garten. Der Rasen war noch zu bewältigen. Aber die zahlreichen Gartenbeete, die mein Vorgänger als passionierter Gärtner offenbar fleissig genutzt hatte – das war einfach zu viel. Das war ein Alptraum. Ich hatte weder Zeit noch Lust, eine derartige Plantage zu pflegen. Zum grossen Glück ergab sich dann eine Lösung. Sie trug einen Namen: Fracheboud. Mit zahlreichen andern Jurassiern war der kleine Mann mit den dichten Silberborsten auf dem Kopf vor Jahrzehnten nach Erlach gekommen, weil hier eine Uhrenstein-Fabrik ihre Tore öffnete. Der Volksmund gab ihr den Namen ‘Steibohri’. Die Uhrensteine mussten in mehreren Arbeitsgängen bearbeitet werden. Dazu gehörten das Schleifen, das Bohren und das Grandissieren. Der Grandisseur zog durch das Bohrloch der winzigen Steine einen Draht, den er mit einer Tretmaschine hin- und her bewegte, bis das Bohrloch die auf Bruchteile eines Millimeters genaue Grösse aufwies. Später musste die Fabrik ihre Tore schliessen. Neue Technologien hatten den Uhrenstein mehr oder weniger überflüssig gemacht. Fracheboud und einige Kollegen blieben. Mit Gelegenheitsarbeiten schlug er sich durch. Darum kam ihm der Pfarrgarten gelegen. Wir haben nie einen Vertrag unterzeichnet und er hat nie Zins bezahlt, höchstens etwa einen Salatkopf abgeliefert. Den Raum des ehemaligen Trüels und das dazugehörige Plumpsklo nahm er für sich in Beschlag. Mit dem vielen Unkraut im Garten fand er sich ab. «C’est quand même de la verdure», tröstete er sich und mich. (Während der vielen Jahre in Erlach hatte er nie Deutsch gelernt). In Erlach wurden unsere zwei älteren Kinder geboren, Thomas und Regine. Wenn sie im Hinterhof spielten, war das für Fracheboud eine grosse Freude. Er kauderwelschte mit ihnen oder brachte ihnen Spielzeuge. Seine Fundgrube war der Erlacher Abfallplatz, den er regelmässig aufsuchte und mit einer nicht immer appetitlichen Beute verliess. Den Kindern zur Freude, nicht aber den Eltern.
Mir gefiel die gesellschaftliche Durchmischung der Gemeinde. Mitten im Städtchen betrieben mehrere Bauern ihre Wirtschaft. Im Sommer rasselten Heu- und Garbenfuder durch die Gassen. Zwei Fabriken boten der Arbeiterschaft zahlreiche Arbeitsplätze. Beamte des Amthauses, Angestellte des Erziehungsheims, Künstler, Lehrer, Pensionierte, Ladenbesitzer, Handwerker, Pendler und fünf Wirtschaften mit ihrem Personal belebten das Städtchen. Im Sommer verdoppelte sich die Bevölkerung. Auf den Campingplätzen in und um Erlach tummelten sich Touristen aus der ganzen Schweiz.
Noch vor meinem Amtsantritt kam ich ins Gespräch mit einem erfahrenen Kollegen. Ich erzählte ihm, nicht ohne leisen Stolz, von meiner Wahl nach Erlach. Da schaute er mich mit grossen Augen an und fragte: «Was, du willst in das gottlose Seeland?» Zwar hatte ich auch schon gehört, dass die Seeländer ein besonderes Völklein seien und der Kirchenbesuch zu wünschen übrig lasse. Doch schien es mir nicht richtig, eine ganze Bevölkerung als gottlos zu diffamieren. Allerdings gehörten auffällig viele Zugezogene zum Kreis der Interessierten. Zu ihnen zählten die Ehepaare Leuenberger, Stark und Walther. Mit ihnen pflegten wir auch persönlichen Kontakt. Hans Stark und seine Frau Helen kamen erst ein halbes Jahr nach uns nach Erlach. Mit ihnen verband uns eine besondere Freundschaft. Auch nachdem Hans vom Lehrer- zum Journalistenberuf gewechselt hatte und als Redaktor in Langenthal, in Basel und schliesslich in Bern wirkte, zuletzt in der Chefetage der Zeitung "Der Bund", änderte dies an unserer Verbundenheit nichts. Viele Gespräche und gemeinsame Unternehmungenbleiben in Erinnerung, insbesondere auch die umwerfend lustigen Silvesterabende in unserem Ferienhaus im Diemtigtal. Ich stellte mir immer vor, nach unserer Pensionierung würden wir uns zu Viert eine gemeinsame Reise kreuz und quer durch die USA leisten. Der Tod von Hans - nach einer schlimmen Krebserkrankung - und das schmerzliche Aus meiner Ehe mit Hildegard machten diese Pläne zunichte.
Die Erlacher wussten das Leben zu geniessen. Herausragende Feste waren der Paulitag und das Winzerfest (Läsetsonntag). Letzteres wurde mit einem Umzug gefeiert und zog immer viel Publikum an. Am Paulitag (Pauli Bekehrung, am 25. Januar) kamen die Erlachburger aus der ganzen Schweiz zusammen, wobei sie eher des Bacchus als des Apostels Paulus gedachten. Gerade unter den Burgern beobachtete ich eine eigenartige Betonung des Namens. Der Vorname, immer auf der ersten Silbe betont und immer in der Verkleinerungsform, wurde zuerst genannt. Zum Beispiel: Noldi Scholl, Fritzi Kislig, Gritli Gammeter, Pauli Forster, Werni Küenzi und so fort. Das verlieh den Gesprächen manchmal einen geradezu zärtlichen Unterton. Es stellte sich für mich bald einmal heraus: Man konnte mit den Leuten reden. Nicht über die Themen, die wir an der Uni diskutiert hatten, aber über ihren Alltag, über ihre Sorgen und selbstverständlich ihre Freuden.
Mit den Jungen hatte ich es gut. Ich gründete eine Jugendgruppe. Wir trafen uns jede Woche, diskutierten, spielten, lachten. Ab und zu luden wir Gäste ein, etwa einen mir bekannten Kapuziner aus Freiburg. Er erzählte von den Tätigkeiten seiner Ordensbrüder, zum Beispiel von den Malefizpriestern, die böse Geister zu bannen wussten. Etwa mit dem Malefizwachs, dessen Wirkung erstaunlich sei. Wenn man es beispielsweise oberhalb der Stalltüre anbringe, werde der böse Geist gebannt. Fehlgeburten und Krankheiten beim lieben Vieh kämen dank dieses Wundermittels nicht mehr vor. Das wollte den Jungen gar nicht einleuchten. Da sagte der Pater, schelmisch lächelnd: «Zu den besten Kunden des Freiburger Kapuzinerklosters zählen die Bauern aus dem Schwarzenburgerland. Und die sind bekanntlich protestantisch».
Jedes Jahr unternahmen wir eine Bergwanderung. Einer der Höhepunkte war ein Kabarettabend im grossen Weinkeller des Pfarrhauses, den wir zum Theaterlokal umbauten. Die Texte und Lieder hatten wir selber kreiert und präsentierten sie mit entsprechendem Vergnügen. In der Jugendarbeit wurde ich besonders von einem jungen Lehrer unterstützt, Max Huber. Er unterrichtete an der Oberstufe des Schulheims Erlach. Einmal stand ein Grillabend auf dem Programm. Da ich abwesend war, organisierte Max den Grillplausch. Er fand auf dem Jolimont statt und verlief offenbar so lustig, dass man die Zeit vergass. Erst deutlich nach zehn Uhr, dem normalen Schluss der JK-Abende, wanderte die Gruppe heimwärts. Da fuhr ihnen ein Auto entgegen, dem der zornige Vater eines JK-Mädchens entstieg. Er regte sich fürchterlich auf und deckte die Gruppe mit einem Donnerwetter ein. Zwar war ich als Abwesender völlig unschuldig. Aber der besagte Vater, gleichzeitig Kirchgemeinderat, war trotzdem über den Pfarrer wütend. Er schleppte seinen Zorn noch viele Jahre mit sich herum, wie ich später erfuhr. Er hat mit mir nie darüber geredet! Als ich in Magliaso im Tessin ein schweizerisches JK-Lager leitete, begleitete mich Max als Co-Leiter. Die Jugendlichen, insbesondere die Mädchen, fanden ihn ganz toll. Wir verloren uns dann etwas aus den Augen. Doch anfangs der neunziger Jahre, als wir uns gleichzeitig in einer Lebenskrise befanden, suchte er mich auf. Ein Resultat des langen Gesprächs war der Entschluss, eine Wanderwoche in Frankreich zu unternehmen. Gesagt getan. Die wunderbare Landschaft, die vorzügliche Gastronomie und natürlich die ausgiebigen Gespräche wirkten therapeutisch und festigten den Plan, diese Wanderwoche zu wiederholen. Inzwischen feierten wir bereits das 25jährige Jubiläum. Wenns die Gesundheit zulässt, wollen wir es nochmals versuchen.
Etwas anders gestaltete sich die Begegnung mit den älteren Gemeindegliedern. In den letzten fünfzig oder mehr Jahren war nie ein Pfarrer gewählt worden, der eben erst das Studium vollendet hatte. Immer waren die Pfarrherren würdige Personen gewesen, mehr oder weniger geachtet. Von Pfarrer K, der um 1920 in Erlach gewirkt hatte, wussten die Leute besonders viele Müsterchen zu erzählen. Er habe die Wirtschaften sehr fleissig frequentiert, habe politisiert und sei sogar in den Nationalrat gewählt worden. An einem Samstagabend habe er mit seinen Kumpanen besonders ausgiebig gezecht. Als er sich verabschieden wollte, kam es zu einer Wette. Ob der Pfarrer sich eine Predigt zutraue, wenn man ihm den Predigttext erst in der Kirche mitteile? Er ging die Wette ein. Als er am Sonntagmorgen die Kanzel bestieg, lag ein Zettel auf dem Kanzelbrett – beidseitig leer. Da habe der Pfarrherr den Zettel hochgehoben, beide leeren Seiten präsentiert und der Gemeinde zugerufen: «Hier ist nichts und da ist nichts, und aus nichts hat Gott die Welt erschaffen». Ich habe diese Geschichte häufig zu hören bekommen. Sie endete immer mit der Feststellung: «Und er hat eine wunderbare Predigt gehalten!» Viele Jahre später erzählten mir Kollegen aus verschiedenen Teilen der Schweiz, dass genau die gleiche Anekdote auch von andern kauzigen Pfarrern erzählt werde. Selbst der Schlusssatz, das mit der «wunderbaren Predigt», sei gleichlautend.
Mit der Würde des Alters konnte ich natürlich nicht punkten. Ich erinnere mich an einen Besuch bei einer alten Dame, die mich freundlich in ihr Stübchen einlud, aber dann alle paar Minuten die Hände zusammenschlug und ausrief: «Eh sit dier e junge Herr Pfaaarer!» Dafür konnte ich freilich nichts, und mit der Zeit erwiderte ich auf derartige Feststellungen, diese Schwäche bessere sich mit jedem Jahr. Wichtig schien mir zudem die Einsicht, dass in der Seelsorge das Zuhören weit wichtiger sei als das noch so gut gemeinte Reden. Aufmerksam zuhören kann auch ein junger Mensch. So vergingen die Jahre und ich durfte erleben, dass viele dieser angeblich gottlosen Seeländer dem Pfarrer Vertrauen entgegenbrachten. Und zu meinem Erstaunen klopften auch wichtige Persönlichkeiten an die Pfarrhaustür, um über ihre persönlichen Probleme zu sprechen. Das erforderte einige Überwindung. Das Pfarrhaus stand nämlich in einer Häuserreihe und die lieben Nachbarn gegenüber registrierten aufmerksam, wer da ein- und ausging. Einmal wollte mich ein Kollege aus Deutschland besuchen. Er läutete und läutete, aber es half alles nichts. Bei uns war niemand zu Hause. Da öffnete sich gegenüber ein Fenster und eine Frau meldete freundlich, aber bestimmt: «Sie sind vor anderthalb Stunden weggefahren und noch nicht zurückgekehrt». Dieses Überwachungssystem war natürlich bekannt und darum meldeten sich meine «Klienten» oftmals erst nach Eintritt der Dunkelheit. Wie oft wünschte ich mir doch ein Büro in der Stadt, mit anonymem Zugang, wo zahlreiche Menschen ein- und ausgingen und sich niemand um ihre Identität kümmerte!
In Thun, auf dem Schlossberg, lag das Pfarrhaus günstiger. Kaum jemand achtete sich der Besucher, die durch das Gartentor traten, hinter dem ausladenden Fliederbusch verschwanden und, geschützt vor neugierigen Blicken, vor der Haustür standen.
(1) Schlossberg Thun, Pfarrhaus

"Brüder der Landstrasse"
Es wäre überaus spannend, eine Geschichte der Obdachlosigkeit zu schreiben.
Im Mittelalter zogen zahlreiche Bettler durchs Land. Betteln war durchaus nicht unehrenhaft. Arme waren nach kirchlicher Lehre dem Himmel näher. Zudem gaben sie den Reichen Gelegenheit, Gutes zu tun und sich den Himmel zu verdienen. Eine Win-win-Situation! Nach der Reformation – vor allem nach dem Dreissigjährigen Krieg – kam es in Europa zu einer schlimmen Massen-Obdachlosigkeit. Die Armen wurden zur Landplage, auch in der Schweiz. Die Obrigkeit schickte regelmässig Landjäger und Soldaten aus, um das Land und vor allem die Wälder zu durchkämmen. Wer konnte, floh über die Grenze in den nächsten Kanton, und kehrte zurück, sobald sich die Lage beruhigt hatte. Wer erwischt wurde, erfuhr eine strenge Strafe. Viele wurden hingerichtet. Im Städtchen Bremgarten zum Beispiel vollstreckten die Behörden in einem einzigen Jahr 200 Todesurteile. Tausenden wurden die Ohren geschlitzt oder ein Bettlerabzeichen in die Haut gebrannt. Abertausende wurden auf die Galeeren geschickt, vor allem nach Spanien und Venedig. Trotzdem wurde es im 18. Jahrhundert immer ärger. Verzweifelte und Verrohte organisierten sich zu Mörderbanden, beispielsweise im Grauholz bei Bern. Nach wiederholten Überfällen und Bluttaten wurden im Jahr 1718 nicht weniger als 11 Bettlerjagden veranstaltet. Erst 1819 unterzeichneten die meisten Kantone ein Konkordat. Ein Schiedsgericht solle von Fall zu Fall entscheiden, welchem Kanton die aufgegriffenen Heimatlosen zuzuteilen seien. 1850 trat das Heimatlosengesetz in Kraft. Aber viele Probleme blieben. Die Gemeinden versuchten, ihre verarmten Bürger abzuschieben. Das aufkommende merkantilistische Wirtschaftssystem schuf zudem neue Tugenden: Nützlichkeit, Erfolg, Gewinn. Arbeits- und Heimatlosigkeit stellen deshalb einen schweren moralischen Makel dar. Obdachlose galten als asozial. Man schickte sie zwar nicht mehr auf die Galeeren, dafür aber in die Zuchthäuser. Dort sollten sie unter Zwang umerzogen werden. In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gründeten teils staatliche und teils private Trägerschaften Heime, wo entlassene Strafgefangene, Arbeitslose und Randständige aufgenommen wurden. So die die Arbeiterkolonie Herdern im Thurgau oder der Tannenhof im bernischen Gampelen. Für die Kirchen wegweisend war Friedrich von Bodelschwingh, der Gründer der Sozialwerke in Bethel bei Bielefeld. 1882 entstand die Arbeitskolonie in Wilhelmsdorf, später «Hoffnungstal» bei Berlin. Die Grundgedanken waren: Arbeit statt Almosen. Arbeit schafft Menschenwürde. Resozialisation statt Strafe und Ausgrenzung. Auf Bodelschwingh geht die Bezeichnung «Brüder der Landstrasse» zurück. Ein entscheidender Paradigmenwechsel, der die neuzeitliche Politik und den Sozialstaat mitprägte. In der Schweiz ist das Bild allerdings sehr getrübt durch den Verdingkinderskandal, der erst in jüngster Zeit aufgearbeitet wird.
Weder staatliche noch private Organisationen, weder Gesetze noch neue sozialethische Denkansätze vermögen alle Probleme zu lösen. Es wird immer Nichtsesshafte geben, Vagabunden, Ruhelose, Randständige, Heimatlose, Unangepasste. Je nach Standpunkt gelten sie als Asoziale oder als Brüder der Landstrasse oder als beides.
Mit dieser Tatsache wurde ich in all den Jahren meiner Berufstätigkeit konfrontiert. Beide Pfarrhäuser, die ich bewohnte, befanden sich nahe bei der Kirche. Der Kirchturm zeigt den Brüdern der Landstrasse schon aus der Ferne die Richtung an. Dorthin wenden sie sich, zur Kirche. Im benachbarten Pfarrhaus melden sie sich lieber als am Schalter irgendeiner Amtsstelle.
Erste Erfahrungen hatte ich während des Vikariats gemacht. Man behalf sich meistens mit Almosen aus der Armenkasse. Es war ja schlichtweg unmöglich, die Erzählungen unter der Haustür auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen oder gar dauerhafte Problemlösungen anzubieten. Es wurden oft Lügengeschichten aufgetischt. Trotzdem fragte man sich: sagt er vielleicht doch die Wahrheit? Oder stimmt immerhin die Hälfte seiner Geschichte? Unter den Bettlern mochte es ja nicht nur kleine oder raffinierte Betrüger geben, sondern auch Leute, die vom Schicksal gebeutelt worden waren oder tatsächlich das Portemonnaie verloren hatten. Diese Möglichkeit wollte ich nicht von der Hand weisen. Von J.Ch. Blumhardt (1805-1880), einem weitherum bekannten pietistischen Pfarrer im Würtembergischen wird erzählt, er habe an jedem Mittagstisch ein zusätzliches Gedeck auftragen lassen. Dies für den Fall, dass irgendeinmal der Herr Jesus anklopfte und man ihn gleich zu Tisch bitten könnte. In ähnlicher Richtung weist auch Leo Tolstois Legende vom Schuster Martin. Natürlich lehrte die Erfahrung, dass die meisten Geschichten, die man unter der Tür zu hören bekam, erfunden und zudem recht simpel und banal waren. Sehr oft drehten sie sich um das leidige Portemonnaie. Leider, leider hatte man es verloren oder irgendwo vergessen. Man hatte einem Kumpel gutmütigerweise Geld geliehen, es aber nicht zurückbekommen. Oft beklagte man sich, seit zwei Tagen nichts gegessen zu haben. Zweifel waren angebracht. Und doch war immer wieder die Frage gegenwärtig: wie, wenn der Mensch vor der Tür doch die Wahrheit sagt? Es könnte ja sein.
Zuweilen luden wir die «Brüder» zum Mittagstisch ein. Manchmal packte ich für sie einen Beutel mit Brot, Käse, Obst etc. Und dann stellte sich heraus, dass der Hunger nicht so schrecklich gewesen sein musste – die angeblichen Hungerleider hatten nämlich den Verpflegungsbeutel auf dem Mäuerchen beim Garteneingang «vergessen».
Eines Sonntags klingelte ein junger Mann und erzählte, seine Mutter im Tessin sei ganz schwer erkrankt. Er sei mit seinem Töff unterwegs, um sie zu besuchen. Leider aber sei der Tank seines Töffs fast leer. Ebenso leer sei der Geldbeutel, und die Banken seien am Sonntag geschlossen. Bancomaten waren damals noch unbekannt. Ich bot ihm an, die Tankfüllung zu berappen, und begleitete ihn zur Tankstelle. Das Auffüllen dauerte nur kurz. Mehr als ein Viertelliter hatte nicht Platz gefunden. Ich bezahlte gemäss meinem Versprechen – es waren etwa 30 Rappen. Der junge Mann setzte sich wortlos auf seine Maschine und brauste davon.
Ein gutgekleideter Herr (Hemd, Kravatte, ohne Jacke) berichtete, er habe auf der Autobahnraststätte die Toilette aufgesucht. Nach seiner Rückkehr habe er feststellen müssen, dass jemand seinen Mercedes mitsamt Jacke und Brieftasche gestohlen habe. Ein netter Automobilist habe ihn hierhergebracht, was ihm natürlich furchtbar peinlich sei, und so weiter. Da fühlte ich mich nun wirklich nicht zuständig. Ich schickte ihn zur Polizei.
Dumm gelaufen war es auch für den jungen Deutschen, der per Bahn von Frankfurt nach Basel habe reisen wollen. Leider sei er eingeschlafen. Erst kurz vor Thun habe ihn der Kondukteur geweckt und ihm noch eine zünftige Busse aufgebrummt. Jetzt sei er natürlich pleite.
Einem Burschen, der sich als Jürg vorstellte und ziemlich frech auftrat, verweigerte ich die Unterstützung. Wütend trollte er sich davon, nicht ohne im Vorbeigang eine Geranienstaude ausgerissen und auf den Gartenweg geschmissen zu haben – was ich erst am Abend bemerkte. Am darauffolgenden Wochenende sass ich mit einem Besuch im Wohnzimmer. Als ich in der Küche etwas holen wollte, traf ich dort besagten Jürg. Entschuldigung, er habe nur Wasser trinken wollen, brummelte er, und war schon an der Haustür. Es gelang mir noch, ihm die Blumenschändung unter die Nase zu reiben. Wieder entschuldigte er sich hastig und verschwand. Meine Besucherin, welche die Handtasche im Korridor hatte stehen lassen, reagierte schnell. Der Geldbeutel war noch vorhanden, nicht aber das Notengeld. Da machte ich mich an die Verfolgung. In Pantoffeln trabte ich hinter dem Schelm her. Mir entgegen strömten festlich gekleidete Konzertbesucher, die der Kirche zustrebten. Sie werden sich wohl über den Pfarrer gewundert haben, der in Pantoffeln herumrannte und kaum Zeit hatte zu grüssen. Jürg war inzwischen auch im Laufschritt unterwegs. Bevor ich ihn einholte, stieg er auf ein Kleinmotorrad und ratterte davon. Ich erstattete Anzeige bei der Polizei und konnte den Fahndern immerhin den Vornamen des Übeltäters nennen. Einige Wochen später erhielt ich die Information, Jürg sei gefasst worden. Er habe zahlreiche andere Einschleichdiebstähle gestanden, davon mehrere in Pfarrhäusern.
Einem anderen, geradezu begnadeten Schauspieler sind auch einige andere Kollegen auf den Leim gegangen. Mit geröteten Augen erschien er an der Haustür. Ich hiess ihn eintreten. Er lehnte sich schluchzend an die Wand und erzählte, seine Braut (Margritli, Adresse in einem Aussenquartier) sei gestorben, heute Morgen, völlig unerwartet. Er könne es einfach nicht fassen. In einem Monat hätten sie heiraten wollen, alles sei vorbereitet gewesen. Dann wieder ein langes, herzzerbrechendes Schluchzen mit beeindruckenden Tränenströmen. Immer wieder verschlug es ihm die Sprache. Wer da nicht Mitleid hatte und nebst dem Herzen auch die Hand öffnete, musste ein ausgekochter Rüpel sein. Anlässlich einer Pfarrerzusammenkunft ein paar Monate später kam heraus, dass sich haargenau die gleiche Geschichte in mehreren Pfarrhäusern abgespielt hatte. Und alle beteuerten, sie und ihre Frauen seien von dieser Schauspielkunst vollkommen beeindruckt gewesen. Vor Gericht versagte jedoch sein Talent, und die Braut war weder tot noch lebendig. Sie existierte gar nicht.
Weil oft der dringende Verdacht bestand, das erbetene Geld werde postwendend in Alkohol umgesetzt, hatte ich immer einige Migros-Gutscheine vorrätig. Damit konnten sich die Bittsteller Esswaren, aber keinen Alkohol erstehen. Bekanntlich verkauft die Migros keinen Schnaps. Diese Lösung war nicht immer zielführend. Es wurde versucht, die Gutscheine in Bargeld umzutauschen – ab und zu mit Erfolg, wie man mir erzählte.
Eher selten meldeten sich Pilger. Aber es gab sie, schon lange vor der Jakobsweg-Euphorie. Kreuz und quer durch Europa wanderten sie von Kraftort zu Kraftort. In Klöstern, Pfarrhäusern und billigen Herbergen baten sie um ein Nachtlager. In Thun entstanden im Lauf der Zeit Institutionen wie das Passantenheim der Heilsarmee oder die Notschlafstelle. Gegen Kostengutsprache konnte man die Übernächtler dort unterbringen.
Unter den vielen «Brüdern der Landstrasse», mit denen ich im Laufe der Jahre zu tun hatte, sind mir ihrer Drei besonders in Erinnerung geblieben.
Beim Ersten handelte es sich um einen Russen. Auf seinem abgegriffenen Ausweis liess sich der Name Sokolov entziffern. Sein Gepäck bestand aus einem Rucksack und einer kleinen Kiste, aus der eine struppige Katze hervorlugte. Sokolov gab sich sehr bescheiden, ja, geradezu demütig. Mit sehr leiser Stimme erbat er Unterkunft für sich und seine Katze. Natürlich interessierte mich seine Lebensgeschichte. Er gab von sich nur wenig preis. Immerhin so viel: Er sei vor Jahren illegal aus der Sowjetunion ausgewandert, via Mongolei und China. Irgendwie habe er es fertiggebracht, mittels eines Frachtschiffes, auf dem er wie ein Sklave geschuftet habe, nach Europa zu gelangen. Über seine Zukunftspläne liess er nichts verlauten. Vor dem Abendessen begab er sich mit seiner Katzenkiste in den Garten und gewährte dem Tier eine Viertelstunde Auslauf. Dann packte er die Katze wieder in die Kiste und platzierte diese neben sich, auf der Bank hinter dem Küchentisch. Die Kinder und auch wir Erwachsenen wunderten uns über sein Essverhalten. Er senkte sein Haupt tief über den Teller. Währenddem er mit der rechten Hand den Teller leerschaufelte, hielt er die Linke vor seinen Mund, als ob er vor uns etwas ganz Hässliches zu verbergen hätte. Ein wahrhaft seltsames Schauspiel, das die Kinder enorm beschäftigte. Noch Wochen später kamen sie immer wieder auf den komischen Besuch zu reden. Man konnte über sein Verhalten nur rätseln. War das eine Zeichen übermässiger Bescheidenheit oder gar der Demut? Oder ein Tick, den er sich während Jahren in sibirischer Lagerhaft angeeignet hatte? Am nächsten Tag, beim Morgenessen, bot Sokolov wieder das gleiche Bild. Und wieder konnten die Kinder ihre Blicke kaum von dem eigenartigen Gast lösen. Nach dem Morgenessen machte er keine Anstalten, sich zu verabschieden und weiterzuziehen. Und plötzlich kam eine ganz andere Seite seines Wesens zum Vorschein. Er stellte Forderungen. Zum Beispiel wollte er einen weiteren Tag unser Gastrecht geniessen. Als ich es ablehnte, wurde er zornig. Und der Zorn verwandelte sich in Arroganz. Er verlangte, das Telefon benützen zu können. Wen er denn anrufen wolle? Er habe einen Bekannten in Griechenland. Also gut, lassen wir ihn. Dafür wird er vielleicht umso eher weiterziehen. Das Telefongespräch nach Griechenland zog sich reichlich in die Länge. Als er geendet hatte, wählte er sofort eine neue Nummer – natürlich ohne zu fragen. Ich erinnere mich nicht mehr, wie es gelang, Gospodin Sokolov mitsamt Katze zum Weggehen zu bewegen.
Interessanterweise habe ich Jahre später einen russischen Studenten (Theologie!) beherbergt, der verblüffend ähnliche Charakterzüge offenbarte: anfänglich überaus freundlich, sogar schmeichlerisch. Dann erfolgte plötzlich ein totaler Wetterwechsel. Ein Beispiel gefällig? Weil er unbedingt den griechisch-orthodoxen Vertreter beim Oekumenischen Rat der Kirchen treffen wollte, fuhr ich mit ihm nach Genf. Vladika (so der Ehrentitel des Erzbischofs) empfing uns freundlich und lud uns zum Essen ein. Er führte kurze Einzelgespräche mit dem jungen Russen, dann auch mit mir. Offensichtlich hatte er den russischen Gast rasch durchschaut und ging nicht auf dessen ziemlich unbescheidene Wünsche ein. Bei der Verabschiedung liess er ihm durch seinen Sekretär ein Kuvert überreichen. Beim Auto angelangt, riss der Bursche den Umschlag auf. «Was, nur hundert Franken!», empörte er sich. Beinahe im Laufschritt begab er sich zurück zur gediegenen Residenz von Vladika, um sich über die Schäbigkeit der Spende zu beschweren. Der Pförtner wies ihn ab. Während der Heimfahrt konnte er sich fast nicht erholen und schimpfte unentwegt über die Hartherzigkeit des Würdenträgers, den er eine Stunde zuvor noch umschmeichelt hatte.
Oft, wenn ich an die beiden Begegnungen zurückdenke, stelle ich mir die Frage: Sind die beiden Russen – zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Umständen - kaputtgemacht worden durch Erfahrungen von Unterdrückung, Gewalt und Erniedrigung? Haben sie gelernt, sich in den schlimmsten Momenten dadurch zu schützen, dass sie sich ganz klein machten, möglichst unauffällig und demütig? So wie Hunde, die durch demütiges Ducken das Schimpfen des Meisters zu mildern versuchen? Und hatten sie sich die Taktik angeeignet, bei günstigen Konstellationen das Haupt zu recken und durch Arroganz Vorteile zu erwirken? Waren sie also beide Opfer verschiedener Formen von Unterdrückung geworden? Verformt durch ein Leben in der Diktatur?
Ich weiss nicht, ob diese Deutung zutrifft. Aber es könnte sein…
Ganz anderer Art war der Zweite im Bund – ein kleines, mageres Männchen, nicht nur bescheiden, sondern geradezu scheu. Als er zum ersten Mal vor der Türe stand und um ein Nachtlager bat, musste man gut hinhören. Er sprach ganz leise, in hoher, fast weiblicher Stimmlage. Wahrscheinlich hatte er schon bei meinem Vorgänger Unterschlupf gefunden und wollte mit dieser «Tradition» fortfahren. Er war nämlich so etwas wie ein Quartals-Tippelbruder, wie es ja auch Quartals-Säufer gibt. Von sich aus redete er selten. Darum erfuhren wir erst im Laufe der Jahre und nur bruchstückhaft etwas über seine Biografie. Wahrscheinlich war er Verdingbub gewesen und hatte als Erwachsener bei einem Gärtner im Emmental eine Stelle gefunden, wohl als Hilfsarbeiter. Er scheint es dort nicht allzu schlecht gehabt zu haben. Aber von Zeit zu Zeit, alle paar Monate, packte ihn die Wanderlust und er zog kreuz und quer durchs Land. Wie sein Meister diese kleinen Fluchten aufgenommen hat, blieb uns verborgen. Irgendeinmal verriet er uns auch seinen Namen: Pons, was nicht grad nach Emmental klang. Pons hatte einige fixe Stationen, wo er nächtigen und sich ein wenig auffuttern konnte. Bei seinem ersten Besuch rüsteten wir ihm ein Bett in einem leeren Zimmer. In der Folge verzichteten wir auf dieses Angebot. Er hatte nämlich die Bettwäsche in einem ziemlich unsauberen Zustand hinterlassen. Ebenso unangenehm war der Geruch, der noch mehrere Tage im Zimmer nachklang. Trotzdem hatte man Mitleid mir diesem ungewaschenen, verschupften Menschen. Auf wen wenn nicht auf ihn traf die Bezeichnung «Bruder der Landstrasse» zu? Bei seinem nächsten Besuch schleppten wir eine alte Matratze und eine ebenso alte Decke in einen Abstellraum. Pons hatte nichts gegen den neuen Lagerplatz. Wir hatten sogar den Eindruck, er fühle sich dort wohler als in einem Zimmer mit Teppich, Vorhängen und Nachttischlampe. Jedenfalls schleppte er gelegentlich einen Wandergenossen daher und teilte mit ihm das bescheidene Lager und auch das bescheidene Frühstück. Während vielen Jahren stattete er uns seine Besuche ab. Fast könnte man sagen, wir hätten uns aneinander gewöhnt. Auch für die Kinder wurde er nicht gerade zu einer vertrauten, aber doch zu einer durchaus geduldeten Figur. Plötzlich hörten seine Besuche auf. Wir hatten keine Ahnung, ob er gestorben oder in einem Heim untergebracht worden war. Wir kannten auch die Adresse seines Arbeitgebers oder seines Vormundes nicht. Er hatte nie darüber gesprochen. Mochte er in dieser oder in einer anderen Welt seine Ruhe gefunden haben!
Der Dritte im Bund war von ganz anderer Art. Eines Abends, bei Einbruch der Dämmerung, als meine Frau mit den Kindern allein zu Hause war, stand vor der Tür eine beeindruckende, ja furchterregende Hünengestalt. Sogleich gestand der Mann, dass ihm die Nähe des Polizeipostens, gegenüber dem Pfarrhaus, gar nicht gefalle. Er habe seinen Seesack im Gebüsch versteckt. Meine Frau liess ihn eintreten und bewirtete ihn mit einigen Spiegeleiern. Halb furchtsam halb neugierig bestaunten die Kinder den Gast. Noch Jahre später vermochten sie das Bild, das er bot, zu beschreiben. Selbst hinter dem Tisch sitzend sei die imposante, wohl fast zwei Meter grosse Statur zur Geltung gekommen. Aus dem Gesicht hätten zwei knallblaue listige Äuglein geguckt. Mit Heisshunger habe er die Spiegeleier verschlungen. Dabei habe er seinen Bart mit Eigelb bekleckert und zwischenhinein allerlei amüsante Geschichten erzählt. Die Kinder waren fasziniert. Sie freuten sich immer, wenn er in den folgenden Jahren wieder auftauchte und von neuen Abenteuern berichtete.
Als ich an jenem Abend nach Hause kam, hatte er seinen recht umfangreichen Bauch vollgeschlungen und begann, freimütig über sein Leben und seine Ansichten zu erzählen. Er präsentierte eine Taschenbibel. Die sei sehr nützlich, insbesondere dann, wenn er erstmals bei einem Pfarrhaus anklopfe: ein richtiger Türöffner sei dieses Buch. Selbstverständlich kannte er einige Kapitel, etwa die Bergpredigt und die Stellen, die von der Gastfreundschaft handelten. Deren gibt es in der Bibel viele. In den Jahren nach dem Krieg war er in der grossen Völkerwanderung aus dem Osten in den Westen gespült worden. Einen festen Wohnsitz hatte er nicht, auch keinen Ausweis. Als Staatenloser pilgerte er kreuz und quer durch Europa. Sein Name: Galetzki. Das unstete Leben behagte ihm. Er fühlte sich frei, arbeitete nur, wenn er dringend Geld brauchte. Sein grösstes Vergnügen sei, an einem schönen Sommertag irgendwo unter einem Baum zu sitzen, den Bauern ringsum beim Arbeiten zuzusehen, und ein interessantes Buch zu lesen. Galetzki war ein belesener Mann. Zufällig entdeckten wir später einmal einen gemeinsamen Lieblingsschriftsteller, den Amerikaner John dos Passos. Die gemeinsame Hochschätzung eines Literaten, den hierzulande nicht viele Leute kennen, war schon etwas Besonderes. Ich beklagte, dass wohl der bedeutendste Roman von Dos Passos, nämlich «Manhattan Transfer», vergriffen sei. Ein paar Monate später brachte der Postbote ein Päckchen ohne Absender. Sein Inhalt: eine Taschenbuchausgabe von Manhattan Transfer. Galetzki hatte den Band in einem Antiquariat irgendwo in Deutschland aufgestöbert und mir zugeschickt. Auf der ersten Seite hatte er mit seiner krakeligen Schrift eine Widmung geschrieben. Viele Grüsse, Galetzki.
Sein Zigeunerleben wies immerhin ein paar Regelmässigkeiten auf. Im Winter lebte er einige Monate auf Sylt, in einem Ferienhaus von Bekannten, die nur den Sommer dort verbrachten und froh waren, wenn jemand zu ihrem Haus schaute. Den Herbst verbrachte er gern in Südfrankreich, als Saisonarbeiter in der Weinlese. Im Sommer klopfte er halb Europa ab. Überall hatte er seine Stützpunkte. Zum Beispiel in einem weiteren Pfarrhaus in der Ostschweiz oder bei einer Ärztin in Basel. Meistens war er mit Fernfahrern unterwegs. Viele Chauffeure hatte er im Laufe der Jahre kennen gelernt. Sie liessen ihn gerne mitfahren, denn er war ein ausgezeichneter Erzähler und ein lustiger Geselle. Als wir nach Thun umzogen, fragten wir uns, ob er uns auch am neuen Wohnort finde. Wie konnten wir nur zweifeln? Schon nach ein paar Monaten tauchte er auf dem Schlossberg auf und übernachtete weiterhin etwa zweimal im Jahr bei uns. Hie und da kam es vor, dass er länger bleiben wollte. Er machte es sich bequem, stöberte in meinen Büchern, liess sich bedienen und schaute gerne zu, wie wir Andern unseren Pflichten nachgingen. Wenn es mir zu bunt wurde, drückte ich ihm eine Schaufel oder einen Spaten in die Hand und hiess ihn, ein Stück des Gartens umzugraben. Das gefiel ihm gar nicht. Nach kurzer Zeit stellte er das Werkzeug in eine Ecke und gab vor, in allernächster Zeit einen Termin zu haben, den er nicht verpassen dürfe, und verabschiedete sich eilig. Beim nächsten Besuch war alles vergessen. Es fiel einem schwer, ihm böse zu sein. Zu offenherzig war er und zu ehrlich, dieser kindliche Opportunist und Lebenskünstler.
Manchmal diskutierte ich mit ihm über seine Zukunftspläne. Er hatte ja weder in Deutschland (wohl seinem Stammland) noch in der Schweiz irgendeine Kranken- oder Lebensversicherung. Von Altersvorsorge war ohnehin keine Rede. Seine Argumente: Er kenne so viele gutherzige Menschen, die ihm helfen würden. Und wenn alle Stricke rissen, müsse der Staat auch einen Staatenlosen unterstützen. Ob er gegenüber der arbeitenden Bevölkerung kein schlechtes Gewissen habe? Überhaupt nicht, meinte er. Anders als die normalen Bürger verzichte er auf zahlreiche Annehmlichkeiten des Lebens. Darum sei er mit den braven Normalbürgern quitt, fand er.
Dann kam eine Zeit, in der man nichts mehr von Galetzki hörte. Als er nach etwa anderthalb Jahren plötzlich wieder auftauchte, war er fast nicht mehr zu erkennen. Nicht nur, weil er den Bart abrasiert hatte. Das Gesicht war aufgedunsen, die Körperfülle geschwunden. Die blauen Äuglein hatten ihren Glanz verloren. Er war ernstlich erkrankt. In Ungarn habe es angefangen, als er einige Tage bei Bekannten am Balaton-See verbrachte. Er habe sich miserabel gefühlt und darum die Rückreise nach Deutschland angetreten. Unterwegs sei es immer schlimmer geworden. Der Fernfahrer habe ihn auf der ersten Autobahn-Raststätte in Deutschland ausgeladen und sei einfach weitergefahren. Die alarmierte Ambulanz habe ihn ins nächste Spital verfrachtet und dort sei er wieder aufgepäppelt worden. Mit listigem Lächeln erzählte er, wie fast jeden Tag jemand von der Behörde aufgekreuzt sei. Sie wollten unbedingt wissen, wo er heimatberechtigt sei und wohin sie die Rechnung schicken könnten. Aber er als Staatenloser habe ja nirgends eine Heimatberechtigung. Offenbar liessen ihn schliesslich die Behörden unverrichteter Dinge ziehen. Sie mussten die Rechnung selber bezahlen. Darüber amüsierte sich Galetzki köstlich. Allerdings war er im Spital nicht ganz auskuriert worden. Obschon nur wenig über 60, klagte er über eine ganze Reihe von Altersbeschwerden. Trotzdem begab er sich wieder auf die Walz. Und wieder herrschte Funkstille, bis nach Monaten eine Postkarte im Briefkasten lag. Wegen seiner angeschlagenen Gesundheit habe ihm eine jüdische Gönnerin den Aufenthalt in einem jüdischen Altersheim ermöglicht. Doch habe er den streng geregelten Betrieb einfach nicht länger ausgehalten. Er habe die Flucht ergreifen müssen und sei nun wieder unterwegs. Freundliche Grüsse. Wiederum hörten wir lange nichts mehr von unserem Weltenbummler. Plötzlich stand er leibhaftig vor der Tür, die spärlichen Haare ergraut und eigenartig kleinlaut. Er wohne jetzt in Thun, im Passantenheim der Heilsarmee. Eine Basler Gönnerin hatte ihn bei der Heilsarmee in Basel untergebracht. Diese Lösung war aber nicht von Dauer. Ob die Ursachen der Probleme mehr an der Heimleitung oder am Pensionär lagen, blieb mir verschlossen. Jedenfalls logierte er jetzt in der Nähe und suchte mich alle paar Tage auf. Mit ein wenig Taschengeld, mit der Ausleihe von Büchern und mit Gesprächen versuchte ich ihn zu unterstützen. Es half wenig. Ohne sich verabschiedet zu haben verliess er das Thuner Passantenheim, vermutlich wieder Richtung Basel. Ich habe nie wieder etwas von ihm gehört. Das Drama Galetzki war zu Ende, der Vorhang gefallen. Oder war es eine Tragödie gewesen? Oder eine Komödie? So oder so bleibt die Erinnerung an eine ungewöhnliche, schillernde Persönlichkeit.

Mauern
1886 gründete die reformierte Berner Kirche den Verein «Bethesda» mit einer «Epileptischen Anstalt» in Tschugg. Damals stand die Medizin dieser Krankheit fast hilflos gegenüber. Die Kranken wurden in der Regel in der Anstalt versorgt und von der Bevölkerung abgeschottet bis zu ihrem Lebensende. Der Arzt aus Erlach kam einmal pro Woche vorbei. Vor allem hatte er die durch Stürze verursachten Blessuren zu versorgen.
Als ich meine erste Pfarrstelle in Erlach antrat, wurde stillschweigend angenommen, dass ich auch die Betreuung dieser Anstalt übernehmen würde. Dass daran nicht zu rütteln war, unterstrich der administrative Verwalter, der im Kirchgemeinderat sass.
Seit den Gründungsjahren hatte sich viel geändert. Die Anstalt Bethesda war zur Klinik geworden, geleitet von einem Chefarzt und einem Oberarzt. Man hatte eine umfangreiche Apotheke aufgebaut und war eng mit der medizinischen Fakultät der Universität Bern verbunden. Der ursprüngliche Name «Bethesda» geriet mehr und mehr in Vergessenheit. Patienten durften mit einer starken Verbesserung ihres Zustandes oder gar mit einer Heilung rechnen. Viele kehrten nach ein, zwei Monaten Klinikaufenthalt zu ihren Familien und zu ihrer Berufsarbeit zurück.
Mein Pflichtenheft sah vor, dass ich zweimal im Monat in der Klinik Gottesdienst zu halten hatte. Damit wollte ich mich aber nicht begnügen. Ich wollte Genaueres wissen über diese Krankheit. Vom Chefarzt erbat ich mir einschlägige Literatur. Er schenkte mir eine Broschüre, in der die komplexen Funktionen und Störungen des Gehirns beschrieben waren. Zudem schilderte der Autor Verhaltensweisen und mögliche Charakterveränderungen von langjährigen Anfallkranken, was sehr hilfreich war. Wichtig war es für mich auch, die Patientinnen und Patienten ab und zu in ihren Aufenthaltsräumen und in ihren Zimmern zu besuchen. Im Frauenhaus wurde das begrüsst, insbesondere von der Oberschwester. Mit einigen Patientinnen verband mich bald eine besondere Beziehung. Da war zum Beispiel das freundliche, kleinwüchsige Fräulein Sommer. Mit seinen verkrüppelten Fingern spielte es gerne Klavier, Kirchenlieder natürlich. Es behauptete, das Klavier im Aufenthaltsraum sei sein persönliches Eigentum. Wer das bestreite, bekomme es mit seinem Götti zu tun. Der sei nämlich Professor Doktor Pfarrer Missionar (aufsteigende Reihenfolge!), komme oft zu Besuch und werde dann schon sagen, ‘was Gattigs’.
Im Männerhaus fand mein Wunsch zunächst gar keinen Anklang. Der Oberpfleger vertrat die alte Schule und liess keine Aussenstehenden das alte, auch äusserlich abweisende Gebäude betreten. Für ihn gab es ein striktes Aussen und ein Innen. Dazwischen eine feste Mauer. Offenbar waren früher auch psychiatrische «Anstalten» derart abgeschottet worden. Damit wollte ich mich nicht abfinden. Ich berief mich auf mein Amt (was ich sonst kaum je tat) und wandte mich an den Chefarzt. Schliesslich wurde ich widerwillig ins Männerhaus eingelassen. Im Aufenthaltsraum befanden sich wohl 30 Kranke. Einige sassen an einem grossen Tisch und entkernten Maiskolben. Andere gingen oder torkelten durch den Raum. Die meisten trugen unförmige Sturzhelme. Das Lallen, die deformierten Gesichter und Gliedmassen, übermässiger Speichelfluss – diese Bilder gingen mir nahe. In den Schlafsälen hatte jeder sein Bett. Aber weit und breit war kein Bild, kein persönlicher Gegenstand, nichts. Es würde sowieso alles kaputt gemacht, sagte man mir. Ich begriff nun, weshalb man Fremden lieber keinen Blick hinter die Mauern gewährte. Um der Gerechtigkeit willen muss ich beifügen, dass ich in der Psychiatrischen Anstalt (sic!) Münsingen einen ähnlich trostlosen Schlafsaal angetroffen habe. Das scheint damals, in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, üblich gewesen zu sein. Allerdings gewährten sie mir in Münsingen ohne weiteres Zugang.
Etwa zwei Jahre später starb der Oberpfleger. Der Nachfolger stammte aus dem Kanton Zürich. Er hatte natürlich eine andere Ausbildung genossen als der Vorgänger. Ihm eignete auch eine andere, offenere Wesensart. Nun durfte jeder Patient seine Bettnische ausgestalten. Zu Häupten der Betten prangten Fotos, Postkarten, Bilder aus illustrierten Zeitschriften und so weiter. Wer eine Taschen- oder Armbanduhr besass, durfte sie nun auf sich tragen. Vorher hatte man alle derartigen Besitztümer eingesammelt und irgend in einem Tresor weggesperrt. Nun sah man Patienten auch draussen. Einige verrichteten leichte Arbeiten. Der Gilgen Kari wischte Tag für Tag den Hof und die Strasse. Häufig aber stand er herum, auf den grossen Reisbesen gestützt, und träumte vor sich hin. Er erwies sich als sehr anhänglich, was dem Krankheitsbild entspricht. Oft machte er mir ein Geschenk, meistens einen Zettel von seinem Abreisskalender. Wenn ich mich recht erinnere, konnte Gilgen Kari nicht lesen. Aber der jeden Tag abzureissende Zettel war ihm wichtig. Ein anderer Patient, der seinen Namen und ein paar Mustersätzlein schreiben konnte, schickte mir Jahr für Jahr am 30. November, meinem Namenstag, ein Brieflein mit guten Wünschen. Noch Jahre nach meinem Wegzug nach Thun durfte ich Ende November immer Post aus Tschugg erwarten.
Dass die einstmals so abweisenden Mauern abgebaut wurden, zeigte sich in mancher Hinsicht. Wenn am Sonntag kein Klinikgottesdienst stattfand, besuchte oft eine Patientengruppe, begleitet von Pflegerinnen und Pflegern, den Gottesdienst in Erlach. Wenn man an einem prächtigen Sommersonntagmorgen diese Gruppe durch die Rebberge oder vom Jolimont her der Kirche zustreben sah, lachte einem das Herz. Nicht nur, weil die Kirchenbänke besser besetzt sein würden. Das war mir natürlich auch recht. Doch mehr noch freute man sich, wie dieses Grüpplein offensichtlich vergnügt unterwegs war, sozusagen auf einem Sonntagsspaziergang in Gottes freier Natur. Weit weg von der dumpfen, grauen und geradezu trostlosen Atmosphäre, die bis vor ein paar Jahren hinter den Anstaltsmauern geherrscht hatte. Und es gingen mir oft die wunderbar kindlichen Liedstrophen Paul Gerhardts durch den Sinn: «Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben…»
Im westlichen Seeland waren und sind, nebst der Klinik Bethesda, auffällig viele Heime und «Anstalten» angesiedelt. So die Schulheime Erlach und Brüttelen, das Arbeiterheim Tannenhof und – besonders markant - die Strafanstalten Witzwil, St. Johannsen und das freiburgische Bellechasse. Mit Witzwil sollte ich schon kurz nach meinem Amtsantritt in Erlach Bekanntschaft schliessen. Ein Gemeindeglied hatte nämlich in betrunkenem Zustand ein anderes Gemeindeglied totgefahren. Der Unfallverursacher wurde zu ein paar Monaten unbedingt verurteilt und in Witzwil eingewiesen. Wie es sich für einen Seelsorger gehört, stattete ich ihm einen Besuch ab. Der erste Eindruck bleibt unvergessen. Da ich noch kein Auto besass, radelte ich durchs grosse Moos zu dem bereits aus der Ferne bedrückend wirkenden Komplex der Strafanstalt. Da sich weit und breit kein Veloständer fand, lehnte ich das Fahrrad an die mächtige Mauer des Hauptgebäudes, sicherte es mit einem guten Schloss und schaute mich um. Alle Fenster am dreistöckigen Hauptgebäude (die sogenannte Kaserne, wie ich später lernte) waren vergittert. Nirgends ein Wegweiser oder gar ein freundlich gestalteter Eingangsbereich. Zuhinterst auf einem weiten Platz arbeiteten einige Gestalten in merkwürdiger Kleidung. Es waren nicht die schwarz/weiss gestreiften Gefängnisklamotten, wie man sie aus amerikanischen Filmen kannte. Hier trugen die Männer soliden Drillich, Ärmel und Hosen in Blau, das Oberkleid in Braun. Da quietschte hinter mir die Bremse eines Fahrrades. Ein sehr grossgewachsener Mann mit grauer Jacke und Schirmmütze musterte mich und fragte kurz angebunden: «Was weit der» (Was wollt ihr)? Ich erklärte mein Anliegen, worauf mich der grosse Mann auf ein Portal hinwies. Ich solle mich dort melden. Das tat ich, und der Diensthabende, hinter einem Tresen stehend, wies mich in ein düsteres Besuchszimmer. Dort erschien nach angemessener Zeit «mein» Gemeindeglied. Der Tod seines Mitbürgers hatte ihn ebenso erschüttert wie die Verurteilung zur Haftstrafe. Jedenfalls war er sehr froh über meinen Besuch. Beim grossen Mann auf dem schwarzen Velo hatte es sich übrigens um Direktor Kellerhals gehandelt. Mit ihm sollte ich wenig später näher bekannt werden. Seine überlange hagere Gestalt und die helle Stimme, die bei Bedarf sehr schneidend klingen konnte, unterstrichen seine Autorität. Er beherrschte sein Imperium in jeder Hinsicht. Ein kurzer Blick auf seinen Werdegang mag Einiges erklären.
Gründer der Anstalten in Witzwil war sein Vater, Otto Kellerhals. Nach der Juragewässerkorrektion übernahm dieser, nach einer mehrjährigen Anstellung in St. Johannsen, den eben erst errichteten Landwirtschaftsbetrieb. Mit einer Gruppe Sträflingen, die er aus St. Johannsen mitgebracht hatte, begann er den Auf- und Ausbau der Strafanstalt Witzwil. Einer seiner Grundsätze lautete: für straffällige Menschen ist es nicht gut, eingesperrt zu sein. Durch Arbeit, und zwar landwirtschaftliche Arbeit, an der frischen Luft, auf Feld und Acker oder auch im Umgang mit Tieren, werden positive Kräfte geweckt. Dies erforderte einen neuen Anstaltstypus: die Halbgefangenschaft. Dieses Prinzip war anfänglich sehr bestritten, aber Otto Kellerhals setzte sich durch. Sein Sohn Hans wurde zum Nachfolger gewählt. Seine Lehrjahre hatten ihn unter anderem nach New York geführt. Von seinem Praktikum im berüchtigten Sing Sing-Gefängnis hat er gern erzählt. So von einem Sonntag, als einige hundert der über zweitausend Strafgefangenen ihre Zellen verlassen und in einem riesigen Aufenthaltsraum den Sonntag verbringen konnten. Es sei für die Aufseher ein traumatisches Erlebnis gewesen. So viele zum Teil brutale Gangster auf einem Haufen! Das habe gebrodelt, wie in einem Dampfkochtopf kurz vor der Explosion. Sing Sing war eine abschreckende Erfahrung. Umso überzeugter übernahm er das Prinzip der Semi-liberté, als er zum Nachfolger seines Vaters gewählt wurde. Das Konzept erregte übrigens weit herum grosses Interessen. Sogar aus Japan sei eine Delegation erschienen, um sich die Sache anzusehen. Dabei führte Kellerhals kein Kuschelregime. Er war streng, zuweilen patriarchalisch. Während des zweiten Weltkrieges geriet er wegen den Methoden, schwer renitente Internierte zu bändigen, in die Schlagzeilen (Wolldeckenwickel-Affäre). Aber er setzte sich für seine Gefangenen - sie wurden offiziell «Enthaltene» genannt – oft persönlich ein. Vor allem dann, wenn er das Gefühl hatte, die kantonalen Behörden handelten ungerecht oder willkürlich. «Mir wei de luege», pflegte er am Schluss einer Audienz oft zu sagen. Und er «schaute» wirklich. Wenn er fand, die Klage eines Insassen könnten eine gewisse Berechtigung haben, ging er der Sache auf den Grund. Er scheute sich nicht, wenn nötig persönlich in den Rathäusern zu Bern, zu Glarus, zu Basel und in anderen Konkordatkantonen anzurufen. Er soll sich sogar gegenüber Regierungsräten durchgesetzt haben. Kellerhals war eine weitherum geachtete und ein wenig gefürchtete Autorität.
Mehrere Wochen nach unserer ersten Begegnung sahen wir uns erneut. Direktor Kellerhals ersuchte mich um ein Gespräch. Es ging um den Ersatz für den reformierten Anstaltspfarrer, der in den Ruhestand getreten war. Ein Grund seiner Anfrage war offenbar die Empfehlung eines Schwiegersohns – eines mir gut bekannten Pfarrerkollegen. Der zweite Grund: Direktor Kellerhals hatte die löbliche Vision, in seiner Anstalt eine kirchliche Jugendgruppe zu gründen. Das wäre schweizweit ein einmaliges Ding gewesen. Deshalb betrachtete er meine Jugend als Vorteil. Das schwierige Unterfangen ist dann aber gescheitert, aus verschiedenen Gründen. Jedenfalls aber war ich für fast zehn Jahre nicht nur Gemeinde-, sondern auch Gefängnispfarrer. Zum Pflichtenheft gehörte ein Gottesdienst pro Monat und wöchentliche Sprechstunden, für die sich die Gefangenen anmelden konnten – auch während der Arbeitszeit. Heute werden für Gefängnis-, Spital- und alle möglichen Spezialpfarrämter Kurse angeboten. Wie ich höre, sind derartige Sonderausbildungen Voraussetzung für eine Wahl. So etwas gab es 1960 nicht. Ich hätte von einer derartigen Möglichkeit gern profitiert. Allerdings habe ich im Laufe der Zeit etliche Spezialausgebildete getroffen, die es trotz aller Theorie schwer hatten, mit Mitmenschen jeglicher Art umzugehen. Wie dem auch sei: ich bemühte mich, meine Arbeit so gut als möglich zu leisten. Für Zweifel gab es keine Zeit. Schon in der ersten Sprechstunde prasselten Fragen und Klagen auf mich herab. Die Unerträglichkeit, hinter Gittern und Mauern gefangen zu sein wie ein Tier im Käfig. Die Trennung von der Familie, insbesondere die ausserordentlich eingeschränkte Kommunikation mit der Partnerin. Konflikte mit Mitgefangenen. Wut über das Gerichtsurteil, das als ungerecht oder gar als total falsch empfunden wurde. Zukunftsängste: wie soll es nach der Entlassung weitergehen? Und, und….
Die allermeisten dieser Probleme hatten eine Gemeinsamkeit: ich konnte sie den Gefangenen nicht abnehmen. Der bedrückenden Realität von Mauern und Gittern konnten sie nicht entgehen – höchstens durch Flucht, und das war eine Lösung mit sehr negativen Folgen. Die Angst vor der Zukunft oder die Trennung von der Familie oder die Gültigkeit der Gerichtsurteile – alles nicht änderbare Fakten. Ich versuchte, mit Empathie, aber ohne Sentimentalität zuzuhören. Ich gestehe, dass ich manchmal eine Zigarette spendete, um die Atmosphäre aufzulockern. Es zeigte sich nicht selten, dass das geduldige Zuhören Wirkung hatte. Es löste Spannungen, minderte Vorurteile und förderte neue Denkansätze. Im Laufe der Jahre fiel mir auf, dass meine Klienten nur in seltenen Fällen über ihre Taten oder gar über Schuld und Schuldgefühle sprechen wollten. Die wenigen, die es taten, versuchten das Geschehene gern in mildes Licht zu stellen. So behauptete ein wegen Inzest Verurteilter, er liebe seine (missbrauchten) Töchter sehr und sie hätten es immer schön gehabt. Das für die christliche (auch für die protestantische) Theologie so wichtige Geschehen von Bekenntnis der Schuld und Zuspruch der Vergebung fand in Witzwil nur in bescheidenen Ansätzen statt. Welchen Erfolg mein katholischer Kollege mit dem Angebot der Beichte erzielte, habe ich mit ihm leider nie erörtert. Für die meisten Gefangenen stellte die Beziehung zu ihren Frauen, Bräuten und Freundinnen ein enormes Problem dar. Briefe durften, wenn ich mich richtig erinnere, nur zweimal pro Monat getauscht werden. Die Hausordnung hielt fest, dass alle Briefe geöffnet und gelesen würden. Besuch war einmal im Monat erlaubt. Offene Kommunikation war unter diesem Regime kaum möglich. Deshalb wurden sehr viele Beziehungen, meist ohnehin problembeladen, arg strapaziert oder endeten mit der Scheidung. Mit was für Phantasien sich diese Männer am Abend und in der Nacht in ihren Zellen doch herumschlugen! Misstrauen und Eifersucht mischten sich mit Wut und Selbstmitleid. Mit der Zeit übernahm ich in manchen Fällen die Rolle eines Mediators. Im Auftrag der Männer schrieb oder telefonierte ich den Frauen, hörte mir ihre Meinung an, vermittelte, erklärte die Sicht der Männer und ging mit dem Gehörten zurück in die Anstalt. So kam manchmal ein Dialog zustande, der vorher aussichtlos schien.
Natürlich spielten die Angestellten eine enorm wichtige Rolle. In der Landwirtschaft und in den Werkstätten arbeiteten Berufsleute, die keine spezifische Ausbildung genossen hatten. In der Landwirtschaft – Witzwil soll der grösste Landwirtschaftsbetrieb der Schweiz sein – waren häufig Bauernsöhne angestellt, die wegen der Erbfolge das väterliche Heimwesen nicht hatten übernehmen können. Einige schafften den Umgang mit den Gefangenen bestens. Auch für die Wachtmannschaften gilt das Gleiche. Ich denke, kaum einer von ihnen hatte irgendwelche polizeiliche Schulung genossen. Ihre Gutmütigkeit schwand in ausserordentlichen Situationen. Etwa dann, wenn ein Enthaltener «auf die Kurve» gegangen war, also die Flucht ergriffen hatte. Mit scharfen Suchhunden ging man auf die Jagd. Und wehe, wenn sich der Flüchtling zur Wehr setzte! Das bekam ihm nicht gut. Im Büro arbeiteten zwei ziemlich verschiedenartige Männer. Der Chef, mit dem Titel Adjunkt, gab sich sehr hilfsbereit, freundlich, zuweilen verdächtig freundlich. Ich fand mich mit ihm nur vordergründig zurecht. Ein Witzbold verriet mir mal: «Wenn Sie möchten, dass irgend eine Nachricht in der ganzen Anstalt verbreitet wird, dann gehen Sie zum Herrn Adjunkt und erzählen es ihm unter dem Siegel grösster Verschwiegenheit». Zudem hatte er die unangenehmen Eigenschaften eines Radfahrers: nach oben buckeln, nach unten treten.
Eine Schlüsselrolle spielte der Hausmeister. Das ist buchstäblich zu verstehen: er verfügte über sämtliche Schlüssel für sämtliche Gebäude und Türen in der Anstalt. Wer unter den Gefangenen das Glück hatte, zu seinem Gehilfen gewählt zu werden, hatte das grosse Los gezogen. Zufälligerweise war dies während mehreren Wintern ein guter Bekannter von mir. Wir hatten zusammen die Rekrutenschule besucht. Als ihm nach der RS die so sehr gewünschte militärische Karriere verwehrt wurde, geriet er komplett aus dem Tritt. Wegen kleinerer Delikte kam er – schon vor meiner Zeit – nach Witzwil. Er wusste sich offenbar rasch einzufügen und wurde eben der Gehilfe von Hausmeister Fischer. Der Posten behagte ihm so sehr, dass er nach der kurzen Strafzeit wieder delinquierte und wieder in Witzwil landete. So soll er es jeden Herbst gehalten und die kalte Winterzeit in der Anstalt verbracht haben. Wie doch der gute Housi strahlte, als er mir, dem neuen Anstaltspfarrer, zum ersten Mal begegnete. Was ihn besonders freute: dass er mit mir per Du war und dass er dies den Mitgefangenen laut und deutlich kundtun konnte. Von Hausmeister Fischer ist mir ein Bild im Gedächtnis geblieben. Ganz Witzwil hatte sich in der grossen saalartigen Kapelle zur Weihnachtsfeier versammelt. Die Kerzen am riesigen Weihnachtsbaum erhellten den Raum, vor allem die vordere Hälfte. In der vordersten Reihe sassen das Direktorenpaar und die Kinder der Angestellten. Nachdem ich eine kurze Weihnachtspredigt gehalten hatte, sang man einige Weihnachtslieder. Unvergesslich. Die 200 Gefangenen sangen nicht, sie brüllten die bekannten Melodien. Es war erschütternd, weil sich in diesem Gebrüll so viel Elend verbarg, Heimweh, Leid, Wut, zerbrochene Hoffnung, zerbrochene Liebe. Darauf stellten sich die Kinder der Angestellten auf und rezitierten ihre Verslein. Die Erregung der Enthaltenen steigerte sich, ein Gemurmel erhob sich, einzelne Worte waren vernehmbar. Da stieg Herr Fischer auf die Kanzel und starrte minutenlang ins Halbdunkel, wo die Gefangenen sassen. Er sagte kein Wort, verzog keine Miene. Aber das Gebrummel wurde leiser und verebbte schliesslich. Die Feier konnte ohne Zwischenfall zu Ende geführt werden. Fröhliche Weihnacht – wie geht das in einer Strafanstalt?
Sehr angenehm waren die Kontakte mit den beiden Sozialarbeitern. Sie hatten sich innerhalb der Anstalt eine gewisse Unabhängigkeit erarbeitet und wagten gelegentlich auch Kritik. Hauptsächlich befassten sie sich mit den verschiedensten Freizeitaktivitäten. Dazu gehörten Metallarbeiten, Schreinern, künstlerisches Gestalten, Fremdsprachen etc. Am liebsten war den Gefangenen der Sport. Es gab interne Fussballturniere, von Zeit zu Zeit aber auch Spiele gegen auswärtige Mannschaften. Mit dem Montags-Fussballklub, den ich in Erlach gegründet hatte, traten wir jedes Jahr gegen den FC Witzwil an. Meistens verloren wir, da sich unter den 200 Gefangenen immer zwei, drei oder mehr Spieler aus höheren Ligen befanden. Bei Tee, einem Stück Brot und einem Wienerli klang der Anlass jeweils gemütlich aus. Der Sportplatz war übrigens zu drei Vierteln von einer mindestens 6 Meter hohen Mauer umgeben. Diese war natürlich nicht errichtet worden, um die Sportler vor dem Wind zu schützen, der gelegentlich über das grosse Moos fegte. Nein, der Kanton – oder war es der Bund? – beabsichtigte während des Weltkrieges, ein Hochsicherheitsgefängnis zu bauen. Als die Umfassungsmauer zum grossen Teil errichtet war, wurde das Projekt abgeblasen. Gründe und Hintergründe sind mir nicht bekannt.
Gelegentlich machte ich abends Zellenbesuche. Zum Beispiel dann, wenn ein Gefangener keine Möglichkeit hatte, die Sprechstunde zu besuchen. Oder wenn einer aus disziplinarischen Gründen für einige Zeit die Zelle nicht verlassen durfte. Die Gespräche gestalteten sich dann oft ergiebiger als sonst, man war ja sozusagen in der Wohnstubenatmosphäre. Die Zellen waren allerdings eng und karg möbliert: ein Bett, ein Tisch, zwei Stühle, der Kübel in einer Ecke. Als Wanddekoration dienten Fotos von Angehörigen, Bilder mit schönen Landschaften und halbnackten Frauen, fromme oder kluge oder lästerliche Sprüche. Die Collagen an den Zellenwänden boten einige Rückschlüsse auf die Bewohner. Behaglich aber konnte man sich wahrhaftig nicht fühlen, schon nur wegen der Geräusche im Zellengang. Man hörte, wie die niedrigen Zellentüren, wohl aus massivem Eichenholz gefertigt, zugeschlagen und die grossen Metallriegel mit einem Knall vorgeschoben wurden. Dann schepperte das hohe Gitter ins Schloss, mit dem der Zellengang abgeschlossen wurde. Wenn die mich nur nicht vergessen haben, dachte ich oft. Doch das Unbehagen war unbegründet. Wie vereinbart liessen mich die Wächter stets wieder frei. Was hätten sie schon mit einem zusätzlichen Insassen anfangen sollen?
Mit einigen Gefangenen verbanden mich besondere Erlebnisse. Es soll allerdings nicht verschwiegen werden, dass die «normale» Tätigkeit als Gefängnispfarrer wenig spektakulär war. Ob und wie die Gespräche meinen Klienten geholfen haben, blieb mir meistens verborgen. Aber es gab immer wieder aufregende oder berührende Ereignisse. Die meisten Männer hatten eine recht bewegte Vergangenheit hinter sich, selbst die Jungen. Da waren unglückliche Familienverhältnisse, schlagende oder alkoholgeschädigte Väter, liederliche Mütter, berufliche Misserfolge, zerbrochene Partnerschaften, Schlägereien, Drogen, Schulden aller Art. Sich in diesem Umfeld durchs Leben zu schlagen, war und ist ein schwieriges Unterfangen. So hielten es viele für unabdingbar, Härte zu zeigen, wenn man nicht vollends untergehen wollte. Ein Leitspruch in der nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands hiess: «Gelobt sei, was hart macht». Dem wurde und wird wohl noch heute in Strafanstalten nachgelebt. Und doch geschah es manchmal, dass der Panzer einen Riss bekam und dass sich ein weicher Wesenskern offenbarte. Einmal gestand mir ein Gesprächspartner, der als harter Bursche berüchtigt war, er sei manchmal vor dem Einschlafen derart verzweifelt, dass er ein Abendgebet aus seiner Kindheit rezitiere. Was denn das für ein Gebet sei, wollte ich wissen. Unter Tränen sagte er es auf wie irgendeinen Kindervers. «I ghöre es Glöggli, es lütet so nätt. Der Tag isch vergange, jetz ga ni i ds Bett. Im Bett tue ni bätte u schlafe de i. Der Liebgott im Himel wird wohl bi mer sy. Amen». Ich traute meinen Ohren nicht. Dieser Kraftprotz, der vor mir sass, und den viele Mitgefangene fürchteten, hatte sich zu einem Häuflein Elend verwandelt und auf die Position eines kleinen Kindes zurückgezogen. Diese Szene verfolgte mich noch lange. Eine derartige Metamorphose muss einen ja an und für sich beschäftigen. Mir wurde aber auch bewusst, dass selbst in so simplen Kindergebeten eine gewisse Kraft liegt. Gleichzeitig aber fragte ich mich, wie denn ein reifes, in schwierigen Lebenssituationen erhärtetes Gebet klingen würde. Kinderglauben mag gut sein für die Nothilfe. Tragfähig wäre Erwachsenenglauben.
Eine ganz andere Szene. An einem Sommermorgen früh, wohl etwa um 4 Uhr, wurde an der Türglocke Sturm geläutet. Auf der Schwelle stand ein junger Mann, mit dem ich schon etliche Gespräche geführt hatte. Kein Schwerkrimineller, aber doch mit einem Sündenregister, das ihn für mehr als ein Jahr hinter Gitter gebracht hatte. Er war getürmt und fühlte sich bei mir einigermassen in Sicherheit. Dank einer Tasse Kaffee und langen Gesprächen beruhigte er sich. Dass ich ihn nicht verraten würde, war uns beiden klar. Hingegen versuchte ich ihn zu überzeugen, dass seine Flucht sinnlos war und seine Situation nur verschlimmere. Das schien er denn auch einzusehen. Ich versprach ihm, ihn mit dem Auto nach Witzwil zurückzubringen und ein gutes Wort für ihn einzulegen. Das meldete ich telefonisch in der Anstalt. Darauf begaben wir uns zu meiner Garage. Leider hatte ich den Schlüssel zur Garage vergessen und eilte zurück ins Haus. Als ich nach einer Minute mit dem Schlüssel wieder auf der Strasse stand, war mein Besucher verschwunden. Offenbar hatte ein Velo, das vor dem Nachbarhaus an der Mauer lehnte, seinen Freiheitsdrang wiederbelebt. Bei diesem Nachbarhaus handelte es sich übrigens ums Amtshaus mit dem angebauten Bezirksgefängnis! Jedenfalls war der Mann auf und davon. Wenig später meldete sich ein Suchtrupp aus Witzwil und ich musste ihnen den etwas peinlichen Verlauf der Geschichte erzählen. Der Flüchtling wurde noch am selben Tag irgendwo am Bielersee gefasst. Fluchtversuche hatten sehr selten Erfolg. Für mich war freilich noch nicht alles vorbei. Der Adjunkt, von dem ich schon kurz berichtet habe, deckte mich mit zünftigen Vorwürfen ein. Ich hätte den Flüchtling unverzüglich melden sollen. Meine Argumente fanden zunächst gar kein Gehör. Aber ich beharrte auf meiner Rolle als Pfarrer. Meine Klienten müssen darauf zählen können, dass ich ihr Vertrauen nicht missbrauche. Dass ich ohne ihr Einverständnis nicht Meldung erstatte. Ich bin nicht der verlängerte Arm der Polizei. Ich habe Schweigepflicht. Ausgenommen sind nur Situationen, in denen ein Seelsorger schwere Verbrechen verhindern kann. Davon konnte im vorliegenden Fall nicht die Rede sein. Vermutlich waren es nicht allein meine Argumente, die den aufgeregten Adjunkten schlussendlich zum Schweigen brachten. Es war wohl mehr noch die unaufgeregte Haltung des neuen Direktors. Herr Loosli war kurz vor dieser Episode zum Nachfolger von Hans Kellerhals gewählt worden.
Während meiner Tätigkeit in Witzwil arbeitete in der Anstaltsküche ein stiller, bescheidener Mann, der mich immer freundlich grüsste, jedoch nur sehr selten eine Audienz verlangte. Beim Küchenchef und bei der ganzen Belegschaft war er beliebt. Er hatte vor seinem Delikt als Werkstattchef einer grösseren Fabrik gearbeitet. Zur Belegschaft gehörten auch einige Erlacher. Ausnahmslos alle schätzten seine Wesensart ebenso wie seine beruflichen Qualitäten. Als die Zeitungen von der furchtbaren Tat berichteten und die Identität des Täters durchsickerte, waren alle seine Freunde und Bekannten fassungslos. Der Mann hatte nämlich mit einem Beil seine Frau erschlagen, zu Hause, in der Küche, und die beiden halbwüchsigen Kinder fanden ihre Mutter tot in einer Blutlache. Der Mann bestritt seine Tat nicht. Er wurde zu 18 Jahren Zuchthaus verurteilt. Auch seine Geliebte musste für ein Dutzend Jahre hinter Gitter. Sie spielte offenbar eine wichtige Rolle und bedrängte über Monate und Jahre ihren Freund, die lästige Gattin zu beseitigen. Die Geliebte soll ihn während eines gemeinsamen Wochenendes im Tessin überredet haben, ein Beil zu kaufen – die spätere Tatwaffe. Ich habe die Gerichtsakten nie gelesen und den Prozess nur in der Presse verfolgt. Insgesamt aber dürften die obigen Angaben stimmen. Ich kenne niemand, den dieses Geschehen nicht bis ins Innerste erschüttert hätte. Wie kann es sein, dass ein friedfertiger und bescheidener Mensch eine derartige Untat begeht? Wie gesagt: ich habe mit dem Mann nur selten Einzelgespräche geführt. Und ich gestehe: wenn er mir gegenübersass, erwartete ich insgeheim, er würde vielleicht die Zentnerlasst, die auf ihm lasten musste, ansprechen. Nur mit einem leisen Hinweis, mit einer flüchtigen Frage. Aber ich konnte aufmerksam hinhören, wie ich wollte: da kam nichts. Ich habe auch nie herausgefunden, ob er unter Schuldgefühlen litt oder gar keine solchen empfand. Die gleiche Frage stellte sich auch der Anstaltspsychiater. Er war ebenso wenig wie ich ans Innerste des Klienten herangekommen. Ein Problem jedoch quälte ihn die ganze Zeit über. Deshalb hatten wir vermehrten Kontakt. Für minderjährige Kinder bestand nämlich ein striktes Besuchsverbot in Strafanstalten. Darunter litt der Mann, der die Mutter seiner Kinder umgebracht hatte, grausam. Offenbar hätten auch die Kinder ihren Vater gern besucht – trotz allem, was geschehen war. Die Kinder waren bei Onkel und Tante untergebracht und hatten es gut. Den Onkel, Bruder des Täters, liess die Sache nicht in Ruhe. Wir besprachen zunächst am Telefon, später anlässlich eines Besuchs, wie man den Kindern und ihrem Vater helfen könnte. Unsere Idee: wir wollten zwei oder dreimal im Jahr ein Treffen bei mir im Pfarrhaus organisieren. Aber dieser Plan wollte den Behörden nicht einleuchten. So wandte sich der Bruder direkt an den damaligen Polizeidirektor, Regierungsrat Bauder. Und siehe da: der zeigte Verständnis. Das erste Treffen zwischen dem Vater und seinen etwa 12 und 14jährigen Kindern werde ich nie vergessen. Rechtzeitig hatte man den Vater hergebracht. Er sass bei uns im Wohnzimmer, angespannt, nervös. Man sah ihm an – er hielt das Warten fast nicht aus. Als es läutete, sprang er auf. Und dann war es so weit: Vater und Kinder standen sich gegenüber. Nur ein kleines Zögern und schon umarmten und küssten sich die Drei mit einer Herzlichkeit ohnegleichen. So, als wäre die schlimme Vergangenheit weggewischt und vergessen. In regelmässigen Abständen fanden weitere Treffen statt. Als ich aus Erlach wegzog, waren die Kinder in einem Alter, das den Besuch in der Strafanstalt erlaubte.
Die Anstalten in Witzwil gehören zu einem interkantonalen Konkordat für den Strafvollzug erstmaliger Delinquenten. Kaum einer von ihnen gehörte zur Kategorie der Schwerkriminellen. Die sassen auf dem Thorberg ein. Einige «Witzwiler» waren zwar wegen schwerer Vergehen (Tötung, schwere Körperverletzung etc) verurteilt worden. Aber sie waren eben keine Wiederholungstäter. Unter den Insassen in Witzwil fanden sich zahlreiche wegen Betrug, Unterschlagung, Veruntreuung und Ähnlichem Verurteilte. Im Volksmund kursierte der bösartige Spruch, in Witzwil wimmle es von Notaren. Ich habe Menschen aus verschiedensten Berufen und gesellschaftlichen Klassen angetroffen, Ärzte wie auch den einen oder andern Pfarrer, Handwerker, Beamte, Bauern. Das war jedoch unter den Gefangenen kaum von Bedeutung. Interessanterweise spielten in der internen Hackordnung die Art der Delikte die grössere Rolle als die Position im Zivilleben. Es ist bekannt, dass Kinderschänder zu der am meisten verachteten Kategorie gehören. Auch den Exhibitionisten kommt viel Geringschätzung, ja Verachtung entgegen. Ein jüngerer Mann aus dem Baselbiet, der zu dieser Gruppe gehörte, suchte mich häufig auf. Ein Grund war die Drohung der Baselbieter Behörden, an ihm eine Zwangskastration vorzunehmen. Heute ist bekannt, dass diese erzwungene Therapie mehr zerstört als heilt. In den sechziger Jahren war das noch anders. Er entging schliesslich diesem schwerwiegenden Eingriff in seine Persönlichkeit. Nach der Haft heiratete er und bald gebar seine Frau ein Mädchen. Offenbar war es nicht ganz einfach, Paten für die Taufe zu finden. Die Eltern baten mich um diesen Dienst. Ich sagte nach einigem Zögern zu und fuhr eines Sonntagmorgens ins kleine Dorf jenseits des Hauenstein. Nebenbei bemerkt: die Kosten für den Predigt-Stellvertreter hatte ich selbstredend aus der eigenen Tasche zu berappen. In den folgenden Jahren suchte ich es jedes Jahr vor Weihnachten einzurichten, das Gotteli mit dem Namen Alexandra zu besuchen. Das schien mir umso wichtiger, weil der Vater seine Familie verliess, als das Mädchen etwa vier Jahre alt war. Niemand wusste, wo er sich aufhielt. Die Alimente zu bezahlen «vergass» er regelmässig. Obschon er von den Behörden gesucht wurde, blieb er viele Jahre verschwunden. Eines Tages, ich war längst nach Thun gezogen, stand er ohne das geringste Anzeichen eines schlechten Gewissens vor der Tür. Munter erzählte er von seiner Wahlheimat Südafrika, wo er sich wiederum verheiratet habe und ein geordnetes Leben führe. Auf meine Vorhaltung, seiner Tochter jeder Unterstützung beraubt zu haben, entgegnete er, das Leben in Südafrika sei teuer und seine neue Frau auch. Ausserdem habe seine Ex einen Job und leide keine Not. Er liess sich danach nie mehr blicken. Obschon seine Frau mit der heranwaschenden Alexandra inzwischen in den Thurgau gezogen war, besuchte ich sie jedes Jahr. Als Alexandras Konfirmation bevorstand, äusserte sie den Wunsch, von mir konfirmiert zu werden. Eine Woche vor dem Fest kam sie zu uns. Ich nahm sie mit in den Unterricht und machte sie mit den anderen Konfirmandinnen und Konfirmanden bekannt. Die einheimischen Mädchen nahmen sie mit grosser Selbstverständlichkeit, ja mit Herzlichkeit auf. Zur Konfirmation erschienen die Mutter und die betagten Grosseltern aus dem Baselbiet. Alexandra war glücklich. Auch danach verloren wir uns nicht aus den Augen. Die Mutter, stets in Sorge, ihre Tochter könnte auf die schiefe Ebene geraten, erzog das Mädchen sehr streng, überängstlich, mit allzu vielen Verboten. Leider vermochte ich die gespannte Situation nicht zu beeinflussen. Es kam, wie es kommen musste. Alexandra hatte eine Liebschaft, wurde schwanger und gebar einen Knaben. Dessen Vater hielt glücklicherweise zur Freundin und anerkannte seinen Sohn. Etwa nach einem Jahr wurde geheiratet. Wer sollte die Trauung halten? Natürlich der Götti. So reiste dieser ins Appenzellische und zelebrierte in einer kleinen Kirche irgendwo in den grünen Hügeln die Trauzeremonie. Ein Jahr später kam ein zweiter Knabe zur Welt. Unsere Kontakte wurden seltener. Immerhin meldete mir Alexandra ab und zu eine Adressänderung, nebenbei auch die Scheidung. Und etwas später eine zweite Heirat – nur zivil. Briefwechsel zu Weihnachten und Neujahr blieben unsere einzige Verbindung. Dann wieder eine Scheidungsmeldung und eine neue Adresse. Einmal noch besuchte mich Alexandra mit ihren beiden inzwischen aus der Schule entlassenen Söhnen, recht flotten Burschen. Sie erzählte mir, sie sei begeisterte Motorradfahrerin. Insbesondere schwärmte sie von den schweren Harley-Davidson – Maschinen und von Töff-Ferien in den USA. Sie sei zudem Präsidentin eines Motoclubs. Da gebe es leider grosse Konflikte und sie habe deswegen ziemlich viele Schulden. Ich konnte ihr nur mit dem Hinweis auf die Stelle für Schuldenberatung helfen. So endete diese Geschichte, die mehr als dreissig Jahre zuvor im düsteren Audienzzimmer in Witzwil begonnen hatte.
G. war kein unbeschriebenes Blatt, als er mich unter Tränen anflehte, die Vormundschaft zu übernehmen. Er hatte in andern Kantonen bereits kleinere Strafen abgesessen und war, aus welchen Gründen auch immer, in Witzwil gelandet. Bald würde seine Haft abgelaufen sein. Der Wiedereinstieg ins zivile Leben wäre doppelt schwierig ohne die Unterstützung durch einen neuen Vormund. Der Bisherige hatte sein Mandat niedergelegt. Die Vormundschaftsbehörde der Stadt Bern warnte. Herr G. sei ein schwieriger Fall. Warum ich dieses Amt trotzdem übernahm? War es Naivität? Falsches Mitleid? Oder – wahrscheinlich – Beides. Zunächst ging es darum, den Austritt vorzubereiten. Einen Job hatte mein Klient selber gefunden. Ein ehemaliger Mitgefangener, Inhaber einer kleinen Firma, bot ihm eine Stelle an als Vertreter für den Vertrieb von kleineren Baumaschinen. Als vorläufige Unterkunft fand ich ein Zimmer bei einer älteren Dame in Erlach. Der Start in die Freiheit gelang ohne besondere Schwierigkeiten. Er verkaufte mehrere Maschinen, wobei ihm sein gutes Mundwerk bestimmt zu statten kam. Die Zimmervermieterin war mit dem Mieter durchaus zufrieden. Ab und zu luden wir ihn am Sonntag zum Essen ein. Er fügte sich gut ein. Die Kinder waren sehr angetan, weil er ihnen lustige Geschichten erzählte und mit ihnen spielte. Allmählich aber trübte sich das schöne Bild. Für eine Fahrt nach Neuenburg hatte er sich bei einem Bekannten ein Auto ausgeliehen. Er baute einen Unfall, wohl nicht ganz unschuldig, wurde gebüsst und konnte sich mit dem Wagenbesitzer nicht einigen. Weil er sich in früheren Jahren als Gelegenheitsjournalist betätigt hatte, nahm er dieses Hobby wieder auf. Er zeigte mir Artikel, die er damals beim «Berner Tagblatt» untergebracht hatte (Das «Berner Tagblatt» erschien bis 1979. Dann wurde es von der Berner Zeitung geschluckt). Es waren vorwiegend Spionagegeschichten. Grinsend erzählte er, dass er diese Artikel vorwiegend aus deutschen Zeitschriften wie dem »Spiegel» abgeschrieben und für bernische Verhältnisse aufbereitet habe. Das konnte mich nicht begeistern. Noch weniger gefiel mir, als er etwas später ein Visitenkärtchen drucken liess. Darauf standen sein Name und die Berufsbezeichnung «Journalist». Darunter zwei Adressen: Hamburg, Pressehaus «Der Spiegel» sowie: Pfarrhaus Erlach. Es blieb kaum Zeit, diese Geschichte zurechtzurücken. Sein Chef schickte ihn nämlich nach Holland, um den dortigen Markt zu erkunden und Bestellungen zu tätigen. Eine in Holland abgestempelte Postkarte war über längere Zeit das einzige Lebenszeichen. Bald zeigte sich, dass er sich nicht nur mit dem Vertrieb von Baumaschinen beschäftigte. Von einem Anwalt aus Amsterdam wurde mir die Aufforderung (mit Einzahlungsschein) zugeschickt, soundso viele Gulden auf sein Konto einzuzahlen. Er brauche diesen Vorschuss, um die Scheidung von Frau XY voranzutreiben. Diese sei entschlossen, ihren Mann zu verlassen und sich mit Herrn G. zu verheiraten. Das war wahrhaft dicke Post. Wenig später rief mich die Wirtin eines Seeländer Restaurants an. Ein gewisser G., den ich offenbar kenne, habe ihrer Tochter den Kopf verdreht. Sie selber traue aber der Sache gar nicht. Wir vereinbarten ein Gespräch, in Anwesenheit der Tochter. Das fand anderntags statt. Ich muss gestehen, dass ich dabei meine Schweigepflicht ziemlich strapazierte und die Tochter deutsch und deutlich warnte vor einer Verbindung mit diesem Herrn. Sie glaubte mir nicht. Aber das war nicht weiter schlimm, weil G. nicht mehr in der Gegend und schon gar nicht im besagten Restaurant aufkreuzte. Immer neue fiese Geschichten tauchten auf. So erzählten mir die Einheimischen, G. habe sich in den Wirtschaften gross aufgespielt. Einmal behauptete er, er sei mein Cousin. Oder er sei mit Res (so mein gängiger Vorname) seit dem Gymnasium befreundet. In einem Bauerndorf gab er sich als Tierarzt aus, und erteilte kluge Ratschläge. Eine Wirtin, die mit ihrer Tochter Probleme hatte, erzählte ihm schon am ersten Abend die vertraulichsten Einzelheiten. Mir hatte diese Mutter zwar auch davon erzählt, aber erst nach mehreren Besprechungen. Es war unglaublich, wie G. die Menschen um den Finger zu wickeln vermochte. Er konnte sehr gut reden, hatte ein flottes Auftreten, gab sich weltgewandt und gleichzeitig einfühlsam. Alles vorzügliche Eigenschaften für seine lange Karriere als Hochstapler. Von vielen Hochstapeleien vernahm ich erst, als er – von der Polizei gesucht – nach Deutschland abgetaucht war. Da brachte nämlich der «Blick» einen seitenlangen Artikel über mein Mündel, natürlich mit einem Porträt. Ich selber kam in besagtem Artikel auch vor. Zwar wurde mein Name nicht genannt. Aber man schrieb unter anderem: G. sei aus Witzwil abgehauen und habe «in einem Pfarrhaus in Erlach» Unterschlupf gefunden. «Als ihm dort der Boden zu heiss wurde, setzte er sich Richtung Deutschland ab.»
Nachdem ich die Vormundschaft abgegeben hatte, war mir wesentlich leichter. Meine Kinder, die die ganze Geschichte dosiert erzählt bekamen, waren irritiert. Sie hatten G. ja in guter Erinnerung. Der sollte so böse Sachen gemacht haben? Wem konnte man denn überhaupt trauen? Regine, etwa fünfjährig, zog ihre Schlüsse. Wenn sie einmal heirate, wolle sie diesen Mann zuvor uns Eltern zeigen. Sie möchte nämlich keinen Räuber zum Mann haben.
Natürlich nahm es mich wunder, wie es mit G. weitergegangen war. Eine kleine Zeitungsnotiz verriet, er sei in Deutschland verhaftet worden und sitze irgendwo im Brandenburgischen in Untersuchungshaft. Was vor der Verhaftung geschehen war, kam erst später und stückchenweise zu meiner Kenntnis. Eine erste Episode spielte sich in Hamburg ab. Dort sprach G. im Polizeipräsidium vor. Er wies sich, wahrscheinlich mit besagtem Visitenkärtchen, als Journalist und Mitarbeiter des «Berner Tagblatt» aus. Er habe den Auftrag, für seine Zeitung eine Reportage über die Reeperbahn und das dortige Rotlichtmilieu zu schreiben. So begründete er den kecken Auftritt. Offenbar schenkte man ihm Glauben, ohne seine Legitimation zu überprüfen. Jedenfalls habe man ihn im Streifenwagen kreuz und quer durch das Quartier geführt. Die Reportage ist nie publiziert worden. Wiederum eine Zeitlang später stiess ich auf eine letzte G. betreffende Pressemeldung. Er sei von einem Gericht in einer mitteldeutschen Stadt zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt worden. Grund der Anklage war unter anderem der Diebstahl einer Kreditkarte, die er zum Kauf einer neuen Garderobe benützt habe. Bei seinen Delikten war es nie um astronomische Summen gegangen. Oft hatte es sich um Dinge gehandelt, die er ohne weiteres selber hätte berappen können. Zum Beispiel den Blumenstrauss, den er nach der Geburt seines einzigen Kindes seiner Frau ins Spital gebracht hatte. Wunderschöne Rosen, leider nie bezahlt. Von dieser himmeltraurigen Episode erzählte mir übrigens seine Schwester – sie war eine im Schweizer Showbusiness bekannte Persönlichkeit. Mit all den wiederkehrenden Betrügereien hatte er auch jene Menschen bodenlos enttäuscht, die ihm ursprünglich nahe gestanden waren. Traurig für sie, traurig für ihn, traurig für alle.
Schlussendlich berichte ich gern noch über einen ganz anderen Aspekt meiner Tätigkeit als Gefängnispfarrer, nämlich über die nationalen Kontakte mit Menschen und Institutionen im Bereich Strafvollzug.
Die Direktoren aller Schweizer Gefängnisse versammelten sich jedes Jahr irgendwo im Land zu ihrer Jahresversammlung. Jedes zweite Jahr nahmen sie auch uns Gefängnispfarrer mit. So lernte man Berufskollegen kennen, aber auch die Chefs anderer Strafanstalten. Zum Beispiel Vater und Sohn Werren vom Thorberg oder Direktor Burren von der Strafanstalt Lenzburg. Sehr interessante Herren mit immenser Erfahrung im Strafvollzug. Am Samstag tagten Pfarrer und Direktoren je für sich. Ich fand die verschiedenartigen Persönlichkeiten der Pfarrkollegen richtig spannend. Da war der welsche Pasteur Hemmeler aus Bern, ein grossartiger Causeur, der jeden und alles kannte, meist gut gelaunt und als Langjähriger ein Mann mit einer immensen Erfahrung. Wie er wohl auf seine Klienten gewirkt hat? Andere Kollegen gehörten in die Kategorien «gewissenhaft» oder «linkisch» oder «schwerblütig und ernst» oder «schneller Problemlöser». Am Samstagabend waren alle zu einem Bankett eingeladen, wobei der Regierungsrat des einladenden Kantons nicht fehlte. Meistens war ein Teil des Abends auch der Unterhaltung gewidmet. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Zauberkünstler, der wirklich hervorragend und verblüffend agierte. In der Regel besuchte man gemeinsam Einrichtungen des Strafvollzugs. Zum Beispiel war die in St. Gallen stattfindende Tagung verbunden mit dem Besuch der neueröffneten Strafanstalt Saxerried im Rheintal. Mir machte diese Anstalt einen enormen Eindruck. Zum Beispiel punkto Architektur. Die Fassaden, aber auch die Innenräume hatten einen hellen, fast weissen Farbanstrich. Wenn ich das mit der düstern Kaserne in Witzwil verglich! Die Fenster waren nicht vergittert. Die extrasoliden bruchsicheren Fenster böten genug Sicherheit, sagte man uns. Interessant waren auch die Therapieangebote. Wenn ich mich recht erinnere, gab es zum Beispiel schon Selbsterfahrungsgruppen (vielleicht TZI?). Oder die Möglichkeit, in der Freizeit Tiere zu pflegen, Esel, Ziegen und Schafe zum Beispiel. Also Tiertherapie. Jedenfalls zeugte fast alles von einem offenen, nichtrepressiven Geist. In besonderer Weise beeindruckte mich das Atelier, das für Maltherapie eingerichtet war. Der Maltherapeut erklärte die grosse Bedeutung des Umgangs mit Farben. Fein abgestimmte Farbübergänge zu malen sei speziell für Gewalttäter und insbesondere für Vergewaltiger ganz wichtig. Das sei ja eben deren Problem: dass sie ihre feinen Emotionen zu wenig oder überhaupt nicht hätten entwickeln können. Dagegen lasse sich mit Maltherapie etwas tun. Mir wurde aber auch bewusst, dass diese Art des Strafvollzugs wahrscheinlich auch anders ausgebildete und anders strukturierte Angestellte bräuchte. Und das Volksempfinden müsste sich wandeln – weg vom Rache- und Vergeltungsprinzip. Weg von der Verunglimpfung aller Reformbemühungen als sogenannte «Kuscheljustiz».
Mit meinem Wechsel nach Thun endete die höchst interessante, anspruchsvolle Arbeit als Gefängnispfarrer. Drei- oder viermal habe ich Witzwil in den folgenden Jahren noch besucht. Für Fussballspiele unserer Thuner Freizeitmannschaft gegen den FC Witzwil. Bei meinem letzten Besuch war die alte «Kaserne» abgebrochen. An ihrer Stelle standen kleinere, freundlich eingerichtete Wohneinheiten. Mindestens architektonisch hatte die Neuzeit Einzug gehalten.

Russland - weites Land
Wie es anfing
Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, stelle ich fest: immer wieder taucht das Thema Russland auf, in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen und in allen Lebensabschnitten. Es begann schon Jahre vor meinem Schuleintritt. Wie im Kapitel «Fantasiewelten» dargelegt, habe ich meinen Schwestern und wohl auch meiner Mutter von einem früheren Leben in Russland erzählt. Sie haben sich bestimmt über meine Geschichten amüsiert. Aber ausgelacht haben sie mich nie. In der Rückschau finde ich sie selber amüsant, aber auch eigenartig, ja, rätselhaft. Ich glaube nicht an die Wiedergeburt und esoterische Spekulationen sind mir fremd. Auf die Frage, warum ich ausgerechnet auf dieses so ferne Russland gekommen bin, weiss ich keine Antwort. Als Gymnasiast lernte ich in meiner weit verzweigten Verwandtschaft einen «Onkel» kennen, der sich mit Familienforschung, Volkskunde und Geschichte befasste. Onkel Fritz (Haas) erzählte mir, unsere Vorfahren seien möglicherweise ukrainische oder russische Juden gewesen, die in den Westen emigriert seien. Auch meine Grossmutter väterlicherseits stammte aus der Haas-Verwandtschaft. Sollte denn in meinen Adern ein kleines Quäntchen russisches Blut fliessen? Se non e vero e ben trovato.
In meiner Kindheit hatte ich natürlich keine Ahnung von derartigen Spekulationen. Auch war der grosse Krieg noch nicht ausgebrochen und der Russlandfeldzug stand erst bevor. Wer redete in unserer kleinen Welt schon von diesem weiten Land? Irgendwo muss ich aber das Stichwort aufgegabelt und in meinen Fantasien entwickelt haben. Mag sein, dass ich aus Gesprächen meiner Eltern etwas aufgeschnappt habe. Beide waren Bücherleser. Jedenfalls stelle ich im Nachhinein fest: auf irgendeine merkwürdige Weise ist mein Leben mit Russland verknüpft. Das änderte sich auch in den Jahrzehnten des kalten Krieges nicht, als nur der als guter Schweizer galt, der Russland und die Russen verdammte oder zumindest fürchtete. Und heute, im Alter, sind meine Beziehungen zu Russland und zu russischen Menschen vielfältiger denn je.
In den Jahren des zweiten Weltkriegs kam am Mittagstisch Russland oft zur Sprache, speziell natürlich der Russlandfeldzug. Während oder nach dem Mittagessen, punkt 12 Uhr 30, wurde das Radio eingeschaltet. Gegenüber dem Esstisch, an der Stubentür, hing eine Europakarte. Auf der linken Seite die zahlreichen, zum Teil winzigen Länder Westeuropas. Mittendrin, verschwindend klein, das grün eingefärbte Schweizerländchen. Auf der rechten Seite, interessanterweise ebenfalls in Grün, dehnte sich das riesige Russland aus. Wir sprachen damals kaum von der Sowjetunion, immer nur von Russland. Der Russlandfeldzug Hitlers und dann vor allem der Rückzug wurde genau verfolgt und mit Stecknadeln markiert. Einzelne Stichworte wie «Schlacht um Stalingrad» oder «Blockade Leningrads» haben sich meinem Gedächtnis eingeprägt. War man früher als bodenständiger Schweizer ein strikter Gegner Russlands gewesen, weichte sich die Antihaltung etwas auf. Man war froh, dass die bösen Kommunisten dem noch viel böseren Hitler die Stange hielten. Doch diese Phase des Umdenkens dauerte nicht lange. Kaum hatte Deutschland kapituliert, zeigte das Bündnis der Sieger Risse. Das Blockdenken nahm überhand. Bald beherrschten Schlagwörter wie «Kalter Krieg» und «Eiserner Vorhang» das Feld.
Eine weitere «Begegnung» mit Russland erfolgte in der 4. oder 5. Primarklasse, als uns der Lehrer am Ende einer Schulwoche Tolstois Volkserzählungen vorlas. Ich habe es im Kapitel Schulgeschichten bereits kurz erwähnt. Ich erinnere mich insbesondere an die Erzählungen «Gefangen im Kaukasus» und «Wie viel Erde braucht der Mensch». Letztere handelt von Pachom, einem Bauern, der weit in den Osten Russlands auswanderte. Er hatte gehört, die dort lebenden Baschkiren verfügten über riesige Ländereien und seien bereit, grosse Flächen ganz billig zu verkaufen. Tatsächlich zeigten sich die Baschkiren zu einem Handel bereit. So viel Land, wie er vom -Sonnenaufgang bis zum Untergang zu umschreiten vermöge, solle ihm gehören. Grossartig! Unterwegs erblickte Pachom hier ein fruchtbares Landstück und dort ein Wäldchen oder das Quellgebiet eines Baches, das er auch noch haben wollte. Derweil sank die Sonne immer tiefer. Genau bei Sonnenuntergang und atemlos erreichte er den Ausgangspunkt. Erschöpft sank er auf die Erde und starb. Der Knecht schaufelte ihm ein Grab, legte den Meister in die Grube und dachte: So viel Erde braucht der Mensch. Diese Geschichte habe ich nie vergessen. Damals, in der Jugend, fand ich sie einfach unglaublich spannend. Später fesselten mich vor allem die Einfachheit und die Wucht dieser Menschheits-Parabel. Nachdem mir die Mutter die gesammelten Volkserzählungen Tolstois geschenkt hatte, ging es mir fast mit jeder Geschichte ähnlich. In ihrer Schlichtheit berühren sie ganz zentrale Fragen des menschlichen Lebens und behalten ihre Gültigkeit selbst in einer globalisierten und digitalisierten Welt.
Ein paar Jahre danach erfuhr mein Interesse für Russland einen weiteren Schub. Gute Bekannte unserer Familie, die in Paris lebten, wollten ihrem Söhnchen Ferien in gesunder Landluft und bei währschafter Kost bieten. Der kleine Gerard, bleich und mager, hatte es wirklich nötig. Nach den Ferien brachte ich ihn – gut genährt und glücklich – nach Paris zurück und durfte eine ganze Woche Grossstadtluft schnuppern. Der Louvre war eines der Ziele. Einen ganzen Tag lang verbrachte ich in diesem grossartigen Museum. Eines Abends nahmen mich meine Bekannten mit zu einer Vorstellung im Casino de Paris. Was für eine Wucht! Noch nie im Leben hatte ich eine halb- oder ganz nackte Frau gesehen. Es faszinierte mich total. Gleichzeitig genierte ich mich, ganz im Gegensatz zu meinen Gastgebern, die das alles absolut normal fanden. Als im Verlaufe der Vorstellung das Golden-Gate Quartett auftrat und einige wunderbare Spirituals vortrug, glättete sich mein seelischer Aufruhr. Nobody knows the trouble I’ve seen but Jesus… Die Sänger hatten sozusagen ein moralisches Gleichgewicht hergestellt. Am nächsten Tag kamen zwei befreundete Damen zu Besuch, Mutter und Tochter. Die junge Frau fragte, ganz nebenbei und kühl, ob am gestrigen Abend viele Nackte aufgetreten seien. Schon wieder genierte ich mich und errötete vermutlich. Zum Glück kam ein anderes Thema zur Sprache. Die zwei Damen waren nämlich russische Emigrantinnen, die schon gut zwei Jahrzehnte in Paris lebten. Im Lauf der Woche vernahm ich, dass sie vor der Emigration recht wohlhabend gewesen seien und dem einfachen Landadel angehört hatten. Jetzt bewohnten sie eine winzige Einzimmerwohnung. Um Platz zu gewinnen, klappten sie die zwei Betten tagsüber auf und befestigten sie an der Wand. Ein kleines Rechaud zum Kochen, Kisten mit Kleidern und Haushaltgeräten vollgestopft, ein paar Stühle – das war die ganze Einrichtung. Trotz ihrer offensichtlichen Armut strahlten sie eine bewundernswerte Würde aus. Die Mutter hatte natürlich keine Altersversicherung. Für den Lebensunterhalt mussten der schmale Verdienst der Tochter sowie der sparsame Verkauf von Wertgegenständen genügen. Offenbar hatten sie einigen Schmuck, Silberbesteck und Ikonen ins Exil mitnehmen können. Aber nach mehr als zwanzig Jahren war wohl nicht mehr allzu viel übriggeblieben.
Der Zufall wollte es, dass ich auf einem Spaziergang durch die Stadt auf eine Russisch-orthodoxe Kirche stiess. Das Portal war halb geöffnet. Aus dem Innern drangen eigenartig klingende Stimmen nach draussen. Zögernd betrat ich das Gotteshaus. Die Zahl der Kirchenbesucher schätzte ich auf zwei Dutzend – gewiss keine imposante Zahl. Zumeist ältere Frauen in Kopftüchern. Was mich jedoch sofort in den Bann zog, war die Stimmung. Vorne die goldgeschmückte Ikonenwand, von vielen Kerzen beleuchtet. Zwei Männer in feierlichen liturgischen Gewändern, Priester und Diakon. Im Halbdunkel ein Chor, der im Wechsel mit dem Priester der dem Diakon Gesänge vortrug, so feierlich, so ergreifend, wie ich sie noch nie gehört hatte. Es erging mir wohl wie jener Gesandtschaft, die Grossfürst Vladimir von Kiew nach Byzanz geschickt hatte. Bei ihrer Rückkehr meldeten sie, sie hätten dort so wunderbare und ergreifende Gottesdienste erlebt, dass es ihnen vorkam, als hätten sie das Paradies geschaut. Darauf habe sich Vladimir entschlossen, das Christentum byzantinischer Prägung in Russland einzuführen. Bei mir kam es freilich nicht so weit, dass ich die Konfession gewechselt hätte. Aber die Faszination der russisch-orthodoxen Liturgie hat mich damals ergriffen und nie mehr ganz losgelassen.
Als Gymnasiast und als Student vertiefte ich mich in die Werke Tolstois. «Krieg und Frieden» fesselte mich mindestens so sehr wie die geliebten Volkserzählungen. Wer sich für Russland und für Literatur interessiert, kommt selbstverständlich nicht an Fjodor Dostojewskij vorbei. Der Idiot im gleichnamigen Roman, Aljoscha in den «Brüdern Karamasow» und der Starez Sossima beeindruckten mich in besonderer Weise. Wenn ich heute nach Russland reise, besuche ich wenn immer möglich das Kloster Optina Pustyn. Dort war Dostojewski (wie übrigens auch Tolstoi und Gogol) verschiedentlich zu Besuch. Ohne einen Namen zu erwähnen beschreibt er in den «Brüdern Karamasow» akribisch diese grossartige Klosteranlage, ebenso die bescheidene Einsiedelei, wo Starez Amvrossi lebte und starb, das Ur- und Vorbild des Sossima.
Während des Studiums begann ich mich auch mit der russischen Kirchengeschichte zu beschäftigen. Dieses Interesse wurde durch die Begegnung mit den Professoren Arsenjew in Bonn und Fritz Lieb in Basel verstärkt. Den Anfang der russischen Kirchengeschichte machte, wie gesagt, der Beschluss des Grossfürsten Wladimir, das byzantinische Christentum einzuführen. Dieser Anfang war total und brutal. Wladimir befahl die ganze Bevölkerung von Kiew ans Ufer des Dnjepr. Dann wurde die vieltausendköpfige Menge in den Fluss gejagt und von importierten Mönchen aus Byzanz in die trüben Fluten getaucht. Mit dieser Massentaufe 988 n.Ch. begann die Geschichte der russisch-pravoslavischen Kirche. Ein ebenso einschneidendes Ereignis fand im 17. Jahrhundert statt. Patriarch Nikon befahl, alle liturgischen Bücher zu korrigieren. An sich war dieser Befehl verständlich, da es in diesen Büchern von Übersetzungsfehlern wimmelte. Aber im Volk, allen Veränderungen abhold, regte sich Widerstand. Die kirchliche wie die weltliche Obrigkeit wollten die Reform mit Gewalt durchpeitschen, was zu einer regelrechten Kirchenspaltung führte. Die Tragik dieser Spaltung scheint mir darin zu bestehen, dass es sich bei vielen Differenzen zwischen der offiziellen Kirche und den Altgläubigen um geringfügige Einzelheiten handelte. Soll eine Prozession um die Kirche im Uhrzeigersinn stattfinden oder gegen den Uhrzeiger? Soll das Halleluja dreimal oder zweimal gesungen werden? Streitpunkte waren auch die Schreibweise des Namens Jesu - Isus oder Iisus? Sind bei der Bekreuzigung zwei oder drei Finger zu krümmen? Die Auseinandersetzung nahm einen blutigen Verlauf. Der Zar unterstützte Patriarch Nikon mit allen Mitteln. Unzählige Altgläubige wurden nach Sibirien verbannt. Ihre Anführer, zum Beispiel Avvakum, wurden verbrannt. Wer überlebte, zog sich in die unendlichen Wälder Sibiriens zurück.
Diese wüste Geschichte veranlasste mich, einer auch im Westen brisanten Frage nachzugehen. Wie steht es um das Verhältnis zwischen Thron und Altar? Anders gefragt: was geschieht mit einer Kirche, die bloss ein Werkzeug des Herrschers beziehungsweise der Staatsmacht ist? Wie wichtig ist das Widerstandsrecht? Ich trug mich eine Zeitlang mit dem Gedanken, zu diesem Thema eine Dissertation zu schreiben. Doch zu Vieles sprach schliesslich dagegen. Diese Arbeit hätte mein Studium verlängert. Für das Quellenstudium hätte ich wohl Russisch und Kirchenslavisch lernen und einige Zeit in Russland verbringen müssen. Vom ganzen Plan blieb schliesslich nur ein Zettelkasten übrig. Den habe ich inzwischen frohgemut entsorgt.
Im Pfarramt fehlte mir dann die Zeit, mich mit dem Thema Russland eingehend zu befassen. Zu viele verschiedenartige und anforderungsreiche Aufgaben hatte ich zu bewältigen. Allein die Predigtvorbereitung beanspruchte viel Zeit, wohl acht oder zehn Stunden und mehr – und dies jede Woche. Erfahrene Kollegen belächelten mich deswegen. Aber ich konnte einfach nicht anders. Dazu kamen der Unterricht, Haus- und Krankenbesuche, Bestattungen, Tauf- und Traugespräche. Doch trotz alledem gärte es in meinem Seelengrund. Diese eigenartige Russophilie liess mich einfach nie ganz los. Wenigstens in der Lektüre konnte ich ihr frönen. Nach einer Dostojewski-Phase kehrte ich wieder zurück zu Lew Tolstoi. «Anna Karenina», «Auferstehung», die furchtbar irritierende «Kreuzersonate». Und immer wieder «Krieg und Frieden». Wahrscheinlich habe ich wiederholt den Wunsch geäussert, diesen Roman aller Romane in der Originalsprache zu lesen. «So mach dich doch daran und lerne Russisch», sagte meine Frau. Die Migros-Klubschule in Biel offerierte einen Kurs für Anfänger. Ich meldete mich an. Das Interesse war damals, l966 oder 67, recht gross. Ein gutes Dutzend Lernwillige versammelte sich. Ich wunderte mich, war doch die Russophobie damals, mitten im kalten Krieg, allgegenwärtig. Als Lehrerin wirkte eine ältere Dame, Madame Judin. Sie war in jungen Jahren in die Schweiz emigriert, hatte einen Arzt geheiratet und war längst verwitwet. Sie empfahl uns ein russisch-französisches Lehrbuch (Nina Potapova). Wir machten uns daran, das kyrillische Alphabet und ein paar einfache Wörter zu lernen. Am zweiten Abend fehlten zwei Kursteilnehmer. In der Folge lichtete sich die Gruppe immer mehr. Schliesslich, als das Grüpplein auf drei Unentwegte geschrumpft war, gab Frau Judin auf. Ein halbes Jahr später wiederholte die Migros das Angebot. Der Schrumpfprozess wiederholte sich. Madame Judin erklärte sich bereit, mir Privatstunden zu erteilen. So reiste ich alle zwei oder drei Wochen nach Bern. In ihrer heimelig-altmodischen Wohnung im Kirchenfeld arbeitete ich mich nach und nach durch das dicke Grammatikbuch der Potapowa. Frau Judin war keine gelernte Sprachpädagogin. Sie unterrichtete ihre wenigen Privatschüler, um Kontakt zu haben und ihre Witwenpension etwas aufzubessern. Sie korrigierte meine Aussprache viel zu wenig. Ich selber kam selten zum Reden. Das besorgte meine Lehrerin selber. Dabei kam ich immerhin in den Genuss zahlreicher Geschichten aus der Zeit vor der Revolution. Frau Judin war in Tjumen jenseits des Ural geboren und aufgewachsen. Ihr Vater, Advokat und Bürgermeister, reiste öfter nach Moskau, zunächst auf dem Fluss Tura bis zur nächsten Bahnstation Jekaterinenburg, und von dort mit der Eisenbahn nach Moskau. Einmal durfte ihn meine Lehrerin begleiten - ein gewaltiges Erlebnis für das Mädchen. Während der Flussfahrt, es ging gegen Abend, sei am Bug des Flussdampfers eine grosse, in einen schwarzen Mantel gehüllte Gestalt gestanden. Ohne sich zu bewegen, eine schwarze Silhouette vor dem Abendhimmel. Wer das sei, fragte sie den Vater. Das sei Rasputin, wohl auf dem Weg in die Hauptstadt, zur Zarenfamilie, antwortete der Vater. Für ihn war dieser Mann einfach ein Bauer aus dem benachbarten Gouvernement Tobolsk, mit dem er gelegentlich beruflich zu tun hatte. Auf seine Tochter machte Rasputin bei ihrer ersten und einzigen Begegnung einen tiefen Eindruck.
Die jahrelangen und regelmässigen Stunden versetzten mich trotz allen Defiziten in die Lage, mit der Lektüre von «Krieg und Frieden» zu beginnen. Ich gestehe wohl, dass neben dem russischen Original eine deutsche Übersetzung auf meinem Schreibtisch lag. Die vielen mir unbekannten Vokabeln im Wörterbuch nachzuschlagen, hätte einen enormen Zeitaufwand erfordert. Auch auf diese «billige» Art, so schien es mir, sei ich mit der Zeit in die Lebens- und Denkwelt Tolstois eingedrungen. Die geschichtsphilosophischen Abschnitte durchmass ich allerdings ziemlich rasch. Sie dünkten mich – milde ausgedrückt – sehr speziell. Hingegen fand ich die Erzählkunst Lew Tolstois einfach grossartig. Zum Beispiel den wunderbaren, grosszügigen Erzählfluss und zwischenhinein das Verweilen bei wichtigen Détailschilderungen. Oder die Darstellung der Personen: Pierre, Fürst Andrej, Natascha Rostowa, General Kutusow. Und die liebevolle Art, mit der er die Bauern und ihr einfaches Leben zeichnete.
Natürlich hatte ich stets im Sinn, Russland zu bereisen. Für 1968 plante ich eine Studienreise mit der Gesellschaft «Audiatur». Sie musste abgesagt werden, wegen des sowjetischen Einmarschs in Tschechien und der gewaltsamen Unterdrückung des Prager Frühlings. Ostreisen schienen im Moment nicht ratsam zu sein. Der zweite Versuch zehn Jahre später brachte mir mehr Glück. Ein guter Bekannter, promovierter Mathematiker, russlandinteressiert wie ich, hatte sich erfolgreich um ein Stipendium an der Moskauer Akademie der Wissenschaften beworben. Um ihn zu besuchen, buchte ich eine Städtereise. Zwei Drittel der zusammengewürfelten Gruppe harmonierten bestens. Der Rest, lauter Welschschweizer, sonderte sich ab. Im Laufe der Woche merkten wir, dass die Miteidgenossen allerlei nicht ganz gesetzeskonformen Geschäften nachgingen. Vor der Heimreise wollten sie uns zum Beispiel überreden, Kaviar zu schmuggeln, was verboten war. Wir Deutschschweizer waren brav mit der Reiseführerin von Intourist unterwegs, fotografierten weder Brücken noch Bahnhöfe, was auch verboten war, und tauschten auf dem Schwarzmarkt nur ganz wenige Rubel, was allerdings auch nicht erlaubt gewesen wäre. Oft waren wir mit Jürg unterwegs, meinem Bekannten. Inzwischen hatte er schon ein halbes Jahr in Moskau verbracht und konnte uns Dinge zeigen oder erklären, die uns die Reiseleiterin nach Möglichkeit vorenthielt. Moskau, insbesondere der städtebauliche Komplex Kreml und Roter Platz, beeindruckte uns enorm. Schräg gegenüber stand unser Hotel, das inzwischen abgerissene Rossia. Dieser hässliche Koloss bildete ein Quadrat mit einer Seitenlänge von schätzungsweise 200 Metern. Das Rossia verfügte über 6000 Betten. Man konnte sich darin leicht verirren. Das ist übrigens Jahre später meiner Jüngsten, Kathrin, passiert. Wir warteten bei einem der vier Haupteingänge auf den Bus. Da bemerkte sie, dass sie im Zimmer etwas vergessen hatte. Schnell huschte die Zweitklässlerin davon. Es dauerte lange, sehr lange, bis sie wiederauftauchte und uns, den zitternden Eltern, schluchzend in die Arme fiel.
Bei meinem ersten Moskaubesuch traf ich eines Abends vor dem Hotel Jean Ziegler, den ich flüchtig kannte. Wir unterhielten uns über «unser» Thun und über den Grund unserer Moskaureise. Er war verabredet mit einem russischen Professor, mit dem zusammen er ein Buch herausgeben wollte. Für unsern letzten Abend hatte Intourist zwei Tische im schicken historischen Hotel National reserviert, mit Kerzenlicht und einem kleinen, gediegenen Folkloreorchester. Der Abschied von Moskau verlief recht interessant. Alle Gruppenmitglieder, inklusive die Welschen mit Kaviar und wohl noch andern unerlaubten Dingen, passierten den Zoll am Flughafen ohne Probleme. Dann war ich, der so Unschuldige, an der Reihe. Und siehe da: mich nahmen sie in die Mange. Der gesamte Inhalt meines Koffers wurde lieblos auf einen Tisch geleert. Stück um Stück wurde untersucht. Die Zöllner tasteten sämtliche Hosennähte genauestens ab. Im Necessaire interessierten sie besonders die Zahnpasta und die Handcreme-Tube. Sie fanden weder Kaviar noch Kokain noch Sprengstoff. Ich hatte das Vergnügen, den ungeordneten Haufen wieder in den Koffer zu stopfen. «Ausgerechnet dich haben sie herausgepflückt», trösteten mich meine deutschschweizerischen Reisegefährten und -gefährtinnen. »Dich Unschuldigen hat es erwischt und die (vermutlich) Schuldigen sind ohne Wimperzucken durchmarschiert». So ist halt die arge, schnöde Welt!
Geistliche Akademie Leningrad
In den Achtzigerjahren hat die gute alte Berner Kirche gemerkt, dass es eventuell sinnvoll sein könnte, ihren Mitarbeitern nebst den Weiterbildungskursen auch einen Studienurlaub anzubieten. Natürlich nur einmal während den durchschnittlich 40 Dienstjahren, und selbstverständlich nicht länger als drei Monate. Immerhin, dachte ich mir. Das ist besser als nichts. Man hatte ein vom Kirchgemeinderat genehmigtes Urlaubsgesuch einzureichen, die Stellvertretung zu organisieren und ein Studienprogramm zu präsentieren. Ich musste nicht lange überlegen. Die russisch-pravoslavische Kirche verfügt für die Ausbildung ihrer Priester und Theologen über eigene Ausbildungsstätten, zum Beispiel im berühmten Sagorsk (heute Sergeijew Possad), einer Klosterstadt nördlich von Moskau. Gern würde ich für einige Zeit in diese interessante fremde Welt eintauchen. Wenn ich mich recht erinnere, schickte ich eine entsprechende Anfrage an die Vertretung der russischen Kirche beim Oekumenischen Rat der Kirchen in Genf. Den Leiter der Mission, Bischof Sergius, hatte ich früher einmal besucht, um mit ihm über die Frage «ökumenische Trauungen» zu sprechen. Er bestätigte, meinen Brief erhalten zu haben. Dann hörte ich lange nichts mehr. Schliesslich, als die Zeit langsam knapp wurde, wandte ich mich an Heini Rusterholz, Präsident des Schweizerischen Kirchenbundes. Ich wusste, dass er als Mitglied der Europäischen Kirchenkonferenz mit dem Metropoliten von Leningrad bekannt war. Wieder verging viel Zeit, während der ich mich intensiv mit Russisch beschäftigte. Frau Judin war inzwischen verstorben. Aber ich fand in Thun eine russische Dame, die mit mir Konversation büffelte. Knapp drei Wochen vor Beginn meines Urlaubs erhielt ich ein Telegramm der Geistlichen Akademie Leningrad. Man erwarte mich zum Beginn des Unterrichtsjahres, am 1. September 1988. Eigentlich war ich ganz froh über das neue Ziel. Die Akademie Leningrad hatte den Ruf, freier und weltoffener zu sein als Sagorsk. Nun galt es, Visum und Flugticket zu beschaffen und den Koffer zu packen. Am Zoll in Leningrad hatten die Beamten ein Problem mit meiner Bibel, aber auch mit dem schon reichlich zerschlissenen Lehrbuch von Nina Potapowa. Sie blätterten das dicke Buch mit zahllosen handschriftlichen Einträgen vorwärts und rückwärts durch. Ich hatte den Eindruck, eben diese Notizen würden sie verunsichern. Ob sie zu viele Spionagefilme gesehen hatten? Schlussendlich gaben sie mir das geheimnisvolle Buch kommentarlos zurück. Auch die Bibel gaben sie endlich frei, allerdings mit der dringenden Mahnung, dieses gefährliche Buch wieder mit nach Hause zu nehmen. Das werde bei meiner Ausreise kontrolliert. In der Halle des kleinen Flughafens Pulkowo wartete ein schwarz gekleideter Herr auf mich. Er stellte sich vor als Vater Andrej (Priester werden so angesprochen. An der Akademie nannten sie dann auch mich Vater Andrej, da dich immerhin ein ordinierter Pfarrer war). Der Leningrader Vater Andrej erklärte, er sei für die ausländischen Studenten zuständig. Er führte mich durch die Räumlichkeiten der Akademie, das Refektorium, die Kirche, das Sekretariat und schliesslich in das Zimmer, in dem ich einige Zeit leben würde. Es war gewöhnungsbedürftig. Zwischen den zwei Betten ein schmaler Gang. Vor dem Fenster ein Brett und zwei Stühle: die Studienplätze. Der Schrank war bereits vollgestopft mit den Kleidern meines künftigen Zimmergenossen. Auf meinen Erkundungsgängen traf ich in der Eingangshalle viele junge Männer, die vor einer Glasvitrine standen. Die Einen waren offenbar vom Gelesenen hoch erfreut, sie strahlten und klopften einander auf die Schulter. Die Anderen schienen tief betroffen, etliche von ihnen verliessen das Haus unter Tränen. Bald fand ich des Rätsels Lösung. In der Vitrine hing eine lange Liste mit den Namen derer, welche die Aufnahmeprüfung bestanden hatten. Ich glaube, es waren ihrer vierzig. Auf dem anderen mindestens ebenso langen Verzeichnis fanden sich die Namen der tief enttäuschten Abgewiesenen.
(1) Aufnahmeprüfung an der geistlichen Akademie Leningrad
Die grosse Zahl der Bewerber machte mir schon Eindruck. Hatte man an unseren theologischen Fakultäten im Westen je von einem derartigen Andrang gehört? Im Verlauf meines Aufenthalts erfuhr ich Einiges über die Hintergründe. Ein erheblicher Teil der Bewerber hatte bereits einen Universitäts-Abschluss, auffallend viele in naturwissenschaftlichen Fächern. Längst nicht alle stammten aus traditionell gläubigen Familien. Sehr oft nannte man mir als Grund für das Interesse an der Theologie die Lektüre: Dostojewski. Ein Jahrhundert nach seinem Tod ist er offensichtlich immer noch ein ganz wichtiger Motivator.
Ich schiebe hier eine kurze Sachinformation ein. An der geistlichen Akademie und am Seminar studierten etwa 300 junge Männer. Die meisten absolvierten in vier Jahren das Seminar und konnten dann als Priester eingesetzt werden. Eine viel kleinere Zahl setzte die Studien an der Akademie fort. Aus ihnen rekrutiert die Kirche ihre Professoren, die höhere Geistlichkeit und die höheren Beamten in der kirchlichen Administration. Eine Besonderheit der Leningrader Akademie bestand darin, dass ihr eine Abteilung für die Ausbildung von Chordirigentinnen angegliedert war. Diese jungen Damen traf man im Refektorium und in den Gottesdiensten an, auch in den Gängen, wo sie zuweilen ganz nett mit den Studenten schäkerten. Man sagte mir (vertraulich), diese Begegnungen und allfällige Liebschaften seien keineswegs unerwünscht. Wenn ein frischgebackener Priester irgendwo in ein entlegenes Dorf geschickt werde und eine Frau als Chordirigentin mitbringe, sei das kulturell, spirituell und kirchenpolitisch von höchstem Nutzen. Die Gottesdienste und die Essenszeiten gaben dem Tag und der Woche eine klare Struktur. Zentral war die Liturgia – der Sonntagsgottesdienst. Zwei ausgezeichnete aus Studenten und Studentinnen gebildete Chöre verliehen ihm ein festliches Gepräge. Die Priester unter den Professoren beteiligten sich, in den zum Kirchenjahr passenden Prachtgewändern, an der Leitung des Gottesdienstes. Eingeladen waren auch die Menschen der umliegenden Quartiere. Es erschienen nicht nur alte Frauen, sondern auch Junge und ganze Familien. In Erinnerung ist mir ein junger Mann, der jeden Sonntag mit seinem Söhnchen von Anfang bis zum Schluss am Gottesdienst teilnahm. Meistens trug er das Kind auf den Schultern. Zwischenhinein trippelte es durch die Menge, um sich schliesslich wieder an Vaters Beine zu schmiegen. Nie hat es während den zwei Stunden geweint oder über Langeweile geklagt. In den russischen Kirchen gibt es weder Stühle noch Bänke. Es kostete mich anfänglich ziemliche Anstrengung, stundenlang zu stehen. Wenn ich aufgeben wollte, beobachtete ich die alten Mütterchen, die unentwegt ausharrten, sich fleissig bekreuzigten, oft auf die Knie sanken, um sich dann wieder aufzurappeln. Im Verlauf der Liturgia wird die christliche Botschaft nicht nur in vielfältigen Gesängen und einer – meist sehr kurzen – Predigt verkündet, sondern auch szenisch dargestellt. Aus dem Altarraum hinter der Ikonenwand tragen die Priester die Bibel zu der Gemeinde, später in einem feierlichen Einzug den Abendmahlskelch mit Wein und Brot. «Kleinen Einzug» und «Grossen Einzug» nennt man diese Handlungen. Sie symbolisieren das in Christus vollzogene Erscheinen Gottes unter den Menschen. Im Raum hinter der Ikonenwand, «Altar» genannt, wird das Abendmahl vorbereitet. Dieser geweihte Ort ist nicht für jedermann zugänglich. Frauen zum Beispiel sind ausgeschlossen. Bei der Taufe trägt der Priester die Knäblein in den Altarraum. Mit den Mädelchen hingegen tritt er nur vor die Ikone der Muttergottes. Zweimal fragte ich, ob ich den heiligen Raum auch mal betreten dürfe. Die Befragten vertrösteten mich. Man (wer? Wo? Warum?) werde meine Frage besprechen. Ich bekam nie eine Antwort. Oekumenisches Denken hat sich nicht überall durchgesetzt. Der Gottesdienst am Samstag dauerte noch länger als die sonntägliche Liturgia, gute drei Stunden. In ihm sind nämlich die früheren Stundengebete integriert und er heisst darum der «Ganznächtige». Eine Besonderheit ist die Ölung der Gläubigen: mit einem Pinsel und geweihtem Öl zeichnet ihnen der Priester ein Kreuz auf die Stirn. Im Prinzip hält sich die Gottesdienstordnung immer noch an die 1000jährige Vorlage des Kirchenvaters Chrysostomus. Ungemein berührend fand ich das Abendgebet um elf Uhr. In der nur von Kerzen erleuchteten Kirche fanden sich die Studenten und Studentinnen wohl vollzählig ein, sangen, beteten, bekreuzigten sich. Am Schluss sanken alle auf die Knie und stimmten eine Hymne auf die Bogorodiza an (die Muttergottes, exakt übersetzt: die Gottesgebärerin). In diesen Gesang legten sie so viel Hingabe, Verehrung und Sehnsucht hinein, dass selbst mir, dem nüchternen, ganz zuhinterst stehenden und etwas distanzierten Protestanten, das Herz schneller schlug. Oft konnte ich mich kaum der Tränen erwehren. Mein Verstand wehrte sich gegen das Phänomen, dass orthodoxe - und katholische - Mitchristen Maria scheinbar so viel inniger als Christus verehrten. Doch die Wogen des Gefühls überspülten oft die Fragen des rationalen Theologen.
Während den Mahlzeiten war das Refektorium gerammelt voll. Zu Beginn wurde natürlich gebetet. Kaum war das «Amin» gesprochen, setzten sich alle und stürzten sich fast auf die Teller. Im Nu war alles leergeschaufelt. Am Morgen und oft auch am Abend wurde zu Brot und Tee Kascha serviert: Reisbrei, Haferbrei, Buchweizenbrei, manchmal süss, manchmal gesalzen. Halt einfach Kascha und nochmals Kascha. Beim Mittagessen gab es vor allem Kartoffeln und Teigwaren, hie und da Fisch (billig, voller Gräte), selten Gemüse und nie Salat. Von Obst gar nicht zu reden. Ich durfte am Tisch der Professoren sitzen – ein Privileg. Wir wurden zuerst bedient. Aber auf dem Teller befand sich die genau gleiche Massenkost wie bei den Studierenden. Gelegentlich war der Platz bei den Professoren mühsam. Dann nämlich, wenn ich neben einen erzkonservativen Herrn zu sitzen kam. Es waren ihrer wenige, aber die machten kein Hehl aus ihrer Ablehnung der Protestanten. Andere hingegen waren freundlich und an Gesprächen interessiert. Der Rektor lud mich sogar ein, an einer Versammlung über die Schweiz und über die protestantische Theologie zu referieren. Es kam nicht mehr dazu, weil meine Abreise kurz bevorstand. Am Professorentisch sass auch Alar Laats, ein Theologe aus Estland. Er war Lutheraner und den Orthodoxen etwas näher als ich. Das zeigte sich auch darin, dass er für die Gottesdienste und die feierlichen Anlässe im Talar erschien, ich dagegen meist im Pullover. Ja, ich war schon ein ziemlich bunter Vogel in diesem wallenden Schwarz. Die Seminaristen trugen ständig eine bis zum Boden reichende schwarze Soutane und die angehenden Chorleiterinnen immerhin ein dunkles Kopftuch. Disziplin wurde grossgeschrieben. Den Gottesdienst zu schwänzen war ein schlimmes Vergehen. Vater Grigori, Inspektor und sozusagen Zuchtmeister, machte persönlich Kontrollen. Während der Gottesdienste klapperte er die Zimmer ab, riss die Türen auf und spähte nach Langschläfern. Wehe, wenn er einen erwischte. Das gab einen Strich. Nach drei Strichen wurden die Studenten auf der Stelle relegiert. Ausgang war erlaubt, aber um 10 Uhr abends musste man wieder im Haus sein. Sonst gab es wieder einen Strich. Alar und ich waren von diesen Regeln befreit. Immerhin waren wir von unseren Kirchen ordiniert und man redete uns mit Vater Alar und Vater Andrej an. Ich schwänzte die Gottesdienste selten. Wenn ich mich schon in dieses fast klösterliche Experiment eingelassen habe, fand ich, dann ziehe ich es nach Möglichkeit durch. Ausnahmsweise sassen Alar und ich während eines Gottesdienstes in meinem Zimmer. Unser Gespräch wurde jäh unterbrochen, als Vater Grigori die Türe aufriss. Schon setzte er zum Donnerwetter an, als er realisierte: diese zwei Sünder sind nicht den Strafnormen des Hauses unterworfen. Er grüsste, schloss die Türe ganz sanft und setzte seinen Kontrollgang fort.
Wesentlicher Bestandteil meines Studienprogramms war der Russischunterricht. Die Akademie stellte mir einen Lehrer zur Verfügung, der jeden Morgen zwei Stunden mit mir arbeitete. Zudem besuchte ich am Vormittag Vorlesungen und beschäftigte mich in der Bibliothek mit Themen, die ich hier nur stichwortartig anführe: Ikonen, Heiligenlegenden, Jurodivye (Narren in Christo), Geschichte der Altgläubigen und der russischen Sekten. Die Nachmittage widmete ich Leningrad. Stundenlang streifte ich zu Fuss durch die Strassen, besichtigte Kirchen, besuchte Museen. Das Russische Museum mit einer hervorragenden Ikonensammlung. Mehrmals die Ermitage. Das Suvorov-Museum mit vielen Exponaten aus der Schweiz. Eine Ausstellung des Modemalers Glasunow. Allerdings, nachdem ich anderthalb Stunden in eisiger Kälte Schlange gestanden war, verzichtete ich auf einen Besuch und trollte ich mich an die Wärme. Auf dem Heumarkt folgte ich den Spuren von Dostojewskis Raskolnikov. Und am Moikakanal, gegenüber dem Jussupow-Palast, denen des hier ermordeten Rasputin. In den düstern Zellengängen der Peter-Paul-Festung begegnet man den Namen von bekannten Häftlingen, Dostojewski zum Beispiel. Viele von ihnen warteten hier auf ihr Todesurteil. Im Zentrum der Festung steht die Kathedrale mit ihrer eleganten goldenen Turmspitze. Sie ist wie die ganze Festung ein Werk des Architekten Trezzini aus Astano im Malcantone. Ich beschliesse hier die Aufzählung. Die Zahl grossartiger Sehenswürdigkeiten ist zu gross. Nicht einmal der Dumont-Reiseführer vermag ihnen allen gerecht zu werden. Auf meinen Stadtwanderungen kam es einmal zu einem unerfreulichen Zwischenfall. Ich war auf dem belebten Newski-Prospekt unterwegs, als sich ein kleines Männchen an mich heranmachte. Er fuchtelte mit den Armen, machte Grimassen und stiess Laute aus wie ein Besessener. Als er mich zu betasten begann, schickte ich ihn mit einem berndeutschen Schimpfwort zum Teufel. Ob ihn das beeindruckte? Jedenfalls rannte er davon. Im gleichen Moment griff ich nach der Hosentasche. Das Portemonnaie mitsamt Ausweisen und Kreditkarte war weg. Ich rannte ihm nach. Aber er war bereits um die nächste Hausecke verschwunden. Glücklicherweise hatte ich meinen Pass im Zimmer zurückgelassen. In der Akademie rieten sie mir, Anzeige zu erstatten. Eine Unterstützungstruppe mit Vater Andrej und Nikolaj Derschawin begleitete mich auf den Polizeiposten. Ein geradezu Tschechow’sches Erlebnis! Der Quartierpolizeiposten befand sich in einem schmutzigen Hinterhof. Eine enge, ebenfalls ziemlich schmutzige Treppe führte in den ersten Stock. In einem kleinen Zimmerchen liess man uns Platz nehmen. Ein Uniformierter sass vorne am Fenster, las in der Zeitung und rauchte. Er nahm von uns kaum Notiz. Der zweite Uniformierte räumte seine Schreibmaschine vom Tisch. Leider sei sie defekt. Aus einem Schrank holte er Papier, Tintenfass und Schreibfeder. Ich erzählte, was passiert war. Er schrieb mit kratzender Feder ein Protokoll, das er mir am Schluss vorlas. Mit einer freundlichen Geste entliess er uns, nicht ohne zu bemerken, derlei Dinge geschähen leider sehr häufig und aufgeklärt würden sie fast nie. So war es denn auch in meinem Fall. Dafür ersetzte mir die Akademie grosszügig das gestohlene Bargeld.
Mit den Bewohnern der Akademie war ich auf unterschiedliche, meist freundliche Art verbunden. Von den Professoren ist mir in bester Erinnerung geblieben Vater Nikolaj, ein sehr offener und liebenswürdiger Gesprächspartner. Das gleiche gilt von Vater Wassili. Er war Mönch und hatte in der Akademie eine Bleibe gefunden, weil in der Sowjetzeit die meisten Klöster zerstört worden waren. Er gab keine Vorlesung, war aber als Seelsorger überaus gefragt. Seine hellen blauen Augen unter den weissen Brauen hatten eine Strahlkraft, der man sich nicht entziehen konnte. Fast immer war er von Studenten, die seine Nähe suchten, umringt. Mehr Mühe hatte ich mit Vater Andrej, dem Ausländerbeauftragten. In seiner Nähe fühlte ich mich von Anfang an unbehaglich. Warum das so war, erfuhr ich bereits nach zwei oder drei Wochen meines Aufenthalts. Studenten rieten mir nämlich, ich solle ihm nicht zu viel anvertrauen. «Er ist ein Spion», sagte einer, und meinte damit: er ist Informant des KGB. Ähnlich verhielt es sich mit dem Professor für Homiletik. Dessen Namen habe ich vergessen. Aber wenn ich an ihn denke, spüre ich auch nach vielen Jahren noch ein eigenartiges Missbehagen. Einmal traf ich die beiden zufällig in der Stadt. Damit war für mich alles klar. Gleich und gleich gesellt sich gern. Von den Studenten war mir mein Zimmerkollege am nächsten. Nicht nur, weil wir einen kleinen Lebensraum zu teilen hatten. Nein, Nikolaj Derschawin, der erst eine Woche nach meiner Ankunft ins Zimmer brauste, war ein sehr liebenswürdiger, hilfsbereiter Mensch. Wir hatten viele gute Gespräche und als er mich bei meinem Abschied auf den Flughafen begleitete, konnte er fast nicht aufhören mich zu umarmen. Aufgewachsen war er irgendwo an der Wolga, wo sein Vater als Priester amtete. Nikolaj wie übrigens auch sein Bruder hatte das Priesterseminar absolviert. Nun arbeitete er an seiner Abschlussarbeit mit dem Thema «Seelsorge». Er hatte nicht die Absicht, eine Stelle als Priester anzunehmen. Sein Ziel war vielmehr, irgendwo in der kirchlichen Hierarchie mitzuarbeiten. Bereits hatte er gute Kontakte mit dem Metropoliten von Leningrad (der zwei Jahre später als Alexi II zum Patriarchen gewählt wurde). Ich freute mich sehr, ihn einige Jahre nach unserer gemeinsamen Zeit anlässlich einer Kirchenkonferenz in Basel wiederzusehen. Dann aber herrschte Funkstille. 2008 starb sein Mentor und Arbeitgeber Alexi II. Die Beerdigungsfeierlichkeiten wurden natürlich im Fernsehen übertragen. Und siehe da: in einem kurzen Dokumentarfilm wurden die Privatgemächer des Verstorbenen gezeigt. Und sein persönlicher Sekretär, der das Kamerateam begleitete, war niemand Anderes als mein Nikolaj Derschawin. Er hatte sich wenig verändert, bloss seine Stimme hatte das Timbre eines wichtigen Amtsträgers angenommen. Alar Laats habe ich bereits vorgestellt. Meistens verbrachten wir zusammen den Sonntag. Uns verband neben der persönlichen Sympathie ein gemeinsamer Bekannter, nämlich Karl Barth. Seine Doktordissertation schrieb Alar zum Thema «Trinitätslehre bei Karl Barth». Er hatte Barth nie angetroffen und war darum besonders interessiert, Persönliches über den bedeutenden Theologen zu hören. Die lutherische Kirche Estlands liess sich seine Ausbildung etwas kosten. Sie schickte ihn später nach Cambridge, wo er mit Frau und zwei Söhnen ein ganzes Jahr verbrachte. Ich habe sie dort besucht. Auf der Rückreise nach Tallin kamen sie bei mir in Thun vorbei. Zunächst erhielt Alar eine Professur in Tartu. Später wechselte er an die Universität Tallin. Dort spezialisierte er sich für allgemeine Religionswissenschaft, mit besonderer Berücksichtigung der Geschichte der russischen Sekten. Wieder hatten sich unsere Interessen getroffen. Viele Jahre beschränkte sich unsere Beziehung auf einen sporadischen Briefwechsel und Grüsse zu Weihnachten. Eines Tages meldete er sich per Telefon. Er befinde sich momentan in Spiez. Man staune! Wir trafen uns zu einem feinen Nachtessen. Wie kam der gute Alar denn ausgerechnet nach Spiez? Dies ist die Erklärung: Die Universität Tallin hatte aus Spargründen seinen Lehrstuhl abgeschafft. Jetzt hatte er für die wenigen Jahre bis zur Pensionierung einen Posten gefunden bei der estnischen Armee, Abteilung Flugwaffen. »Was machst du denn bei der Flugwaffe? Du hast doch keine Ahnung von der Militärfliegerei». «Du hast recht. Ich bin eine Art Medienbeauftragter, da muss man von Flugzeugen keine grosse Ahnung haben. Eben in dieser Funktion hat man mich zu der kleinen Konferenz nach Spiez geschickt». Ich fragte, wie gross denn die estnische Luftwaffe sei. Im Moment hätten sie nur zwei Flugzeuge, beide etwa im gleichen Alter wie er, sagte er schmunzelnd. Lustigerweise steckten wir Eidgenossen damals mitten im Abstimmungskampf um den Grippen. Ein weiterer Anlass zum Schmunzeln. Gern erzähle ich von einem dritten Freund, den ich an der Geistlichen Akademie gefunden habe. Sascho Velikov war Bulgare. Er kam häufig zu mir ins Zimmer um zu schwatzen. Vielleicht lag das auch daran, dass bei mir mehr Ruhe herrschte. Kollege Nikolaj war sehr häufig unterwegs. Sascho hatte sein Zimmer mit sieben Anderen zu teilen. Achtbettenzimmer mit einem Tisch in der Mitte waren die Norm. Da war es manchmal zu lärmig. Nach Studienabschluss kehrte Sascho nach Bulgarien zurück und wurde in einer Landgemeinde als Priester der bulgarisch-orthodoxen Kirche eingesetzt. Nach dem Umbruch und den chaotischen Wirtschaftsverhältnissen landeten wie in Russland auch in Bulgarien die meisten landwirtschaftlichen Kolchosen im Ruin. Das Geld für den Um- und Aufbau fehlte. Sascho wollte helfen und verfiel auf die Idee, landwirtschaftliche Occasionsmaschinen zu beschaffen. Ich lieferte ihm ein paar Schweizer Adressen. Offenbar scheiterte er mit seinen Plänen. Später meldete er sich mit einem neuen Projekt, nämlich dem Verkauf von getrockneten Kräutern und Pilzen. Ich platzierte ein paar Inserate in Schweizer Zeitungen, leider mit geringem Erfolg. Ziemlich resigniert berichtete er, sein Lohn als Priester reiche einfach nicht aus, um die Familie zu ernähren. Darum übe er noch zwei weitere Tätigkeiten aus, als Journalist zum Beispiel. Schliesslich fand er sein Heil in der Emigration. Weil er gut italienisch sprach, versuchte er es in Italien. Dann zog er weiter nach Spanien. In Denia dient er heute noch als Priester einer bulgarisch-orthodoxen Gemeinde. Anlässlich einer Spanienreise wollte ich ihn besuchen. Einen ganzen Tag lang fragte ich mich kreuz und quer durch Denia. Die Spanier wussten nicht einmal, dass es in ihrer Stadt eine bulgarische Gemeinde gab. Noch weniger kannten sie einen Herrn namens Sascho Velikov. Wieder zu Hause, schilderte ich ihm per E-Mail meine vergebliche Suche. Er reagierte sofort. Sowohl seine Familie wie auch die kleine bulgarische Kirche waren umgezogen. Der Sekretär der bulgarischen Kirche in Spanien habe vergessen, die Adressänderungen im Internet nachzutragen. So etwas von schade! Seither sind wir per Facebook verbunden. Sascho ist ein fleissiger User, sodass ich immer im Bild bin über sein Wirken.
Gegen Ende meines Studienaufenthaltes kam ich mit verschiedenen Leuten in Kontakt, die näher kennen zu lernen ich leider nicht mehr die Zeit hatte. Da arbeitete zum Beispiel ein auf die Ikonenmalerei spezialisiert junger Mönch. Er hatte wie Vater Wassili im Seminar Unterschlupf gefunden. Über seine Maltechnik und über die spirituellen Hintergründe dieser Kunst hätte ich gern noch mehr erfahren. Den Deutsch- und den Französischunterricht erteilten zwei befreundete ältere Damen. Sie beklagten sich, ihre Studenten seien zu wenig bei der Sache. Zu ihrem Bedauern gehörten ihre beiden Sprachen halt nicht zu den Pflichtfächern. In der letzten Woche luden sie mich zu sich nach Hause ein. Es war sehr gemütlich, aber auch dramatisch und zuletzt sehr traurig. Die Französischlehrerin erzählte nämlich aus ihrer Jugend, insbesondere über die schreckliche Blockade Leningrads durch die Deutschen. Im Winter gab es kein Heizmaterial mehr – die meisten Möbel waren längst im Ofen verheizt worden. An den täglichen Beschuss hätten sie sich fast gewöhnt. Das allerschlimmste sei der Hunger gewesen. Eine winzige Ration Brot musste genügen. Wobei das Brot mit Sägemehl angereichert war. Sie habe damals bei ihrer Tante gewohnt, im zweiten Stock eines grossen Hauses. In den beiden unteren Etagen hätten etwa fünfzig Lehrlinge der nahen Putilow-Werke gelebt, alle stark unterernährt. Nach und nach seien alle verhungert. Ihre gefrorenen Leichen seien in der Eingangshalle geklaftert worden, da die Toten nur einmal pro Woche abtransportiert wurden. Sie habe jeden Tag an diesem Leichenstapel vorbeigehen müssen, um die Brotration für sich und für die Tante abzuholen. Nie vergesse sie diese Bilder. Und nie vergesse sie das furchtbare Hungergefühl, das man fast nicht ausgehalten habe. Die Frau brachte ihren Bericht nur mit Mühe zu Ende. Dann begann sie zu weinen und verliess das Zimmer fluchtartig. Ich habe mich nicht von ihr verabschieden können.
Die Blockade Leningrads dauerte übrigens vom September 1941 bis zum Januar 1944. Schätzungsweise 1,1 Millionen Menschen fielen ihr zum Opfer. Die meisten von ihnen starben an Hunger. Auf dem Piskariover Friedhof sind 800 000 Menschen in Massengräbern bestattet worden. Ein erschütterndes Erlebnis ist es, entlang der vielen Grashügel zu spazieren und begleitet zu werden von Tschaikowskis Requiem, mit dem die riesige Anlage diskret beschallt wird.
Während meines Aufenthaltes in Leningrad begann der Umbruch, den Gorbatschow mit den Begriffen «Perestroika» und «Glasnost» (Umbau und Offenheit) charakterisierte. Grosse Änderungen waren zu meiner Zeit noch nicht zu bemerken. Die Natur braucht im Frühling ja auch Zeit, um zu grünen und aufzublühen. Politisch interessierte Studenten fanden übereinstimmend, jetzt gelte es die Vorteile des Sozialismus und die des Kapitalismus zu vereinigen. So könnte ein gutes Neues entstehen. Ein kleines, aber eben doch bedeutungsvolles Ereignis war ein Filmabend in der Akademie. Man zeigte uns den Film «Reue» von Abuladse. Der bekannte Regisseur hatte ihn schon früher vollendet. Jetzt endlich durfte er gezeigt werden. Das Stadtoberhaupt war gestorben. Der Leichnam wurde mehrmals in der Nacht ausgegraben. Man sollte seine Untaten nicht vergessen. So der Inhalt des Films. Ganz offensichtlich eine frühe Abrechnung mit dem Stalinismus. Der Anlass konnte einen mit Hoffnung erfüllen. Neues kann ja nur entstehen, wenn man sich mit den Altlasten auseinandersetzt. Anlässlich eines Interviews mit dem Rektor der Akademie stellte ich die Frage, was für Auswirkungen der Perestroika spürbar seien. Zuerst nannte er die freie Meinungsäusserung als wichtige Errungenschaft. Sodann sagte er schmunzelnd, für die Renovationsarbeiten in der Akademie könne man die Materialien nun auf dem Markt bestellen und sei nicht auf "Beziehungen» angewiesen.
Ein besonders erfreuliches Zeichen für den Beginn eines gesellschaftlichen Wandels war Folgendes. Die Leitung des Russischen Museums lud den Chor der Akademie zu einem Konzert ein. Dieses fand in der pompösen Eingangshalle des Museums statt. Erstmals seit 70 Jahren durfte ein kirchliches Ensemble offiziell und öffentlich auftreten. Das Konzert muss für die zahlreichen Zuhörer wie für die Sänger ein unbeschreibliches Erlebnis gewesen sein. Niemand habe seine Tränen zurückhalten können. Der Applaus habe fast nicht enden wollen. So berichteten die tief beeindruckten Sänger nach ihrer Rückkehr an die Akademie.
In lebhafter Erinnerung bleibt mir eine Begegnung mit dem Leningrader Metropoliten und späteren Patriarchen Alexi II. Ob sie mein Zimmergenosse Nikolaj oder Vater Andrej eingefädelt hat, weiss ich nicht. Auf alle Fälle stand ich eines Tages, in Begleitung von Vater Andrej, vor der Residenz des Würdenträgers. Er empfing mich sehr wohlwollend. Da er im Baltikum geboren und aufgewachsen war, sprach er vorzüglich deutsch. Im Lauf des Gesprächs erzählte ich von den Kinder-Bibelwochen, dich ich unlängst in Thun eingeführt hatte und die die traditionelle Sonntagsschule ersetzte. Alexei zeigte sich sehr interessiert. In Russland habe die kirchliche Unterweisung eine eminente Bedeutung. Während Jahrzehnten war sie verboten gewesen. Zum Jubiläumsjahr – 1000 Jahre seit der Einführung des Christentums – schenkte er mir eine Schallplatte mit orthodoxen Festgesängen. Ich überreichte ihm einen Band der Heimatbücher vom Berner Haupt-Verlag: Tausendjährige Kirchen am Thunersee. Zum Abschied erwähnte Vater Andrej, wie mir schien fast ein wenig stolz, ich hätte mich sehr gut ins Leben an der Akademie eingefügt und immer die Gottesdienste besucht. Das Lob freute mich. Die Tatsache, gut beobachtet gewesen zu sein, ernüchterte mich. Eigentlich hatte ich nie das Gefühl, überwacht zu werden. Als ich nach meiner Heimkehr gefragt wurde, ob ich mich frei und unbeaufsichtigt in Leningrad habe bewegen können, antwortete ich mit einem ehrlichen Ja. Wenig später wurde in der Schweiz die Fichen-Affäre aufgedeckt. Als ich Einsicht bekam in meine Akten, fand ich Merkwürdiges. Der Chor der Akademie war zu einem grossen Jubiläumskonzert nach Basel eingeladen worden. Im Anschluss daran organisierte ich in Thun ein Konzert, das übrigens vom Radio übertragen wurde. Die meisten Chormitglieder waren für zwei Nächte bei Familien untergebracht. Zwei Personen logierten im Hotel Krone. Das wurde von der Kantonspolizei registriert. Die zwei russischen Staatsangehörigen (Namen geschwärzt) hätten B. (mich) verschiedentlich auf dem Schlossberg besucht. Offenbar sind also Polizisten meinen Gästen nachgeschlichen, mehrmals die 221 Stufen die Kirchentreppe hoch, und haben die Verdächtigen im Pfarrhaus verschwinden sehen. Was für eine tolle Erkenntnis!
Jede Woche während meines Aufenthaltes erhielt ich von der Akademie ein Taschengeld, wie alle Studierenden. In den Geschäften war damals wenig Attraktives zu kaufen. Daher verfügte ich am Schluss über eine ganz ansehnliche Summe. Darum beschloss ich, drei Kameraden zu einem feinen Abschiedsessen einzuladen: Nikolaj Derschawin, Alar Laats und meinen Russischlehrer Nikolaj Zabolotski. Den Rest wollte ich am letzten Tag der Spendenkasse der Akademie zurückzahlen. Wirklich einladende Restaurants waren damals eine Seltenheit. Darum entschloss ich mich, im einstmals gediegenen, aber immer noch passablen Hotel Europa einen Tisch zu reservieren. Das war allerdings nicht ganz einfach. Ob an dem und dem Tag ein freier Tisch für vier Personen verfügbar wäre, fragte ich den Oberkellner. Das könne er mir nicht sagen. Sie hätten immer 24 Stunden Dienst. An besagtem Abend sei eine andere Equipe an der Reihe. Ich solle morgen wiederkommen, dann träfe ich das passende Team. Also ging es am nächsten Tag nochmals quer durch die halbe Stadt ins Europa. Ich traf tatsächlich die richtige Equipe. Aber die Reaktion war, gelinde gesagt, lustlos. Vielleicht sei am gewünschten Abend viel los und dann wäre kein Tisch frei. Als ich insistierte, fragte mich der Diensthabende, in welchem Hotel ich untergebracht sei. Was sollte denn diese Frage? Fürchtete der Herr etwa, am betreffenden Tag Überstunden auf sich nehmen zu müssen? Als ich sagte, ich wohnte nicht in einem Hotel, ich sei an der geistlichen Akademie eingeschrieben, geschah eine wundersame Verwandlung. Auf einmal lächelte mich der Mann an, griff zu seinem Reservationsbuch, fand natürlich einen freien Tisch und dankte mir für die Anfrage. Das Wort «geistliche Akademie» hatte gewirkt wie ein Zauberschlüssel. Wir wurden am folgenden Tag sehr aufmerksam bedient und erlebten einen lustigen Abschiedsabend – eine freundliche Frucht von Glasnost und Perestroika.
An einsamen Abenden in meiner Studentenbude habe ich gelegentlich versucht, Erlebnisse und Stimmungen in berndeutsche Verse zu fassen. Ich erlaube mir, mit einigen Beispielen dieses Kapitel über meine Leningrader Zeit zu beschliessen.
Mittagässe ir Akademie
Linggs sy d Meitschi
Rächts sy d Pursche
Aui schwarz im Prieschterrock
Chrisdick höckle si a ihrne Tische
Schwätze lache lärmidiere
D Suppelöffle sy scho griffbereit
Uf ds mau tönt e Glogge dür e Saal
Scho sy aui uf de Beine
Fö a singe was si möi
Otsche nasch heisst „Unser Vater“
Druf ganz vorne bir Ikone seit e Prieschter
Sägeswort vo töifem Sinn
Aui rüefe hurti gschwing Amin
Höckle ab u griffe nach em Löffu
Ändlech darf me afa ässe
Näbscht der Seu o ds Büchli nähre
D Inbrunscht wo das junge Vöukli
Sire Suppe tuet eggägebringe
Isch nid chlyner aus bim Singe
Dogmatik – Vorläsig über ds filioque
Da sitzt er vorne a s ym Pult
Der fründlech Vatter Liveri
S’ dunkt eim är sygi d Güeti säuber
Mit wissem Samichlouse- Bart
U syre miude Stimm
Redt är vou Ifer vo de aute Zyte
Konzildischpute u vo Chirchevätter
Vom Schtritt um Wort u um Begriffe
Zum Bischpiu Vatter Suhn u Heilig Geischt
Wohär dä chöm. Vo disem, äim – vo bedne?
S isch eifach schwierig mit däm Filioque!
Zum Glück het är die rächti Lehr
Är bchennt sis Fach
Isch sehr beläse u gelehrt
Basilius u Ambrosius
Origenes u Gregor vo Nazianz
U bsungerbar Chrysostomus
Är kennt se au bis hingeruus
Derwile suecht der Läbesschtrom
No anderwitig siner Bahne
Es paar Schtudänte si nid ganz bir Sach
Da luegt doch eine grad zum Fänschter us i d Sunne
D Gedanke flüge wit dervo wär weiss wohi
U eine list es Buech, verschteckt uf sine Chnöie
Der Dritt studiert e Katalog
Mit nöie Outo us em Weschte
Är zeigt sym Nachbar mit em Finger
Uf wele Chare n är spanifli
O dä wo hie di Zile schribt
Het mängisch nid gnau möge lose
We öpper fragti was är schlaus
Vom Vatter Liveri begriffe heig
De wüsst är leider o nid aus
Vo Vatter Suhn u heiligem Geischt
Abegebätt
Drühundert dunkli Gschtaute
Ir Nacht am eufi i der Chiuche
Wie Schattewäse vor em winzig chlyne Cherzeliecht
Dert zvorderscht bir Ikonewang
Da schwäbt uf ds Mau fasch wie ne Wouche
E wundersame Gsang im Ruum
Die gloggehäue Froueschtimme
Di töife Bäss u chräftigi Tenör
Am Afang tönt es lis u zart
Vou Sehnsücht nach em Himurich u nach em Glück
U handcherum fortissimo
Dernah e churzi Schtiui
De lüchte Lampeliechter uf
Us Schätte wärde Mönsche
Ganz langsam läärt sech d Chiuche
Es zieht jetz d Pursche zu de Meitschi
Me ghört se zäme schwätze, zäme lache
Wie doch die Wäute nach binangere sy
Der Himu hie u dert isch d Ärde
I frage fryli: was isch wo?
Der Himu hie u d Ärde dert –
Oder no grad einisch umgekehrt?
Vatter Kirill
Är het ke Schtimm
Wo dür die ganzi Chiuche dröhnt
S tönt schwach u brüchig we n är singt
„Der Fride syg mit euch“
Der goudig Prieschtermantu, d Mitra
Si passe nid so rächt zu ihm
Ganz angersch we n är vor dier schteit
Im schwarze Rock aus Mönch
Du luegsch i häui, blaui Chinderouge
Im runzuriche Gsicht
Drum ume wie ne Rahme wissi Haar
Da gschpürsch der Mönsch
Gschpürsch Wermi Demuet ächti Liebi
U ds glycher Zyt es grosses Mass vo Leid
Wo ihn im Louf vor Zyt het troffe
Der Chrieg, der Tod vo sine Liebe
Verfougig wäg em Gloube u Verrat
Du weisch: är würd di nie bedränge
Är nimmt sech Zyt, cha warte u cha lose
Ihm chöntisch aus das säge wo di drückt
Är würd verschta, är würd di sägne
E Mönsch. E Muettervatterbrueder
Är brucht kes glänzigs Prieschterchleid
Kaluga – Thun
Seit meiner Rückkehr aus Leningrad waren erst ein paar Monate verstrichen, als mich eine Doppelseite in der Zeitung „Bund“ richtig elektrisierte. Im Städtchen Wiedlisbach sei eine bemerkenswerte Ausstellung eröffnet worden: Maler aus der russischen Stadt Kaluga und aus Moskau präsentierten ihre Werke. Ein ausserordentliches Ereignis, vermerkte der Berichterstatter. In den letzten Jahrzehnten wäre eine derartige, von Privaten organisierte Ausstellung nie möglich gewesen. Wie die Hirten in der lukanischen Weihnachtsgeschichte «machte ich mich eilends auf, die Sache zu sehen, die da geschehen ist». Ich bestaunte die Bilder, lernte einige der Künstler und auch die Mitglieder des mitgereisten Balalaika-Ensembles «Kalinka» kennen. Vor allem aber traf ich den Mann, der diesen wichtigen Kontakt zwischen Ost und West geplant und realisiert hatte: Valeri Slavinski. Bei ihm muss ich unbedingt einen Moment verweilen. Seine berufliche Laufbahn begann er als Klavierstimmer. Später übernahm er den Posten eines Sekretärs der Jugendorganisation «Komsomol». In dieser Funktion organisierte er viele Konzerte und andere kulturelle Events. Er sei darum in Kaluga sehr bekannt und beliebt gewesen, sagte man mir. Jahre vor der Wende suchte er schon Kontakte mit dem Westen. Das war ein Risiko, wie sich bald zeigte. Nachdem Valeri bei der Partei ein Gesuch für ein West-Visum gestellt hatte, wurde er Knall auf Fall entlassen. Durch Zufall kam er in Briefkontakt mit einer Person im schweizerischen Wiedlisbach. Diesen Kontakt nützte er gleich nach der Wende aus, um die erwähnte Ausstellung zu organisieren. Die Wiedlisbacher Organisatoren luden mich zu einem Nachtessen ein, wo ich mit Valeri und seiner Frau Lilja näher bekannt wurde. Wir diskutierten nicht nur über die Vergangenheit und die Gegenwart, sondern auch über die Zukunft. Wie wäre es, fragte Valeri, einen Kulturaustausch zu beginnen? Zum Beispiel mit Konzertreisen der Kirchenchöre. Ich versprach, bei der mir nahestehenden Thuner Kantorei behutsam die Fühler auszustrecken. Valeri wollte in verschiedenen Kirchen Kalugas vorsprechen. Ich stiess bei der Kantorei auf reges Interessen. In Kaluga zeigte es sich, dass die Chöre der verschiedenen Kirchen nicht zu gewinnen waren. Die Sänger wirken individuell und gegen ein kleines Entgelt in den Gottesdiensten mit. Sie sind nicht als Verein organisiert. Valeri Slavinski liess sich nicht entmutigen. Aus Mitgliedern des grossen städtischen Männerchors und Lehrerinnen der verschiedenen Musikschulen stellte er einen ad-hoc – Chor zusammen. Für die Leitung gewann er die renommierte Dirigentin Sinaida Derewjaschkina. Mit ihr und zwei weiteren Vertretern des neuen «Kammerchor Kaluga» traf ich mich zu Gesprächen in Moskau. Wir waren uns sofort sympathisch und einigten uns über die Modalitäten der gegenseitigen Besuche. Damit begann die lange Geschichte des Kulturaustauschs zwischen Kaluga und Thun.
An einem warmen Frühlingstag des Jahres 1991 holte ich den Kammerchor Kaluga am Flughafen Zürich ab. Diese erste Westreise hatte die Administration der Stadt Kaluga subventioniert. Deshalb konnten sich die Sängerinnen und Sänger den Flug überhaupt leisten. Kaum jemand war vorher im Westen gewesen. Das Staunen über die Geschäfte und Restaurants im Flughafen war enorm. Es setzte sich in Thun fort. Wie viele prächtige Autos doch verkehrten, wie jedes Haus und alle Gartenmäuerchen perfekt instand waren! «Warum ist das so bei euch?», fragte mich Lew, «wir sind doch auch geschickte Handwerker, und dumm sind wir auch nicht.» Wir hatten für alle eine Gastfamilie gefunden. Trotz Sprachbarrieren fanden Russen und Schweizer erstaunlich rasch zueinander. Frau Rohrer, die die Dirigentin beherbergte, erzählte: «Wenn wir trotz Wörterbuch nicht weiterkamen, haben wir uns einfach umarmt.» Das erste Konzert in der Stadtkirche war ein Grosserfolg. Die geistlichen Gesänge gingen dem Publikum an die Seele. Die Volkslieder, bald humoristisch und ausserordentlich temporeich, bald sehnsüchtig-melancholisch, rissen uns Schweizer aus der Behäbigkeit. Die Platzierung der russischen Gäste in Familien erforderte zwar einen erheblichen organisatorischen Aufwand. Doch der Aufwand lohnte sich. Man kam den Fremden nahe. Es entstanden Brieffreundschaften. Es kam zu privaten Besuchen. Kinder von Kalugaer Freunden weilten später für zwei, drei Ferienwochen in der Schweiz. Vertieft wurden diese Beziehungen durch den Gegenbesuch der Thuner Kantorei in Kaluga, im Herbst 1991. Auch wir wurden bei Familien untergebracht. Das war, angesichts der knappen Raumverhältnisse, nicht ganz einfach. Doch all die Probleme und Problemchen des Zusammenwohnens wurden aufgewogen durch die Herzlichkeit der Gastgeber. Die war einfach überwältigend.
Ein paar Bemerkungen zu Kaluga. Die Stadt, Hauptort des Oblast (Kanton) gleichen Namens, und 200 Kilometer südlich von Moskau gelegen, hat 340 000 Einwohner. Sie liegt am Fluss Oka. Im Stadtkern finden sich viele sehr schöne Gebäude aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Kaluga war damals eine wichtige Handelsstadt. Zu Sowjetzeiten wurde sie zu einem Zentrum der Rüstungsindustrie. Waffen aller Arten und wichtige Raketenbestandteile für die Weltraumfahrt wurden fabriziert. Darum stand Kaluga unter strengem Regime. Die Stadt war für Touristen und andere Ausländer verschlossen. Für Ingenieure, Wissenschaftler und Kaderleute waren Reisen ins Ausland strikte verboten. Nun aber, nach dem Umbruch in Russland, durften drei Dutzend Schweizer durch Kalugas Strassen flanieren und in Konzertsälen auftreten. Mit der Thuner Kantorei konzertierte erstmals eine ausländische Formation in der ehemals verbotenen Stadt. Das war für viele Kaluganer und selbst für die Nomenklatura ein bedeutendes Ereignis. Als am Schluss des ersten Konzertes der Kammerchor Kaluga auf die Bühne stieg und zusammen mit den Thunern die russischen «Abendglocken» und das bernische «Burebüebli» sang, blieb kaum ein Auge trocken. Beim anschliessenden Festmahl in der Aula der Musikschule ging es überaus fröhlich zu. Es wurde gesungen, getafelt, Wodka getrunken und gefeiert. Hansjakob Rüfenacht, Dirigent der Kantorei, sang Mani Matters «Der Hansjakobli u ds Babettli» und begleitete sich auf der Gitarre gleich selbst. William Tantlewski mit seiner samtweichen Tenorstimme gab einige Romanzen zum Besten. Ich hatte die Ehre, neben Herrn Sudarenko zu sitzen, dem Parteisekretär des Oblast. 1991 gab es noch kaum demokratische Strukturen. Der Parteisekretär war oberster Chef – wie in der Sowjetunion Chruschtschov, Breschnev oder zuletzt Gorbatschov. Die Begegnung blieb nicht ohne Folgen. Am folgenden Tag erhielt ich eine offizielle Einladung ins Weisse Haus, das pompöse Regierungsgebäude Kalugas. Die Einladung galt ausdrücklich nicht für Valeri Slavinski, was ihn sehr kränkte. Offenbar haftete an ihm immer noch der Makel, als Sekretär des Komsomol abgesetzt worden zu sein. Dafür durften mich zwei angesehene Damen des Stadt-Etablissements begleiten, die Chordirigentin Sinaida und die Direktorin des Konservatoriums, Natalja Abramova. Da sass ich nun zwischen Sinaida und Natalja am einen Kopfende des grossen Tisches. Uns gegenüber thronte Herr Sudarenko. An den Längsseiten des Tisches je etwa ein halbes Dutzend wichtige, zum Teil recht finster blickende Herren. Die Gespräche, für die ich einen Übersetzer verlangt hatte, verliefen recht freundlich. Bis zum Schluss aber fand ich nicht heraus, was man von mir wollte. Hatte man mich als politisch oder wirtschaftlich einflussreiche Person angesehen? Erhoffte man, durch mich Kontakte mit Schweizer Institutionen oder Firmen knüpfen zu können? Sie mussten doch wissen, dass ich bloss Pfarrer in einer kleinen Schweizer Stadt und Reisebegleiter eines Kirchenchors war. Als ich die Frage stellte, ob sie konkrete Erwartung hätten, bekam ich keine klare Antwort. So endete die nette, aber unverbindliche Verhandlung. Ausflüge zum Optina Pustyn – Kloster und nach Jasnaja Poliana, dem Landgut Tolstois, erquickten meine russophile Seele wesentlich mehr. Im Kloster empfanden die Frauen eine gewisse Unfreundlichkeit der Mönche als unangenehm. Fast ungetrübt und interessant verlief dafür der Besuch auf Tolstois Landgut. Auf dem Weg dorthin, in der Stadt Tula, lernten einige Herren aus unserer Gruppe die Strenge des Gesetzes kennen. Auf einem kleinen Rundgang gelangten sie zum Bahnhof. Wie fast alle Schweizer interessierten sie sich natürlich für Eisenbahnen, betraten die Bahnhofhalle und die Perrons, begutachteten die Lokomotiven und fotografierten alles Mögliche. Plötzlich waren sie von Polizisten umringt, wurden auf den Posten geführt und eingehend befragt, was sich als überaus schwierig erwies. Erst nach einiger Zeit bemerkten wir das Fehlen einiger Reisegefährten. Sogleich eilte unsere treue Reisebegleiterin Svetlana den Vermissten zu Hilfe. Offenbar konnte sie die Polizisten von der Unschuld der lieben Schweizer überzeugen. Die Fotoapparate waren allerdings geöffnet und die Filme herausgerissen worden. Die Sünder hatten halt nicht gewusst, dass das Fotografieren von Kasernen, Bahnhöfen und Brücken verboten war. Das hatten sie nun gelernt und taten das fortan nur noch heimlich.
Nachdem die ersten Kontakte derart geglückt waren, war es für beide Seiten selbstverständlich, sie weiterhin zu pflegen. Schon im nächsten Jahr reiste der Chor aus Kaluga wiederum in die Schweiz, diesmal allerdings im Autobus. Der Fluss obrigkeitlicher Subventionen war versiegt. Sparen war angesagt. Darum verbrachten die Sängerinnen und Sänger die Nächte auf dem Weg nach Deutschland und in die Schweiz im Bus. In Thun wurden sie dann wieder ein wenig aufgepäppelt. Die Gastfamilien wie die Gäste waren sehr zufrieden. Die Konzerte hatten Erfolg. Doch da platzten beunruhigende Nachrichten aus Moskau in die freundschaftlich-entspannte Atmosphäre. Nach dem Putsch vom August 1991 und dem wirtschaftlichen Niedergang hatte sich die wirtschaftliche Lage rasant verschlechtert. Es drohte eine hohe Inflation, Geldentwertung und darum Verlust aller Ersparnisse. Unsere Gäste befürchteten Schlimmes. Tatsächlich verschlechterte sich die Situation dramatisch. Nicht nur am Geld fehlte es der Bevölkerung, sondern auch an Gebrauchsgütern, Nahrung und Kleidung. In der Sowjetzeit hatten die Menschen zwar sehr bescheiden gelebt. Aber für Nahrung, Kleidung und Unterkunft reichten die Einkünfte. Im Winter 1991/92 begann es an allem zu fehlen. Ich startete darum mit Freunden und Bekannten in der Kirchgemeinde eine Winterhilfe-Aktion. Ein Aufruf für eine Kleidersammlung fand ein ausserordentliches Echo. Ein ganzes Wochenende sortierten wir, etwa zwei Dutzend Freiwillige, die Kleiderhaufen, die fast bis zur Decke des Saals reichten. Schliesslich konnten 15 Tonnen in einen Lastwagen mit Anhänger verladen werden. Zusammen mit drei Leuten aus der Gemeinde reiste ich nach Kaluga. Ein Tag nach unserer Ankunft traf auch der Lastwagen mit den Hilfsgütern ein. Ein Dutzend Rotarmisten half beim Entladen mit. Andere Helfer sortierten die Ware. Und dann strömten die Bedürftigen zur Kleiderausgabe. Zugelassen war nur, wer von der Stadt Kaluga eine Bescheinigung mitbrachte. Die ganze Verteilung verlief sehr geordnet. Sie stand unter der Leitung einer gewissen Ljudmila Goriltschenko. Jahre später konnten wir die ausserordentlich tüchtige Frau als Vertreterin und Treuhänderin des Vereins Kaluga –Thun gewinnen. Mit den Barspenden, die wir mitgebracht hatten, unterstützten wir verschiedene soziale Projekte, beispielsweise eine Suppen- und eine Milchküche. Die Aktion fand einige Beachtung, nicht nur in der Presse. Auch die hohen Herren der Regierung hatten davon gehört und uns zu einem Empfang ins Weisse Haus eingeladen. Seit meinem ersten etwas seltsamen Besuch hatte sich politisch einiges getan. Die kommunistische Partei war entmachtet, der Generalsekretär Sudarenko ins Privatleben entlassen. Jelzin ernannte in den meisten Oblast Gouverneure – zumeist zivile Fachleute ohne Parteikarriere. In Kaluga war dies Aleksander Wassiliewitsch Derjagin, von Beruf Ingenieur (oder Physiker?) und Vizedirektor einer grossen Fabrik. Er begrüsste uns sehr freundlich und lud uns zu einem einfachen Mittagessen ein. Mit am Tisch sassen einige Minister und Kaderleute. Lilja Slavinskaja, die Frau Valeris, begleitete uns und übersetzte, wenn es nötig war. An die Gesprächsthemen erinnere ich mich nicht mehr. Geblieben ist aber der Eindruck eines unkomplizierten, freundlichen Zusammenseins. Freilich strahlten nicht alle Gesichter. Da gab es ein paar finster blickende stiernackige Typen, die stark an Breschnew erinnerten. Es waren Minister, die schon zu Sowjetzeiten auf ihren Sesseln gethront hatten und sich schwer taten mit Perestroika und Glasnost. In Erinnerung geblieben ist mir auch ein Zeitungsreporter, der mit seiner Kamera die ganze Zeit um uns herumscharwenzelte. Am folgenden Tag überbrachte er uns ganze Stapel von grossformatigen Fotos.
Mit Gouverneur Aleksander Derjagin verband mich eine über mehrere Jahre dauernde sehr freundliche Beziehung. Im Jahr 1993 begleitete er während einer Woche den Kammerchor auf seiner Konzertreise. In Thun war er im Pfarrhaus auf dem Schlossberg mein Gast. Wir führten viele Gespräche über alle möglichen Fragen, auch über Persönliches. Einmal, als er allein im Haus war, tauchte mein Sohn Thomas auf. Die Beiden waren sich noch nie begegnet, begannen aber, englisch radebrechend, eine Unterhaltung. Thomas erinnert sich noch heute schmunzelnd an den Höhepunkt des Gesprächs. Der Herr Gouverneur fragte nämlich den jungen Mann, welche Krawatte zu seinem Hemd passe. Ob er dessen Rat befolgt hat, weiss ich nicht. Einen Empfang bei Stadtpräsident Hansueli von Allmen und ein Mittagessen mit dem Gemeinderat schätzte Derjagin sehr. Am Sonntag jener Woche unternahm ich mit ihm und mit Sinaida, der Dirigentin, einen Ausflug nach Neuenburg. Unterwegs führte ich die Gäste in meine Heimat und zeigte ihnen den Bauernhof, auf dem ich aufgewachsen war. Aleksander Derjagin interessierte sich sehr für die Landwirtschaft. Er fragte meinen Bruder nach der Milchleistung der Kühe – und staunte. In Russland sei diese nicht halb so hoch. Es liege wohl an der Fütterung. Am Neuenburgersee empfing uns ein gut betuchter Thuner und lud uns zu einer Rundfahrt auf seinem komfortablen Boot ein. Mit weissem Speck und reichlich Wodka wurde der Ausflug gefeiert. Bei dieser und anderen Gelegenheiten zeigte sich eine Schwäche des Gastes: er sprach dem Alkohol (zu) reichlich zu. Eines späten Abends zum Beispiel musste ich mich weigern, eine weitere Flasche zu öffnen. Stattdessen griff ich ihm buchstäblich unter die Arme und führte ihn die Treppe hoch in sein Zimmer. Er liess es widerstandslos geschehen. Im folgenden Jahr, als ich Kaluga besuchte, lud er mich ins Weisse Haus ein. Ein besonderes Erlebnis. Nach der Eingangskontrolle führte man mich ins Vorzimmer, wo mich zwei Herren warten hiessen. Nach angemessener Zeit führte mich einer von ihnen, wohl der Sekretär, ins Gouverneurszimmer, einen riesigen, langgestreckten Raum. Den hatte man zu durchschreiten bis zum pompösen Schreibtisch. Aleksander blieb aber nicht sitzen, wie einstmals wohl Könige und andere Herren. Er kam mir entgegen und umarmte mich. Während unseres Gesprächs führte er mich ans Fenster und zeigte mir die benachbarte Kathedrale, insbesondere die goldene Spitzte zuoberst auf der Kuppel. Die sei auf seinen persönlichen Befehl per Helikopter aufgesetzt worden. Das erfüllte ihn mit Stolz. Dann begleitete er mich über die Strasse zum Sitz des Erzbischofs. Dieser, Kliment, liess einen kleinen Lunch auftragen. Die beiden Herren schienen sich gut zu verstehen. Ich selber hatte etwas Mühe mit dem Erzbischof (und späteren Anwärter auf das Patriarchenamt). Es wollte mir nicht gefallen, wie er – in einer notvollen Zeit – das Modell seiner künftigen Residenz vorzeigte: eine pompöse, von Ringmauern umgebene Anlage mit drei Kirchen und, in der Mitte des Komplexes, einer mehrstöckigen Residenz. Ein oder zwei Jahre danach überbrachte ich ihm einen ansehnlichen Betrag, den ich beim Hilfswerk der evangelischen Kirchen der Schweiz erbettelt hatte für den Wiederaufbau des zerstörten Tichon-Klosters. Es sollte ein Zeichen ökumensicher Freundschaft sein. Kliment zeigte sich nicht und liess sich das Kuvert vom Türhüter überbringen. Meines Wissens erhielt das HEKS nie ein Wort des Dankes. Derweil verschlechterte sich die Situation Aleksander Derjagins. Offenbar nützten Minister und Mitarbeiter, die schon zu kommunistischer Zeit im Amt gewesen waren, die Schwäche des Gouverneurs immer wieder aus. Es ist ja wohl keine Kunst, einen alkoholabhängigen Chef immer wieder auszunützen oder auszuspielen. Bei den nächsten Gouverneurswahlen ist er jedenfalls klar gescheitert. Gewonnen hat Anatoli Artamanow, der noch heute am Ruder ist. Immerhin hat die neue Regierung Derjagin nicht ganz in die Wüste geschickt. Man übertrug ihm das Amt eines Auslanddelegierten. Er sollte mit ausländischen Firmen und Wirtschaftsvertretern Kontakte aufnehmen. Ich stattete ihm in seinem Büro, das sich in einem historischen Gebäude in der Nachbarschaft des Weissen Huses befand, einen Besuch ab. Das Büro war bescheiden, von Zigarettenrauch vernebelt. Aber Aleksander freute sich über meinen Besuch. Beim nächsten Besuch wolle er mich zu sich nach Hause einladen. Es gab kein nächstes Mal. Aleksander Wassiliewitsch Derjagin ist wenig später an Krebs gestorben.
Ich reiste oft nach Kaluga manchmal allein, oft auch mit Gruppen. Valeri Slavinski und andere Bekannte bemühten sich, auf die schwierige soziale und wirtschaftliche Situation aufmerksam zu machen. Man führte mich in ein Waisenhaus, in ein Spital mit von der Strahlenkrankheit (Tschernobyl!) schwer geschädigten Kindern, aufs Land, wo in der Umgebung der Kolchose-Ruinen weite Flächen des Landes brachlagen und verwilderten. Einen besonderen Eindruck hinterliess der Besuch in der städtischen Polikinik. Die Direktorin erklärte, dass die medizinische Grundversorgung unentgeltlich geschehe. Dann öffnete sie den Schrank und zeigte mir einige blendend weisse Arztkittel. Auf die Kragen waren zwei Worte sauber aufgestickt: Bruderholzspital Basel. Die Erklärung war einfach. Valeri Slavinski hatte nicht nur mit Wiedlisbach und Thun Beziehungen geknüpft, sondern auch mit Binningen und Bottmingen. Dort war der Verein «Ein Herz für Kaluga» gegründet worden. Deren Mitglieder hatten beste Beziehungen zu Spitälern und Chemiekonzernen. Auch sie organisierten Hilfstransporte. So kamen die ausrangierten, aber gut erhaltenen Basler Arztkittel in die Poliklinik Kaluga. Man führte mich auch in ein Kleinkinderheim. Was für ein Bild! Im Hauptraum krabbelten etwa 80 Kinder herum. Sie seien alle von ihren Müttern weggegeben worden, erklärte die leitende Ärztin. Die meisten dieser Mütter seien ledig und aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Kaum eine habe ihr Kind jemals besucht. Aber all diese zumeist unerwünschten Babys krabbelten und plapperten um die Wette und erfüllten den grossen Raum mit Leben. Was für ein Kontrast! Ich fragte die Ärztin, ob diese Kinder adoptiert werden könnten, eventuell auch von Schweizer Eltern. Sie bejahte die Frage. Nach meiner Rückkehr in die Schweiz leitete ich diese Information in meinem Bekanntenkreis weiter. Tatsächlich bekundete ein Ehepaar Interessen. Nach den Abklärungen bei den hiesigen Behörden meldete es sich via russische Vermittler in Kaluga. Eine Woche verbrachten die Zwei in Kaluga, klapperten alle notwendigen Ämter ab und kehrten recht zuversichtlich zurück nach Hause. Dann geschah längere Zeit nichts. Während meines nächsten Kalugaaufenthaltes wandte ich mich an den Sozialminister Gennadi Lowetski. Ich kannte ihn seit Jahren und er zeigte sich hilfsbereit. Er liess die leitende Juristin seines Ministeriums kommen. Sie prüfte die vorhandenen Dokumente und erklärte, die seien absolut in Ordnung. Einer Adoption stehe nichts im Wege. Als die Eltern weiterhin ohne Nachricht blieben, wandten sie sich wieder an die Behörden. Da kam, unterzeichnet von Freund Gennadi, die Antwort, man sei jetzt in einem neuen Jahr und deshalb müssten alle Dokumente neu übersetzt, notariell beglaubigt und nochmals eingereicht werden. Da gab das schwer enttäuschte Ehepaar auf. Mein Ärger war erheblich. Glücklicherweise konnte das junge Ehepaar dann ein Kind vom indischen Subkontinent adoptieren. Eine Fachperson aus Kaluga meinte, vielleicht hätten sie Glück gehabt. Bei vielen Kinder aus Heimen sei nicht auszuschliessen, dass sie krank oder erblich belastet seien. Das adoptionswillige Ehepaar habe sich möglicherweise Probleme erspart.
Viele meiner Bekannten besitzen eine Datscha. Nikolai und Galina Brokmiller zum Beispiel haben es bequem. Ihre Datscha liegt nur etwa 15 Autominuten ausserhalb der Stadt. Nikolai ist ein passionierter Gärtner und Blumenfreund. Wenn man sein Paradies besucht, wird man zuallererst durch den Garten geführt und hat Gelegenheit, kleine Treibhäuser, ein Kartoffeläckerlein, Gemüsebeete und an allen Ecken und Enden Blumen zu bewundern. Das Plumpsklo in einer Ecke des Gartens verdient auch Erwähnung. Es ist mit Duftkräutern aller Arten ausgestattet. Alles ist sauber. Keine Spur von üblen Gerüchen. Die Bewirtung bei Brokmillers ist grossartig. Stets sind auch die Freunde Anastasia und William Tantlewski eingeladen. Fast immer gibt es ein Konzert des ausgezeichneten Gesangsduos Nikolai, Bass, und William, Tenor. Die Datscha der Familie Goriltschenko liegt auf einer Anhöhe über dem Flüsschen Ugra. Die Sicht auf die weite und geschichtsträchtige Ebene ist einzigartig, ebenso die Kochkunst Ljudmilas. Im Garten steht ein renoviertes Badhäuschen. Wenn es die Zeit und die Umstände erlauben, heizen die Gastgeber die Sauna auf und wir, Männlein und Weiblein säuberlich getrennt, geniessen diese schöne Prozedur. Im ehemaligen Bauerndorf Sivkovo wurden die Bauern, wie wohl überall, unter Zwang in Kolchosen eingegliedert. Sie mussten in Miethäusern wohnen, was als Fortschritt galt. Die verlassenen Bauernhäuser wurden von Stadtbewohnern übernommen, die sie für ihre Freizeit und vor allem für das Gärtnern benützten. Während vielen Jahrzehnten waren die auf den Datschas gepflanzten Kartoffeln, Gurken, Kohlköpfe und Tomaten fürs Überleben wichtig. Eines der alten Bauernhäuser in Sivkovo war die Datscha der Familie Slavinski. Ein Korridor trennt das Haus in zwei Teile. Auf der einen Seite ist das «kalte» Zimmer. Es wird nur im Sommer bewohnt und im Winter als Vorratsraum gebraucht. Auf der anderen Seite liegt das warme Zimmer. Mittelpunkt ist ein mächtiger, fast zwei Meter hoher Ofen mit Öffnungen fürs Heizen, fürs Backen und für das Rohr des Samowars. Mit einer Leiter erklimmt man die Höhe des Ofens. Dort befinden sich zwei Schlafplätze, früher vor allem für Babuschka-Grossmütterchen und Grossvater. Sie hatten dort schön warm und konnten überdies das Treiben in der Stube überblicken. Das Wasser muss in einer wunderbar klar sprudelnden Quelle unterhalb des Dorfs geholt werden. Oft haben wir in Slavinskis Datscha Feste gefeiert, zusammen mit dem Chor oder andern Bekannten und Freunden. Bei gutem Wetter stellten die Männer auf der Wiese hinter der Hütte mit Brettern Tische und Bänke auf. Die Frauen rüsteten Gemüse, brieten und kochten und buken. Dann konnte das fröhliche Treiben losgehen. Oft habe ich mir gewünscht, auf einer dieser Datschen eine stille Ferienwoche ohne jeglichen Komfort zu verbringen. Es ist nie dazu gekommen.
Ende der 90er Jahre haben mich zwei Begegnungen nachhaltig beeindruckt und zum Handeln veranlasst: der Besuch in einem düsteren Kellergewölbe und das Gespräch mit Juri Klementjew, einem Abgeordneten der Stadtduma.
Auf Anregung von Valeri Slavinski besuchte ich im Untergeschoss eines baufälligen Mietshauses eine Veranstaltung besonderer Art. Einige Frauen spielten und bastelten mit behinderten Kindern. Mir wurden im Verlaufe des Besuchs die Hintergründe dieses an sich unspektakulären Anlasses erklärt. In Sowjetzeiten waren die grossen Betriebe, Fabriken, Kolchosen und andere Kollektive, nicht nur Arbeitgeber. Sie sorgten auch für die medizinische Betreung, betrieben Einrichtungen für Behinderte, Kinderhorte, Polikliniken, Kranken- und Invalidenversicherungen, Sanatorien, eine Kulturabteilung etc. Kurz: sie verfügten über ein soziales Netz, das die meisten Notfälle aufzufangen vermochte. Der Umbruch während der 90er Jahre brach den meisten Grossbetrieben das Genick. Plötzlich gab es keine Gratismedizin mehr, keine Krankenversicherung, keine Betreuung von Kindern und von Behinderten. Für die Eltern von behinderten Kindern hiess das: Betreuung rund um die Uhr. Keine Entlastung. Heillose Überforderung. Da taten sich einige Freiwillige zusammen. Sie mieteten das beschriebene Kellergewölbe und übernahmen an zwei, später an drei Nachmittagen die Betreuung von etwa drei Dutzend behinderten Kindern. Da sie über keine Kredite verfügten, beschlossen wir, einige Thuner (der Verein Kaluga-Thun wurde erst später gegründet), dieses Unternehmen finanziell zu unterstützen. Schliesslich nahm sich auch die Stadt Kaluga der Sache an. Sie bestimmte eine Leiterin, Olga Borisowa, und besoldete einige Mitarbeiterinnen. Zudem stellte sie dem Kollektiv ein grosses Haus zur Verfügung. Allerdings: es war nicht viel mehr als eine Ruine. Geld für die Renovation gab es nicht. Wir, inzwischen zum Verein mutiert, leisteten Jahr für Jahr finanzielle Unterstützung. Olga führte die Sache sehr geschickt. Im Lauf der Jahre wurde das Gebäude renoviert, die Mitarbeiterinnen geschult und das Angebot erweitert. Das Zentrum mit dem schönen Namen Dobrota (Güte) hat sich ausgezeichnet entwickelt. Es bietet heute verschiedenste Therapien an für über 800 Kinder, die tage- oder stundenweise gefördert und therapiert werden. Wir vom Verein Kaluga – Thun sind schon ein wenig stolz, dass wir zur Entwicklung dieser kompetent geführten Institution beitragen durften.
Wie es zur Begegnung mit Juri Klementjew kam, weiss ich nicht mehr. Irgendeinmal sass ich ihm gegenüber in seinem Büro im Stadthaus. Er war Abgeordneter des Stadtparlamentes und gleichzeitig Vorsteher des Sozialamtes, ein distinguierter Herr mit grauen Schläfen und angenehmer Stimme. Im Verlauf des Gesprächs fragte ich ihn, welches seiner Meinung nach die grössten sozialen Probleme seien. Im Moment, sagte er, sind es die Strassenkinder. Unter ihnen seien viele Waisen und Halbwaisen. Ihre Eltern, so vorhanden, seien alkoholabhängig, krank, arbeitslos. Man suche für die Kinder Bezugspersonen, die bereit wären, sie für eine bestimmte Zeit aufzunehmen. Grossmütter zum Beispiel, auch entferntere Verwandte. Leider sei die Stadt nicht in der Lage, diese Pflegepersonen finanziell zu unterstützen. Spontan frage ich Herrn Klementjew, ob es erwünscht und sinnvoll wäre, diese gutwilligen, meist aber sehr bedürftigen Angehörigen mit Patenschaften zu unterstützen. Ja, das fände er sehr sinnvoll, meinte er. Ich versprach, Abklärungen zu treffen. Vielleicht finde ich in Thun ein paar Leute, anderthalb oder zwei Dutzend, die für eine Patenschaft zu gewinnen wären. So dachte ich optimistisch. Ich hatte ja schon verschiedentlich erfahren, dass die Menschen hilfsbereit sind, sofern man ihnen sinnvolle Projekte vorlegen kann. Meine Erwartungen wurden übertroffen. Bald einmal hatten sich über 40 Personen bereit erklärt, eine Patenschaft zu übernehmen. Das Unternehmen musste aber organisiert werden. In Thun gründeten wir einen Verein mit Statuten, Vorstand, Postcheckkonto und einem tüchtigen Sekretär. In Kaluga fanden wir drei Persönlichkeiten, die ein Komitee bildeten. Juri Klementjew erklärte sich bereit, sodann eine Sozialarbeiterin des Erziehungsdepartementes und – ganz wichtig – Ljudmila Goriltschenko als «Geschäftsführerin». Ihr bezahlten wir einen bescheidenen Lohn. Und so funktionieren die Patenschaften bis heute: unsere Mitglieder zahlen pro Jahr 160 Franken. Wir überbringen das Geld persönlich nach Kaluga. Dort organisiert Ljudmila alle drei Monate eine Zusammenkunft, an der die begünstigten Familien jeweils 40 Franken pro Kind abholen und den Empfang quittieren. Der Betrag mag, gemessen an schweizerischen Verhältnissen, gering sein. In Russland jedoch war die Kaufkraft um ein vielfaches höher. Er reichte aus, um Jacken, Winterschuhe und dergleichen zu kaufen. Im Laufe der Jahre verdoppelte sich die Zahl der Paten. Schliesslich konnten 120 Patenkinder bzw. Patenfamilien unterstützt werden. Unsere Aktion zeitigte Nebenwirkungen. Die Stadtduma genehmigte Beiträge für die Betreuung der Strassenkinder. Wir konnten fortan eine neue Zielgruppe unterstützen: Kinder und Familien, die an oder sogar unter der Armutsgrenze leben. Deren gab und gibt es viele. Nach Juri Klementjew leitete nun Soja Artamanowa das Sozialamt der Stadt Kaluga. Sie – nebenbei bemerkt: Gattin des Gouverneurs – und ihre Mitarbeiterinnen lieferten uns die Adressen. So konnten wir darauf vertrauen, dass unser Geld an die richtigen Leute gelangte. Die Bemerkungen auf den Verzeichnissen sprachen für sich. «Vater (oder Mutter) gestorben. Eltern alkoholabhängig. Vater unbekannten Aufenthaltes. Vater im Gefängnis. Kind lebt bei Grossmutter, Eltern verstorben. Mutter alleinerziehend, sieben Kinder. Mutter hat Familie verlassen». Mit Soja Artamanova verband uns eine besondere Beziehung. Fast immer, wenn wir in Kaluga waren, statteten wir ihr einen kurzen Besuch ab, brachten und empfingen kleine Geschenke, tranken Tee miteinander. Einmal war ich allein zu Besuch. Im Verlauf des Gesprächs zeigte sie mir zwei Fotos, die sich, schön eingerahmt, auf ihrem Schreibtisch befanden: ihr Mann an der Seite Putins und sie selbst, auch mit Putin. «Schliesslich muss man etwas haben fürs Herz», erklärte sie mir stolz und geradezu treuherzig. 2016 kündigte sie die Zusammenarbeit auf. Aus Gründen des Datenschutzes sei diese leider nicht mehr möglich. Wir nahmen es gelassen. Ljudmila und ihre zwei neuen Mitarbeiterinnen kennen sehr viele bedürftige Familien. Sie bekommt jahraus und jahrein Anfragen und verfügt über eine lange Warteliste. Wenn am Ende des Jahres die 17jährigen keine Beiträge mehr bekommen, kann sie die Liste der Patenkinder ohne Probleme mit neuen Namen ergänzen.
Nebst dem blühenden Zentrum «Dobrota» hat unser Verein im Lauf der Jahre noch andere Institutionen unterstützt. Etwa das Sanatorium «Waldmärchen». Dort werden mehrere hundert Tschernobyl-geschädigte Kinder betreut. Jährlich kommen sie für drei Wochen ins Sanatorium, das mitten im Wald liegt. Sie werden genau untersucht, erhalten notfalls neue Medikamente verschrieben und kehren dann wieder nach Hause zurück. Die Kinder sind bereits Opfer in dritter Generation. Ihre Grosseltern wurden 1986 verseucht, zum Teil bei Aufräumarbeiten am Katastrophenort. Die schädlichen Mutationen pflanzen sich fort. Nicht nur, wie es in der Bibel heisst, «bis ins dritte und vierte Glied», sondern über viele Generationen hinweg leiden sie an den Folgen der Strahlenkrankheit: Diabetes, Blut- und Muskelkrankheiten.
Im Dorf Schiletowo wurde vor einigen Jahren ein Heim eröffnet für verwahrloste Kinder und Jugendliche im Rayon. Ihrer 20 leben im Internat, ebenso viele besuchen während des Tages die Schule des Zentrums. Das Heim mit dem schönen Namen «Raduga» (Regenbogen) bietet den Kindern neben dem Schulunterricht zahlreiche Therapiemöglichkeiten und Angebote für die Freizeit. Leiterin ist die junge Sozialpädagogin Maria Valevatsch. Wurzeln der Verwahrlosung sind meistens die kaputten Familien. Sie werden von Spezialisten regelmässig aufgesucht und beraten. Dank einer gezielten Spende aus Thun konnten die Leute von «Raduga» eine Eheberatung aufbauen, meines Wissens fast ein Unikum in Russland.
Seit einem Jahr gehört auch ein grosses Schulinternat für Gehörlose und Hörbehinderte zu unserer «Kundschaft». 200 Kinder leben hier im Internat und werden auf alle möglichen Arten geschult. Wir gewannen bei unserem Besuch einen ausgezeichneten Eindruck.
Alle diese Institutionen haben Gemeinsamkeiten. Die Gebäulichkeiten werden von der Stadt oder vom Oblast zur Verfügung gestellt. Diese bezahlen auch die Löhne und übernehmen die Kosten für Ernährung, für Medikamente und ambulante ärztliche Betreuung. Lang ist aber die Liste der Dinge, die nicht bezahlt werden: Unterhalt und Renovationen der Gebäulichkeiten, Reparatur von Apparaten, Anschaffung von Spielsachen und besonderem Unterrichtsmaterial. Kosten für Ausflüge, Exkursionen. Auch für die Reparatur- und Benzinkosten der betriebseigenen Autos müssen die Mittel irgendwie zusammengekratzt werden. Eben für solche scheinbar nebensächlichen, jedoch enorm wichtigen «kleinen Dinge» greifen wir den Institutionen unter die Arme, jährlich mit je etwa 4000 Franken. Über deren Verwendung wird genaue Rechenschaft abgelegt. Wiederum liesse sich einwenden: eine bescheidene Unterstützung. Wir bilden uns darauf auch nichts ein. Aber wir erleben, wie Menschen ermutigt werden durch unser Interesse und unsere Teilhabe an ihrer Arbeit. Sie haben an vielen Fronten zu kämpfen und erleben mancherlei Enttäuschungen. Darum ist für sie jede positive Erfahrung lebenswichtig. Darf man sogar sagen: überlebenswichtig.
Oft wird man gefragt: Warum tut ihr dies? Eure Spender kennen uns doch gar nicht! Manchmal antworte ich darauf mit dem Hinweis auf das Gleichnis von jenem Samaritaner, der auf dem Weg nach Jericho einen verletzten und ausgeraubten Mann liegen sieht. Er fragt nicht: wer bist du? Er steigt von seinem Reittier, bückt sich, verbindet die Wunden und transportiert den Verletzten zum nächsten Gasthaus. So einfach ist das für den, der Augen hat zu sehen und Ohren hat zu hören. Eine weitere Gemeinsamkeit vieler Institutionen in Russland: sie werden fast ausschliesslich von Frauen getragen. Von Direktorinnen wie Olga Borisowa, Maria Valevatsch und Chefärztin Valentina im «Waldmärchen», und vom Kader bis zu den Hilfsarbeiterinnen. Alles Frauen. Zuallermeist ausserordentlich tüchtige, hartnäckige, kluge und grossherzige Frauen. Jürg, mein Bekannter, Stipendiat in Moskau, pflegte pointiert zu sagen: er kenne kein Büro, kein Institut und keinen Betrieb, der ohne die Tüchtigkeit der Frauen existieren könnte. Ähnliches wäre wohl von vielen Familien zu sagen, wo die berufstätige Frau und Mutter nach Feierabend die Einkäufe und den Haushalt managt, währenddem der Herr Gemahl in Pantoffeln auf dem Sofa sitzt und TV guckt.
Eine langjährige Beziehung verbindet unsern Verein mit der Bauernfamilie Blinow im kleinen Dorf Piatnizkoje, etwa vierzig Kilometer südwestlich von Kaluga. Ende der Neunzigerjahre wagt es das Ehepaar Lena und Slava Blinow, ihr Leben völlig neu zu gestalten. Lena ist Kleinkinder-Erzieherin, Slava arbeitet in einer Fabrik als Vorarbeiter. Ihre drei Kinder haben ihre Ausbildung abgeschlossen und sind zum Teil ausgezogen. Schon immer wollte das Paar auf dem Land wohnen. Da bietet sich die Gelegenheit, von einer ehemaligen Kolchose Land zu kaufen. Es ist billig, niemand hatte damals Interessen an Landwirtschaft. Die Hälfte der Bewohner in dem zur Kolchose gehörenden Dorf ist in die Stadt gezogen. Blinows kaufen nebst hundert Hektaren Land ein paar Holzhäuser, alle in desolatem Zustand. Sie beginnen das grösste Haus in Pjatnizkoje zu renovieren und ein oder zwei Hektaren verwildertes Land zu bebauen. Sie kaufen ein paar Hühner, einige Ziegen, einen Hund und eine Kuh. Sie sind mit Feuereifer bei der Arbeit. Freilich haben sie nicht nur die Landwirtschaft im Sinn. Lena kennt so viele zerrüttete Familien und verwahrloste Kinder. Wie gut täte es ihnen, auf dem Land aufzuwachsen, in der freien Natur, mit den Tieren. Beim Erziehungsdepartement melden sie die Bereitschaft, solche Kinder in Obhut zu nehmen. Jewgenia Manochina, eine der Leiterinnen, prüft das Gesuch und gibt grünes Licht.
(2) Lena Blinova mit ihren Pflegekindern
So fanden in den nächsten Jahren neun Kinder eine neue Heimat. Sie fühlten sich sichtlich wohl in der Grossfamilie. Die Distanz zum Lärm und Schmutz der Stadt, das Herumtollen im Freien, der Umgang mit den Tieren. Alles hatte positive Auswirkungen. Der Betrieb wuchs. Eine weitere Kuh wurde dazugekauft. Verwilderte Katzen wurden gefüttert und gezähmt. Fast alles wunderbar. Leider bekamen Blinows wenig finanzielle Unterstützung. Sie hatten ja nicht den Status eines öffentlichen Heims. Sie waren Privatleute. Da wandte sich Jewgenia Manochina an unseren eben erst gegründeten Verein und bat um Unterstützung. Zunächst sprachen wir allen neun Kindern Patengeld zu. Damit konnte sich die Grossfamilie einstweilen über Wasser halten. Jedes Jahr, wenn man zu Besuch kam, war Einiges neu im alten Haus: ein Aufenthaltsraum, ein Schlafzimmer, eine Treppe, die Wasserpumpe, das Badhaus. Slava war ein handwerklicher Tausendsassa. Die Kinder besuchten die Dorfschule. Zwei Knaben allerdings waren derart behindert, dass ein Schulbesuch nicht in Frage kam. Ein schwerer Schicksalsschlag traf die Grossfamilie. Unerwartet starb Vater Slava, wohl an einem Herzversagen. Wie sollte Mutter Lena es schaffen, den Betrieb weiterzuführen und die Kinderschar zu erziehen? Die Situation schien ausweglos. Doch es traf sich, dass der jüngste Sohn des Ehepaars, Iwan Blinow, seinen zweijährigen Militärdienst eben hinter sich gebracht hatte. Nach einigem Zögern willigte er ein, die Stelle seines Vaters einzunehmen. Ob Zufall oder Schickung: vor dem Militärdienst hatte er zwei Semester an einer Landwirtschaftsschule studiert. Es dauerte einige Monate, bis sich der Betrieb eingependelt hatte und, vor allem, die grösseren Kinder Iwans Autorität anerkannten. Weitere Probleme hielten Blinows in Atem. Die hauseigene Quelle drohte zu versiegen. Es musste unbedingt eine neue Wasserleitung gegraben und ein Wasseranschluss im Haus installiert werden. Unser Verein gewährte einen Sonderkredit. Knapp vor Wintereinbruch war das Werk getan. Währenddem Slava nur einen kleinen Teil des Landes genutzt hatte, wollte Ivan die Wirtschaft erweitern. Dies umso mehr, als die Behörden allen Eignern von unbebautem Land Strafsteuern androhten. Mit dem winzigen Pflug und dem uralten asthmatischen Traktor, der alle paar Tage streikte, war dies unmöglich. Und siehe da – ich wiederhole mich: wenn man gute Projekte präsentieren kann, finden sich Menschen, die sich engagieren. Sponsoren aus Thun stellten eine sehr grosszügige Summe zur Verfügung. Iwan konnte einen neuen Pflug und, in Weissrussland, einen neuen Traktor erwerben. Grosse Flächen kamen unter den Pflug und wurden angesät. Eine reiche Heuernte ermöglichte die Anschaffung neuer Kühe. Inzwischen sind es wohl dreissig Stück. Sieben der neun Pflegekinder sind inzwischen ausgezogen und haben zum Teil gute Berufslehren absolviert. Nur die zwei behinderten Burschen sind auf dem Hof geblieben. Sie verrichten leichtere Arbeiten. Anderswo wäre für sie keine Arbeitsstelle und vermutlich auch kein Heim zu finden. Vor jedem Besuch beschwören wir Lena, sie möchte uns doch bloss eine Tasse Tee aufstellen. Alles vergeblich. Der Tisch in der Wohnstube ist immer reich gedeckt. An der Stirnwand hängt ein Foto des verstorbenen Slava. Links und rechts davon ganze Reihen von Diplomen und Anerkennungen, ausgestellt von der Stadt und sogar vom Gouverneur. Der hat vor Jahren persönlich eine derartige Anerkennungsurkunde mit der Laudatio «Beste Familie» überreicht. Eine Equipe vom Fernsehen war bestimmt auch dabei. In Russland liebt man derartige Urkunden und Übergabe-Zeremonien. Sie sind für die Regierung wesentlich billiger als eine effiziente materielle Hilfe.
Kaluga veränderte sich. Ausländische Investoren entdeckten die Stadt an der Oka. Zum Beispiel VW. Zufälligerweise war ich an dieser Entwicklung auch ein klitzekleines Bisschen beteiligt. Schätzungsweise 2004 telefonierte mir ein Herr aus Wolfsburg. Seine Firma beabsichtige, in Kaluga ein Werk aufzubauen. Er sei der Verantwortliche und suche nach Adressen von Leuten, die Wohnungen vermieteten oder Sprachkurse anböten. Nach einigem Nachfragen konnte ich ihm ein paar wenige Adressen liefern. Wie er wohl auf mich gekommen war? Vermutlich hatte er sich im Internet umgesehen. Damals fanden sich wohl noch nicht allzu viele Westeuropäer, deren Namen in Zusammenhang mit Kaluga registriert waren. Ich habe den Anrufer einmal ganz kurz in Kaluga getroffen. Es war vor der Eröffnung der Fabrik im Jahre 2007. Kaluga boomte. Denn nicht nur VW, sondern auch Volvo, Peugeot und Renault bauten hier ihre Fabriken. «Wir werden zum Detroit Russlands», kommentierte Nikolaj Brokmiller – mit kritischem Unterton. In der Tat hatte der Aufschwung auch seine Kehrseiten. Die Rekrutierung der Mitarbeiter erwies sich als schwierig. Die 150 000 Facharbeiter in der Rüstungsindustrie, die nach dem Zusammenbruch arbeitslos geworden waren und sich seither irgendwie durchzuschlagen versuchten, hatten in den vergangenen 15 Jahren ihre Berufskompetenz eingebüsst. Zur Rekrutierung der nötigen Arbeitskräfte beauftragte VW den Schweizer Arbeitsvermittler Adecco. Die anfängliche Begeisterung verebbte. Es sprach sich herum, dass VW nur niedrige Löhne zahlte. Dazu kam, dass die Produktionsziele bei weitem nicht erreicht wurden. Statt der ursprünglich geplanten 120 000 Autos pro Jahr wurden weniger als die Hälfte hergestellt. Ausländische Ingenieure und Monteure bevölkerten Hotels und Restaurants und kauften Wohnungen. Deshalb stiegen die Boden- und die Mietpreise drastisch an. Einheimische können da kaum mithalten. Die Schere zwischen reich und arm öffnet sich immer mehr. Oligarchen vergnügen sich in St. Moritz und kaufen westliche Fussballklubs. In Russland müssen viele den Gürtel eng, sehr eng schnallen. Im Winter 2016/17 sah sich die Stadtregierung gezwungen, Lebensmittelgutscheine auszuteilen, an Alleinerziehende, kinderreiche und verarmte Familien. Ich bin jedenfalls überzeugt, dass das Engagement des Vereins Kaluga – Thun weiterhin sinnvoll ist.
Ich möchte den Bericht über meine Russlandbeziehungen nicht mit dem Thema «Wirtschaft» beschliessen. Zwar rede ich nicht gern von der «russischen Seele». Dieser Begriff ist mir zu diffus und gleichzeitig zu abgegriffen. Aber ich erzähle gern von der unglaublichen Herzlichkeit der russischen Menschen, von ihrer Gastfreundschaft, ihrer Wärme und ihrer Liebe zu Musik und Literatur und Kunst, aber auch von ihrer Religiosität.
Die tiefe Gläubigkeit vieler Russen beeindruckt mich, obschon mein von der Reformation und der Aufklärung geprägtes theologisches Denken viele Fragezeichen setzt. Bekanntlich hat die Aufklärung Russland nur ganz oberflächlich gestreift. Biblische und andere Wundergeschichten werden kaum hinterfragt. An der Leningrader Akademie fragte ich Studenten, die vorher an der Universität studiert und naturwissenschaftliche Fächer belegt hatten: wie denkt ihr zum Beispiel über die Geschichte, wonach Mose mit einem Stecken aufs Wasser geschlagen hat und dieses sich teilte, sodass die Israeliten zwischen den Wassermauern durchmarschieren könnten? Die Antwort lautete: hier ist die eine Welt, dort die Andere. Das lassen wir einfach so stehen. An einer Ausstellung von Ikonen des Heiligen Nikolaj kam ich ins Gespräch mit einer Aufseherin, einem freundlichen Mütterchen. Sie erläuterte mir die Wundertaten des populären Heiligen. Der Teufel hatte sich im Dorfbrunnen versteckt. Niemand konnte Wasser schöpfen. Da vertrieb der Heilige den Teufel. Dieser nistete sich in einem Holzstapel ein. Das Holz wurde hart wie Stein, niemand konnte es zu Scheitern zerkleinern. Wieder vertrieb Nikolai den Satan. Auch erweckte er verschiedentlich Tote wieder zum Leben. Das erzählte die Frau so, als wären diese Wunder gestern geschehen, als eine selbstverständliche und tröstliche Realität. Hätte ich ihr diese naive Gläubigkeit ausreden sollen? Einmal Kürzlich hatte ich Gelegenheit, an einer Wallfahrt zu Ehren der heiliggesprochenen Grossfürstin Elisaweta Fjodorowna teilzunehmen. Dazu einige Vorbemerkungen. Elisaweta war die Tochter des Erbprinzen Ludwig von Hessen, Enkelin der Königin Viktoria. Ihre Schwester hatte den letzten Zaren, Nikolaj II, geheiratet. Sie selber ging die Ehe mit dem Zarenbruder, Grossfürst Sergej, ein. Der fromme, aber als Polizeichef von Petersburg verhasste Sergej kam bei einem Bombenanschlag ums Leben. Elisaweta, schon längst zur Orthodoxie konvertiert, gründete ein Kloster und engagierte sich stark für die Armen. Nach der Revolution wurde sie umgebracht und starb als Märtyrerin. 1992 wurde sie, wie die ganze Zarenfamilie, von der russisch-pravoslavischen Kirche heiliggesprochen. Noch vor der Revolution war sie einmal mit der Eisenbahn nach Koselsk und von dort mit der Kutsche zum Kloster Optina Pustyn gereist. Eingeladen vom Wallfahrtsverein Kaluga fuhren wir auf ihren Spuren per Autobus nach Koselsk. Ein geschmücktes Auto mit der Ikone Elisawetas war uns vorausgefahren. Eine grosse, festlich gestimmte Gemeinde versammelte sich vor dem Bahnhofgebäude, wo eine Gedenktafel enthüllt wurde. Viele Redner priesen die Heilige, zuerst der Bischof, dann ein Minister des Oblast. Kirche und Staat in voller Eintracht.
(3) Wallfahrt mit Ikone der hl. Elisabeth
Anschliessend wurde die Ikone in eine geschmückte Droschke gesetzt wie eine lebendige Person. Ausser dem Kutscher vorne auf dem Bock sass kein Mensch im Gefährt. Droschke voran und Bus im Schritttempo hinterher tuckerten wir bis zum Kloster. In der Klosterkirche wurde die Ikone vielfach gesegnet und beräuchert, sodann zur Einsiedelei des berühmten Starzen Amwrossi getragen und zuallerletzt ins Frauenkloster Schamardino gebracht. Mit einem feierlichen Mittagessen im Klosterrefektorium endete die Wallfahrt. Es war ein heisser Tag, wir waren alle sehr durstig. Vor uns auf den Tischen standen Karaffen mit Wasser und Fruchtsaft. Doch wehe, wenn jemand die Hand nach der Tranksame ausstreckte. Die Nonnen, verteilt im ganzen Saal wie Wachthunde, stürzten sich auf die Übeltäter. Aufstehen oder Platz wechseln durfte man auch nicht. Erst nachdem vorne an der Ehrentafel Bischof und Minister mit der griesgrämigen Äbtissin Platz genommen und schier endlos gebetet hatten, durften wir den Durst löschen. Es war eine zwiespältige Erfahrung. Ob diese Wallfahrt mit allem Drum und Dran der Heiligen Elisaweta gefallen hätte? Jedenfalls schweiften meine Gedanken um mehr als ein Dutzend Jahre zurück, zu meinem ersten Besuch in Schamardino. Eben erst waren einige Nonnen mit ihrer jungen Äbtissin eingezogen. Die gewaltige Kirche lag noch grossenteils in Trümmern. Die Nonnen wohnten in bescheidenen Baracken. Ein kleiner Saal diente als Kirche. Aber die Äbtissin war überaus freundlich und hatte nichts von der frommen und strengen Verbitterung der Frau, die dort vorne an der Ehrentafel sass. Ihre Vorgängerin hatte mir übrigens ein kostbares Andenken geschenkt: ein Buch mit Briefen und Gedanken des ehrwürdigen Amwrossi, Gründer des Klosters und Dostojewskis Vorbild für die Romanfigur Starez Sossima.
Den Stellenwert der Künste mag folgende Erinnerung illustrieren. Eines Sonntags war ich zu einer Schifffahrt auf der Oka eingeladen. Froh gestimmt tuckerten wir durch die malerische Flusslandschaft. Die Stadt hatten wir hinter uns gelassen. Links das vom Wald gekrönte hohe, und rechts das flache Ufer. Eine Naturlandschaft ohnegleichen. Ein Hirsch durchschwamm vor unserer Nase den Fluss. Es herrschte eine sehr aufgeräumte Stimmung, es wurde viel geredet und gelacht. Auf einmal verstummte die muntere Gesellschaft. Jemand hatte gerufen «Seht, das Haus von Richter»! Alle richteten ihre Blicke auf das linke Ufer, wo hinter den Baumwipfeln der Giebel eines Hauses hervorlugte. Eine Minute der Stille, ja, der Andacht folgte, bis das Dach nicht mehr zu sehen war. Die kleine Szene lässt nicht nur die Verehrung für den grossen Pianisten Swjatoslaw Richter erahnen und den Stolz, dass der Gefeierte sein Ferienhaus an der Oka und so nahe von Kaluga erbaut hatte. Sie manifestierte den hohen Stellenwert der Musik überhaupt. Später tauchten am rechten Ufer ein paar hinter Bäumen verborgene Häuser auf. Das sei das Dorf Polenovo und dort, im grössten Haus, habe der berühmte Maler Polenov gewirkt. Wieder herrschte einen Moment lang andächtige Stille. Ziel des Ausflugs war die kleine Stadt Tarussa. Zahlreiche Schriftsteller und Musiker hatten in und um diesen Ort Sommerferien verbracht oder sogar längere Zeit gelebt. Zwei Literaten sind besonders zu erwähnen. Einmal der bedeutende Erzähler Konstantin Paustowski, der viele Jahre in Tarussa lebte. Sodann die Poetin Marina Zwetajewa. Ihr Vater, Gründer des Moskauer Puschkin-Museums, erwarb in Tarussa ein Haus. Dort verbrachte die Familie stets ihre Sommerferien. 1922 wohnte Marina, die mit Pasternak, Ossip Mandelstamm und andern Literaten befreundet war, den ganzen Sommer über dort. Ihr ist ein kleines Museum gewidmet, wo ihr tragisches Schicksal dokumentiert wird. Sowohl für die Zwetajewa wie für Paustowski hat man in Tarussa Denkmäler errichtet. Jeden Tag legen Menschen frische Blumen zu Füssen der in Bronze gegossenen Persönlichkeiten. Allen Dichtern in ganz Russland wird solche Ehre zuteil. In der Schweiz habe ich zu Füssen der Denkmäler von Gotthelf oder Gottfried Keller noch nie Blumen entdeckt!
(4) Denkmal Zwetaewa in Tarussa
Hervorzuheben ist Alexander Puschkin. Nicht nur durch Blumen erweist man ihm Reverenz. Auffällig ist, wie viele Menschen Gedichte des grossen Dichters auswendig wissen. Zweimal besuchte ich den Ort Polotnjani Savod. Dort lebte einst die Fabrikantenfamilie Gontscharow mit ihrer schönen Tochter Natalja, der späteren Frau Puschkins. Der Dichter hielt sich insgesamt nur wenige Wochen an diesem Ort auf. Trotzdem errichtete man hier eine bedeutende Gedenkstätte. Im herrschaftlichen Haus befindet sich ein Puschkin-Museum. Dazu gehört auch ein grosser Park. Zweimal bin ich dort spazieren gegangen, einmal in Begleitung von Anastasia Tantlewski und einmal mit Olga Borisowa. Beide Frauen begannen, kaum hatten wir den Park betreten, Verse von Puschkin zu rezitieren. Ihr Gedächtnis schien unerschöpflich. Mehr als eine halbe Stunde lang reihten sie ein Gedicht an das Andere. Ich verstand nur wenig, russische Gedichte sind sehr schwer zu verstehen – akustisch und inhaltlich. Aber ich spürte, wie sich die beiden Frauen mehr und mehr in eine innere Bewegung steigerten und sich die Dichterworte gleichsam einverleibten. So sehr, dass beide ihre Tränen nicht zurückzuhalten vermochten. Das bewirkt eben Puschkin, noch hundertfünfzig Jahre nach seinem tragischen Tod. Dazu Dazu fällt mir noch eine weitere Episode ein. Während meines Aufenthalts in Leningrad besuchte ich Puchkins Wohnhaus an der Moika. Eine Studentin führte uns durch die verschiedenen Räume. Zum Schluss standen wir im Sterbezimmer des Dichters. Er war in einem unglückseligen Duell verwundet worden und starb nach einigen Tagen. Da standen wir also in diesem schicksalsträchtigen Raum. Das Bett an der Rückwand, der Schreibtisch samt Feder und Tintenfass. Und auf dem Schreibtisch eine grosse Standuhr. Ihre Zeiger hatte man auf die Todesstunde gestellt. Unsere Führerin war im Begriff, darüber zu sprechen. Plötzlich hielt sie inne, wandte sich ab und begann herzzerreissend zu schluchzen. So ist es mit Puschkin und den Russen. Ich habe Respekt.