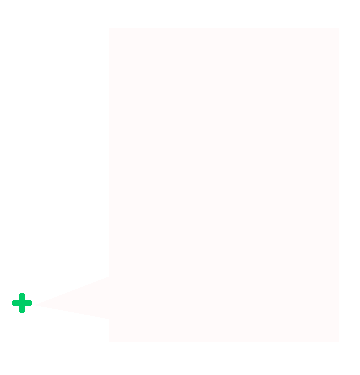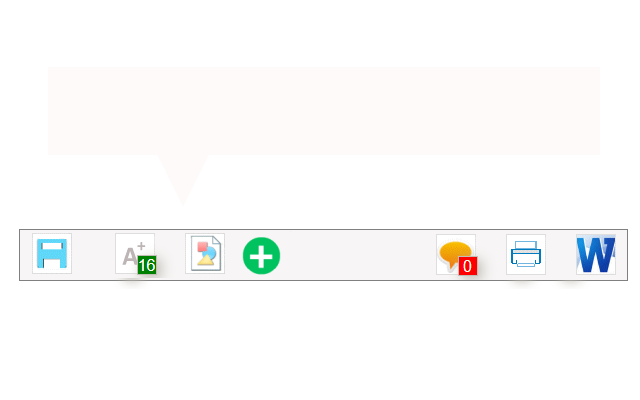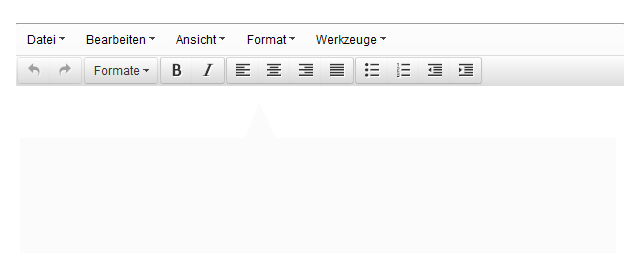Zurzeit sind 519 Biographien in Arbeit und davon 290 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 176

Wenn sich die Wolken des Vergessens, die unser Gedächtnis umhüllen, auf Anlässe von innen, aussen oder aus den Tr
äumen an manchen Stellen lichten, ist es entscheidend, wo die Strahlen des Erinnerns hinfallen: Auf einen ruhigen, glatten Bergsee, auf Berge mit Nadel-, Laub- oder gemischten Wäldern, auf Wiesen und Alpen, in welcher Jahres- und Tageszeit und in welchem Abstand und Winkel. Spiegelt der See sie uns direkt in die Augen und sie blenden, schmerzen uns sogar, oder wir können sie ruhig und ungestört von der Seite beobachten. Beleuchten sie nur manche Gipfel und Bergkämme, sehen wir die Mulden und Täler oder im Dunst nur die einfachen glatten Flächen der Hänge?

(1) Lago Maggiore - Blick von Agra.
*
Wer bin ich? Der Mensch möchte wissen, woher er kommt, wer Mutter, Vater, Grosseltern sind. Er möchte eine vollständige Geschichte erzählen können über sich, mit einem Anfang und mit einem Ende, das ist menschentypisch. Die Frage nach der Herkunft, sagen Kulturwissenschaftler, sagen Psychologen, werde für die Menschen wichtiger in einer Welt, die unübersichtlich ist, in der Beziehungen oft unverbindlich sind. Dafür braucht der Mensch genaue Orte und genaue Zahlen. Er möchte sich alle Fragen beantworten, weil er glaubt, dass die Beantwortung aller Fragen ihn zu seiner wahren Geschichte führt. Er will wissen: Wie sind meine Eltern, wie meine Geschwister? Was ist einzigartig an mir? Wie ist meine Identität?
Hardinghaus B: Das falsche Leben. Der Spiegel 2012;(11):52-6
*
Wir haben keine Ahnung, was unsere Nachkommen wissen müssen, um sich besser zu verstehen.
Pierre Nora
*
Im Sommer nach meinem 80. Geburtstag reisten wir in die Slowakei, in die Gegend meiner Kindheit. Ich wollte sie meinen Enkelkindern zeigen. Gleichzeitig wurde dieser Bericht (halb-) fertig, mit dem Vorteil und der Belastung, dass man ihn weiterhin ergänzen und verbessern kann. Ich schrieb ihn vor allem für meine Nachkommen, auch als Wiedergutmachung an meine Mutter, die mir über ihre Kindheit, ihre Probleme und über ihr Leben gerne erzählt hätte. Ich lehnte es leider grob ab. Ich war eben mit dem Aufbau und der Gestaltung meines Lebens in einem anderen Land beschäftigt. Sie sollte es mir nicht mit alten, teilweise sehr traurigen Geschichten erschweren. Merkwürdig, fast in derselben Zeit, Mitte vierzig, familiär und beruflich endlich verankert, überfiel mich das Bedürfnis über meine gegenwärtigen Erlebnisse und Erfahrungen zu schreiben. Manche Berichte wurden als Auffrischung und Ablenkung von den trockenen und ernsten Themen in den ärztlichen Zeitschriften veröffentlicht. Sie bilden den mittleren Teil dieses Lebenslaufes.
Später, nach dem Tod meiner Mutter, wurde mir bewusst, wie töricht ich war. Wie die Geschichte nicht nur für das eigene Leben, für das Verständnis des eigenen Schicksals ist. Deswegen schrieb ich über meine Kindheit, was natürlich am Anfang des Lebenslaufes steht.
Je mehr ich mich meinem Tod nähere, desto mehr beschäftigt mich das Alter und das Sterben. Die Ergebnisse bilden das Ende des Lebenslaufes, der vor der Geburt beginnt und nicht mit, sondern nach dem Tod endet.
Die einzelnen Abschnitte sind verschieden lang und eigentlich selbständig. Sie spiegeln mein abwechslungsreiches Leben. Es gibt traurigere und lustigere. Ich hoffe, der eine oder andere spricht den Leser an. Sofern sich überhaupt Leser finden, können sie beginnen, wo es sie gelüstet, am Ende, in der Mitte oder am Anfang und beliebig von einem Thema zum anderen springen.
*
Danken möchte ich meiner Frau Silvia, die mit mir einen grossen Teil der Geschichten erlebte und die Mühe auf sich nahm und nimmt, deren Inhalt mit mir kritisch zu besprechen sowie Sprache, Stil und Grammatik zu verbessern. Von ihr stammen auch die Fotos von unserem gemeinsamen Leben, viele derjenigen aus der Kindheit von meinem Bruder Palko. 
(2) Silvia

Zu den vielen kleinen und grossen Begebenheiten, Umständen, Ereignissen und den vielen guten, anständigen Menschen, die uns retteten, dank denen wir am Leben geblieben sind, trug auch bei, dass wir in einem Haus hinter den Bahngeleisen wohnten, meinte mein Vater. Grossvater Josef Langer war zwar kein Angeber, aber auf Ansehen und Ruf achtete er sehr. Der ältesten Tochter Jolan gab er als Mitgift einen grossen Teil seiner Landwirtschaft. Als mein Vater Aurelia, die zweite Tochter, heiratete, richtete er ihm einen kleinen Speditionsbetrieb ein, weil Vater die Handelsschule absolviert hatte und so ein Betrieb damals in Martin sowie im ganzen Turiec noch nicht existierte. Ja, Grossvater Langer mangelte es nicht an guten Ideen, nur mit ihrer Verwirklichung haperte es manchmal. Er wollte ursprünglich dafür ein Haus in der Mitte der Stadt an der Hauptstrasse kaufen und damit zeigen, wie weit er es und seine Töchter gebracht hatten. Mein Vater, ein nüchterner, realistischer Mensch, entschied sich aber lieber für ein einfacheres Haus an der Arbeiterstrasse nicht weit vom Bahnhof. Anscheinend soll ich eine unausgewogene, wechselhafte Mischung zwischen dem Grossvater Langer und Vater sein.
(1) Hauptstrasse in Martin: Der Ursprung des alten Fotos ist nicht feststellbar.
Gegenüber unserem Haus, auf der anderen Seite der Strasse, befand sich ein grosses Gelände mit aufgetürmten Holzstämmen, das als Lager der nahen Zellulosefabrik diente. Diese Stämme wurden vor allem im Winter auf den schneebedeckten Strassen, die weder gepflügt noch gesalzen wurden, von Pferden auf Schlitten aus den Wäldern geschleppt. Wenn man sich am Ende des Baumstammes hielt, konnte man sich mehrere hundert Meter ziehen lassen, was aber nicht jeder Fuhrmann erlaubte, da er seine Pferde schonen, Ordnung halten und die bösen, unerzogenen Buben erziehen wollte. Wir sprangen erst ab, wenn er uns mit der Peitsche drohte. Es war eine der wirklichen Arten des Spiels „Räuber und Gendarmen“. Dieses Treiben war von unseren Eltern aus anderen Gründen verpönt und verboten: Die Schuh-, Stiefel- und besonders die Filzschuhsohlen gingen schneller kaputt. In den Kriegsjahren waren sie, wie alles, rar und wertvoll. Zwischen den gelagerten Holzstämmen konnte man, auch wenn der Zutritt streng verboten war, wunderbar „Versteckis“ spielen. Ab und zu tauchte ein Aufseher auf. Wir flohen dann schnell weg, sonst bekam man nicht nur das Gesäss gnadenlos versohlt, sondern wurde auch von den anderen Mitspielern schadenfreudig gehänselt und verachtet, weil man sich vom Aufseher hatte fangen lassen. Wieder eine andere Art des Räuber- und Gendarm-Spiels
(2) Martin - Hlavna ulica a namestie roky neskor. Povod fotky sa sucasne neda urcit.
Unsere Arbeiterstrasse war fast eine Naturstrasse. Sie hatte viele Löcher, die bei Regen mit matschigem Schlamm gefüllt und mit dickerem umgeben waren. Als Fussgänger musste man zwischen ihnen hüpfen, um nicht manchmal doch noch mit den Schuhen tief im Schlamm zu versinken, der nicht nur mit dem Mist unserer Pferde, sondern auch mit dem der Kühe vermischt war, die hier in wärmeren Jahreszeiten von Hirten mit Hunden getrieben morgens eher zügig weiden gingen und abends satt und gemächlich in ihre Ställe zurücktrotteten. Dadurch war Schuhputzen eine tägliche Aufgabe: Entweder waren sie von Schlamm oder in trockenen Zeiten von Staub dick belegt. Das Leder der Schuhe war damals nicht so gut präpariert wie heutzutage. Man konnte nicht einfach den Schmutz mit Wasser abspülen und sie schnell trocknen lassen. Jeder besass „Galoschen“, grosse Halbschuhe aus Gummi, welche man über die Schuhe stülpte, wenn es regnete, was man damals selten im Voraus wusste – es gab weder im Radio noch in den Zeitungen Wettervorhersagen. Fernsehen existierte überhaupt noch nicht. Mein Vater, ein vorsichtiger Mensch, war im Stande, wenn es ihm schien, dass Regen kommen könnte, sicherheitshalber schon im Voraus die Galoschen einzupacken und mitzunehmen. Meistens regnete es dann wirklich. Uns Kindern war eine solch übertriebene Vorsicht fremd. In unregelmässigen Abständen, die Strasse musste trocken sein, kam ein Strassenputzer und reinigte sie mit einem Besen aus dünnen, gut biegsamen Holzzweigen und einer grossen Schaufel vom gröbsten Mist. Um der Empörung und der Abneigung, wenn nicht Feindschaft, vorzubeugen, wurden unsere Arbeiter angehalten, den eigenen Mist, besser gesagt ihrer Pferde, selbst wegzuräumen, was sie in der Regel auch taten. Abgesehen davon waren unsere Pferde gut erzogen und verrichteten ihren Stuhlgang meistens im Stall oder im eigenen Hof, aus Freude, dass sie von der schweren Arbeit nach Hause zurückkehrten und bald wieder Nahrung bekamen.

(3) Peterli (Peterchen = Petricek) mit Bruder Paul (Palko) und Tante Aranka (Aurelia = Zlatica) vor ihrem Laden; rechts unser Haus, links die Geleise der Schmalbahn, im Hintergrund die Zellulosefabrik mit dem Kamin. Foto: Mutter mit dem Fotoapparat, den Palko zur Geburt von Peterli bekam, damit er Peterlis Leben dokumentieren kann.
Die Hauptstrasse war hingegen (was für ein Fortschritt und Luxus) schon damals asphaltiert, selten mit Mist belegt und wurde häufiger, vielleicht sogar jeden Tag gereinigt. Wir wohnten nicht irgendwo, sondern in Martin, dem Nabel der Slowakei. Wäre unser Transportgeschäft an der Hauptstrasse gewesen, hätten unsere Pferde sie täglich verschmutzt. Wie leicht wäre es, meinte Vater, nicht lange später, sich dieses Mistes und seines Verursachers zu entledigen, indem man ihn samt Familie wegtransportieren liesse, was in der kommenden Zeit die einfache Art und Weise wurde, solche und ähnliche Probleme zu lösen. Direkt vor unserem Haus war ein breites asphaltiertes Trottoir, auf dem die Geleise einer Schmalbahn lagen. Auf ihren kleinen Wagen transportierte man Ziegel aus der Ziegelfabrik oben unter dem Wald, wo aus dem Schlamm während Jahrtausenden ein dichter, guter Ton entstand. Die voll mit Ziegeln beladenen Wägelchen wurden von einem Arbeiter den grössten Teil des Weges nach unten gebremst. Man lagerte sie dann auf einer Rampe beim Bahnhof. Die Pferde mussten aber die leeren Wagen wieder nach oben ziehen. Auf der Rampe wurden die Ziegel von Hand in die Güterwagen der Bahn umgelagert. Falls es eilig war, weil der Güterzug bald wegfahren sollte, konnte man auch als Kind einen Batzen verdienen, wenn man half, die Ziegel umzuladen. Es war auch möglich, ähnlich wie bei den Holzstämmen im Winter, auf die Wagen der Schmalbahn aufzuspringen und heimlich gebückt sich transportieren zu lassen, was wir, nicht nur die Arbeiterkinder, die in den „Kolonien“ wohnten, gerne taten. Eine Zeit lang ersetzte eine kleine Dieselmaschine die Pferde, als jedoch im Krieg Öl rar wurde, kamen die Pferde wieder zum Zug.
Es gab drei „Kolonien“, zwei Reihen mit mehreren Ein- und Zweizimmerwohnungen, in der Mitte 1-2 Dreizimmerwohnungen für die kinderreichen oder besser gestellten Familien von Arbeitern der Zellulosefabrik. Gleich am Anfang wohnte unsere Putzfrau, Frau Cunek, mit drei Kindern in einer Einzimmerwohnung. Kein Wunder, dass die Tochter, als sie achtzehn wurde, heiratete. Über diese Hochzeit, wie auch eine „Metzgete“ bei Cuneks, berichte ich später. Die ersten zwei Kolonien wurden durch die Brücke über den Fluss getrennt. Die dritte war noch ein Stück weiter Richtung Ziegelfabrik. Gegenüber der ersten Kolonie, dort wo unsere Putzfrau wohnte, war der Eingang in die Fabrik. Auf der anderen Seite der zweiten Kolonie hinter der Brücke stand ein schönes, einstöckiges Haus, wo der Direktor der Fabrik und sein Stellvertreter wohnten. Es war ein Zeichen der Zeit, weil auch solche Leute noch nicht mit dem Auto zur Arbeit fuhren und es nicht nur für den Arbeiter vorteilhaft war, in der Nähe des Arbeitsplatzes zu wohnen – es war eine Art damaliger Gleichheit. Aber auch sonst war unsere Umgebung nicht ganz arm an Prominenz. In einer Nebengasse wohnte der Bahnhofvorsteher – auch er hatte es nicht weit zur Arbeit - und der damals vielleicht einzige slowakische Magnetopath. Seine Patienten kamen von weit und breit mit der Bahn und nicht mit dem Auto. Wir waren nie bei ihm – zu Hause ist man kein Prophet und auch kein Wunderheiler. Und direkt neben uns, Richtung Bahn, war das Elektrizitätswerk, das in meiner Zeit nicht mehr Strom produzierte, doch als Regelwerk diente. Seine Gebäude waren weit hinten. Vorne im zweiten einstöckigen Gebäude an unserer Strasse, war im Erdgeschoss die Verwaltung und im Obergeschoss wohnte der Direktor, ein sehr feiner, vornehmer Mensch, der jagte und auch sonst in besseren Kreisen verkehrte, aber den Makel hatte, dass er mit einer Jüdin verheiratet war. Sie hatten zwei Söhne, und er trennte sich von ihr, ähnlich dem deutschen Philosophen Jaspers und vielen anderen aus Prinzip nicht; er war eben ein wirklich feiner, vornehmer Mensch. Seine guten Verbindungen halfen aber nicht, seinen Schwager samt ganzer Familie vor der Deportation und dem Tod in Auschwitz zu retten.

(4) Stolze Eltern mit Peterli im Hof; links neben dem Stall der Misthaufen, rechts im Hintergrund Kamin des alten Elektrizitätswerkes. Eigentlich bin ich zwischen Misthaufen und zwei Fabrikkaminen aufgewachsen. Foto: Palko.
In meiner Zeit haben wir keinen Hund mehr gehabt. Der letzte, angeblich ein Prachtexemplar, sonst sehr friedlich und folgsam, hatte es auf die Hühner des Bahnvorstehers abgesehen, die er nacheinander jeweils nachts grob zerriss. Offensichtlich erwachte auf diese unpassende Weise sein unterdrückter Jagdinstinkt wieder. Man konnte es ihm nicht abgewöhnen, und weil auch die Hühner auf ihre Art Prachtexemplare waren und viele besonders grosse Eier legten und im Alter nach der Menopause als Grundlage für eine sehr schmackhafte Suppe dienten, gab es ein Problem. Der Hund musste weg. Die Eltern befürchteten, ein Nachfolger würde den gezeichneten Weg über mehrere nicht sehr hohe Zäune wieder einschlagen. Auch wenn man den Bahnhofvorstand für die Hühner reichlich entschädigte, brauchte man keinen Zwist, noch dazu in der nahen Umgebung, weil man in die Situation mit dem Pferdemist auf der Hauptstrasse geraten könnte.
Was die Einwohner auf unserer Seite der Bahngleise einigte, war der Gestank der Zellulosefabrik. Mehrmals in der Woche, unangemeldet, liessen sie am späten Nachmittag die stinkigen Reste ihrer holzverarbeitenden Chemikalien in die Luft raus. Je nach Wind dauerte es zwei bis drei Stunden, an schönen ruhigen Sommertagen noch länger, bis der Gestank zerstreut und verweht wurde. Fast ununterbrochen leitete die Zellulosefabrik, die deswegen am Fluss lag und den grössten Teil des Wassers für sich abzweigte, ihre Chemikalien in den Fluss ab. Es dauerte mehrere Kilometer, bis man wieder in ihm fischen oder baden konnte. Damals, und es sollte Jahrzehnte so bleiben, existierte kein Umweltschutz, keine grüne Bewegung. Erst als man vor nicht allzu vielen Jahren die Fabrik schloss, wurden Luft und Wasser nicht nur hinter den Bahngleisen sauberer.
(5) Peterli im Leiterwagen. Foto: Palko.
Da wir hinter den Bahngeleisen lebten, mussten wir sie überqueren. Unsere Strasse begann gleich nach den Schranken, die von Hand von einem Bahnwärter gesenkt oder gehoben wurden. Dafür musste er jeweils sein Häuschen auf der anderen Seite der Geleise verlassen. Zu unserem und auch des Schrankenaufsehers Leidwesen fuhren auf den Geleisen viele Züge. Nicht wegen des Fernverkehrs, aber weil sowohl Wagen mit Ziegeln, wie mit Holz und Chemikalien für die Zellulosefabrik, sowie mit Brot und anderen Gütern für die Soldaten in den zahlreichen Kasernen, auf dafür bestimmte Nebengeleise gebracht werden mussten. Bevor die Güterwagen Martin verlassen konnten, ob leer oder voll, war es nötig, sie vorher in Züge zu formieren. Für das alles wurden sie an unseren Schranken vorbei hin und her rangiert. So waren an den für die Bahn guten, für uns schlechten Tagen, die Schranken während der Arbeitszeit mehr geschlossen als geöffnet. Es galt also jede Pause, jede Lücke auszunützen, um unter den Schranken durchzuschlüpfen und schnell auf die andere Seite zu laufen. Auch wenn ich mich nicht erinnere, dass je jemand überfahren wurde, so statteten sie später die Schranken, wie es sich gehörte, mit einem Metallnetz aus. Man liess aber neben den Schranken Lücken, durch die man jetzt noch schneller hindurch schlüpfen konnte, was der Sicherheit wenig, aber der Abwehr von Klagen und der Beruhigung des Gewissens der Bahnbehörden diente. Zu meiner Überraschung, als ich nach Jahrzehnten Martin wieder besuchte, musste ich in einer langen Autokolonne vor denselben Schranken warten. Hingegen ein grosser Fortschritt, sie wurden nicht mehr von Hand gesenkt und gehoben!
Wir hatten zwar keinen Hund mehr, aber eine sehr schöne, gute Katze. Gut bedeutete, sie fing hervorragend Mäuse, für mich, dass ich mit ihr spielen konnte. Wenn sich die Mäuse im Vorratsmagazin mit Futter für Pferde vermehrten, die Säcke durchlöcherten, das Futter wegfrassen, es sogar mit ihrem Kot für die Pferde, die wählerischen Feinschmecker, ungeniessbar machten, sperrte man sie für die Nacht dort ein. Sie war eine richtige Jägerkatze. Morgens fand man sie nicht nur satt von einer gefangenen Maus wie bei gewöhnlichen Katzen üblich, nein, es lagen im ganzen Magazin verstreut viele Mäuseleichen. Dann hatte man vor den Mäusen für eine gewisse Zeit wieder Ruhe, weil sie auch keine blöden Tiere waren und sich die Gefahr gut merkten und weitervermittelten. Aber diese Information wurde nicht vererbt, offensichtlich wussten damals auch die Mäuse noch nicht Bescheid über Epigenetik. Die neue Generation wagte sich wieder ins Magazin. Manchmal brachte die Katze eine noch lebende Maus und spielte mit ihr genüsslich und stolz vor unseren Augen, indem sie sie ein Stück laufen liess, um sie wieder einzufangen, was sie wiederholte, bis die Maus das Spiel vor Erschöpfung (auch über Stress wussten damals weder die Menschen noch die Mäuse etwas) nicht mehr mitmachte. Dann verspeiste sie sie. Sie war auch sehr fruchtbar und brachte zweimal pro Jahr mehrere Kätzchen zur Welt. Als wir alle Freunde und Bekannten, die eine gute Katze wollten, versorgt hatten, mussten die übrigen umgebracht werden. Dazu kam ein Arbeiterkind aus der dritten Kolonie, das es für einen Batzen tat. Man musste die Kätzchen aber zuerst finden. Anfangs war es nicht schwierig, doch mit der Zahl der Geburten und dem Verlust ihrer Kinder suchte die Katze immer bessere Verstecke. Zu Beginn hatte ich Spass, dem Jäger bei der Suche in Estrichen über Waschküche und im
(6) Peterli mit der Mutterkatze. Foto: Palko.
Stall mit Heu oder Stroh zu helfen, später, wahrscheinlich auch unter dem Einfluss der Ereignisse, siegte mein Mitleid, und ich suchte nicht mehr mit. Er steckte die Kätzchen in einen Jutesack und warf sie in den Fluss. Entweder erschienen im Magazin mehr Mäuse oder man bekam mit der Katze Mitleid: Aus einem Wurf liess man einen kleinen, schönen Kater am Leben. Er bedankte sich damit, dass er ein guter Sohn wurde und gleich fleissig Mäuse fing wie seine Mutter. Ich war froh, denn als er jung war, spielte er leidenschaftlich mit mir. Also hatte ich zwei Katzen, die ich sehr liebte. Als wir nach dem Krieg in das ausgeraubte Haus zurückkehrten, waren die Katzen verschwunden. Sie endeten nicht in einem Konzentrationslager, sondern in den Essschalen der durch Martin gezogenen Soldaten.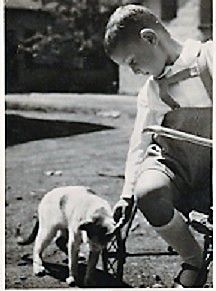
(7) Peterli mit dem Katzensohn. Foto: Palko.
Sie blieben gute Jägerkatzen, weil sie ausser Milch kaum etwas zu fressen bekamen und im Haus nur auf der Veranda übernachten durften, wenn die Temperatur gegen -20° sank. Diese Strenge übte man auch gegen sich selbst, zwar bei etwas weniger Grad: Wir hatten eine Spültoilette im Bad in unserem Haus, aber erst wenn es -10° bis -15° war, durften wir sie benützen, sonst ging man, ausser man war krank, draussen auf das Plumpsklo, das verschlossen war. Der Schlüssel hing in der Küche. Ein anderes Plumpsklo nur mit einem drehbaren Riegel für die Arbeiter befand sich etwas weiter weg, näher zum Misthaufen und Pferdestall. In der Not, wenn unseres besetzt war, benützten wir es auch. Spültoiletten blieben auch dann tabu. Kein Wunder, wir konnten unsere diesbezüglichen Bedürfnisse den Pferden ähnlich gut beherrschen und regulieren und verrichteten sie rechtzeitig, möglichst vor Beginn der Dunkelheit. Wir waren trotzdem sehr früh „sauber“. Dazu trug eine andere erzieherische Massnahme bei. Bald nach dem wir sitzen konnten, wurden wir, zur Tageszeit, die den Erwachsenen als vorteilhaft und angebracht schien, auf den Topf gesetzt und durften ihn nicht verlassen, bevor wir unser Bedürfnis erledigt hatten. Kein Wunder, in der Regel waren wir schon bald „sauber“, etwa um den ersten Geburtstag herum. Über die Charakterschäden, die Freudianer nennen es „Analfixierung“, die wir dabei erlitten, grübeln die Psychologen. Wir wurden dafür sehr gelobt und merkten, dass die Eltern auf uns mächtig stolz waren. Diese Erziehung hatte von Seiten der Eltern und der Kinder handfeste praktische Gründe. Es gab damals weder die feinen, jede Flüssigkeit aufsaugenden Wegwerfwindeln, noch Waschmaschinen, noch die gut duftenden, schonenden Waschpulver. Wir wurden in eher grobe, reibende Windeln gewickelt, die von Hand mit spezieller, starker, nicht aromatisierter Seife gewaschen wurden. Man fühlte sich ohne sie eindeutig wohler, freier.

(8) Ein Plumpsklo ähnlich demjenigen in Martin. Vielen Dank für das kostenlose Foto aus dem Internet.

Martin hatte bereits seit den zwanziger Jahren ein Spital, aber das Gebäude der Geburtsabteilung im Bauhausstil wurde erst Anfang des Jahres 1937 eingeweiht. Als Chefarzt kam Professor Schwartz, ein Geburtshelfer mit bestem Ruf. Warum er diese Stelle der akademischen Karriere in Prag oder Bratislava bevorzugte, kann man nur mutmassen. Wollte er sich in der Abgeschiedenheit der Provinz den Rivalitäten, Intrigen, Spannungen und Hierarchien des akademischen Lebens entziehen und sein eigener Herr werden? Für uns in Martin war es klar, dass wir es verdienten und dass es Martin entsprach, den besten Geburtshelfer des Landes zu haben. Von weit und breit kamen Frauen zu ihm, um zu gebären, vor allem, wenn sie Probleme während der Schwangerschaft hatten. Wie sein Name sagte, war er deutscher Abstammung, und in der Tat, während des Krieges verliessen ihn seine politische Zurückhaltung und vornehme Beschränkung auf das Fachgebiet und zur Enttäuschung meiner Eltern, jedoch aber sicher unter dem Druck der Landsleute, die nicht weit von Martin eine starke Enklave bildeten, trat er der Deutschen Partei NSDAP bei, was ihn veranlasste, gegen Ende des Krieges nach Deutschland zu fliehen. Ich (8.3.1937) war eines der ersten Kinder in Martin, die nicht zu Hause, sondern im Spital geboren wurden. Diese Neigung, wenn möglich eine Vorreiterrolle zu spielen, blieb mir erhalten.

(1) Peterli im Kinderwagen; Foto: Bruder Palko.
An die Geburt erinnere ich mich nicht, behaupte aber, meine Abneigung gegen den Geschmack frischer Tomaten komme davon, dass es mich an den Geschmack des Fruchtwassers erinnere, wovon ich nach neun Monaten in der Gebärmutter genug hatte und mit freudigem Hurra in die Welt schlüpfte. Erstmals wurde mir dies bewusst, als ich zweijährig ein Nachbarkind beobachtete, wie es diese schöne, rote, glänzende Frucht mit Lust ass und mir anbot, davon zu probieren, ich aber darnach den Probebiss gleich angewidert wieder ausspuckte. Dieser Widerwille verliess mich trotz wiederholten Versuchen, die Tomaten zu essen, nie mehr. Das nächste Ereignis, an das ich mich erinnere, war, dass mich ein paar Tage nach der Geburt, als ich mit Mutter noch im Spital weilte, eine Schwester in einem Wägelchen auf die Ohren-Nasen-Abteilung schob, da sie dachten, weil ich oft weinte, es sei hoffentlich nicht etwas mit meinen Ohren nicht in Ordnung. Unterwegs unterhielt sie sich mit einer Frau, der sie erklärte, zu wem ich gehöre und bemerkte, dass ich ein ansehnlicher Knabe sei, was mir sicher gut tat und so früh ausgesprochen, mein Dasein sicher positiv beeinflusste. Die Ohren, das weiss ich sicher, waren in Ordnung. An das Stillen erinnere ich mich nur neblig, genau aber an meine Vorlieben für gewisse Kleider, die ich später näher beschreibe.
Eigentlich sollte ich nicht geboren werden. Meine Eltern heirateten 1923. Wir feierten dies jeweils am 22. August. Nach dem Tod meiner Mutter, als meine Frau die Dokumente durchschaute, fand sie jedoch in der Urkunde das Datum 13. August. Wir dachten, dass meine Eltern, die zu Aberglaube neigten, dazu beeinflusst von der ihnen nicht bewussten Kabbalatradition, wollten den 13. nicht feiern. Aber warum heirateten sie dann doch am 13.? Ein Kenner der damaligen Bürokratie erklärte uns, dass damals solche Verschiebungen wegen der Bequemlichkeit von Beamten nicht aussergewöhnlich waren. Trotzdem passt es nicht zu meinem Vater, dass er die Täuschung in einem Dokument zugelassen hatte. Aber vielleicht war er in der Zeit zu solchen Problemen noch anders eingestellt. Er wuchs in dem kleinen Dorf Drazkovce vier bis fünf Kilometer östlich von Martin auf. Seine Eltern waren dort die einzigen Juden und betrieben wie üblich das einzige Gasthaus im Dorf, in dem alle Schichten des Dorfes notgedrungen verkehrten, begonnen vom Kleinadel, sog „Zemanen“ (Grundbesitzer = Freiherren) bis zu ihren Knechten. Die Eltern meines Vaters waren diesen Umständen entsprechend auch nicht sehr religiös und assen nicht koscher. Die Spielgefährten von meinem Vater waren die Kinder der Nachbarn, der Zemanen, mit denen er gut auskam. Vor meiner Flucht (Frühjahr 1967) war ich mit meinem Vater dort, um mich von seinem Geburtsort heimlich zu verabschieden. Wir dachten nicht, dass ich jemals dorthin zurückkehren könnte. Wir wurden von seinen ehemaligen Nachbarn mit jahrzehntealtem Sliwowitz und anderen Köstlichkeiten bewirtet, was eine grosse Ehre war. Als ich noch als Pfadfinder durch die Felder mit den kleinen Wäldchen, Hainen um Drazkovce wanderte, die vor allem im Herbst mit ihren verschiedenen Farben besonders prächtig aussahen, stiessen wir immer wieder auf kleine, durch schön geformte Gusseisen eingezäunte Gärtchen mit Gräbern (Privatfriedhöfe der Zemanen) auf ihren Feldern. Es gehörte sich für sie nicht, mit den andern, dem Fussvolk auf dem gemeinen Friedhof begraben zu werden. Von Drazkovce flossen zwei Bäche in den Fluss Turiec mit den merkwürdigen Namen Jordan und Hebron. Irgendwelche Vorfahren der Freiherren beteiligten sich im 13. Jahrhundert an den Kreuzzügen. Nach der Rückkehr aus dem Heiligen Land gaben sie ihnen diese Namen. Im Rahmen der Verbesserung und Vereinfachung des Lebens während des realen Sozialismus wurde einer der Bäche zugeschüttet. Meine Grosseltern wurden selbstverständlich auf dem neuen jüdischen Friedhof in Martin begraben, der nicht mehr neben der Synagoge, sondern an der zu Drazkovce zugeneigten östlichen Seite des gemischten christlichen Friedhofs lag und mit seinen grossartigen Gräbern der reichen und für die slowakische Kultur und Nationalbewusstsein bedeutenden Verstorbenen quasi ein slowakischer Friedhof Père Lachaise war. Als es in Martin nach dem Krieg an Juden mangelte und die Vandalen den jüdischen Friedhof verunstalteten, wurden die Grenzmauern abgebrochen und dort die Christen begraben. Ich bin immer wieder berührt, wenn ich Martin besuche, dass in einem kleinen Restteil beim Eingang gleich hinter der ehemaligen jüdischen Leichenhalle zwischen den wenigen erhaltenen jüdischen, jetzt aber liegenden Grabsteinen, sich auch noch derjenige meines Grossvaters Josef E(c)kstein befindet. Es scheint mir, diese Lage und der Zustand bezeugen lebendig und anschaulich die Geschichte der Juden in der Slowakei und symbolisieren das, was sie erlebten, was ihnen angetan wurde. Ich hoffe, es bleibt jetzt so und die geretteten Grabsteine werden nicht mehr gestört, bewegt oder sogar zerstört, was alles gegen die jüdische Tradition wäre.
Ein Nachbar des Vaters in Drazkovce, angesprochen auf die vielen unehelichen Kinder, die er mit seinen Dienstmädchen hatte, entgegnete, er erschaffe seine Knechte selber, was mehrere Vorteile habe. Wie wir sehen, war Drazkovce sehr fortschrittlich, weil dort schon damals die Selbstversorgung gross geschrieben wurde. Ein anderer Nachbar pflegte zu seiner Frau liebevoll zu sagen: „Anna, mein Liebling, der Veitstanz soll dich schütteln, wohin hast du den Besen wieder verlegt?“ Das Gasthaus meiner Grosseltern lag sehr gut, weil auch die Reisenden der weit entfernten Dörfer vor der Ankunft im grossen, unheimlich beschäftigten und lebendigen Martin in Ruhe dort noch einen Halt zu machen pflegten. Und so kehrte einmal auch ein Mann mit seinem Sohn ein, der sich unvorsichtig beim Spielen mit der Pistole seines Vaters die Hand durchgeschossen hatte. Sie waren unterwegs zum Arzt in Martin. Der Vater des Kindes nahm nicht nur seinen Sliwowitz zur Beruhigung und Stärkung, er begann auch Karten zu spielen. Als ihn der Sohn mit seinem Jammern, Stöhnen und Weinen störte, sagte er zu ihm und seinen Mitspielern immer wieder vorwurfsvoll: „Er hat sich die Hand durchgeschossen und jetzt weint er!“ und spielte ruhig weiter. Auch der einzige evangelische Pfarrer kam regelmässig dorthin, um Karten zu spielen.
Als einziger Sohn wurde mein Vater vermutlich verwöhnt, umso mehr als er noch als Säugling eine Lungenentzündung überlebte, was damals ein kleines Wunder war. Er ging später mit seinem Körper und seiner Gesundheit vorsichtig um. Seine Mutter starb früh und mit seiner Stiefmutter vertrug er sich schlecht. Auch sein Vater starb früh, noch vor der Heirat seines Sohnes. So sind wir nur selten nach Drazkovce gegangen. Meine Mutter aber hielt guten Kontakt zur restlichen Familie meines Vaters, schon wegen ihres sehr entwickelten Gerechtigkeitssinnes.

Die Freunde meines Vaters waren Kinder der „Olejkaren“. Ihre Väter und Grossväter reisten mit verschiedenen pflanzlichen Ölen (slowakisch olej), die sie selbst produzierten, meistens zu Fuss nach Russland, die Öle auf dem Rücken tragend. Sie fanden dort eine dankbare Kundschaft, weil die Öle gegen fast alle Krankheiten und Gebresten halfen. Wenn wir jetzt über die Macht der Pflanzenextrakte und der Placebowirkung Bescheid wissen, wundert uns der Erfolg nicht. Sie wurden dadurch nicht nur reich und welterfahren, dazu grosse Freunde der Russen, wozu man auch die Belorussen und Ukrainer rechnen darf; sie wurden auch sogenannte Slawofilen. Nicht zufällig wurde Turiec das Zentrum des slawischen, damit slowakischen und tschechoslowakischen Bewusstseins sowie des nationalen Erwachens in der Slowakei. Olejkaren waren teilweise gebildete Männer. Ihre Verwandten und Freunde bewunderten Tolstoi. Einer von ihnen, der grosse slowakische Dichter Svetozar Hurban-Vajansky war ein „Batko“ (kommt aus dem Südslawischen und bedeutet der Älteste, Dorf-, Kreis-, Landvorsteher).
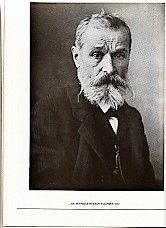
(3) Batko Svätozar Hurban-Vajansky (SHV). Aus Slivka M. Strelinger A (Vetter Alino, dem ich für Copyright danke): Sochan Sochan war vor Hornik, dem späteren Arbeitgeber von Bruder Palko der Fotograf in Martin. Peterli fast 100 Jahre nach Batko Vajansky am Mädokys. Foto S. Jelinek.
Mein Vater traf ihn oft auf seinem Weg in die Schule nach Martin, als er fast jeden Morgen zum „Mädokys“ in „Jahodnicky haj“ spazierte (Hain von Jahodniky = Erdbeerweiler, ein ehemaliges Dorf südlich von Martin). Mädokys ist ein eisenhaltiges erfrischendes Naturmineralwasser. Das von Martin, bzw. vom Jahodnicky Haj, ist selbstverständlich das Beste der Welt. Es fliesst noch immer wie damals aus einem Rohr mit verschiedener Fliesskraft je nach Regenstärke der vorangegangenen Tage. Man wartet in einer Schlange, weil man es nicht nur dort trinkt, sondern meistens in mehrere, teilweise grosse Flaschen abfüllt und dabei „dorfet“ (schwatzt). Leute die nicht warten möchten, kommen früh morgens oder spät abends.

(4) Peterli fast 100 Jahre nach Batko Vajansky am Mädokys.
Batko Svätozar Hurban-Vajansky, in den kalten Jahreszeiten in eine Pelerine eingehüllt, schleppte selbstverständlich keine Flasche mit. Ich kannte seinen Nachfolger, Batko Skultety, den Präsidenten der Matica Slovenska. Ich war als Schulkind in der ersten Klasse an seinem Begräbnis. Mit ihm endete die Tradition, die Reihe der Batkos, da der nächste Anwärter, der Dichter Stephan Krcmery, mit dessen Schwester meine Mutter in die Schule ging und mit dem mein Bruder Palko als angehender Dichter Kontakt hatte, unter Schizophrenie litt. Durch die kommenden Umwälzungen ging die Zeit der Batkos sowieso zu Ende.
(5) Mutter als Teenagerund junge Frau..
Wie meine Mutter erzählte, lernte sie meinen Vater kennen, als sie einmal irgendeine Ware in einem Geschäft umtauschen ging. Der fesche junge Mann stach ihr gleich ins Auge. Sie erkundigte sich, wer er sei, und weil die Auskunft auch für ihre Eltern günstig ausfiel, liess sie die Verbindung knüpfen. Sie war mit der Selbstwahl eine Revoluzzerin. Sie wollte nicht das Schicksal ihrer älteren Schwester teilen, die wie üblich eine arrangierte Ehe mit einem Mann, der ihr nicht entsprach, eingehen musste, mit dem sie zwar zwei hübsche, gelungene Töchter Aliska und Valika (Alice und Valerie) hatte, aber schlecht zusammenlebte. Für diese Version spricht, dass die Mutter in ihrem langen Leben alles immer eintauschen ging, was sie erworben hatte, mit Ausnahme eben ihres Mannes. Vetter Jano wüsste sicher irgendeine weniger romantische Geschichte dazu, aber leider ist unsere Beziehung jetzt nicht so, dass ich ihn fragen könnte. Die Eltern verliessen ihr Hochzeitsfest früher als die Gäste, weil sie auf Hochzeitsreise nach Venedig aufbrechen wollten. Vater liebte nicht nur meine Mutter, sondern auch Melonen sehr. Als sie vom Gondoliere transportiert wurden, sah er die Früchte irgendwo nicht weit vom Hotel entfernt aufgetürmt. Er liess seine frisch angetraute Frau im Zimmer und ging schnell eine Melone kaufen. Auf den engen, sich ähnelnden Gassen verirrte er sich, was jedem Besucher von Venedig nachvollziehbar sein dürfte, und aus dem kurzen Sprung nach Melonen wurden fast volle fünf Stunden, bis er das Hotel und seine in Tränen aufgelöste Frau wieder fand, die dachte, er sei in dieser fremden, zwar wunderschönen, aber auch auf eine Weise Furcht einflössenden Stadt ermordet und seine Leiche in einem Kanal entsorgt worden. Gott sei Dank, lebte damals Donna Leon noch nicht, und so konnte die Angst meiner Mutter unter Einfluss ihrer Krimis nicht ins Unermessliche und Unerträgliche gesteigert werden.
(6) Mutter als junge Frau.
Vater absolvierte die Handelsschule in Martin. Im Militär brachte er es zum Leutnant eines Regiments, das in Wien stationiert war. Er erinnerte sich gern an die schöne Zeit in Wien und blieb ein Anhänger der k.u.k. Monarchie, seiner Natur entsprechend nüchterner als der Vater meiner Mutter. Im Krieg wurde er verletzt. Sein linker Unterschenkel blieb verformt und so verändert, dass die Ärzte jeweils meinten, dass er unter Morbus Paget leide. In der Mitte des Krieges geriet er in russische Gefangenschaft und wurde in einem Lager in Turkmenistan interniert. Es ging ihm dort nicht schlecht. Unangenehm war, dass er ausser Malaria sehr oft „Gehacktes“ bekam und obwohl er, ein sonst absolut unwählerischer Esser, der mit Genuss Fische samt Kopf, Schweinskopf, Schweinsfüsschen und Wädli bis zum Knochen abnagte, Milchkaffeehaut, also alles ass, Gehacktes nicht mehr berührte. Als die Lage in Russland unsicher wurde, die Aufsicht im Lager weniger streng war, floh er über St. Petersburg zuerst in das neutrale Dänemark. In St. Petersburg weilte er ausgerechnet in der Zeit der „Oktoberrevolution“, von der er aber nichts merkte. Sie verlief weniger spektakulär als man später behauptete. Es war eine „Palastrevolution“ ohne des später behaupteten blutigen Sturms des „Winterpalastes“. Während der „sozialistischen“ Zeit hätte er solche Ketzereien nicht verbreiten dürfen. In Dänemark wurden die k.u.k. Offiziere, die aus der Gefangenschaft geflohen waren, auf dem Königshof empfangen, und bei einem vorzüglichen Abendessen gab es unter anderem auch gebratene Hühnerschenkel. Wenn wir Knochen in der Hand hielten, damit wir sie vom wertvollen Fleisch wie Geier gründlich befreien konnten, was wir nicht nur wegen der Seltenheit, aber auch aus Wonne gerne taten, sagte mein Vater: „Man hat auch am Königshof, wie ich es selbst erlebt habe, das Hühnerfleisch mit Händen gegessen.“ Dazu wandte meine Mutter ein: „Die Hühnerschenkel waren am Ende, wo man sie mit der Hand hielt, in Staniol eingepackt.“ Sie wusste es, auch wenn sie nicht am Königshof dabei war.

(7) Vater als k.u.k. Offizier.
Vater akzeptierte und arrangierte sich nicht nur mit den Folgen seiner Kriegsverletzung, was umso leichter war, als sie ihm eigentlich ausser dem verformten Unterschenkel keinen Nachteil brachten, er hinkte nicht, aber auch mit der neuen Tschechoslowakei hatte er keine Probleme, was im panslawischen Martin unbedingt notwendig war, wenn man es als Geschäftsmann und auch sonst weiterbringen wollte. Er fuhr Motorrad, später aus Sicherheits- und Berufsgründen Autos.
Ich erinnere mich, wie wir einmal einen Grafen in seiner Kurie besuchten. Ich denke es war in Trebostovo, in einem Dorf neben Pribovce, wo auch irgendwelche unserer Verwandten wohnten, die später in Auschwitz ermordet wurden. Wir fuhren zusammen mit Milka, meinem „Kindermädchen“, über die ich bald berichten werde, die mich vor dem Haus des Grafen beaufsichtigen sollte. Ich weinte jedoch weniger aus Angst, mehr aus Neugier, wohin Vater ging und vor allem aus Missmut, dass ich nicht mit ihm mitgehen durfte, sodass ich bald auch reingelassen wurde. Ich beruhigte mich sofort und war vermutlich ganz lieb. Als Belohnung bekam ich von der Gräfin etwas Besonderes, Exotisches zu essen – ein Stück Schweizer Schokolade. Zwei bis drei Wochen später durfte ich sogar ohne Milka mit dem Vater alleine mitfahren. Selbstverständlich ohne speziellen Sitz, die man damals nicht kannte. Die Kurie beeindruckte mich nicht nur wegen der Schokolade. Die Räume waren ungewöhnlich gross und mit wenigen, aber schönen dunklen Möbeln ausgestattet. An den Wänden hingen Bilder der Ahnen, wie es sich für eine so vornehme Familie gehörte.
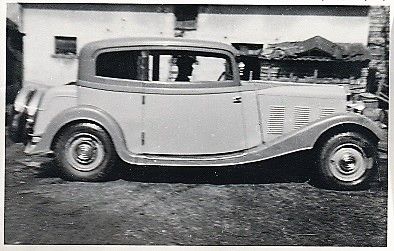
(8) Unser Newtimer. Foto: Bruder Palko.
Mit Kindern warteten die Eltern zu, Vater schon wegen seines ausgeprägten Sicherheitsbedürfnisses, bis das Geschäft lief und das Haus eingerichtet war. Mein Bruder Palko wurde am 10. Dezember 1926, mehr als drei Jahre nach der Hochzeit, geboren. Fünf Jahre später übertrug die Mutter einen Knaben, der tot geboren wurde. Ob deswegen oder auch sonst, zögerten die Eltern mit der Zeugung eines weiteren Kindes. Wahrscheinlich war ich ein „Unfall“, da mich Vater von Onkel Laci, dem Allgemeinarzt, auskratzen lassen wollte. Die Begründung war, dass in Deutschland Hitler an die Macht kam, und wie man sah, für die Juden unsichere, gefährliche Zeiten begannen, die nicht nur auf Deutschland beschränkt bleiben würden. Onkel Laci weigerte sich, und die ganze Familie war auch dafür, dass ich ausgetragen werden sollte. Er war dann, mit Recht, auch mein „Götti“ und seine Frau, Tante Ella, meine „Gotte“. Der Theorie nach sind das keine optimalen Umstände für ein Kind. Ich denke aber, sie wirkten sich nicht negativ auf mich aus, auch dank dem, dass ich es später von meinem Vater nie zu spüren bekam, auch als meine Existenz das Leben der Familie sicher komplizierte. Auf der anderen Seite war ich ein starker Grund, die schweren Zeiten zu überleben und ein Anker für das Weiterleben nach dem Tod von Palko.
*
Nach meiner Geburt hatten wir zwei Dienstmädchen. Eine etwas rundliche, fröhliche Paula, die vorwiegend mit Kochen und Putzen beschäftigt war und eine zierliche, feine, vorsichtige Milka, die sich um mich kümmerte. Sie war mein „Kindermädchen“. Ihre Rollen waren aber nicht streng geteilt. Paula beschäftigte sich auch gerne mit mir, und Milka musste beim Kochen, Waschen und Abwaschen helfen, wenn ich schlief. Wenn mich Milka morgens auf die Kommode legte, strampelte ich und schrie, bis sie mich kleidete, wie ich wollte. Manchmal musste Mutter kommen, aber auch dann überwog mein ästhetisches Empfinden. In den von mir unerwünschten, falschen Kleidern blieb ich missmutig. Mindestens der Vormittag war damit verdorben, wie wenn ich mit dem linken Bein aufgestanden wäre. Ich erinnere mich noch genau, wo die Kommode stand. Paula wollte mich oft mit einem Spuk züchtigen, und wenn ich nicht gehorchte, sagte sie: „Es kommt der Bobak und nimmt dich mit.“ Nicht klar war wohin, aber weg von zu Hause, und das sollte für alle genug schlimm sein. Lange machte es mir keinen Eindruck, ich wusste nicht, wer Bobak und was Angst war. Einmal im ersten Spätherbst oder Winter, nach Einbruch der Dunkelheit, fiel die Elektrizität aus. Dies passierte nicht selten, und wir hatten dafür Kerzen und Öllampen parat. Paula hob mich aus dem Bett und trug mich auf dem einen Arm und in der anderen Hand hatte sie, oder jemand der sie begleitete, eine angezündete Öllampe. Der Spiegel, der an der Öllampe befestigt war und durch den die Strahlkraft des kleinen Feuers verstärkt wurde, warf einen Schatten an die Wände. Sowie sich die Person mit der Öllampe in der Hand bewegte, tanzte und änderte sich dauernd die Form des Schattens und des Spiegels. Den Grund wusste ich damals nicht und mir war plötzlich klar - Bobak existierte in der Tat und war jetzt da! Mit ihm kam auch erstmals die Angst, und ich konnte mich nicht beruhigen und weinte lange. Die Erkenntnis der Angst blieb. Dieses Gefühl wurde bald leider nicht nur durch Bobak verursacht und verstärkt.

(9) Onkel Laci und Tante Ella.
Ich war ein widerspenstiges Ekel nicht nur beim Anziehen. Einmal sonntagnachmittags wollten Paula und Milka tanzen gehen. Meine Eltern waren einverstanden. Aus irgendwelchem Grund wollten sie mich mitnehmen. Es wurde länger darüber diskutiert, verhandelt, vielleicht auch Befürchtungen geäussert, ob dies gut gehe. Wie ich auch neugierig war und gerne gehen wollte, begann ich plötzlich zu weinen. Kaum fühlte ich mich abgeschoben, eher dachte ich, es müssten sicher irgendwelche Gründe für das Misslingen bestehen, wenn sie darüber zweifelten. Zum Verdruss des ganzen Tanzlokals trieb ich es mit kurzen Unterbrechungen auch dort weiter und vermasselte damit Paula und Milka den lang ersehnten „freien“ Tanznachmittag total. Ihre männlichen Freunde versuchten, mich mit Limonade zu beruhigen, ich war jedoch nicht käuflich. Es zeigte, warum nicht selten Befürchtungen ohne guten Grund erfüllt werden. Ich weiss noch genau, wo das Lokal war. Wie ich Martin kenne, stehen dort jetzt neue, grössere Häuser.
Noch eine Person war in den ersten Jahren wichtig für mich. Tante Aranka hatte den gleichen Vornamen wie meine Mutter, und ich liebte sie auch mindestens so stark. Sie war eine Cousine meines Vaters und kam aus Ungarn wegen des Antisemitismus kurz vor meiner Geburt. Es ergab sich, dass das Nachbarhaus, in dem ein Mischladengeschäft war, in dieser Zeit zu kaufen war. Vater zögerte nicht, weil im Hinterteil des Hauses Platz für ein Magazin war und in der Mitte eine kleine Wohnung, in der sie wohnen konnte. Neben dem Haus, dem Elektrizitätshaus zugewandt, war ein kleines Gärtchen, in dem beide Arankas, die wie Schwestern sehr gut zusammen auskamen, ihre grünen Daumen einsetzen konnten. Nebst einem etwas breiteren Rasenstreifen, auf dem man auch Ball spielen konnte, war gegen den Holzhag ein schmales Blumenbeet mit Schnee- und Maiglöckchen, Vergissmeinnicht, Stiefmütterchen, Immergrün sowie weissen, stark und schwer duftenden Lilien, die man entweder bei offenem Fenster haben oder aus dem Zimmer stellen musste, sonst konnte man sich an ihnen vergiften, wurde mir gesagt. Ich glaubte es umso eher, als mir in der Zeit Tante Aranka auch das Schneewittchen erzählte. Sie zeigte mir, wie man einfache Gesichter und Figuren (bodka, bodka, ciarka, palicka – hotova je hlavicka = Pünktchen, Pünktchen, Komma, Strich – fertig ist das Angesicht) zeichnete. Sie war eine fröhliche Natur, die oft nicht nur mit mir sang. Sie war von allen geliebt und geschätzt, und das Geschäft florierte. Sie sang auch den „Traurigen Sonntag“ (szomoru vasarnap), ein damalig ungarischer, aber auch in der Slowakei beliebter Schlager. Ich verstand ungarisch, da man mit Tante Aranka vorwiegend ungarisch sprach, auch wenn sie ganz gut slowakisch konnte, was für das Geschäft wichtig war. Ihre Eltern kamen auch aus der Slowakei. Ich konnte mich an den Gesprächen slowakisch beteiligen, und so blieben meine Ungarischkenntnisse passiv. Nicht nur die Sonntage, sondern die ganze Zeit wurde trauriger, schwieriger. Als einer ausländischen Jüdin drohte Tante Aranka, dass sie mit den ersten Transporten ins Konzentrationslager gehen musste. In Ungarn gab es damals noch keine Transporte und so organisierte mein Vater ihren illegalen Übertritt zurück. Man sagte mir sicherheitshalber nichts darüber, damit ich es nicht verplappern konnte. Bei solchen Angelegenheiten benützten sie Deutsch, das sie mich deswegen weder aktiv noch passiv lehren wollten. Eines Morgens war diese meine zweite Mutter weg, verschollen, wie wir es schmerzhaft kurz danach erfuhren, da der Mann, der sie durch die Grenze schmuggeln sollte und den man dafür gut voraus bezahlen musste, machte sich nicht die Mühe und übergab sie den Gendarmen und sie ging doch mit dem ersten Transport nach Auschwitz. Man konnte gegen diesen treulosen Gangster nichts unternehmen, da es illegal, verboten war, und er konnte sich damit rächen, dass er unseren Nachschub nach Auschwitz veranlassen würde. Selbstverständlich blieb er auch nach dem Krieg ungesühnt, da man ihm nichts nachweisen konnte. Ausserdem hatte man andere Sorgen.

(10) Peterli mit Tante Aranka vor ihrem Laden. Foto: Bruder Palko. Haus von Tante Aranka 2007; Nach unserem und der des Nachbarhauses links gähnt eine Lücke. Inzwischen ist sie mit einem stattlichen Bürohaus gefüllt. Foto: Tochter Corinne.
Niemand, ich inbegriffen, konnte begreifen, warum ich in der ersten Klasse perfekt lesen und schreiben konnte und auch sonst gut war, aber bei einfachen Zeichnungsaufgaben völlig versagte, wie blockiert war und nach dem Unterricht als Strafaufgabe mit mässigem Erfolg das Zeichnen üben musste. Da später noch mein Bruder Palko starb, blieb niemand, der mir mit den Handfertigkeiten helfen konnte. Vater war dazu völlig ungeeignet. Als ich nach dem Krieg eine kleine Auswahl von Handwerksinstrumenten wollte, dauerte es lange, und ich musste ihm dauernd mit meinem Wunsch in den Ohren liegen, bis er sie für mich kaufte. Aus Prinzip, da man Kinder nicht verwöhnen und ihnen nicht unbedingt jeden Wunsch erfüllen sollte. Es wiederholte sich später, als ich als Fünfzehnjähriger den Wunsch äusserte, ein leichtes „Rennvelo“ zu erhalten, wie es alle meine Freunde besassen. Ich musste bei meinem soliden, schweren deutschen Militärvelo Marke NSU bleiben. Bei unseren ausgedehnten Ausflügen und Touren hatte ich mit Steigungen vermehrt Mühe und die Freunde mussten oft auf mich warten. Zu meiner Genugtuung und meinem Ärger wurde das Geld anfangs der 50er Jahre ausgetauscht und verlor an Wert, was ich Vater dann bei jeder guten Gelegenheit unter die Nase rieb, meistens vergeblich. Trotzdem oder eben deswegen, als ich in die Bundesrepublik floh, wollte ich mir möglichst ein NSU-Auto kaufen. Bevor ich genug Geld zusammen hatte, ging diese Marke kaputt, beziehungsweise in den Audi über. So ging auch dieser Wunsch nicht in Erfüllung. Zeichnen und Werken blieben meine Schwachstellen und verschiedene Reparaturen muss meistens meine Frau ausführen, auch wenn sie sich vielleicht eher einen Mann wünschte, der wie ihr Vater und ihre Brüder selbstverständlich dazu fähig sind. So bin ich mit den unerfüllten Wünschen nicht allein. Zu meinem 60. Geburtstag schenkte mir mein ehemaliger Chef, Professor Akert, eine CD mit verschiedenen alten Schlagern, arrangiert und gespielt vom bekannten französischen Zigeunerjazzmusiker Boulanger. Unter anderen ist dort auch „Szomoru vasarnap“. Wenn ich es höre, bin ich jeweils fast zu Tränen gerührt.
Unser Haus, damals schöner, stolzer als das Nachbarhaus mit dem Geschäft der Tante, diente, als wir aus Martin wegzogen, zuerst als Wohnhaus für Spitalangestellte. Später wurde es von Zigeunern benützt, vergammelte und zerfiel. Das kleine, damals bescheidene Haus daneben mit dem Geschäft wurde dagegen aus welchen Gründen auch renoviert, blieb erhalten und ist immer noch ansehnlich.

(11) Haus von Tante Aranka 2007; Nach unserem und der des Nachbarhauses links gähnt eine Lücke. Inzwischen ist sie mit einem stattlichen Bürohaus gefüllt. Foto: Tochter Corinne.
Paula und Milka verliessen uns auf eine andere, gewöhnliche, nicht traurige, anständige Weise. Für Paula fand man eine andere gute Stelle und ihr weiteres Schicksal verfolgten wir nicht, mindestens ist es mir nicht bekannt. Milka heiratete einen tüchtigen Handwerker, vielleicht denjenigen, der mir im Tanzlokal Limonade brachte. Sie wohnten im hinteren Teil des Hauses von den Grosseltern, hatten fünf gelungene Kinder, die meisten davon hübsche Mädchen. Nach dem Krieg ging ich sie an Ostern „baden“, d.h. gemäss slowakischem Brauch wurden die Mädchen mit Wasser und Parfüm „begossen“, was manchmal eine richtige Flut verursachte.
Vater war froh, dass ich nicht mehr zu Hause, sondern im Spital geboren werden konnte. Ich war das letzte Vorkriegskind in der Familie, von allen geliebt, bewundert und gehätschelt. Auch Vater hatte sich mit dem „notwendigen Guten“ abgefunden. Mein Bruder Palko war nicht begeistert, wenn er mit mir im Kinderwagen spazieren gehen sollte, statt mit seinen Freunden spielen zu können.
(12) Gute Brüder. Foto: Hornik, später Arbeitgeber von Bruder Palko.
Sonst war Palko ein guter Bruder, der sich um mich kümmerte. Als er vom Vater geohrfeigt wurde, was selten geschah, wenn er etwas Widerspenstiges getan hatte, dachte ich zuerst mit Genugtuung, dass es nicht nur mir, sondern auch ihm passierte. Als es aber öfters vorkam, begann ich bitter zu weinen, was den Vater noch mehr erboste und so nebenbei bekam ich auch ein, zwei Schläge, damit ich aufhörte, was selbstverständlich das Gegenteil bewirkte. Einmal blutete Palko sogar aus der Nase. Da weinte ich noch mehr als üblich. Das Schlagen gehörte zu den üblichen Erziehungsmethoden nicht nur in unserer Familie, mit dem man rechnen musste, wenn man ungehorsam war oder etwas anstellte. Als ich einmal, vielleicht etwas über dreijährig, in einem kleinen Gemüsegarten neben dem Stall mit den Nachbarskindern unter den Steinen die Käfer und Würmer beobachtete (und tötete), war ich damit so beschäftigt, dass ich trotz des starken Stuhldrangs das Bedürfnis so lange unterdrückte, bis ich nach langer Zeit wieder in die Hosen machte. Ich war schon lange ohne Windeln, aber da die Scheisse fest war, spielte ich weiter. Als ich endlich stinkend ins Haus zum Mittagessen zurückkehrte, nahm mich Vater nach draussen und versohlte meinen Hintern samt der Scheisse. Erst dann durfte mich die Mutter putzen und waschen. Während Mutter nur solche Übertreibungen missbilligte, war Tante Aranka damit grundsätzlich nicht einverstanden, ein Grund mehr, warum ich sie so liebte.
*
(13) Das Gasthaus der Grosseltern in Pribovce. Foto aus einer Ansichtskarte aus der damaligen Zeit (s. Kapitel 21: Familienversammlung in Pribovce über Identität). Pribovce hatte schon damals Ansichtskarten, und das Gasthaus von Grossvater musste auf einer davon abgebildet werden! Die Quelle des Fotos ist nicht mehr eruierbar.
Grossvater Langer, der Vater meiner Mutter, war ein aktiver, unruhiger Mensch, der immer voller Ideen und Tatendrang war. Wie bei solchen Menschen üblich, war nicht alles gut und richtig, vor allem hatte er nicht die Geduld, in Ruhe abzuwarten – es musste immer etwas geschehen, immer etwas unternommen werden. Er kam nach Turiec aus dem fruchtbaren, warmen Süden, aus Zlate Moravce mit einem Planwagen voll Obst und Gemüse, wie es während meiner Kindheit noch üblich war, um in dem von Bergen umrahmten eher kalten Turiec diese Seltenheiten zu verkaufen. Es gefiel ihm nicht nur Rosa Neumann, die Tochter des damaligen Wirtes, der als Lehrer in Mosovce nicht genug verdiente, sondern auch der „Turiec-Garten“ (Turciansk zahradka), in dem diese Rose blühte. Urgrossvater Neumann beteiligte sich an der 1848er Revolution in Wien, floh dann aus der Gegend um Czernowitz aus Galizien und begann ein neues Leben in Turiec. Er hatte fünf Kinder aus der ersten Ehe und drei Töchter aus der zweiten. Die Kinder aus der ersten zerstreuten sich in der ganzen k.u.k. Monarchie, die drei Töchter aus der zweiten blieben in Turiec. Rosa hatte grossen familiären Sinn. Sie fand nebst fünf Kindern und dem grossen Betrieb nicht nur die Zeit für umfangreiche Briefe, schickte der ganzen Familie ausserhalb von Turiec Pakete mit einheimischen Köstlichkeiten. Ein Sohn des Bankdirektors aus Wien, der bekannte Schriftsteller Robert Neumann, Vetter meiner Mutter, erinnerte sich in seiner Autobiografie an seine schönen Ferien in Pribovce. Übrigens wurde er in den Spuren seines Grossvaters hundert Jahre später eines der Idole der 1968er-Bewegung in Deutschland.

(14) Robert Neumann, vor allem Satiriker und Ironiker, Präsident des deutschsprachigen PEN-Clubs auf der Titelseite der Zeitschrift "Der Spiegel" Anfang 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Die Quelle des Fotos ohne Schutzwarnung um Copyright angefragt, keine Antwort erhalten.
Das breite, fast viereckige Tal von Turiec ist von allen Seiten von Bergen umsäumt. Als man dem Grossvater später vorschlug, nach Budapest um- und dort ein neues Geschäft aufzuziehen, wollte er aber sein Gasthaus in Pribovce, das geografische Zentrum von Turiec, wo die Kutschen und Fuhrwerke mit ihren Reisenden Halt machten und einkehrten, nicht verlassen, umso mehr, als er dort „jemand“ war. Zum Beispiel, wenn die Kinder mit der Vorbereitung zur täglichen Fahrt in die Schule nach Martin und mit dem Frühstück noch nicht fertig waren, konnte er den Stationsvorsteher, einen guten Kunden, anrufen und ihn bitten, den Zug anzuhalten, bis sie auf dem nicht weit entfernten Bahnhof erschienen. Meine Frau glaubte nicht so recht an diese Geschichte, bis wir bald nach der Wende im Jahre 1991 von Budweis nach Linz mit einer alten Dampflokomotive fuhren. In einem Dorf vor der Grenze wartete der Zug ein paar Minuten, bis ein gut beladenes, altes Mütterchen ihn mühsam erreichte. Grossvater hielt nicht nur ein Gasthaus, wie die Eltern meines Vaters, sondern auch ein Geschäft, in dem man alles bekam, ein Vorgänger von einem Kaufhaus in Miniaturausgabe. Er bestellte immer die neusten Entwicklungen, weil er, wenn schon weder in Budapest noch in Wien ansässig, nicht hinter dem Sortiment der dortigen Geschäfte hinken wollte. So hatten seine Kinder die ersten Schlitt- und Rollschuhe, Skier und anderes Spielzeug. Bei den Bestellungen war er grosszügig und rechnete nicht damit, dass in der Umgebung von Pribovce weniger Interessierte für solche Waren lebten als in den Grossstädten. Vielleicht war er auch bei den Bestellungen nicht genau. Einmal kam eine Ladung von neuen Schuhen, leider aber nur die linken Paare. Trotzdem, obwohl er das Geschäft eher als Künstler denn als Händler betrieb, wurde er reich und besass immer mehr Ländereien um Pribovce herum. Er war ein begeisterter Anhänger der k.u.k. Monarchie, deren Liberalismus es den Juden ermöglichte, sich auf vielen Gebieten durchzusetzen. So zögerte er nicht, sein ganzes Geld in die k.u.k. Kriegsanleihe zu stecken. Als der Erste Weltkrieg die k.u.k. Monarchie beendete, war das Geld endgültig verloren. Aber er verkraftete die Verluste und wirtschaftete so, dass die Söhne studieren konnten und die Töchter beziehungsweise ihre Männer gute Mitgifte erhielten. Mehrere Jahre wohnten die Grosseltern zusammen mit der ältesten Tochter Jolan, ihrem Mann Poldi und den Töchtern 
(15) Grossvaters Familie: hintere Reihe von links Niklaus (Miki), Ladislav (Laci), meine Mutter Aurelia (Aranka, Zlatica), Oskar (Osi); untere Reihe: Jolanda (Jolan) mit dem ersten Enkelkind Valerie (Valika), Grossmutter Rosa (Ruzena), Grossvater Josef (Jozef)
Valika und Aliska in Pribovce und halfen, den Betrieb mit der Landwirtschaft und dem Gasthaus weiterzuführen. An den Sonntagen traf sich die ganze Familie in Pribovce. Ich erinnere mich, wie wir mit der Kutsche von Pribovce dorthin und zurück gebracht wurden. Wir assen gut und besichtigten auch die Güter in Rakovo mit den wertvollen Simmentaler Kühen, die ungewöhnlich viel Milch spendeten. Vielleicht zwei Jahre nach meiner Geburt zogen die Grosseltern in ein Haus fast neben Onkel Laci mit einem kleinen Laden vorne, damit Grossvater etwas zu tun hatte und nicht ganz aus der Übung kam. Er musste sich im Sortiment sehr einschränken und führte nur einfache Nahrungsmittel und Waren für den Haushalt. Im gegenwärtigen Geschäft von Idiglio in Agra bekommt man eine Vorstellung, wie der Laden von Grossvater in Pribovce in grösserem und in etwas kleinerem Ausmass in Martin war. Wichtig für uns war, dass er dort, wie bei Idiglio, auch Süssigkeiten hatte, die er uns nicht im Übermass verteilte. Der Vorteil des kleinen, nicht profitablen Ladens war, dass ihn später niemand arisieren wollte, er wurde einfach geschlossen. Grossvater sass gerne im Schaukelstuhl und erzählte uns Märchen, die üblicherweise damit endeten, dass die Hauptmärchenperson furzte und damit war Schluss. Meine Vettern Duro und Jano

(16) Vettern Duro (Georg, Juraj) und Jano (Johann, Jan) links.
hatten nicht das genügende Sitzfleisch, um zuzuhören und verabschiedeten sich schon nach dem ersten Märchen. Sie bekamen trotzdem ein bis zwei Bonbons. Manchmal erhielten wir einen Batzen, mit dem wir beim nicht weit entfernten Pferdemetzger eine Schnitte von einer Wurst kaufen gingen. Sie war sehr gut gewürzt, um den süsslichen Geschmack des Pferdefleisches etwas zu übertünchen.
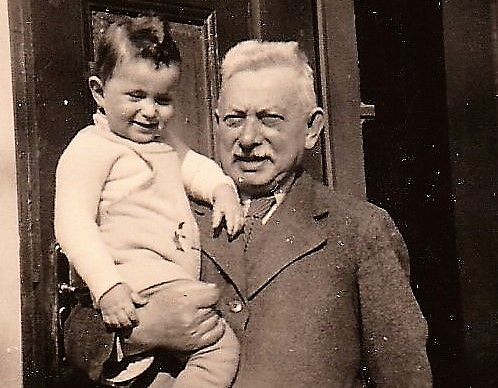
(17) Grossvater und Peterli. Foto: Bruder Palko.
Grossvater war ein direkter, sehr gerechter Mann und bekämpfte Schwindeleien und falsches Handeln, wo er nur konnte. Als schon die Abtransporte drohten, kämpfte er gegen den Vorsteher der jüdischen Gemeinde, weil er mit Recht meinte, dass dieser sich auf Kosten der Mitglieder begünstigte. Vater konnte ihm immer wieder sagen, er soll es lassen, in diesen schwierigen Zeiten hätten alle wichtigere Probleme. Er liess sich nicht davon abbringen. Er war ein leidenschaftlicher Spaziergänger. Am Sonntag bald nach dem Mittagessen führte sein Weg regelmässig bei uns vorbei. Er machte gerne Halt bei uns und kam zu einem Schwatz, auch wenn mein Vater lieber ein Mittagsschläfchen gemacht hätte. Ob schon immer oder erst im Alter, mein Grossvater wurde, selbstverständlich unbegründet, eifersüchtig. Grossmutter war alt, übergewichtig, erschöpft und herzkrank und sicher keiner Liebelei zugeneigt. Er jedoch meinte, sie habe mit einem alten Juden, mit dem sie sprach, ein Techtelmechtel. Er liess es sich nicht ausreden. Es war kaum ein Zeichen von Demenz, weil er sonst geistig sehr rege war. Grossmutter war eine liebe, ruhige, eher nachdenkliche Frau, die neben diesem Mann nie zur Ruhe kam. Ich erinnere mich, wie man ihr die Blutegel an die Unterschenkel legte, damit sie weniger geschwollen wurden und sie besser atmen konnte. Wenn sie sich satt getrunken hatten und vom Blut aufgedunsen waren, streute man etwas Salz auf die Blutegel, was sie nicht gerne hatten. So liessen sie sich problemlos abnehmen und in ein Glas mit Wasser legen. Diesen Vorgang konnte man ein paar Mal wiederholen, dann musste man neue Blutegel in der Apotheke besorgen. Neben ihrem Haus war ein Garten mit viel Johannis- und Stachelbeersträuchern. Die Grosseltern hatten weder Lust noch die Kraft, die Beeren zu pflücken. Wenn wir also im Sommer zu ihnen gingen, die Erwachsenen auf der Bank sassen und schwatzten, konnte ich mich an den Beeren stundenlang erquicken. Die Liebe zu dieser Art Obst zu pflücken blieb mir erhalten, und ich kann ihr nicht widerstehen.

(18) Grosseltern. Foto: Bruder Palko.

Das Verschwinden von wichtigen, mir nahen und entfernteren Menschen aus meinem Leben wurde zur Regel. Es begannen die Transporte. Erst wurden die Juden aus ihren Häusern von Gardisten geholt. „Hlinkova Garda“ war die paramilitärische Organisation der nationalen, slowakischen Partei, die von Hlinka, einem katholischen Pfarrer aus Zilina, gegründet wurde. Zuerst strebte sie nur nach der Schaffung eines eigenen slowakischen Staates. Mit der Zeit wurde sie immer radikaler, faschistischer. Nach dem Tod von Hlinka noch vor dem Krieg, der vielleicht die neuen Methoden nicht gebilligt hätte, führte sie ein anderer katholischer Pfarrer, Tiso. Er verhandelte mit Hitler. Nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei, zu welcher diese Partei eifrig beitrug, durfte als Belohnung dafür der erste eigene slowakische Staat entstehen. Tiso wurde der erste und der einzige Präsident dieses Hitler hörigen und von ihm abhängigen Staates. Für uns war es verheerend, für die Mehrheit der Juden tödlich. Die Gardisten waren die zuverlässigen Mitglieder dieser Partei, die bereit waren, nicht nur mit dem Wahlzettel, sondern auch mit dem eigenen Körper und den Waffen sich für die Partei einzusetzen. Sie holten die Juden umso eifriger, weil sie dann die ersten waren, die ihr Vermögen als Belohnung bekamen. Wie immer im Leben, gab es auch hier eine Hierarchie. Die Ärmeren konnten in die Wohnungen von ärmeren Juden einziehen, die Reicheren bekamen die Häuser und die Reichsten, Aktivsten übernahmen als sogenannte „Arizatoren“ die Geschäfte und Betriebe samt den Liegenschaften. Die Juden wurden zuerst in das Sammellager nach Zilina gebracht und nach ein bis zwei Wochen in Viehwagen nach Auschwitz abtransportiert. Nach Tante Aranka, mit der es begann, wurden zuerst junge, starke Männer abgeholt, die noch keine eigenen Familien hatten, da sie angeblich eben für den Sieg von Deutschland als Arbeiter helfen sollten. Bald kamen aber ganze Familien an die Reihe. Aus unserer Familie traf es die ältere Schwester meiner Mutter, Jolan (Jolanda) mit ihrem Mann Poldi (Leopold) und ihren zwei Töchtern Aliska und Valika. 
(1) Valiska, Palko und Aliska (von links).
Wie die Umstände meiner Zeugung zeigen, sah man es kommen. Jeweils im Sommer trafen wir uns, mehrere Familien mit Freunden, auf einer schönen Wiese mit einer Wasserquelle im Wald, nicht weit oberhalb der Ziegelei. Man nannte es „Pri Studnicke“ (bei der Quelle). Man picknickte und spielte Volleyball und andere Spiele. Im Frühsommer assen und sammelten wir ausserdem am Waldrand und auf dem nahen abgeholzten Waldstück Erdbeeren und Himbeeren, später Brombeeren, Heidelbeeren und Pilze. Jedes Jahr sank auch ohne Deportationen die Zahl der Teilnehmer und die gute Laune. Manche kamen nicht mehr, da sie nicht auffallen, provozieren wollten, was schon an und für sich die Laune minderte. Juden sollten sich nicht vergnügen. Im Sommer 1941 durften wir nicht mehr die besseren Umkleidekabinen in der Badeanstalt zusammen mit den Christen benützen. Für uns waren neu die bis anhin für die Armen reservierten älteren, schlechteren bestimmt. Anfangs spielte Palko in der Christenrunde Volleyball, aber niemand von ihnen spielte in der Judenrunde. Nach einer Weile reihte er sich ein, wo er hingehörte. Wahrscheinlich machte mich das Ganze unsicher. Ich wurde unzufrieden, weil ich zwar als kleiner Knopf mitspielen durfte, reklamierte aber dauernd, wenn mir der Ball nicht zugespielt wurde, auch wenn ich ihn nicht weitergeben konnte. Das Spiel wurde beendet und meine Cousinen Aliska und Valika, auch Palko, schämten sich wegen dieses ekelhaften Spielverderbers.
. 
(2) Valika (Valerie) und Aliska (Alice).
Im Frühjahr des nächsten Jahres, die jungen unverheirateten Männer waren schon weg, befahl man den jüdischen Frauen, sich in einem grossen Saal jeweils nachmittags zu versammeln, um gleich den Männern für den Krieg nützlich zu sein und Uniformen oder etwas Ähnliches für die Armee zu nähen. Mein Vater vernahm über seine guten Kanäle, dass dies die Vorbereitung für den Abtransport war und erreichte wieder auf irgendeinem Wege, dass unsere Mutter von dieser Pflicht befreit wurde, damit sie nicht auf die Liste kam. Vorher gab es bei uns Auseinandersetzungen darüber, weil Mutter es als mangelnde Solidarität und Familiensinn auffasste. Sie wurde von Palko dabei unterstützt. Nicht das erste und das letzte Mal dachten wir, Vater sei, wie einst mit den Gummigamaschen, ein übervorsichtiger Feigling. Aliska und Valika waren trotz des verdorbenen Volleyballspiels enorm stolz auf mich, weil ich lange Gedichte und Geschichten auswendig vortragen und Lieder singen konnte, was ich mit Freude tat. Sie wollten, dass ich die jüdischen Frauen bei der Arbeit etwas erheiterte und sagten, ich solle eines Nachmittags kommen, was meinen Vater erboste, und die Auseinandersetzung begann wieder darüber. In diesem Falle setzten wir uns durch, und ich erschien stolz in dem Raum, aber wie ich mich auch bemühte, als ich alle diese Frauen, samt meiner heiss geliebten Cousinen sah, die in Gefahr waren, konnte ich trotz des vielen Zuredens ihrerseits keine Silbe aus meinem Mund lassen, was mich nur noch mehr verdross und verstörte. Ich wollte wirklich, dass sie zufrieden und fröhlich waren. Diese Verklemmtheit und Unsicherheit begleitete mich seither, wie ich später beschreibe, weiter. Ich denke, alle diese Frauen sind in Auschwitz umgekommen. Mein Vater hatte wie (fast) immer recht. Leider.
Valika und Aliska wuchsen unter Umständen auf, die ihnen auch nicht genug Sicherheit und Selbstbewusstein geben konnten. Ihre Mutter war das älteste von fünf Kindern und als solches musste sie sich um die jüngeren kümmern, denn Grossmutter litt nach der Geburt des vierten Kindes Oskar, genannt Osi, unter Wochenbettdepressionen. Sie weilte für Monate in einem Kurhaus. Daher zog sie Osi im Grunde genommen alleine auf. Sie war gewohnt zu gehorchen, sich unterzuordnen und anzupassen. Und so heiratete sie auch den Mann, der für sie gefunden, vermittelt wurde, selbst wenn er weder ihr noch zu ihr passte. Onkel Poldi (Leopold) war ein runder, eher einfacher Mensch. Es gab zwischen ihnen viele Auseinandersetzungen, jedoch an eine Scheidung konnten sie damals nicht denken. Es besserte auch nicht, als um meine Geburt die Grosseltern sie in Pribovce alleine gelassen hatten und nach Martin umzogen. Die beiden Töchter waren liebe, sehr gelungene, hübsche Mädchen, über Aliska könnte man sagen, eine ausgesprochene Schönheit. Sie waren oft bei uns und bei Onkel Laci in Martin. Um zwei bis drei Jahre älter als Palko, waren sie für ihn wie Schwestern. Wir waren auch oft in Pribovce. Grossvater und später Onkel Poldi liessen uns am Sonntag von einer Kutsche abholen oder wir fuhren, weniger lustig aber schneller, mit dem Auto. Die Familie von Onkel Laci (Ladislav) mit den Vettern Duro (Juraj = Georg) und Jano (Jan = Johann) waren mit von der Partie. Seltener kamen auch
(3) Zuzka und Peterli vor der Emigration nach Amerika. Foto: Bruder Palko.
Onkel (Osi) mit Frau Zoka (Sophie) und meiner Cousine Zuzka aus Bratislava. Wir bekamen einen guten Zvieri, unterhielten uns, fuhren zu den Ställen mit den Tieren, unter welchen auch die berühmten Simmentaler Kühe waren. Nach Hause fuhren wir nicht nur satt, aber auch mit vollen Körben von erlesenen Köstlichkeiten, wie Mohn- und Nussstollen, Rahm und frischer Milch, die uns zuerst Grossmutter, später Jolan eingepackt hatten. 
(4) Zoka und Osi vor der Emigration nach Amerika.
Noch vor meiner Geburt, Valiska konnte zehn- bis zwölfjährig sein, verletzte sie sich an einem Bein. Die Verletzung war nicht schlimm, aber sie bekam eine Blutvergiftung. Die Ärzte sagten, wenn man ihr das Bein nicht amputieren würde, könnte sie nicht überleben. Jolan erlaubte die Amputation nicht, weil sie meinte, für ein Mädchen mit einem Bein sei das Leben zu schwer, um lebenstüchtig zu sein. Es waren damals solche Zeiten und Ansichten. Valika genas ohne irgendwelche Benachteiligungen.
Es war damals üblich, am Silvester „Blei zu giessen“. Man erwärmte Blei in einer grossen Schale und goss es ins kalte Wasser in der Badewanne oder einem Zuber. Es entstanden verschiedene Formen, aus denen man erraten konnte, was einen erwarten würde und nicht zu vermeiden war. Ich erinnere mich, dass am selben Silvester beide meinten, Valika mehr als Aliska, ihr Blei bringe nichts Gutes. Beide verbrachten mit mir viel Zeit und spielten mit mir. Ich liebte beide, aber die ernstere, ruhigere Valika etwas mehr. Einmal waren nur wir drei zusammen, ich weiss noch genau wo, im Hof der Elektrizitätsverwaltung, wo ein Sandhaufen zum Spielen war und ich als Nachbar dort auch graben durfte. Aliska fragte mich, welche von beiden ich lieber habe. Ich sah, beide interessierte die Antwort. Es war mir sehr unangenehm, weil ich sie nicht hintanstellen wollte, anderseits lügen oder eine Antwort verweigern sollte man besonders so nahen Menschen auch nicht. Ich sagte halt dann doch, dass ich Valika lieber habe.
(5) Jolan mit Töchtern vor dem Transport nach Auschwitz. Foto: Bruder Palko.
Um beide interessierten sich Männer. Einer von ihnen, der auf Aliska ein Auge geworfen hatte, begleitete sie bei den Ausflügen zur „Studnicka“, auch sonst war er oft in ihrer Nähe. Er „genügte“ der Familie nicht. Als lediger junger Mann wurde er mit dem ersten Transport aus dem Umlauf genommen. Die Deportation drohte auch der ganzen Jolan-Familie. Man suchte nach einer Rettung für diese zwei Mädchen. Ärzte und ihre Familien gehörten zu denen, die automatisch eine „Vynimka“ (Ausnahme) hatten, das heisst, sie wurden als wichtige, wertvolle, nützliche Menschen nicht weggeschafft. In der Zeit arbeiteten im Spital in Martin zwei junge, ledige, jüdische Ärzte. Onkel Laci, der gegenüber dem Spital seine Praxis hatte, versuchte, aber vermutlich war es eher Tante Ella, seine Frau, sie mit Valika und Aliska zusammen zu bringen.
(6) Jolan und Poldi beim Abschied vor dem Transport nach Auschwitz. Foto: Bruder Palko.
In der Tat, sie gingen zusammen aus. Wir sahen sie vor dem Haus stehen, als wir spät abends von Lacis oder den Grosseltern, die zwei Häuser weiter weg wohnten, nach Hause gingen. Die Ärzte konnten sich aber nicht entschliessen. Wahrscheinlich hatten sie Angst vor der Verantwortung. In der schweren Zeit wollten sie sich weder binden noch mit einer Familie belasten. Mutter meinte, sie hätten Valika und Aliska auch nur formell heiraten können. Was aus den Ärzten geworden ist, weiss ich nicht. Neblig erinnere ich mich, dass einer von ihnen nach dem slowakischen Aufstand, als jeder Jude, egal ob Arzt oder nicht, ermordet wurde, auch umgekommen ist. Valika und Aliska sind samt Eltern bald nach Zilina abgeführt worden. Ein paar Tage vorher waren sie mit den Eltern bei uns, um sich zu verabschieden. Palko hatte uns fotografiert. Die Bilder, auch wenn klein, strahlen unsere Niedergeschlagenheit und Trauer aus. Ich bin im Pyjama, da ich wieder, wie damals oft, krank war. Man schlug vor, Valika und Aliska aus dem Sammellager in Zilina zu befreien, was durch gute Verbindungen und mit viel Geld möglich war. Ein Vetter von Tante Ella, Bubo Klein, der in Zilina lebte, war der Vermittler. Meine Cousine zweiten Grades, Hanka aus Israel, kam so samt der Eltern aus dem Lager raus, und sie lebten während zwei Jahren bei Strelingers „versteckt“ (s.Kap. 4 “Strelingers”. Valika und Aliska weigerten sich. Zermürbt durch die schlechte Ehe der Eltern, ohne Vertrauen und mit einem kleinen Selbstbewusstsein, wozu auch die Geschichte mit den Ärzten beitrug, wollten sie die Eltern nicht verlassen und der Familie zur Last fallen. Wir alle, am meisten vielleicht Palko, dem sie am nächsten standen, waren davon schwer betroffen, besonders als wir ein Jahr später, durch welchen Kanal auch immer erfuhren, dass sie nach ein paar Monaten vergast wurden. Wahrscheinlich gaben sie auf und kämpften nicht um ihr Leben. Aber möglicherweise verwechsle ich es und es war erst nach dem Krieg, als uns diese traurige Nachricht zugetragen wurde.
(7) Wir traurig beim Abschied von Jolans Familie; Ich war wieder einmal krank. Foto: Bruder Palko mit Selbstauslöser oder einer der Reisenden nach Auschwitz?
Ja, ich war in dieser Zeit oft krank. Ohne irgendwelchen Grund, ohne Beschwerden bekam ich hohes Fieber. Anfangs kam Onkel Laci, der mich untersuchte, als sie weg mussten, sein Kollege Doktor Pirozenko, ein russischer Flüchtling, ein anständiger Mensch, kein Antisemit, der - denke ich - Verständnis für unsere Lage und meinen Zustand hatte. Mit mehr Erfahrung meisterte es meine Mutter später praktisch ohne ihn, da man mit Geld sparsam umgehen musste. Die Krankheiten waren einerseits für mich angenehm, die Mutter sorgte sich vermehrt um mich. Die meiste Zeit verbrachte ich alleine – die Erwachsenen waren mehr als genug beschäftigt und Dienstmädchen hatten wir schon lange nicht mehr. Nur gegen Abend und nach dem Abendessen kamen Mutter oder Palko und lasen mir vor. Es gab zuerst zwei bis drei besonders schöne Bücher, die ich nur bei einer Krankheit anschauen durfte, wie das Tragen spezieller Kleider für den Sonntag. Wenn ich kein zu hohes Fieber mehr hatte, durfte ich aufsitzen und Bilder anschauen. Ausser Neugier und Streben nach Unabhängigkeit trugen auch die langen Tage im Krankenbett dazu bei, dass ich baldmöglichst selbst die Bücher lesen wollte. Ich war 4 1/2 als es mir zuerst mit den Überschriften gelang, mit der Zeit brachte ich es fertig, ganze Bücher zu lesen. In Erinnerung blieben mir ein wunderschön illustriertes Buch mit Versen über verschiedene Tiere, ein Buch über Käfer, auch mit Bildern, in welchem Glühwürmchen als Lichtspender den anderen unter der Erde dienten; eines über Abenteuer zweier Schweinchen, Budkacik und Dupkacik, und mehrere Märchenbücher, unter anderem über die slowakischen Riesengebrüder Valibuk, Lomidrevo und Loktibrada (Buchekipp, Holzbrech und Langbart). Wenn das Fieber am Verschwinden war, bekam ich zur Stärkung ein rohes Eigelb mit Zucker, ein Leckerbissen. Während der Krankheit hätte dies die Verdauung und damit den ganzen Körper zu viel belastet. Bei hohem Fieber hatte ich Halluzinationen. Ich flog frei herum und hatte verschiedene andere angenehme Erlebnisse. Das Fieber wurde von meiner Mutter energisch mit Aspirin bekämpft, das, wenn ich es nicht schnell schluckte, fürchterlich bitter schmeckte, sowie mit den Priesnitz-Umschlägen. Dazu benützte man in kaltes Wasser eingetauchte und nicht sehr gründlich ausgewrungene Tücher, die sie um die Füsse wickelte und dann mit trockenen Tüchern umhüllte. An den Füssen war es erträglich, aber noch häufiger wegen der grösseren Fläche, die die Prozedur wirksamer machte, umwickelte sie mir die Brust, wozu ich mich mit dem vom Fieber glühenden Rücken auf das feuchte eiskalte Tuch legen musste, das dann auch mit trockenen Tüchern umhüllt wurde. Dabei bekämpfte man nicht nur das Fieber, sondern übte auch Beherrschung und Mut. Ob dank dieser unangenehmen Therapie oder von selbst, der Spuk war nach drei bis vier Tagen vorbei. Als ich in die erste Klasse kam, verbrachte ich mehr Zeit zu Hause als in der Schule, da ich alle möglichen Kinderkrankheiten bekam, auch eine Gelbsucht, die, wie sich später durch eine Blutuntersuchung zeigte, keine übliche infektiöse Gelbsucht, sondern eine Begleiterscheinung irgendeiner viralen Krankheit war. Hatte ich die Fieberschübe wegen der schwierigen Umstände und waren sie, wie man es heute bezeichnen würde, psychosomatisch? Die Beherrschung wurde, ausser mit den fürchterlichen Priesnitz-Umschlägen, auch damit geübt, dass ich, solange der Fiebermesser nachmittags um vier über 37° zeigte, das Bett hüten musste und erst nach einem fieberfreien Tag aus dem Haus gehen durfte.
(8) Peterli ist etwas nachdenklich. Foto: Bruder Palko.
Bereits nach den ersten Transporten der jungen jüdischen „Arbeitskräfte“, noch mehr auch ihrer Familien, wirkte Martin wie halb ausgestorben. Die vielen Bekannten, die ich traf, die mir freundlich zuwinkten, grüssten, mit mir gesprochen hatten, waren verschwunden. Mit der Zeit leerte sich Martin immer mehr von den Juden. Auch jeder von uns hatte inzwischen einen Rucksack bereit, gepackt mit den notwendigsten Utensilien. Den grössten, dunkelgrünen hatte der Vater, einen kleineren, helleren die Mutter, Palko einen gleich grossen, ähnlich dunklen wie der Vater und ich einen ganz kleinen, auch hellen. Alle waren mit dem jeweiligen Namen bezeichnet. Ich hatte darin Toilettensachen, das heisst eigene Seife, ein kleines Handtuch, Zahnbürste, Zahnpasta, Haarbürste und Kamm – alles neu, unverbraucht. Ich war darauf ganz stolz. Später bekam ich, ich weiss nicht mehr von wem, eine Tafel Schokolade, die selbstverständlich nicht so fein schmeckte wie diejenige von der Adelsfrau. Ich versorgte sie in meinen Rucksack, und nur bei besonderen Anlässen wie Geburtstagen gönnte ich mir ein kleines Quadrat, Teil einer Reihe. So blieb sie mir erhalten bis wir wieder frei wurden. Ich glaube, im Frühherbst 1942 wurde es ganz bedrohlich. Die Eltern sagten mir, ich solle nicht weit spielen gehen, da die Gardisten jederzeit kommen und sie ohne mich mitnehmen könnten. Ich gehorchte, wie ich nur konnte und wenn ich nur hinten im Hof des Elektrizitätswerkes war, plagte mich schon eine unangenehme Mischung aus schlechtem Gewissen und Angst. Aber ins Lager wollte ich auch nicht, wenn es so gefährlich war und man es so fürchtete. Wir fühlten uns einsam und isoliert und waren es auch. Der Kontakt mit den wenigen Juden, die zurückblieben, schien gefährlich und war es fast mit Sicherheit. Zu den Eltern ging die Mutter auch nur abends in der Dunkelheit. Sogar Frau Cunek, unsere Waschfrau, die sonst fast jeden Tag bei uns vorbeikam, erschien eine Woche lang nicht. Als sie dann eines Abends wiederkam, rannte ich ihr mit erhobenen Armen und unbeschreiblicher Freude entgegen und rief: Frau Cunek, Sie sind wieder hier! Sie erklärte glaubwürdig, sie hätte besondere Sorgen und Aufgaben gehabt und versprach, nie mehr so lange bei uns zu pausieren, was sie auch hielt.

Auf der anderen Seite vom Haus, in dem Tante Aranka ihr Geschäft hatte, war unser Haus mit einem fast gleichen verbunden. Ein kleines Häuschen, ursprünglich vielleicht ein Magazin oder eine Waschküche, trennte unseren Hof mit einem Birnbaum von ihrem kleinen Garten. In den zwei kleinen Räumen des tiefen Häuschens wohnte eine Arbeiterfamilie mit mehreren Kindern. Das Jüngste war ein drei- bis vierjähriges Mädchen. Wenn sie zu uns kamen, was sie gern taten, krochen sie einfach aus dem Fenster ihrer Küche, in der selbstverständlich etliche von ihnen auch schliefen, und ersparten sich damit den Weg um die zwei Häuser. Die zwei Jüngsten spielten mit mir, schoben mich auf der kleinen Schaukel und schaukelten selbst. Sie versuchten mir beizubringen, wie ich alleine angeben kann, aber es gelang mir nicht, ich war dafür noch zu klein. Dieser Misserfolg prägte sich tief in mir ein und ich mied das Schaukeln, wo ich nur konnte und lernte es erst später von meiner Frau wegen unserer Tochter. Wenn ich Znüni ass, bekamen sie auch Butter- oder Marmeladenbrot. Dann krochen schnell auch die anderen aus dem Fenster heraus, ähnlich den Hühnern beim Füttern.
Als ich ungefähr vier Jahre alt war, fragten mich die beiden Mädchen, ob ich Vater und Mutter spielen möchte. Ich bejahte es freudig. Auf der Strasse erwartete uns ein ihnen bekannter gleichaltriger Knabe. Wir zogen zusammen in den geräumigen Hof des Nachbarelektrizitätswerkes, wo zwischen dem Bürogebäude an der Strasse und der Werkstatt viele Zement- und Metallröhren lagen, mit denen man ursprünglich irgendeinen wilden Bach bändigen wollte. Der Krieg verdarb jedoch diese Pläne, wie auch viele andere vernünftige Unternehmungen. Wir spielten zwischen und in ihnen oft und gerne Versteckis, wozu sie wie geschaffen waren. So dienten sie doch einem guten, friedlichen Zweck. Unterwegs erklärten sie mir, warum uns niemand bei diesem Spiel erwischen durfte, was ich umso leichter begriff, als mich Vetter Jano schon längst darüber aufgeklärt hatte, was Erwachsene verschiedenen Geschlechts, Eltern inbegriffen, zusammen im Geheimen und meistens in der Dunkelheit trieben. Bei den Röhren erwartete uns bereits ein weiterer Mitspieler, der im ersten Stock des Hauses am Rand des Hofes gegenüber der Geleise wohnte. Im Erdgeschoss hausten die Besitzer, ein altes, rechtschaffenes Ehepaar, das aber auf einen guten Mietzins angewiesen war. Unser neuer Mitspieler war zwei bis drei Jahre älter als meine Nachbarinnen und unheimlich geeignet für das Spiel, da seine Schwester eine Prostituierte war, die zu Hause in einer nicht zu geräumigen Wohnung ihre Besucher, ihre Kunden, überwiegend Soldaten aus den vielen Kasernen in Martin empfing, bediente und befriedigte. Selbstverständlich imponierte mir enorm, dass sich mit uns ein so alter Knabe abgab, was auch den Rest meines schlechten Gewissens, dass ich etwas Unerlaubtes trieb, beruhigte.

(1) Drei der "Lüstlinge", Peterli links. Foto: Bruder Palko.
Wir krochen in das breiteste genug hohe Rohr, das mit der Öffnung nach oben stand. Die beiden Mädchen zogen die Unterhosen aus, hoben den Rock, wir öffneten unsere Hosen und versuchten abwechslungsweise unsere Glieder an ihrem Schoss zu reiben. Bei unserer unterschiedlichen Höhe benützten wir die umliegenden Ziegel zum Ausgleich. Unser erfahrener Oheim belehrte uns, wie wir uns helfen sollten, wenn die Glieder nicht genug steif waren. Auf seine Befehle wechselten wir uns nicht nur beim Reiben ab, aber nach Art der Murmeltiere auch bei der Beobachtung der Umgebung, damit wir gewarnt würden, falls sich jemand näherte, auch wenn sich dort selten jemand verlief. Er verteilte gerecht die Frist des Reibens und bestimmte Pausen, aber die Umgebung beobachtete vor allem er. Es ging ihm mehr um die Rolle des Führers als um das Reiben, was eher die Ansichten von Adler als diejenige von Freud bestätigt. Ich kam relativ wenig dazu, da sie mir als dem Jüngsten diese verantwortungsvolle Fähigkeit nicht ganz zutrauten. Er rief uns nicht mit Namen, sondern, weil wir uns in einer anderen Welt befanden, nach dem, was dabei wichtig war, nach der Form des Gliedes. Mein Mitspieler war Pflaume, ich Birne, was nicht nur treffend war und mich besonders freute, da ich die Birnen aus dem einzigen verbliebenen Obstbaum in unserem Hof sehr liebte und unser wichtigster Hauptfuhrmann Herr Birne hiess. Bei diesem Spiel sah ich, dass mein Glied anders aussah als diejenigen der christlichen Knaben. Es schien mir eher ein Vorteil, etwas Anderes, Besonderes zu haben. Ich hatte noch nicht das Gefühl von Schuld, Minderwertigkeit und Angst. Vielleicht trug auch mein „besserer“, „höherer“ Stand als Sohn eines Unternehmers in Mitte dieser Arbeiterkinder dazu bei. Diese nicht sehr häufige Unterhaltung, weil dafür nicht immer die besten Bedingungen vorhanden waren, unterbrach zuerst der besonders kalte Winter des Jahres 1941, der auch den Deutschen die Einnahme von Moskau vereitelte. Später im Frühjahr beendeten sie die Transporte der Juden. Unsere Nachbarn zogen in ein grösseres, schöneres Haus weiter weg von uns, das nach einer armen jüdischen Familie zurück blieb, die auch mehrere, aber schon grössere Kinder hatte. Alle mussten ins Konzentrationslager gehen. Zuerst die Kinder, die angeblich durch ihre Arbeit zum Sieg der Deutschen beitragen sollten, bald darnach die Eltern. Sie waren unsere entfernten Verwandten, und Vater vermittelte den Wohnungswechsel, da er meinte, wenn sie einmal zurückkehren würden, könnten sie alles in Ordnung wieder von unseren dankbaren Nachbarn übernehmen. Aber diese mussten sich nie dieser schwierigen moralischen Prüfung unterziehen, da selbstverständlich niemand je zurückkehrte, sondern alle bald vergast wurden. Auch unser sogenannter Führer wechselte auf die andere Seite der Bahn. Sie übernahmen nicht nur das Haus, sondern auch den erstgeborenen Säugling eines nicht hoffnungsvollen jüdischen Ingenieurs, womit sie den Knaben vor dem sicheren Tod retteten. So wurde die Schwester unseres Freundes Mutter, man kann sagen auf umgekehrte Weise wie die Jungfrau Maria. Sie waren gut zu ihm, kümmerten sich um ihn wie um ein eigenes Kind. Ob angeboren oder durch Einfluss der Umgebung, wurde aus ihm ein blonder, hübscher, christlicher Knabe. Erfuhr er je seinen Ursprung? Wie gingen sie und er mit seiner „Birne“ in Mitte von all den „Pflaumen“ um? Was ist aus ihm geworden?
Ungefähr in derselben Zeit geschah etwas Merkwürdiges. Ich durfte nur Mutters nackten Oberkörper sehen. Auch das vermutlich nur, weil sie mich einmal stillte. Ich durfte nicht in das Badezimmer, wenn sie badete. Dorthin gelangte man sowohl aus dem Schlafzimmer wie aus dem kleinen Zimmer von der anderen Seite, in dem nach den Dienstmädchen Palko schlief und wo auch die Grossmutter starb. Ich lief gerne durch die ganze Wohnung, rundum durch das Vorzimmer, Veranda, kleines Schlafzimmer, Bad, grosses Schlafzimmer und Wohnzimmer. Einmal, nicht zur üblichen Zeit des Badens am Samstagnachmittag oder abends, rannte ich aus dem kleinen Schlafzimmer ins Badezimmer und erschreckte meine Mutter, die eben aus dem Bad stieg und sich abtrocknete. Ich merkte ihre Verlegenheit. Ich sah ihre Behaarung, sonst nichts, da ich nach ihrem Schrei sofort die Türe schloss. Die Eltern nahmen es als einen ungeheuren Verstoss und wollten wissen, was mich dazu geführt hatte. Als ich sagte, ich sei nur so wie üblich herumgelaufen, wollten sie es nicht glauben und beauftragten sogar Palko mit meinem Verhör. Sie dachten, ihm werde ich es eher verraten. Es war mir nicht klar, wie ich wissen sollte, dass Mutter in der ungewöhnlichen Zeit badete und begriff nicht, wieso sie nicht in Betracht zog, das Bad von beiden Seiten abzuschliessen. Mehr verteidigte ich mich nicht, es schien mir aussichtslos. Ein bisschen dachte ich auch, dass ich doch etwas schuldig war, da sie in der Zeit viele Sorgen wegen der Berufsstelle von Palko sowie der steigenden Beschränkungen und Verfolgungen hatten, dass sie sich deshalb so ausführlich meinem Verstoss widmeten. Es trug dazu bei, dass die weibliche Nacktheit für mich etwas Besonderes blieb, hinter der sich in der Tiefe trotz meiner mühsamen Forschungen unerreichbare Geheimnisse verbargen. Dadurch stieg noch meine Neugier und Sehnsucht, sie einmal zu enthüllen, was auch gute Seiten hatte.

Ausser zur Familie von Onkel Laci Langer pflegten wir engen Kontakt auch zur Familie von Onkel Laci Strelinger, einem Vetter meiner Mutter. Das hatte lange Wurzeln. Als die Langer-Kinder die Mittelschule besuchten, wohnten sie während der Woche bei Strelingers in Martin, da es in Pribovce keine Mittelschule gab. Der Kopf der Familie in meiner Zeit, war die Schwester meiner Grossmutter, Tante Teresia, genannt „Teri-Neni“ (ungarisch Tante Teri). Ihr Mann starb schon früh. Wahrscheinlich hatten die zwei jüngsten Langer-Brüder damals bereits die Mittelschule in Pribovce besuchen können. Meine Mutter genoss es bei Strelingers, da es dort lustig war, und sie hatte in den zwei fast gleichaltrigen Cousinen Ella und Valika Gespielinnen, mit denen sie etliche Streiche machte. Einmal, als sie schon alt war, verriet sie, dass sie, oh, oh, enormen Spass hatten, nur so nackt herumzulaufen. Selbstverständlich musste sie dort auch Hausarbeiten verrichten. Für meine Grossmutter war es ein guter Grund, sich bei den Strelingers für ihre gutmütige Grosszügigkeit zu revanchieren und sie mit einem Haufen von Köstlichkeiten aus der eigenen Landwirtschaft zu verwöhnen. Das tat sie auch mit der Familie einer anderen Schwester in Vrutky, die einen unfähigen Bäcker heiratete, dazu noch einen Trinker, was bei den Juden selten und verpönt war. Sie hatten viele Kinder, die er kaum ernähren konnte. Ausser einer Tochter, die rechtzeitig als Dienstmädchen nach England emigrierte, endeten alle in Auschwitz. Grossmutter schickte sogar den Halbgeschwistern Pakete nach Wien, womit sie nebst den regelmässigen Briefen Kontakt hielt. Als Besitzer einer Essigfabrik waren die Strelingers in Martin keine reichen Leute. Das änderte sich gegen Ende des Ersten Weltkrieges. Sie erhielten billig den während des Krieges raren Alkohol für die Produktion des Essigs und wurden reich. Auf der anderen Seite war unser träumerischer, vertrauensvoller, etwas leichtsinniger Grossvater ein grosser Anhänger der k.u.k. Monarchie und Bewunderer von Kaiser Franz Josef und fühlte sich verpflichtet, die Kriegsanleihen zu kaufen, die nach dem Ende des Krieges ihren Wert völlig verloren und damit auch ein grosser Teil des Besitzes von Langers vernichtet war.
Ein anderer Grund der Rivalität zwischen Langers und Strelingers war das Studium. Während bei Langers der eine Sohn Arzt, der andere Rechtsanwalt und der dritte ein studierter Handelsfachmann wurde, absolvierte der einzige Sohn von Strelingers keine Hochschule; nicht dass er dazu nicht fähig gewesen wäre, aber aus Pflichtgefühl, die Essigfabrik des früh verstorbenen Vaters zu übernehmen, um den Schwestern eine angemessene Mitgift garantieren zu können, vielleicht auch wegen der Bindung zur Mutter, die ihn bei sich haben wollte, „blieb er nicht auf Essig“ (slowakisch für unverheiratete Frauen), aber ein Essigproduzent. Das war einer der Gründe, warum sich mein Vater mit ihm so gut verstand. Beide waren für die Langer-Söhne niedrige Unternehmer, „Krämer“. Beide konnten nicht viel Verständnis für die späteren kommunistischen Träumereien der drei jungen Langers aufbringen. Sie halfen jedoch beide, wie sie nur konnten, den beiden Onkeln Laci und Miki, den naiven Idealisten, als man sie verhaftet hatte, da sie 1941 bei dem Druck der Flugblätter gegen den Krieg mit Russland dabei waren. Das war auch der Grund, warum Onkel Laci mit der Familie später in die „Verbannung“ nach Hrachovo in die Südslowakei gehen musste, da ihm auch als Arzt die Deportierung nach Auschwitz drohte. Diese Beziehung wurde noch fester, als sie sich gegenseitig halfen nicht nur ihre Familien vor der Deportation zu bewahren, sondern auch die Familie von Laci Strelinger's Schwester, Tante Vali. Sich gegenseitig und mit anderen beraten, kühl und unabhängig abwägen, möglichst alle Möglichkeiten betrachten und diskutieren, waren Eigenschaften und Gewohnheiten sowohl von Onkel Laci Strelinger wie meines Vaters.
(1) Strelingers: Vordere Reihe von links Hanka (Anna), Terri-néne, Alino (Alexander), hintere Reihe von links Onkel Bandi (Arpad), Tante Vali (Valerie), Tante Böszi (Bozena), Onkel Laci (Ladislav).
Wir weilten oft bei Strelingers. Sie wohnten nur ein paar Häuser weiter von unseren Grosseltern, und so „gehörte es sich“ für meine Mutter, mindestens einmal in der Woche dort „rein zu schauen“ und Teri nèni zu begrüsssen. Als ich bereits so weit gehen konnte, bin ich, nachdem Vetter Duro und Jano nach Hrachovo verschwinden mussten, alleine zu Alino, dem einzigen Kind der Strelingers, spielen gegangen. Er hatte einen grösseren, schöneren Spielzug und andere Spielzeuge, mit denen er mir grosszügig erlaubte auch zu spielen, aber er hatte keinen älteren, grösseren Bruder wie ich. Meistens spielten wir auch mit den Knaben aus der Nachbarschaft in Hof und Garten. Selten, nur wenn wir wussten, dass der einzige Arbeiter abwesend war, spielten wir trotzdem „Versteckis“ in der Essigfabrik, obwohl es uns Onkel streng verboten hatte. Es roch nach Essig, und die grossen Fässer waren bedrohlich wie Riesen. Es war dort auch sehr sauber. Wir fürchteten, dass die Erwachsenen nicht nur mit uns schimpfen, sondern uns auch schlagen würden. Im Garten waren Beete mit schönen Blumen und Gemüse. Onkel Laci-Strelinger war ein passionierter und leidenschaftlicher Gärtner mit einem grünen Daumen. Wir achteten beim Spielen, dort nichts zu zertrampeln. Sie hatten weniger Johannis- und Stachelbeeren als unsere Grosseltern, sodass wir sie nicht grenzenlos pflücken und essen durften, da sie es sofort bemerkt hätten und nicht genug zum Einmachen geblieben wäre.

(2) Alino in unserem Hof in Lederhosen, um die ich ihn beneidete. Mit der Pistole durfte ich auch spielen und die Hose habe ich später geerbt. Foto: Bruder Palko.
Seit undenkbarer Zeit mag ich den Geruch und den Geschmack von Essig nicht. Ich weiss nicht, wie weit es eine epigenetische Folge der Geschichte mit dem Reichtum der Strelingers ist, aber sicher auch, weil man ihn für die Reinigung verschiedener Gegenstände brauchte und vor allem für die Zubereitung der Sauerlunge, einer Speise, die wir mindestens einmal im Monat auf dem Speisezettel hatten. Schon die gummige Konsistenz war schrecklich, ungefähr so wie der Pelz auf dem Milchkaffee auf der damals nicht pasteurisierten Milch, die die heutige Jugend schon gar nicht mehr kennt. Deswegen esse ich keinen Salat mit Essigsauce, keine Essig-, sondern Salzgurken, kein in Essig eingelegtes Gemüse.

(3) Showboxkampf Alino - Peterli. Foto: Bruder Palko.
Auch als Produkt der Zusammenarbeit zwischen Onkel Laci und meinem Vater, versteckte sich bei Strehlingers die Familie der Schwester Tante Vali mit Tochter Hanka. Beide hatten ihre christlichen guten Freunde, die ihnen nützliche, lebenswichtige Informationen lieferten: Onkel Laci vor allem von seinem anständigen Arizator, mein Vater vom Kommandanten der Gendarmen in Martin, die jeweils genug früh das Verzeichnis der Juden, die abtransportiert werden sollten, mitteilten. Wenn dort die Familie der Schwester Vali stand, zogen sie für ein paar Tage zu uns bis der Transport beendet war. Wenn sie sie bei Strelingers nicht fanden, liessen sie von ihnen ab und suchten nicht weiter. Es war auch eine Art Spiel zwischen Räubern und Gendarmen, ein Überbleibsel aus der mittelalterlichen Kriegsführung, das auch den Ersten Weltkrieg überdauerte. Diese „Nachlässigkeit“ wurde genügend belohnt und jemand von den Gardisten bekam Geld dafür, das er teilweise unter zuverlässigen Genossen verteilte. Eine andere Art, die Familien vor Transporten zu bewahren, war eine vorgetäuschte Krankheit. Dafür benutzte man die Hilfe des Chefs der Hals-Nasen-Ohren-Abteilung im Krankenhaus. Er war der hiesige Schindler, ein Lebemann, der Freude hatte, seine Stärke und Unabhängigkeit zu zeigen. Bei einem drohenden Transport nahm er einem Kind der Familie die Mandeln raus. So überlebten alle meine Vettern den Krieg ohne Mandeln. Hanka blieben die Mandeln, weil sie und ihre Familie in Martin nicht angemeldet waren und somit illegal dort weilten. Heutzutage zweifelt man über den Sinn dieser Operation, damals war sie sicher lebensrettend.

(4) Wieder einträchtige Freunde. Wie am Anfang jedes Sommers wurde Peterlis Kopf zur Anregung des Haarwuches und aus praktischen Gründen kahl geschoren - damals eine übliche Massnahme. Foto: Bruder Palko.
Hanka war froh, wenn ich jeweils erschien, weil ich eher geneigt war, mit den Puppen zu spielen als ihr Vetter Alino. Mir passte es ebenfalls, wenn sie zu uns ausweichen mussten, weil wir nebst anderem auch „Dökterlis“ spielten, wozu ich die Nachbarsmädchen nicht mehr hatte.

Einen Speditionsbetrieb zu führen, war auch in den normalen Zeiten keine einfache Aufgabe. Man musste bei uns die Arbeit für die vier Paar Pferde möglichst gut, gerecht, und mit den richtigen Arbeitern dazu einteilen, die Wege möglichst kurz halten, damit sie zur richtigen von den Kunden verlangten und versprochenen Zeit erschienen. Die Pferde sollten rechtzeitig gefüttert und getränkt werden. Sie liebten es, zu Hause die Mittagspause zu verbringen und im Stall zu fressen. Nur ausnahmsweise wurden sie aus den Jutesäcken unterwegs gefüttert. Sowohl bei Pferden wie bei ihren Fuhrmännern herrschte strenge Hierarchie. Das schönste, leistungsfähigste Paar am linken Rand des Stalls betreute Herr Hruska (Birne), ein bedächtiger, ruhiger Mann, der, wenn er mit der Arbeit fertig war, an seiner Pfeife zog. Er und seine Pferde wurden mit den schwierigsten Aufgaben betreut. Er war auch meistens mit den Möbelumzügen beauftragt, weil er gut einschätzen konnte, wie viel Raum und wie viele Möbelwagen man für den jeweiligen Umzug benötigte. Wir hatten zwei Umzugswagen, einen grösseren und einen kleineren. Für reiche, vornehme Kunden brauchte man eben beide. Er dirigierte auch, welches Möbelstück wohin platziert werden musste. Seine Pferde waren braune Steirerpferde, eine gute Rasse aus der Steiermark. Meistens kam er auch jeden Sonntag, nicht nur um seine Pferde zu füttern. Er hatte die Tiere gern und schlug sie nur ausnahmsweise mit der Peitsche, auch weil die Zuneigung gegenseitig war. Ich erinnere mich nicht mehr, ob es noch im Krieg oder bald nach seinem Ende war, jedenfalls gab es nicht genug Getreide. Als Vater am Sonntagmittag im Stall nachschaute, ob alles gut läuft, was er oft tat, sah er, dass die Pferde vor sich geöffnete Zeitungen statt ihr Fressen hatten und Hruska neben ihnen sass und seine Pfeife rauchte. Als Vater überrascht und verärgert fragte, was das zu bedeuten habe, sagte Hruska gelassen: „Wenn die Pferde nicht genug zu fressen bekommen, sollen sie wenigstens die Zeitung lesen.“ Der zweite Angestellte neben Hruska war Herr Brako. Er hatte zwei schöne, starke Schimmel, war jedoch nicht so perfekt wie Hruska. Ich glaube, Hruska trank nicht, Brako schon, auch wenn nicht viel. Die anderen zwei Paar Pferde waren auch nicht schlecht, aber nicht so schön und bekamen auch weniger zu fressen und verrichteten eher weniger schwere Arbeiten. Wie schwierig es war, erinnerte mich Vetter Alino. Bei ihnen musste man die vollen Essigfässer holen und die leeren wieder zurückbringen. Der Eingang in den Hof war eng und einmal rammte irgendein Fuhrmann, vielleicht auch noch nicht ganz wach und nüchtern nach seinem abendlichen Trinkgelage, etwas von der Ecke des Hauses, was Alinos Vater äusserst empörte und er meinem Vater deswegen Vorwürfe machte. Beim nächsten Transport der Fässer erschien mein Vater persönlich, um zum Rechten zu schauen, was Alino sehr beeindruckte. Im Allgemeinen hatte Vater die anspruchsvollen, kritischen, unzufriedenen jüdischen Kunden nicht so gern, weil sie nicht selten die Arbeit und die Rechnung reklamierten. Es gab sie als Kunden nicht mehr, als Menschen immer weniger. So hatte er es nicht gemeint.
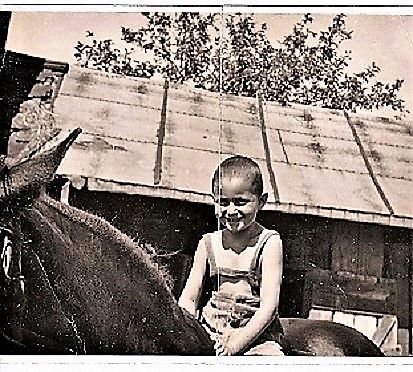
(1) Peterli hoch auf dem Ross. Foto: Bruder Palko.
Dass wir nicht abtransportiert wurden, hatte mehrere Gründe. Der Hauptgrund war unser „Arizator“, Herr Hanzel, ein kleiner, eher primitiver Angestellter einer Bank, der nicht nur von der Spedition keine Ahnung hatte. Einige Juden, so wie auch Onkel Laco Strelinger, konnten den Arizator wählen, umgekehrt, wählten manche Arizatoren den Betrieb nach ihren Kenntnissen und Neigungen. Herr Hanzel wurde uns zugeteilt. Ob die dafür Verantwortlichen bereits ihre guten Gründe dafür hatten oder ob es nur ein Zufall war? Mein Vater litt sehr unter dieser Last, wünschte sich jemanden Besseren; aber ob es besser ausgegangen wäre? Herr Hanzel war ein Bankangestellter, Trinker und spielte dazu leidenschaftlich, jedoch wenig erfolgreich Karten, was er meistens kombinierte. Wie so oft bei Alkoholikern hatte er eine sehr anständige, gläubige Frau. Unser Betrieb half ihm, die Verluste zu begleichen, wovon alle seine Mitspieler Nutzen hatten und kein Interesse, diese gute „Melkkuh“ zu verlieren. Es war allen klar, dass der Betrieb ohne meinen Vater bald bankrottgehen würde und dadurch Herr Hanzel seine Schulden nicht begleichen könnte. Das Problem war, dass Herr Hanzel manchmal mehr mit dem Kartenspiel verlor, als der Betrieb erwirtschaftete, und so musste sich mein Vater das Geld leihen. Trotz der grossen Unsicherheit solcher Anleihen, fanden sich dafür anständige Leute. Als „Pfand“ hinterliess und gleichzeitig versteckte mein Vater bei ihnen unsere wertvollen Bilder. Nach dem Krieg beglich mein Vater die Schulden und als Zugabe gab er ihnen ein Bild nach ihrer Wahl. Begreiflicherweise, wenn Herr Hanzel Geld brauchte, und es war den Umständen entsprechend nicht selten, drohte er meinem Vater mit dem Transport ins Konzentrationslager, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. An eine solche Episode erinnere ich mich. Als meine Grossmutter nach mehrwöchigem Aufenthalt bei uns im hinteren Zimmer an Herzschwäche starb, wurde Onkel Miki in seinem Versteck in Ziarska Dolina (ein wunderschönes Tal, das wir anlässlich des Familientreffens im 2009 besuchten), wo er sich als einen debilen Hirten mit Sprachfehler ausgab, benachrichtigt. Trotz grosser Gefahr kam er sich von der toten Mutter verabschieden. Als er unter dem Fenster des Büros durchlief, in dem Hanzel zufällig anwesend war, bückte er sich nicht genug. Hanzel sah ihn und nach einer Weile fragte er, wer da gelaufen sei, auch wenn er trotz seiner beschränkten geistigen Fähigkeiten ahnte, wer und warum. Miki war inzwischen irgendwo versteckt, doch Hanzel nützte es mit Wonne aus, dem Vater zusätzlich ein paar tausend Kronen abzupressen. Das Leben von Hanzel endete tragisch. Nach dem Aufstand und der deutschen Besetzung der Slowakei ging er, wie üblich, mit seinen Freunden jagen. Die Niederlage der Deutschen war allen klar. Die Freunde von Herrn Hanzel fürchteten, dass er mit seinem einfachen Gemüt, nach dem Krieg vor dem zu erwartenden Gericht über sie gefährliche Tatsachen ausplaudern würde und beschlossen deshalb, ihn wegzuschaffen, in dem sie einen Jagdunfall veranstalteten. Vater war froh, dass ihm die Auseinandersetzungen nach dem Krieg vor Gericht und sonst erspart blieben und tröstete dann die Witwe mit den Worten: „Auch dank Ihrem Mann sind wir da“. Er unterstützte sie aber auch finanziell.

(2) Tal von Ziar (Ziarska dolina) im Frühjahr. Eigenes Foto.
Noch vor dem Krieg gründete ein Grossbauer eine andere Spedition. Die Konkurrenz war zwar nicht ganz willkommen, aber Vater kam mit ihm gut aus. Er überwies ihm sogar manchmal Arbeit wie auch Kunden. Diese gute Beziehung war durch die Charaktereigenschaften der beiden Seiten möglich, aber auch dadurch, dass der andere ein vollblütiger Bauer und nicht Spediteur war. Er besass nur einen kleinen Umzugswagen, seine Pferde und Angestellten verrichteten hauptamtlich Feldarbeiten und wenn sie damit voll beschäftigt waren, kamen ihm Speditionsaufgaben höchst unwillkommen, so überliess er sie meinem Vater. Auch als ihn mein Vater fragte, ob er ihn als Arizator vorschlagen könne, lehnte er dankend ab, was auch nicht schlecht war, weil er sicher weniger Einfluss und auch Interesse als Hanzel hatte, uns vor dem Konzentrationslager zu bewahren. Wie auch, er war nicht interessiert, dass wir verschwinden würden.
(3) Unser Lastwagen. Foto: Bruder Palko.
Wie mit ihm, so verkehrte mein Vater auch mit anderen Menschen und hatte keine ernsthaften Feinde aber viele Freunde, was dann ein grosser Vorteil war. Von einem Dorf ohne Juden war er gewohnt mit Christen umzugehen und zu verkehren. Er sparte weder mit Zeit noch mit Geld und ging jeden Tag zu einem Männerfriseur namens Slivka (Pflaume), um sich rasieren zu lassen. Beim Warten plauderte er mit den anderen Kunden und dem Chef, der auch ein Gardist wurde und so bei den Entscheidungen eher für Vater ein Wort einlegte. Der Bruder von Slivka führte an einer anderen Strasse ein Damencoiffeurgeschäft, wo alle Langer-Frauen sich ihre Frisuren machen liessen. Er trat nicht in die Garde ein. Auch mir wurden dort die ersten Haarschnitte verpasst, begleitet von Weinen und Schreien, für das ich eigentlich keinen Grund fand. Später, als ich beim Haarschneiden nicht mehr weinte und es angenehm empfand, ging ich mit Vater zum Gardisten Slivka. Man konnte verschiedene Gründe für diese unterschiedliche Einstellung der Coiffeurbrüder finden. Der eine war anständiger als der andere, für Frauen gab es keine Garda, nur Männer waren Gardisten und potenzielle Kunden. Vermutlich wollten sich die Brüder im Falle der Fälle auf beide Seiten absichern. Später liess sich auch Vater nur die Haare schneiden. Jeden Tag sich vom Coiffeur rasieren zu lassen, diese herrschaftliche Gewohnheit, gehörte sich nicht mehr für einen Juden. Es war besser, sich nicht öffentlich zu zeigen. Es war peinlich den judenfeindlichen und deutschfreundlichen Gesprächen, die in Mode kamen, zu lauschen. Zudem musste Vater mit Geld und Zeit sparen. Den Zvieri nahm Vater vor dem Krieg oft nicht zu Hause sondern in einer „Bodega“ an der Hauptstrasse ein. Der Imbiss bestand nicht selten aus Schweinsprodukten wie Schinken, Press- oder anderen Würsten, was seinem Schwiegervater ein Dorn in Auge war. Es störte ihn noch mehr, dass Vater dazu auch Schnaps oder Wein trank, was sich für einen guten Juden nicht gehörte. Auf der anderen Seite imponierte es den Christen, und sie schätzten es, dass ein Jude dies tat und mit ihnen auch auf diese Art verkehrte. Dank seiner freundlichen Natur gewann er so wichtige Freunde und Unterstützer. Er tat es nicht absichtlich, es lag in seiner Natur.
Wichtig war auch, dass er mit den Arbeitern gut auskam. Es war nicht immer leicht. Während der grossen Wirtschaftskrise der 30-er Jahre entliess er keinen Angestellten, auch wenn es eine finanziell sowie organisatorisch vorteilhaftere und einfachere Lösung gewesen wäre. Sie arbeiteten und verdienten weniger, aber keiner musste hungern. Die Arbeiter schätzten es. Dafür gab es wenig Wechsel. Es gingen nur solche, die eine bessere Stelle fanden. Es war eine gute Referenz, wenn sie sagen konnten, sie kämen vom Eckstein. Eigentlich war es dasselbe auch mit den Dienstmädchen meiner Mutter. Einer der Angestellten, der uns verliess, war ein sehr guter Pferdekenner. Vater nahm ihn immer mit, wenn er ein Pferd kaufen wollte. So gingen sie einmal auf einen berühmten grossen Pferdemarkt. Ihnen gefiel ein sehr schönes, kräftiges Pferd, das noch dazu überraschend günstig zu haben war. Sie gingen mit ihm herum, vielleicht machten sie sogar eine Probefahrt mit dem Pferd. Sie waren begeistert und bezahlten, ohne gross zu handeln, gerne den verlangten Preis. Als am nächsten Tag das Pferd eingespannt wurde und es den Wagen ziehen liess, merkte man, dass es laut pfiff. Dies verminderte seine Leistung zwar nicht, aber es war unter der Würde und in Martin besonders störend, da wir weit und breit berühmt waren, mit schönen, sauberen, gut ernährten Pferden zu arbeiten. Als ich nach Jahrzehnten zurückkehrte und sagte, wer ich sei, hörte ich sofort von älteren Leuten, was für Pferde wir gehabt hätten. Es war klar, dass so ein Pferd nicht bei uns bleiben konnte. So begaben sich mein Vater mit seinem Pferdekenner erneut auf den Markt. Vater sagte ihm, wenn er das Pferd verkaufe, bekomme er eine zusätzliche Belohnung. Es dauerte nicht lange und das Tier wurde einem Bauern verkauft. Lange Zeit hörten sie nichts vom Pferd, der Bauer reklamierte nicht. Nach längerer Zeit brauchten sie wieder ein Pferd. Kaum waren sie auf dem Markt, als ihnen derselbe Bauer winkte, zurief und auf sie zusteuerte. Sie taten, als ob sie ihn nicht sehen würden und versuchten sich zu verstecken. Es half nichts, der Bauer verfolgte sie mit einer grossen Ausdauer. Als er sie erreichte, fragte er sie zu ihrer grossen Überraschung sehr freundlich, ob sie nicht noch ein solches Pferd hätten. Des Rätsels Lösung: Der Bauer war fast vollständig taub und auf dem breiten Feld störte das Pfeifen des Pferdes niemanden. Und auch das Pferd freute sich, dass es endlich geschätzt wurde und arbeitete noch eifriger als früher.
Jeden Samstagabend war Zahltag. So zwischen fünf und sieben hatte die Mutter die unangenehme Aufgabe, den Lohn auszurechnen und den Arbeitern zu übergeben. Die Arbeiter wurden nach Akkord, je nachdem wieviel, wie schwer, wie lange sie gearbeitet hatten, bezahlt. Naturgemäss war es nicht einfach zu beurteilen und ein willkommener Anlass für Meinungsverschiedenheiten, Reklamationen, Streitereien und Ärger, umso mehr als manche schon angetrunken erschienen. Wenn Mutter zu grob behandelt wurde, erschien Vater und klärte die Lage ab, was mit den Betrunkenen in dem Moment nicht leicht war und er hie und da sogar als schmutziger Jude beschimpft wurde. Schon in normalen Zeiten war es kein Honiglecken, aber jetzt, während des Krieges mit der Drohung der Deportation, war es sehr belastend. Aber zum Glück beschwerte sich kein Arbeiter, indem er uns bei den Behörden anzeigte. Sie waren so weit anständig und wussten auch, wie die Kartenpartner von Hanzel, dass ohne Vater das Geschäft bankrott ginge und sie eine doch nicht so schlechte und sichere Stelle verlieren würden. Das Problem war auch, dass die Frauen von den schweren Trinkern die Mutter baten, ihnen den Lohn auszahlen. Das ging vielleicht zwei bis drei Wochen gut, aber wenn die schlimmsten Schulden bezahlt waren, verlangten die Männer den Lohn für sich. Sie ertrugen die Erniedrigung nicht.
Fero (Ferdinand) war einer der Arbeiter. Er war körperlich und vor allem geistig behindert. Vater „erbte“ ihn von Grossvater, dem er jahrelang in Pribovce diente. Grossvater hielt weiterhin seine schützende Hand über ihn. Fero konnte nicht gut sprechen, aber da er über keine komplizierten Tatsachen berichtete oder nachfragte, konnte man mit ihm gut verkehren, umso mehr als er ein friedfertiger Mensch war, sogar wenn er getrunken hatte, was oft und regelmässig geschah, sodass man seinen „Lohn“ direkt in „seine“ Kneipe hätte überweisen können. Er verrichtete ohne Widerstand, sogar mit sichtbarer Freude die schwersten und schmutzigsten Arbeiten. Er putzte dauernd etwas, zum Beispiel die Strasse nach den Pferdeäpfeln. Eines Jahres an Weihnachten war es sehr kalt. Man bemerkte, dass die Speisen, die man ihm am Heiligen Abend in seine einfache Bleibe neben der Waschküche stellte, sowohl am Weihnachts- wie am Stephanstag unberührt blieben. Man machte sich Sorgen, wo Fero sein könnte, was war mit ihm geschehen? Umso mehr, als er gegen seine Gewohnheiten auch in der Kneipe nicht gesehen wurde. Am Morgen nach Weihnachten kroch Fero aus dem Misthaufen heraus, wo es ihm unter dem warmen Pferdemist angenehm warm war und wo er eine ruhige Zeit verbrachte und ausschlafen konnte. Seither sorgte man dafür, dass er bei grosser Kälte in der Waschküche übernachtete, wo er heizen konnte. Ihn direkt im Haus zu haben, war damals unvorstellbar und auch den Umständen und seiner Hygiene entsprechend nicht zu verwirklichen. Es gab noch keine Invalidenversicherung und keine Invalidenrente. Bald nach Beginn des Krieges wurde Fero abgeholt. Er kam nie mehr zurück. Man hielt das Versprechen, dass solche lebensuntüchtigen Wesen zu vernichten seien. Niemand erhob dagegen seine Stimme, niemand protestierte. Nur Grossvater machte sich Sorgen, wohin sein Schützling verschwunden sein könnte. Für weitere „lebensunwürdige“ Wesen war klar, was sie erwarten konnten, auch wenn sie sich trösteten, dass es jetzt „nur“ die offensichtlich Schlechteren traf. Ich glaube, in der Slowakei suchte man bisher die verantwortlichen Ärzte nicht, vermutlich Psychiater, die diese Euthanasie durchgeführt hatten.
Nicht weit hinter der dritten Kolonie war eine kleine Zigeunersiedlung. Wenn etwas gestohlen wurde, meinte man, sie würden dahinter stecken; aber im grossen Ganzen lebte man nicht schlecht mit ihnen. Ab und zu kam einer als Schleifer, und die Mutter gab ihm die Messer und Scheren regelmässig zum Schleifen. Im Sommer brachten die Zigeunerfrauen Waldbeeren zum Verkauf. Ihre kleinen Kinder hängten sich derweil an ihre bunten, grell gelben, blauen oder roten Röcke. Zu meinem Bedauern bekamen wir die Beeren wegen des Verdachts mangelnder Sauberkeit der Sammlerinnen nicht zum Essen. Es war eine Art von Almosen, die man ihnen während der waldbeerenfreien Jahreszeit auch sonst gab. Die Mutter wunderte sich immer, wie hübsch die kleinen Zigeunerkinder waren, auch wenn sie unter Armut und schlechter Hygiene aufwuchsen. Ich glaube, es war noch kurz vor den ersten Judentransporten, als die Zigeuner heimlich, ohne dass es die anderen gross bemerkten, entführt und die armseligen Hütten der Siedlung zerstört wurden. Die Diskussionen, ob die Leute, die abtransportiert wurden, wussten, dass sie in den Tod gehen, ist müssig – sie ahnten und fürchteten es genug, auch wenn bei den ersten Transporten die Beweise natürlich noch fehlten.

(4) Drahter (Drotar) unterwegs, ein anderer bei der Arbeit und Glaser (Sklenar). Alle drei Bilder aus dem Buch Sochan von Slivka M. Strelinger A., (Vetter Alino, dem ich für Copyright danke): Sochan war der Fotograf in Martin vor Hornik, dem späteren Arbeitgeber von Bruder Palko.
Ausser den Zigeunern als Schleifer kamen noch Arbeiter von drei weiteren Berufsgattungen regelmässig vorbei. Es gab „Glaser“, die auf dem Rücken in ihren Zainen verschiedene Arten und Grössen von Glas trugen und die Fenster auswechselten oder wenn das Glas nur gespalten war und nicht Haus-, sondern Waschküchen-, Stall- oder Vorratskammerfenster waren, diese zusammenklebten. Sie kamen im Herbst, damit die Kälte im Winter nicht durch die kaputten Fenster drang. Während den wärmeren Jahreszeiten drehten die sog. „Drahter“ ihre Runden, die mit rostfreien Drähten zerbrochene Schalen, Töpfe und Krüge von aussen „zusammenbanden“. Dies war schon vor dem Krieg günstiger als neue zu kaufen. Sie arbeiteten draussen, wanderten von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus, was in den wärmeren Jahreszeiten angenehmer war. Dagegen im Winter, wenn man draussen weniger zu tun hatte, kamen die „Störschneiderinnen“, die nicht nur Kleider flickten, aber je nach Ausbildung, Geschick und Fähigkeit auch Neues für Frauen und Kinder nähten.

Für meinen vorsichtigen, vorausschauenden Vater war das Judentum schon eh und je und mit der Zeit eine immer gefährlichere Angelegenheit, die man durch die Assimilation loswerden sollte. Er hing an keiner Religion fest. Auch meine Onkel, Kommunisten, hatten zum Leidwesen ihres Vaters für Religion, welche auch, kein Verständnis. Mein Vater war unzufrieden, wenn Mutter mich oder die Cousinen Valika und Aliska in dieser für die Juden nicht zugeneigten Zeit in die Synagoge mitnahm. Vater beanstandete auch die getrennten Räume für Männer und Frauen. Für mich war das dunkle, einfache Innere der Synagoge, die Sprache, die ich aus dem täglichen Leben nicht kannte, sonderbar und abstossend. Auch der Gesang war merkwürdig. Ich begriff nicht, und es verstiess gegen meinen Sinn für Gleichheit, dass ich als Kleinkind bei den geliebten Frauen weilen durfte, jedoch mein Bruder Palko bei den Männern bleiben musste, weil er schon nach Bar Mizwa (jüdische, männliche, religiöse Mündigkeit) war. Wahrscheinlich setzte sich Vater noch nicht dagegen durch. Unter den gegebenen Umständen feierten wir sie nur gedämpft. In der Synagoge weinte ich jeweils, weil ich mit allen sein wollte, wie vor und nach dem Gottesdienst. Also nahmen sie mich zu Vaters und meiner Freude nicht mehr mit. Bald wurde die Synagoge sowieso geschlossen. Man sorgte dafür, dass niemand da war, der sie brauchte.

(1) Synagoge mit Friedhof in Martin; Mit Dank aus judaica.cz. Die Quelle des Bildes ohne Schutzwarnung um Copyright angefragt, keine Antwort erhalten.
Ich denke, es war gegen Ende 1942, als schon nur noch wenige Juden in der Slowakei (somit auch in Martin) waren, entschied die slowakische Regierung, dass die Juden, die sich taufen liessen, bleiben könnten. Das bedeutete, sie würden nicht in die Konzentrationslager abtransportiert. Was der Grund für diese barmherzige Entscheidung war, wissen vielleicht inzwischen die Historiker. Setzten sich irgendwelche anständige Leute durch, lohnte es sich nicht, für die wenigen Übriggebliebenen, von denen die Mehrzahl für die Wirtschaft wirklich wichtig und nützlich war, die ganze Maschinerie zu unterhalten oder waren die Konzentrationslager mit den Juden aus anderen Ländern überfüllt? Wie auch, wir hatten Aussicht auf ein ruhigeres, sichereres Leben. Aber für wie lange?

(2) Synagoge in Martin. Nach dem Krieg diente sie als Lager, 1972 abgebrochen. Mit Dank aus judaica.cz. Die Quelle der Fotos ohne Schutzwarnung um Copyright angefragt, keine Antwort erhalten.
Mit der Einstellung meines Vaters zum Judentum und Mutter zweifelte auch nicht darüber, war klar, dass wir uns taufen liessen. Es war auch klar, dass trotz unserer guten, treuen Frau Cunecka, die eine fromme Katholikin war, wir evangelisch würden. Nicht nur waren die Katholiken eher Anhänger des selbständigen slowakischen Staates, der uns so viel Leid brachte, auch war der katholische Pfarrer in Martin der Schwager des damaligen Präsidenten des slowakischen Parlaments, der all den Gesetzen gegen die Juden mit Begeisterung zustimmte. Der evangelische Pfarrer, Herr Bucko, war dagegen ein mutiger, offener Gegner des Regimes, der in seinen Predigten die Übeltaten des Regimes so scharf, wie es damals möglich war, geisselte und verurteilte. Es war für ihn Ehrensache und christliche Pflicht, die Schwachen, ungerecht Verfolgten zu schützen und zu retten. Wir waren an einem Nachmittag bei ihm zum Unterricht über die evangelischen Religionsregeln und -sitten und bald darnach, während eines Abendgottesdienstes, wurden wir noch mit einer anderen jüdischen Familie getauft. Ob es ihnen auch gelang, sich zu retten? So erging es, denke ich, allen noch in Martin lebenden jüdischen Familien, auch der Familie von Onkel Laci. Nur Grossvater konnte man dieses Prozedere nicht zumuten. Ich bin nicht sicher, ob er überhaupt erfuhr, dass seine Kinder und Enkelkinder getauft wurden. Grossmutter war, von dieser Seite betrachtet, zum Glück bereits tot, auch wenn sie uns eher verstanden hätte.

(3) Evangelische Kirche in Martin. Foto: Tochter Corinne.
Mein Vater wollte nicht, dass wir mit Lacis und Strelingers gemeinsam getauft werden. Es schien ihm besser, sicherer, wenn wir nicht demonstrierten, wieviele von unserer Familie noch da waren. Sicher wollte er auch die Nähe zu Laci, zu diesem frechen, gefährlichen Kommunisten, nicht betonen und zur Schau stellen. Solche Vorsicht brachten meinem Vater in der Familie den Ruf eines Feiglings ein, was ihm ziemlich egal war, Hauptsache, er wendete damit die Gefahr von Auschwitz von uns ab und schädigte dazu weder Lacis noch Strelingers. Meine Mutter und Palko mit ihrem Familiensinn konnten dagegen nichts ausrichten. Ich hatte damals noch nichts zu melden; ich durfte höchstens fragen. Prinzipiell war ich immer auf der Seite der Mutter.
Ich wurde ein dankbarer und überzeugter Christ. Religion, als ein Teil des Judentums, war bis dahin für mich nur mit Gefahr und Verfolgung verbunden. Weihnachten mit Baum, Geschenken und gutem Essen, so weit vorhanden, die wir schon immer feierten, waren ohne religiösen Inhalt. Jetzt hatte ich den lieben Gott als eine grosse, mächtige Stütze, der, wenn ich mich anständig verhielt und zu ihm genug ergeben betete, die Gefahr von uns abwenden konnte. Und so betete ich nicht nur jeden Abend „Vater unser“ und andere, auch selbst zusammen erdachte Gebete, aber auch bei jeder nach Ungemach und Gefahr riechenden Situation, die leider genug vorhanden waren. Ausserdem ging ich nun jeden Sonntagvormittag zum Gottesdienst in die Kirche, selten mit Mutter. Vater dachte, es wäre unnatürlich und eine Provokation, wenn ihn die Leute dort sehen würden. Ich denke, Palko ging getrennt mit seinen Freunden. Es war beruhigend und stärkend, sich in dieser grossen, bedeutenden Gemeinschaft und Organisation aufgenommen und zugehörig zu fühlen. Und an beiden, Ruhe und Stärke, mangelte es uns sehr. Jetzt war es zu Beginn, so lange Lacis noch in Martin waren, auch ganz lustig, weil Vetter Jano, der schon damals schnell Verbindungen und Beziehungen zu wichtigen Personen anknüpfen konnte und damit entscheidende Kenntnisse erwarb, nahm mich sowohl vor wie auch am Ende des Gottesdienstes zum Läuten mit. Die grösseren Knaben hängten sich an die dicken Seile der grossen Glocken und flogen hin und her sowie zogen an den kleineren. Der Grösste, Erfahrenste dirigierte die Reihenfolge, was eine Kunst war, weil in Martin keine dissonanten Melodien entstehen durften, wie sie in Italien und in der Südschweiz beliebt sind. Nur stärkere Knaben hielten die ganze Zeit durch. Andere machten Pausen und wechselten sich ab. Manchmal durfte ich mit Jano kurz fliegen. Sie versuchten, mir die Bedienung der kleinsten Glocke alleine anzuvertrauen, aber zu meiner Schande schaffte ich nicht einmal das. Ich war noch zu klein und zu schwach. Als Lacis nach Hrachovo gehen mussten, gelang es mir nicht, die Beziehung zu den Glöcknern aufrecht zu erhalten. Ich wollte mich nicht immer wieder blamieren und der einfühlsame Beschützer Jano fehlte mir nicht nur dabei. Die Gottesdienste wurden eine ernste Angelegenheit mit Beten, Gesang und interessanten, inhaltsvollen Predigten von Herrn Pfarrer Bucko, über die nicht nur wir, sondern auch „ganz Martin“ diskutierte. Nach der Unterdrückung des slowakischen Aufstandes wurde Pfarrer Bucko, als dessen Anhänger und aktiver Befürworter nach Mauthausen verfrachtet, wo auch mein Grossvater endete.
(4) Gedenktafel für Pfarrer Bucko auf dem Kirchengemeidehaus. Foto: Tochter Corinne.
Pfarrer Bucko starb noch vor ihm an Unterernährung und einer Infektion. Wir, seine dankbaren Schützlinge, überlebten. Am Kirchgemeindehaus neben der Kirche, wo Pfarrer Bucko wohnte und wohin ich in die Sonntagsschule ging, ist eine ihm gewidmete Gedenktafel angebracht. Herr Batel, sein Organist, war später mein Lehrer. Auch wegen des Schicksals seines Pfarrers wurde er nach dem Krieg Kommunist. In seiner gutmütigen Naivität konnte er sich nicht vorstellen, was für eine Einstellung zur Religion die primitiven Kommunisten nehmen würden, die später an die Macht kamen. Eine gewisse Zeit waren sie mit Onkel Laci ein Herz und eine Seele und versuchten die Schicksale von Martin nach ihren Vorstellungen zu lenken, was selbstverständlich nicht gelingen konnte. Aus verschiedenen Gründen zerfiel diese Freundschaft.
Ich blieb ein gläubiger Christ, auch wenn ich, bedingt durch bessere Umstände, immer weniger betete. Noch beim Konfirmationsunterricht, bereits in Bratislava, war ich einer der besten Schüler. Pfarrer Cibulka, der uns für die Konfirmation vorbereitete, meinte, auch wenn er über meine jüdischen Wurzeln wusste, ich würde ein guter Pfarrer werden. Es blieb einer meiner grösseren Gewissensbisse, als er erfuhr, wie ich in den folgenden Jahren immer mehr von der Religion abfiel. Ich hoffe, er verzieh mir inzwischen und ich kann ihn oben, im Himmel, wo ich trotz meiner vielen Sünden gelangen werde, ruhig treffen. Mein Vater weigerte sich, in den sozialistischen Zeiten, als es üblich und vorteilhaft war, aus der Kirche auszutreten. Er meinte, die Treue seien wir ihr in ihren schweren Zeiten schuldig, was ihn aber nicht hinderte, nach der Emigration mehrmals je nach Bedarf zwischen dem Christen- und Judentum zu pendeln. Offensichtlich meinte er, beide seien in Deutschland nicht bedroht und nicht auf seine Unterstützung angewiesen, eher umgekehrt, er von ihnen beiden. Er starb trotzdem ruhig, ohne Angst vor einer Strafe des einen oder des anderen Gottes für seine Untreue. Ich halte mich an seine ursprüngliche Einstellung und bin immer noch ein Kirchensteuer zahlender Mensch. Meine Frau Silvia, die eigentlich schon durch Heirat mit ihrem ersten Mann Urs, einem Protestanten, aus der katholischen Kirche ausgeschlossen wurde, hält es mit mir. (Siehe auch Kapitel 20. Nach dem Krieg ein neues Leben - Nomen est omen, patria est ... und meine Identität)

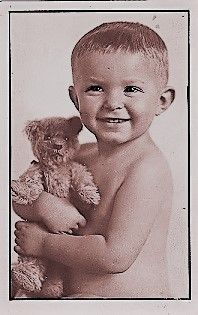
(1) Palko.
Während der grossen Deportationen im Jahre 1942 war Palko noch nicht sechzehnjährig. Dadurch musste er nicht zwangsläufig als erster mit seinen nur um ein paar Monate älteren Altersgenossen als gute Arbeitskraft im Konzentrationslager landen und mehr oder weniger später in der Gaskammer enden. Er konnte in der Obhut der Familie bleiben und mit ihr das Schicksal teilen.

(2) Palko als Teenager.
Er war ein ausgezeichneter, vielseitig talentierter Schüler und begann selbstverständlich sein Studium im Gymnasium. Nach zwei oder drei Jahren musste er wegen der Nürnberger Gesetze, die vom slowakischen Staat dankbar übernommen wurden, das Gymnasium verlassen und eine Lehre beginnen. Aber was für eine? Eine Lehrstelle zu suchen war nicht leicht. Jemand musste ihn als Juden überhaupt einstellen wollen. Nebst der Abneigung gegen Juden oder umgekehrt aus Angst als Judenfreund zu gelten, spielte auch ein Risiko eine Rolle. Die Familie könnte doch abtransportiert werden und die Mühe mit seiner Ausbildung wäre umsonst gewesen. Trotz der misslichen Situation sollte Palko wenn möglich einen Beruf erlernen, der ihm Spass machte, seinen Neigungen und Fähigkeiten entsprach und das Studium einigermassen ersetzen würde.

(3) Palko als angehender Mann.
Nach gründlichen, aber nicht langen Überlegungen, dafür war die Lage nicht geeignet, fiel die Wahl auf den einzigen Fotografen in der Stadt, bei dem, wie es sich in „besseren Kreisen“ gehörte, unsere Familie schon immer mindestens einmal pro Jahr für das obligate Familienfoto erschien. Er war zwar Mitglied der Hlinkova garda, die für die Transporte der Juden verantwortlich war, aber nicht aus Überzeugung, sondern als Mitläufer, um sich zu schützen, da seine Frau Tschechin war. Schon das war damals nicht ganz in Ordnung. Er war schwerhörig. Wegen dieser Schwächen und Nachteile war er vielleicht empfänglicher für die Lage und Belange der Verfolgten. Auf der anderen Seite konnte es ihm den Mut nehmen, einem Juden entgegenzukommen und ihn einzustellen. Er gewährte Vater einen Termin, was schon als ein gutes Zeichen gewertet wurde. Als er und Palko bei ihm erschienen und er ihr Anliegen hörte, erbat er sich drei Tage Zeit zum Überlegen. Es waren angespannte, schwierige drei Tage. Es war klar, dass er so eine fähige Arbeitskraft unter normalen Umständen nicht bekäme. Er würde auch keinen Konkurrenten züchten. Entweder können wir uns retten, die Deutschen werden besiegt, Palko wird studieren und ergreift später einen anderen Beruf, oder wir kommen um. Der Fotograf hatte zugesagt, auch wenn er ihn nicht unbedingt brauchte. Es war ein Lichtblick in diesen schwierigen, drückenden, gefährlichen, dunklen Zeiten. Mit Freude und Begeisterung trat Palko die Stelle an; die Freude wurde aber bald getrübt. Im Fotoatelier arbeitete noch ein älterer Lehrling. Dieser war weniger fähig und etwas faul und wie auch im Militär üblich, meinte er, den Jüngeren plagen zu müssen und so zu seiner Ausbildung beizutragen, was ihm umso berechtigter schien und leichter vorkam, als dieser ein Jude war. Ausserdem befürchtete er Palkos Konkurrenz. Er mischte im Geheimen etwas in die Entwickler- und Fixierlösungen, was die Fotos verdarb, schob die Schuld dafür Palko zu und trieb ähnliche Streiche. Vater sprach darüber mit dem Chef, der aber keine Lust zeigte, etwas dagegen zu unternehmen. Die Wende kam erst mit dem Sieg der Roten Armee bei Stalingrad. Palkos Kollege wurde zahmer und liess von seinen Sticheleien weitgehend ab. Inzwischen wurde Palkos Arbeit anerkannt und geschätzt. Er durfte den Chef bei den Aufnahmen im Theater vertreten. Ins Städtchen, das das protestantische Zentrum des Widerstandes gegen das klerikal-katholische, faschistische Regime war, zog neu der beste Teil der Theaterleute aus der Hauptstadt Bratislava. Sie waren mit dem Spielplan dort unzufrieden. Selbstverständlich durften die Fotos nicht unter Palkos Namen veröffentlicht werden. Damit war Palko voll in seinem Element, weil er schon immer nicht nur viel las, sondern auch selbst dichtete. Seine Gedichte wurden unter einem Pseudonym, leider konnten wir uns nicht erinnern unter welchem, in den zwei slowakischen kulturellen Zeitschriften Elan und Tvorba (Schöpfung) veröffentlicht, die er trotz gebotener Sparsamkeit abonnierte. Palko war auch mit dem etwas älteren angehenden slowakischen Schriftsteller Peter Karvas befreundet, der ein Halbjude war und den er beim Skifahren kennen lernte. Dieser machte ein Foto von Palko, das wir noch haben. Die grosse Mehrheit der Kulturschaffenden war gegen Faschismus und den herrschenden Staat und sehnte sich nach der Vorkriegstschechoslowakei mit der viel grösseren, bunteren, lebendigeren, besser verflochtenen und aufgeschlosseneren Kulturöffentlichkeit. Elan und Tvorba veröffentlichten Übersetzungen der von Faschisten aus guten Gründen verpönten Surrealisten und ihren Vorgängern Baudelaire und Rimbaud, wie auch Verlaine und Rilke. Petöfi war auch einer von Palkos Lieblingsdichtern. Er übersetzte manche seiner Gedichte, vielleicht auch das Gedicht, mindestens rezitierte er es oft: „Ich sterbe nicht im Bett“, was sowohl Petöfi wie Palko auf ähnliche Weise gelang.
„Ein Angsttraum quält mich...
Ein Angsttraum quält mich: Sterben müssen
in dumpfer Stube, in den Kissen;
verwelken elend, schmerzgeplagt,
der Blume gleich, vom Wurm zernagt;
langsam verlöschen wie der Kerze Schimmer,
die man vergaß in dem verlaßnen Zimmer.
Nicht solchen Tod, der mir zum Spott,
nicht solchen Tod gib mir, mein Gott!
Möcht sterben wie ein Baum, umwettert,
vom Sturm gefällt, vom Blitz zerschmettert,
möcht fallen wie der Fels einmal,
vom Donnerschlag gestürzt ins Tal...
Wenn die versklavten Völker sich ermannen,
des Joches müde, gegen die Tyrannen
mit roten Fahnen zornig ziehn ins Feld
und ihre Losung gellt:
"Freiheit der Welt!",
wenn diesen Ruf ich wie Posaunenchöre
machtvoll in Ost und West erschallen höre -
dann will ich fallen im Kampf,
stürmend durch Feuer und Dampf!
Möge mein Herzblut verrinnen,
glücklich scheid ich von hinnen!
Sollt sich ein Todesschrei mir noch entringen,
mag im Kanonengedröhn er verklingen,
verwehn mit dem Pfeifen von schwirrendem Stahl,
mit unseres Sieges Trompetensignal!
Der Hufschlag der Pferde
stampf ein in die Erde,
was von mir noch blieb, wenn nur siegreich die Schlacht,
die frei von Tyrannen uns endgültig macht!...
Wenn glorreich dann der Morgen angebrochen,
dann sammelt ein die Splitter meiner Knochen
und kommt, mit feierlichen Trauerchören,
mit schwarz beflorten Fahnen, uns zu ehren,
gemeinsam all die Helden zu begraben,
die für die Weltfreiheit ihr Leben gaben.
Aus Schätze der Ungarischen Dichtkunst, Band V: Sándor Pet%u0151fi: Gedichte. Auswahl. DIE DEUTSCHEN NACHDICHTUNGEN SIND VON MARTIN REMANÉ. mek.oszk.hu/01000/01008/01008.htm#13

(4) Haus vom damaligen Fotoatelier Hornik 2007 (links). Foto:Tochter Corinne.
Bei den Theateraufnahmen befreundete sich Palko mit einer etwas älteren Schauspielerin, die aus einer Arbeiterfamilie stammte, was den Eltern nicht ganz passte, die Beziehung aber tolerierten. Sie war nie bei uns. Auf dem Programm des Theaters war auch Rostands Cyrano de Bergerac. Nicht nur die grosse Nase aber auch andere Begebenheiten und Situationen dieser Tragikomödie erinnerten an die gegenwärtige Situation. Die Vorstellungen wurden auch als Protest gegen die regierenden Faschisten aufgefasst und hatten einen Riesenerfolg. Palko rezitierte Teile aus diesem Stück, die ihm am besten gefielen.
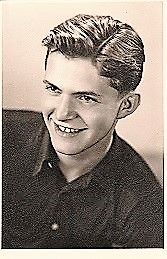

Während des Krieges erlebte ich zwei sorglose, von Glück und Zufriedenheit strahlende, besondere Ausnahmeereignisse. Beide haben einen Zusammenhang mit unserer Waschfrau, Frau Cunecka, genau, offiziell richtig, Frau Cunekova. Einmal in der Woche, am Dienstag, kam sie für die kleine Wäsche, die aus Hemden, Blusen, Unterwäsche, Socken und ähnlichen Sachen bestand und einmal im Monat für die grosse Wäsche auch mit Tüchern und Bettwäsche. Die Waschküche war im Hof mit einem Kessel, in dem man die Wäsche kochte. Man heizte darunter mit Holz und Kohle, wie unter dem Boiler im Badezimmer. Damit sie schnell trocknete, wurde die Wäsche jeweils gründlich mit den Händen ausgewrungen. Für die Bettwäsche und die grossen Tischtücher brauchte man zwei stärkere Menschen als ich war. Wir badeten am Samstag, damit wir für die frische Wäsche und die Sonntagskleider sauber waren. Sofern ich in dem einwöchigen Abstand im Sommer zu schmutzig war, steckten sie mich inzwischen in einen verzinkten Trog, den man auch für die Wäsche benützte. Das warme Wasser aus dem Boiler führte nur in die Badewanne und reichte für zwei Bäder. Wie auch mein Vater sonst peinlich sauber war, für ein Bad fand er nur selten Zeit. Dafür wusch er sich gründlich und lange jeden Morgen von Kopf bis Fuss mit kaltem Wasser, wie er es vom Ersten Weltkrieg und der Gefangenschaft gewohnt war. Somit durfte Mutter das Badewasser für sich alleine beanspruchen und ich, als ein Schmutzfink, ging in der dritte Runde erst nach Palko in die Badewanne. Es gab keine Dusche, stattdessen übergossen wir uns mit dem Wasser aus einer Kanne.
Wie ich bereits erwähnte, wohnten die Cuneks mit drei Kindern im Teenageralter in einer Einzimmerwohnung ohne Badezimmer gleich zu Beginn der ersten Kolonie, direkt gegenüber dem Eingang in die Zellulosefabrik. Als WC mussten sie das Plumpsklo im Hof benützen. Begreiflicherweise waren unter solchen Umständen nicht nur bei ihnen die Nachttöpfe Objekte des täglichen, beziehungsweise nächtlichen Bedarfes. Dies erklärte auch, warum im fortgeschrittenen Alter weder meinem Vater noch mir in den Sinn kam, mehrmals pro Nacht aufzustehen, um aufs WC zu torkeln. Ich benütze ein grosses Einmachglas, das man mit einem Schraubdeckel auch im Halbschlaf gut öffnen und verschliessen kann. Ich benütze den Fortschritt, der im Bereich des Einmachens herrscht, auch für ein angenehmes, bequemes Urinieren. Auf Reisen nehme ich dafür ein leichtes Plastikgefäss mit, das ich auf dem Hinweg mit sauberen und zurück mit schmutzigen Socken fülle. Wegen der übertriebenen Sauberkeit meiner Frau Silvia müssen sie, wie auch das Gefäss, sowohl hin wie zurück in Plastiksäcken stecken. Damit verzichte ich nicht auf einen der wenigen Vorteile, die wir Männer haben. Ich hoffe, diese vernünftige, praktische, nützliche Einstellung sowie das Vorgehen bleibt unsere familiäre Tradition. Wie viele unnötige verschiedene Knochenbrüche könnte man damit, mindestens bei alten Männern, vermeiden. Meinen Patienten versuchte ich es beizubringen. Aus mir unbekannten und unbegreiflichen Gründen nicht bei allen mit Erfolg.
Herr Cunek war in der Zellulosefabrik der Mensch für die schwersten Arbeiten. Zu seinen Aufgaben gehörte auch das Reinigen der Kessel von den an deren Wänden klebenden Chemikalien, was man damals ohne jeglichen Schutz tat. Wenn diese schon wesentlich verdünnt aus dem Fabrikkamin in die Luft strömten, so dass es manchmal bei ungünstigem Wind in ganz Martin stank, war er diesen Chemikalien direkt ausgesetzt. Ob er sich diese Belastung erleichtern wollte oder aus schlechter Gewohnheit, trank er, später sicher süchtig, wie ein Regenbogen (Duha) wie die Slowaken sagen. Ich denke, er rauchte noch dazu. Frau Cunecka erreichte sogar mit der Zeit, dass sein Gehalt wöchentlich, wie damals bei den Arbeitern üblich, statt ihm, direkt ihr ausbezahlt wurde. Dies half jedoch nicht wesentlich, da er immer ihre Verstecke fand, wo sie das Geld aufbewahrt hatte, was in der kleinen Wohnung weder viel Phantasie noch Mühe brauchte. Manchmal, wenn die grösste Not herrschte, da er den letzten Heller vertrank, liess sie das Geld bei uns. Dann kam sie nicht nur an den Waschtagen zu uns, sondern fast täglich, wie ein Familienmitglied. Sie war eine sehr anständige, fleissige, geschickte und sehr religiöse Person, wie es sich für die Frau eines Alkoholikers gehörte. Mindestens einmal pro Tag weilte sie in der Kirche, entweder während der Messe oder nur einfach zum Beten. Meistens beides. Wie es schon im Leben nicht selten so geht, auch wenn er während Jahrzehnten giftige Gase einatmete, konnte er die Rente bis er über neunzig war ohne ihre Vorwürfe und Beschränkungen durchtrinken und durchrauchen, weil sie noch vor ihrem sechzigsten Geburtstag an Darmkrebs gestorben war. Offensichtlich betete sie gut für ihn und auch für uns – wir kamen gottlob nicht dazu, ein gewisses Gas in Polen einzuatmen und überlebten. Meine Eltern auch bis neunzig.
Die Wohnung der Cuneks gleich am Anfang der Kolonie hatte den grossen Vorteil, dass dazu auch ein kleines Stück Land gehörte, auf dem sie Hühner hielten, (wie alle Einwohner) dazu auch noch Platz für einen kleinen Stall mit einem Schwein hatten. Nebst der Arbeit mit unserer Wäsche züchtete Frau Cunecka Kartoffeln auf einem kleinen geerbten Feldstück, sodass sowohl ihre Schweine wie auch wir während des Krieges jeweils für ein paar Monate mit diesem wichtigen Nahrungsmittel versorgt waren. Kartoffeln konnte man damals nicht das ganze Jahr lagern. Daher war dies auch eine weitere willkommene Gelegenheit, das karge Gehalt von Herrn Cunek, noch durch seine Sucht vermindert, aufzubessern. Und so sammelten auch wir unsere Speiseabfälle in einem Gefäss der einzigen und einheitlichen Marmelade, die erhältlich war. Es hatte auch den Vorteil, dass man es leicht verschliessen konnte. Zu dieser Zeit war es uns nicht mehr möglich, eigene Konfitüre herzustellen, da man gegen Marken nur wenig Zucker bekam. Mit dem fortschreitenden Krieg gab es auch nicht genug Metall für solche Zwecke, und so kam die Marmelade aus Prievidza, damaliges Zentrum des slowakischen Obstparadieses, in kleinen Kisten aus Holz verpackt. Alles war damals nützlich und wertvoll. Das Holz der Kistchen wurde verheizt. Diese Marmelade mit einer merkwürdigen, eher abstossenden rot-braunen Farbe rottete meine nicht allzu grosse Liebe für Konfitüre fast ganz aus. Während ihrer Zubereitung bedauerte ich, dass ich aus den frischen Erdbeeren, Himbeeren, Aprikosen, Johannisbeeren, Äpfeln und Birnen nur die missratenen und zerquetschten essen durfte, was mir nicht reichte, und ich verstand nicht, dass man das Obst mit den verschiedensten feinen Geschmäckern vernichtete und in diese allzu süsse, nicht sehr unterschiedlich schmeckende, klebrige Masse umwandelte. Noch weniger verstehe ich es heutzutage, da man während des ganzen Jahres frisches Obst erhalten kann. Folgerichtig esse ich nur wenn ich muss das klassische Schweizer Frühstück – Kaffee und Butterbrot mit Konfi. Jeden dritten bis vierten Tag kam Frau Cunecka, um das Gefäss abzuholen. Hatten wir mehr Abfälle, brachte ich es ihnen inzwischen. Kam ich in einer Zeit, wenn es der Sau erlaubt war, wieder zu fressen, weil auch sie, wie wir, feste Zeiten dazu hatte, schaute ich zu, wie Frau Cunecka den Inhalt des Topfes in den Trog umkippte und das Schwein es mit Dankbarkeit und Wonne grunzend komplett ausfrass. Frau Cunecka wusch den Topf gut aus, und ich kehrte zwar nicht grunzend aber fast so zufrieden wie die Sau nach Hause zurück, weil wir ihr offensichtlich so gutgetan hatten und es ihr so „wohlete“. Auch sonst spielte ich ab und zu mit den Kindern aus der Kolonie und verfolgte dabei mit Freude und Genugtuung, wie das Schwein wuchs und gedieh. Ich denke, es war im Winter 1942/1943, vielleicht auch erst ein Jahr später, als man entschied, ich sei genug gross, an der Metzgete teilzunehmen. Wahrscheinlich war es noch im 42/43, da ich mir nicht vorstellen kann, dass ich deswegen in der Schule fehlen durfte, und an Sonntagen durfte man so etwas nicht machen, besonders nicht bei Cuneks. So verfolgte ich mit besonderer Spannung die Berichte von Frau Cunecka, wie das Schwein an Gewicht zunahm. Wenn sich sein Wachstum verlangsamte, verabredeten sie mit dem Störmetzger und anderen Helfern den Termin der „Metzgete“, weil es keinen Sinn machte, ein Schwein zu mästen, das nicht mehr an Gewicht zulegte.
Am erwartungsvollen erinnerungswürdigen Tag war ich bereits am frühen Morgen noch während der Dunkelheit bei Cuneks. Bald kam auch der Metzger und die anderen Teilnehmer der Metzgete. Dem sonst ruhigen, freundlichen, sorglosen, man kann sagen glücklichen Schwein gefiel diese Aktivität offensichtlich nicht, noch dazu zu dieser ungewöhnlichen Zeit. Das Ganze schien verdächtig. Es begann laut zu quietschen und bewegte sich nervös hin und her, sodass ihm der Metzger nicht gut den tödlichen Stoss mit dem langen Messer zufügen konnte. Es gelang ihm sogar aus dem Käfig in den Hof zu entweichen und dort blutend herumzulaufen. Nur mit Mühe war es ihnen möglich, der Sau den Weg auf die Strasse in die vorübergehende Freiheit, zu versperren. Das war zu viel für meine zarten, durch Kriegsereignisse, Verschwinden und Verluste von nahen Menschen strapazierten, geschwächten Nerven. Ich begann zu weinen und zu schreien. Ich musste in die Wohnung, aber zum Glück nicht nach Hause, wo mich dann die Tochter von Cuneks tröstete und beruhigte. Ich wurde mehr Last als Hilfe. Inzwischen holte jemand eine Flinte und erschoss das wild gewordene Schwein. Bei diesem Aufstand verlor es überall Blut, nur nicht in die dafür vorbereitete Schale, wie es die Gewohnheit und in gewissem Masse auch Pflicht der braven Schweine ist, mit der Folge, dass wir nicht genug Blut für die Blutwürste hatten.
Das endlich mühsam getötete Schwein warfen sie in einen grossen Zinktrog, in dem sie sonst badeten und Wäsche wuschen. Sie begossen es zuerst von der einen, dann von der anderen Seite mit dem schon lange vorbereiteten heissen Wasser, das man auch beim Nachbarn kochte, da für zwei grosse Töpfe Wasser, die man dazu benötigte, auf einem Sparherd nicht genug Platz war. Aus der verbrühten Haut konnte man die Borsten mit den harten Bürsten leichter entfernen. Noch immer bedauerte ich es, aber schon etwas weniger. Das so schön glatt rasierte Schwein hing man zuerst mit einem Haken auf die an die Mauer schräg gestellte Türe, weil in der Wohnung dafür keine andere Möglichkeit vorhanden war. Die Türe nahm man aus den Angeln, da sie das Gewicht des gut gemästeten Schweins nicht getragen hätte. Der Metzger zerkleinerte das Schwein vorsichtig schrittweise von oben nach unten, wobei er, wie beim Wild, die Kugel suchte, den Einschusskanal reinigte, sorgfältig die Innereien rausnahm und dann den Kopf abschnitt. Ausser den Därmen brauchte man alles. Der Magen wurde gründlich gereinigt und später mit der dafür vorbereiteten Mischung gefüllt. So entstand die Presswurst. Die Schweinedärme sind zu fein für Würste und so ging jemand schnell zum Schlachthof, um frische Rinderdärme zu holen, was man im Voraus verabreden musste. Die ganze Metzgete verlangte eine gute Organisation und Zusammenarbeit, einen ziemlichen logistischen Aufwand, wie man heute so schön sagen würde. Es war nicht nur körperlich, sondern auch geistig eine schwere Arbeit – alles hatte wie am Schnürchen zu laufen. Die zwar schon leeren Därme musste man wegen des Gestanks zuerst draussen im Hof gut reinigen, dann etwas, aber nicht zu viel kochen, damit sie zwar nicht mehr roh waren, aber auch nicht so schwach, dass sie vom Druck der Füllung platzen würden.
Mit der Zeit bekamen wir Hunger, und da nicht nur Därme, aber auch Lempen gekocht wurden, servierte man sie uns fein geschnitten auf einem Brett. Dazu Salz, Paprika, Pfeffer, Zwiebeln und selbstverständlich Vollkornbrot. Wer wollte, bekam auch ein Stamperl Sliwowitz dazu. Gekochte Schweinehalslappen sind immer gut, aber so frisch, noch warm, mit diesen Beilagen und unter diesen Gegebenheiten waren sie ein Traum. Ich half die dicke Schweinehaut in kleine Stücke zu schneiden, die wir in Pfannen warfen und diese auf den Sparherd stellten. Dort wurde auf kleinem Feuer das Fett ausgebraten und übrig blieben feine, braune, knusprige Grammeln, die wir wieder mit Brot, Salz und Zwiebeln kosten durften. Der Meister Metzger mit den etwas erfahreneren Helfern als ich es war, sortierte und verarbeitete das Fleisch. Der kleinste Teil wurde ohne Verarbeitung zum Essen bestimmt, der grössere blieb unverändert oder wurde in Würsten geräuchert. Aus dem Minderwertigen und den Innereien entstanden Leberwürste, Schwartenmagen sowie die Sülze. In die Presswurst, Blut-, Leber- und andere Würste gehörten verschiedene Gewürze, auch Knoblauch und in die Leberwürste Buchweizen, der ihnen etwas Körniges verlieh und wie erwünscht auch ihren Inhalt und damit ihre Menge erhöhte, wie die klein geschnittenen Semmeln in den Blutwürsten. Zwanzig Jahre später, inzwischen wohnten wir nicht mehr in Martin, beim Skifahren in Donovaly ass eine Familie neben uns. Ich roch den einzigartigen, unverwechselbaren Geruch der Würste aus Martin, die ich schon Jahre nicht mehr im Mund hatte (Frau Cunecka war schon tot und niemand anderer schickte sie uns). So fragte ich sie, ob sie mir etwas von ihrer Wurst geben könnten. Ich würde ihnen dafür das ganze Abendessen bezahlen. Sie hatten nur noch ein nicht angefangenes Stück und wollten dafür nur Torte und Sirup für ihre Kinder, was ich gerne bezahlte. Weder Coca-Cola noch andere Soft- und Energy-Drinks waren damals bei uns erhältlich. Ich wagte nicht zu sagen, dass ich auch das angefangene Stück gern genommen hätte. Der Geschmack der Wurst entsprach ganz ihrem Geruch. Nach weiteren vierzig Jahren war ich mit meiner Tochter Corinne in Martin. Wir besuchten auch meinen ehemaligen Kollegen Vilo Mezes, der dort viele Jahre Dekan der medizinischen Fakultät war. Die Wände waren voll von Wildschwein-, Reh-, Hirschköpfen und -Fellen, sogar ein Bär hing dort, die er alle selbst erlegt hatte. Corinne war etwas verstimmt und erschrocken. Aber nach einer Weile boten sie uns verschiedene vortreffliche Speisen an, unter ihnen auch Wurst, die er selbst zubereitet hatte. Sie war genau gleich wie die bei Cuneks. Als Corinne sie probierte, verliessen sie alle Vorbehalte und Bedenken, wie mich damals bei der Metzgete, als sich das arme lebendige Schwein in die verschiedenen Köstlichkeiten umwandelte. Als wir nach Hause kamen, wollte sie das Rezept haben. Vilo schickte es mir, sodass um den Bestand der Würste aus Martin in unserer Familie gesorgt ist. Hoffentlich kommen wir noch während meines Lebens dazu, es in wirkliche, real existierende Würste umzuwandeln.
Aus dem Schnörrli, den Wädli, einem Teil des Kopfes und sogar den oberen Teilen der Füsse kochte man die Sülze, die man dann gut bedeckt und von Steinen beschwert draussen kühlen liess, damit Hunde und Katzen sich nicht statt der Menschen an ihr laben konnten. So wie die Juden wissen, wie man die letzte Zelle aus einer Gans oder einer Ente verwenden kann, so können es die Christen mit den Schweinen. Eigentlich nur damals, denn in unserer verwöhnten Überflussgesellschaft sind ja nur die sogenannt besten Fleischstücke gut genug und nach den anderen Delikatessen wird nicht mehr gefragt, auch weil ihre Zubereitung Zeit und Mühe kostet. Wir schauen lieber Fernsehen. Wisst ihr wie schrecklich geschmacklos und abstossend die Presswurst der Migros ist?
Zunge, Schinken, Rippli und Würste musste man räuchern. Nach mehreren Jahren durften Cuneks gleich neben dem Stall auch eine Räucherstube bauen. Dadurch konnten sie metzgen, wann sie wollten, sie mussten für die Räucherei nicht zusätzlich bezahlen, sogar andere konnten es bei ihnen tun, wofür die Cuneks noch etwas verdienten. Die Räucherstube war ein schmaler, nicht zu hoher Turm aus Holz mit einer kleinen Öffnung nach oben, durch die der Rauch entweichen konnte. Zum Räuchern war nicht jedes Holz geeignet. Es durfte eigentlich nicht brennen, nur lodern. Das Holz und die Äste gaben dem geräucherten Fleisch einen speziellen Rauchgeschmack. Fleisch zu räuchern war eine ähnlich schwierige Tätigkeit wie Holz in Kohle umzuwandeln, was die Köhler damals machten. Deswegen gibt es so viele Familiennahmen „Köhler“. Die Hütten befanden sich in den Bergtälern nicht nur wegen der Erz-, sondern auch der Holzvorkommen. Manchmal versagte jedoch diese Kunst und in der Räucherstube blieb statt Schinken und Würste nur Feuersbrunst und Asche. Daher war es nicht erlaubt, sie in der Nähe der Häuser aufzustellen. Im Simmental hatte ich einen Patienten, der die „Grubenwalder Chämiwurst“ räucherte. Manchmal musste ich ihn besuchen. Als Zeichen der Zufriedenheit holte er mir ein Paar der Würste aus seiner Räucherstube. Diese befand sich direkt im Haus. Die Zeiten ändern sich, oder die Schweizer können brandsicherere bauen. Niemand kam bisher auf die Idee, ausser Käse und Uhren auch Räucherstuben zu exportieren. Die Grubenwalder Chämiwürste waren zwar gut geräuchert, aber ihren Geschmack konnte man mit denen aus Martin nicht vergleichen.
Etwas verspätet assen wir mittags Krautsuppe, in der das fettigere Fleisch, trockene Pilze und die frischen Würste gekocht wurden. Eine Krautsuppe ist immer gut, aber die von der Metzgete ist neben den frischen Lempen ein weiterer Leckerbissen. Man sah die Fettaugen auf ihrer Oberfläche schwimmen, da wir in Martin ihren Geschmack nicht durch Rahm, sondern durch Kartoffelstock milderten, auch damit wir das wertvollere Brot sparen konnten, das damals, wenn ich mich gut erinnere, wie Zucker rationiert war. Der Vorteil des Kartoffelstocks war auch, dass jeder sich nach seinem Gusto die Suppe verdicken konnte. Silvia kann eine ausgezeichnete Krautsuppe kochen, was neben ihren slowakischen Mohn- und Nusskuchen eine, aber nicht die einzige Tragsäule unserer Ehe ist. Sie war bereit und fähig, es von meiner Mutter, ihrer Schwiegermutter zu lernen. Chapeau! Ich hoffe, so wie sich in der Familie die Tradition der Nachttöpfe bei dem männlichen Geschlecht erhalten wird, so diejenige der Krautsuppe und der Mohn- und Nussbeugel bei dem weiblichen, wobei ich nichts dagegen habe, wenn es auf das gegenseitige überspringt. Diesbezüglich kann ich als Beispiel dienen, weil ich wieder zu kochen und backen beginne, vorläufig noch einfachere Speisen als Krautsuppe, Mohn- und Nussbeugel.
Gegen vier Uhr nachmittags begann man mit dem Aufräumen, wozu sie mich nicht brauchten. Damals gab es noch keine Plastiksäcke. So begab ich mich mit einer Tasche voll von Würsten, einem Topf mit Krautsuppe und einem mit Sülze nach Hause, stolz auf meine Leistung und meinen Verdienst. Wir sind mit diesen Gaben vorsichtiger umgegangen als der „Hans im Glück“ und genossen sie lange bis zum letzten Bissen und Schluck.
Unsere Speiseabfälle verwandelten sich in Köstlichkeiten. Es interessierte mich, wie so ein Wunder geschah. Vielleicht auch deswegen wurde aus mir später ein Biochemiker. Aber auch sonst drang mir die Metzgete tief in den Körper, die Seele und das Gedächtnis, nicht nur wegen der Grammeln, der Krautsuppe, der Sülze und der Würste. Das grenzenlose, wenn auch kurze Vorhandensein der Nahrungsmittel - noch dazu des Fleisches - wie auch die entspannte, sorglose Stimmung, die dabei herrschte und die gute Zusammenarbeit – alles lief wie geschmiert – es war für mich ungewöhnlich, sonderbar. Ich war gewohnt, dass Vater dauernd mühsam darauf achten musste, damit alles gut klappte, die Pferde genug zu fressen hatten, die Angestellten ihre Arbeit gut verrichteten. Einerseits waren sie mit dem Gehalt fast immer unzufrieden, anderseits benötigte und verbrauchte der Arizator viel Geld für sein Kartenspiel und ähnliche Zwecke. Darüber berichte ich jedoch an einer anderen Stelle (Kapitel 6: Unser Betrieb). Bei Cuneks konnte ich aber ein paar Stunden ohne Probleme, Spannungen, Belastungen, Gefahr, Krieg und Angst verbringen. Die ganze Zeit beschäftigten wir uns nur mit dem Essen und seiner Zubereitung. Es war so animalisch wie das Leben mit Kleinkindern. Damals kannten wir keine Ferien, und ich war noch nie so lange alleine weg von zu Hause, noch dazu in der Welt der Christen: Eine schöne, glückliche Welt! Wie gerne hätte ich dazu gehört. Das arme Schwein verschwand aus meinem Gedächtnis. Wie man sieht, war es auch eine gute Übung in der Beherrschung der Gefühle. Deren Übermass war in den damaligen schwierigen Zeiten oft gefährlich, wie auch Beispiele unserer Familie zeigen, da es zu Zweifeln, Verzweifeln und Zögern führt: Soll ich, soll ich nicht, was ist richtig? Aber je bedrohlicher die Umstände, die Situationen sind, desto wichtiger ist eine schnelle und richtige Entscheidung. Leider, half es nicht immer, auch nicht unserem Schwein. Die Metzgete war für mich also auch eine emotionale Erziehung. Eine erfolgreiche, wie man nicht aus meinem Urin, aber aus den Umständen meines nächtlichen Urinierens sieht.
So eine gute Metzgete wie damals bei Cuneks in Martin gibt es ganz sicher nirgendwo mehr, aber wo auch, und welche auch, ich habe die Metzgete sehr gern. Wundert es Euch?

Das zweite schöne, sorglose Ereignis während des Krieges, wieder ein Lichtblick, war die Hochzeit von Viera. Sie war das mittlere Kind von Cuneks. Ein, zwei Jahre vor ihr wurde Jan, oder Janko, und ein bis zwei Jahre nach ihr Rudolf oder Rudo geboren. Jan war eher ein ernsthafter Mensch, machte problemlos eine Elektrikerlehre und trank, im Unterschied zu seinem Vater, fast nichts. Rudo ging eher in den Stapfen des Vaters, aber schlussendlich, mit Ach und Krach, schaffte er auch eine Lehre in irgendeinem weniger anspruchsvollen Beruf. Er heiratete später er eine Halbjüdin oder sogar Jüdin. Der Stern der Familie war Viera, ein hübsches, lebendiges und lebensfrohes Mädchen, das mich bei der Metzgete tröstete. Auch wenn sie fürs Lernen die Geeignetste von den dreien war, hatte sie als Mädchen ausser Kurse für Kochen und Nähen keine Schule mehr besucht. Ihre Aufgabe war, wie damals üblich, möglichst gut zu heiraten und eine gute, tüchtige Hausfrau und Mutter zu werden. Das „gut heiraten“ war schon immer nicht so einfach.
Mit ihrem Aussehen und ihren Eigenschaften hatte sie keinen Mangel an Verehrern. Nach kurzen Wirrungen und Versuchen mit verschiedenen jungen Männern entschied sie sich für einen hübschen, fröhlichen, drei Jahre älteren Handwerker, der auch aus einer Arbeiterfamilie stammte und dadurch kein Vermögen zu erben hatte. Er spielte in der Blasmusik, sang wie sie und tanzte gerne und gut. Sie hatten und hätten es auch weiter wahrscheinlich lustig und schön, vermutlich aber nicht leicht gehabt, da sie kaum je reich geworden wären. Die Meinung war, dass Viera „jemanden Besseren verdiente“. Wie auch; ein zehn Jahre älterer Besitzer einer Vulkanisationswerkstatt, in der er bei seinem Vater lernte und diese dann übernahm, begann sich für sie zu interessieren, besser gesagt über irgendeine Vermittlerin sein Interesse kund zu tun. Diese Werkstatt war immer schon ein sicherer Wert, da damals auf den schlechten Strassen und Wegen mit scharfen Kieselsteinen die Reifen und die Pneus, slowakisch genannt „Seelen“ (der Reifen), oft kaputt gingen und neue viel zu teuer waren. Während des Krieges war Gummi noch schwieriger zu bekommen, und somit war diese Werkstatt enorm wichtig und eine richtige Goldgrube. So wie die Werkstatt war auch ihr Besitzer weder an- noch aufregend. Er war ein ruhiger, solider Mensch, der selten und sicher weniger als Vieras Vater trank, nicht tanzte und sich ausser der Arbeit um nicht viel anderes kümmerte. Für ihn sprach aber, dass er katholisch war. Nach längerem hin und her und einigen Tränen war Viera mit diesem Bräutigam einverstanden.
Es begannen die Vorbereitungen zur Hochzeit. Nicht nur wurden auch wir Ecksteins eingeladen, ich wurde dazu noch mit der schwierigen Aufgabe des „Schleierträgers“ beauftragt. Meine Partnerin war die Tochter der Nachbarn des Bräutigams, die einen florierenden Laden besassen, in welchem sie auch Spielzeug verkauften. Ich beneidete sie, weil ich dachte, sie könne nach Lust und Laune frei in diesem Königreich zwischen verschiedenen Spielzeugen wählen. Sie war hübsch und in ihrem weissen Kleid, in dem sie auch an Fronleichnam aus ihrem Korb Blumen verteilte, kam sie mir wie eine Prinzessin vor. Ich trug einen weissen Sonntagsanzug. Wir erledigten unsere Aufgabe gut, den meterlangen Schleier der Braut würdevoll und vor allem so zu tragen, dass sich weder die Braut noch der Bräutigam oder die Zeugen in ihm verfingen.

(1) Katholische Kirche in Martin. Foto mit Dank für Bewilligung aus der Internetseite der Pfarrei. Bild nicht geschützt. Auf Anfrage wegen Bewilligung zur Veröffentlichung keine Antwort erhalten.
Ich war nicht das erste Mal in der katholischen Kirche. Frau Cunecka nahm mich schon früher mit. Die Kirche war mir etwas unheimlich. An die reichliche, sogar goldige Verzierung war ich aus „unserer“ lutheranischen, schlichteren Kirche nicht gewohnt. Wozu das? Der Kontrast zwischen der einfachen, ja armen Ausstattung der Wohnung bei Cuneks und dem Prunk in der Kirche, in die sie ging und der sie jeweils, trotz ihrer Armut, einen Batzen in einen der überall bereitstehenden Opferstöcke warf, schien mir nicht gerecht. Noch mehr störte mich eine auf der einen Seite der Kirche liegende, von Blumen geschmückte und gut beleuchtete lebensgrosse Statue des toten Jesus Christus. Sie war viel eindrucksvoller als das flache, dunkle Bild, das in der evangelischen Kirche hing. Ich dachte mir, die ist nicht nur überflüssig, sondern für mich persönlich auch gefährlich, wenn man so eindrucksvoll darstellte und die Kirchgänger immer wieder daran erinnerte, dass die Juden die blutende Wunde an der linken, zu dem Betrachter zugeneigten Brustseite von Jesus zugefügt hatten und ihn dadurch ermordeten. Es war von Frau Cunecka auch etwas frech, aufmüpfig, herausfordernd, dass sie, und sie war es, die den Schleierträger für ihre Tochter, einen kleinen, erst vor kurzem zu einem evangelisch und nicht zu einem katholisch getauften Judenknaben wählte und bestimmte. Noch vor Monaten hätten auch meine Eltern dieser Provokation nicht zugestimmt, aber jetzt waren - wir hofften für immer - die Transporte in die Lager in Polen beendet. Die Hochzeitszeremonie wurde auch nicht vom Pfarrer, einem Schwager des damaligen Parlamentspräsidenten und offenem Antisemiten, sondern von einem mässigen, toleranten Kaplan, bei dem Frau Cunecka meistens beichtete, abgehalten.
(2) Vieras Hochzeit - Brautpaar, Zeugen und Schleierträger. Foto: Bruder Palko.
Alle diese Gedanken, Überlegungen, Befürchtungen und Ängste waren während der Zeremonie weitgehend weg, wenn auch nicht ganz. Ich war auf meine Aufgabe konzentriert, kam mir aber fremd vor, da ich die lateinische Messe nicht nur nicht verstand und anders wie die meisten Anwesenden, samt meiner Schleiermitträgerin, auch nicht mitmurmeln konnte. Ich war froh, als wir nachher vor der Kirche waren, wo der Fotograf zum Zuge kam. Einerseits durfte er vorher die ehrwürdige Zeremonie nicht stören, und anderseits gab es noch keine Blitze, die das Innere der Kirche für die Aufnahmen genug beleuchtet hätten. Es wurden auch Bilder von uns Schleierträgern mit und ohne dem frisch getrauten Ehepaar geschossen. Während das Ehepaar noch fotografiert wurde, begaben wir uns zu Fuss in die Kolonie, in Cuneks Einzimmerwohnung. Es war nicht weit, etwas mehr als ein Kilometer. Das Ehepaar kam in einem mit weissen Streifen und Blumen geschmückten Auto des Bräutigams, was viel vornehmer war als in einer Kutsche. Die Einwohner der Kolonie konnten sich wundern und bewunderten, wen Viera geheiratete hatte. Später gesellte sich auch der Kaplan zu uns, der uns aber noch vor dem Essen verliess. Wir Schleierträger sassen zuerst nebeneinander. Dann wurden wir in den Hof zum Spielen geschickt. Für das, was ich mit ihr am liebsten getan hätte, "Dökterlispielen“, aber auch zu anderen Spielen, war ihr schönes, weisses, langes Kleid zu hinderlich. Ich wusste dort auch kein sicheres gutes Versteck dazu. So versuchten wir uns sonst zu unterhalten, kehrten aber bald zu den Erwachsenen zurück, und jeder ging zu den eigenen Eltern. Das einzige Zimmer wurde schon vormittags ausgeräumt und geliehene Tische in die U-Form eingeordnet, sowie mit auch von uns ausgeliehenen Tischtüchern bedeckt. Wir waren gut über zwanzig Leute in dem kleinen Raum. Die Speisen wurden in der auch nicht grossen Küche nebenan zubereitet. An das ganze Menu erinnere ich mich nicht mehr. Ich weiss nur, dass die Vorspeise „polnische Eier“ waren, eine jüdische Spezialität, die meine Mutter sehr gut zu machen verstand. Dann kam Fleisch, aber ich weiss nicht mehr, wie es zubereitet war. Als Aperitif und auch zum Essen tranken die Erwachsenen verschiedene Schnäpse, vor allem Sliwowitz. Aus einem Glas des kostbaren, wertvollen und damals seltenen Weines konnte ich, denke ich, das erst Mal in meinem Leben etwas kosten. Zu Hause wurde Alkohol, ausser bei „verdorbenem Magen“ ein Stamperl, nie getrunken. Bei guten Juden war es überhaupt verpönt, in dem war mein Vater jedoch kein perfekter Jude, wie ich es schon beschreibe und in den schweren Zeiten gab es nichts zu feiern, auf das wir hätten anstossen können. Es gab auch nur wenig von dem sehr teuren Wein aus dem kleinen Weingebiet um Bratislava. Aus dem Ausland importierte man für den Krieg wichtigere Güter, und so blieben als leicht erreichbare Alkoholgetränke, die man sich leisten konnte, Schnaps, den man aus verschiedensten Obstsorten und auch Kartoffeln brannte, sowie Bier. Ob die Torte auch mit Hilfe meiner Mutter gebacken wurde oder von der Conditorei „Horacek“ stammte, kann ich mich nicht mehr erinnern. Wenn ich bei der Metzgete die Fröhlichkeit, Ausgelassenheit, Entspannung der Anderen, der Fremden, der Christen bewundert und genossen hatte, hier habe ich mit Überraschung festgestellt, dass es auch meine stets besorgte, ernsthafte Familie ebenfalls konnte. Sie lachten nicht nur über Witze, sowohl Vater wie auch Palko erzählten sie – und die anderen schätzten es, wie und was sie sonst sagten. Wir waren nicht die Schwachen, Erniedrigten, Schuldigen und Verfolgten. Sogar jemand, der nicht als Freund, sondern als Feind der Juden galt, seine Anwesenheit konnte man in einer solchen Gesellschaft nicht vermeiden, liess es uns nicht spüren. Ich wurde leider immer müder, schlief ein und ging, ich denke noch vor Mitternacht mit Mutter nach Hause. Ich war überrascht und froh, als ich am nächsten Tag hörte, dass Vater bis zwei Uhr und Palko noch länger geblieben war. Ist so etwas überhaupt möglich, wunderte ich mich.

(3) Viera mit Schleierträgern. Foto: Bruder Palko.
Nach dem Krieg, als der Sozialismus kam, wurde die Werkstatt von Vieras Mann verstaatlicht, später liquidiert. Es gab mehr Pneus und bessere Strassen. Sie hatte sich mit dem Mann und der Ehe abgefunden und wurde eine gute, sorgsame Mutter einer Tochter und eines Sohnes, die zwar ihre Fähigkeiten aber nicht ihr Temperament erbten. Ob sie ihrem Ehemann treu blieb, interessiert uns nicht. Sie wurde eine sehr tüchtige Sekretärin, die rechte Hand irgendeines wichtigen Direktors im grössten Rüstungsbetrieb der Slowakei, der die Panzer exportierte, oder anders gesagt, der Hauptmuskel an seinem Hals, der seinen Kopf bewegte. Damit beteiligte sie sich erfolgreich nicht nur am Bau des Sozialismus in der Slowakei, sondern auch an vielen Kriegen in der Welt.
Es gibt sicher noch andere Gründe, warum ich Feste gern habe. Ich halte dann eine Rede, geniesse die Anerkennung dabei und dass ich kurz im Mittelpunkt stehe, wie damals Palko bei der Hochzeit von Viera.
*
Sowohl der eine Sohn wie auch ein Enkel von Frau Cunecka heirateten Jüdinnen.

Mit der Zeit wurde immer klarer, dass die Deutschen den Krieg nicht gewinnen würden. Der Widerstand wuchs nicht nur unter den Theaterleuten in Martin. Der Aufstand gegen die Deutschen wurde zum grossen Teil dort vorbereitet. Palko suchte den Anschluss zu seinen Organisatoren und den Partisanen. Vater war sehr dagegen, weil es ihm unnötig und gefährlich schien. Palko aber wollte, wie sein geliebter Dichter Petöfi zum Sieg der guten, richtigen Ideen und der aufrechten, anständigen Menschen beitragen und nicht warten, bis ihn andere für ihn erringen. Er dachte auch an seine unschuldigen Cousinen und Freunde, die nie mehr zurückkommen würden, deren Schicksal er wegen seines Geburtsdatums entkommen konnte. Ein paar Wochen vor Ausbruch des Aufstands brachte er seine neuen bewaffneten Bekannten, die Partisanen, nach Hause. Beim Manipulieren mit einer Waffe löste sich ein Schuss, der zum Glück gegen die Zimmerdecke aufschlug. Unser vorsichtiger, ängstlicher Vater, der schon immer gegen solche Unternehmen Vorbehalte hatte, befürchtete, dass die Nachbarn es hören und sie anzeigen könnten, aber es geschah gottlob nichts dergleichen. Die Leute waren jetzt schon mehrheitlich für den lodernden Aufstand. Dieser brach Ende August 1944 in Martin aus.
Die deutsche Militärmission, die im Zug aus Rumänien nach Hause fuhr, wurde nicht nur heimtückisch verhaftet, es wurden auch die Konventionen verletzt und alle Fahrenden samt Frauen und Kindern erschossen. Als Ausrede und Begründung galt, dass die Deutschen in der Regel nichts anderes in den von ihnen besetzten Gebieten getan hatten. Alle Männer zwischen achtzehn und vierzig Jahren wurden in die Armee eingezogen. Auch wenn er noch nicht achtzehnjährig war, meinte Palko, es sei seine Aufgabe und Pflicht und meldete sich freiwillig, gegen die Deutschen zu kämpfen. Vergebens versuchten die Eltern, ihn mit Erklärungen, Bitten und Beschwörungen davon abzuhalten. Er bekam Uniform und Waffe und wurde schnell zum Soldaten ausgebildet.
(1) Palko als Soldat.
Unser vorsichtiger Vater bereitete uns schon lange auf diese Entwicklung vor. Dabei arbeitete er mit Onkel Laci Strelinger eng zusammen. Wir hatten bereits neue Dokumente mit neuen Namen – wir hiessen jetzt Cerny. Bald, schon nach ein paar Tagen, noch vor Ende August, verliessen wir nicht nur Martin, sondern auch Palko und Grossvater und mussten sie ihrem Schicksal überlassen. Grossvater wäre eine schwere Last gewesen, die unser und sein Überleben verunmöglicht hätte. Meine Eltern veranlassten noch, dass er nach Blatnica, einem Dorf am Eingang in ein wunderschönes Felsental 20 km von Martin entfernt, zu einer Bauernfamilie ging, um sich dort zu verstecken. Aehnlich machten es auch die Strelingers später mit Teri neni. Palko blieb als Soldat bei seiner Einheit, die später zufällig im selben Ort stationiert war, wohin Grossvater umgezogen wurde.

(2) Dolna Lehota 2007 (Foto: Tochter Corinne).
Wir waren die ersten „Flüchtlinge“ in Dolna Lehota. Wir wählten den Ort tief in der Mittelslowakei, weit weg von den anrückenden deutschen Truppen, da jemand, ich glaube unsere Freunde Picklers, direkt oder über jemand anderen, den Oberförster dort kannten. Er war ein anständiger Mensch, hilfsbereit, kein Antisemit, wie fast die ganze Bevölkerung auch nicht. Er wohnte ausserhalb des Dorfes in einem der schönsten Häuser, einer Art Villa. Mit seiner Stellung war er auch ein geschätzter, angesehener, einflussreicher Mann. Ich kann mich nicht genau erinnern, denke aber, dass die Picklers bei ihm wohnten. Dolny, dolna, dolne bedeutet der, die, das untere Lehota, ein Gebiet, eine Ortschaft, die ausgeliehen, in Ausleihe gegeben wurde. Warum unsere Lehota Dolna, untere genannt wurde, ist klar: sie liegt tiefer als die Horna Lehota, die obere, die sich nicht weit neben der Dolna am Anfang eines anderen, parallelen Tales befindet. Der Höhenunterschied ist aber nicht gross – ganze 160 m. Dolnans gehörten dort eher zu den reicheren Familien. Sie besassen etwas Wald, voneinander entfernte, nicht grosse Wiesen und Felder und ein eher verhältnismässig grosses Haus in der Mitte des unteren, „dolneho“ Teil des Dorfes, in dem sich auch die Kirche befand. Das Haus war so gross, dass wenn sie uns auch in ihrem Schlafzimmer übernachten liessen, fanden sie Schlafgelegenheiten für sich. Ein Badezimmer hatten sie selbstverständlich nicht. Wir wuschen uns beim Brunnen im Hof, der Wasser für das Tränken der Tiere spendete. Bei Kälte holte man das Wasser mit einem grossen Zinkkrug in die Küche und goss es in eine Schüssel. So „badeten“ wir auch einmal in der Woche, wofür man das Wasser auf dem Ofen erwärmte. Das war eine gute Vorbereitung für das spätere Leben in den Bergen. Wasser zum Trinken und Kochen holte man in Behältern aus einem hygienisch sicheren Gemeindebrunnen, der ungefähr dreihundert Meter entfernt war. Die Mutter von Herrn Dolnan lebte noch, war aber alt, zerbrechlich und pflegebedürftig. Sie musste versorgt werden. Der Vater starb schon beim Holzen, als Herr Dolnan noch klein war. Ein Baum erdrückte ihn. Die Dolnans hatten zwei Kinder, ihr Sohn Jaro (Jaromir = Frühlingsliebhaber), um zwei bis drei Jahre älter und ihre Tochter Anna, drei Jahre jünger als ich. Die Stube war auf der Strassenseite, in der jetzt während unseres Aufenthaltes jemand notdürftig schlafen musste. Wir schätzten es sehr, dass die Dolnans bereit waren, uns aufzunehmen und entschädigten sie für die Unannehmlichkeiten und Belastungen, die sie mit uns hatten. Mutter kochte oft, half bei der Pflege der alten Frau Dolnan. Auch sonst entlastete sie Frau Dolnan, wo sie nur konnte. Selbst wenn Vater auf dem Dorf aufwuchs, ehemaliger Besitzer mehrerer schöner, kräftiger Pferde war, was er vermutlich nicht verriet, fanden sie keine Arbeit für ihn. Ich weiss nicht, wie wir unseren Aufenthalt begründeten. Vielleicht auch damit, dass Palko gegen die Deutschen kämpfte. Ich glaube, niemand interessierte sich sehr darum und um unsere Herkunft, umso mehr, als immer mehr auch christliche Familien aus Martin hierher zogen. Die Bevölkerung war gutmütig, einfach, anständig, zum grössten Teil waren es arme Kleinbergbauern, evangelisch, das hiess schon aus diesem Grund „gegen das Regime eingestellt“. Die Schule begann nicht wie üblich anfangs September, da der Lehrer in die Armee eingezogen worden war. Den Kindern und auch ihren Eltern war es nur recht. So konnten wir den ganzen Tag im Hof helfen oder auf den Wiesen die Tiere hüten. Es blieb auch mehr Zeit zum Spielen. Als wir Ende August zu Dolnans kamen, wurde noch irgendein Getreide reif, selbstverständlich mit der Sense von Hand gemäht, da es noch keine Mähmaschinen gab und die Felder dafür sowieso zu klein, zu schmal und zu steil gewesen wären. Man trocknete es, ähnlich wie beim Heu, auf Ständern aus Holz, in denen wir uns dann verstecken und spielen konnten. Wann und wie lange es dauerte, bis es trocken wurde, hing vom Wetter ab. Dann konnte man in der Scheune die Körner mit den Dreschschlägern aus den Aehren befreien. Damit es zügig vorwärts ging, standen in der Mitte zwei bis vier Menschen gegeneinander und schlugen auf das Getreide ein, bis keine Körner mehr herauskamen. Das Dreschen war streng regelmässig, damit man sich nicht in die Quere kam und wenn jemand ermüdete, stieg er aus und machte eine Pause. Wenn die Drescher Lust nach Abwechslung und Spass für sich und die Zuhörer hatten, änderten sie den Rhythmus der Schläge wie Trommler. Man wischte die Körner peinlich genau zusammen, bevor man mit einem neuen Haufen von Getreide fortfuhr. Die vollen Säcke brachte man mit Wagen, die von Ochsen (bei den Reichen von Pferden) gezogen wurden, in die Mühle, sofern der Müller Zeit und Platz hatte. Sie befand sich unten im Haupttal des Flusses Hron, da die Bäche von Horna und Dolna Lehota für den Betrieb einer Mühle nur unregelmässig genug Wasser führten.
(3) Drescher. Bild aus dem Buch Sochan von Slivka M., Strelinger A. (Vetter Alino, dem ich für Copyright danke): Sochan war vor Hornik, dem späteren Arbeitgeber von Palko, der Fotograf in Martin.
In Dolna Lehota lernte ich auch Kvaka (Steckrübe) kennen. Ich weiss nicht, warum wir sie in Turiec nicht hatten. Es sollte weder am Klima noch an der Erde liegen. Es gab damals auch im Bereich der gezüchteten Pflanzen Unterschiede zwischen verschiedenen Gebieten. Kvaka schmeckt süsslich und wir assen sie gerne roh wie Kohlraben. Man konnte sie in der Kühle einige Wochen halten und kochte sie auch zu einer Speise für Menschen, fütterte damit aber vor allem die Schweine. Es gab damals nicht genug Mist und Jauche, keinen künstlichen Dünger, und so diente Kvaka, ähnlich dem Klee, auch zur willkommenen Abwechslung der fruchtbaren Landwirtschaftsflächen. Die grossflächigen Wiesen auf den Hügeln vor den Wäldern und Bergen in Pohronie sind durch Reihen von Sträuchern, die den kleinen Wildtieren als Versteck und Heim dienen, aufgeteilt. Die Büsche bestehen zum grossen Teil aus Haselnuss- und Eschenstauden. Wenn wir auf den Wiesen die Kühe und Ziegen hüteten, sammelten wir die Haselnüsse und assen sie mit den kleinen halbwilden, leicht bitteren Äpfeln und Birnen, die auf den seltenen Obstbäumen reiften und beim Essen den Mund zusammenzogen. Manchmal wurden wir direkt geschickt, die Haselnüsse zu pflücken. Man konnte sie für den Winter aufbewahren. Die Äpfel und Birnen musste man jedoch zuerst trocknen, sonst verdarben sie schnell.

(4) Dolnans Haus 2007. Foto: Tochter Corinne.
Die Arbeit auf den Feldern war zum grossen Teil schon erledigt, die Tage wurden kürzer, die Abende länger. Nach dem frühen Abendessen - man musste den kostbaren Strom sparen - trafen sich mehrere nahe und befreundete Familien abwechslungsweise in ihren Häusern. Bei uns fanden die Zusammenkünfte in der Stube statt, anderswo auch in der Küche, wenn sie dafür gross genug war. Die Frauen bereiteten die Leinenbüschel zum Spinnen vor, und eine Geübte webte auf dem Webstuhl. Die Männer kamen später, wenn sie in den Ställen mit der Versorgung der Tiere fertig waren, halfen wo sie konnten und tranken dazu Sliwowitz. Die Laune war auch ohne Sliwowitz fröhlich und ausgelassen. Man sang und erzählte witzige und grausame, wirkliche und erfundene Geschichten. Beliebt waren Jäger-, besser gesagt Wildererberichte, da die Bauern ihr Geld für notwendigere Einkäufe brauchten als für teure Jagdpatente. Der Oberförster wurde schon wegen seiner hohen Stellung nicht zu den Abenden eingeladen. Ausserdem hätte er erfahren, mit welchen Tricks sie ihn und seine zahlenden Gäste leimten. Herr Dolnan erzählte, wie er einmal in den Wald holzen ging. Das tat man eben im Winter, wenn die Arbeit auf dem Feld ruhte. Unterwegs traf er gute Freunde, und sie begannen sich schon vor der Arbeit mit dem zur Erwärmung mitgebrachten Schnaps zu stärken. Als sie ihre Vorräte verbraucht hatten, kehrten sie zurück ins Dorf in die Wirtschaft. Erst abends in der Dunkelheit gingen sie nach Hause. Die Mutter fragte: „Wo ist das Holz, das Du fällen solltest?“, worauf er verkündete: „Mutter im Wald gibt es kein Holz“. Unterhaltsame, gute Erzähler wurden sehr geschätzt. Diese Gabe war selbstverständlich nicht allen Männern und Frauen eigen. Sie waren überall willkommen, ausser wenn man, aus welchem Grund auch immer, verfeindet war. Dies war aber eher selten. Man trachtete bald, sich zu versöhnen, da man mit den schweren Lasten des Lebens hier aufeinander angewiesen war – ein Grund für die Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft, für den Anstand der Bevölkerung in den Bergregionen. Eigenschaften, die für uns jetzt enorm wichtig waren. Ähnlich der Metzgete bei Cuneks und der Hochzeit von Viera Cunek waren es für uns helle Punkte in der Dunkelheit der Angst und Unsicherheit, die uns umhüllten. Die Deutschen näherten sich trotz des Widerstandes der Aufständischen Dolna Lehota immer mehr. Wir wussten nicht, was uns erwartete, wie es weitergehen, enden sollte.

(5) Im Hof eines ähnlichen Hauses. Foto: Tochter Corinne.
Die Zusammenkünfte dauerten trotz der guten Laune nicht zu lange – man musste am nächsten Tag früh und in guter Verfassung mit der Arbeit im Stall und Haushalt beginnen. Unterwegs nach Hause konnte man zu jeder vollen Stunde den Nachtwächter in der Mitte des Dorfes mit seinem Horn und Ruf hören: „Es schlug die und die Stunde, lobe den Herrn, der erlässt unsere Sünde“ (slowakisch „Udrela ta a ta hodina, chval kazdy hospodina“). Inzwischen machte er eine Runde durch das ganze Dorf und schaute zum Rechten, dass keine Diebe unterwegs waren und vor allem, dass es nirgendwo brannte. In einem solchen Falle schlug er mit seinem Horn Alarm, indem er eine andere Melodie blies. Der Nachtwächter musste ein zuverlässiger Mensch sein, der sich mit den Verbrechern nicht einliess und kein Trinker, der im Suff seine Pflichten vernachlässigen und statt die Runden zu drehen, irgendwo schlafen würde, was trotzdem manchmal geschah. Zweimal pro Woche ging er auch am hellen Tag, um Mittag oder gegen Abend, wenn die Leute zu Hause weilten, durch das Dorf und an mehreren festgelegten Stellen trommelte er zuerst und wenn keiner mehr zu ihm strömte, verkündete er die frischen Nachrichten und neuen Verordnungen. In Notfällen, wenn es dringend wurde, drehte er eine zusätzliche, ausserordentliche Runde. Martin war zu meiner Zeit schon zu gross für einen Nachtwächter, aber erst nach Beginn des Krieges wurde der Trommler durch „Amplione“ ersetzt, grosse Lautsprecher, die an den Säulen für elektrische und telefonische Leitungen und anderen geeigneten Stellen befestigt wurden. Damit bekam man garantiert alle, nicht nur Nachrichten und Verordnungen, aber auch politische Propaganda genug laut mehrmals täglich zu hören.
(6) Mutter als Bäuerin Cierna (Schwarz) in Dolna Lehota.
Im Jahre 1944 war ein schöner Herbst. Wenn es aber ein paar Tage regnete oder ein grosses Gewitter kam, schwoll der Dorfbach bedrohlich an. Die Holzhacker nutzten dies und schickten oben im Wald die an günstigen Stellen bereit gestellten Baumstämme den Bach hinunter. Unterwegs war es nötig, sie zu begleiten und zu schauen, dass sie sich nicht verkeilten, einklemmten und damit sowohl den Fluss des Wassers wie auch ihr Weiterkommen verhinderten. Im Dorf halfen ihnen dabei die halbwüchsigen Knaben. Auch Jaro Dolnan war schon gross genug dafür. Es war für die Kinder ein spannendes, jedoch gefährliches Spiel, bei dem sie ihren Mut und ihre Geschicklichkeit zeigen und üben, sich für die Arbeit als Erwachsene vorbereiten konnten. Mit langen Haken mussten manchmal mehrere Menschen die Holzstämme ziehen und schieben. Dies geschah meistens vom Ufer aus. Manchmal war es besser, direkt auf die Holzstämme zu klettern, um die eingekeilten verschieben zu können, die sich dann wieder zu rühren begannen. Es war wichtig, gut zu denken, abzuschätzen, schnell, geistig und körperlich zu reagieren. Eine Art Akrobatik, bei der sich die Bedingungen ständig änderten.
.
(7) Holzflösserei; aus dem Buch: Sochan von Slivka M., Strelinger A.; mit Bewilligung von Alino (A. Strelinger).
Selbstverständlich kam es auch zu Unfällen. Während meiner Zeit in Dolna Lehota brach sich ein Knabe dabei den Arm. Die Unfälle nahm man im Allgemeinen als unangenehme, unvermeidliche Begleiterscheinungen, die zum Lernen, zur Arbeit und zum Leben gehörten. Erst als wegen der deutschen Besetzung von Martin auch viele christliche Anhänger des Aufstandes mit ihren Familien aus Angst vor Rache und Verfolgung in das noch aufständische Pohronie, zahlreiche auch nach Dolna Lehota zogen, unter ihnen auch ein Lehrer, begann die Schule. Jemand aus dem Dorf leistete Hilfe. Wir waren sehr viele Kinder aller Klassen zusammen, die Schule zum Bersten voll. Bei schönem Wetter wurden wir draussen „unterrichtet“. Es ging mehr darum, uns zu beschäftigen. Man hatte die kaum begründete Angst, wir würden sonst ganz „verfaulen“.
Gefährliche Spiele mit dem geschlecht

Vor dem Umzug nach Dolna Lehota warnte und bat mich mein Vater, mich nicht zu entblössen oder Spiele mit dem Glied zu spielen, damit ich uns als Juden nicht verrate und die ganze Versteckerei verderbe, was uns auch das Leben kosten könnte. Selbstverständlich erschwerte und beschränkte es mich, denn so konnte ich mich nicht an den verschiedenen nicht nur im Dorf beliebten Spiele beteiligen, wie am Wettbewerb, wessen Urinstrahl weiter reichte. Einmal beim Kuhhüten weit weg vom Dorf gegen die Berge schlug mein Mithirte vor, mit den Gliedern zu spielen, aber es gelang mir, ihn davon abzubringen. Er war anständig und bestand nicht darauf.

(1) Wiesen um Dolna Lehota; Foto mit Dank von Filip Majercik, www.dolnalehota.sk/okolie/, Die Quelle des Fotos ohne Schutzwarnung um Copyright angefragt, keine Antwort erhalten.
Als Kind war ich ein guter Schläfer. Nachdem mich Vetter Jano aufgeklärt hatte, was die Eltern heimlich im Bett trieben, bemühte ich mich, manchmal nicht einzuschlafen, damit ich es hörte und erlebte, aber ich schlief doch immer bald ein. Auch morgens schlief ich gut und lange. Aber eines nachts in Dolna Lehota erwachte ich etwas nach vier Uhr. Die Deutschen näherten sich immer mehr, aber der Zug fuhr noch zwischen Brezno und Banska Bystrica. Plötzlich hörte ich, dass die Eltern miteinander leise sprachen. Ich schärfte meine Ohren, und vernahm, dass Vater am kommenden Vormittag um 10.00 Uhr nach Banska Bystrica fahren wollte, um die Familie von Mutters Cousine Ella zu besuchen, sowie dort gleichzeitig einen Revolver zu besorgen. Er wusste auch schon wo. Die Situation war aussichtslos. Zuerst würde er Mutter, dann mich und zuletzt sich selbst erschiessen. Palko sei genug gross und selbständig, er könne alleine weiterleben. Wozu sollten wir uns in den Bergen plagen, sie erwischen uns sowieso. Ich bekam enorme Angst, einen Riesenschreck und Wut, dass sie so etwas machen wollten und dazu bereit waren, Palko alleine zu lassen und dass Mutter damit einverstanden war. Selbstverständlich konnte ich nicht mehr einschlafen und dachte dauernd, dass mich Vater ermorden wollte, und was ich dagegen tun konnte. Von der biblischen Geschichte wusste ich, dass Isaaks Vater ihn ermorden wollte, sollte? Am nächsten Tag war ich mit mehreren Knaben verabredet, damit wir zusammen die Kühe und Ziegen auf dem Hügel direkt oberhalb des Dorfes hüten gingen. Ich befürchtete, dass sich wieder jemand besinnen könnte, mit den Gliedern zu spielen. Dazu gesellte sich diese neue, andere, fürchterliche Angst dieser Nacht. Es war nicht anders möglich, ich strahlte meine Verfassung aus. Ich war nicht beim Hüten, sondern überlegte, ob ich nach Hause zurückkehren sollte, um meinen Vater zu bitten, er solle es nicht tun und den Revolver nicht kaufen. Wir waren nicht lange oben, die Kühe und die Ziegen waren noch brav beieinander, sodass wir sie nicht zusammentreiben mussten, als der Älteste, Stärkste von uns vorschlug, dass wir uns die Glieder zeigen sollen. Mich als Fremden baten sie, damit zu beginnen. Als ich mich weigerte, wollte er mich dazu zwingen. Ich wand mich heraus und so schnell ich konnte, nicht nur wie sonst, rannte ich wirklich um mein Leben nach unten. Zuerst liefen sie mir nach, doch sie durften nicht zu weit weg, da die Tiere ihre Abwesenheit hätten benützen können, um in den umliegenden Feldern sich am Klee und ähnlichen Köstlichkeiten gütlich zu tun. Vom frischen Klee konnten sie tödlich gebläht werden. Im Winter diente dagegen der trockene Klee als gutes Futter. Und so, wenn auch nicht als Vierkleeblatt, der Klee und die Tiere, ähnlich der Krippengeschichte, verhalfen mir zu meiner Rettung. Unterwegs schaute ich dauernd auf die Kirchenuhr, ob ich Vater noch vor der Abreise zum Zug in Lopej erwischte. Fast ausser Atem gelang es mir; den Weinkrampf konnte ich aber nicht unterdrücken. Als sie mich fragten, was los sei, warum ich weinte, verriet ich, dass ich in der Nacht alles gehört hatte, und bat Vater innig, er möge nicht nach Bystrica fahren, keinen Revolver kaufen und uns nicht erschiessen. Er versprach es mir, erklärte aber, dass er auch wegen anderen Angelegenheiten nach Bystrica müsse. Ich ging nicht mehr auf den Hügel. Als Vater abends kam, zeigte er mir, dass er keinen Revolver mitbrachte. Ich denke, über den Übergriff der Knaben sagte ich nichts. Einerseits wollte ich die Eltern nicht beunruhigen, anderseits, typisch für die Opfer, fühlte ich mich schuldig, dass es überhaupt dazu kam.

Ende Oktober standen die Deutschen nicht weit vor Dolna Lehota. Man bereitete sich für den unvermeidlichen Abgang in die Berge vor. Fast alle erwachsenen Flüchtlinge aus Martin gingen in die Bergbauhütte im Vajskova Tal oberhalb des Dorfes, um sich ihrem Zugriff zu entziehen. Manche liessen ihre Kinder im Dorf bei den Familien, bei denen sie Zuflucht fanden, in der Hoffnung, dass die Deutschen es nicht erfahren, und wenn, die Kinder in Ruhe lassen würden. Auch meine Eltern wollten mich verschonen von den Belastungen und Gefahren des Lebens in den Bergen. Ich sollte im Dorf bleiben wie Vetter Alino in Horna Lehota. Ich lehnte es ab, ähnlich ihm und anderen Kindern in der gleichen Lage, denn ich hatte einen zusätzlichen gewichtigen Grund – ich fürchtete, unter Umständen könnte es den Eltern wieder in den Sinn kommen, sich zu erschiessen oder sie würden gefangen genommen und ich bliebe alleine, was ich ihnen auch sagte. Wahrscheinlich trieb mich auch die Angst vor den Knaben im Dorf weg, deren Neugier auf mein Glied und die Lust, mich zu erniedrigen, jetzt nur stieg. Lieber ging ich mit den Eltern, unter welchen schwierigen Bedingungen auch immer, schlimmstenfalls selbst um mit ihnen zu sterben. Livia, die sechs Jahre ältere Tochter unserer Freunde Picklers, war anfangs mit uns. Zwei Tage später kamen die Deutschen nach Dolna Lehota.

(1) Schafe oberhalb Dolna Lehota; Foto mit Dank von Filip Majercik, www.dolnalehota.sk/okolie/, die Quelle des Fotos ohne Schutzwarnung um Copyright angefragt, keine Antwort erhalten.
In die Berge begaben wir uns sehr früh am Morgen. Der Weg führte zuerst durch die Wiesen. Wir machten bei „Salas“ (Almhütte) Halt, wo jetzt alles voll besetzt war mit den Schafen und all ihren Hirten, samt dem ältesten, erfahrensten „Baca“ (Oberhirten), da die Tiere bereits von der höher gelegenen „hola“ (Alp) vor dem bald einsetzenden Schnee etappenweise zurück zum Überwintern ins Dorf unterwegs waren. Wir tankten noch süsse oder gegorene „Zincica“ (Schafsmolke), labten uns am frischen Schafskäse und nahmen „Ostiepka“ (geräucherte Schafskäsebällchen) mit. Bis Salas und noch ein Stück weiter war ich imstande zu gehen, dann durfte ich auf dem Wagen sitzen, der unser Hab und Gut transportierte und von Pferden gezogen wurde. Inzwischen begann sich der Tag schon aufzuhellen. Nach „Dve vody“ („Zwei Wasser“, da sich dort Bäche aus zwei Tälern treffen) bogen wir links ab. Der Weg zur Bergbauhütte wurde immer steiler, auch wir Kinder mussten absteigen und alle Rucksäcke und Taschen selbst tragen. Die Hütte war überfüllt, die Stimmung gedämpft, aber wir ertrugen uns gut. Nicht klar war, wie wir es über längere Zeit aushalten würden.

(2) Bach in Vajskova Dolina, Foto: Tochter Corinne.
Vielleicht am dritten Tag rief jemand nachmittags plötzlich Alarm aus: „Die Deutschen kommen! Versteckt Euch alle in den nächsten Stollen.“ Hals über Kopf flohen wir dorthin. Als wir so in der Dunkelheit und Kälte dastanden, kam jemand mit der Idee, dass es ganz falsch war, hierher zu fliehen, weil es nichts Leichteres gebe, als mit ein paar Handgranaten den Eingang zum Stollen zuzuschütten und uns damit. Noch dazu rochen wir einen unangenehmen, fäkalen Gestank – später stellte sich heraus, dass eine Frau schon beim Springen über das Wasser, das aus dem Stollen floss, in die Hosen gemacht hatte. Ich war stolz, dass mir so etwas nicht passierte. Bald wurde Entwarnung gegeben und wir durften wieder an die freie, frische Luft raus. Nach zwei bis drei Tagen kam aus dem Dorf die Botschaft, es gebe eine Amnestie für alle Christen, sie könnten zurückkehren in ihre Wohngemeinden. So zogen alle Flüchtlinge aus Martin, Dolna Lehota und Umgebung aus. Von den Kindern blieb nur Livia, die sechs Jahre ältere Tochter unserer Freunde Picklers. Später weilte sie je nach Umständen zeitweise im Dorf. Sie schleppte dann zusammen mit den Partisanen Nahrungsmittel, nicht nur für die Eltern. Auch das war eine aussergewöhnliche Lösung. Selbstverständlich auch mit genug Angst beladen.
In der Hütte gab es jetzt plötzlich enorm viel Platz. Jeder hatte zum Schlafen sogar einen eigenen Strohsack(!) und die Heimkehrer liessen uns genug Nahrungsmittelvorräte. Wir waren guter Dinge, da wir hofften, die Russen würden ihre Bemühungen für den Sieg verstärken und uns bald befreien. Es blieben auch ein paar alte Schafe und Schafböcke, die es genossen, dass ihnen keine Schäferhunde das Grasen auf der Wiese um die Hütte vermasselten. Es war einerseits klar, dass das friedliche Leben mit dem kommenden Schnee bald enden würde; zudem konnte man das Fleisch nicht gut aus dem Dorf transportieren, war dazu sehr teuer und ohne Schnee schwierig zu lagern, sodass die Schafe, zuerst die schwächeren, mageren geschlachtet wurden. Jeden Tag gab es Schaffleisch, vor allem als Gulasch, was schon an und für sich genug wäre, aber die Schafe waren alt, das Fleisch zäh und stinkig, vor allem bei den alten Böcken mit einem abstossenden Beigeschmack. Meine Mutter zwang mich mindestens ein paar Happen zu essen, lange zu kauen (was mühsam war), nicht auszuspucken, sondern zu schlucken. Ich schwor, sollte ich überleben und ein Frieden ohne Mangel herrschen, was ich fest hoffte, würde ich nie mehr Schaffleisch essen. Als sich meine Hoffnung erfüllte, probierte ich es nach Jahren wieder und wurde doch ein Liebhaber des guten, feinen Lammfleisches. Aber ein Lamm ist kein Schafbock.
Wegen der Ordnung wurde eine Selbstverwaltung in der Hütte bestimmt. Mein Vater, als ehemaliger k.u.k. Offizier, wurde ihr Vorsitzender, also ihr Chef. Ein paar Tage später meldete die Wache, ein Haufen bewaffneter Leute würde sich uns von unten nähern. Es seien keine Deutschen. Die Wache ging ihnen entgegen und begleitete sie zu uns in die Hütte. Es waren die kommunistischen Führer Sverma und Slansky und der linke Sozialdemokrat Lausman, die wie viele Soldaten von Moskau bald nach Anfang des Aufstandes mit Fallschirmen auf dem freien Gebiet abgesprungen waren. Jetzt waren sie auf der Flucht, unterwegs zu der am höchst gelegenen touristischen Hütte in der Niederen Tatra unter dem Chabanec, dem Berg, der das Tal westlich von uns krönte. Mein Vater erstattete ihnen und ihrer Begleitung einen militärischen Bericht, was sie wenig beeindruckte, uns dagegen sehr. Wir kippten fast um, dass zur Begleitung ausser drei bis vier russischen Soldaten als Aufpasser auch der jüngste Bruder meiner Mutter, Onkel Miki, mit fünf bis sechs Soldaten seiner Kanonenbatterie dazu gehörten, die von der Leitung des Aufstandes als Begleitung und Schutz dieser grossen und wichtigen Tiere bestimmt wurden.
Sverma, Slansky und Lausman zogen sich mit ihren russischen Begleitern in ein kleines Zimmer neben der Küche zurück. Sie suchten keinen Kontakt mit uns. Ich glaube, nur Lausman wechselte ein paar Sätze mit mir. Sie wirkten sehr angespannt und assen sogar nur aus ihren Vorräten. Dafür bedienten sich Miki und seine ausgehungerten Soldaten umso mehr von unserem fürchterlichen Schafsgulasch. Nach einer Weile kam aus dem kleinen Zimmer jemand raus und verkündete, sie würden weiterziehen, bräuchten aber keine slowakische militärische Begleitung mehr. Sie hatten einen Funker mit einem Apparat mit sich und bekamen offensichtlich den Befehl dazu. Unsere Freude war gross: Miki blieb bei uns! Er war auch froh, dass er dieser schweren und wie man sah etwas unwürdigen Bürde enthoben wurde, da die russischen Offiziere ihre slowakischen Mitkämpfer, sogar auch Sverma, Slansky und Lausman ziemlich von oben herab behandelten. Noch am selben Tag verschwanden sie bergauf Richtung Chabenec. Ihr Ziel durften wir jedoch nicht erfahren. Ein bis zwei Tage später war alles weiss. Der Schnee kam. Die restlichen zwei Schafe mussten geschlachtet werden. Sie hatten auch das kümmerliche herbstliche Gras nicht mehr.

(3) Chabenec im Winter, aus www.nizketatry.sk/ciele/chabenec/chabenec.html. Die e-mail Adresse für die Anfrage um Bewilligung leider nicht erruierbar.
Miki blieb bei uns. Ich glaube ohne seine Soldaten. Sie nützten die Amnestie, die für sie als Armeeangehörige und nicht freiwillige Partisanen noch galt und kehrten verspätet nach Hause zurück. Miki war für uns eine Stütze, eine Verstärkung. Manchmal lagen wir nebeneinander oben auf der Pritsche mit speziell grossen Strohsäcken, die schon den Bergleuten als Matratzen dienten und sprachen über Gott und die Welt. Einmal erklärte ich ihm meine Gründe, warum ich meinte, dass wir uns retten, nicht mehr untergehen und sterben würden. Es beruhigte mich enorm, dass er mir ernsthaft zuhörte und meine Argumente akzeptierte. Ich denke, die Wirkung war gegenseitig, die Beziehung zwischen uns speziell. Manche Familienangehörige wunderten sich später, warum er mich so schätzte. Vielleicht vergass er unsere damaligen Gespräche mit der Zeit, ich nicht. Er beschäftigte sich auf eine andere Weise mit Frau Pickler, was meiner Mutter nicht sehr gefiel, da sie Probleme mit deren Mann fürchtete, aber der merkte entweder nichts oder tat nur so, um nicht allen das Leben noch mehr zu erschweren. Diese Idylle dauerte kaum länger als zwei Wochen, da Miki von seinen Vorgesetzten anderswohin versetzt wurde. Wir trafen ihn erst nach dem Krieg wieder.
*
Bis zu unserer Berghütte kamen die Deutschen nie. In die höher gelegene „Unter dem Chabenec“ wegen einer besser ausgebauten Strasse hingegen schon. Sie brannten sie aus. Wahrscheinlich wussten sie, dass sich dort die kommunistische Führung des Aufstandes versteckte. Bei der Flucht starb Jan Sverma im Schneegestöber. Er litt unter Tuberkulose. Später, im Slansky-Prozess, wurde Slansky für den Tod von Sverma verantwortlich gemacht – er solle ihm zu kleine Schuhe gegeben haben. Dass ausgerechnet der kranke Sverma mit der schwierigen Aufgabe betreut worden war, wurzelte in den Spannungen und Intrigen der kommunistischen Führung in Moskau, die nach der Wende zum Vorschein kamen. Meine beiden Onkel Osi und Miki waren mit Slanskys Schicksal verbunden; Miki nach dem Aufstand kurz als sein Begleiter und Beschützer, Osi während des Prozesses als Zeuge der Anklage und Mitopfer. Zu seiner kurzen Aussage musste er lange durch Folter gezwungen werden.
Im Bunker

Eines Tages kam von oben per Funk der Befehl, die Soldaten und die Partisanen, die inzwischen in der Hütte wieder Zuflucht gefunden hatten, sollen die Bergbauhütte bald verlassen, da der Zugang zu ihr mit einer relativ gut ausgebauten Strasse, auf der man in ruhigen Zeiten das Antimonerz ins Tal transportierte, die Deutschen zum Angriff verlocken könnte. Damit sei diese Bleibe gefährlich. Sie sollten sich wie bereits andere in kleine Einheiten zerstreuen und jede für sich einen Bunker bauen. Einerseits war es gut, dass die Hütte nicht mehr überfüllt wurde, anderseits blieben wir Zivilisten ohne Schutz, also umso mehr dem deutschen Angriff ausgesetzt. Und wer sollte uns Proviant aus dem Dorf besorgen und bringen? Also mussten wir uns auch zerstreuen und möglichst jede Familie bei irgendeiner militärischen Einheit in ihrem Bunker unterschlüpfen. Mein Vater dachte, es wäre besser, wenn wir bei Soldaten wären, die uns nicht aus der Hütte kannten und wüssten, dass wir Juden sind. Bei der nächsten gemeinsamen Wache bei Dve Vody („Zwei Wasser“, die ich später noch näher beschreibe) lernte er einen ruthenischen Unteroffizier kennen, der ihm gefiel und in dessen Bunker noch keine Zivilisten waren. Somit eröffnete er ihm sein Anliegen. Dieser war Vaters Wunsch nicht abgeneigt und versprach, seinen Kommandanten der Gruppe im Bunker zu informieren. Da die Sache eilte, verabredeten sie auch ohne Wache bald ein Treffen bei Dve Vody. Es war ein gutes Zeichen, dass dazu auch der Offizier selbst, ein Tscheche, erschien. Der Offizier machte meinem Vater einen guten Eindruck. Man durfte sowieso nicht wählerisch sein. Die Zeit drängte, und es gab nicht viele Möglichkeiten. Und so verabredeten sie unseren Umzug in ein paar Tagen, da sie für uns noch die Pritschen in Form von Kajütenbetten bauen mussten.
Warum nahmen Soldaten uns Zivilisten, meistens dazu noch Juden, die sie damit retteten, zu sich, warum boten sie ihnen Unterschlupf? Vermutlich wussten eigentlich die Wenigsten, dass es sich um Juden handelte. Meistens waren sie mit den neuen Verhältnissen in der Slowakei nicht gut vertraut, da sie erst nach dem Ausruf des slowakischen Aufstandes aus Russland oder England kamen. In Russland meldeten sie sich als Gefangene lieber zum Dienst in der neu gebildeten tschechoslowakischen Armee, als in einem der fürchterlichen Gefangenenlager unter Hunger, Kälte, schwerer Arbeit und verschiedenen Krankheiten zu leiden. Aus England kamen dagegen besser situierte, geschulte und informierte, überzeugte Kämpfer für die neue demokratische Tschechoslowakische Republik, die aber etwas abgehoben, bequem, dazu verwöhnt und weder bereit noch geneigt oder angewiesen waren, die Juden zu schützen und zu verstecken. Das war auch einer der wichtigen Gründe und Quellen unserer Bewunderung, Zuneigung, sogar Liebe zu den Russen, die wir fälschlicherweise mit dem System verbanden, das dort herrschte, was sich bald als ein schmerzhafter Irrtum erwies. Sicher führte sie dazu nebst aller menschlichen und tierischen Grausamkeit, die eben ihre Blüte erlebte, auch das edle menschliche, ja animalische Urbedürfnis (die Tiere zeigen es nicht nur bei der Aufzucht) Schwachen, Hilfsbedürftigen, Abhängigen zu helfen, wobei auch das angenehme Gefühl der eigenen Überlegenheit, der Stärke und Grösse gestillt wird. In dieser Zeit schien es möglich, in einem Bunker drei bis vier Personen zusätzlich ohne grössere Schwierigkeiten ernähren und versorgen zu können. Man dachte auch, dass es nicht zu lang dauern würde, bis die russische Armee kommen und uns befreien würde. Aber eben, wir, ähnlich den Aufständischen im Warschauer Ghetto, waren Opfer der Taktik und Strategie der Grossmächte. So zögerten und warteten unsere Befreier mit ihrer Offensive und ihrem Fortschreiten durch die Slowakei. Selbstverständlich entschädigten wir unsere Hüter für ihre Bereitschaft, uns aufzunehmen. Bei jedem Einkauf, bei jeder Besorgung verteilte sich die finanzielle Last damit auf mehrere Personen. In der Natur der Umstände lag es, dass sich die Zivilisten eher mehr daran beteiligten. Für die Soldaten war es mindestens angenehm, dass die Frauen kochten und sich um die Hausaufgaben kümmerten. Begreiflich, dass man sich diese gewissen Vorteile nicht entgehen lassen wollte. Es gab kaum einen Bunker, in dem nicht eine Familie Zuflucht fand. Die Einwohner unseres Bunkers konnten nicht ahnen, was für eine gute Köchin sie in meiner Mutter ergattert hatten. Vermutlich aber erwähnte es mein Vater, als er über unsere Aufnahme verhandelte. Sie konnte aber ihre Künste durch die Bescheidenheit der vorhandenen Ressourcen nicht voll entfalten. Es war aber umso wichtiger (und schwieriger), gut und schmackhaft zu kochen. Unsere Anwesenheit machte ihnen das Leben bunter, vielseitiger, erträglicher. Nur schon ein Kind dabei zu haben, brachte sie etwas näher zu einem „normalen“ Leben. Eigentlich waren wir eine Mischung aus Hausdiener und Haustieren. Problematischer konnte es für die jungen Männer zwischen zwanzig und dreissig werden, so eng (und so lange) in einem kleinen Raum mit einer Frau - auch wenn sie schon um die vierzig war - zu leben und zu schlafen. Ich glaube, wir hörten nie von Übergriffen und ähnlichen Problemen in Bunkern. Bewundernswert beherrschten sich die jungen Menschen, auch aus Angst vor Strafen seitens der Vorgesetzten. Disziplin musste herrschen, sonst konnte man in einem Bunker nicht gut zusammenleben, mit oder ohne einer Frau. Verwilderte Menschen, noch dazu mit Waffen, sind immer und für jeden gefährlich.
Bald kam der Tag, an dem wir uns von denjenigen verabschiedeten, die noch in der Bergbauhütte geblieben waren. Diejenigen, die bis dahin keinen Bunker für sich gefunden hatten, beneideten uns. Wir hofften alle, dass wir, wo und wie auch, den Krieg überleben. Wir konnten in unseren bereits vollgepackten Rucksäcken nicht alles mitnehmen. Gottlob kamen aus dem Bunker zwei Soldaten mit ihren Rucksäcken, um von uns noch eine Kiste mit Bettwäsche sowie Kleidern und eine mit Geschirr mitzunehmen. Dieses Entgegenkommen war ein gutes Zeichen. Unsicher, was uns alles erwartete, brachen wir in eine allem Anschein nach sicherere Bleibe und hoffentlich bessere Zukunft auf. Die Deutschen kamen nie bis zur Bergbauhütte. Eigentlich konnten wir uns den Bunker, wie Picklers ersparen.
.
(1) Vajskova Tal; Irgendwo rechts war der Abgang in den Bunker. Mit Tochter Corinne (Fotos) suchten wir vergebens seinen Platz.
Der Bunker wurde von den Soldaten an die Südwestwand eines grossen Felsens aus Baumstämmen trotz der Eile solide gebaut, da mindestens einer der mehr als zehn Soldaten Schreiner oder Zimmermann war. Ungefähr zwanzig bis dreissig Meter schräg nach oben war der Zugang zu einem kleinen Bach, der aber immer Wasser hatte: Gutes, sauberes Trinkwasser. Der kommandierende Offizier war ein Tscheche, der Unteroffizier, mit dem mein Vater die Verbindung anbändelte, war ein Rhutene aus dem östlichen Teil der Ukraine (der vor dem Krieg zur Tschechoslowakei gehörte) wie auch seine Soldaten, mit Ausnahme eines Slowaken. Sie waren einfache Bergbauernburschen. Die Räume zwischen den Balken wurden mit kleinen Ästen, Moos und Sägemehl abgedichtet. Von aussen wurde zuerst ein Zeltstoff gespannt, vor dem noch eine Schicht von Brennholz lag; die Reihe wurde immer erneuert, damit das Holz für den Ofen einigermassen trocken war. Der Zeltstoff war selbstverständlich nicht so dicht und leicht wie jetzt. Es waren Dreiecke aus wasserabstossendem dickerem Stoff, die man als Pelerinen benützte, aber auch zu grösseren Flächen binden konnte. Der Boden wurde auch mit Ästen belegt, die Lage des Bunkers fachmännisch gewählt: Man brauchte nur drei Seiten zu bauen, der Fels schützte vor dem oft kalten Nordwind und damit hatte der Ofen, beziehungsweise der einfache, improvisierte Kochherd, einen ungestörten Abzug, sodass sich der Bunker nur selten, wenn man schlecht heizte, in eine Rauchkammer verwandelte. Die Soldaten schliefen in einer Reihe auf einer Pritsche an der länglichen Wand, zuerst bei dem Eingang der Offizier, dann der Unteroffizier, anschliessend dem Rang nach die Soldaten. Der Bunker hatte sogar einen Windfang – der Eingang war vom restlichen Raum durch eine Wand und einen gespannten Zeltstoff abgetrennt. Was für ein Luxus, der die wertvolle Wärme bei so vielen ein- und ausgehenden Leuten wirksam schonte. Man überlegte sich jeweils bevor man hinausging, was man alles erledigen und mitnehmen konnte. Es stört mich sehr, dass mir diese gute Art von geistiger Sparsamkeit und Zweckmässigkeit, die mir damalige Umstände aufzwangen, durch altersbedingtes Nachlassen des Gedächtnisses oft abhanden kommt, so dass ich mehrmals kehrtmachen muss, um alles was ich brauche oder erledigen möchte, zusammen zu haben. An der Felswand blieb noch genug Raum für das für uns gebaute Kajütenbett, da das schräge Dach dort am höchsten war. Unten schlief mein Vater, oben meine Mutter zusammen mit mir, sie am Rande, damit ich nachts nicht herausfallen konnte, ich an der Felswand, die nur mit Zeltstoff bedeckt war. Meine Mutter lebte in ständiger Angst, dass sich dort meine Nieren entzünden oder ich unheilbare Rückenschmerzen bekommen könnte und zog mich dauernd von der Wand weg. Mit Erfolg – die Nieren sind immer noch gut und die Rückenschmerzen, die ich viel später kriegte, hatten eindeutig einen anderen Ursprung. Merkwürdig genug, auch wenn ich zu Hause immer wieder krank war und die Hälfte des ersten Schuljahres versäumte, im Bunker blieb ich die ganze Zeit gesund, so wie alle Bewohner des Bunkers. Alle schliefen wir auf den Strohsäcken, die wir auch aus der Bergbauhütte mitnehmen mussten. Hier waren sie dann nicht mit Stroh, sondern mit Heu und trockenen Blättern gefüllt.
Der Kommandant unserer Soldaten war Oberstleutnant Janku, ein blonder, heiterer, besonnener, gebildeter, offener, aber resoluter Mann, der auf die Stimmung und Meinung der anderen hörte, sich mit seinem Vertreter, Korporal Petruschka, immer beriet und ihm viel Führung überliess. Sowohl er als Person wie seine Entscheidungen wurden akzeptiert und ohne Widerspruch und Widerstand erfüllt. Petruschka war ein schlauer, geschickter Mensch, dem es Spass machte, in aussergewöhnliche Situationen zu geraten, sie erfolgreich zu lösen, sowie sich leicht mit Menschen anzufreunden, die ihn dann bewunderten und liebten. Er ging jeweils ins Dorf und trieb auf, was ein anderer nie bekommen hätte. Zu Beginn wurde er von anderen begleitet, damit er die Ware nicht allein hinauf tragen musste, aber das störte seinen Aufenthalt, umso mehr, als er, wie war es anders möglich, im Dorf eine Freundin hatte, mit der er ohne Beschränkung seitens seiner Kameraden die Zeit verbringen wollte. Es reichte schon, wenn er vor den deutschen Patrouillen, die ab und zu unerwartet nach Dolna Lehota zur Kontrolle kamen, frühzeitig aus dem Liebesnest flüchten musste. Manchmal war es zu spät, und so wartete er im Versteck, bis sie wieder abzogen. Mit der Zeit wurde er dreister, und während die Deutschen in der Stube weilten, wartete er nebenan im Schlafzimmer, weil er sich nicht rechtzeitig auf den Estrich oder in den Stall bemüht hatte. Ihm konnte man es zumuten und glauben. Dass er nicht mehrere Freundinnen hatte, dann nur aus Vorsicht, weil ihn eine von ihnen aus Eifersucht den Deutschen hätte verraten können. Damit der kostbare Vorrat, den er zusammengetragen hatte, nicht leiden musste, sorgte Petruschka für Helfer aus dem Dorf, die die Ware bis an den Rand des Waldes brachten. Dort versteckten sie sie gründlich vor allem vor den Tieren, weil es anfangs passierte, dass etwas bereits angeknabbert worden war. Jemand aus dem Bunker ging sie baldmöglichst holen. Bei diesem System wurde Petruschka unabhängiger und freier.
Dank Petruschka und selbstverständlich speziell wegen der Lieferungen der Dorfbewohner lebten wir nun verhältnismässig in Saus und Braus, wie es uns später schmerzhaft bewusst wurde. Zu unserem Wohl trug eines schönen Tages auch die Jagdfertigkeit eines Soldaten bei, der eben unterhalb des Bunkers Wache hielt (darüber später noch mehr). Plötzlich erblickte er anstatt der Deutschen ein Reh. Er erlegte es mit zwei Schüssen und kam uns holen. Wir sahen zwanzig bis dreissig Meter weit Blutspuren, so weit sprang das angeschossene Reh noch und lag mit seinen offenen schönen Augen reglos in einer Blutlache. Selbstverständlich packte mich wieder das Mitleid wie mit dem armen Schwein bei Cuneks „Metzgete“ vor ungefähr einem Jahr. Ich begann zu weinen, auch wenn ich mich vor den harten Soldaten sehr dafür schämte. Obwohl man mir erklärte, was für ein Glück und Segen das für uns war, da wir nun für eine Weile genug von wertvollem Fleisch hatten, konnte ich mich nicht beherrschen. Ich wurde mit meiner Mutter in den Bunker geschickt. Ich sah noch, wie sie das Reh auf dafür frisch abgesägten Tannenästen zum Bunker schleppten. Jetzt konnte meine Mutter ihre Kochkünste voll entfalten. Jedes essbare Stück vom Reh wurde auf möglichst verschiedene Weise zubereitet. Zuerst assen wir die Innereien. Das Fleisch wurde gebeizt und noch lange Zeit genossen. Kaum wäre dies ohne meine Mutter möglich gewesen.
Fliehen

Es war ein herrlicher Januartag wie er nur in den Bergen - und jetzt auf den Ansichtskarten, die damals nicht so perfekt und nur schwarz-weiss zu haben waren - vorkommen kann. Der Himmel war wolkenlos blau, die Sonne schien schon so stark, sodass der Schnee auf der ihr zugewandten Seite der Bäume und des Daches unseres Bunkers zu tauen begann. Es schien, als würde es ein vergnügter Arbeitstag. Manche unserer Soldaten sägten und hackten Holz, damit wir genug zum Kochen und Heizen hatten, andere kochten in einem grossen Kessel draussen neben dem Bunker die Wäsche wegen der Läuse aus und hängten sie an die Leinen zwischen den Bäumen. Die Läuse waren nicht nur unangenehm, nebst den Deutschen auch ein gefährlicher Feind. Mein Vater warnte uns, dass sie im Ersten Weltkrieg wegen der Übertragung des Flecktyphus mehr Soldaten töteten als die Waffen. Wir wussten nicht, dass die gegenwärtigen Läuse hygienischer und anständiger geworden waren und nur kleine Epidemien des Flecktyphus vor allem in Konzentrationslagern verursachten. Meine Mutter nützte die Sonnenwärme und kämmte meine nach der seltenen Wäsche noch etwas feuchten Haare mit einem speziellen Kamm - mit engen Räumen zwischen den Zacken - durch und säuberte ihn dann sorgfältig von den Haarläusen, die harmloser waren als die Kleiderläuse, da sie keinen Flecktyphus verbreiteten und ihre Bisse nur unangenehm juckten. Sie warf die Nissen in den Schnee. Langsam entstand dort deshalb ein kleiner gelblich brauner Fleck (gelb wegen der Eier, braun wegen der reifen Läuse), den wir am Ende mit Schnee bedeckten. Wir standen genug weit vom Bunker entfernt, damit die Läuse nicht irgendwie wieder in den Bunker zurückkehren konnten. Wir wähnten uns in Sicherheit, umso mehr, als zwei Tage vorher die Deutschen mit zwei kleinen Panzerwagen bis auf Dve Vody vorgedrungen waren, es aber nicht wagten, weiter zu gehen und kehrten um. 
(1) Bach in Vajskova dolina; Foto mit Dank von Filip Majercik, www.dolnalehota.sk/okolie/ Die Quelle des Fotos ohne Schutzwarnung um Copyright angefragt, keine Antwort erhalten.
Dve Vody („Zwei Wasser“) ist die Stelle, wo die zwei Hauptbäche vom „Vajskova Tal“ zusammenfliessen, einer aus dem kleineren Nebental mit unserer Bergbauhütte, von der wir wegen der besseren Sicherheit in den Bunker weggezogen waren, der andere aus dem Haupttal. Nach ungefähr einem Kilometer im Haupttal bog man dort rechts in den Hang zu unserem Bunker. Wenn wir zur Talstrasse und von dort zurück gingen, mussten wir unsere Spuren im Schnee sorgfältig verwischen, damit uns nicht nur der Feind nicht finden konnte, aber auch der Freund nicht wusste, wohin der Weg zu uns führte, damit er, falls gefangen und gefoltert, uns nicht verraten konnte. Etwas aufwärts war eine Brücke und oberhalb ein gerades Stück Strasse, wo ich, wenn die Lage besonders sicher war, auf dem Eis rutschen durfte, falls unser Offizier es ausdrücklich bewilligte. Ich hatte selbstverständlich keine Skis oder Schlittschuhe, keinen Schlitten oder Plastikbob; Plastiksäcke kannte man damals nicht. Aber ich war froh und glücklich, dass ich, wenn auch nur kurz, nicht nur um den Bunker schleichen konnte und stellte mir vor, wie schön es nach dem Krieg sein würde, wenn ich in Martin wieder auf dem Schlitten die Hänge runtersausen könnte, wo und wie lange ich möchte.
Gleich unterhalb des Zusammenflusses der zwei Bäche stand auf Dve Vody („Zwei Wasser“) ein einfaches Holzhaus für Holzhacker. Jetzt diente es als Unterkunft für die Wachen, die sich dort jeden Tag nach einem genauen Plan abwechselten. Jeder Bunker schickte dort seine Vertreter hin, Soldaten, aber auch Zivilisten. Auch mein Vater musste dorthin, wo er manchmal Onkel Laco Strelinger oder jemanden aus seinem Bunker, wie auch manche Bekannte aus anderen Bunkern traf. So wussten wir, wie es ihnen geht, wie es mit ihnen steht. Für das „Gesellschaftsleben“ mit gegenseitigen Besuchen hätten wir zwar Zeit, aber die Umstände waren dafür alles andere als günstig, schon aus Gründen, die ich erwähnte. Meine Mutter musste sich auch diesbezüglich vollständig einschränken. Wir waren luftlinienmässig vielleicht nicht einmal einen Kilometer von Strelingers entfernt, in Wirklichkeit waren sie aber unerreichbar. Zwei bis drei hundert Meter unterhalb Dve Vody („Zwei Wasser“) war eine ganz enge Stelle mit einem grossen Felsbrocken, wo jeweils für drei Stunden zwei gut ausgerüstete Soldaten mit Handgranaten und Kalaschnikows postiert waren. Für mehr war dort kein Platz. Man konnte diese Stelle nicht verminen, weil man da ins Dorf ging und der Weg für die Wagen, die je nach Situation für uns alle die Nahrungsmittel und andere lebenswichtige Sachen brachten, durchgängig bleiben musste. Man konnte von dem Punkt vielleicht zwei-dreihundert Meter tief ins Tal blicken. Diese Wache sollte vor den eindringenden Deutschen warnen und sie, wenn nicht wegjagen, so wenigstens aufhalten, damit sich diejenigen in der Hütte auf den Kampf vorbereiten konnten. Zwei Tage vorher war es so weit. Weder mein Vater, und ich glaube auch niemand sonst aus unserem Bunker hatte, Gott sei Dank, an dem Tag dort Dienst. Als die Wache auf dem Felsen die heranrückenden Panzer, mit denen man nie gerechnet hatte, erblickte, lief einer in die Hütte, um die anderen zu warnen und zu mobilisieren. Der Verbliebene versuchte die Panzer aufzuhalten. Vergebens. Wie durch ein Wunder gelang es ihm zu fliehen. Gegen Panzer war auch die Wache auf Dve Vodny nicht ausgerüstet und machtlos, und so flohen sie alle. Die Deutschen zündeten die Hütte an, die ganz ausbrannte und kehrten dann um.
Wir dachten, das reiche ihnen und unser Bunker sei, wie sich eben zeigte, ausser ihrer Reichweite. Auf der anderen Seite, ermutigt, könnten sie verstärkt wieder erscheinen. Unsere Soldaten hielten bei einer unklaren Situation sicherheitshalber schon am Tag Wache. Sie wechselten sich an einer verdeckten Stelle am Rande unseres eher ebenen Waldstückes Richtung Tal ab, von wo sie gut sehen konnten, wenn sich uns jemand nähern würde. An diesem schönen, gemütlichen Vormittag rannte plötzlich die Wache, es war unser einziger Slowake, zu uns und rief aufgeregt: „Die Deutschen kommen, die Deutschen kommen!“ Sofort unterbrachen wir unsere vergnüglichen Tätigkeiten. Die Soldaten rüsteten sich schnell und rannten auf ihre für solche Situationen vorgegebenen Posten, um die Eindringlinge wegzujagen. Nur unser Slowake floh zu unserem Glück den Berg hinauf, und wir folgten ihm mit unseren immer bereiten Rucksäcken. In dieser Richtung waren weder ein Weg noch Spuren. Es war ein harter Winter mit viel Pulverschnee, ohne Tauwetter, das eine härtere Unterlage und einen festeren Schnee bereitet hätte. So sank er nicht nur bei jedem, sondern auch vor jedem weiteren Schritt noch ein Stück tiefer ein, was unheimlich ermüdend war. Nach einer Weile wechselte er sich mit meinem Vater ab. Ich lief hinter ihnen und am Ende kam Mutter, die mir wenn nötig half. Manchmal waren die Spuren der Vordermänner für meine kurzen Beine zu weit auseinander und ich musste einen Schritt in den tiefen Schnee setzten, aus dem ich fast nicht mehr raus kam. Es ging um unser Leben, und ich wollte nicht, dass uns wegen meiner Schwäche die Deutschen fangen würden. Besonders schwierig waren die Stellen, wo der Wind noch eine dicke Schicht von Schnee hinwehte. Aber wir konnten sie wie auch die sehr steilen Stellen nicht umgehen. Wir befürchteten, die Deutschen würden uns folgen. Nach einer Weile wurden auch die Männer müde und erschöpft. Sie setzten sich nahe Teilziele, wie die grosse Tanne vorne, dann der Felsen usw. und legten dort Pausen ein, was mir nicht allzu viel half, weil, wenn ich sie einholte, gingen sie sofort weiter. Die Schneekristalle auf der Oberfläche glänzten und die Sonne blendete uns. Sonnenbrillen gab es im Bunker keine. Nach ungefähr anderthalb Stunden, oben vom Schweiss, unten vom Schnee durchnässt und völlig kaputt, kamen wir auf einem flacheren Stück des Waldes an. In der Mitte stand ein einsamer, riesiger, steiler Felsbrocken, den man aber von der uns abgewandten Seite besteigen konnte und der in der Mitte, einem Wehrturm ähnlich, eine fast quadratische Einwölbung hatte. Es schien, dass er Jahrhunderte wenn nicht Jahrtausende hier gerade auf uns gewartet hatte. Auf der Südseite, von der wir aufstiegen, ragte eine kleine Föhre heraus. Nachdem wir alle vier hinauf kletterten, begannen wir den Schnee zu stampfen, da wir keine Schaufeln hatten, um ihn wegzuschaffen. Unser Soldat wachte und wäre bereit gewesen, mit seiner Flinte die Deutschen zu erschiessen. Dann sagte meine Mutter, wir sollen frische Hemden nehmen, sonst würden wir uns erkälten, könnten auch eine Lungenentzündung bekommen und sterben. Die nassen Hemden hingen wir auf die Föhre zum Trocknen. Mutter packte auch unsere Hausschuhe aus, und wir mussten aus demselben Grund unsere nassen Schuhe ausziehen. Die Füsse waren bereits so eingefroren, dass wir sie und die Schmerzen nicht mehr spürten. Ich dachte, typisch meine Mutter, die sich um solche unwichtigen Kleinigkeiten kümmerte, als ob es nicht egal wäre, ob uns die Deutschen mit nassen, kalten oder trockenen, warmen Füssen kriegen und ermorden würden. Dann zog sie Brot aus dem Rucksack, beschmierte es mit damals rarem und wertvollem Schweineschmalz und begann uns zu füttern. Sie meinte vermutlich, es wäre schade, wenn es in die Hände der Deutschen geriete und die sich daran laben würden. Es war wie ein eigenes Totenmahl. Ich berührte die Reste meiner Schokoladentafel im Rucksack trotzdem immer noch nicht. Merkwürdig genug, durch diese scheinbar sinnlose Tätigkeit und durch die immer längere Zeit, die wir noch am Leben waren, beruhigte ich mich und glaubte immer mehr, die Deutschen würden nicht kommen: sie wären zu faul, diese Strapaze wegen uns auf sich zu nehmen. Als wir trockene und warme Füsse hatten, ruhiger und zuverlässiger wurden, meldete der Soldat aufgeregt, dass jemand unseren Spuren folgen würde und lud die Flinte. Vater, ein alter kriegserfahrener k.u.k. Offizier, sagte ihm, er solle warten bis die Person näher komme; einerseits könne man sie besser treffen, andererseits sei es womöglich einer unserer Leute, der nach uns schaute. Er solle auch nicht alle Patronen verbrauchen, sondern für uns die letzten fünf behalten – genau mein Vater, der aus Sicherheit auch jetzt an Reserve dachte, wenn eine der Patronen versagen sollte. Erleichtert und mit Riesenfreude sahen wir, dass sich uns ruhigen Schrittes, ohne Waffe, die Jacke über dem Arm, einer unserer Soldaten näherte. Als wir uns überzeugt hatten, dass er nicht als Falle diente, riefen wir ihm laut zu. Er wartete, bis wir von unserem Felsen runter krochen. In den mühsam gestampften Spuren sprangen wir leicht den Weg zurück. Durch die steilsten Teile rutschten wir mit einem Stock zwischen den Beinen, wie man es vor der Entdeckung der Skier tat. Wir waren in etwa einer Viertelstunde zurück beim Bunker. Das Mittagessen wartete schon auf uns. Wir liessen unsere nassen Kleider und die schweren Schuhe, „Baganzen“, an der weiter und
noch stärker strahlenden Sonne trocknen.
(2) Felsen in der Umgebung vom Bunker, Foto: Tochter Corinne.
Unsere slowakische Wache hörte Schüsse, die wir nahe beim Bunker nicht vernehmen konnten. Das lodernde Feuer, das die Deutschen bei dem Überfall auf „Zwei Wassern“ gelegt hatten, erreichte irgendeine Munition, die die fliehenden Männer hinterlassen mussten. Von den Deutschen keine Spur. Eigentlich sollte unser Begleiter wegen Fahnenflucht bestraft werden. Der Offizier und die anderen nahmen es eher mit Humor, aber das Ansehen des Soldaten war angekratzt. Ich denke, uns nahmen sie nicht übel, dass wir ihrer Verteidigung nicht ganz trauten. Wir haben ihn nach dem Krieg nie mehr getroffen, auch wenn er aus einem Dorf nicht weit weg von Martin kam. Wir wollten uns gegenseitig nicht an die schwierige Zeit, die Erniedrigungen und Peinlichkeiten erinnern. Hauptsache, wir waren wieder einmal davongekommen.
Die Geschichte hatte ein trauriges Nachspiel. Nach dem Krieg baute man auf Dve Vody ein neues Holzhaus, aber neu oberhalb und nicht wie ursprünglich unterhalb des Zusammenflusses der zwei Bäche. Wollte man aus Aberglaube nicht mehr an derselben Stelle bauen? 1956 ging dort eine riesige Schneelawine runter, zerstörte das Haus und begrub 19 Menschen, Holzarbeiter, unter sich. Drei davon überlebten. Die Stelle, wo die alte Hütte stand, erreichte sie aber nicht. Manchmal entscheiden scheinbare Kleinigkeiten über Leben und Tod.

(3) Dve vody - Denkmal für die Lawinenopfer; Mit Dank aus AjDnes.sk.
Flehen

Zu unserer grossen Freude näherte sich die Front endlich unserer Gegend und wir hofften, bald befreit zu werden. Wir wussten nicht, dass die Landschaft nicht nur zum Verstecken hervorragend geeignet ist, aber leider auch zum Bauen einer Abwehrkette. Ausgerechnet unterhalb von uns, zwischen den zwei Dörfern, Horna und Dolna Lehota, wurden von Deutschen Gräben ausgehoben, und die Front kam für Wochen zum Stehen. Niemand wusste für wie lange. Wir wurden vom Nachschub aus dem Dorf abgeschnitten und hatten immer weniger Vorräte. Die Portionen wurden kleiner und kleiner. Zuletzt hatten wir kaum mehr als ein paar wenige trockene Erbsen in einem Sack. Wenn wir sie mit Mutter säuberten, zuerst für einen Brei, später nur für eine dünne Suppe, konnte ich mich nicht beherrschen und nahm vielleicht drei bis vier einzeln in den Mund, um sie wie die besten Bonbons langsam auf der Zunge zergehen zu lassen. Sie schmeckten auch so. Bald meldete dies ein Soldat dem Offizier und meine Mutter wurde gemahnt, es mir nicht zu erlauben. Dann begannen wir die Erbsen für jeden abzuzählen. Die letzte Zahl war fünf. Die Luft wurde immer dicker, die Stimmung trüber und feindlicher. Eines Nachmittags wurde uns vom Offizier eröffnet, sie könnten uns nicht mehr haben, wir müssten weg, die Soldaten wollten es so. Es traf uns wie ein Schuss. Vater fragte, wohin wir gehen sollten, es sei doch klar ein Todesurteil für uns. Später bat er kniend vor ihnen, ihren Entscheid zu widerrufen. Er versprach ihnen eine grosszügige Entlöhnung, sobald er später dazu fähig sein werde. Es war eine jüdische Urszene. So baten unsere Vorfahren bei Verfolgungen und Pogromen ihre Verfolger und Peiniger um Gnade. Ich verfolgte es von oben, von meiner Pritsche aus, schämte mich für den schwachen, erniedrigten, unwürdigen Vater, bedauerte ihn, schätzte, was er für uns zu tun imstande war und hasste unsere gnadenlosen, schwachen und feigen Mitbewohner. Vater erreichte mit seinen Bitten und seinem Flehen, dass die Soldaten ihre Entscheidung nochmals überlegten. Wir mussten den Bunker verlassen und draussen warten. Ich betete, aber stellte mir auch schon vor, wie wir unsere Rucksäcke nehmen mussten, weiter kam ich nicht. Wir wurden gerufen und der Offizier eröffnete uns, dass wir bleiben durften. Vielleicht hätten sie die Gnade nicht gehabt, wäre ich nicht dabei gewesen. Die Stimmung hellte sich auf, blieb aber gespannt. Vielleicht drei Tage später kamen wir wie durch ein Wunder irgendwie wieder zu Proviant. Gleichzeitig kam der Befehl, dass die Soldaten nicht weiter untätig warten sollten, sondern sich an den Flügel der Front auf die befreite Seite zu begeben hätten, um dort weiter zu kämpfen. Sie verabschiedeten sich von uns. Vater hielt sein Wort, traf nach dem Krieg Oberleutnant Janku und übergab ihm genug Geld, das er bestimmt, so wie wir ihn kannten, den anderen weiter verteilte.

(1) Umgebung vom Bunker, Foto: Tochter Corinne.
Das Leben im Bunker war hart. Ausser Wasser und Holz, die man aber auch vorbereiten und holen musste, herrschte Mangel an allem, man hatte äusserst sparsam mit was auch immer umzugehen. Beim Kochen und Heizen musste man Acht geben, dass das Feuer unter Kontrolle blieb und die Funken nicht den Bunker anzündeten. Wir gingen früh schlafen. Der Letzte legte in den Sparherd noch etwas Holz nach, aber ja nicht zuviel. Das Waschen war mühsam. Manchmal wuschen wir uns nur mit Schnee. Frische Wäsche wechselten wir, wenn auch manchmal durchgeschwitzt, nur jede Woche. Man musste das Wasser dafür erwärmen, was für so viele Personen nur im Turnus möglich war. Deswegen waren wir froh, wenn das Wetter schön war und man im Kessel draussen waschen und dort auch trocknen konnte. Licht hatten wir nur von Kerzen und vielleicht einer Öllampe. An Fenster kann ich mich nicht erinnern. Nach dem frühen Abendessen unterhielten wir uns. Petruschka berichtete seine Abenteuer, die Soldaten erinnerten sich an ihr Leben zu Hause und stellten sich vor, was sie nach dem Krieg tun würden. Zum Lesen hatte ich ein paar dünne Bücher ohne Deckel, da sie zu schwer zum Tragen gewesen wären, die ich eher bei Licht vormittags las. Meine Eltern waren mit Erzählen begreiflicherweise eher zurückhaltend, damit man ihnen nicht peinliche Fragen stellen konnte. Wir schliefen früh ein. Vorher mussten wir unsere Blasen entleeren, weil das nächtliche Wasserlösen in der Kälte unangenehm war, dazu störte man unter Umständen mindestens die Schlafnachbarn. Als Toilette diente ein einfaches Loch mit einem Balken, der aber für mich zu hoch war. Die Latrine war genug weit am anderen Ende des Bunkers auf der anderen Seite des Bächleins, aus dem wir Wasser genommen hatten. Mit einer Schaufel musste man die Scheisse mit Erde bedecken, von der man immer vorher einen Haufen bereitstellen musste, was zu den Aufgaben gehörte, die gerecht verteilt wurden. Die gefrorene Erde dafür vorzubereiten war nicht leicht. Mutter hatte für sich nicht weit weg eine kleine, gut geschützte Latrine. Diese Ordnung diente als Vorbeugung eventueller Infektionen. Wie auch, das Leben im Bunker, in diesem Loch, hatte nicht nur unser Leben gerettet, aber uns auch gestärkt und stolz gemacht, dass wir überlebten. Wahrscheinlich hätten meine Eltern in ihrem Alter die Emigration im August 1968 nicht gewagt ohne diese Erfahrungen. Trotz oder wegen dieser Erlebnisse habe ich Wälder und Berge sehr gern.

Wir waren jetzt auf unserer Seite, aber immer noch nicht in Sicherheit. Es erwartete uns ein langer Marsch auf der provisorischen Strasse unmittelbar vor den russischen Kanonen, sodass wir sehr achten mussten, dass sie uns beim Feuern nicht abschossen. Wir verabschiedeten uns von dem Soldaten und die Familien zerstreuten sich, je nach dem wie schnell oder wie langsam jemand gehen konnte. Ab und zu, zum Glück nicht so oft, kamen einige Schüsse von der Gegenseite zurück. Der Weg war gesäumt und manchmal unterbrochen von Kratern, selten sahen wir die Granaten nicht weit von uns einschlagen. Auf der Strasse, die von Schnee und Schneematsch bedeckt war, verkehrten kleine und grössere Wagen, die von mageren, kleinen Pferden gezogen wurden, die man mit unseren stattlichen, die wir in Martin lassen mussten, nicht vergleichen konnte. Sie transportierten Material und Menschen zur vielleicht einen Kilometer entfernten Front mit ihren Gräben und Bunkern, sowie von dort auch wieder zurück. Vergebens versuchten wir immer wieder, die Kutscher der leeren oder nur wenig beladenen Wagen dazu zu bringen, uns mitzunehmen. Wenn einer bereit war, war der Wagen noch vom Blut verschmiert oder sogar mit Leichen beladen, denen manchmal die Eingeweide heraus quollen oder die Glieder fehlten. Mutter weigerte sich jedoch einzusteigen. Zuerst packte mich sowohl Mitleid - wie mit dem Schwein bei der „Metzgete“ bei Cuneks oder mit dem Reh im Wald neben dem Bunker - wie auch Ekel. Mutter sagte mir jeweils, ich solle mich abwenden, aber mit diesem zurückgelegten Weg und den erlebten, spannenden, belastenden Erlebnissen wurde ich so müde und stumpf, dass mich weder die nahe eingeschlagenen Kanonenkugeln noch die Leichen störten. Was ich noch spürte waren Durst und Hunger, überlagert von den Schmerzen der Füsse. Wir marschierten auf diesem Weg schon mehr als 10 Stunden, und ich war noch nicht sieben! Je mehr wir uns Brezno, der nächsten Stadt, näherten, desto reger wurde der Verkehr. Wir sahen sogar ein bis zwei Lastwagen. Die Wahrscheinlichkeit stieg, dass wir ausser stumpfen, gleichgültigen, auch feinere, mitfühlendere „gute“ Menschen treffen würden. In der Tat, auf den letzten fünf bis sechs Kilometern nahm uns ein rumänischer Kutscher mit, mit dem sich Vater deutsch unterhalten konnte – es war ein Deutscher aus Siebenbürgen, der jetzt unter russischer Führung in der rumänischen Armee gegen die Deutschen kämpfte, kämpfen musste. Eigentlich fast alle Soldaten hier waren Rumänen.
In Brezno trafen wir spät ein. Wir suchten ein Hotel, das offen war. Zuerst wurden wir abgewiesen, nachdem Vater den Preis erhöhte, konnten wir noch mit einer anderen Familie in einem grösseren Zimmer übernachten. Nachdem meinem Vater die Uebelkeit im Verlauf des Tages verging, überfiel ihn, der nie besonders gern schwarzen Kaffee trank, der Wunsch, aus dem sich eine fixe Idee entwickelte, dass er zum Feiern der errungenen Freiheit einen schwarzen Kaffee trinken müsse. Und so begab er sich auf die Suche in den anderen Hotels und Gasthäusern, von denen es zum Glück in Brezno nicht viele gab, davon unter den entsprechenden Umständen die meisten geschlossen waren oder den höheren Offizieren als Unterkunft dienten. Er kam unverrichteter Dinge zurück. Mutter meinte, der eine von uns spinne vormittags, der andere abends. Für mich bekam sie von der Wirtin ein Glas Milch. Den Geschmack hatte ich schon Monate nicht mehr gekannt. Ich öffnete meinen Rucksack und ass den Rest meiner Schokolade auf.

Was sollte uns in Brezno halten, in einem teuren Nest, nicht weit von der gefährlichen Front, überfüllt von Soldaten, wo man nicht nur keinen schwarzen Kaffee bekommen konnte, sondern auch das Brot nur mit Schwierigkeiten. Und so suchte Vater eine schnelle Möglichkeit, nach Rimavska Sobota zu gelangen, das wieder zur Tschechoslowakei gehörte. Dort, in der fruchtbaren landwirtschaftlichen Gegend, gab es genug zum Essen, und genau dort praktizierte Onkel Laci in Hrachovo, wohin er flüchten musste. Nach dem Aufstand mussten sie sich in den nördlichen Bergen verstecken. Nach der Befreiung zogen sie in die nächste Stadt, Rimavska Sobota. Als Honorar bekam er Mehl, Zucker, Brot, Butter, Hühner, also alles, was wir schon lange nicht oder nur in homöopathischen Dosen für eine Menge Geld erhielten. Irgendwie bekamen wir diese Botschaft über das erreichbare Paradies. Vielleicht würde Vater dort endlich sogar seinen schwarzen Kaffee erhalten! Zwischen Brezno und Hnusta verkehrte der Zug noch nicht, da die Deutschen beim Rückzug sämtliche zahlreichen Bahnbrücken in dieser Bergregion zerstört hatten. Aber auf der Ebene zwischen Hnusta und Rimavska Sobota verkehrten die Züge wieder. Alle diese Informationen erhielten wir, bzw. Vater in Gesprächen mit einer Menge von Leuten. Es gab keine Zeitung, kein Telefon und auch der Dorffunk funktionierte noch nicht. Man musste reden, fragen, zu Menschen gelangen, die jemanden kannten, der dort war und Erfahrung hatte. Die Menschen waren jedoch entgegenkommend, meistens hilfsbereit, und dieses „Medium“ war zuverlässig. Es bestätigte sich, dass „die Information eine Macht ist“, und die Menschen fühlen sich gerne mächtig, stark, auf welche Art auch immer, wovon diese nicht die übelste war. Auf diese Weise fand Vater jemanden, der etwas nach Tisovec transportieren musste und bereit war, uns für gutes Geld mitzunehmen. Von dort fuhr bereits ein Zug weiter. Wir stiegen in den bedeckten Wagen ein, was wir schätzten, weil es kalt war und nieselte. So konnten wir die schöne Umgebung nicht bewundern, aber wir wollten so schnell wie möglich nach Rimavska Sobota. In Tisovec hörte der Nieselregen auf. Auf dem Bahnhof wartete schon eine Menge Leute. Selbstverständlich existierte noch kein Fahrplan. Man musste den Stationsvorsteher fragen, wann der Zug abfuhr. Aber zuviel durfte man ihn nicht mit Fragen belästigen, er hatte auch anderes zu tun. Natürlich nur gegen eine zusätzliche Bezahlung gab er uns noch Karten, auch wenn der Zug bereits überfüllt war. Nach einer langen Zeit, viel länger als der Stationsvorsteher angab, erschien der Zug. Glücklich pferchten wir uns rein. Es dauerte jedoch lange, bis der Zug abfuhr. Wir Männer mussten stehen. Ich konnte ab und zu auf den Knien meiner Mutter sitzen. Der Zug bewegte sich nur langsam vorwärts und blieb nicht nur lange an den Bahnstationen stehen, aber auch dazwischen. Nicht überall waren die Geleise schon in Ordnung, und man musste mit der Kohle sparsam umgehen und warten, bis der Dampfdruck im Kessel genug hoch war. Mit der fortgeschrittenen Zeit nutzten wir die Pausen für den kleinen und grossen Bedarf. Die Frauen auf der einen, die Männer auf der anderen Seite. Nicht zu denken, wie es auf den Transporten in die Konzentrationslager war. Als wir in Hrachovo hielten, wussten wir, dass wir nicht mehr weit hatten. Innert ein paar Stunden überwanden wir die ungefähr 40 km zwischen Tisovec und Rimavska Sobota, und spät abends erreichten wir unser Ziel.
Lacis wohnten in der vermutlich schönsten Wohnung in Rimavska Sobota. Sie war am besten Ort des rechteckigen Hauptplatzes. Auf dem Balkon des grossen Wohnzimmers, eher eines Salons, hielt man Festreden. Sie gehörte einem Advokaten, dem Führer der faschistischen Organisation, der vor der Roten Armee geflohen war. Dieser schöne Raum mit einer Stukkaturdecke wurde in ein Massenlager umgewandelt, worin gegen fünfzehn Menschen schliefen. Ohne grosse Probleme fanden auch wir dort Platz. Mutter benützte mit Tante Ella zusammen eines der Schlafzimmer. Die Einwohnerschaft des Salons wechselte. Länger weilte dort auch Ellas Onkel Bubo Klein, von dem ich bereits berichtete, mit seinem Sohn Arthur. Trotz seinem unermesslichen Geschick und seiner Gerissenheit gelang es ihm nicht, seine Frau zu retten. Arthur hatte irgendeine offene, entzündete und nicht heilende Wunde an einem Vorderarm. Ich denke, auch der Knochen war schon infiziert. Vor allem nachts schrie er vor Schmerzen. Meine Mutter konnte nicht zuschauen. Onkel Laci widmete sich mehr der Politik als der Praxis, aber sowieso gab es damals noch keine Antibiotika oder andere Medikamente dagegen, und so wurde er seinem schweren Leiden und Schicksal überlassen. Unter den vorübergehenden Gästen weilte damals auch ein rumänischer Arzt. Weiss Gott, wie solche völlig fremden Leute den Weg hierher fanden. Aber wir waren alle froh und glücklich, dass wir überlebt hatten. Mutter fragte ihn, ob er dem armen Knaben nicht helfen könne. Er riet Arthur, er solle die Fliegen nicht von der Wunde wegjagen und keine Angst haben, wenn bald kleine Larven aus der Wunde kriechen würden. Dazu solle er täglich alle paar Minuten die Sonne auf die Wunde scheinen lassen. In der Tat, bald zeigten sich die ersten Würmer, die sich samt den Fliegen an der Wunde labten. Zuerst hörte die Wunde auf zu eitern, dann wurde sie sauber und begann zu heilen. Heute, mit der Antibiotikaresistenz, kehren wir zurück zu dieser Methode. Inzwischen wissen wir auch, dass Vitamin D, das unter Sonnenbestrahlung entsteht, die Wundheilung unterstützt.

(1) Rimavska Sobota; in der Wohnung mit Balkon residierten Lacis. Aus www.e-obce.sk/obec/rimavskasobota/fotky/2052.html, e-mail Adresse zur Anfrage nicht eruierbar, das Bild wurde bereits für mehrere Zwecke im Internet verwendet.
Mutter übernahm das Kochen für die Familienangehörigen, aber auch die anderen bekamen etwas. Vielleicht beteiligten sie sich etwas an den Kosten, doch zum grossen Teil unterhielten Lacis dieses Gasthaus. Ihr Haus war schon immer offen, und sie waren grosszügige Gastgeber nicht nur gegenüber der Familie. So betreuten sie am Anfang des Krieges Kommunisten, die Laci und Miki in gefährliche Abenteuer und ins Gefängnis brachten, die aber in den 50-er Jahren während der Prozesse nichts von ihnen wissen wollten. Nach dem Krieg, schon wieder in Martin, weilte bei Lacis ein rothaariger russischer Arzt, der unterwegs nach Amerika war und bereits Wochen, wenn nicht Monate, auf die Bewilligung wartete. Er warnte vor Russen und Kommunismus und empfahl jedem Vernünftigen, dass er ihm folgen solle. Leider ohne oder mit spätem Erfolg.
Mein Leben in Rimavska Sobota war sehr schön, abwechslungsreich und interessant. Es war ein willkommener Gegensatz zur mehrmonatigen Einsamkeit und Beschränkung im Bunker, wo ich wie ein Tier in einem Käfig lebte. Wie immer hatte Vetter Jano bereits viele Freunde. Ganze Tage, nachdem die Schule begann, leider nur nachmittags, verbrachten wir mit ihnen und zogen durch die Stadt und die nähere Umgebung wie ein Rudel wilder Tiere. Am meisten interessierten uns Waffen, Patronen und andere Munition. So kurz nach dem die Front hier vorübergezogen war, fanden wir alles Mögliche in den zerstörten Häusern oder frei herumliegend auf den Wiesen und Feldern. Wir unterhielten uns damit, dass wir sie zur Explosion brachten. Schwierig und gefährlich war das Hantieren mit der Kanonenmunition und den nicht explodierten Minen. Diese Kunst beherrschte nur ein erfahrener, mutiger Meister, den wir dafür entsprechend bewunderten. Sogar Jano wagte es nicht, und er verbot es mir auch. Einmal hielt ich eine Gewehrpatrone nach der Zündung zu lang in der Hand und so explodierte die Zündkapsel und verbrannte mir die Mitte des Handtellers. Es dauerte lange, bis die Wunde heilte. Selbstverständlich verriet ich nicht wie sie entstand. Gott sei Dank passierte bei all diesen Handlungen kein grösserer Unfall.
(2) Duro und Jano umgefähr in der Zeit
Wir unterhielten uns auch damit, dass wir die russischen Soldaten mit ihren Freundinnen, meist Prostituierte, verfolgten. Es war ein schöner Frühling und so fehlten uns geeignete Objekte nicht. Entweder beobachteten wir sie, wenn sie sich schon in der Stadt zusammentaten, Jano war dafür ein besonders tüchtiger Fachmann, oder wir warteten an den Wegen ausserhalb der Stadt, die zu den Büschen oder anderen Verstecken führten. Dann verfolgten wir sie offen oder etwas versteckt, um dann überraschend aufzutauchen, wenn wir annahmen, dass sie mit ihrer Tätigkeit beginnen würden. Einmal drohte uns ein Offizier mit der Pistole, und so hörten wir mit diesem Spass lieber auf. Nicht lange nach unserer Ankunft begann leider die Schule. Mindestens die drei ersten Klassen waren zusammen in einem Zimmer, gut über einhundert Schüler. Viel konnten wir nicht lernen, aber ich erinnerte mich wieder an die Schrift. Ich las perfekt, im Rechnen war ich auch gut, sodass meine Probleme mit dem Schreiben sowohl die Lehrer wie auch meine Mitschüler überraschten, die nicht wussten, dass ich fast das ganze Schuljahr ohne Unterricht verbracht hatte. Mich überraschte auf der anderen Seite, als ich von einer nicht hässlichen Mitschülerin den ersten Liebesbrief erhielt. Sie bot sich an, mir beim Schreiben zu helfen. Ich begriff nicht, was sie an mir sah, an einem Menschen, der nicht einmal gut schreiben konnte, und vor allem wusste ich nicht, was ich mit ihr anfangen sollte. Auch Jano liess mich wissen, dass es sich für einen Knaben, der sich mit solchen ernsthaften Sachen wie mit einer Munitionsexplosion beschäftigte, nicht gehöre, sich mit Mädchen herumzuschlagen. Und so reagierte ich nicht.
Am Ende des Krieges lebten wir immer noch in Rimavska Sobota. Auf dem Platz vor und unter uns fand ein grosses, spontanes Fest statt. Man schoss in die Luft, aber für ein Feuerwerk fehlte es an Material. Wir wagten nicht, in Mitte so vieler Menschen unsere pyrotechnischen Künste zu demonstrieren. Vater war nicht mit uns, da er nach Martin gegangen war, das noch nicht so lange befreit wurde, um unsere Rückkehr zu organisieren. Als er zurückkam, schilderte er uns, was und wie er es dort fand. Er wollte dann mit uns beiden, Mutter und mir, alleine sprechen. Er eröffnete uns, dass Palko umgekommen sei. Uns beunruhigte schon lange, warum Palko sich noch nicht gemeldet hatte und fanden Ausreden, weil wir nicht an seinen Tod zu denken wagten. Vater wusste es aber schon lange. Er erfuhr es bereits bei der Wache auf "Dve vody", aber er wollte es uns nicht sagen, damit wir durch die Trauer nicht noch mehr geschwächt würden und unseren Widerstand und die Lust am Leben verloren hätten. Vater war ein starker Mann, dass er sich so beherrschen konnte und es so lange alleine ertrug.

Am Ende des Krieges lebten wir immer noch in Rimavska Sobota. Auf dem Platz vor und unter uns fand ein grosses, spontanes Fest statt. Man schoss in die Luft, aber für ein Feuerwerk fehlte es an Material. Wir wagten nicht, in Mitte so vieler Menschen unsere pyrotechnischen Künste zu demonstrieren. Vater war nicht mit uns, da er nach Martin gegangen war, das noch nicht so lange befreit wurde, um unsere Rückkehr zu organisieren. Als er zurückkehrte, schilderte er uns, was und wie er es dort fand. Er wollte dann mit uns beiden, Mutter und mir, alleine sprechen. Er eröffnete uns, dass Palko umgekommen sei. Uns beunruhigte schon lange, warum Palko sich noch nicht gemeldet hatte und fanden Ausreden, weil wir nicht an seinen Tod zu denken wagten. Vater wusste es aber schon lange. Er erfuhr es bereits bei der Wache auf „Dve vody“, aber er wollte es uns nicht sagen, damit wir durch die Trauer nicht noch mehr geschwächt würden und unseren Widerstand und die Lust am Leben verloren hätten. Vater war ein starker Mann, dass er sich so beherrschen konnte und es so lange alleine ertrug.
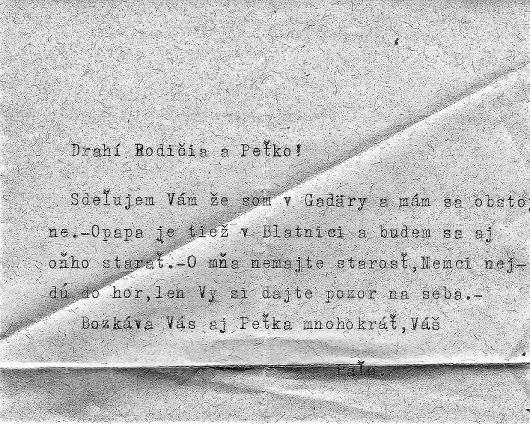
(1) Palkos letzter Brief
Liebe Eltern und Peterchen!
Ich teile Euch mit, dass ich im Gadertal bin und es mir einigermassen gut geht. Opapa ist auch in Blatnica und ich werde mich auch um ihn kümmern. Macht Euch keine Sorgen um uns. Deutsche gehen nicht in die Wälder, achtet nur auf Euch.
Ich Küsse Euch und Peterchen
Euer Palko
In seiner jugendlichen Unerfahrenheit und in seinem Idealismus schätzte er die Lage falsch ein. Die Deutschen kamen so weit und erschossen viele, auch Palko.
(2) Palkos Grab. Seine Überreste wurden eigentlich nie gefunden. Für den Vater war es eine grosse Kränkung. Auf Umwegen, beschaffte er aus dem Gemeinschaftsgrab der im Gadertal Gefallenen eine alters- und geschlechtsmässig ähnliche Leiche eines Unbekannten. Bei dem letzten Grabbesuch einigten wir uns mit Tochter Corinne, dass sie die neue Granitgrabtafel (rechts) an einem anderen Platz montierten, als die ursprüngliche Messingplatte (links), die gestohlen wurde. (Übrigens die Namenstafel von Henri Dunant, des Gründers vom Roten Kreuz ist auch nicht am richtigen Platz.) Die Grabsteine von Grossvater Josef Ekstein (s.Kap. 1.1. Geburt, Ahnen, Eltern) und von Palko spiegeln komplizierte, nicht nur persönliche Schicksale.
Ein paar Tage später kam aus Martin ein mit Zeltplanwagen bespannter Wagen mit zwei Pferden und dem Besitzer als Fuhrmann. Die Züge verkehrten zwar schon, auch zwischen Brezno und Banska Bystrica, aber in den Bergen zwischen Tisovec und Brezno und Banska Bystrica und Martin war die Bahn noch immer unterbrochen. So war es einfacher, die ganze Strecke mit dem Pferdewagen zu bewältigen. Ausser unseren Rucksäcken hatten wir eine Truhe. Am nächsten Morgen begaben wir uns auf den Weg. Fast bis Hnusta führte die Strasse durch Wiesen und Felder. Jetzt sahen wir, warum diese Umgebung so reich war und nie unter Nahrungsmittelmangel litt. Dann begannen Hügel und Berge. Im Unterschied zur Hinfahrt war jetzt ein schöner, warmer Frühlingstag. Wir bewunderten das enge Tal, auch wenn es nicht zwischen hohen Bergen lag. Beide Seiten waren zuerst von gemischten, nach Hnusta zunehmend nur mit Nadelbäumen bedeckt. Der Weg war schon besser, als wir vor Wochen in die umgekehrte Richtung fuhren. Teilweise führte er neben dem Fluss. Wir stiegen nur während den Pausen aus, wenn die Pferde und wir an besonders schönen Plätzen an Bächen oder am Fluss assen und tranken. Gegen Abend erreichten wir das breitere Pohronie mit den schmalen Feldern und grossen Wiesen. Bei Lopej, wo man nach Horna und Dolna Lehota abbog, kreuzten wir Gräben, die unseren Aufenthalt in den Bergen verlängerten und uns das Leben erschwerten. Wir hatten keine Lust, anzuhalten und die vier bis fünf Kilometer nach Dolna Lehota abzubiegen und bei unseren Dolnans vorbeizuschauen. Wir und auch unser Fuhrmann wollten nur so schnell wie möglich nach Hause, nach Martin. Als es dunkler wurde, übernachteten wir bei irgendwelchen Bauern, bei denen auch die Pferde im Stall schlafen konnten. Zum Frühstück gab es frische Milch und etwas zu essen, auch wenn wir noch Vorräte aus Rimavska Sobota hatten. Am nächsten Tag übernachteten wir nach Banska Bystrica vor dem Pass „Harmanec“. Als wir durch Banska Bystrica fuhren, erinnerten wir uns an Kaudls, die Familie von Mutters Cousine Ella, die die Deutschen in einem Dorf nicht weit von der Stadt fingen und ermordeten. Nie mehr werden wir sie im Haus am schönen Hauptplatz besuchen können. Die Strasse über Harmanec war damals noch nicht asphaltiert und war noch mehr vom Krieg beschädigt, als diejenige zwischen Tisovec und Brezno. Ab und zu sahen wir oder kreuzten noch zerstörte Brücken der Eisenbahn und die Portale in die Tunnels. Hier fuhren wir zwischen richtigen Bergen und nicht wie nach Hnusta zwischen „Hügeln“. Häufig mussten wir aussteigen, damit die Pferde die Hindernisse besser umgehen und wo die Strasse zu steil war, sie den Wagen leichter ziehen konnten. Eigentlich waren wir froh, denn dadurch hatten wir die Möglichkeit, unsere Glieder etwas zu strecken. Es herrschte weiterhin gutes Wetter. Die Wiesen waren voll von Blumen in verschiedenen Farben, die wenigen Laubbäume und auch die vielen Nadelbäume hatten eine frische hellgrüne Farbe. Hie und da, auf der Seite von Turiec, blühten nun immer mehr auch die Obstbäume. Der Frühling erwachte nicht nur, er siegte bereits. Nur ganz oben auf der Nordseite des Passes lagen noch Reste von Schnee. Die Geschwindigkeit der Pferde, die einen beladenen Wagen zogen, überschritt diejenige der Fussgänger nicht sehr und so konnten wir gründlich beobachten, spüren und diese Schönheit geniessen.
Es war nicht nur ein schöner, sorgloser Ausflug. Unterwegs durch Pohronie trafen wir immer wieder Pferde- und Ochsenwagen, die Menschen und Waren zwischen den Dörfern transportierten. Durch Harmanec fuhren wir weit und breit alleine. Wir hatten Angst vor „Vlasovcov“, Soldaten des ukrainischen Separatisten Generals Vlasov, der sich auf die deutsche Seite schlug, die sich hier in den Bergen verstecken konnten, wie auch irgendwelche vergessene deutsche Soldaten. Nicht nur wegen der Schönheiten beobachteten wir die Umgebung scharf, wir machten nur nötige Pausen und waren bemüht, dass die Pferde so schnell wie es ging vorwärts kamen. Mein Vater hatte einen Revolver, der Kutscher eine Flinte. Hätte es uns geholfen oder auch nicht?
In Gedanken und in Gesprächen beschäftigten wir uns immer wieder mit Palko und seinem Tod. Wir fühlten uns schuldig, dass wir nun ohne ihn die Freiheit und die schönen Seiten des Lebens geniessen konnten. Mein Vater erlebte mit uns wieder die Trauer und die Niedergeschlagenheit. Meine Eltern warfen sich vor, warum sie es nicht zu verhindern vermochten, dass Palko sich freiwillig in den Kampf meldete und ich, dass ich mit ihm stritt und nicht immer das tat, was er wollte. Aber die Schönheiten der Natur um uns herum, das Gefühl der Freiheit, die Freude am Überleben übertönten und unterbrachen unsere düsteren Gedanken. Je mehr wir uns Martin näherten, desto ungeduldiger und neugieriger wurden wir auf das, was uns erwartete, und wir freuten uns auf zu Hause. Am Ausgang aus Harmanec, vor Horna Stubna, sahen wir nicht nur die Umrisse der gut bekannten Berge, fühlten aber auch und spürten, ja rochen sogar, dass wir wieder in Turiec waren. Dieses besondere Gefühl, dieser seltsame friedliche Eindruck, dieses „Wohlen“ führten vermutlich auch unseren Urgrossvater Neumann und meinen Grossvater Langer dazu, dass sie sich hier niederliessen. Wie Grossvater Langer einmal, kamen wir hier auch mit dem Planwagen. Ohne Verfolgung und Kriege, könnte man hier gut leben.

(3) Turiec; slovakia.travel/narodny-park-velka-fatra. Die e-mail Adresse für die Bewilligung zur Veröffentlichung nicht eruierbar.
Unser Haus war leer und schmutzig, der Stall ohne Pferde. Meine zwei heiss geliebten Katzen landeten vermutlich in den Töpfen der hungrigen Soldaten. In der Mitte der Stube stand die leere beschädigte Truhe ohne meine Spielsachen. Neben ihr lagen zerfetzte Reste der Kinderzeitschrift „Slniecko“ (Die Sonne). Ein Wunder, dass sie nicht verheizt wurden. Aber keine Spur von meinen Büchern. Wo waren sie alle meine wunderschönen „Käfer“, die ich zum Geburtstag von Frau Fischer-Frolik erhielt, wo „Bambi“, „Budkacik a Dubkacik“, „Valibuk, Lomidrevo a Loktibrada“ und andere Schätze? Die Eltern trösteten mich, dass man Bücher wieder kaufen könne. Das Schwierigste, das Schlechteste aber war, dass Palko nie mehr mit uns und überhaupt da sein konnte. Für uns Geretteten, die dem Tod entkommen waren, begann ein neues Leben.
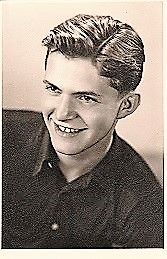

Mein Familienname verbirgt ungewöhnlich viel von der Familiengeschichte und von den Eigenschaften meiner Ahnen, somit auch von mir. Sie weist zwar weder wie Schmied, Köhler, Becker auf ihren Beruf hin, noch wie der Name eines slowakischen Aufklärers namens Stur auf ihren Charakter. Während der Emanzipationswelle des aufklärerischen österreichischen Kaisers Joseph II bekam einer meiner Vorahnen den deutsche Namen Eckstein. Kam dem kaiserlichen Beamten dieser Name in den Sinn, weil er Ecken und Kanten hatte oder konnte er sogar selbst wählen? Sehr emanzipatorisch dürften die „echt“ deutschen Namen in der Mitte der slawischen Bevölkerung nicht sein, aber die deutschsprachige Obrigkeit meinte im Rahmen des Zeitgeistes wahrscheinlich mit Recht, dass die Juden eher deutsch klingende Namen haben möchten. Sie hofften und bemühten sich sowieso, dass alle, nicht nur die Juden, deutschsprachig werden.

(1) Grossvaters Grabstein
Als ich mit (Tochter) Corinne auf dem kargen und kleinen Rest des jüdischen Friedhofs in Martin mit den noch wenigen, erhaltenen, alten, nunmehr liegenden Grabsteinen ausgerechnet denjenigen des Grossvaters erblickte, stand dort Josef Ekstein. Jemand von den Ahnen passte also den Namen Eckstein dem slawischen an und entschied sich für Ekstein. War es eventuell sogar der Namensgeber selbst? Wahrscheinlich wollte mein Vater seine deutschsprachigen Kunden mit so einem Frevel nicht verdriessen und änderte den Namen in den „richtigen“ Eckstein. Er ahnte nicht, dass es nicht seine letzte Änderung sein sollte, aber er bekam Übung in dieser Angelegenheit. Eckstein passte auch besser zu seinem Vornamen Armin.
Die nächste, nicht echte amtliche Namensänderung folgte, als wir von Martin mit gefälschten Dokumenten vor den Deutschen nach Dolna Lehota flüchteten. Wir nannten uns Cierny (Schwarz) und überlebten unter diesem Namen bis wir nach der Befreiung nach Rimavska Sobota kamen. Nach dem Krieg begann bei vielen Juden die nächste Emanzipationswelle. Nicht nur mein Vater wollte mit dem lebensgefährlichen Judentum nichts zu tun haben. Sie änderten ihre alten übertrieben deutschen Namen, die aber in der Schweiz bei Nichtjuden gängig sind (z.B. Grünenwald, Blum) in gut slowakische. Was wäre naheliegender, schon aus Dankbarkeit, wenn wir den Namen Cierny behalten hätten, der uns das Überleben erleichterte? Aber nein, mein Vater wollte nicht an die schwierigen Zeiten erinnert werden und noch wichtiger, der Name war nicht einfach, universell genug, da er den weich machenden Haken über dem C hatte. Man weiss nie was kommt, und wenn man schon ändert, dann gründlich, gut für alle Gelegenheiten, für alle Länder und alle gängigen Sprachen. Nach langer Suche entschieden sich die Eltern für den Namen Marko – kurz, in allen europäischen Sprachen bekannt und dazu in unserer Umgebung, in Turiec nicht üblich, sodass man sich Fragen nach Verwandten hier oder dort ersparen konnte. Meine Mitschüler nahmen es gelassen auf, und ich bekam merkwürdigerweise keine Probleme damit. Vermutlich wurde es meistens mit Genugtuung als Zeichen der Anpassung aufgenommen. Noch dazu besuchten wir ausser meinem Vater jeweils die Kirche. Sogar meine Cousine Zuzka, die mit ihren Eltern aus Amerika zurückgekehrt war, wurde auf Wunsch und Druck meiner Eltern getauft! Damit verlor auch sie unwiderruflich ihr religiöses Judentum.
Im Grossen und Ganzen erwiesen sich die Überlegungen meines Vaters als richtig. Nach der Emigration hatte ich weder in Deutschland, noch in der Schweiz oder bei den Reisen Schwierigkeiten mit dem Namen. Inzwischen leben hier viele Kroaten, die Marko heissen. Nur die Italiener und italienisch sprechenden Schweizer hätten lieber Marco. Die Deutschschweizer schliessen sich ihnen an und meinen, dass Marko eher der Vorname und Peter der Nachname sei. Wenn ich mich in der Praxis in Zweisimmen bei Telefongesprächen kurz „Marko, Zweisimmen“ meldete, passierte nicht selten, dass ich von der anderen Seite hörte „Guten Tag Herr Zweisimmen“. Nicht nur nach der Vorstellung, aber auch später sagten und schrieben mir viele „lieber Marco“.
Mein Vater ging mit den Namen ähnlich frei und zweckmässig um, wie mit der Religion (Kap). Es mag unwürdig und frivol scheinen, aber haben sie wirklich die Bedeutung, die ihnen viele zuschreiben? In unseren Kulturkreisen setzt sich die Einstellung meines Vaters immer mehr durch. Die Frauen können ihren Mädchennamen auch nach der Hochzeit beibehalten und umgekehrt, die Männer denjenigen der Frau übernehmen. Man kann sowohl seinen Namen wie seinen Vornamen ändern. Wir haben immer weniger Verständnis für das Töten im Namen der Religion, ob im Krieg oder durch Terror. Unsere Tochter behielt, für uns völlig überraschend, nach der Hochzeit den Namen Marko, auch wenn sie den Grundschweizer Namen Bischofberger wählen konnte. Sie nahm die für ihre Kinder komplizierte Situation in Kauf, dass sie anders heissen als ihre Mutter. Ob sich irgendwann einer der Nachkommen wieder für Marko entscheidet, erlebe ich nicht.
Mir ist es lebenswichtig, mich frei zu fühlen, von institutionellen Zwängen möglichst unabhängig zu sein, mich nach meinen inneren Bedürfnissen zu richten. Das bedeutet nicht, sich der Verantwortung zu entledigen. Der Freiheitsdrang führte mich in die Emigration einerseits, verunmöglichte mir aber die erfolgreich begonnene akademische Karriere anderseits. Die Lage mit mehreren Herkünften, Nationalitäten, Sprachen, Religionen, Kulturen entspricht mir inzwischen gut, ist meine zweite Haut geworden, in der ich mich wohl fühle. Wo ich bin, bemühe ich mich, und es gelingt mir, Wurzeln zu schlagen. Wenn ich zurückkehre, wo ich war, wo ich wohnte, lebte, treffe ich Freunde und Bekannte und erinnere mich an die gemeinsamen schönen alten Zeiten. In Abwandlung des Spruches: „Du hast so viele Leben wie Du Sprachen sprichst", kann ich sagen: „Ich hatte so viel Leben wie Wohnorte“. Kaum hätte ich es ausgehalten, immer an demselben Ort zu leben. Schon Cicero schrieb „Patria est, ubicumque est bene" = Heimat ist dort, wo man sich wohlfühlt.
Zwei Begebenheiten zeigen meine Lage. In einer Predigt sprach die protestantische Pfarrerin (eigentlich bin ich ein getaufter Lutheraner) über irgendeine biblische Geschichte. Ihre Auslegung schien mir nicht schlüssig. Ich rief sie an. Sie war überrascht, wieso es mich interessierte und wie ich dazu komme. Nicht umsonst heisse ich Peter – den Grund und meine jüdische Herkunft wagte ich (damals) nicht zu offenbaren. Ich wollte dazu auch die Meinung des nächsten Rabbiners hören. Als er mein Anliegen vernahm, fragte er mich, ob ich Jude sei. Als ich ihm sagte ja, aber getauft, beschied er, dass ich kein Jude mehr sei und verweigerte ein weiteres Gespräch. Er zeigte eine Härte, die offensichtlich alle Abtrünnigen trifft. Sie ist die Kehrseite des Verzichts des Judentums auf das Missionieren. Das bekannteste Beispiel ist Spinoza.
Dieser Lebenslauf ist mein erstes öffentliches Bekenntnis zu meinen jüdischen Wurzeln. Ich war es auch meinen Ahnen schuldig.


(1) Das Gasthaus der Grosseltern in Pribovce. Foto aus einer Ansichtskarte aus der damaligen Zeit (s. Kapitel 21: Familienversammlung in Pribovce über Identität). Pribovce hatte schon damals Ansichtskarten, und das Gasthaus von Grossvater musste auf einer davon abgebildet werden! Die Quelle des Fotos ist nicht mehr eruierbar.
1997 organisierte ich ein Treffen der Nachkommen von Urgrossvater Neumann aus USA, Irland, Schweden, Schweiz, Israel, Tschechien und Slowakei in unserem Ursprungsort Pribovce. Vergebens suchten wir das Gasthaus von Urgrossvater Neumann und Grossvater Langer – es existierte nicht mehr. Wir wohnten im Nachbardorf Benice und unternahmen Ausflüge in die schöne Umgebung. Einen Nachmittag widmeten wir uns dem Stammbaum der Familie, einen anderen unserer jüdischen Identität. Hier sind Beiträge von Tochter Corinne, Sohn Daniel, Ehefrau Silvia und mir. In dieser Reihenfolge wurden sie vorgetragen und diskutiert. Ich bitte den Leser, den familiären Rahmen zu berücksichtigen:

(2) Versammlung der Neumann-Familie 1997 im Bereich des alten Gasthauses in Pribovce
Corinne
Meine Identität als (Halb-) Jüdin entdeckte ich erst in der Pubertät als ich auf einem Foto des Grabsteins des Bruders von meinem Vater den Namen Pavol Eckstein las. Diese Entdeckung hat mich nicht erschüttert, wie meine Grossmutter und andere befürchteten. Umgekehrt, ich war sehr stolz darauf. Als ein Bücherwurm liebte ich schon immer Bücher über Juden. Mein grosser Wunsch war, eine jüdische Familie kennenzulernen. Was für eine Überraschung und ein Gefühl, dass ich in einer solchen schon immer lebte! Manche Eigenschaften schienen mir plötzlich bei uns als typisch jüdisch:
- unsere Kultivierung und Kultur von Diskussionen und Auseinandersetzungen über geistige (und häufig auch andere) Angelegenheiten
- ewige Einmischungen von Grosseltern und auch anderen Familienangehörigen in unsere familiären Angelegenheiten
- die Wichtigkeit der Kenntnisse.
Ich bin, wie bereits erwähnt, stolz auf meine jüdischen Wurzeln. Aber ich verstehe auch die Angst und die Befürchtungen meines Vaters. Mein Leben ist (Gott sei Dank) nicht beeinflusst und bestimmt durch seine Erlebnisse. Somit ist auch meine jüdische Identität anders als seine. Ich denke, dieser Aspekt kommt zur Rede in weiteren Beiträgen. Die eigenen persönlichen Erlebnisse, die eigene Identität beeinflussen auch die Beziehung zum Judentum. Beachten wir es auch in der folgenden Diskussion. Seien wir tolerant. Sonst ist ein typischer jüdischer Familienstreit vorprogrammiert. Und das wäre schade!

(3) Palkos Grab
Daniel
Ein Nichtjude in einer jüdischen Familie
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, über meine Beziehung zum Judentum und zu meinem Stiefvater als einem Juden zu sprechen. Er war es, der sich wünschte, dass ich bei dieser Versammlung über diesbezügliche Erfahrungen und Gefühle berichte.
Erst dachte ich aus guten Gründen, ich habe dazu nichts zu sagen. Das Thema, das mir Vater zuteilte, implizierte, über das Miteinander der zwei Kulturen zu reden. Schwierigkeiten können vorkommen, wenn die Regeln des täglichen Lebens, die Traditionen sehr unterschiedlich sind. Aber in unserer Familie wird nicht nach jüdischer Tradition gelebt.
Gehen wir einen Schritt zurück in meiner Geschichte, (wenn man bei einem 32-jährigen Menschen über Geschichte überhaupt sprechen kann). Ich war etwas über zwanzig als ich erfuhr, dass mein Vater ein Jude ist. (Als Corinne zwölfjährig war, schaute sie alte Familienfotos an. Sie fand dort eine Grabtafel mit den Namen Pavol Eckstein. Sie fragte die Grossmutter Starka, wer war das? Vaters Bruder Palko, antwortete sie. Wir sind aber Marko, oder? So war die Katze aus dem Sack.) Es war nicht die Tatsache, dass jemand aus der Familie jüdische Wurzeln hat, sondern, dass ich sie so spät erfahre, die mich überraschte. Warum sagten sie mir es nicht? Vielleicht waren die Erlebnisse noch zu schmerzhaft, um sie wieder hervorzurufen. Das war meine Erklärung für das lange Schweigen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich nicht interessierte, was meine Familie erlebte. Aber ich wagte nicht zu fragen. Weder meinen Vater noch seine Mutter, die wir nach slowakischer Art „Starka“ nannten, aus Angst, sie zu verletzen. Erst später erfuhr ich zufällig durch ein Missgeschick, dass sie schon lange mich und meine Schwester in dieses Geheimnis einweihen wollte. Aus verschiedenen Gründen wagte sie nicht, die Initiative dazu zu ergreifen.
Ein Nichtjude in einer jüdischen Familie – ohne Zweifel erweckt es schnell die Frage der Identität. Ich kann Folgendes dazu sagen: Als Kind verbrachte ich meine Ferien meistens bei meinen Grosseltern, den Eltern meiner Mutter. Ihr strenger Glaube hatte sicher einen gewissen Einfluss auf mich, aber rückblickend wuchs ich in einem sehr liberalen Umfeld auf. Diese grosszügige Einstellung führte dazu, dass ich eine offene Person geworden bin – offen zu anderen Kulturen und Mentalitäten.
Merkwürdig und paradox kam ich in Kontakt mit jüdischer Tradition nicht in der eigenen Familie, aber weit weg von zu Hause. Vor einigen Jahren verbrachte ich mehrere Wochen in einer jüdischen Familie in Neuseeland. Sie kamen aus Holland. Die ganze Familie befolgte strikt die religiösen Vorschriften und Zeremonien. Dort lernte ich den symbolischen Charakter der Schafsknochen, der hartgekochten Eier, des Meerrettichs, des Apfelmuses kennen. Auch wenn ich diese verschiedenen Rituale akzeptierte, wurde mir immer klarer, dass mir die Fähigkeit, nach strengen religiösen Vorschriften zu leben, fehlt. Nein, nicht gegen jüdische oder andere religiöse Traditionen hege ich meine starken Zweifel, sondern gegen ein Leben nur nach religiösen Einstellungen und Regeln.
Ein Nichtjude in einer jüdischen Familie – wir praktizieren nur die einzige Regel der jüdischen Tradition, die der scharfen Argumentation. Wir alle lieben inbrünstige Diskussionen über wichtige Fragen des Lebens. Oft diskutieren wir nur aus Spass, um unsere Denkfähigkeit zu schärfen.
Diese frühe Schule des Meinungsaustausches war Grundpfeiler meines Lebens als Student. Ich geniesse das Wortspiel, das Argumentieren als Provokation zur Diskussion, die Übung in die Rolle von „Advocatus diaboli“. Ich übe immer noch die Diskussion als Herausforderung zur Verteidigung der eigenen Meinung und gleichzeitig respektiere ich andere Ansichten. Es ist eine faszinierende Art zu einer klaren Denkweise ohne Verlust der Flexibilität und der Toleranz.
Die Kenntnis von den jüdischen Wurzeln meines Vaters setzte einiges in Bewegung bei mir: Ich verlor meine emotionelle Distanz zu den Schrecken des Holocausts. Bis dahin wusste ich darüber nur aus Büchern und Filmen. Es gehört zu den allgemeinen Wahrheiten, dass historische Ereignisse eine gewisse rationelle Distanz erzeugen, da sie nicht selbst erlebt wurden.
Als ich zwanzig war, erfuhr ich über Vaters Vergangenheit. Es schien sich bei mir nichts zu ändern. Aber über die Jahre, besonders in den letzten Tagen der Vorbereitung auf dieses Treffen, versuchte ich, Teile der Geschichte und der Welt mit dem Blick meiner Familie zu betrachten. Auch wenn ich das sehr Schmerzhafte in ihrem Leben nicht selbst erlebte, fühle ich mich noch näher zu ihnen und ihrer Vergangenheit. Die emotionelle Distanz ist weg.

(4) Oben erwähnte Ansichtskarte von Pribovce in ungarischer Sprache mit Langers Gasthaus als Sehenswürdigkeit
Silvia
Verheiratet mit einem Juden (und seinen Eltern)
Wir hörten bereits viel über Identität. Meine Identität gründet sich auf keine Religion. Deswegen hatte ich kein Problem, einen Juden zu heiraten. Ich hatte mehr Schwierigkeiten, als ich meinen ersten Mann, einen Protestanten heiratete. Ich war damals eine gute Katholikin. Meine Mutter wollte nicht zur Hochzeit kommen. Ein Pfarrer hatte es ihr verboten. Erst als ihr alle meine sieben Brüder den Krieg erklärten, kam sie. Nachdem ich beim Begräbnis meines Mannes hörte, es sei kein Wunder, dass er ein Opfer eines Unfalls geworden sei, weil eine Katholikin so einen protestantischen Heiden heiratete, änderte ich meine Einstellung nicht nur zu dieser Religion.
Wenn ich darüber sinniere, so hatte ich seit meiner frühen Kindheit Kontakt mit Juden. Eine jüdische Mutter mit zwei kleinen Kindern lebte mit uns während des Krieges. Die Juden scheinen meinen Weg zu kreuzen, wohin ich auch gehe, was ich auch tue. Von zehn Büchern, die ich lese, sind mindestens die Hälfte von jüdischen Autoren, ohne es zuerst zu ahnen. Als ich einen Job in einer Bank Namens Cifico in Zürich suchte, erfuhr ich erst im Gespräch mit dem Direktor, dass es eine jüdische Bank war. Normalerweise fragen die Arbeitgeber nicht nach der Religion, aber er wollte alles wissen über mich, was mich überraschte. Selbstverständlich schätzte ich dort die zusätzlichen freien Tage während der jüdischen Feiertage. Wenige Jahre später in Genf hatte ich im Büro eine jüdische Mitarbeiterin. Wir schreiben uns noch immer. Und als ich nach Zürich zurückkehrte, in wen verliebte ich mich – selbstverständlich in einen Juden namens Peter Marko. Zu Beginn wusste ich es nicht. Peter sagte mir es erst später, in dem er fragte, ob ich je einen Juden heiraten würde. Es überraschte mich genau gleich, wie als der Direktor mich über meine Religion ausfragte. Soweit ich sah, Peter war eine etwas spezielle Person, sonst hätte ich ihn später nicht geheiratet, aber nicht der Typ, der jeden Samstag die Synagoge besuchen möchte, oder am Freitagabend etwas zu tun, etwas zu berühren aufhört. Ich hätte Schwierigkeiten, mit so jemandem zusammen zu leben. Sonst habe ich allgemein nichts dagegen, jeder soll leben, wie es für ihn am besten ist.
Dass Peter ein Jude ist, war nie ein Problem für mich. In dieser Hinsicht hatte ich auch keine Probleme mit seinen Eltern. Leider haben sie die Gewohnheit, sich in alles einzumischen, was wir taten, was ich von zu Hause nicht gewohnt war. Ich dachte damals, es ist jüdisch. Zum Beispiel meine Eltern würden es nicht wagen, nach unseren Finanzen zu fragen, was Peters Eltern regelmässig taten. Als ich in unserer Arztpraxis Einsicht in das Leben mehrerer Leute bekam, sah ich jedoch, dass es, sogar nicht selten, auch in nichtjüdischen Familien geschieht.
Viele wundern sich, warum wir die Kinder über Peters Familiengeschichte nicht aufklärten. Hätte ich solche schreckliche Kriegserlebnisse, über die Peter oft träumt, ich würde nicht anders handeln. Unsere Kinder sollen in dieser Hinsicht so sorglos aufwachsen, wie es möglich ist, keine Sonderlinge, Outsider sein. Daniel hatte genug Belastung als Kind ohne Vater, den er mit drei Monaten verlor. Aber es war uns immer klar, dass wir es später tun. Es geschah dann aber natürlich und in einem guten Moment, wie beide bestätigen können.
Ein Jude zu sein oder nicht, ist für mich eine Frage der Religion. Auf dem Papier bin ich noch immer eine Katholikin. Ich wechselte nicht, ich trat aus der Kirche nicht aus. Würde ich es tun, jeder würde es akzeptieren. Ich kann nicht verstehen, warum ist es mit Juden nicht so. Jude zu sein ist nicht Frage der Hautfarbe. Ein schwarzer Mensch ist nicht ein weisser Mensch, und kann eine beliebige Religion haben. Niemanden stört es. (Hitler vergass, dass Jesus und seine Jünger Juden waren.) Man sollte toleranter werden, ob jemand gelb, schwarz oder weiss ist, welcher Religion er angehört. Hauptsache, er ist so glücklich. Ich bin glücklich, ich geriet in eine so interessante Familie, auch wenn es manchmal ziemlich anstrengend ist, mit Peter verheiratet zu sein.

(5) Von rechts Silvia, Daniel, Corinne und Peter bei ihren Reden in Benice
Peter
Jude zu sein – eine Belastung und Gefahr?
Meine Gross- und Urgrosseltern väterlicherseits lebten als einzige Juden in den Dörfern Sklabina und Drazkovce, nicht weit von hier. Ihre Kinder wuchsen zwischen christlichen Kindern auf, und selbstverständlich übernahmen sie dabei auch ihre Bräuche. Von manchen waren später die Langers nicht begeistert, zum Beispiel, wenn mein Vater mit seinen Freunden trank. Aber das trug nicht nur zu unserer Rettung, aber auch zu manch anderen Mitgliedern aus der Langer Familie bei.
Wir überlebten auch, weil wir 1942 getauft wurden. Es war von der christlichen Seite auch nicht selbstverständlich, da nicht alle Pfarrer dazu bereit waren. Zum Glück hatten wir in Martin einen anständigen, ehrlichen und ehrwürdigen Menschen als evangelischen Pfarrer, einen Gegner des Faschismus und des Rassismus, der uns gerne getauft hatte. Später, nach dem slowakischen Aufstand teilte er das Schicksal unseres Grossvaters und starb im Konzentrationslager Mauthausen (s. Kapitel 7: Taufe).
Seit meiner frühesten Kindheit war Judentum für mich mit Gefahr verbunden. Es schien mir noch dazu etwas von aussen Aufgezwungenes. Es hatte etwas Widerliches in sich. Wir verteidigten uns mit der Meinung und Behauptung, wir seien nicht anders und weniger wert als die Christen. Mein Bruder Palko wurde erschossen und vielleicht vorher gefoltert, weil sie bei ihm als Verwundetem ein kleines Stück Haut vermissten. Wie vorteilhaft und lebensrettend es war, das Judentum zu verlassen, sahen wir häufig. Zum Beispiel unsere Nachbarin war eine Jüdin, verheiratet mit einem Christen, was sie und ihre zwei Söhne rettete, während ihr Bruder samt Familie in Auschwitz endete. Nach dem Krieg wollten wir unsere Gleichheit beweisen. Wir wollten gleich leben wie die anderen. Wir wechselten den Namen, wir emigrierten nicht, und ich ging fleissig und gern in die Kirche, wo ich über das Judentum hörte und nicht in der Synagoge. Zu Hause lebten wir nach den christlichen Bräuchen und wenig nach den jüdischen. Bei dem Unterricht vor der Konfirmation war ich so eifrig, dass Pfarrer Cibulka hoffte, ich werde in seinen Spuren gehen. Während des „real existierenden Sozialismus“ wurde jegliche Religion unerwünscht und unterdrückt, und so verliessen viele die Kirchen, aber wir blieben. Mein Vater meinte, sie hat uns das Leben gerettet, als wir verfolgt wurden, jetzt werden sie verfolgt. Ich blieb dabei, und sowohl ich wie Silvia, auch wenn sie formell aus der katholischen Kirche schon wegen ihrer ersten Heirat mit einem echten Protestanten exkommuniziert wurde, zahlen die Kirchensteuer. Die Religion ist bei mir, kein Wunder, verbunden mit Vorteilen und Nachteilen und hat auch eine profane Seite.
Viele Menschen meinen, dass das Judentum nicht eine religiöse Angelegenheit sei. Man könne es nicht leicht ändern. Es gab immer Juden, die aus verschiedenen Gründen das Judentum zu verlassen versuchten. Manche Neumanns waren Sozialisten und Kommunisten, die meinten, es werde in der Welt keine Unterschiede und Diskriminierung mehr geben und die Religionen somit auch verschwinden. Ich kann mich nicht erinnern, ausser, wenn sie von ihren politischen Genossen verfolgt wurden, und es ihnen aufgezwungen wurde (Kapitel 21: Prozesse), dass das Judentum bei meinen kommunistischen Onkeln eine Rolle spielte. Ich glaube, auch ohne Hitler hätten wir uns assimiliert, nur etwas leichter und schmerzloser. Es ist kein glücklicher Zufall, dass ich, der die Verfolgung an der eigenen Haut erlebte, nicht begeistert bin, ein Jude zu sein. Judentum ist bei mir mit einer unangenehmen Vergangenheit verbunden. Mein Bruder ist heroisch gestorben. Kann man sich wundern, und betroffen sein, dass ich mich lösen will von etwas, worüber ich weiss, dass es war, ist und bleibt nicht nur unangenehm, aber auch gefährlich?
Vor dieser Versammlung waren wir in Pohronie, in der Gegend wo wir uns nach dem Slowakischen Aufstand versteckten. Ich ging auf den Wiesen, auf welchen ich mit den einheimischen Knaben die Kühe hütete. Einmal wollten sie, wie in dem Alter nicht unüblich, mit den Genitalien spielen. Ich war sehr erschrocken und verängstigt, dass unsere Besonderheit, mein Judentum entdeckt würde, und das ganze Verstecken vergeblich gewesen wäre. Schreiend und weinend, wahrscheinlich in derselben psychischen Lage wie mein Bruder Palko vor seinem Tod, rannte ich zu meinen Eltern ins Dorf (s. Kapitel 12: Gefahr durch die Spiele mit dem Geschlecht). Wegen ähnlichen Erlebnissen ist das Judentum für mich etwas Intimes, worüber ich nicht gerne spreche.
Mit welchen Juden soll ich mich identifizieren? Zwischen uns gibt es so verschiedene: Gute und schlechte, anständige, grosszügige, talentierte und blöde, Ausnützer, Rassisten und Liberale, usw., wie bei anderen Menschen. Spielt Judentum, Religion, Nationalität und Rasse immer eine kleinere Rolle nur für mich? Beteiligt sich mein Judentum irgendwie noch an meinem Leben?
Es ist nicht leicht für mich, solche Gedanken ausgerechnet hier zu äussern, wo unsere Ahnen lebten und ihr Judentum auslebten. Auch sie wurden deswegen verfolgt und geplagt. Ich würde gerne Ruhe von all dem haben, aber es ist nicht möglich. Meine Assimilation hat ihren Preis. Der jüdische Teil meiner Identität beeinflusste und beeinflusst nach wie vor mein Schicksal. Mit einer einfacheren, ausgeglicheneren Beziehung würde ich eine selbstsicherere, durchschlägigere Person mit mehr Erfolg auf verschiedenen Gebieten. Auf der anderen Seite bin ich kämpferischer, eigensinniger, unangenehmer auf manchen Gebieten, was sich zum Beispiel in den fachlichen Diskussionen zeigt. Schon mehrmals hörte ich, eine gute Diskussion beginnt erst nach meinem Votum. Ist die „Chuzpe“ Folge der Unterdrückung, Verfolgung und Anpassung?
Ich versuchte in Kürze meine Beziehung zum Judentum zu beschreiben. Ich verstehe, dass Andere mit anderen Erlebnissen, Erfahrungen eine andere Einstellung haben. Auch wenn wir ein ultraorthodoxes Mitglied in unserer Familie hätten, ich würde versuchen, seine Gründe dafür zu verstehen. Ich hoffe, ich würde nicht versuchen, ihn von meinem Standpunkt zu überzeugen. Das verlange ich auch für mich. Mein Bruder Palko rezitierte oft das Gedicht von Alexander Petöfi „Ich möchte nicht im Bett sterben.“ Nicht nur sie beide, aber auch etliche Mitglieder unserer Familie teilten leider dieses Schicksal, beziehungsweise einen solchen Tod. Von niemandem möchte ich mir vorschreiben lassen (solange ich niemandem Schaden zufüge), wie ich leben, sterben und begraben werden solle.

Wir waren mit unserem Leben zufrieden. Für sein Erhalten dankten wir der Roten Armee, der Armee des fortschrittlichsten Landes auf der ganzen Welt, da sie dort schon den Sozialismus aufbauten, und dort die Kommunistische Partei herrschte. Wir freuten uns, waren sogar begeistert, dass es uns gegönnt war, bei der Verwirklichung der grossen Sehnsucht der Menschheit nach Gleichheit, Gleichberechtigung, nach gleichen Möglichkeiten zu helfen. Nach der Ideologie der Kommunisten war der gemeinsame Besitz der Produktionsmittel die Grundlage für dieses Glück. Nicht umsonst träumten meine Onkel Laci, Osi und Miki darüber schon in ihrer Studentenzeit. Wie klug und voraussehend sie nur waren! Viele unverbesserliche Ewiggestrige, die nicht daran glauben wollten, flüchteten feige in das materiell zwar noch entwickeltere, aber politisch rückständige Ausland, in dem eine dünne Schicht die Mehrheit ausbeutete und auf ihre Kosten lebte. (Aber viele waren ermüdet durch den Krieg, bequem und fürchteten ein neues, unsicheres Leben zu beginnen. Als mein Vater von manchen zur Emigration animiert wurde, dachte er unter anderem, dass damit der Ruf seiner Schwäger als stramme Kommunisten beschädigt würde, was sie von ihm sicher nicht verdienten.) Nicht wenige, die an dieser schönen Zukunft zweifelten und geblieben waren, wurden sicherheitshalber verhaftet (wie auch viele religiöse und andere Klassenfeinde), oder, wie auch mein Vater, beteiligten sich freiwillig am Aufbau des Sozialismus. Die Mehrheit der Bevölkerung, auch wenn keine Mitglieder der Kommunistischen Partei, hoffte auf das versprochene bessere Leben (schon auf dieser Erde). Fast ununterbrochen feierten wir etwas, trugen in Umzügen Bilder von Marx, Engels, Lenin, Stalin und der Führer der Kommunistischen Parteien der ganzen Welt, man skandierte ihre Namen und liess sie und ihre Taten lang leben. Dabei sang man „Wenn wir haben, was wir wollten, fröhlich an die Arbeit, damit diejenigen, die für uns starben ...“, aber ganz ohne die Ironie, die Jahrzehnte später in Deutschland den Schlager begleitete „Es wird in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt“. Wir tanzten auf den Plätzen, Strassen und in den Parks. Künstler traten auf und unterstützten kräftig diese Begeisterung.
Unserer ganzen Familie ging es gut, was wir nach der Verfolgung während des Krieges als gerecht und verdient betrachteten. Onkel Laci wurde Stellvertreter des Ministers für Gesundheit der Slowakei, Osi Stellvertreter des Ministers für Industrie und Handel, Miki zuerst Chefredaktor der Armeezeitung, die für seine illustren, interessanten Artikel die beliebteste und auflagestärkste Zeitung wurde, noch vor dem offiziellen Organ der Kommunistischen Partei „Wahrheit“. Ob ihr Niveau sinken sollte, oder für seine Verdienste, wurde Miki als Militärattaché nach London geschickt. Mein Vater bekam dank Osi eine gute, seinen Fähigkeiten entsprechende Stelle im Verkehrsministerium. Wir hielten die perfekte Wohnung von Miki besetzt, die ursprünglich einem deutschen, aber jüdischen Architekten gehörte, der den Krieg nicht überlebte. Seine auch deutsche, kinderlose Frau floh zuerst vor der Roten Armee nach Westen, kehrte aber nach gewisser Zeit zurück. Man nahm ihr das vierstöckige Haus und die Wohnung weg, da sie Deutsche war. (Bald wurde so ein grosses Haus unabhängig von Nationalität und Religion verstaatlicht). War es Zufall oder Bösartigkeit der kommunistischen Freunde von Miki, dass diese Frau, zwar hoffnungslos, um ihre Wohnung gegen einen Juden kämpfen musste? Wir alle nahmen an, dass Miki mit seinen Fähigkeiten und Verdiensten eine andere Stelle im diplomatischen Dienst in London bekommen wird und wir dort weiter wohnen können. Übrigens befand sich in der Wohnung auch ein von Miki geschriebenes Telefonverzeichnis mit den Nummern aller damaligen kommunistischen Grössen mit vollen Vornamen, da Miki mit allen per Du war. Ich benützte es nicht. Mir fehlte die Chuzpe von Cousine Zuzka, die eines Abends den Kreml anrief und mit Genosse Stalin sprechen sowie ihm ihre Bewunderung, Dankbarkeit und Liebe zeigen wollte, damit er besser schlafen könne. Sie wurde verbunden, auch wenn nicht direkt mit Stalin. Aber ich genoss nicht die amerikanische Erziehung von Zuzka, ich erlebte Hitlers Totalitarismus.

(1) Zoka und Osi in Amerika
In der Zeit begann der Krieg in Korea. Mein Vater hörte wieder, wie während des Krieges, den ausländischen Rundfunk, und zweifelte, ob der offiziellen Version, dass die amerikanischen Imperialisten ihn angezettelt hatten, aber musste auch in der Familie damit hinter dem Ofen bleiben. Die Imperialisten schickten uns auch einen neuen Kartoffelschädling, damit sie uns schwächen. (Die Bauern kannten ihn bereits seit Jahrzehnten.)

(2) Zuzka in Präpubertät - man ahnt schon die spätere Diva als Sängerin
Wir Pubertierenden, Zuzka und ich, wollten nicht hintanbleiben, der Familie Schande zuzufügen, und so beteiligten wir uns ehrgeizig und eifrig am Bau des neuen, besseren Lebens. Nicht zufällig wurden wir Vorsitzende der neu gegründeten Organisation der jungen Pioniere in unseren Schulen. Sie lagen parallel nebeneinander, getrennt durch einen Hof, in dem wir gemeinsam leidenschaftlich Volleyball spielten. Zuspiel des Balles wie auch die Gespräche während und nach dem Spiel funkten mit pubertärer Erotik, ähnlich wie die Märsche und gesellschaftlichen Tänze und Spiele bei Feierlichkeiten. Vor den nächsten Ferien wurde uns angekündigt, dass jemand aus unseren Schulen die Ferien in Artek auf der Krim verbringen kann. Dieses Pionierlager wurde in Zeitungen und Zeitschriften in höchsten Tönen besungen als Gipfel der Schönheit und des Wohlfühlens (die Grenzen waren schon geschlossen und man konnte nirgendwo ins Ausland frei reisen). Wer käme dafür in Frage, wenn nicht die Vorsitzenden der Pionierorganisation? Und so fürchteten wir, mindestens ich, dass unser ausgezeichnetes Verhältnis getrübt wird, wenn nur einer von uns gehen kann. Meine Befürchtungen waren gegenstandslos. Sie wählten die Stellvertreterin von Zuzka, ein farbloses Mädchen ohne Ausstrahlung, die aber aus einer Arbeiterfamilie stammte. (Nach der Rückkehr hielt sie ein nichtssagendes, sicher vorgefasstes Referat. Sie wollte nie über ihre Erlebnisse reden, auch wenn ich sie mit meiner Langerischen Neugier drängte, was ihr offensichtlich unangenehm war. Sie wurde noch ernsthafter, und vermutlich von Illusionen geheilt.) Wir spürten, aber wollten es nicht zulassen, dass Fähigkeiten und Verdienste in diesem System nicht entscheidend waren.

(3) Zuzka singt.
Die Begeisterung für Sozialismus trug seltsame Früchte. Manche Leute wurden meschugge. Einer unserer Lehrer, ein ukrainischer Emigrant nach der Oktoberrevolution, vermutlich nicht nur um diesen Makel zu beheben, sondern aus aufrichtiger Überzeugung, schickte seinen einzigen Sohn, einen kleinen schmächtigen Jungen, als für die Ausbildung als Bergmann geworben wurde, und an jeder Ecke ein Plakat hing: „Das Vaterland braucht die Grubenleute“, in diese Lehre. Selbstverständlich kam er nach nicht einmal zwei Jahren gebrochen zurück. Es wäre interessant zu wissen, was aus ihm geworden ist. Es erinnert mich an Abraham und Isaac. Als Abraham seinen Sohn opfern wollte, erschien ein Engel, der die Botschaft brachte, der gnädige Gott verlange es von ihm nicht mehr. Den atheistischen Zeiten entsprechend, erschien leider kein Engel. Der Vater der damaligen besten Freundin von Zuzka, ein Schüler und Mitarbeiter des grossen Linguisten Jacobson, selbst aus Russland vor Kommunisten nach der Revolution in die Tschechoslowakei emigriert, beteiligte sich eifrig am Bau des Sozialismus. Erst Jahre später, als sie ihm die Freude daran gründlich vermasselt hatten, emigrierte er nach Wien, vermutlich noch mit Hilfe seines Lehrers aus den USA.
Nach kurzer Zeit bereiteten sie den IX. Kongress der Kommunistischen Partei der Slowakei vor, eine grossartige, wichtige Angelegenheit. Wie gewöhnlich nach sowjetischem Muster mussten bzw. durften „die besten Pioniere“ aus Bratislava die Teilnehmer begrüssen, und einer hielt die Begrüssungsrede. Wir sollten sie selbst schreiben. Die beste Rede wurde ausgewählt. Beim letzten Vorbereitungstreffen wurden aus zig die fünf besten vorgelesen, darunter (selbstverständlich) diejenigen von Zuzka und mir. Als wir in die Kongresshalle einmarschierten, hielt die Rede ein um zwei Jahre jüngerer Knabe aus unserer Schule. Natürlich aus unseren, dem Alter entsprechenden Reden, war dort kein Satz. Sie bestand aus allgemeinen, üblichen nichts sagenden Phrasen. Erneut erlaubten wir uns kein Urteil. Wir waren nur enttäuscht. Die Partei wusste, was sie tat. Ob vor oder nach der Rede banden wir den Mitgliedern des Zentralkomitees der Partei, die auf den Treppen des Podiums sassen, eine rote Pionierbinde um den Hals. Zuzka band sie in der ersten Reihe Genosse Bacilek um, der später nicht nur beim Schicksal ihres Vaters Osi eine grosse Rolle spielte, ich Ladislav Novomesky, einem Dichter und ehemaligen Minister für Kultur der Slowakei, der bereits abgesetzt und kurz darnach verhaftet wurde. Ein schlechtes Omen war, dass er in der letzten Reihe des Podiums sass. Als Zeichen des Dankes schenkte er mir den letzten Band seiner Gedichte mit einer persönlichen Widmung. Mein vorsichtiger Vater schmiss das Buch später weg. In jenen Zeiten konnte uns sein Buch, noch dazu mit seiner Unterschrift, schaden. Man wusste nicht, ob sie von der Staatssicherheit nicht kommen, die Wohnung durchsuchen und durchstöbern würden, wie es bei Zoka geschehen war nach der Verhaftung von Osi.
In den Ferien zwischen der mittleren Schule und dem Gymnasium bauten wir in der Mitte der Stadt einen kleinen Park, wo jetzt Platz war nach den von Bomben zerstörten Häusern der Weinbauern. Dabei verliebte ich mich erstmals in eine Mitschülerin und Freundin von Zuzka, mit grossem Busen, einer ruhigen Natur und einem Bruder, der unser Pionierführer war. Aber sie erwiderte meine Zuneigung nicht, sie war ebenfalls sehr in einen Freund des Bruders, der ihr (und Zuzkas) Pionierführer war, verliebt (kompliziert, kompliziert). Nach diesen Ferien teilten sich unsere Schulwege mit Zuzka, auch wenn unsere Gymnasien nicht weit voneinander entfernt waren. Zuzka besuchte, aus für mich unklaren Gründen das reine Mädchengymnasium, ich das gemischte Realgymnasium, auch wenn meine Eltern sehr wollten, dass ich im klassischen mit Latein blieb, das die angehenden Ärzte benützten – ihr Traumberuf für mich. Aber sowohl meine Liebe wie meine besten Freunde waren im Realen, das die Schüler für technische Berufe vorbereitete – die Traumberufe der Partei für den Aufbau des Sozialismus. Ich setzte mich durch. Als ich beim Direktor des Realgymnasiums sass, um meinen Übertritt zu besprechen, war ich nicht vorbereitet, dass er mich nach dem Grund fragte. Ich wagte nicht die wahren Gründe, die Liebe und die Freundschaft, zu nennen. Es kam mir nichts Besseres in den Sinn, als zu sagen, dass ich es näher habe, auch wenn beide Schulen in demselben Gebäude den Unterricht wochenweise abwechselten – eine Woche vormittags, eine nachmittags. Der Direktor nahm mich schmunzelnd auf! Wie sonst, nach einigen Monaten verfloss meine unerhörte Liebe. Ich verliebte mich in eine andere Mitschülerin, mit der ich schöne Zeiten erlebte. Aber auch diese Liebe dauerte nicht ewig. Zu einer langzeitigen Bindung war ich zu jung, zu unreif. Ein ruhiges, geordnetes Leben lockte mich nicht. Ich wollte frei sein – frei für viele weitere Erlebnisse. Aber die guten Freundschaften aus diesen Zeiten dauern noch immer. Meine „politische“ Karriere setzte sich fort. Ich wurde der Leiter der Jugendorganisation in meiner Klasse, und nicht nur mein Klassenlehrer nahm an, dass ich ein würdiger Nachfolger des gegenwärtigen Leiters der ganzen Schule wäre, wenn er Ende des Jahres nach der Matura die Schule verlassen würde. Aber dazu kam es nicht, so weit brachte ich es nicht.

(4) Peter als Gymnasiast.
Plötzlich trübte sich unser Leben ein. In welcher genauen Reihenfolge weiss ich nicht mehr. Onkel Miki musste aus London zurückkehren und eine Stelle suchen. Osi bekam zuerst eine untergeordnete Stelle, wie später auch mein Vater, Laci wurde wieder ein Allgemeinarzt. Unser (Markos) Leben wurde unmittelbar durch Mikis Rückkehr beeinflusst, da wir plötzlich und dringend eine neue Wohnung suchen mussten, was nicht so leicht war. Als wir nach Bratislava kamen, verliessen viele Juden (und andere) die Heimat, und ihre Wohnungen standen zur Verfügung. Inzwischen baute man nur spärlich neue Wohnungen, sodass wir froh sein mussten, dass wir eine alte Wohnung mit zwei kleinen Zimmern am Ende eines alten Winzerhauses erhielten. Im Keller, wo wir die Kohle lagerten, roch es noch immer nach Weinhefe. Das Ende des Hauses hatte keine übliche, gut isolierte Mauer, entweder entstand sie gewaltsam beim Bombardement während des Krieges oder als Folge des natürlichen Zerfalls, sodass die Küche, in der unser Dienstmädchen Marka schlief, eine feuchte, verpilzte äussere Wand hatte. Auch Zoka musste in eine alte kleine Hofwohnung umziehen, die aber nicht feucht war. Bald musste sie, als ein „unzuverlässiges Element“ mit Tana auch diese Wohnung verlassen und beim Aufbau des Sozialismus in Tvrdosovce helfen, einem Kaff im ungarischen Teil der Slowakei. Sie beschreibt es sehr interessant und dazu teilweise witzig in ihrem Buch, das 2007 zum Buch des Jahres gewählt und in viele Sprachen übersetzt wurde. Aber Osis Verhaftung war der grösste Schlag für uns. Selbstverständlich hofften wir zuerst naiv, dass es sich um einen Irrtum handelte, den man aufklären, und er bald wieder frei sein würde. Aber die Umstände und die ganze Situation waren verändert. Der Ballon der Begeisterung platzte, es ging ihm die Luft aus. Es entstanden Misstrauen, allgemeine Verdächtigungen, Angst. Freiheit wurde durch Beschränkung, Unterdrückung, Verfolgung ersetzt. Wir hörten auf zu singen: „Wenn wir haben, was wir wollten ...“. Wir wurden wieder minderwertig und verfolgt.

Die römische Göttin der Gerechtigkeit, Justitia, wird seit dem Mittelalter mit verbundenen Augen dargestellt als Zeichen dafür, dass sie unabhängig untersucht, sowie be- und verurteilt. Blinde können jedoch die Mächtigen mit ihrem Druck und ihrer Kraft umso leichter beeinflussen. Sokrates, Jan Hus, Giordano Bruno sind die bekanntesten Beispiele dafür. Unter Hitler, Stalin und anderen neuzeitlichen Diktatoren sind Millionen unschuldiger Menschen als Opfer solcher Justitia gestorben, viele ohne Prozess, ohne Urteil. Die Mächtigen wollen so nicht nur ihre Gegner beseitigen und die ihnen unangenehme Meinung unterdrücken, aber auch alle das Fürchten lehren, damit sie ihre Wünsche und Interessen befolgen.
Nach der Verfolgung während des Krieges hofften wir, dass so etwas nie mehr vorkommt. Onkel Osi ist gutmütig mit der Familie im Jahre 1946 aus den USA zurückgekehrt. Amerika und die Mentalität der Leute gefielen ihm, einem Mitteleuropäer alten Schlages, nicht besonders. Dazu rief ihn nicht nur der älteste Bruder Laci, aber auch die Kommunistische Partei zurück. Ein hoher Funktionär, der Sekretär der Partei, Genosse Bacilek, schrieb ihm einen Brief, dass die Partei eben solche Fachleute, wie Osi für die Wirtschaft einer sei, jetzt dringend brauche. Seine Frau Zoka war von der Idee nicht begeistert.
Nach ihrer Rückkehr war es trotz der Beteuerungen und Versprechungen der Partei, schwierig, eine Wohnung in Bratislava zu bekommen. Zoka und Zuzka verbrachten ein paar Monate bei uns in Martin. Zuzka ging in die Schule und lernte schnell slowakisch. Wir hatten es schön und lustig zusammen. Sie war für mich der Ersatz für den verlorenen Bruder Palko. Im Rahmen der Assimilationsbemühungen meiner Eltern wurde sie sogar getauft, auch wenn Zoka von der Idee nicht begeistert war. Sie rief bei den Frauen in Martin Unmut hervor, weil sie unerhörterweise die Fussnägel mit strahlend rotem Lack färbte und das noch dazu beim Ausflug zum lokalen Heiligtum, zum Mädokys Aber es wurde überwunden.

Nach dem kommunistischen Putsch im Februar 1948 wurde Osi stellvertretender Minister für Wirtschaft in der Slowakei, Miki wurde im Militär befördert und später Chefredaktor der militärischen Tageszeitung „Narodna Obrana“ (Nationalverteidigung), die zur meistgelesenen Zeitung, noch vor dem Parteiorgan „Pravda“ (Wahrheit), wurde, was bei der Parteiführung nicht nur Gefallen fand. 1949 wurde er als Militärattaché nach London geschickt.

(2) Osi und Miki auf dem Wenzelsplatz in Prag.
Diese Idylle dauerte nicht lange. Im Jahre 1951 musste Miki plötzlich zurück und Osi verlor zuerst seine Stelle, merkte, dass er überwacht und schliesslich verhaftet wurde. Zoka musste mit der kleinen zweieinhalbjährigen Tochter Tana in eine notdürftige kleine Wohnung umziehen, später sogar in ein Dorf im slowakischen Teil der Tschechoslowakei.
Es vergingen mehrere Monate, aber von Osi kam keine Nachricht. Eines Morgens wurde meine Mutter von den Staatssicherheitsleuten abgeführt. Wir wussten nicht warum, wohin, für wie lange. Zum Glück wurde sie spätabends entlassen. Wir hatten keine Ahnung, was sie und uns weiter erwartete. Sie kam kurz vor Mitternacht und referierte über das Verhör, was sie von ihr wollten. Kommen sie sie wieder holen? So wie Osi und eine Cousine des Vaters ohne Rückkehr?
Niemand war, sollte und konnte sicher sein. Wir trafen uns regelmässig am Sonntagnachmittag bei verschiedenen Langer-Familien und diskutierten aufgeregt, was mit Osi sei, wie man ihm helfen könnte. Aus der Konstellation und Mimik der kommunistischen Führer bei den öffentlichen Treffen und bei ihren Auftritten versuchten wir, wie aus dem Kaffeesatz, Schlussfolgerungen zu ziehen: Wie steht es mit Osi und uns, wie wird seine und unsere Zukunft sein? Man überlegte, ob Miki nicht seine alten, jetzt bedeutenden, und wir dachten auch einflussreichen Kameraden versuchen sollte, anzusprechen, ob Ella nicht einen davon wieder kontaktieren sollte, mit dem Laci und Miki während des Krieges illegale Plakate druckten und ihn beherbergten, mit dem sie damals, bösen Zungen nach, engere Beziehungen pflegte. Sowohl meinem Vater, wie auch mir, waren solche Diskussionen und Überlegungen etwas fremd, unreal, und so schwiegen wir meistens, was vor allem Miki störte und mich zum Votum herausforderte. Zoka, dank ihrer Natur und fehlenden Erfahrungen mit einem totalitären Regime, war sehr aktiv und erzwang den Zutritt zu ehemaligen Freunden, die noch immer bedeutende Stellen inne hatten. Die Aussichtslosigkeit solcher Diskussionen (wie auch die Aktivitäten) ist jetzt, nach der Veröffentlichung der Dokumente aus jener Zeit, klar. Unsere grossen Führer hatten keine so grosse Macht, waren nur Figürchen, die der geliebte Genosse Stalin hin und her schob und gelegentlich töten liess. So fürchteten sie sich selbst, da sie nicht wussten, ob und wann sie die Anklage, Verurteilung und die vorausbestimmte Strafe treffen würde. Vielleicht durften sie die Details, den feinen Schliff der Sache geben, und ihre persönlichen Abneigungen und Feindschaften durchsetzen. Wie immer gehörten dazu auch Minderwertigkeitsgefühle gegen Menschen, die mehr wussten, sich besser ausdrücken konnten, beliebt waren. Die Abhängigkeit von Moskau, die fehlende Selbständigkeit konnten wir bereits ahnen, als wir nach dem Aufstand in den Bergen Miki trafen, der die kommunistischen Führer Sverma, Slansky und Lauschman mit seinen Soldaten schützte. Die drei hatten nicht viel zu sagen. Alles entschieden die sowjetischen „Berater“, die sie begleiteten, nach der Funkverbindung mit Moskau (s. Kapitel 13. In den Bergen - Bergbauhütte).
1952 fand der sogenannte Slansky-Prozess statt, dessen Verlauf im Rundfunk übertragen wurde. Plötzlich hörten wir, dass Osi als Zeuge der Anklage auftrat. In kurzer Zeit sagte er Tatsachen, die klar schon weder zeitlich noch örtlich stimmen konnten. Seine Stimme war schwach und eintönig. Später erfuhren wir, dass er durch Folter, Medikamente und Hirnwäsche gemäss den üblichen Verfahren dazu gebracht wurde. Wir waren froh, dass er nicht, wie die überwiegende Mehrheit der Angeklagten zum Tode verurteilt wurde. Ironie des Schicksals war, dass der Minister für Sicherheit derselbe Mann war, der Osi aus Amerika zurückrief. Damals wussten wir nicht, dass auch er nur eine Marionette des sowjetischen Sicherheitsdienstes war. Die ganze Zeit konnte niemand Kontakt zu Osi haben. Erst nach seinem Prozess, in dem er zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, die er in verschiedenen Arbeitslagern, zeitweise auch in radioaktiv verseuchten Minen verbrachte, durfte ihn Zoka mit ihren beiden Töchtern für eine halbe Stunde mit Überwachung sehen. Ironie des Schicksals: Als Osi aus Amerika zurückkehrte, brachte er ein Buch von zwei Amerikanern: „Grosse Verschwörung“ mit, das sofort übersetzt wurde. Im Buch wurden Moskauer Prozesse der dreissiger Jahre gegen Klassenfeinde in der Kommunistischen Partei „erklärt“ und gutgeheissen. Es war der Anfang und das Muster für alle weiteren Prozesse. Später kam heraus, dass die Autoren vom sowjetischen Geheimdienst gut bezahlt wurden.
Wie es schon zu solchen Prozessen gehörte, die Zeitungen waren voll von Briefen, in welchen „verdiente Arbeiter“ die schändlichen Taten der, in diesem Falle „zionistischen Verräter“ verurteilten. Sogar ein Sohn empörte sich über die Verbrechen des Vaters. Es war uns klar, dass sie ihn dazu zwangen, so wie unseren Osi zu falschen Aussagen. Wir befürchteten, dass sie auch von uns so etwas verlangen könnten.
Unsere Freunde und Mitschüler änderten ihre Beziehung zu uns nicht, ein grosser Unterschied zu den Kriegszeiten. Umgekehrt, wir spürten Verständnis und Mitleid. Um Zuzka, die Tochter eines „Verräters und Verbrechers“, interessierten sich die gutaussehensten Knaben der von uns etwas älteren Klassen. Ihre besondere Schönheit, Ausstrahlung, Anziehungskraft – Sex Appeal – überwanden alle politischen Hindernisse und Ängste.
Nach zehn Jahren wurde er rehabilitiert und aus dem Gefängnis entlassen. Den ganzen Dornenweg beschreibt Zoka im Buch „Convictions“ (Überzeugungen), das in mehrere Sprachen übersetzt, sowie 2007 als "Das Buch des Jahres" gewählt wurde und auch als Theaterstück grossen Erfolg hatte. In der deutschen Sprache erschien es leider noch nicht. Es ist ein schonungslos ehrliches, spannendes, den Umständen entsprechend mit schwarzem Humor geschriebenes Buch über das Leben im real existierenden, somit verschrobenen Sozialismus aus dem Blick einer Verfolgten. Osi genoss nicht lange die wiedergewonnene Freiheit – 1966 ist er, lebenslang ein Abstinent, an akutem Leberversagen gestorben, offensichtlich als Folge der Torturen in den Gefängnissen und Lagern.
Wo waren die geträumte Gleichheit und Gleichberechtigung? Es herrschte Unterdrückung und Verfolgung. Kein Wunder, dass wir enttäuscht waren. Diesem Sozialismus trauten wir nicht mehr. Es begann die Zeit der Anpassung und der Verstellung. Vielleicht als Rest der Hoffnung und der langen familiären Linkstradition trösteten wir uns damit, dass die Idee eigentlich gut, nur ihre Verwirklichung in falsche Hände geraten sei – auch der Grund für die samtene Revolution 1968. Am meisten, am längsten, bis zum bitteren Ende seines durch Gefängnis und Folter verkürzten Lebens, blieb Osi bei dieser Überzeugung.

Für mich hatte es keine grossen nachhaltigen Folgen. Die vorgesehene Funktion des Leiters der gymnasialen Jugendorganisation kam zwar nicht mehr in Frage, aber sonst wurde ich nicht benachteiligt. Als 1953 die Aufnahme an die Hochschule bevorstand, herrschte das erste kleineauwetter. Die Maturanden mit lauter besten Noten (damals 1) konnten die Hochschule ohne Aufnahmeprüfung frei wählen. Ein Jahr früher wurde Vetter Jano aus fadenscheinigen Gründen nicht an der Medizinischen Fakultät zum Studium zugelassen. Er sollte ein Jahr warten, aber auch dann wäre es nicht sicher gewesen. So wählte er das Studium der Chemie. Nach der Emigration in die Schweiz wurde er ein sehr erfolgreicher Unternehmer und mehrfacher Millionär, was er als Arzt kaum geworden wäre.

(4) Osi wieder frei und gepflegt
Wie auch diese Familiengeschichte zeigt, direkte, anständige Menschen sind für Politik kaum geeignet. Und wie mein Leben zeigt, Politik entspricht nicht meinen Neigungen, ist nicht mein Bereich. Auch in der freien, demokratischen Gesellschaft erfuhr ich, dass der persönliche, politische Einsatz die Freiheit und die Unabhängigkeit des Denkens und des Urteils beschränken kann. Und diese sind mir, vielleicht auch als Folge der Erlebnisse, enorm, fast lebenswichtig.
Ausser dem Schicksal von Onkel Osi erlebte ich während der Jugend, während des "Aufbaus des Sozialismus“ weitere, zwar weniger drastische, aber trotzdem abschreckende Wirkungen der blinden Justitia.
Gegen Ende der Pubertät befreundete ich mich mit einem sehr dünnen Knaben, auch mit Namen Peter. Wir hatten gemeinsame Interessen und Ansichten, verbrachten viel Zeit zusammen und dachten, dass unsere Freundschaft bis ans Ende unserer Leben überdauern wird, was sich erfüllte. Ungefähr nach einem Jahr, als wir ins Gymnasium wechseln sollten, sagte er mir, dass er weg von zu Hause das Militärgymnasium besuchen möchte. Unter anderem lockte ihn die Aussicht, am Ende des Gymnasiums die ausgezeichnete militärische technische Hochschule besuchen zu können, was versprochen wurde. Einerseits war ich enttäuscht und unzufrieden, dass ich meinen besten Freund verliere, anderseits bewunderte und beneidete ich ihn. Als ich meinen Eltern mitteilte, dass auch ich die „Zizkovka“ besuchen möchte (die Schule trug den Namen des legendären mittelalterlichen Führers der Husiten Jan Zizka) stiess ich an einen unüberwindlichen Widerstand meines Vaters, eines ehemalig begeisterten k.u.k. Offiziers, der aber bereits im Krieg einen Sohn verlor, der freiwillig in den Kampf zog. Er meinte, es wäre unverzeihbar leichtsinnig und unverantwortlich, eine militärische Karriere zu wählen. Nach zwei Weltkriegen sollte aus seinem Sohn ein Arzt werden, da diese auch im Krieg wertvoll und geschützt sind. Mein Freund erlebte während des Krieges nicht nur eine lange Trennung von den Eltern, nicht gewusst, ob sie noch lebten, wo sie waren, ob er sie je wieder sehen würde. Beiden war nicht bewusst, dass sie die Trennung wiederholten. Nur die Mutter war mit der Wahl nicht einverstanden. Losbindung und Verlassenheit blieben schmerzhafte Knotenpunkte in seinem Leben. (Als er gegen Ende seines Lebens lange schwer krank war und ihn seine Frau nur für ein Weilchen verlassen musste und etwas später als versprochen zurückkam, überfiel ihn eine unbegreifbare, unbeherrschbare, panische Angst.) Nach einer kurzen Weile in der Schule schmeckte ihm der militärische Drill und somit auch die Schule nicht mehr. Aber für ein Zurück- und Austreten war es zu spät. Am Ende, nach der Matura, durften nur zwei bis drei Schüler weiter an die militärische Hochschule. Selbstverständlich diejenigen, die am besten den militärischen Ansprüchen genügten, zu denen gehörte selbstverständlich mein Freund auch nicht. Er musste die Offiziersschule besuchen, dann wurde er Kompaniekommandant. Bei einer feuchten Runde mit Kollegen erwähnte er, dass ihm die Militärkarriere nicht schmecke und er überlegen würde, wie er sie beenden könnte. Selbstverständlich war dabei jemand, damals eine gute Gewohnheit, der es am nächsten Tag meldete. Noch mit einem Teilnehmer der Runde wurde er verhaftet und wegen Hetze gegen die Armee und Sozialismus zu elf Monaten Gefängnis verurteilt. Der Richter sagte dem Vater mit Verständnis und einer gewissen Entschuldigung, in der Zivilschule würde sein Sohn im Benehmen nur eine um eine Stufe schlechtere Note bekommen. Er musste aber eine Strafe verhängen, die ihm von „höheren Stellen“ verordnet wurde, was er zwar nicht sagen durfte, aber klar war. Peter hatte Glück. Nach drei Monaten kam eine Amnestie – es kam ein neuer Präsident oder etwas Ähnliches. Zuerst musste er sich als gewöhnlicher Arbeiter bewähren. Dank guten Verbindungen seines Vaters, eines langjährigen, aber nicht mehr überzeugten Parteimitgliedes dauerte es nicht lange, und im nächsten Herbst wurde er sogar zum Studium an die Universität aufgenommen – ein halbes Wunder in der damaligen Zeit. Aber er wurde nie mehr der fröhliche, sorglose, freie Mensch, wie er am Anfang unserer Freundschaft war.

(5) Miki im Alter
*
Während der grössten Dunkelheit, kurz nach dem Slansky-Prozess, mussten die ganzen Klassen unseres Gymnasiums einem Prozess im Justizia-Palast gegen drei jüngere Knaben zuschauen. Sie planten den Bau eines Fantasie-Unterwasserbootes, mit dem sie unter der Donau nach Österreich fliehen wollten – eine typisch pubertäre Fantasie. Ich weiss nicht mehr, wie es rauskam, wer sie verriet. Sie wurden zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Offensichtlich sollte uns dies von ähnlichen Plänen und Unternehmungen abschrecken, aber während des Prozesses wurde uns nicht nur seine Absurdität klar, sondern die aller damaligen politischen Prozesse. In diesem Fall erreichte die Macht das Umgekehrte davon, was sie wollte, sie machte sich unglaubwürdig und lächerlich.
Im vierten Jahr meines Medizinstudiums wurden wir aufgefordert, dem Ausschluss eines Kollegen vom Studium zuzustimmen und uns öffentlich von seiner schamlosen Tat zu distanzieren. Was hatte er verbrochen, dass ihn so eine schwere Strafe traf, die ihm das Leben verdarb? Dieser etwas sonderbare Mensch schrieb seinen Eltern kritische und ungünstige Briefe über manche Führer unserer Jugendorganisation und lobte, zwar als Nichtjude, die Fähigkeiten der jüdischen Kommilitonen und Kommilitoninnen. Sein Vater, ein Frauenarzt in der Mittelslowakei, führte Auskratzungen durch, die damals streng verboten, aber als einzige "Verhütungsmethode darnach" sehr begehrt waren. Eine Patientin war mit ihm entweder nicht zufrieden, oder wollte eher nicht zahlen und zeigte ihn an, worauf sie sein Haus durchwühlten und die besagten schändlichen Briefe fanden. Sie schickten sie unserem Personalchef, der eine wichtige Person war, die selbstverständlich und automatisch der Sicherheitspolizei angehörte. Warum brauchten sie zum Ausschluss aus dem Studium die Versammlung unseres ganzen Jahrganges? Wollten sie alle das Fürchten lehren, die nicht konform über Leitung, Partei und Verhältnisse dachten? War ihnen bange vor der ähnlichen "konterrevolutionären" Entwicklung, wie vor einem Jahr in Ungarn?

(6) Kommilitonin Sona M. beim praktischen Anatomie-Unterricht (rechts des sitzenden Lehrers). Mit Dank Foto von ihr erhalten.
Waren sie „beleidigte Leberwürste“ und wollten sich rächen? Zur grossen Überraschung gelang ihnen die Versammlung nicht nach ihren Plänen und Vorstellungen. Noch verwurzelte Reste von Ehre und eines gesunden Urteils, erlaubten uns keine Zustimmung. Ich denke, auch als Rest der alten Zeiten und Sitten stimmten wir geheim ab. Dazu trug auch ein Professor, der Tutor unseres Jahrgangs, der angetrunken, wie es seine Gewohnheit war (wozu auch die politische Entwicklung beitrug, aber das ist eine andere Geschichte), bagatellisierte diese Schandtat unseres Kollegen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil er ein Kommilitone seines Vaters war. Unter anderen schloss sich ihm auch ein jüdisches Mädchen an, das mit dem „Sünder“ in einer Gruppe den praktischen Unterricht besuchte. Wir stimmten mit einer grossen Mehrheit gegen den Ausschluss, was eine unerhörte und unerträgliche Ohrfeige sowohl für den Personalchef, die Führung unseres Jahrganges wie auch für den Sozialismus war – es entstand eine grosse Affäre. Unser Professor wurde ordentlich zusammengeschissen, das jüdische Mädchen wollten sie auch aus dem Studium rausschmeissen. Sie beriefen eine neue Versammlung, die sie besser, unter einer grösseren Drohung vorbereiteten, und so stimmten wir, jetzt öffentlich, dem Ausschluss dieses bürgerlichen, unzuverlässigen, hinterlistigen, dem Sozialismus feindlichen Element zu.

(7) Im Hörsaal, Peter dritter von links in der zweiten Reihe von oben
Damit wir den Militärdienst verkürzen, und uns so früher und länger am Aufbau des Sozialismus beteiligen konnten, hatten wir einen Tag pro Woche Militärunterricht. Zweimal, nach dem vierten und achten Semester, weilten wir je einen Monat im Militärlager, damit wir die Militärkenntnisse und Fähigkeiten intensivieren und vertiefen konnten. Nach dem achten Semester, also nach dem erinnerungswürdigen Ausschluss des Kollegen, fand das zweite Lager statt. Nach einer Übung kehrten wir vor dem Mittagessen für eine kurze Pause in die Zelte zurück. Wir dachten, dass wir, wie üblich in einer solchen Zeit, ohne Aufsicht blieben. In einem Zelt nicht weit von mir, sagte ein beliebter, fröhlicher Kommilitone, verstimmt durch die eben beendeten Übungen: „Major M. ist ein Rindvieh“, nicht ahnend, dass dieser sich soeben oberhalb des Zeltes befand. Anstatt es zu überhören und weiter zu gehen, machte er Halt und fragte: „Wer sagte, dass ich ein Rindvieh sei?“ Unser anständiger, ehrlicher Kollege meldete sich. Major M. sagte: "Wiederholen Sie es!“, was er tat. Es entwickelte sich daraus erneut eine grosse Affäre. Zuerst entliessen sie den Kollegen aus dem Lager und dem Militärdienst, aber damit nicht genug, wir sollten seine abschreckende Tat verurteilen. Erneut beriefen sie bereits am nächsten Tag eine Versammlung der Jugendorganisation, deren Mitglieder wir selbstverständlich alle waren, die sie jetzt belehrt, gründlicher vorbereiteten, da sie sich auf Spontaneität nicht verlassen konnten. Der Führer der Jugendorganisation kam auch zu mir, als dem Führer unserer Gruppe und auch sonst guten, bereits wissenschaftlich tätigen Studenten, mit dem Vorschlag, oder besser Befehl, ich solle bei der Versammlung auch den sündigen Kollegen verurteilen. Lange kämpfte ich mit mir, dachte an Onkel Osi und andere Schicksale. Ich schwieg jedoch bei der Versammlung, auch wenn der Führer mich mit drohenden Blicken

(8) Während des Studentenmilitärdienstes; Peter ganz links oben
dazu herausforderte. Es fanden sich genug andere, die es taten. Auch seine engsten Freunde, mit denen er Klarinett in einer Musik spielte. Der Führer sagte nichts, aber als ich nach der Promotion als Assistent auf dem Biochemischen Institut bleiben sollte, wo ich bereits neben dem Studium vier Jahre arbeitete, bestimmten sie mich für eine Stelle in einem peripheren Krankenhaus. Nur dank einer Kollegin, einer Kommunistin aus unserer Gruppe, gelang es mir doch, die erstrebte Stelle zu erreichen. Den lustigen Kollegen schmissen sie nicht nur aus dem ärztlichen Militärdienst, sondern auch aus dem Studium. Wir wissen nicht, wie es ihm erging. Zu unserer Schande weder erwähnten wir ihn dabei, noch luden wir ihn je zu unseren regelmässigen fünfjährigen Promotionstreffen ein. Es blieb ein Tabu. Die Verarbeitung der Vergangenheit schreiben wir nicht nur mit kleinen Buchstaben, sondern überhaupt nicht. Wenn ich es erlebe, versuche ich es beim nächsten Treffen nachzuholen.

(9) In den Ferien vom Militärdienst
Wie ein Freund sagte, es waren schwierige Zeiten, während denen alles eine politische Bedeutung hatte. Wenn man bei einem Spiel ein Fenster einschlug, war es eine Beschädigung des gemeinsamen Gutes und eine feindliche Tat gegen den Sozialismus. Keine Kirche war je so streng und kleinlich.

Bratislava wuchs, entwickelte und erweiterte sich, aber alle drei Gymnasien befanden sich in der Mitte der Stadt, nicht weit voneinander entfernt. Ein Jahr vor unserer Matura entstand aus den drei durch eine Mischung von direkter und indirekter Teilung mindestens sechs Gymnasien. Es war eine der wenigen vernünftigen, berechtigten Reformen in den an Reformen jeglicher Art nicht direkt armen Jahren. Sie sollten das ständige, unaufhörliche Streben nach Fortschritt herbeiführen. Meistens war es nur ein leeres, sinnloses Wimmeln. Wie wir inzwischen wissen, ist das derzeitige System auch nicht völlig immun dagegen.
Wir aus der Stadtmitte blieben im alten Gebäude, das gegen Ende des vorletzten Jahrhunderts gebaut wurde. Aber bereits im 17. Jahrhundert stand dort eine Klosterschule. Zu Beginn unserer Gymnasialjahre gingen wir abwechlungsweise eine Woche vormittags, die andere nachmittags in die Schule. Dies als Zeichen der sozialistischen Sparsamkeit und Effektivität, da auf diese Weise in einem Gebäude zwei Gymnasien untergebracht wurden. Nun aber nur vormittags. Damit blieben die Nachmittage frei für Sport und andere Interessen. Meistens kannten wir uns von den vorgängigen Schulen, wenn auch nicht Klassen, aber in der neuen entwickelten sich neue Freundschaften, Beziehungen und Lieben. Die Letzten, wie üblich, nicht immer erfüllt, wie es in dem Alter üblich ist. Wir hatten auch neue Lehrer – die Karten wurden in vielen Hinsichten neu gemischt. Auch eine gute Vorbereitung auf das, was uns erwartete und nicht zu vermeiden war.
Obwohl wir verschiedene Familien- und Lebenshintergründe hatten, entstand aus uns nach kurzer Zeit eine „gute Klasse“. Wesentlich auch dank unserer Klassenlehrerin. Ihr Mann war auch Lehrer, aber auf einem anderen Gymnasium. Sie hatten keine Kinder. Nach langen Jahren des Unterrichtens an einem Mädchengymnasium mit postpubertären Problemen der jungen Damen, war ihr eine gemischte Klasse willkommen, auch was das Geschlecht betrifft. Sie vermittelte uns die Freude an neuen Belastungen, Aufgaben und Herausforderungen. Vielleicht war auch deshalb das Motto unserer Maturitätsanzeige die Aussage des tschechischen Dichters Nedbal: „Es war schön, aber es war genug!“.
Wir spürten, dass sie uns alle gern hatte, uns verstand und uns und unsere Probleme ernst nahm, aber mit einem guten, gesunden Abstand. Sie vermittelte und beruhigte die Auseinandersetzungen nicht nur zwischen uns, was nicht oft nötig war, aber auch zwischen uns und den anderen Lehrern. Sie stand souverän aber nicht überheblich, mit einer natürlichen Selbstverständlichkeit, darüber. Sie strahlte aus, dass ausser des Unterrichts, der Kenntnisse, des Lernens, des Sports, im Leben etwas mindestens so Wichtiges existierte – was?
Die anderen Lehrer, auch wenn sie Kanten und Ecken hatten, liessen uns wissen, dass sie sich freuten, wenn sie uns etwas beigebracht hatten. Sie waren gerecht, was Balsam war in den Zeiten der „Kaderniks“ (Personalleiter) und ihren Zeugnissen, kurz nach verschiedenen Gerichtsprozessen, in denen aus unschuldigen Menschen durch Folter Zugeständnisse zu Verbrechen erpresst wurden.
Beide Mathematiklehrer, streng und sachlich, wie es ihrem Fach entsprach, führten nicht nur unsere besonders talentierten Mitschüler zu Siegen in der Landesolympiade, einem der seltenen Wettbewerbe, die man von aussen nicht beeinflussen konnte und nur die Leistung zählte, brachten aber auch unseren mathematisch nicht so aussergewöhnlich begabten Mitschülern bei, was Sinus und Cosinus ist und das Rechnen mit einem Rechenschieber, einem Hilfsmittel, das den gegenwärtigen jungen Generationen unbekannt bleibt. Der Physiklehrer „Supro“ (sudruh profesor = Genosse Professor) war ein Unikum. Wie der ihm selbst kreierte Kosename zeigt, benützte er mit Wonne alle möglichen und unmöglichen Abkürzungen. So verlangte er auch von uns, dass wir nicht nur die Physik, sondern auch seine Abkürzungen lernen mussten. Aber doppelt genäht hält besser. War es nur seine „Mücke“ oder wollte er fein und ohne Gefahr vor der Verfolgung, den damaligen Überfluss an Verkürzungen verspotten? Wie dem auch sei, er war, zwar nicht ein junger, aber desto grösserer Pionier, da heutzutage Fachartikel praktisch aus lauter Abkürzungen bestehen. Nicht selten bezeichnete er uns als Mistvieh und ähnliche Tiere, aber niemand nahm es ihm übel, da es klar war, dass er als ein guter Pädagoge entweder den augenblicklichen Zustand unserer Kenntnisse oder das Verhalten würdigte und nicht eine unveränderbare Eigenschaft. Während unseres Maturitätsjahres herrschte der erste, leider nur vorübergehend politische Frühling, aber die folgenden Winter waren nicht mehr so hart wie vorher. Dank diesem Tauwetter wurde ein würdiger, etwas altmodischer, feiner Herr Direktor unseres Gymnasiums. Die Ungarn haben dafür einen passenden Ausdruck: „uri ember“. Er unterrichtete auch ein Fach, das gut zu ihm passte – die Logik. In unserer Klasse herrschte nicht das übliche Chaos und Lärm, wenn manchmal die Unterrichtstunde später begann oder ganz ausfiel. Als Zeichen unseres guten Zusammenlebens und steigender Reife, las jemand von uns aus dem Svejk vor. Aus diesem Werk lernten wir, dass man dem Leben und seinen Schlägen wie auch verschiedenen Autoritäten mit einem gesunden Abstand und wenn möglich mit Humor begegnen sollte. Im Vorlesen folgten wir unbewusst einer sehr dünnen, vermutlich anorektischen alten Lehrerin der Sprachen (slowakisch sagt man solchen Menschen „nur die Seele geht in ihnen schlafen"), die kam, um ihren kranken Kollegen zu vertreten. Sie war Absolventin der Sorbonne. Sie war auch eine Pionierin, da sie schon damals antiautoritär unterrichtete. Die ganze Stunde verbrachte sie jeweils mit dem Lesen nicht der damals vorgeschriebenen Werke aus der Weltliteratur, sondern derjenigen nach ihrem persönlichen Geschmack. Sie hielt sich nicht nur am 6. Dezember, dem Klaustag, an den Spruch, den wir an die Tafel schrieben: Na sväteho Mikulasa, neuci a neskusa sa! (Am heiligen Klaustag wir weder unterrichtet noch geprüft!).

(1) Maturitätsfoto
Nach der Matura verteilten wir uns auf verschiedene Hochschulen. Nach fünf Jahren, noch mit unserem Studium beschäftigt, hatten wir noch keinen Sinn für ein Maturitätstreffen. Erst nach zehn Jahren begannen die Organisatoren mit Treffen in fünfjährigen Abständen. Mit fortgeschrittenem Alter treffen wir uns abwechslungsweise in zwei- und dreijährigen Abständen, womit wir den traditionellen Grundabstand von fünf Jahren doch halten. Nach dem ersten Treffen machte ich, wie auch manche andere, eine gezwungene Pause, da wir Flüchtlinge wurden. Als ich einen Gruß bekam, war ich einerseits froh, dass sie an mich dachten, anderseits traf es mich, weil ich nicht dabei sein durfte. Erst nach dreissig Jahren, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, konnte ich wieder dabei sein. Es war rührend, wieder fast alle alten Mitschüler zu sehen, dazu noch in dem etwas maroden, aber im Grunde unveränderten alten Gebäude. Auch betreffend unserer Beziehungen und Verhalten hatte ich nicht den Eindruck, dass ich so lange pausierte. Ein Freund sagte, wenn er in den vergangenen schwierigen Jahren jemanden aus der Klasse traf, konnte er ihm trauen und sich mit ihm offen und gelöst unterhalten, was damals nicht üblich war. Inzwischen wurde das Gebäude renoviert. Am Anfang der Treffen erinnern wir uns an die verstorbenen Kollegen, und geben bekannt, was mit uns inzwischen geschehen war. Wir bemühen uns nicht, in die Rolle der erfolgreichen, bedeutenden und einflussreichen Menschen zu schlüpfen, wie es nicht selten bei ähnlichen Treffen der Fall ist. Trotz wachsenden Erlebnissen, Erfahrungen, körperlichen und geistigen Änderungen, werden wir wieder Gymnasiasten. Maturanden aus anderen Klassen treffen sich entweder überhaupt nicht oder nur sporadisch. Sie wundern sich, dass wir diese Tradition so konsequent halten. Tun wir es, weil wir damals „an der Wurzel“ im damals alten Gebäude blieben? Kaum. Diese ungewöhnliche Stabilität in unseren geschäftigen, wechselhaften, an Änderungen reichen Zeiten tut uns gut. Es ist ein „Jungbrunnen“, ein natürliches Antiaging, und zeigt, dass ausser Familie, Religion, Nationalität, Politik, Wirtschaft, Finanzen, Gesundheit und Karriere im Leben und zum Leben noch etwas Wichtiges gehört - was?

(2) Die spätere Folge der Maturität - die Promotion

Heimat ist dort, wo du dich frei fühlst.
Neu Zürcher Zeitung 29.2.2020
Habe den Mut, dich zu Hause zu fühlen.
Thea Drost, Neue Zürcher Zeitung 7.7.17
Es war für mich nicht leicht, die Eltern, die Freunde, die bekannten Orte und Landschaften, die gewohnte Art des Handelns und Verhaltens, kurzum die Art des Lebens zu verlassen. Dazu eine relativ bescheidene wirtschaftliche Sicherheit mit einem Karriere versprechenden Posten, wenn man gewisse Regeln befolgte und sich mit der eigenen Meinung zurückhielt. Die Gründe für und gegen diesen Schritt konnte ich nur mit den Eltern abwägen, da es als eine strafbare Tat, als Verrat galt. Dazu kam, dass es nicht möglich schien, je zurückzukehren und die Zukunft unklar war. Abstossende Gründe mischten sich mit anziehenden. Bei Entscheidungen, die unser Leben auf den Kopf stellen, es umkrempeln, sind uns die wichtigsten Motive oft nicht klar. Ich war ein junger Wissenschaftler, den der Ehrgeiz trieb, etwas Grosses, für die ganze Menschheit Wichtiges zu entdecken, nicht nur der beschränkten Zahl der mir anvertrauten Patienten, nein, der ganzen Menschheit zu helfen. Von Fachliteratur, Kontakten mit Wissenschaftlern, Berichten der wenigen Glücklichen, die im Westen für eine kurze Zeit arbeiten durften, war mir klar, dass dort ausserdem materielle und geistige Bedingungen günstiger waren als in meinem Land mit einem System, das aus Prinzip beschränkte und unterdrückte, und für alles, was man durfte, den Herrschenden zu Dank und Lob verpflichtet wurde.

Ivan Pechan gehört zu den Menschen, bei denen ich mich schuldig fühle, und die ich, wo und wann auch, gerne wieder treffen würde. Ich lernte ihn anlässlich der jährlichen Konferenz kennen, an der Studenten ihre wissenschaftlichen Versuche präsentierten. Mit seinem Beitrag, einem brillanten Vortrag über Pharmakokinetik unseres oralen Antikoagulans Pelentan, gewann er den ersten Preis. Die westlichen Produkte Warfarin, Marcoumar und Sintrom waren für uns, schon wegen der Preise in Devisen nicht verfügbar. Abgesehen davon wollte der Ostblock selbständig und unabhängig sein, auch was Medikamente betrifft. Unsere Slovakopharma produzierte Pelentan für den ganzen Ostblock. Jedem Teilnehmer der Konferenz war klar, dass er den Aufgang eines neuen Sternes am Himmel der slowakisch medizinischen Wissenschaft beobachtete, auch wenn Ivans Leiter Kovalcik, Assistent der Pharmakologie, beteiligt war. Ich war als Student des ersten Jahres dabei, da ich mich auch in die wissenschaftliche Arbeit einführen lassen wollte. Ivan wurde mein strahlendes Beispiel. Nach dem zweiten Jahr des Studiums begann ich im Biochemischen Institut zu arbeiten. Es hatte den Ruf, beispielhaft organisiert zu sein und gute, zukunftsträchtige, wissenschaftliche Arbeit zu leisten. Nicht nur der Chef, Professor Niederland, der nach dem Krieg mindestens ein Jahr lang im Labor von Nobelpreisträger Cori in St. Louis arbeitete, aber auch alle Assistenten, die ihn bei seiner Abwesenheit vertraten, hielten ausgezeichnete Vorlesungen. Ich half bei den Versuchen, an denen sich alle Institutsangehörigen beteiligten – jeder hatte seinen Platz und seine Aufgabe. Es war jeweils ein Ereignis, als die Versuchstiere – Kaninchen – getötet wurden und jeder etwas Anderes untersuchte. Bereits während des Studiums wurde ich Mitautor zweier Facharbeiten. Ich half auch beim praktischen Unterricht. Unter der Führung von zwei Assistenten, R. Dzurik und P. Kovac, begann ich eine eigene kleine Arbeit über die Messung des Oxidations-Reduktions-Potentials im biologischen Material. Nach zwei Jahren meldeten wir sie an die jährliche Konferenz der studentischen wissenschaftlichen Arbeiten, und zu unserer grossen Überraschung gewann sie den Wettbewerb, ähnlich derjenigen von meinem Vorbild Ivan. Wir kamen uns auch persönlich näher. Ivan blieb nach der Promotion nicht am Institut für Pharmakologie, sondern aus ähnlichen Gründen wie ich, wählte er die Biochemie – sie schien ihm ebenfalls für eine erfolgreiche wissenschaftliche Tätigkeit geeigneter zu sein.
Ob in demselben oder ein Jahr später, verliess Professor Niederland samt seinen bewährten Assistenten das Institut und gründete eine neue III. Klinik für Innere Medizin. Nur P. Kovac und Ivan blieben unter dem neuen Chef, Professor Tursky, der aus Kosice kam, sowie ich als studentische Hilfskraft. Ich begann Ivan bei der Einführung der Messungen der prostataspezifischen Phosphatase in der Slowakei zu helfen. Die Proben erhielten wir von der urologischen Klinik. In diesem Projekt zeigte sich die Tendenz von Ivan, als Sohn eines Chefarztes, an Aufgaben zu forschen, die eine unmittelbare Bedeutung für Klinik, Praxis und Patienten hatte. Ich lernte auch seine Laborantin und spätere Frau Edit näher kennen. Ein Jahr später beendete ich das Studium, nachdem ich die Hindernisse überwunden hatte, die mir manche meiner politisch einflussreichen Studienkollegen in den Weg gelegt hatten, da sie mir das unabhängige freie Urteil und die Einstellung, (was ich in „Prozesse“ näher beschreibe) nicht vergessen konnten, erhielt die sehnsüchtig gewünschte Stelle als Assistent des Biochemischen Instituts und wurde Kollege von Ivan.

(1) Ivan Pechan
Ich bildete aber mit einem anderen Kollegen eine Gruppe, deren Aufgabe es war, die Untersuchung der Eiweisse mittels einer neuen Methode einzuführen. Unsere Arbeit bestand aus der Suche nach einer dafür geeigneten Sorte von Stärke, die wir zu einem Gel kochen sollten. Es war nicht einfach. Anfangs hoffnungsvoll kauften wir naiv gleich einen grossen Sack Stärke. Aber wie und wie lange wir sie auch kochten, was wir pingelig genau protokollierten, ergab sie kein geeignetes Gel. So suchten wir weiter und kauften in verschiedenen Läden jeweils kleine Mengen. Aber auch so wurde uns kein Erfolg beschieden. Es erinnerte mich an ein slowakisches Märchen aus der Kindheit, in welchem ein Riese namens Loktibrada (Langbart) für seine Brüder einen Buchweizenbrei kochte, aber ein Zwerg kam und sagte ihm: „Du kochst den Brei, aber essen wirst Du ihn nicht!“. Tatsächlich weder die hungrigen Riesen bekamen ihren, noch wir unseren Brei. Ich musste ins Militär einrücken, wo ich statt der üblichen sechs Monate wegen des Baus der Berliner Mauer ein ganzes Jahr dienen musste. Mein Mitarbeiter hörte ebenfalls auf, die Stärke zu kochen und bekam eine andere Aufgabe.
Nach der Rückkehr wurde ich Ivan mit seiner Frau Edit als Laborantin zugeteilt. Es begann eine sehr schöne und fruchtbare Zusammenarbeit, wie die vierzehn gemeinsamen fachlichen Veröffentlichungen aus diesen Jahren zeigen. Vermutlich waren wir nahe an zwei wichtigen Entdeckungen, eine davon im Widerspruch zur damals herrschenden Meinung (die Desoxiribonucleinsäuren im Gehirn seien stabil und haben keinen Umsatz). Auch auf Grund unserer sozialistischen Erziehung waren wir nicht gewohnt, uns fehlte der Mut, einer offiziellen Meinung und Autoritäten zu widersprechen. Stattdessen wiederholten wir relativ alte Versuche und bestätigten die Ergebnisse, über die es eigentlich keinen Zweifel gab. Das entsprach nicht meinen Bemühungen um Originalität und meiner Hoffnung, etwas ganz Grosses, Bedeutendes zu entdecken. Wozu bin ich in der Forschung, wozu bin ich ein Wissenschaftler geworden? Die Spannung zwischen uns stieg. Dazu trug auch ein neues, vorübergehendes Mitglied des Teams, eine Doktorandin, bei. Eine Zusammenarbeit zwischen vier Menschen mit verschiedenen Naturen ist um einiges anspruchsvoller, noch dazu in einem kleinen Laboratorium. Ich dachte, der Chef werde darüber empört sein, aber die Sitzung entschied mit Ruhe, dass wir uns trennen sollten. Ivan war fair und überliess mir einen Teil der Aufgaben. Unter anderem auch zu bestimmen, was eine flüchtige Substanz sei, die man nur in frischen Hirnextrakten finden konnte. Später waren wir beide überzeugt, dass es das wichtige zyklische-AMP war. Unsere Beziehung beruhigte sich auch. Es war eine schöne Zeit für das ganze Institut. Wir machten zusammen Ausflüge, gingen Skifahren. Ich bereitete mich vor, die nächste Karrierehürde zu nehmen und den Titel des „Kandidaten der Wissenschaft“ zu erwerben. Mein Thema war „Die Synthese der Pyrimidine im Gehirn“. Wie üblich, begann es mit der Sammlung der Literatur. Ich durfte für ein paar Tage nach Prag, da dort die Bibliotheken besser ausgestattet waren. Eines Abends ging ich zum Altstädterring, wo neben dem alten Rathaus ein Denkmal für die dort im 17. Jahrhundert hingerichteten tschechischen Adeligen steht. Erstmals nahm ich den Titel „Freiherr von ...“ (slobodny pan z …) wahr. Wie gerne würde ich auch ein, wenn auch nicht adeliger „freier Herr“ werden! Ich sollte mit der praktischen Arbeit beginnen.

(2) Ivan und Edit
In der Zeit weilte Ivan als Humboldtstipendiat in der Bundesrepublik im Institut von Professor Gerlach in Freiburg, den wir aus der Literatur kannten. Trotz unserem früheren Zerwürfnis fragte er mich, ob ich nicht sein Nachfolger dort sein möchte, was ich mit Begeisterung und Dankbarkeit bejahte. Ich beantragte das Stipendium, wie er es mir empfahl. Beide ahnten wir nicht, dass ich ihm dadurch das Leben komplizieren werde. Aus verschiedenen, nicht nur fachlichen Gründen war ich überzeugt, dass ich den Beschränkungen des Lebens im „realen Sozialismus“ entkommen und ein „freier Herr“ werden wollte. Mein Vater trug wesentlich dazu bei, da er meinte, ich sollte eine bessere Zukunft haben. Es wäre auch besser, nicht auf den Austausch mit Ivan zu warten, da man in den unsicheren Zeiten nicht wisse, ob man dann überhaupt noch ins Ausland gehen könne. Im Prinzip behielt er recht, in der genauen Zeit irrte er sich um drei Jahre. Ich nützte die Ferien in England und rief Professor Gerlach von dort an, ob ich das Stipendium um ein Vierteljahr früher antreten könne. Er hatte eine gute Verbindung mit der Leitung der Alexander-von Humboldt-Stiftung. Bald bekam ich die Antwort, es sei in Ordnung. Als ich im Labor in Freiburg erschien, war Ivan schon informiert. Ich erwartete Fragen, Vorwürfe, weil ich nicht mehr in die Slowakei zurückkehren wollte. Ivan blieb jedoch neutral freundlich und half mir, wie er nur konnte, auch wenn ihm dadurch das Leben zu Hause kompliziert wurde. Meine Gründe blieben für ihn Tabu. Er führte mich in seine Arbeit, die Synthese von Purinen in Schnitten verschiedener Gewebe ein.
Das erste Wochenende erwarteten wir beide mit Spannung, ich noch etwas mehr als Ivan. Ein Kollege aus dem Institut in Bratislava beabsichtigte, Ivan zu besuchen. Er war ein unkritischer, uneinsichtiger, fanatischer Kommunist, der eine gute Beziehung zum Zentralkomitee der Partei und zum Staatssicherheitsdienst pflegte und terrorisierte nach dem „Prager Frühling“ fast alle Mitarbeiter des Instituts und verdarb ihnen das Leben. Ich befürchtete, dass er mich aus Ärger verschleppen oder sogar ermorden lässt, weil ich nicht mehr in die Slowakei zurückkehren wollte. Diese Befürchtungen waren übertrieben, so wichtig war ich schon nicht, dass sie sich damit die Mühe machten. Aber wir atmeten ziemlich tief auf, als er mit seiner Familie nicht erschien. (Nach der „gesamten Revolution“ gehörten seine Kinder zu den ersten, die im Westen studierten!?)
Ganze Tage, nicht selten bis in die Nacht, verbrachten wir mit der Arbeit im Institut, was wir oft auch schon zu Hause taten. Wir schätzten und genossen die für uns ungewöhnlich günstigen Bedingungen. Wir hatten auch keine familiären Verpflichtungen. Einmal kam Professor Gerlach und sagte, wir sollten uns überlegen, was wir brauchen würden. Er bekam von irgendeiner staatlichen Institution DM 50'000.00. Ob von diesem Geld oder aus einer anderen Quelle, wir erhielten einen der ersten Tischcomputer der Firma Olivetti, den wir selbst für unsere Rechnungen und statistischen Auswertungen programmierten! Eine für uns auch ungewöhnlich umfangreiche Bibliothek gehörte dem Biochemischen Institut (wir arbeiteten in der Physiologie) in unserem Gebäude, zu der wir immer, Tag und Nacht und an Feiertagen freien Zugang hatten. In dem Institut arbeiteten früher auch die Nobelpreisträger Warburg und Krebs. All das war für uns ein riesiger Ansporn und gab uns die Sicherheit, dass wir etwas Wichtiges, etwas Bedeutendes taten. In unserer Begeisterung dachten wir übermütig und naiv, auch wir werden einmal den Nobelpreis bekommen. Wir waren wie zwei gute Brüder. Ich schätzte immer mehr, dass Ivan, obwohl er zu Hause als eigentlicher Fluchthelfer galt, gegenüber mir keine Abneigungen entwickelte und zu spüren gab, auch nicht ein Quäntchen Neid.

(3) Festen mit Ivan
Vor Weihnachten 1967 endete sein Aufenthalt, aber Professor Gerlach vermittelte ihm durch die Humboldt-Stiftung wieder einen kurzen Aufenthalt in Aachen für den nächsten Sommer. Er kam jetzt mit seiner Frau Edit, aber die zwei Söhne mussten als Pfand zu Hause bleiben. Wir erlebten schöne zwei bis drei Wochen, und wenn wir nicht arbeiteten, unternahmen wir mit ihrem Wagen schöne Ausflüge in den Schwarzwald. Ich besass noch immer keinen. Nachdem die Russen den „Prager Frühling“ beendeten und viele Wissenschaftler die Tschechoslowakei verliessen, erwarteten wir, dass Ivan mit Familie kommen wird. Professor Gerlach hätte ihn mit offenen Armen empfangen. Aber er kam nicht. 1970 verliess ich das Institut von Professor Gerlach, der inzwischen nach Aachen umzog, wo ich ein halbes Jahr verbrachte, Richtung Zürich. Ich dachte, Ivan wird mir diese „Untreue“ übelnehmen. Später vernahm ich, dass er auch jetzt Verständnis zeigte, weil er wusste, dass Professor Gerlach und ich inkompatibel waren. Er erlebte, wie wir zur Besprechung der Veröffentlichung einer Arbeit erst um 23 Uhr verabredet waren. Wir mussten bis nachts um halb zwei auf Professor Gerlach warten. Für mich war es unerträglich, erniedrigend und unverträglich mit dem angestrebten Zustand als „Freiherr“. Ich verliess nicht ein willkürliches System, das beschränkte und flüchtete, damit ich in ein Ähnliches gerate. Ivan schickte sich leichter in solche Situationen, auch weil er auf die Gunst des ehemaligen, unfreiwilligen, minderjährigen Flakschützen, der als Folge unter Schlafstörungen und Neurosen litt, mehr angewiesen war. Ich litt mit und durch Professor Gerlach wieder unter den Folgen des Krieges.
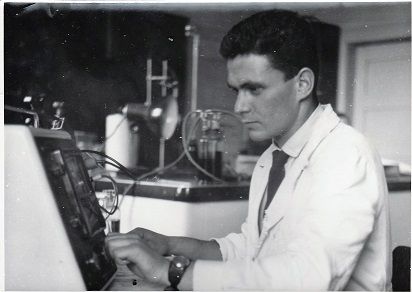
(4) Als Humboldt-Stipendiat im Labor
Dann kam „Dunkel“ in die Tschechoslowakei. Unser Kollege, dessen Besuch wir am ersten Wochenende in Freiburg befürchteten, wurde Chef des Instituts. Lange Jahre hörte ich nichts von Ivan. Ich schickte weiterhin meine Neujahrsgrüsse. Ende der 80-er Jahre liess er mich wissen, dass er auf dem Rückweg nach seinem Aufenthalt im Labor von Professor Gerlach über Lindau fahre, wo wir uns treffen könnten. Er wusste, dass ich auf der anderen Seite des Bodensees in Romanshorn wohnte. Unsere Beziehung war wieder so, als ob wir uns nicht jahrelang aus den Augen verloren hätten. Und so war es mit ihm immer wieder, auch als wir uns später wieder zu Hause trafen. Es freute mich, dass wir uns noch kurz vor seinem Tod, als er schon von seiner schweren Krankheit gezeichnet war, treffen und verabschieden konnten.

(5) Neurochemiegruppe des Instituts für Hirnforschung der Universität Zürich; von links Professor M. Cuénod, Lucette Heeb, Eva Niederer und Peter Marko
Unzufrieden mit Professor Gerlach, suchte ich eine neue Stelle. Durch Freunde in Basel erfuhr ich, dass das neu gegründete Friedrich-Miescher Institut Biochemiker benötigte. In der Tat, sie nahmen mich auf, aber da sie noch nicht genügend eigene Räume hatten, "liehen" sie mich an das Institut für Hirnforschung der Universität Zürich aus. Ich hatte Glück. Einen Tag bevor die Grenze wegen der sogenannten Schwarzenbach-Initiative für Einwanderer geschlossen wurde, kam ich in die Schweiz. 
(6) Institutsausflug auf dem Vierwaldstättersee; zweite von links Peter, vierte von links halbbedeckt Silvia


(1) Hochzeitsanzeige
Verwundet durch die Wirrungen, Verwirrungen und Enttäuschungen mit Bekanntschaften, Lieben, Verlobungen sehnte ich mich desto mehr nach der endlich richtigen, zu mir passenden Frau, mit der ich wegen meines fortgeschrittenen Alters leider nicht mehr die ursprünglich nach dem Beispiel des Grossvaters erwünschte Zahl von fünf Kindern haben konnte. Aber zwei bis drei sollten es schon noch sein.
Eines schönen Frühlingstages, wir arbeiteten im Labor im Untergeschoss des Hirnforschungsinstituts, zeigte mir die trotz ihres jungen Alters weise, lebenserfahrene und viel wissende Mitarbeiterin Lucette auf zwei Frauen, die gegenüber unserer Fenster aus einem weissen Mittelklasswagen ausgestiegen waren, und fragte mich, ob eine von ihnen nicht für mich geeignet wäre. Schon beim ersten Blick hatte ich nichts dagegen, nur war mir nicht klar, wie ich zu diesen zufälligen Besucherinnen Kontakt aufnehmen könnte. Ich brauchte mich nicht damit zu beschäftigen, da Lucette gleich präzisierte, die Schwarzhaarige sei die neue Sekretärin, die andere ihre Schwester. Sie arbeite bei uns teilweise, da sie nur ein Symposium und den neuen Postgraduate Kurs organisieren helfe. Das beruhigte mich, da ich so genug Zeit hatte und nicht gleich aus dem Haus stürzen und vor allem nicht wieder etwas überstürzen musste. Ein paar Tage später kam zu unserem Fenster alleine ein kleiner hübscher Knabe, der sich ohne Scheu erkundigte, was wir da machten. Er wollte etliche Einzelheiten wissen und diskutierte lange fast fachkundig mit uns. Als er befriedigt wegzog, sagte Lucette, das ist der Sohn der neuen Sekretärin. Sie ist eben eine Witwe. Ich dachte, so ein gelungenes Kind ist keine schlechte Referenz für die Mutter und ein gutes Muster für weitere Nachkommen.

(2) Braut mit Daniel; Im Hintergrund mein Vater
Wir trafen uns während der Arbeit, und sie gefiel mir immer mehr. Ihre Haltung und Bewegungen waren anmutig, die Stimme angenehm, melodisch. Nur etwas schreckte mich ab: sie war immer passend und geschmackvoll angezogen, aber es dauerte für mich zu lange, bis sie wieder dieselben Hosen, dieselbe Bluse oder denselben Pulli anhatte. Ich dachte mir, wie sollte ich einmal die Ansprüche dieser Frau befriedigen? Ich war nicht der Einzige, dem sie gefiel. Wie Hummeln auf eine bunte Blume, flogen alle mehr oder auch weniger geeigneten Männer auf sie, was meine Befürchtungen noch steigerte. Wieso sollte sie bei einer solch reichhaltigen Auswahl ausgerechnet mich wählen, und noch schwieriger und betrübter, mir treu bleiben? Zu einem Fest brachte sie den Sohn mit, der mit dem grossen Institutschef wie mit einem gleichaltrigen Freund umging, ihn vor allen laut fragte, was er wissen wollte, und es war nicht wenig, und ihn auch so furchtlos und selbstverständlich duzte, was alle beeindruckte und erheiterte. Der Chef besiegelte die Freundschaft und versicherte ihm, dass dieses Duzis für immer bleibe, was er ihm sogar später schriftlich bestätigte.
*
Mit dem Institut gab es regelmässig Feste wie auch Ausflüge. Nach so einem Fest lud uns Silvia nach Hause zu einem Drink ein, um den schönen Tag „abzurunden“. Lange machte niemand Anstalten, die Runde zu verlassen. Ich hatte schon damals zu lange Sitzungen nicht gern, war müde, wollte sie nicht stören und ohne mich zu verabschieden, schlich ich mich heim. Bevor die anderen endlich gingen, suchten sie überall, auch unter den Betten nach mir, da sie vermuteten, ich könnte mich versteckt haben, um mit der Gastgeberin die Nacht zu verbringen, was vor allem ihr Wunschtraum gewesen wäre. Inzwischen erfuhr ich, dass ihr Mann bei einem Arbeitsunfall verunglückte, als Daniel drei Monate alt war, was meinen Gefühlen auch Mitgefühl beimischte.

(3) Hochzeitsfoto mit Kanone; Ivan Pechan meinte, es ist ein Omen, es wird gekämpft.
Irgendwie merkte ich, dass auch ich Silvia nicht gleichgültig war. Als das von ihr organisierte Symposium zu Ende war, brachte sie mir ein verziertes Kaffeelöffelchen ins Labor, ein Geschenk für die Teilnehmer des Symposiums, was übrig blieb. Sie war dabei etwas verlegen. Ich fand das niedlich. Mehrmals wollte ich mich mit ihr verabreden, fand aber keine gute Gelegenheit dazu. Bald nach dem Symposium endete auch ihre Anstellung im Institut, auch wenn sie hätte bleiben können. Man wollte nicht so eine tüchtige Arbeitskraft verlieren. Silvia aber wollte die Matura nachholen. Sie begann schon via Fernstudium damit, und da sie es beschleunigen wollte, drückte sie wieder die Schulbank. Eines Samstags im August fasste ich meinen ganzen Mut zusammen und rief sie an. Ich fragte, ob sie nicht Lust hätte, am nächsten Abend mit mir etwas zu trinken. Ich erinnere mich nicht mehr, wieso ich wusste, dass Daniel nicht zu Hause war. Sie sagte ja. Sie kam in einem Minirock mit breiten weiss-roten Streifen, der ihre gebräunten Beine gut zur Geltung brachte. Wir gingen zuerst ins Restaurant Dézaley etwas Weisswein trinken. Ich wollte meine Weltläufigkeit vorführen und bestellte dazu Schnecken. Sie ass sie. Erst viel später stellte sich heraus, dass es das erste Mal in ihrem Leben war, und sie dazu einen Ekel vor solchen Speisen hatte. Diese Geschichte widerlegt eine der Grundbehauptungen der Psychologie, nämlich, dass der erste Kontakt entscheidend sei. Trotz dieses Fehltritts wurde unsere Ehe ein Erfolg. (Die positive Ersatzerklärung – Silvia war mit mir bereit, sogar Schnecken zu essen.) Nach den Schnecken sind wir zu ihr nach Hause gegangen. Unterwegs machten wir Halt bei der alten Kirche in Witikon und bewunderten einen wunderschönen Sonnenuntergang, wobei wir den ersten körperlichen Kontakt übten. Diese Übung setzten wir zu Hause fort. Wir waren eindeutig verliebt.
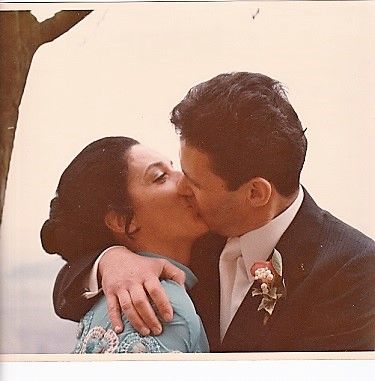
(4) Hochzeitskuss, auch ein Omen
Nur war da auch Daniel. Als ich während seiner Anwesenheit wieder kam, musterte er mich lange, und fragte dann: „Willst Du uns heiraten?“ Meine Begeisterung über diesen Vorschlag musste ich nicht vorspielen. Silvia meinte, mich beruhigen zu müssen, und erklärte mir, dass er diese Frage jedem männlichen Besucher stelle. Wie mich sein Wunsch auch freute, fragte ich mich, ob ich diese Aufgabe, ein Kind, noch dazu so ein grosses anzunehmen und ihm ein guter Vater zu sein, erfüllen könne. Wie sollte ich mich nur davon überzeugen? Ich erinnerte mich, dass mir bei den Schwierigkeiten mit der letzten Verlobung und als ich die Berufsrichtung ändern wollte, eine ältere Graphologin und Psychologin sehr half. So ging ich wieder zu ihr. Sie versicherte mir, dass ich dazu sehr gut fähig sei, ich könne Verantwortung tragen. Mit dieser Mutter werde es auch noch leichter. So nebenbei sagte sie, nicht nur für Daniel, aber auch für uns beide wäre es gut und an der Zeit, einen zuverlässigen, festen Partner zu haben. Dadurch bestärkt, steuerte ich jetzt sicher und entschlossen den Hafen einer baldigen Ehe an. Wir heirateten im Februar, nicht bedacht, dass sich dieser Termin auch bei künftigen Jubiläen mit der Grippewelle überlappen kann.

(5) Mit Eltern und Zeugen: Von links Silvias Eltern, Schwager Frido, Hochzeitspaar, Schwägerin Maria, meine Eltern und vorne in der Mitte Daniel, der dazu lieber die Augen schliesst.
Sicherheitshalber wollte ich mich noch überzeugen, dass Silvia doch nicht eine „Fufulka“, ein verwöhntes Luxusweibchen ist. Ich war ein eingefleischter „Zeltler“ und schlug vor, die Herbstferien im Ardèche-Gebiet zu verbringen. Übernachten konnten wir in meinem Zelt. Daniel war begeistert. Silvia wollte mit ihrem Wagen und nicht mit meinem kleinen Käfer fahren, damit wir genug Platz fürs Gepäck hatten. Am Morgen der Abreise rief sie mich an, dass ihr Wagen nicht starten wolle, etwas sei kaputt gegangen. "Kein Problem, wir fahren mit dem Käfer, obwohl die Gepäckklappe seit zwei Tagen nicht mehr geschlossen werden kann", sagte ich. Ich wollte sie erst nach den Ferien reparieren lassen. Mühsam liess sie sich überreden, sowohl weniger einzupacken, als auch den Gepäckraum provisorisch mit einem Seil zu verschliessen. Etwas später als geplant, brachen wir auf. Spätnachmittags kamen wir an und fanden auf einem praktisch leeren, schönen Zeltplatz in einem Pinienhain problemlos Platz. Selbstverständlich konnte man im Oktober nicht mehr mit den Flossen die Ardèche runter fahren, wie in einem Artikel in der „NZZ“ beschrieben wurde. So machten wir schöne Ausflüge mit dem Auto sowie auch zu Fuss. Silvia meisterte das Zeltleben, wie wenn sie schon immer solche Ferien gemacht hätte. Sie schlief mit Daniel im Zeltinneren, ich in dem Vorraum. Am Abend vor der weiteren Reise in den Süden, in die Provence, die berühmte Camargue, sassen wir alleine, Daniel schlief schon, und wir tranken noch etwas Wein. Jetzt war ich an der Reihe, und fragte, ob sie mich heiraten wolle. Sie war einverstanden. Im Süden war schlechtes Wetter, aber Daniel war vom Meer begeistert, nur als er schnell im Meer baden wollte, kam er schreiend und schnell wie ein Pfeil wieder raus, denn leider rutschte er am Tag vorher an einem Hang aus und schürfte sich den Popo wund. Die vielen Sehenswürdigkeiten interessierten ihn weniger. Ich merkte, dass Silvia dafür echtes Interesse hatte, und dachte, wie gut, dass ich auf diese vielseitige Frau gewartet hatte.

(6) In der Mitte mit grauen Haaren Opa - der Grossvater von Daniel und links von ihm neben der Braut meine Cousine Darinka. Mit der Familie Rüfenacht pflegen wir eine schöne, enge Beziehung.
*
Wir suchten einen schönen Platz für die Hochzeit. Es war nicht so leicht. Alle drei fuhren wir um Zürich herum und lernten dabei nicht nur einen schönen Teil des Zürcher Ober- und Unterlandes und der Ostschweiz kennen, sondern auch uns gegenseitig. Nicht leichter war die Suche nach den katholischen und protestantischen Pfarrern, die schon damals bereit waren, ökumenisch zu trauen. Aber auch das ist uns gelungen, wie auch Daniel seine Hochzeitsrede. Nach der Hochzeitsreise wurde ich Abstinent. Als meine Semesterkollegen zum Besuch kamen und sahen, dass ich nur Sauermilch trank und den Wein ganz ihnen überliess, erschraken sie und fragten sich, was für eine Hexe ich geheiratet hätte, die mich so schnell schon so verändern konnte. Ich erklärte nicht, dass ich während der Zeugungszeit auf Alkohol verzichten und alles tun wollte, damit meine Spermien nicht verdorben werden. Die Abstinenzzeit dauerte zum Glück nicht lange. Bald setzte sich eine von ihnen durch, wie auch meine Bemühungen um eine selbständige Praxis. Ich sah nicht ein, wieso ich auf eine tüchtige Säule der Praxis verzichten sollte, und so opferte Silvia dafür ihren Traum – Matura, eventuell ein weiteres Studium.

(7) 40 Jahre später
Es gibt selbstverständlich tiefe Gründe, die uns damals nicht klar waren, warum es bei uns nicht bei einem mehr oder weniger kurzen körperlichen Rausch und Verliebtheit geblieben ist, und warum unsere Ehe trotz häufigen kurzfristigen Gewittern schön, interessant, spannend und glücklich geblieben ist. Vielleicht konnte schon die Graphologin es aus der Schrift ersehen, uns wurde es erst mit der Zeit allmählich bewusst. Wir beide stammen aus kleinbürgerlichen selbständigen Unternehmerfamilien, die ähnliche, nicht nur finanzielle Probleme hatten. Silvia wuchs in einem kleinen Dorf, ich in Martin, damals eigentlich ein grosses Dorf, in einer vorwiegenden Arbeitergegend auf. In meiner frühen Kindheit waren zum grossen Teil Arbeiterkinder meine Spielkameraden. Wir wurden wegen des Judentums schon seit Jahrhunderten verfolgt, während des Krieges unser Leben bedroht, und deswegen wechselten wir die Religion. Silvias Vater wechselte sie unter einem anderen Druck - er hätte sonst Grossmutter nicht heiraten und somit auch sozial aufsteigen können - aber heimlich übte er den Protestantismus weiterhin aus. In ihrer Diplomarbeit zeigte Corinne einen weiteren Grund, eine weitere Parallele – als Juden gehörten wir zu minderwertigen Menschen, wurden unterdrückt und verfolgt, Silvias Vater als Verdingkind ebenfalls. Solche Erfahrungen und Einflüsse prägen über mehrere Generationen die Sicht und den Umgang miteinander und mit der Welt.

(8) 40. Hochzeitstag: Festgemeinschaft (enger familiärer Kreis): links hinten Daniel, Peter, Silvia, Alexa, Barbara; unten Corinne mit Liv, Christian mit Tim

In unserem Dorf praktizieren drei Ärzte: ein Chirurg, ein Internist und ich als Allgemeinpraktiker. Wir vertreten uns gegenseitig während der Ferien und leisten abwechslungsweise Wochenenddienste, auch im Spital, so dass wir über unsere Patienten eine gute Übersicht haben. Unser Gebiet ist zirka 25 km lang. Ungefähr die Hälfte unserer Patienten sind Bergbauern, die in den kälteren Jahreszeiten ihre Zipfelmützen tragen. Trotz der Spezialisierung sind wir oder wollen wir alle drei das sein, was man Familienarzt nennt. Wie macht unsere, meistens bodenständige, zur Tradition neigende Bevölkerung von unserem Angebot Gebrauch? Es gibt bei uns die verschiedensten Variationen über das Thema Arzt-Patient- beziehungsweise Familien-Arzt-Beziehung. Da sind Familien, deren Mitglieder grundsätzlich nur in Notfallsituationen zu uns geraten, sonst gehen sie zu den Ärzten außerhalb des Tales, ins Unterland. Der Grund liegt meistens weder in ihren Enttäuschungen noch in unseren Unfähigkeiten, sondern eher in ihrem Minderwertigkeitsgefühl, das sie in uns projizieren: Alles, was man zu Hause haben kann, ist nicht gut, ausserhalb liegt die grosse, fähige Welt. Oder wollen sie daheim ihre Schwäche, die Krankheit, nicht zugeben, nicht gelten lassen? Dann kommen solche Familien vor, von denen das eine zum einen, das andere Mitglied zum anderen Arzt geht, manchmal ständig, manchmal wechselhaft. Weitere Familien wandern oder wandeln nach Ablauf des Krankenscheines von einem Arzt zum anderen. Wieder andere Patienten sind hie und da sogar mit demselben Leiden gleichzeitig bei zwei Aerzten oder bei allen dreien in Behandlung. Einmal traf ich meinen Kollegen beim Besuch desselben Patienten. Selbstverständlich sind auch viele Patienten und Familien ganz treu und wechseln nur im Notfall. Es gibt Patienten, die während der Abwesenheit ihres Arztes nicht zum diensthabenden Kollegen gehen und so wegen zu guter beziehungsweise zu enger Arzt-Patient-Beziehung ihren Zustand unnötig verschlechtern.
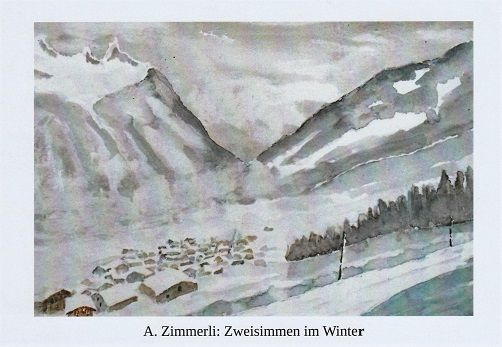
(1) Zweisimmen im Winter; Aquarell des einstigen Chefarztes A. Zimmerli
Unter Familientherapie stellte ich mir, leicht übertrieben, ungefähr folgende Situation vor: Es gibt ein krankes Familienmitglied, das aber nicht so krank ist, wie es beziehungsweise seine Familie meint, und die Familie ist an seiner Krankheit mitbeteiligt, mitschuldig. Sie sind alle etwas krank. Sie übertragen ihre Krankheit auf das eine Mitglied. Der Arzt - am leichtesten gelingt es eben dem Familienarzt - bringt dies der Familie bei, versucht, am besten in Form gemeinsamer Sitzungen am runden Tisch (die Grossmutter darf am Kachelofen sitzen), jedem seine eigene Krankheit wieder zuzuordnen. Dadurch werden sie zwar zu Beginn alle bewusst etwas krank, aber dieses gewisse Etwas, so verteilt, ist dann im günstigsten Falle leichter wegzuheilen, als wenn das Ganze an einem Familienmitglied hängt.
Mit diesen Vorstellungen begann ich auch meine Praxis. Wenn zum Beispiel eine nervöse, überbelastete, junge Bäuerin zu mir kam, versuchte ich, wenn nicht auch immer die Schwiegermutter, so doch mindestens den Ehemann in meinen Therapieplan einzubeziehen. Als ich sah, dass nach einer solchen Andeutung weder die Schwiegermutter noch der Ehemann zugänglich waren, sondern sogar die Patientin selbst nicht mehr in der Sprechstunde erschien und im Dorf noch Unwahrheiten über mich erzählte, wurde ich eines Besseren belehrt.
Einen anderen Verlauf nahm es bei Frau Sch., die mit den verschiedensten Beschwerden zu mir kam. Ihr Ehemann ist etwa um 16 Jahre älter und noch sehr rüstig (sie selbst ist Ende 50). Er kommt fast täglich zum Jassen und um "einen zu kippen" ins Dorf. Ihr Hauptproblem habe ich bei einer Überweisung wie folgt geschildert: "Sie kommt immer wieder mit irgendwelchen Beschwerden, mehr um der Einsamkeit und Eintönigkeit zu entkommen, als dass sie wirklich leidet. Für sie ist das Kommen von K. nach Zweisimmen vergleichbar mit Ihren Gefühlen, wenn Sie einen Kongress in New York besuchen." In diesem Falle versuche ich, weder ihr das Jassen beizubringen noch ihn zur Beschränkung zu überreden, sondern ihre manchmal wirklich kleinen Beschwerden (zum Beispiel ihre Hühneraugen) allen Ernstes und mit Hingabe wochenlang zu behandeln, und gebe ihr damit, bei Bedarf ein- bis zweimal wöchentlich, die Gelegenheit, stolz triumphierend hinter ihrem Mann ins Dorf zu marschieren, wo sich ihre Wege trennen. Wenn sie Glück hat und bei mir lange warten muss, erlebt sie noch dazu die Live-Vorstellung, das Happening des Wartezimmers. Allem Anschein zum Trotz ist diese Behandlungs- und Verhaltensweise sowohl eine Art von Familientherapie wie auch kostensparend. Frau Sch. leidet nicht an schweren Krankheiten und brauchte während dieser Zeit noch keine Spitalaufenthalte. Zweimal versuchte ich die höhere Familientherapie und sprach mit Herrn Sch. darüber, seiner Frau sage und schreibe 5 Tage Ferien mit ihren zwei noch ledigen Töchtern zu erlauben. Letztes Jahr habe ich es umsonst versucht, und Herr Sch. sowie die Krankenkasse haben dies deutlich zu spüren bekommen. Dieses Jahr war mir Erfolg beschieden.
Manchmal kann man eine Art von Familientherapie betreiben, auch wenn man nicht mit der ganzen Familie Kontakt hat. Im Falle von Herrn M. liegt die Familientherapie eben darin, dass ich nur ihn und nicht seine allmächtige, diesem kleinen, alten Mann das ganze Leben beherrschende und beschränkende Frau behandle. Bis dahin konnte ich alle ihre Versuche, sich bei mir einzunisten, mit Erfolg abwehren. Mit einem Teil seines Lebens ist er wenigstens ausserhalb des Hauses selbständig, und das ist auch für die Frau besser.
*
Jetzt möchte ich Ihnen den eigentlichen (Parade-)Fall meiner familientherapeutischen Bemühungen vorstellen. Es handelt sich um die Familie G.. Am Anfang erschien immer die ganze Familie G. im Wartezimmer, auch wenn nur ein Kind krank war. Ich fragte mich, was diese Demonstration zu bedeuten habe, und dachte: Hier stimmt etwas nicht. Ich horchte auf, als mich Frau G. fragte, ob sie richtig handelte, als sie einem schwer erziehbaren, an Schlafstörungen leidenden Kind, welches bei ihr zu Besuch weilte, ein Beruhigungsmittel gab. Meine Antwort war: Es war nicht schlecht, aber was geschieht sonst mit dem Kind? Ist es in Behandlung? Oder füttert man es nur mit einem Medikament? Nach seinem Ursprung habe ich nicht geforscht. Einige Monate später kam Herr G. mit Symptomen, die einer Depression entsprachen, in meine Behandlung. Ich erfuhr, dass der Grund seiner Mißstimmungen vor allem das Verhalten der Kinder, besonders von Stephan, war. Ich versuchte, das Ganze zu bagatellisieren, ungefähr in dem Sinne, dass wir alle mit den Kindern unsere Probleme haben, und wenn er und seine Frau sich in ihren Forderungen einig seien und sich nicht gegenseitig ausspielen, werde sich schon alles zum Besseren wenden. Offensichtlich half es nicht, da bald beide Eltern zu mir kamen. Die Mutter weinte und meinte, so gehe es mit Stephan nicht, sie ertrage ihn nicht mehr, es müsse etwas geschehen. Ich solle mich mit dem Kinderpsychiater in A., wo sie früher wohnten, in Verbindung setzen. So erfuhr ich sowohl von den Eltern wie auch vom Psychiater folgendes: Frau G. heiratete Herrn G., ohne zu wissen, dass er ein Trinker war. Er hat zwar mit dem Trinken aufgehört, ist jetzt aber ein eher strenger, ernster, spiessbürgerlicher Mensch. Bei der ersten Schwangerschaft wünschte sich Frau G. ein Mädchen, und es kam Stephan, mit dem es schon seit dem Säuglingsalter Schwierigkeiten gab. Er litt immer unter Schlaflosigkeit. Alles verschlechterte sich noch nach der Geburt von Thomas. Wegen all dieser Probleme gelangte die Familie zum Psychiater, der Stephan Tacitinsirup verschrieb und der mir das äußerst aggressive Verhalten Stephans gegen seine Mutter, teilweise verbunden mit halluzinatorischen Zuständen, bestätigte. Gespräche mit den Eltern oder eine andere Therapie für Stephan fanden nicht statt. Ich versuchte, sie zu beruhigen. Anfangs verschrieb ich auch Tacitinsirup, sprach mit den Eltern und erteilte kleine Ratschläge. Es half zwar etwas, aber nicht allzuviel, und so schlug ich vor, Stephan wieder für eine Therapie an einen Kinderpsychiater zu überweisen. Der erste Versuch misslang, sowohl Stephan wie die Eltern waren unzufrieden.
Den letzten Anstoss zum Abbruch der Therapie gaben angeblich die päderastischen Neigungen des Kollegen. Und so kamen die Eltern, vor allem der Vater, wieder zu mir, was allerdings auch nicht allzu viel weiterhalf. Nach einiger Zeit wagte ich, erneut den Vorschlag zu machen, es nochmals bei einem anderen Kinderpsychiater zu versuchen. Zu meiner Überraschung wurde er nicht abgelehnt. Und so gehen Stephan und seine Eltern wöchentlich nach C.. Am Anfang erfuhr ich bei den Kontrollen von Vaters Hypercholesterinämie, dass diese Therapie auch nichts Besonderes sei und dass sie die gleichen, kleinen Ratschläge erhalten würden, die sie schon von mir kannten. Das Verhalten von Stephan besserte aber doch allmählich, die Familie beruhigte sich. Den Erfolg der Therapie sieht man nicht nur an der verminderten Zahl der Erkrankungen und Konsultationen: In einem sonst an Katarrhen der Luftwege gesegneten Frühjahr und Sommer dieses Jahres war die Familie G. praktisch nicht krank. Die Familie G. ist ruhiger, sicherer, zufriedener geworden, was man beim Kontakt mit ihnen deutlich spürt. Bei einer der letzten Cholesterinkontrollen erfuhr ich, dass sich auch Herr und Frau G. einer Psychotherapie unterziehen wollten; der Kollege habe diese aber wegen Überbelastung vorläufig nicht durchführen können. Mein Rat, es bei einem anderen Therapeuten zu versuchen, wurde abgelehnt. So empfahl ich ihnen, geduldig zu warten, eventuell hätte er bei Gelegenheit dann doch Zeit für sie.
Es stellt sich die Frage, wieso ich die Frechheit habe, Ihnen diese Familie als Beispiel meiner Therapie vorzustellen. "Die Familientherapie“ macht doch der Kollege in C.. Er hat regelmässig Kontakt mit Stephan und spricht auch mit den Eltern. Aus Zeitgründen kann ich nicht alle Einzelheiten aufführen. Ich glaube jedoch, auch etwas zur Therapie beigetragen zu haben. Wahrscheinlich ist die Tatsache, dass die Eltern wegen Stephan allwöchentlich bereit sind, mit ihm nach C. zu fahren, ebenso wichtig wie die Gespräche, und bei mir hat die Familie die nahe „Stütze", die für sie "da ist“, an die man sich halten kann.
Die nächste Frage ist, was dies mit Psychosomatik, bewusster Therapie und der Arbeit in der Balint-Gruppe zu tun habe? Kann dies nicht ein anderer Kollege ohne die Balint-Gruppen-Erfahrung ebenso gut machen, ebenso gut da sein? Möglicherweise ja, etliche sogar besser. Ich hätte es aber nicht so gut gekonnt. Aus Zeitmangel möchte ich nur auf einen Aspekt näher eingehen. Falls erwünscht, kann ich weitere in der Diskussion vorbringen. Die Hypercholesterinämie, unter der Herr G. leidet, hat mehrere Seiten, Schichten, Deutungen und Bedeutungen. Was wir von der naturwissenschaftlichen Medizin lernen und sehen, ist die Gefahr der Gefäßlädierung mit deren Folgen wie Myokardinfarkt, Apoplexie, vorzeitiger Tod. Auch wenn darüber noch nicht alles klar und sicher ist, die entsprechende Therapie ist jedenfalls festgelegt und besteht aus Diät sowie verschiedenen Medikamenten. In der Balint-Gruppe und durch das Interesse an der Psychosomatik lernte ich, die anderen Seiten zu sehen: Die Kontrollen des Cholesterinspiegels geben Herrn G. und mir die Möglichkeit einer regelmässigen Kommunikation, ohne dass er dazu depressive Symptome entwickeln muss. Eine medikamentöse Therapie vermeide ich nach Möglichkeit, auch wenn das Cholesterol vorübergehend erhöht ist, weil ich der Meinung bin, dass ihnen die Aktivierung ihrer gemeinsamen Kräfte - Frau G. durch geeignetes Kochen, Herr G. durch den Willen, die Diät durchzuhalten und den Cholesterinspiegel wieder zu senken - auch in anderen Bereichen das Gefühl gibt, die Kraft zu haben, die so sehnlichst gewünschte Ordnung und Beruhigung zu erreichen.
Leicht gekürzte Fassung aus Psychosomatische Medizin 1980; 9: 238-244,

In Memoriam Frau Magdalena Gobeli-Bühler (1888—1980) aus Grubenwald-Loch
Heutzutage reist man viel. Trotzdem verbleiben immer noch viele Orte und Ortschaften, Länder und Landschaften, in die wir gerne fahren möchten. Ich bin zwar noch nie in Paris, Rom oder Florenz gewesen, aber seit gewisser Zeit keimte und wuchs in mir der Wunsch, einmal mit dem Zug nach Grubenwald zu fahren.
Unsere nicht erfüllten Wünsche vergessen wir meistens, um neuen Platz zu machen. Oder sie bohren, plagen und zwingen uns zur Erfüllung. Zu dieser zweiten, unangenehmen Sorte gehörte mein Grubenwalder Wunsch. Er flammte vor allem immer wieder neu auf, wenn wir an Grubenwald vorbeifuhren. Anfänglich versuchte ich mich abzulenken, ich las etwas oder probierte einzuschlafen. Mit der Zeit gelangen diese Ablenkungsmanöver nicht mehr. Die Fahrten mit dem Bummler, der auch in Grubenwald anhielt, waren besonders quälend: sehnsüchtig und neidisch schaute ich den Glücklichen nach, die in Grubenwald ausstiegen. Die rund vierzig Häuser von Grubenwald liegen wie ein Hufeisen vom Wald umrahmt in einer Grube, die nicht nur von beiden Seiten wie das ganze Tal, sondern auch von vorne und hinten durch die Berge eingeschlossen wird. Die Simme und die Strasse konnten sich noch mit Mühe durchschlängeln. Für die Eisenbahn gab es jedoch am unteren Ende der Grube keinen Platz mehr, so dass man für sie einen Tunnel bohren musste. Direkt im Dorf gibt es ein Lebensmittelgeschäft und noch einen Kiosk dazu, aber keine Wirtschaft und keine Post. Diese liegt im zweieinhalb Kilometer entfernten Zweisimmen. Politisch gehört Grubenwald auch zu dieser Gemeinde, ist aber trotzdem nicht unbekannt. Für Kenner ist die Grubenwalder «Chämiwurst» ein Begriff wie für andere St. Galler Spitzen oder Schüblinge.
Nicht, dass ich noch nie in Grubenwald gewesen wäre. Ich fahre oft mehrmals pro Woche dorthin, manchmal mehrmals pro Tag und ab und zu auch nachts. Besonders gern fahre ich in die tiefste Grube Grubenwalds, genannt Loch. Dann melde ich meiner Frau oder der Arztgehilfin: «Ich fahre zu Frau XY im Loch» oder «Ich bin bei Herrn XY im Loch».
Ja, aber so fahre ich, um Besuche zu machen, dazu mit dem Auto und in Eile. Einmal wollte ich ohne Zweck, mit dem Zug und in Ruhe, einfach nur so, nach Grubenwald fahren und dann den etwas steilen Feldweg von der Bahn über die Simme zum Dorf nehmen. Vom Anschauen kannte ich den Weg schon gut, und meine Grubenwalder Angina-pectoris-Patienten pflege ich zu fragen, wie manches Mal sie unterwegs haltmachen müssten, um ihren Zustand oder die Wirksamkeit der Therapie zu beurteilen. Wie gerne wollte ich einmal selbst diesen Weg, möglichst ohne Angina pectoris, beschreiten.
Eigentlich sollte es nicht so schwierig sein, das kurze Stück von Zweisimmen nach Grubenwald meinetwegen mit dem Zug zu fahren, auszusteigen, den Weg von der Bahn ins Dorf hinauf unter die Füsse zu nehmen und dann mindestens für eine kurze Zeit ruhig, zufrieden und wunschlos glücklich zu werden. Am Sonntag oder an irgendeinem Feiertag sollte man auch genug Zeit dazu finden. Jedoch bleiben einem Landarzt in den Bergen nicht so viele freie Wochenende und Feiertage, auch wenn die Dienste geregelt sind. Und die freien, sind sie wirklich frei?
Unzählige Gesellschaften, Organisationen und Institutionen lauern auf einen und bieten die verlockendsten Möglichkeiten zur Fortbildung. Wenn man dieser Verlockung nicht nachgibt, was einem nicht so leicht fällt, besonders weil man nicht ohne weiteres in ein Seminar oder in eine Vorlesung abspringen kann, gibt es unzählige Verwandte und Freunde, die irgendein Jubiläum feiern müssen, heiraten oder sich dauernd fortzupflanzen versuchen, was ihnen überraschend oft gelingt, so dass sie dann ihre Sprösslinge taufen, wozu sie einen entweder als «Götti» oder die Frau als «Gotte» brauchen. Dies alles ist mit der Fahrt ins Unterland, meistens mit dem Zug, an Grubenwald vorbei, verbunden. Niemand veranstaltet etwas in Grubenwald. Verwandte und Freunde besuchen uns auch. Sie wollen dann Bergtouren machen, auf irgendeinem Grat wandern, skifahren oder langlaufen. Das ginge noch, manchmal genügt ihnen aber der Aufenthalt in Zweisimmen und in der näheren Umgebung nicht, sie wollen, wenn nicht nach Gstaad, so mindestens nach Lenk fahren. Vergebens versucht man solche Leute zu einer Fahrt nach Grubenwald zu animieren.
Zu meinem Leidwesen hatte auch aus der eigenen Familie niemand etwas für meinen Wunsch übrig. An den freien Tagen wollen sie skifahren, baden, wandern, Enziane oder Beeren sammeln. Weil man selten dazu kommt, muss ich dabei sein. An einem freien Sonntag im Spätfrühjahr - schwerer, matschiger Schnee lag noch, die Enzianknospen tief bedeckend, fast bis ins Dorf, es war nicht mehr gut zum Skifahren, niemand wollte uns besuchen, wir mussten nirgends hingehen, der Sohn hatte kein Ausgangswochenende im Internat, die Tochter bekam Masern, die Frau Grippe - an so einem, für meinen Wunsch besonders geeigneten freien Sonntag, den mir nur meine Hemmungen und Rücksichten nicht als glücklich zu bezeichnen erlauben, an jenem Sonntagmorgen verkündete ich: «Heute fahre ich mit dem Zug nach Grubenwald.» Die Reaktion meiner Frau schwankte zwischen Skepsis und Auslachen, die Tochter zeigte wegen der Masern-Benommenheit keine Emotionen. Ich nahm einen Fahrplan zur Hand, und zu meiner Freude stellte ich fest, dass der nächste Zug, der in Grubenwald anhielt, ganz günstig um 10.56 Uhr abfahren würde, und wenn alles gut ginge, wäre ich zu Fuss mittags wieder zu Hause.
Ungeduldig begab ich mich zum Bahnhof, verlangte eine einfache einheimische Fahrkarte nach Grubenwald und hielt Ausschau nach dem Zug, der meiner Überzeugung nach bald abfahren sollte. Alle Geleise waren frei, so ging ich zum Schalter und fragte, ob der Zug nach Grubenwald auch heute fahre. Die Antwort war bejahend, aber erst in einer Stunde. Mit Bedauern stellte ich fest, dass es wirklich zu früh war, und ich kehrte mit einer leicht verlängerten Nase nach Hause zurück. Mit merklicher Freude und Hoffnung klang die Stimme meiner Frau: "Hast du es dir doch überlegt?" Als sie meine Erklärung hörte, fragte sie: "Genierst du dich nicht, noch einmal zu gehen?" Ich wusste nicht, warum ich mich genieren sollte.
Diesmal ging ich zur richtigen Zeit wieder zum Bahnhof. Der Zug stand auf dem Geleise, ich stieg in den letzten Wagen ein, wo nur noch ein ehemaliger Schulkollege meines Sohnes sass. Der Schaffner kam sofort nach der Abfahrt, und zu meiner Überraschung begann er, als er meine Karte sah, mit mir zu schimpfen: Wieso ich nicht gesagt habe, dass ich nach Grubenwald fahre, der Zug halte dort nur auf Verlangen, jetzt könne er nicht nach vorne laufen, um es dem Lokführer zu sagen, so müsse ich bis nach Weissenbach fahren. Ich genierte mich immer noch nicht und nahm diese Verkündung so hin, wie wir die schwersten Schicksalsschläge nehmen sollten: mit Ruhe und Gelassenheit. Er räumte zwar ein, es gäbe noch eine Möglichkeit, dass dieser Zug in Grubenwald halte und zwar, wenn dort jemand einsteige. An so viel Glück glaubte ich jedoch nicht recht. In meinem Kopf jagten Gedanken wie: "Es ist mir doch nicht gegönnt, nach Grubenwald mit dem Zug zu fahren. Ich versuche es noch einmal, wenn auch in zehn Jahren, oder wenn ich Rentner bin."
Vor Grubenwald begann der Zug zu bremsen, Herr und Frau M. stiegen ein. Ich versuchte sie vergebens zu begrüssen und obwohl Frau M. ihres hohen Blutdruckes wegen alle zwei bis drei Monate zu mir in die Kontrolle kommt, erkannte sie mich nicht. Sie war mit dem für ihr Alter etwas mühsamen Einsteigen zu beschäftigt, ich fuhr auch nicht im weissen Kittel, und vor allem rechnete sie nicht damit, mich bei einer solchen Gelegenheit zu treffen. Der Schaffner dagegen rief mir noch etwas verärgert nach, beim nächsten Mal sollte ich sagen, ich fahre nach Grubenwald, sonst halte der Zug wirklich nicht an. Ich hätte jetzt Glück gehabt. Wahrhaftig, wann fahre ich nächstes Mal nach Grubenwald?

(1) Bahnhof in Grubenwald, damals ohne Häuschen. Vermutlich dieselbe Quelle wie das folgende Bild.
Der Weg von der Bahn ins Dorf ist noch schöner, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Er ist ein schmaler Feldfussweg und führt zuerst über eine hölzerne Brücke geradewegs zum Dorf. Kurz nach der Brücke beginnt der Weg zu steigen. Dort steht auf der einen Seite ein altes Holzhaus, auf der anderen liegt ein kleiner, umzäunter Blumen- und Gemüsegarten, offensichtlich zum Haus gehörend. Man hat den Eindruck, man gelange durch ein Tor nach Grubenwald. Die Fenster am Hause waren offen, es herrschte Ruhe, niemand schien drin zu sein und mein Vorbeigehen zu bemerken. Ich ging weiter, und als ich mich den Dorfhäusern näherte, begann ich mich zu genieren. Die Dorfstrasse in Grubenwald ist kein Bärenplatz in Bern oder Piccadilly Circus in London, wo man nur so, ohne Grund, hingehen kann. Was hätte ich gesagt, was ich hier wolle, was ich in Grubenwald suche?
Ich kehrte zurück. Als ich am Torhaus vorbeiging, herrschte immer noch die gleiche Ruhe. Nur die Insekten in der Luft und die Autos auf der Strasse am Gegenhang summten, und in dem kleinen Garten raschelte ein zum Abschrecken der Vögel im Wind drehendes Rad. Ich weiss nicht, wer dort wohnt, ich bedauere nur, dass ich in diesem sonderlichen und schön liegenden Haus noch niemanden besuchen musste.
Als ich mit der Praxis angefangen hatte, fürchtete ich die Besuche vor allem in den abgelegenen, schwierig zugänglichen Häusern, besonders bei einem Notfall. Mit der Zeit verging mir die Angst, und ich gehe nun gerne Teile des Weges zu Fuss, mit oder ohne Schnee, was aber je länger, je mehr zur Seltenheit gehört. Es genügt mir auch, wenn ich nur mit dem Wagen Zufahrtschwierigkeiten habe.
Deswegen freue ich mich immer wieder, wenn ich eine alte Frau besuchen muss, zu der ein Feldweg über eine schmale, geländerlose, in einer Mulde liegenden Brücke führt. Im Sommer müsste man betrunken sein, um von der Brücke zu stürzen. Im Winter ist es anders, umso mehr, als man im tiefen Schnee nicht wenden kann und rückwärts fahren muss. Das erste Mal nach Überquerung der Brücke in beiden Richtungen war ich so übermütig, dass ich gleich nachher wenden wollte, mit dem Ergebnis, dass man das Auto aus dem Schnee bergen musste. Jetzt fahre ich in solchen Fällen lieber den Weg bis zur Strasse weiter rückwärts.

(2) Grubenwald; links der Weg vom Bahnhof ins Dorf dem Torhaus vorbei. www.swissfot.ch/swissfotclosed/HTM_closed_d/3750/25.htm. Die Quelle des Fotos ohne Schutzwarnung um Copyright angefragt, keine Antwort erhalten.
Wie ich die Entwicklung kenne, wird man mir diesen Spass bald verderben: Zuerst werden sie hier eine schöne, breite Brücke bauen, der kurz danach ein solides, festes Geländer angepasst wird, später wird die Autobahn kommen.
Der Weg von Grubenwald nach Hause verlief problem- und komplikationslos. Auf dem üblichen Wanderweg der Simme entlang war ich schnell zu Hause. Ich war stolz und froh, wie wenn ich einen schwierigen, hohen Berg erklommen hätte. Es überfiel mich das Gefühl, jetzt ruhiger sterben zu können.
Einige Wochen später, nach zwei aufeinanderfolgenden Dienstwochenenden, bekam meine Frau, die schon seit fast drei Wochen wegen des Telefonhütens nicht aus dem Haus gegangen war, den Praxiskoller und fragte mich vorwurfsvoll, was sie eigentlich vom Leben habe. Ich wollte sie trösten, indem ich zurückfragte: "Und was habe ich vom Leben?" "Du machst, was du willst", kam die Antwort. Überrascht sagte ich: "Was meinst du damit?" "Du fährst mit dem Zug nach Grubenwald." Sie hat, wie immer, recht.
Schweiz Ärztezt. 1981;62:3437-8. Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH.

Als die angesehene medizinische Zeitschrift New England Journal of Medicine zwei Berichte über den Alltag in einem gegenwärtigen USA-Spital veröffentlichte (1,2), und bei uns wird es nicht wesentlich anders, dachte ich, ich sollte doch festhalten, wie es in den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts, also vor vierzig Jahren, in einem kleinen Bezirksspital in den Schweizer Bergen war. Damals schrieb ich: „In unserem Dorf praktizieren drei Ärzte: Ein Chirurg, ein Internist und ich als Allgemeinpraktiker. Wir vertreten uns gegenseitig während der Ferien und leisten abwechslungsweise Wochenenddienste, auch im Spital, so dass wir über unsere Patienten eine gute Übersicht haben. Unser Gebiet ist zirka 25 km lang. Ungefähr die Hälfte unserer Patienten sind Bergbauern, die in den kälteren Jahreszeiten ihre Zipfelmützen tragen“ (3). Ja, wie war denn mein Alltag im Spital?
Ich kam in ein „Notstandsgebiet“. So wie heute mangelte es an Ärzten, die bereit waren, abgeschieden unter schwierigeren Bedingungen als in einer Stadt zu arbeiten und zu leben. Damals waren aber auch Aussenbezirke von Zürich noch Notstandsgebiete! (Langsam ist es wieder so.) Wenn ich nach mehr als zehn Jahren die Forschung verliess und mich für die Allgemeinmedizin entschied, wollte ich eine richtige Allgemeinpraxis führen mit allem Drum und Dran. Wegen der Landschaft entschieden wir uns für das Simmental. Der Internist war überlastet und der neue Chirurg wünschte sich angeblich im Unterschied zum Vorgänger nur eine beschränkte Praxis ohne Hausbesuche. Also musste ein Allgemeinpraktiker her, der dazu den Internisten im Spital während seiner Ferien vertreten sollte. Zum Verdruss des neuen Chirurgen machte der Internist auch Geburten und wollte mir einen Teil überlassen, was ich in Anbetracht meiner bescheidenen Erfahrung in diesem Fach dankend und entschieden ablehnte. Ich hätte gerne auch auf die Anästhesie verzichtet, aber da war der Bedarf zu gross: Die Narkosen machte eine nicht sehr zuverlässige ältere Kollegin, die dazu in Saanen wohnte und so bei Notfällen nicht zur Verfügung stand. Oder eine nicht gut ausgebildete Krankenschwester. Ich war nicht heiss darauf, auch wegen mehreren Todesfällen, die durch die Verwechslung der Narkosegasleitungen bei der Installation unter der Frau des alten Chirurgen passiert waren. Aber ablehnen, die Not der Anästhesie zu lindern, konnte ich auch innerlich nicht.
Bei der Renovierung des alten Arzthauses durften wir unsere Wünsche anbringen, und sie wurden auch mehrheitlich verwirklicht. Ich hätte auf die Selbstdispensation mit Apotheke lieber verzichtet, aber der Dorfapotheker bot mir ungewöhnlich schlechte Bedingungen an, wenn ich über ihn die Medikamente bezogen hätte. Und so musste ich tagelang studieren und überlegen, welche Medikamente ich vor allem für Notfälle in dem Bergtal mit einem sommerlich und winterlich regen Tourismus brauchen könnte. Ich führte die Apotheke im Geiste meines Grossvaters, der nicht ertragen konnte, wenn ein Kunde in seinem Laden etwas nicht fand, mit der Folge, dass manchmal der Apotheker die Leute zu mir schickte, wenn sie dringend ein seltenes Medikament brauchten. Ähnlich den Grosseltern war ich enorm stolz darauf, weniger meine Frau, weil dieser Stil wirtschaftlich nicht übermässig erfolgreich war.
(1) Bezirkspital Obersimmental, Zweisimmen, Edition Guggenheim & Co., Zürich, aus dem Simmentaler Heimat-Buch, 1938, Verlag Paul Haupt, Bern; mit Dank von G. Pfander durch Vermittlung von A. Zimmerli, beide aus Zweisimmen, erhalten.
Ich war sehr enttäuscht, als ich trotz Notstandsgebiet kaum Patienten hatte. Als ich ein krankes Kind einer Basler Familie, die in Lenk ihre Skiferien verbrachte – der ältere Lenker Arzt verschwand nach der schweren Belastung während der Wintersaison für ein paar Tage in sein Ferienhaus auf dem Napf – verrechnete ich dreissig Franken samt der über 15 km langen Fahrt auf den Berg oberhalb von Lenk. Sie waren überrascht und ich zufrieden, dass ich keine Rechnung ausstellen musste, worauf ich überhaupt nicht vorbereitet war. Entsprechend empfing mich meine Frau, als ich unheimlich stolz und zufrieden von meinem Erfolg erzählte. Eben, es war alles „learning by doing“. Zum Trost feierten wir meinen 40. Geburtstag mit Freunden aus Bern im „Olden“ in Gstaad, wo es noch nach Elisabeth Taylor und Richard Burton roch.
Bald ging der Internist das erste Mal in vierwöchige Ferien irgendwo unerreichbar weit weg, nachdem er fast zwanzig Jahre als internistischer Chefarzt, Geburtshelfer und Allgemeinpraktiker verbrachte. Entsprechend froh und dankbar war seine Frau, dass wir gekommen waren. Plötzlich war ich auch voll beschäftigt. Er tat es auch in der Hoffnung, dass ein Teil seiner Patienten bei mir „hängen blieb“ und er entlastet wurde. Zuerst um halb acht Uhr tägliche Visite in der internistischen Abteilung des Spitals, dann die volle Praxis. Inzwischen Notfallbesuche, meistens mittags und abends. Gegen Abend wieder ein schneller Blick ins Spital. Zum Glück war der Chirurg zurückhaltend mit dem Bedarf an Narkosen, was sich auch später nicht änderte und einer besonderen Erwähnung verdient. Ja, ich wurde plötzlich ins Wasser geworfen und schwamm, wie ich nur konnte. Es unterlief mir kein grosser Fehler, aber ich war froh, als der Internist zurückkehrte. Jetzt hatte ich mehr Patienten in der Praxis und hie und da auch im Spital.

(2) Das neue Spital Zweisimmen in den 70-er Jahren. Die Quelle des Fotos ohne Schutzwarnung um Copyright angefragt, keine Antwort erhalten.
Von Anfang an verabredeten wir, das alte System der gemeinsamen Samstagsvisiten weiter zu führen, das der Internist und der frühere Chirurg pflegten. Wir trafen uns um 7.30 Uhr und je nachdem, ob der Chirurg noch operieren musste, gingen wir zuerst die chirurgische oder die internistische Abteilung durch. Zuletzt kam die geriatrische Station an die Reihe, wohin uns aber der Chirurg praktisch nie begleitete. Dadurch wurden wir nicht nur darüber informiert, was im Spital läuft, konnten über Diagnostik und Therapie diskutieren, und sparten gegenseitige schriftliche Berichte. Wir führten auch keine eigenen Krankengeschichten. Die Eintragungen der Krankenschwester und der seltenen Pfleger reichten für die Kontrolle. Mit der Zeit hatte ich als Belegarzt nie mehr als eine Hand voll meiner eigenen Patienten. Ich machte die Visiten im Spital um 10.00 Uhr nach dem Internisten. Die Schwester und Pfleger waren meistens schon anderweitig beschäftigt. Ich war mit den Patienten alleine, was ich gut und angenehm fand. Es war ähnlich der Situation in der Praxis, nur hier waren noch andere Patienten im Raum. War etwas besonders wichtig oder unklar, rief ich die für das Zimmer verantwortliche Pflegekraft. Sonst ging ich nach der Visite in das Abteilungszimmer und verordnete Medikamente und andere Massnahmen. Ähnlich verhielt es sich mit den Assistenzärzten. Es gab Zeiten, wenn wir für das ganze Spital nur einen einzigen hatten, der dann während meiner oder sogar der Visite des Internisten bei den Operationen assistierte. Ich hatte gerne Assistenzärzte, mit denen man über Patienten, Diagnosen und Therapien diskutieren konnte. Ähnlich dem Internisten und Chirurgen besuchte ich die Patienten meistens kurz auch abends unterwegs zu den Hausbesuchen und änderte bei Bedarf die Verordnungen.
Um die Entlöhnung musste ich mit dem Verwalter kämpfen. Er jammerte, dass für die Kosten weitgehend die armen Gemeinden der Umgebung aufkommen müssten und hob die grosszügige Möglichkeit hervor, dass ich eigene Patienten im Spital weiter behandeln könne. Ich wurde also pro Patient und Tag mit Fr. 10.00 bezahlt, der Weg und die Abendvisite inbegriffen. Diese Summe gefiel meinem Finanzminister, meiner Frau, nicht.
Ein anderer Stein des Anstosses waren die Ferien. Näherten sich laut dem Kalender die Schulferien, beauftragte mich meine Frau, sie mit dem Internisten und dem Chirurgen bei der Samstagsvisite festzulegen. Ich kam nicht dazu. Es gab sooo vieeele andere, viel wichtigere Probleme zu besprechen. Der Chirurg musste noch operieren, und in der Praxis des Internisten warteten schon ungeduldig unzählige Patienten. War es nicht anmassend, fast unmoralisch, unter diesen Umständen über Ferien zu reden?! Zu Hause wurde ich unfreundlich empfangen und mir nach einer Woche wieder ans Herz gelegt, wir müssten wissen, wann wir Ferien buchen können, sonst werden wir weder Plätze im Flugzeug noch Zimmer im gewünschten Hotel bekommen. Die zwei reagierten überrascht, was stürmt der Jüngling da schon wieder, was will er eigentlich? Und so ging es weiter noch etliche Wochen. Je früher ich damit anfing, desto länger. Schlussendlich fuhren wir irgendwann irgendwohin für fast den doppelten Preis. Erst viel später begriff ich, dass ich mit einem Berner und einem Menschen zu tun hatte, der nicht nur nie in die Ferien ging, aber sie auch niemandem gönnte. Dann legten wir die Ferien fest, wann es uns passte, ich gab sie früh bekannt, und siehe da, es ging bestens.
Der Chirurg nützte auch die Narkosen, um mich zu plagen. Wir verabredeten, dass er am Mittwochvormittag Wahleingriffe vornahm, bei denen ich die Narkose durchführen müsste. Das geschah jedoch selten. Er operierte lieber an einem anderen Tag, die Narkoseärztin aus Saanen kam oft nicht. So musste ich einspringen und meine Praxis schnell umstellen. Dafür rief er mich zu kleinen notfallmässigen Eingriffen, liess aber den Patienten nicht die vorgeschriebene Zeit, um nüchtern zu werden, da er Angst hatte, sie lassen sich dann nach Ausnüchterung im Unterland behandeln.
Einmal verschlug es einen Kollegen aus Australien zu uns. Der Internist war abwesend, sodass ich dem Gast das Spital zeigen sollte. Am Anfang standen wir vor dem Spital und er fragte nach den groben Zahlen. Wieviel Betten wir haben, wieviel Ärzte und so weiter. Als ich ihm sagte um achtzig Betten, zwei Chefärzte, einer davon nebenamtlich, ein Belegarzt und ein bis zwei Assistenzärzte, war er merklich verstört. Er wusste nicht, mache ich einen Witz, bin ich gut im Kopf? Als ich ihm auch den Luftschutzkeller zeigte und er im ganzen Spital nur den einzigen Assistenzarzt erblickte, konnte er sich nicht beruhigen, fragte nach Details, wie war dies möglich, wie machten wir es?
Für unsere Patienten waren wir in der Praxis vierundzwanzig Stunden erreichbar mit Ausnahme eines Nachmittags pro Woche und der Wochenenden, wenn der andere Dienst hatte. Der Internist und ich wechselten uns ab, sowohl bei den Allgemeinen- wie den Spitaldiensten für die internistische Abteilung. Wir gerieten nicht selten ins Rotieren, wenn gleichzeitig im Spital wie irgendwo abseits in einem Nebental ein Notfall war. Aber auch an normalen Tagen konnte es brenzlig werden, wenn wir einen Patienten dringend nach Bern verlegen mussten, weil die Ambulanz aus Bern zu spät kam. In Erinnerung blieb mir ein kleiner Knabe mit einem bakteriellen Pseudocroup, den ich intubieren musste. Ich begleitete ihn in der Ambulanz bis nach Bern und übergab ihn der Notfallstation. Am nächsten Tag riefen sie mich an, und fragten, wie es mir nur gelungen sei, ihn zu intubieren? Sie wollten den Tubus für einen Dauerhafteren wechseln, was ihnen aber nicht gelang und mussten warten bis die Stimmbänder abschwellten. Die Eltern des Knaben zeigten keine Dankbarkeit, vielleicht auch, weil sie Patienten des Chirurgen waren, der Anerkennung nur für sich pachten wollte. Eine Zeit lang ertrug ich solche Fahrten, aber einmal musste ich bei einem Patienten dauernd den Puls und den Blutdruck messen (es gab damals keine Automaten), dabei zeitweise stehen, auf den Blutdruckmesser und die Uhr schauen, bis mir in den zahlreichen Kurven der Talstrasse übel wurde. Schlussendlich war ich fast schlechter daran als der Patient. Seither kehrte meine von der Kindheit bekannte Empfindlichkeit zurück. Hatten wir einen schweren Fall im Spital, ich erinnere mich an einen Herzinfarkt mit Rhythmusstörungen, verbrachten wir manchmal Stunden währen der Nacht beim Patienten. Am nächsten Tag in der Sprechstunde mussten wir vollen Einsatz leisten.
So konnten wir arbeiten und leben nur Dank unseren Ehefrauen. Sie wurden durch Notfallanrufe auch in der Nacht nicht nur gestört, aber nicht selten mussten sie dabei auch helfen. Es gab keine Mobiltelefone, keine GPS. Sie wussten immer, wo wir uns befanden und riefen dort an, wenn man noch einen anderen Besuch machen oder ins Spital zum Notfall fahren musste. Dies an sechsundzwanzig Wochenenden, der Hälfte der Feiertage und mindestens 150 sonstigen Arbeitstagen! Vielleicht ist jetzt die Empörung meiner Frau über die Ewigkeit, bis man die Ferien festlegen konnte, einfühlbarer. Die Ehefrauen opferten sich und stutzten nicht nur ihre beruflichen Pläne. Die Frau des Internisten, selbst studierte Ärztin, verzichtete nebst vier Kindern und trotz Haushaltshilfen auf eine eigene ärztliche Tätigkeit. Sie besprachen zusammen, was in der Praxis lief und ähnlich meiner Frau stützte sie ihn bei Entscheidungen und Problemen. Sie erledigten meistens auch die schriftlichen Arbeiten und Abrechnungen.
Finanziell war unser Arbeits- und Lebensstil vorteilhaft für alle ausser uns. Wir wurden nicht reich an Geld, aber an Erlebnissen und Erfahrungen. Und alles wird leichter: Das Sterben, die Erde über uns und auch durch das Tor zum Himmel müssen wir uns nicht schleichen. Mindestens hoffe ich.
1 Rosenthal DI, VergheseA: Meaning and the nature of physicians’ work. N Engl J Med 2016;375:1813-5.
2 Obermeyer Z, Lee TH: Lost in thought - the limits of the human mind and the future of medicine. N Engl J Med 017;377(13):1209-11.
3 Marko P: Familienarzt, Familientherapie und ein Fall. Psychosom Med 1980;9:238-44.

Wenn er wirklich mit ganzem Herzen bei der Arbeit ist, beansprucht sie ihn emotionell so stark, dass er total erschöpft ist. Deswegen sollte er sich erlauben, als spontaner, warmherziger ganzer Mensch zu reagieren, sobald er seine Praxis verlässt. Er braucht einen Platz, wo er gelegentlich unrecht haben und sich irrational verhalten kann. Er braucht einen Platz, wo er seine Schwächen zeigen kann und nicht nur dafür nicht bestraft wird, sondern, wo sie als liebenswürdige Eigenschaften angesehen werden. Es ist leicht einen klugen Mann zu lieben und bewundern, aber nur eine wirklich liebende Frau kann auch jemanden lieben, der zeitweise ein Narr ist.
R. R. Greenson, ein Psychoanaly-Tiger
Als wir vor Jahren einmal an einem See vorbei fuhren, sah ich das erste Mal die anmutigen Gestalten, die, nur auf einem Brett stehend, mit einem Segel in der Hand dahinglitten. Dieser Anblick faszinierte mich, und ich fragte: „Was ist das?“. Trotz aller Faszination dachte ich, es sei mit meinen bald vierzig Jahren zu spät, damit anzufangen. Ich entschied, mein Sohn solle statt mir diesen offensichtlich schönen Sport betreiben. Mich überfielen dabei selbstgefällige Gedanken und Gefühle: Ich kann meine Grenzen erkennen, akzeptiere mein altersbedingtes Nachlassen der Kräfte, lasse meinen Sohn gewähren und selbständig sein und werde auch ruhig sterben können, wenn die Zeit dafür einmal kommt.

(1) Vater und Sohn am Anfang ihrer Surfkarriere
Merkwürdigerweise waren während der nächsten Jahre immer weniger gute Surfer zu sehen. Es wimmelte auf den Gewässern von Leuten, über die man sich totlachen konnte, wenn sie, unsicher auf dem Brett stehend und unmöglich das Segel haltend, immer wieder bei nichtigen Gelegenheiten ins Wasser fielen. Unser Sohn wurde inzwischen älter und kräftiger. Die nächsten Sommerferien verbrachten wir in Oberitalien, an zwei schönen, aber ziemlich schmutzigen Seen. Der Familienrat beschloss: Unser Sohn soll hier und jetzt mit Windsurfen anfangen. Mit den bereits erwähnten Hinweisen auf mein fortgeschrittenes Alter weigerte ich mich, mitzumachen. Ich glaubte wirklich, unser Sohn sei geschickter. Ich konnte nicht zuschauen, wie er unmöglich und unsicher auf dem Brett stand, wie lange es ihm dauerte, bis er vorwärts, dort, wo der Lehrer es wollte, hinsteuerte. Ins Wasser fiel er auch genügend. Die ganze Familie forderte mich auf, es doch auch zu probieren. Nur einmal! Es halfen keine Ausreden, ich stand auf dem Brett, mein Sohn ruderte im ausgeliehenen Boot neben mir und schrie mir seine frisch erworbenen Weisheiten zu, wie und wo ich stehen, das Segel ziehen und halten und, das Schwierigste, wie ich drehen solle. Nicht zu glauben, ich schaffte es, zwei bis dreihundert Meter vorwärts und wieder zurück zu kommen. Ich fiel auch nicht zu oft ins Wasser. Aber an jenem Tag war der See ganz ruhig und glatt und nur ein Hauch von einem Wind wehte. Ich glaubte aber, damit sei meine Windsurfkarriere beendet. Im nächsten Frühjahr - mein Sohn und ich haben die Geburtstage nebeneinander - schlug meine Frau vor, wir sollten die Gelegenheit nützen und uns die Windsurfer-Ausrüstung kaufen. Wir könnten uns doch beim Surfen abwechseln. Nach langer Beratung kauften wir das Surfbrett und alles Nötige dazu. Ich dachte immer noch, es sei nur für den Sohn, der sich auch riesig freute. Als in der Zeitung der Beginn der Surfsaison am Faulensee angekündigt wurde, meldete ich mich doch zu einer Unterrichtsstunde am nächsten freien Nachmittag an. Von einer Surfunterrichtsstunde zur anderen blieb ich immer länger auf dem Brett als im Wasser, ich ertrug immer stärkeren Wind und höhere Wellen, fuhr in die Richtung, in die ich wirklich wollte, und kam meistens ohne fremde Hilfe wieder zurück. Unser Leben, unsere Freizeit änderte sich. Den Sommer hindurch wurde nicht mehr gewandert, sondern gesurft. Mein Sohn und ich jedenfalls. Die Tochter war fürs Surfen leider noch zu klein und meine Frau wehrte sich dagegen, selbstverständlich nicht mit Hinweisen auf ihr Alter, sondern wegen der Haare. Mein Ferienverhalten änderte sich auch. In den Bergen wohnend, sind wir sowieso schon immer in den Ferien ans Wasser gefahren und ein ruhiger Langschläfer war ich nie. Das Frühstück nahm ich aber bis dahin doch in Ruhe zu mir und die Siesta mit einem erquicklichen Nachmittagsschlaf wie auch den Spaziergang am späten Nachmittag zu Kaffee und Kuchen genoss ich sichtlich. Solche Vergnügungen gab es nicht mehr, höchstens aus Zwang. Morgens stand ich schon bei der ersten Halbschlafbewegung auf und hielt Ausschau nach dem Wind. Beim Frühstück schluckte ich ungeduldig die notwendigsten Bissen runter und zeigte auf die kaum zitternden Blätter mit dem leicht übertriebenen Hinweis: „Schaut mal, wie sich die Bäume biegen!“
Den Wind lernte ich erst beim Surfen richtig kennen. Sonst nimmt man ihn nur bei einem Gewitter, höchstens noch beim Velofahren wahr. Der Surfer ist von ihm ganz und gar abhängig und bemerkt seine Launenhaftigkeit. Er ändert nicht nur die Richtung und Stärke, sondern auch die Orte, an denen er bläst. Das Wasser und der Wind sind für einen Windsurfer gute Freunde, an denen man sich freut, auf die man sehnsüchtig und ungeduldig wartet, mit denen man viel Schönes erlebt. Wann kann man sonst als erwachsener, ernsthafter, ehrwürdiger Mensch diese Mischung aus Akrobat, Seiltänzer, Jongleur und Clown erleben? Wie mit engen, guten Anvertrauten bekommt man mit ihnen auch Streit. Bei den Kämpfen mit Wind und Wasser ist man auch wie ein Boxer, der nicht so hart, aber desto genauer getroffen wird und immer wieder ins Wasser fliegt. Bei dieser Auseinandersetzung flucht man ruhig, weit und breit ist meistens niemand, man ärgert sich unverhüllt, ohne Rücksicht und Schuldgefühle. Man fühlt sich schwach, klein und ungeschickt, bald darnach wieder stark und siegreich. Man konzentriert sich nur auf diesen Kampf, alles andere ist leicht und auf natürliche Weise vergessen.

(2) Vater und Sohn in der Pause mit der Tochter
Anfangs September erlebte ich wieder einen herrlichen Nachmittag am Faulensee, wo ich das Surfen gelernt hatte. Es war noch warm, die Sonne schien, der Wind blies regelmässig und ausdauernd. Man konnte sich am Segel aufhängen und den Rücken vom Wasser streicheln lassen. Das Brett zischte durch die Wellen, und wir scheuchten die in den Wellen ruhenden Möwen und Enten auf. Ein Bild wie auf einem Werbefoto! Es war an einem Samstagnachmittag, und ich sang dazu vor lauter Glück den Kriminaltango. Am darauffolgenden Montagmittag kam dann der Schuss. Beim Aufstehen aus dem tiefen Ledersessel spürte ich im Rücken einen starken Schmerz und hielt mich wie angeklebt am Bücherregal fest. Zuerst konnte ich keine Bewegung machen. Die Sprechstunde nachmittags konnte ich nur unter ständigen Schmerzen, die sich bei jeder Bewegung und kleinstem Druck steigerten, mühsam durchführen. Mein Leiden wurde durch die Überlegungen, besser gesagt Feststellungen meiner Frau über Grund und Entstehungsart meiner Beschwerden unnötig verschlimmert. Für sie war es klar, dass die Ursache dafür das Surfen war, und ich konnte sie mit keinen Hinweisen auf die in meinem Alter üblichen Abnützungsvorgänge und auf die unzähligen Patienten, die ohne Surfen unter Rückenschmerzen leiden, davon abbringen. Ich wartete, wie sich der Bandscheibenvorfall entwickelte. Wird er sich verwachsen und verhärten oder muss ich das Windsurfen mit allen Freuden und Leiden doch meinem Sohn überlassen?
Inzwischen sind mehr als dreissig Jahre verflossen. Die Bandscheibe verwuchs, der Rücken wurde hart und steif. Ich kann mich nicht mehr gut biegen und die Schuhe muss ich auf einer Stufe binden. Es ist ein echt alter Mann, bald ein Greis aus mir geworden.
Schweiz Ärztezt. 1985;66:t428-30 - gekürzt und der letzte Absatz hinzugefügt.
Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH.

Jedes Jahr gegen Ende des Winters bekam er eine Lungenentzündung. Damals existierte noch keine Impfung dagegen. Die ersten zwei, drei Tage spritzte ich ihm Antibiotikum und als es ihm besser ging, was immer der Fall war, verabreichte ihm die Frau die Tabletten. Sie tat es sehr gewissenhaft. Ab und zu sah ich sie beide vor allem an „Märittagen“ im Dorf. Er trug immer eine braune Filzhose und dieselbe Jacke, sie ein altmodisches Kleid mit einem kleinblumigen Muster und Schürze. Ihr Mund hatte grosse Zahnlücken, was sie überhaupt nicht hinderte herzlich zu lachen. Eine Zahnversorgung war für sie offensichtlich unüblich, unnatürlich, überflüssig. Er liess sich nie in der Praxis blicken.
In ihrem etwas abgelegenen alten Holzhaus wärmten sie das Wasser und kochten mit Holz auf einem Herd. Vermutlich gab es nur ein Plumpsklo. Als ich kam, sass er jeweils schon in der warmen Küche. Der Weg dorthin führte über einen Gang, eine Art von Veranda, in dem man sich durch Haufen von Altpapier, leeren Flaschen, volle Taschen und andere gebrauchten Gegenstände durchschlängeln musste. Dazu gehörten Schalen mit Essensresten für mehrere Katzen, die einen je nach Laune mehr oder weniger freundlich begrüssten. Man musste achten, dass man ihnen die Pfoten bei dem Hindernislauf nicht zerdrückte. Wie sah es wohl in den anderen Räumen des Hauses aus?

(1) Mit Corinne und ihrer Freundin Andrea oberhalb von Zweisimmen
Arm waren sie nicht. Ausser der riesigen Wiese mit dem Haus gehörten ihnen noch andere rund ums Dorf und sogar ein „Berg“, eine Alp. Sie besassen nicht viele Tiere und so haben sie ihr Reich mehrheitlich verpachtet. Sie arbeiteten aus Pflicht, Gewohnheit und Spass, desto mehr als sie kinderlos blieben. Als er älter und schwächer wurde, verzichteten sie ganz auf das „Bauern“. Sie half dann in der Küche eines Restaurants aus.
Eines Tages klagte er, dass er nicht gut Urin lösen könne. Sowohl der Tastbefund wie das Labor zeigten einen fortgeschrittenen Prostatakrebs. Als ich einmal im Mai an meinem freien Nachmittag den Katheter gewechselt hatte, begleitete sie mich ein Stück zum Auto. Auch sie war froh, aus dem dunklen Haus an die frische Luft hinauszukommen. Die Sonne schien, die Wiese blühte, die Kühe lechtzten nach dem Gras und dem Wasser aus dem Trog, in den es aus dem Brunnen plätscherte, man hörte ihr lautes Schnaufen und ihre Glocken. Wir blickten von oben auf das Dorf und weit ins Tal. Die Spitzen der Bergen waren noch weiss vom Restschnee. Ich sagte, es scheint ein gutes Jahr zu werden. Sie sagte dazu in ihrem singenden Dialekt: Ja, das Gras wächst den Viechern direkt ins Maul. Treffender konnte man das Ganze nicht ausdrücken.

(2) Kühe am Rinderberg oberhalb Zweisimmen; Bewilligung zur Uebernahme vom Tourismusbüro mit Dank erhalten.
Eine Untersuchung und Beurteilung bei einem Spezialisten, eine Einweisung ins Spital, eine Operation oder Bestrahlung wären für ihn unüblich, unnatürlich, überflüssig, eine Zumutung und kamen nicht in Frage. Und so starb er in seinem Haus, man kann sagen glücklich und zufrieden, so wie er dort gelebt hatte, sorgsam und liebevoll gepflegt von der Frau und der Gemeindeschwester.
*
Schon als Kind störte mich, dass ich aus Kleidern, die ich gerne trug, hinausauswuchs. Ungefähr zweijährig besass ich ein Overall, damals eine Seltenheit, in dem ich mich wie ein Pilot oder Rennfahrer vorkam, welche Berufe ich gerne in meinem Holzauto spielte. Ich konnte meiner Mutter nicht verzeihen, dass ich den Anzug nur ein bis zweimal tragen durfte, da sie ihn nur für besondere Gelegenheiten aufhob. Damals hatte man noch Kleider, die man nur an Sonn- und Feiertagen anziehen durfte, beziehungsweise musste. Später war das Neue für mich wichtig und interessant. Seit geraumer Zeit trenne ich mich wieder besonders schwer von Sachen und Gegenständen, die ich gern habe, die mir gut dienten, mit und in denen ich viel erlebte. Es braucht eine äussere Kraft oder Macht, die mich dazu zwingt. Dann suche ich eine gute Gelegenheit, mich davon zu lösen. Und so sammeln sich in der Wartenschleife im Schrank Hemden, Jacken und Hosen, die das letzte Mal gewaschen wurden. Ihre Zahl übersteigt langsam derjenigen, die ich noch unbeschränkt tragen darf. Das 1. August-Fest auf einer Alp mit Höhenfeuer war ein würdiger Anlass, mich von Turnschuhen zu verabschieden, in denen ich jahrelang wanderte, besser gesagt, über Feld, Wiese, durch Wald, Wasser, Schilf und Farn schwebte, ohne Blasen und Schwielen, aber die Löcher im Futter an der Ferse begannen leider die Socken kaputt zu machen. Während Menschen und Tiere von uns gehen, ohne dass wir es gross beeinflussen können, entscheiden wir, wann und wie wir uns von Sachen endgültig trennen. Es ist eine Art von Mord oder Selbstmord, da damit ein handfestes Stück unserer Erinnerung, ein Stück von uns selbst verschwindet.
Schon immer hatte ich gerne Kleider, die mehreren Zwecken dienen konnten, wie reversible Jacken. Jetzt besitze ich immer weniger Kleidungsstücke, aber immer mehr solche von „universeller“ Art. Mit schwerem Herzen werde ich mich einmal von meinen Schuhen trennen, in denen ich sowohl wandere wie ins Theater gehe, von der Jacke, in der ich Ski fahre und den ganzen Winter in der Stadt trage. Ist die nicht nachlassende Beliebtheit der Jeans auch ein Zeichen dieser Sehnsucht nach Einfachem, Gleichem? Wie leicht hatte es mein Patient mit seiner Garderobe, seinen braunen Filzhosen und seinem geblümten hellblauen Hemd, die man an jedem „Märit“ kaufen kann. Gefällt mir ein blaues Hemd, muss ich mir gleich mehrere Stücke besorgen, weil Jahre vergehen, bis blau wieder Mode wird, dann aber während einer Saison lauter blaue Hemden in den Geschäften auftauchen.*
Ja, wenn es mir so durch den Kopf geht, denke ich, dass es kaum Zufall war, dass ich in „säbem“ Haus der Arzt war.
Gewidmet der Gemeindeschwester in Zweisimmen Frau Hanny Zeller.
Schweiz Ärzteztg 2007;88:212-3. Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH.

Angelo, unser Neffe, inzwischen Vater von zwei Kindern, von ihm nahen Personen immer noch Angi genannt, sollte mit dem Ernst des Lebens beginnen und bald in die Schule gehen. Als Geschenk zu Weihnachten hätte der Siebenschläfer, schon in dem Alter ein vernünftiger, praktischer Mensch, gerne einen Wecker gehabt, meinte seine Mutter.
Wir wohnten in den Bergen in Zweisimmen. Ich litt unter einem Fortbildungskomplex: Kollegen im Unterland hatten viele Gelegenheiten zur Fortbildung, aber ich, weit weg, dazu durch häufige Dienste verhindert, musste mich mit dem Lesen von den drei Fachzeitschriften begnügen, die ich selbst abonnierte. Es gab noch keine gesponserten, gebührenfreie. Neuigkeiten über Medikamente vermittelten mir Pharmavertreter. Alle zwei Wochen ging ich am freien Nachmittag nach Bern in die Balintgruppe, meistens von meiner Frau begleitet. Vor den Sitzungen kauften wir in der Stadt ein, und während ich über schwierige Fälle mit Kollegen diskutierte, sass sie im Kino. So hielten wir uns fachlich, kulturell und mit der Garderobe auf dem Laufenden. Manchmal opferten wir die Ferien der Fortbildung.
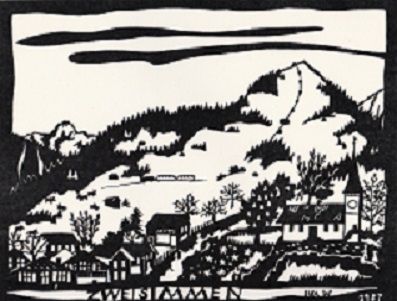
(1) Zweisimmen mit Rinderberg; Scherenschnitt von Teenager Ina Wende, Tochter unseres Zahnarztes und Freundes.
So auch diesmal im Herbst. Vom Montag bis Freitag besuchte ich einen Kurs über manuelle Therapie in Zürich und wenn wir schon im Unterland weilten, gleich am darauf folgenden Wochenende wir beide noch einen in Basel, der dem Ausgleich von Problemen im Umgang mit Patienten gewidmet war. Meine Frau half in der Praxis, wie es bei Landarztfrauen üblich war. Wir wohnten in einem Hotel, das in einer ruhigen Seitengasse liegt, zwischen Universitätsspital, damals Kantonsspital, wo ich den Kurs hatte, und Limmat, damit meine Frau es nicht weit zum Treffen mit Bekannten hatte. Sie sollte die Zeit auch nützen, um ausnahmsweise in Ruhe die vorweihnachtlichen Einkäufe zu erledigen. Schon meine Eltern wohnten dort, wenn sie uns in Zürich besuchten. Sie zahlten für ein Doppelzimmer zwanzig Franken. Aber es war noch vor seiner Renovation. In der Zeit meines Kurses kostete es zwar schon ein Mehrfaches davon, aber es war auch für normale Menschen wie wir bezahlbar. Jetzt nicht mehr. Man sieht, in welchen alten, guten, fast schon vergessenen Zeiten sich diese Geschichte abspielte. Die Schere zwischen unserem Einkommen und dem Preis der Hotelzimmer öffnet sich immer mehr.
Die Fortbildungen waren noch freiwillig und nicht eine kontrollierte Angelegenheit, die schriftlich bestätigt werden musste. Man ging, weil man interessiert war, etwas Neues zu erfahren, wollte besser werden, auch wenn die Ärztedichte und damit die Konkurrenz kleiner war als jetzt. Parallele Sitzungen waren eine Ausnahme. Heutzutage kann man sich nicht leicht bei jeder grösseren Fortbildungsveranstaltung entscheiden, welches Thema man auswählen soll und befürchtet, nachher bei den anderen etwas Wichtiges verpasst zu haben. Von Tierversuchen wissen wir, dass schwierige, nicht eindeutige Entscheidungen, über die man zweifelt, stressen und verschiedene Krankheiten begünstigen sowie auch eine neurotische Entwicklung, was nicht der Zweck einer Fortbildung sein sollte, eher umgekehrt.
Der Kurs begann jeden Tag um 10 Uhr (unsere Lehrer hatten nicht frei und mussten das Wichtigste vorher noch erledigen), womit wir vor dem Frühstück eine Stunde Tennis spielen konnten, und endete jeweils schon um 17 Uhr. Weil die Fortbildung der Hauptzweck des Kurses war, strapazierte man nicht über Gebühr unsere normale menschliche Aufnahmefähigkeit. Am Freitag waren wir schon früher fertig. Ich war begeistert, wie viel Neues, Nützliches ich gelernt hatte, wie viel besser, schneller ich jetzt meinen Patienten helfen konnte.
Wir fuhren gleich nach Basel weiter. Ziemlich schnell und ohne Komplikationen fanden wir das Hotel. In einem seiner verschieden grossen Sitzungssäle, wie praktisch, begann am nächsten Morgen der Kurs. Die Rezeption erhielt von uns angeblich keine Reservation, das Hotel war voll, aber diese gütigen Leute fanden für uns trotzdem ein grosses, schönes Zimmer, sogar für denselben Preis. Wir zogen in das Zimmer, ja es war direkt eine luxuriöse Suite mit riesigem Bad, die wir uns nie hätten leisten können. Ich freute mich auf die schöne Nacht mit einem erholsamen Schlaf. So werde ich an den folgenden zwei Tagen mühelos weiter lernen.
Am Abend trafen wir unsere Freunde aus Basel. Als wir nachher die Türe zu unserem Hotelzimmer öffneten, sahen wir, dass sich diese luxuriöse Idylle inzwischen in einen discoähnlichen Raum umgewandelt hatte. Hinter dem Fenster blitzte es abwechselnd in verschiedenen grellen Farben, begleitet von jeweils explosionsartigen Geräuschen – das Zimmer war direkt hinter dem Namen des Hotels an der Fassade, die jetzt mit Neonröhren beleuchtet war. Wir zogen die Vorhänge zu, was die Blitze etwas dämpfte, aber die Geräusche blieben unerträglich. Meine Frau rief die Rezeption an und sagte, wenn wir kein ordentliches, ruhiges Zimmer bekommen, gehen wir in ein anderes Hotel. Überraschend schnell schickten sie einen Mann, der unser Gepäck in ein anderes, nicht so grosses Zimmer ganz oben im fünften Stock mitnahm. Ich liess ihn nicht gehen, bis ich bei offenem Fenster nachkontrollierte, ob hier keine Reklame oder sonst etwas, was uns stören könnte, versteckt war. Er war kaum weg, wir begannen wieder auszupacken, als wir ein komisches Geräusch hörten. Wir versicherten uns zuerst gegenseitig, dass es keine Halluzination war und einigten uns, dass es von der Tür zum Nebenzimmer kam. Es war eben kein luxuriöses Zimmer mehr. Wir versuchten die Tür zu öffnen, es ging nicht, legten dann unsere Ohren an sie, das Geräusch wurde lauter, und lauschten irgendeinem Gespräch, das wir, da leise und in einer fremden Sprache geführt, nicht verstanden. Wir waren daran auch nicht interessiert, sondern froh, dass wir die Verursacher des Geräusches, die Störfeinde gefunden hatten. Ich läutete bei ihnen und wollte sie bitten, das Geräusch abzustellen. Es kam ein Mann raus, dem ich meinen Wunsch höflich mitteilte. Er sprach eine Sprache, die ich nicht einordnen konnte, kurz mit der Frau, die ich nicht sah, zeigte auf die Verbindungstüre zu unserem Zimmer und sagte in einem nicht perfekten Deutsch aber unmissverständlich, dass das Geräusch von uns komme. Ich dachte Meines, aber begann nicht mit ihm zu streiten. Meine Frau rief schon wieder die Rezeption. Es kam derselbe Mann, bereit, uns in das bereits dritte Zimmer zu führen. Er nahm die Koffer von dem Abstellplatz gleich neben der Verbindungstür in die Hand. Alle drei merkten wir mit gemischten Gefühlen, wir beschämt, er schien etwas belustigt und schadenfreudig, dass das Geräusch ihm folgte – in einem der Koffer war etwas, was lärmte. Wir baten ihn, das Gepäck wieder zurückzulegen, wir würden doch gerne in diesem Zimmer bleiben. Er war damit nicht einverstanden und führte uns, begleitet vom Geräusch, neben einer langen Reihe von offenen, freien Zimmern in einen anderen Flügel des Hotels in ein kleines Zimmer ohne Verbindungstüren, mit Fenster in einen ruhigen Hof und nicht auf die Strasse, sogar mit einem französischen Bett, was wir damals noch besonders schätzten. Wir öffneten sofort den Koffer, suchten und zum Vorschein kam der Wecker, den meine Frau am Vormittag noch schnell kaufte. Als sie probierte, wie er funktionierte, vergass sie ihn abzustellen. Aus der Tiefe des Koffers, umgeben von verschiedenen Kleidungsstücken war sein Läuten nicht zu erkennen. Tückisch wurde es an den Verbindungstüren stärker, wie wir es von Streichinstrumenten kennen. Dass er aber ausgerechnet in diesem Augenblick, in dieser Situation zu läuten begann ... Es war genau zwölf Stunden nach dem Kauf. Ein zuverlässiger Wecker, wie wir jetzt bitter erfuhren. Wir bogen uns von Lachen.
In diesem Zimmer verbrachten wir zwei angenehme, schöne Nächte in einem tiefen, ganz tiefen, erquicklichen Schlaf. Sogar der Hotelrezeption verziehen wir ihre Lügen. Selbstverständlich erhielten sie unsere Reservation und wie wir uns leider überzeugen konnten, hatten sie nicht nur die unmögliche, lärmige Suite, sondern viele ruhige Zimmer frei. Warum dann diese Umstände? Auch eine Hotelleitung hat doch ihren Ehrgeiz, schwierige Aufgaben zu erledigen, Herausforderungen zu meistern. Ein Bergsteiger klettert nicht auf einen Hügel neben seinem Ort, ein Chirurg operiert nicht gern nur einfache Fälle. So bemüht sich die Hotelrezeption, wenn man dort das erste Mal erscheint, dem Gast ein Zimmer zuzuteilen, oberhalb der Küche oder mindestens dem Restaurant, unterhalb vom Swimmingpool, neben dem Spielzimmer für Kinder oder neben der Kegelbahn. In Moment, wenn man erscheint, ist der Ventilator, der abends die Gerüche der Küche in das offene Fenster des Zimmers bläst, selbstverständlich ausgeschaltet, wie auch die Umwälzungspumpe des Swimmingpools, die Kinder sind im schönen Wetter draussen, noch niemand wirft die Kegel um, die Disco ist leer. Alles das hört und riecht man erst, wenn man abends in das Zimmer kommt und schlafen möchte. Offensichtlich gibt es genug Gäste, die den Gang zur Rezeption und die Auseinandersetzung scheuen und mindestens die erste Nacht in so einem Zimmer mit Krümeln des Schlafes ausharren. Ein klarer Sieg für die Hotelleitung. Nach einer solchen Nacht fühlt man sich auch wie nach einem Knockout. Wahrscheinlich bewähren sich neue Hotelangestellte auf diese Weise in ihrer Prüfungszeit und die Älteren beweisen, wozu sie noch immer fähig sind. Ein anderer Grund dafür ist auf den ersten Blick nicht klar, aber das Hotel erwirbt auf diese Weise Stammgäste. Solch weich Geplagte sind nämlich dankbar, dass sie früher oder später doch ein gutes Zimmer bekommen und fürchten, in einem anderen, neuen, unbekannten Hotel wieder einer solchen Tortur ausgesetzt zu werden. Ich vermute, Hotelarchitekten werden direkt beauftragt, auch solche Folterzimmer einzurichten.
Es ist leicht, einfach und teuer in eine Luxusherberge zum Beispiel in Paris einzuziehen, dagegen ein erschwingliches kleines Familienhotel in einer ruhigen Gasse in Quartier Latin, in dem man alles hat, was man braucht, aber kaum etwas, was man vermissen möchte, ist ein Kleinod. Man muss es hoch schätzen, wenn man von Freunden und Bekannten die Adresse eines solchen Hotels bekommt, aus Sicherheit mit der genauen Zimmernummer dazu.
Die Weihnachten waren schön. Alle freuten sich über unsere mit genug Zeit, Geduld und Liebe ausgewählten, passenden Geschenke. Auch Angi über seinen Wecker.
PrimaryCare 2012;12:450. Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH.

Ausserdem fiel damit die Last der pekuniären Interessen weg, was mich zu neuen Bemühungen zugunsten der leidenden Vergesslichen und vergesslichen Leidenden und der Wirksamkeit unserer therapeutischen Massnahmen beflügelte. Ich rief in der Schweizer Vertretung einer internationalen Firma der Elektronikbranche an, die mir mitteilte, mein Gerät passe, wie nützlich es auch sein könne, nicht in ihr Produktionsprogramm. Als auch ein anderes ähnliches Unternehmen sich ebenso herausredete, wandte ich mich an die als innovationsfreundlich bekannten Japaner. In ihrer europäischen Niederlassung in D-Frankfurt/Main wurde mir kundgetan, ich solle mich mit der Zentrale in Japan in Verbindung setzen, ohne dass sie mir die entsprechende Adresse gegeben hätten! Diese bitteren Erfahrungen führten dazu, dass ich jetzt selbstverständlich die Meinung derer teile, mit denen ich sonst nicht das Heu auf der gleichen Bühne habe, dass unsere gegenwärtigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten nur im Missmanagement wurzeln.
Nach den schlechten Erlebnissen mit den grossen internationalen Konzernen, dachte ich, eine mittelständige Firma würde mehr Verständnis für meine Idee und ihr künftiges Produkt haben, mit dem der Besitzer doppelt so reich wie bisher werden könnte. Ich weiss nicht mehr wie, aber auf komplizierten Umwegen, nach etlichen Telefonanrufen, erfuhr ich den Namen einer Firma in der Zürcher Umgebung, die für die Produktion meines, wie Sie es etwas profan nennen, medizinischen Weckers, geeignet wäre. Ich sprach telefonisch mit dem Chef, der sich für unsere persönliche Unterredung etwas Zeit erbat. Bei der nächsten gemeinsamen Visite im Spital teilte mir mein Kollege mit, dass sich einer seiner Bekannten vom Militär, Chef einer mittelständischen Firma in der Umgebung von Zürich, nach mir, vor allem nach meinem geistigen Zustand erkundigt hätte. Die Sache begann ungemütlich zu werden, ich wollte keinesfalls im Irrenhaus landen, was, in gewissem Masse auch für Sie, liebe Frau Kollegin, eine Warnung sein soll.
Und jetzt kommen Sie und wecken mich mit Ihrem Leserbrief aus dem diesbezüglich jahrelangen Dornröschenschlaf. Vielleicht hilft bei der breiten Leserschaft dieser Zeitschrift schon unsere Korrespondenz, das Interesse an unserem "Medizinischen Wecker" an den geeigneten Stellen zu wecken. Sonst können wir zur Förderung und zur Verwirklichung unseres Vorhabens, trotz aller damit verbundenen Widrigkeiten und Gefahren, einen Verein gründen.

(1) Zweisimmen beim Umzug "Anno dazumal" mit Haushaltshilfe von Kollege Zimmerli

Zum Wegzug von Dr. P. Marko
Lieber Peter,
was immer auch die Gründe sind, die Dich bewogen haben, Deine allseits geschätzte ärztliche Tätigkeit im Simmental und Deine wohl etablierte Praxis aufzugeben, um in der Ostschweiz ein neues Wirkungsfeld zu suchen, wir - d.h. Deine Patienten, Freunde und Kollegen - respektieren Deinen Entschluss und suchen ihn zu begreifen. Auch wenn uns dies nicht ganz leicht fällt.
Während den zehn Jahren Deines Wirkens in Zweisimmen ist es Dir dank Deinen fachlichen Fähigkeiten, Deinem unermüdlichen Einsatz, aber auch dank Deiner Aufgeschlossenheit und Deinem Humor mühelos gelungen, Dich in Deine neue Heimat zu integrieren und Dir nicht nur das Vertrauen, sondern auch das Herz der Kranken zu gewinnen. Deine anspruchsvolle ärztliche Tätigkeit konnte Dich nicht davon abhalten, Dich mit nie erlahmendem Interesse allen Neuerungen der Medizin zu erschliessen, Dich ständig weiterzubilden und Dich über die reine Schulmedizin hinaus auch mit angewandten Methoden der physischen und psychischen Krankenbetreuung zu befassen. Manch einer, dem Du im rechten Moment den Kopf zurecht gedrückt und ihn dadurch von seinen Nackenschmerzen befreit hast, wird Dir dafür dankbar bleiben und Deine Kurse über autogenes Training werden vielen Simmentalern und Saanenländern noch über Jahre hinaus zu innerer Ruhe und Entspannung verhelfen.
Deine Vielseitigkeit hast Du aber auch ausserhalb Deiner beruflichen Tätigkeit auf mannigfache Art bewiesen. Ich erwähne hier nur Deine schriftstellerische Aktivität. So haben Deine witzigen, mit Selbstironie durchsetzten Essays nicht nur für den geliebten Surf-Sport geworben, sondern kleine Kostbarkeiten, wie etwa das Dorf Grubenwald, landesweit bekannt gemacht. Ich hoffe, dass Dich Pegasus auch in fernen Landen noch öfters in dichterische Sphären entführen wird, und dass uns auch künftig hie und da ein Erzeugnis Deiner Feder erreicht und erfreut.
Wenn Du uns in den nächsten Tagen verlässt, nimm den herzlichen Dank all Deiner Patienten mit, welche Du Tag und Nacht kundig und gewissenhaft betreut hast, aber auch den Dank und die Anerkennung Deiner Kollegen für die freundschaftliche und fruchtbare Zusammenarbeit. Wir alle wünschen Dir und Deiner Familie Wohlergehen und Erfolg am Orte Deines neuen Wirkens.
Andreas Zimmerli
*
Beitrag von Peter Marko in der Obersimmentaler Zeitung vom 13. November 1986.
Abschied nach zehn Jahren
Nach mehr als zehn Jahren verabschieden wir uns vom schönen, sonnigen Obersimmental. In letzter Zeit wurde ich oft nach den Gründen für den Wegzug gefragt: es gibt verschiedene und wie üblich, die Wichtigsten sind einem selbst nicht klar. Es waren schwierige, aber schöne zehn Jahre, wir haben viel erlebt, und ich habe viel gelernt, nicht nur Fachliches.
Ich möchte mich bei allen Kollegen für die gute Zusammenarbeit, die auch im Interesse der Patienten war, herzlich bedanken. Ein besonderer Dank gilt Herrn Dr. med. A. Zimmerli, der mich von Anfang an grosszügig und verständnisvoll unterstützte, und die vier Jahre der Zusammenarbeit im Spital mit ihm bleiben für mich eines der schönsten kollegialen Erlebnisse.
Mein Dank gilt vor allem den vielen Patienten, die zu mir Vertrauen hatten und bei mit Hilfe suchten. Ihre Zufriedenheit war für mich eine grosse Unterstützung. Die Einstellung "äs isch mir doch gliich" ist meiner Natur fremd und auch deswegen kam es ab und zu zu mehr oder weniger heftigen Auseinandersetzungen. Ich versuchte mich auch daran zu halten, was ein kluger Professor folgendermassen ausdrückte: "Der Patient soll beim Arzt nicht das bekommen, was er will, sondern das, was er braucht". Leider hatte ich nicht immer die nötige Fähigkeit und Geduld, es dem Patienten zu erläutern. Wie dem auch sei, in gutem oder schlechtem Sinne, allen Patienten brachte ich das Wertvollste, was man hat, die eigenen Gefühle, entgegen. Der Hauptgrund gewisser Enttäuschungen war sicher meine fachliche und menschliche Unzulänglichkeit.
Der Arzt kann oft helfen, manchmal "nur" trösten. Erlauben Sie mir am Ende allen Patienten, die meinen Wegzug bedauern, damit zu beruhigen, dass sie zehn Jahre nach ihrer Ansicht "so än guete Dokter" geniessen konnten, und diejenigen die mich aus verschiedenen Gründen nicht mochten, damit, dass "so än chaibä Quär- und Plooggeischt" endlich weg ist.
Ich möchte die vergangenen zehn Jahre nicht anderswo erlebt haben. Das schöne Simmental mit allen Einwohnern bleibt uns in bester Erinnerung.
Peter Marko

Im Frühjahr 2019 ist mein guter Kollege und Freund Andreas (Kai) Zimmerli im Alter von 93 Jahren sanft eingeschlafen. Bis zum Ende war er voll bei seinen geistigen Kräften und vor einem halben Jahr stellte er mit Frau Lilly Ergebnisse ihres gemeinsamen Altershobbys, Bilder, aus (eines davon s. Kapitel 28), der sonst nichts für äusserliche Anerkennung, sondern für den Sinn tat. Er war ein ausserordentlich anständiger, ehrlicher, redlicher, grosszügiger und geduldiger Mensch, der für seine Patienten viel opferte. Während unserer 10 jährigen Zusammenarbeit, mit teilweise gemeinsamen, teilweise von einem zu anderen pendelnden Patienten entstand zwischen uns keine Missstimmung. Ich danke seinem Sohn Thomas, dass er mir seine Grabrede zur Verfügung stellte, in der sich nicht nur der Mensch und Arzt Andreas Zimmerli spiegelt, aber auch die Medizin, die diese Generation ausübte, und die sich die Jüngeren nicht mehr vorstellen können. Damit hat sie auch eine medizinhistorische Bedeutung.
(1) Kai Zimmerli
*
Im Herbst 1991 bin ich mit meiner Frau Barbara und unseren drei Kindern nach einem zweijährigen Aufenthalt in Tanzania nach Zweisimmen gekommen, um in die Fussstapfen unserer Eltern zu treten. Ich habe dann die frisch umgebaute Praxis übernommen, mit äusserst hilfreichen, von zum Teil mehrbändigen Krankengeschichten, die Du mit Deiner Hermes-Schreibmaschine geschrieben hast. Ich bin stolz gewesen, Dein Lebenswerk zu übernehmen und habe gehofft, die Praxis in Deinem Sinne und mit Deinen Qualitätsansprüchen weiterführen zu können. Ich konnte immer Deinen Rat holen, wenn ich selber unsicher gewesen bin, aber Du hast mir nie Vorschriften gemacht, wie ich etwas machen soll.
Du hast mein Interesse an der Medizin schon in meiner Schulzeit geweckt, sei es, dass ich Dich bei den Hausbesuchen begleitet habe (häufig der einzige Moment, wenn wir etwas Wichtiges zu besprechen hatten…) Einmal durfte ich Dir helfen, wenn Du einen Patienten mit Lungenentzündung vom Fermeltal mit einem Hornschlitten zum Döschwo im Matten-Dorf transportieren musstest, weil die verschneite Strasse unpassierbar war, oder wenn eine grosse Wunde in der Praxis zu später Stunde versorgt werden musste … Dein Spektrum von Medizin war viel umfangreicher als das von uns heutigen Hausärzten. Du hast neben der Praxistätigkeit und den abendlichen Hausbesuchen noch die Medizinische Abteilung im Spital Zweisimmen geleitet, jeden Eintritt selber mit einem Assistenzarzt besprochen, daneben hast Du geholfen, Kinder auf die Welt zu stellen, ob bei einer Spontangeburt oder mittels Vakuum oder Zange, oft sogar noch zu Hause bei den werdenden Eltern. Es hat Hausbesuche gegeben, wo es nicht selten um Leben und Tod gegangen ist, weil ein Transport ins Spital nicht mehr möglich war! Gelegentlich bist Du zu Bergrettungen ausgerückt – Ambulanzen oder sogar Helikoptertransporte standen nicht zur Verfügung! Du hast psychisch angeschlagenen Patienten geholfen, mit schwierigen Lebenssituationen zurecht zu kommen – und manchmal dabei Karabiner, Revolver und Pistole eingesammelt, wenn Gewalt gegen Angehörige, Beamte oder gegen sich selbst gedroht hat.
Die Sprechstunde war meistens übervoll, und Wartezeiten von mehr als einer Stunde keine Seltenheit wegen Notfalleinsätzen. Meistens haben auch prominente Patienten (unter ihnen ein Bundesrat) das Warten ohne Murren akzeptiert. Andere Patienten haben damit mehr Mühe gehabt und das auch laut und deutlich den Arztgehilfinnen mitgeteilt. Die Bürokratie hat noch viel weniger Raum eingenommen: statt die Abende am Schreibtisch mit Aktenstudium und Briefdiktaten zu verbringen, hast Du Hausbesuche, oft mehr als fünf pro Tag, gemacht. Telefonbeantworter und Natel hat es noch nicht gegeben, die Besuchs-Tour wurde in Deinem kleinen Kalender mit den Telefonnummern der Patienten aufgeschrieben, und so konnte Mami, die das Telefon hütete, reagieren, wenn wegen einem Notfall die Tour geändert werden musste. Manchmal wurden auch wir Kinder in die Pflicht genommen, wenn beide Eltern nicht da waren. Kam ein Telefon mit einem französischsprechenden Patienten, mussten wir folgendes Sprüchlein aufsagen: «Le docteur n’est pas là, téléphonez à l’hôpital svp».
Die Patienten haben es begriffen, wenn Du erst in der Nacht um elf Uhr bei ihnen eingetroffen bist, die Medikamente (Hustenmittel und Antibiotica) sind in braunen Fläschen im Besuchskoffer gewesen, und jedes Tablettchen ist einzeln abgezählt in einem weissen Papiersäckli abgegeben worden. Oft sind wir zu einem Hausbesuch auf einer Alp gewesen. Zu einem abgelegenen Bauernhof bei Boltigen habe ich Dich einmal begleitet, zwei kleine Appenzeller Sennenhunde sollten am gleichen Abend getötet werden, weil sie niemand mehr haben wollte – wir haben einen davon mitgenommen – und ich musste zu Hause den verschissenen Kofferraum selber putzen, weil ich den Hund unbedingt haben wollte … Der Hund Mutz hat seine Wächtertätigkeit eifrig wahrgenommen; viele Leute haben keine Freude an seinem bissigen Charakter gehabt!
Menschlich und in der Medizin bist Du für mich ein grosses Vorbild gewesen mit deinem profunden Wissen, deiner Einsatzbereitschaft, deinem hohen ethischen Anspruch, deiner Geduld und einer enormen Korrektheit. Die Zeit für die Familie war rar, umso mehr genoss ich die Tage am Walensee, wo ich mit Dir Regenwürmer versenkt habe beim erfolglosen Versuch, einen Fisch aus dem See zu ziehen – wir sind dann auf Brotkügelchen umgestiegen, um den Würmern das nutzlose Ertrinken zu ersparen …, oder wie Du mich an einem Sonntagmorgen um sechs geweckt hast: «Ich gehe mit Fritz Gerber auf das Wyssstätthorn, hast Du Lust mitzukommen?» (das hat nicht immer sofort Begeisterung in mir ausgelöst, aber anschliessend immer zu einem tollen Bergerlebnis geführt!)
Als wir im September 1991 das Bolgengasse-Haus und die Praxis übernommen haben, hast Du Dich stark zurückgezogen und mich machen lassen! Sehr froh bin ich im ersten Jahr um Deine wertvolle Hilfe gewesen, wenn Du am Donnerstag Morgen Sprechstunde gemacht hast oder mich während zum Teil langen Militärdiensten vertreten hast. So hast Du den stetigen Wandel in der Praxismedizin (Abschied von der grünen mechanischen Schreibmaschine, neue Laborgeräte, mehrere Telefonstationen, Handy, Fax, Computer, etc.) noch mitverfolgt, aber einmal hast Du begreiflicherweise auch genug gehabt.
Schwierig war für Dich sicher der Rollentausch vom heilenden Arzt zum teilweise Betreuungsempfänger, als sich bei Dir in den letzten Jahren zunehmend gesundheitliche Probleme abzeichneten. Aber Deinen Willen, möglichst alle selber zu machen, hast Du bis zuletzt behalten.

Sicher ist jedermann einverstanden, dass es zumindest unbedacht, wenn nicht unverantwortlich ist, für das Autofahren gesetzliche Schulen mit Abschlussprüfungen vorzuschreiben und das viel schwierigere Zugfahren ohne entsprechende Vorbereitung zu belassen. Wie ins Wasser geworfen, einfach so, wird die Menschheit auf den Bahnsteig ausgesetzt. Zugegeben, das Autofahren verlangt gelegentlich etwas Geschick, wenn man gleichzeitig mit einer Hand das Lenkrad drehen, mit der anderen den Gang schalten und mit einem der Füsse eines der drei Pedale treten soll. Falls jemand damit überfordert ist, kann er sich ein Gefährt mit Automatik anschaffen. Gegen die geistige Beanspruchung einer Zugfahrt mit dreimaligem Umsteigen ist es nur ein kleiner Fisch. Anderseits ist eine Zugfahrt ohne Umsteigen wie ein Essen ohne Würze. Die Bahn besitzt unendlich viele Mittel, um das Zugfahren nicht zur Routine und Langweile herabsinken zu lassen. Ein Zug hält an einem Ort, der andere nur auf Voranmeldung, der dritte überhaupt nicht. Der eine Zug fährt die ganze Strecke, der nächste nur einen Teil. Wenigstens wechselt der Bahnsteig, von dem der Zug abfährt. Man muss doch die vielen Bahnsteige irgendwie ausnützen. Alles ändert mit den Jahreszeiten, Feiertagen, Wochenenden, man hat bald den Eindruck mit den Mondphasen. Zum Glück sind wir ein Binnenland, sonst würden auch die Gezeiten ihren Einfluss ausüben. Damit ist die Reise mit dem Zug so anspruchsvoll, schwierig, aber nicht ohne Reiz. Vermutlich haben Sie in einem Zirkus einen Affen oder einen Hund Auto fahren gesehen. Die Tiere bewältigen das spielend. Hat jemand jedoch ein echtes Tier alleine im Zug angetroffen?
Eben, mit dem Auto fährt man verhältnismässig einfach. Ausser wenn man den Schlüssel sucht und deswegen einen Familienzwist vom Zaune bricht, steigt man ruhig ein und fährt wann und wohin man will. Vor der Fahrt mit dem Zug muss man jedoch erst mühsam und lange den Fahrplan studieren. Während vieler Jahre unserer Ehe wurde diese Aufgabe zufälligerweise, je nach Zeit, Lust und Laune, sozusagen doppelblind, einigermassen gerecht zwischen den beiden Partnern verteilt.
Eines Sommers entschied sich auch der Jüngste der sieben Brüder meiner Frau, in einer malerischen, aber versteckt liegenden Kapelle, irgendwo in der Ostschweiz, den Bund seines Lebens einzugehen. Meine Frau Silvia, aus Datenschutzgründen löschen Sie bitte dieses Engramm sofort aus, aus denselben werde ich weiter nur S.M. aufführen, also S.M. war mit der Garderobenzusammenstellung und ähnlichen nebensächlichen Vorbereitungen völlig beschäftigt, sodass ich mich in das Studium des Fahrplanes vertiefte. Zur Freude der ganzen Familie, die mir die Anerkennung dafür nicht vorenthielt, gelang mir eine aussergewöhnlich günstige Verbindung, mit nur einem einmaligen Umsteigen, auszutüfteln. Alles klappte vorzüglich. Beruhigt und zufrieden schlief ich in Zürich ein, was mir im Zug wesentlich leichter fällt als im eigenen Bett. Plötzlich wurde ich aus dem Schlaf gerissen. Ohne Erklärung wurde mir ein Koffer in die Hand gedrückt, und noch schlaftrunken wurde ich durch den Gang gezerrt und aus dem Zug bugsiert. Am meisten entsetzte mich aber, dass meine vorsichtige, ausser bei Steuererklärungen alle Vorschriften pingelig erfüllende Frau, der graust, wenn ich mit dem Auto unbeabsichtigt die Mittellinie um einen Millimeter überfahre, hemmungslos über die ungeschützten Geleise zum gegenüberstehenden Zug sprang. Als ich geringste Anzeichen von Zweifel und Zögern zeigte und mitunter die Bahnhofpolizei erwähnte, wurde ich fast wie ein Vieh weitergejagt. Ohne Störung seitens der sonst in solchen Fällen sehr aufmerksamen Bahnangestellten verfrachteten wir uns von hinten in irgendeinen Zug hinein, der sich darauf sofort in Bewegung setzte, was S.M. mit folgenden Worten begleitete: «Wir haben wieder einmal Glück gehabt. Dies ist uns nur gelungen, weil dieser Zug eine kleine Verspätung hatte. Normalerweise kann man dem Fahrplan nach in Winterthur nicht mehr umsteigen, dazu ist Zürich vorgesehen.» Diese positive, lebensbejahende Betrachtung und Einstellung wurde durch Beschimpfungen, böse Verallgemeinerungen und Beleidigungen an meine Adresse abgelöst (gemäss all den Büchern über glückliche Ehen, die ich verschluckte, aber S.M. nicht mal anschaute, soll man so etwas nicht tun): Man könne sich mit nichts auf mich verlassen, ich sei nicht einmal fähig, eine Zugverbindung zwischen einem Ort im Berner Oberland und einem in der Ostschweiz herauszusuchen, die Hochzeit mit allen mühsamen Vorbereitungen wäre für uns im Eimer gewesen, hätte uns nicht der Schaffner kurz vor Winterthur darauf aufmerksam gemacht, dass wir falsch gefahren seien. Man hätte sich etwas ausdenken müssen, warum wir nicht rechtzeitig eingetroffen wären, um meinen Ruf in der Familie nicht noch weiter zu strapazieren und so weiter und so fort. S.M. versuchte mich mit den Erklärungen des Schaffners, wo der Fehler passiert sei, zu traktieren. Es wurde mir langsam zu viel, und ich hielt die Ausführungen mit der Bemerkung auf, Beschimpfungen lasse ich mir vor all den zuhörenden Mitfahrern, sogar den eigenen Kindern noch gefallen, aber Belehrungen im Allgemeinen und über das Zugfahren im Besonderen habe ich ausgesprochen nicht gern. Falls wir als einigermassen intakte Familie zum Familienfest erscheinen wollen, soll sie gnädigst aufhören. Mit ähnlichen, noch triftigeren Einwänden gelang es mir, die Diskussion über diese Reise im Keim zu ersticken und die Fahrt in das Familienunbewusste versinken zu lassen. Bis heute ist mir nicht klar, was da schief gelaufen ist, und wieso der Zug eigentlich in die falsche Richtung gefahren ist.
Beim Autofahren kann so etwas nicht passieren. Wenn man in die falsche Richtung fährt, genügt es, mit dem Lenkrad ein bisschen herumzudrehen, und schon ist der Fehler korrigiert. Im schlimmsten Falle «tütscht» man dabei mit irgendeinem unvorsichtigen Autofahrer zusammen, den Schaden bezahlt die Versicherung. Sogar wenn man auf der Autobahn umkehrt, wird die Allgemeinheit sofort im Rundfunk darüber informiert, mehrere Polizeiwagen fahren einem vorsichtig entgegen, nachher wird das Blut abgezapft, und Körper und Seele werden gründlich untersucht. Nichts dergleichen geschieht beim Zugfahren. Man lässt Sie ruhig auch hunderte von Kilometern falsch fahren. Unser Schaffner war eine löbliche Ausnahme. Bekennen Sie sich als ehrlicher Mensch zu Ihrem Irrtum, sind Sie des Spottes sicher. Kein Mensch, keine Versicherung zahlt Ihnen dafür einen Rappen. Weltbekannt ist, wie es vor Jahren vier Schachmeistern aus irgendeinem entfernten Land erging, die zu ihrer Olympiade nach Luzern eilten. Der Unterschied zwischen Luzern, Lausanne, Lugano und Locarno ist für einen Ausländer, ich weiss das aus eigener Erfahrung, aus unbegreiflichen Gründen anfangs kaum wahrnehmbar und diese vier Unglückspilze bestiegen nach Ankunft in Zürich den Zug nach Lugano. Man liess sie ruhig fahren, auch wenn sie die Fahrkarten nach Luzern hatten. So haben sie ihren ersten Match durch Abwesenheit zu null verloren, es halfen ihnen keine Ausreden, auch die Fahrkarten aus Lugano nicht.
Als Folge der ereignisvollen Ostschweizer Fahrt wurde ich im stillen Einverständnis der ganzen Familie der schwierigen, vertrauensvollen und folgenschweren Aufgabe enthoben, die Routen für Zugfahrten vorzubereiten und zusammenzustellen.
*
Nach vielen Jahren im Berner Oberland beabsichtigten wir, in die engere Heimat meiner Frau, in die Ostschweiz, umzuziehen. Viele Leute meinten, und sie könnten recht haben, dass wir uns nur die Zugfahrten zur Familie vereinfachen wollten. Wir bauten unser Haus, und dies ist für einen durchschnittlich begabten Menschen nur mit Hilfe eines Architekten möglich. Einer meiner acht Schwäger kannte einen guten und verabredete mit ihm ein Treffen, dem er auch beiwohnen wollte. S.M. hatte noch anderes zu erledigen, sie fuhr einen Tag früher und übernachtete bei ihren Eltern nicht weit von Romanshorn, wo wir unser Haus bauen wollten. Ich sollte alleine am nächsten Tag nachfahren. Sie schrieb mir alle Zugverbindungen auf und legte mir ans Herz, den Zettel nicht zu verlieren und vor allem mich daran zu halten. Es war meine erste Fahrt bis an die Grenze der Schweiz in diese Richtung. Am nächsten Morgen begab ich mich zettel- und befehlsgemäss zum Bahnhof. Es stand kein Zug dort. Ich erfuhr, dieser Zug fahre nur im Winter und schon seit zwei Tagen gelte der Sommerfahrplan. Typischerweise hat die Sommerzeit der Bahn nicht im Entferntesten etwas mit dem Kalender, dem Wetter oder der amtlichen Sommerzeit zu tun. Ich wurde getröstet, dass ich auch mit dem nächsten Zug, die auf dem Zettel aufgeschriebene und auch in der willkürlichen Bahnsommerzeit gültige Verbindung in Spiez erwische, und ich könne die Fahrt planmässig, wie wenn nichts geschehen wäre, fortsetzen. Es war glaubhaft, denn meine Frau hat sogenannte Sicherheitsmargen gern, da man mit knappen Zeiten den Zug oder das Flugzeug leicht versäumen könnte. Beruhigt setzte ich mich auf die Terrasse des gegenüberliegenden Restaurants, trank einen Kaffee, las die frische Zeitung, schaute meinen emsig hin und her laufenden Mitbürgern zu und dachte, die Fahrt beginne ganz gemütlich. Es «wohlete» mir. Ich sinnierte, warum ich mir einen solchen Genuss nicht öfters gönnte und fingierte Fahrten unternahm, um nach solch ruhigem Weilen entspannt zur Arbeit zurückzukehren. Wie auf dem Zettel aufgeführt und versprochen erschien bald nach meiner Ankunft in Spiez der Zug. Zu meiner Überraschung mit direktem Wagen nach Zürich, auch wenn auf dem Zettel eindeutig feststand, ich solle in Bern umsteigen. Sicherheitshalber fragte ich den Kondukteur, ob man mit demselben Wagen bis nach Zürich fahren könne, was er ohne Zögern bejahte. Ich dachte, das reicht mir, ich lasse mich während einer Zugfahrt nicht zweimal leimen und blieb in Bern im Wagen sitzen. Als alle Mitreisenden ausstiegen und niemand einstieg, bekam ich leise Zweifel, die sich dann weitgehend verflüchtigten, als ich entdeckte, dass doch noch ein anderer Passagier geblieben war. Eine Weile nachdem die Abfahrtzeit auf meinem trotz vielen falschen Angaben aufbewahrten Zettel verstrich, fragte ich den immer noch einzigen Mitfahrer, ob dieser Zug nach Zürich fahre. Sichtlich überrascht, wieso ich so lange ruhig in einem Zug hocke, wenn ich nicht weiss, wohin er fährt, bejahte er kurz meine Frage. Ich musste nachfragen, warum wir denn nicht planmässig abfahren. Dieser Zug fahre erst in 20 Minuten ab, er wandle sich in Bern in einen Halbbummler um und halte mindestens fünfmal zwischen Bern und Zürich. Ich sollte in den Zug aus Lausanne umsteigen, erklärte mir dieser aussergewöhnlich weise und erfahrene Mann. Unsicher geworden, zog ich mich auf meinen Platz zurück, nahm den Fahrplan zur Hand und stellte bald fest, dass seine Angaben stimmten und alles verdorben war: in Zürich werde ich den Zug nach Romanshorn nicht mehr erwischen, alle werden vergebens auf mich warten und wie ich S.M. kenne, wird sie sich sorgen, was mir zugestossen ist. Es «wohlete» mir nicht mehr. Ich versuchte zu retten was möglich war, stieg zum Erstaunen meines Mitfahrers hurtig aus, und versuchte meine Frau telephonisch zu erreichen. Sie war, zu meinem Pech, nicht mehr bei den Eltern. Ich rief das mir noch unbekannte Restaurant an, in dem wir uns alle treffen sollten, beschrieb S.M. möglichst genau und bat, ihr auszurichten, dass ich wohlauf sei, aber wegen widrigen äusseren Umständen erst mit dem späteren Zug komme.
Fast hätte ich inzwischen auch noch diesen Zug versäumt. Während der Fahrt mit den vielen Haltestellen hatte ich genug Musse, darüber nachzudenken, wer an dieser Misere schuld war. Eindeutig, ausser meiner Frau, die Bahn. Wozu lassen sie überhaupt Züge fahren, mit denen man die Verbindungen nicht erreichen kann. Man kann sich nicht wundern, wenn solche Züge fast leer verkehren.
Eine Stunde später als vorgesehen, stieg ich in Zürich in den Zug nach Romanshorn. Wie ich bereits erwähnte, fuhr ich zum ersten Mal diese ganze Strecke. Als ich in Weinfelden alleine im Wagen zurückblieb, wurde ich wieder misstrauisch, eine Eigenschaft, die für einen Zugfahrer von ungeahntem Wert sein kann. Es schwebte mir das Schicksal einer Bekannten vor Augen, die von St. Gallen erstmals mit dem letzten Zug nach Trogen fahren wollte. Kurz nach der Abfahrt wurde das Licht ausgelöscht, es war innen und aussen stockdunkel, was ihr ziemlich Angst einflösste. Kurz darnach blieb der Zug in einem tunnelähnlichen Gebäude stehen. Nach einer Weile überwand sie ihre Furcht und stieg aus, noch früh genug bevor der letzte Bahnangestellte das Depot verlassen wollte. Dieser erklärte ihr des Rätsels Lösung: der letzte Zug verlasse St. Gallen von einem anderen Bahnsteig als üblich. Es wäre nicht gut, wenn ich das Treffen doppelt, der Bedeutung nach im Quadrat, versäumte.
Beim nächsten Halt stieg ich sicherheitshalber aus und schaute, ob wir in Romanshorn angekommen waren, eine für einen Alphabeten meistens einfache, für einen Zugfahrer aber, wie wir sehen werden, wichtige Massnahme. Wir waren erst in Amriswil. Die nächste Haltestelle war endlich das gelobte Romanshorn. S.M. empfing mich sehr herzlich, offensichtlich war sie froh, dass ich überhaupt, dazu noch so früh angekommen war. Nachdem ich ihr die Gründe für meine Verspätung geschildert hatte, wurde diese Stimmung, wie zu erwarten, durch ungerechte und unnötige Anschuldigungen an meine Person abgelöst: Schön habe ich es angestellt, man könne mich, wie ein kleines Kind, nicht alleine mit dem Zug fahren lassen, wie sehe es vor dem Architekten aus, was denke er über einen Bauherrn, der nicht mal Zugfahren könne, es sei eine teure Reise, da er und von ihm diesbezüglich informierte Handwerker so jemanden um die Ohren hauen werden. Ich fühlte mich gezwungen, beim anschliessenden Treffen alle Register meiner Schläue und Gerissenheit auszuspielen, mit dem Ergebnis, dass der Bauvertrag mit dem Architekten fast nicht zustande gekommen wäre. Das Haus steht, ist solid gebaut und war nicht zu teuer.
Diese Reise hinterliess damit zwar keine materiellen Folgen, aber tiefe Spuren, nicht zu sagen Wunden in meiner Seele. In meinen freien Augenblicken grübelte ich darüber, wie man das Zugfahren einfacher, menschenfreundlicher gestalten könnte. Es war nicht möglich, diesbezüglich zur Ruhe zu kommen, da S.M. nicht müde wurde, bei jedem Treffen mit Verwandten, Freunden und Bekannten, bei jeder guten und schlechten Gelegenheit, über meine Reise zu berichten. Andere Frauen erzählen über Erfolge und Heldentaten ihrer Gatten bei Kranz-, Hirsch-, Eisstock- und Bockschiessen, über Turniersiege beim Tennis und Kegeln, nur sie muss mich so verleumden. Die Unterhaltung zum Thema wurde immer mit dem geflügelten Satz beendet: Man muss eben Zug fahren können! Vor jeder Reise wurde lieber ohne meine Mitwirkung und Mitsprache sorgfältig ein detaillierter Reiseplan ausgearbeitet, aufgeschrieben und seine Einhaltung durch Simulation mehrmals geprüft. Beim Abschied rief die Tochter noch aus dem Fenster: «Papi, vergiss nicht, in Spiez umzusteigen», auch wenn dort die Endstation des Zuges war. Nur dank meiner robusten seelischen Verfassung und der nicht nachlassenden Leidenschaft, mit dem Zug zu fahren, überstand ich diese Zeit.
Diese Plagerei liess mich bedauern, dass die alte Zeit vorbei war, als mein Grossvater in der k.u.k. Monarchie, den Bahnvorsteher (sein Kartenspielpartner) anrufen konnte, er solle den Zug kurz anhalten, er sei mit dem Frühstück noch nicht fertig. Ich dachte, es wäre am einfachsten, wenn nur ein Zug pro Tag fahren, aber überall halten würde. Noch besser, die Orte wären statt durch die Züge mit einem laufenden Band verbunden, auf dem man beliebig ein- und aussteigen könnte.
Eine andere, bereits verwirklichte Möglichkeit, die Reise mit dem Zug zu erleichtern, lernte ich bei meiner nächsten Fahrt nach Romanshorn kennen. Nach Bern kam ein neuer Kondukteur, und bei der Kontrolle der Fahrkarten sagte er kurz: In Zürich-Flughafen umsteigen. Wir sind bis dahin immer in Zürich umgestiegen. Ich vertiefte mich in das Studium des Fahrplanes, da S.M. diese Möglichkeit in ihrem Zettel nicht erwähnte und vor Zürich glaubte ich, die Angabe könnte stimmen. Zum Glück kam er nochmals vorbei und ich fragte vorsichtig und indirekt, ob ich auch in Zürich umsteigen könne. Selbstverständlich, sagte er. Warum habe er mir dann Flughafen angegeben, insistierte ich. Dort habe ich es einfacher, gleich auf dem Geleise gegenüber könne ich wieder einsteigen, belehrte er mich. Das war für mich eine Erleuchtung! Ich wunderte mich schon immer über die verwirrend vielen Geleise und Bahnsteige auf den Bahnhöfen. Zum Umsteigen braucht man doch immer nur zwei Züge, einen aus dem man aussteigt, einen anderen, in den man einsteigt, oder? Somit nur zwei Paar Geleise und einen Bahnsteig. Alle anderen sind im Grunde genommen überflüssig. Es wurde mir auch klar, warum alle grossen Städte wie New York, London, Paris und Rom über mehrere Flughäfen verfügen. Ich glaube, die Zürcher kommen auch nicht darum herum, sich noch mindestens in Richtung Luzern einen Flughafen zuzulegen. Wieso sollen nur die Ostschweizer das einfache Zugumsteigen geniessen?

(1) Unser Haus im Bau
Das Haus wuchs weiter, man sollte mit dem Architekten die Gestaltung der Küche und des Bades besprechen. Bei solch einer weiblichen Angelegenheit musste ich nicht dabei sein. S.M. fuhr ohne mich. Als Ersatz nahm sie meine Mutter mit, die bewundern sollte, was ihre Kinder zustande bringen. Trotz ihrer mehr als achtzig Jahre ist sie eine quirlige, wundrige Person, auch ohne Rolle der Schwiegermutter keine leichte, anspruchslose Reisebegleiterin. Ihr Programm war überfüllt, sie konnten erst mit dem letzten Zug nach Hause zurückkehren. Als sie spätabends im letzten Abschnitt zwischen Spiez und Zweisimmen im Zug sitzen sollten, las ich die Zeitung und schaute immer wieder auf die Uhr, wann ich sie vom Bahnhof abholen sollte. Ich war überrascht, als das Telefon läutete und S.M. mir mit bewegter Stimme mitteilte, sie befinde sich in Uetendorf. «Wo ist das?» «Irgendwo zwischen Thun und Bern.» «Was suchst du dort», war meine berechtigte Frage. «Wir sind in Thun falsch umgestiegen, komm uns nach Spiez mit dem Auto abholen, es gibt von dort keinen Zug mehr. Ich erkläre dir alles später, jetzt geht das Kleingeld aus und der Zug zurück nach Thun kommt bald." Von wo würde ich meine Frau nicht abholen, noch dazu, wenn sie mit dem Zug falsch gefahren ist!

(2) Das Haus und die stolzen Besitzer
Wie nur, wie so etwas passieren konnte, aber meine ganze Fantasie und Kombinationsfähigkeit reichte nicht aus. Falsch Umsteigen, das geht noch, aber wieso in Thun? Von dort fährt normalerweise kein Zug nach Zweisimmen, erst von Spiez. Dort traf ich zwei erschöpfte, niedergeschlagene und schuldbeladene Gestalten, auch wenn bald klar war, dass wieder, wie üblich, die Bahn dieses Missgeschick verursacht hatte. Alle Züge, mit denen wir bisher von Bern nach Spiez gefahren waren (nie so spät), hielten nur einmal in Thun. Dieser jedoch, ohne eine besondere Ankündigung, unerwartet, unerklärlich, völlig überflüssig, machte auch in Münsingen Halt, was die beiden, ermüdet von den Strapazen des Tages, in der Dunkelheit nicht bemerkten. Aus dem Rhythmus gebracht, stiegen sie in Thun aus und siehe da, auf dem gegenüberliegenden Geleise, auf demselben Bahnsteig, in entgegengesetzter Richtung, ganz wie in Spiez der Zug nach Zweisimmen, stand ein zur Verwechslung ähnlicher, in den sie auch ahnungslos einstiegen. Als der Schaffner fragte, warum sie wieder nach Romanshorn, mit einem Bummler und auf Umwegen über das Emmental fahren, hat sich S.M. empört, wieso er spätabends solche unpassenden Spässe treibe. Es gelang ihm ziemlich schnell, sie zu überzeugen (ich hätte mehr Mühe gehabt), dass sie, nicht zu glauben, wirklich falsch gefahren waren. Er war im Grunde ein gütiger Mensch, sie mussten für diese Fahrt nach Uetendorf, so hiess das nächste Dorf, nichts bezahlen. Es muss ein fürchterliches Kaff sein, es gibt dort kaum einen Bahnhof, kein öffentliches Telephon, man steigt in den Feldern aus. Sie mussten herumsuchen, damit sie mich endlich erreichten. Das wurde mir im gut bekannten, beschuldigenden Ton vorgetragen, nur ausnahmsweise waren die Bahn und die Uetendorfer schuld und nicht ich. Aus Solidarität und anderen Gründen wagte ich trotz der misslichen Lage einzuwenden, dass es zwar schade für die Umwelt sei, aber wegen der kurzen Strecke zwischen Uetendorf und Thun würden vielleicht nicht viele Menschen mit dem Zug fahren und für die wenigen, die nicht Zug fahren können und mitten in der Nacht in Uetendorf landen, lohne sich der Bahn ein feudaler Bahnhof nicht. Das hat man davon, wenn man nicht schaut, wo man umsteigt. Man muss eben Zug fahren können, «denk»!
Als Folge dieser Fahrt kehrten Gleichgewicht und Gleichberechtigung in unserer Familie ein. Zufällig, je nach Zeit, Lust und Laune, bereiten wieder beide Elternteile die Zugfahrten vor.
P.S.: S.M. ist immer noch nicht gut auf Uetendorf zu sprechen. Vor kurzem hörten wir in den Nachrichten, dass dort ein bedeutendes Tennisturnier stattfindet. «Wie kommen die ausgerechnet auf Uetendorf», wunderte sie sich. «Es gibt dort eine der grössten und schönsten Tennishallen der Schweiz», erklärte ich, inzwischen ein guter Kenner und ein grosser Bewunderer dieses Ortes. Sie sollten lieber ihren Bahnhof etwas ausbauen, dann können sie, meinte S.M., ihretwegen auch eine Olympiade organisieren.
Sicher haben Sie bemerkt, während meine Frau überall über meine Fahrt nach Romanshorn erzählte, ich, in meiner vornehmen Zurückhaltung, vertraue diese Geschichte nur Ihnen an.

Nach mehr als zehn Jahren in der Forschung begann ich mit meiner klinischen Ausbildung. Ich wollte den von verschiedenen Seiten Gegensatz zur Forschung ausüben – die Allgemein- oder noch lieber Familienmedizin. Eine Praxis auf dem Land schien mir dazu geeigneter zu sein als eine in einer Stadt. Es gab damals, Anfang der Siebzigerjahre des vorigen Jahrhunderts, dafür keine Vorgaben, keine Curricula, keine besondere Ausbildung. Generationen von Ärzten erwarben wichtige Kenntnisse und Fähigkeiten auf diesem Gebiet durch Vertretungen. Nicht lange nach dem ich in einer chirurgischen Abteilung eines Landspitals zu arbeiten begann, wollte ich dazu meine Sommerferien benützen. Ich fand eine Vertretung in einem Dorf am Vierwaldstättersee. Der Kollege wollte sich mit einem Monat Ferien in Skandinavien von der Überarbeitung und den Strapazen seiner überlaufenen Praxis erholen. Als ich mich vorstellen kam, zeigte er mir „kursorisch“ das Dorf und sagte, oberhalb auf dem Hang wohnen noch vereinzelte Bergbauern, die aber in der Regel gesund sind, und wenn nicht, so schmücke an der Wand in einem Raum seines geräumigen Hauses eine grosse Luftaufnahme der Gegend, auf der alle Häuser gut zu erkennen seien – ein Vorgänger der Google Earth. Die Arztgehilfin wisse, wer wo wohne. Er liess mir den Schlüssel vom älteren der zwei Praxisautos und erklärte, was ich tun solle, wenn es seine Altersmücken bekäme. Es schien, er vertraue mehr meinen Fähigkeiten, mit Menschen als mit Maschinen umzugehen.

(1) Beckenried - der Ort meiner ersten Praxisvertretung (Ansichtskarte aus der damaligen Zeit)
Eigentlich war es unverantwortlich und frech von mir, aber der Kollege fand keinen Besseren, Erfahreneren für die harte Knochenarbeit. Die Ferienpause diente auch den Patienten, da er sie nachher wieder frisch und fröhlich behandeln konnte, begründete und entschuldigte ich es mir. Und ich wollte so schnell und so viel lernen wie nur möglich.
Der Notfalldienst war dort zwar schon damals organisiert, aber wegen der niedrigen Ärztedichte konnte die Entfernung zu einem Patienten über fünfzig Kilometer betragen, und so, mehr wegen der Patienten als der Kollegen, verpflichtete ich mich für „unsere“ Patienten dauernd in Bereitschaft zu sein. Die zwei Arztgehilfinnen konnten sich dafür abwechseln. Kurz nach dem Mittagessen am ersten Samstag, ich weilte dort erst zwei Tage, rief eine Bäuerin an, die eben dort oben an dem Hang wohnte, dass sie unerträgliche Kopfschmerzen habe. Wir begaben uns in den Raum mit dem grossen Bild und die Arztgehilfin zeigte mir wohin und wie ich fahren solle. Ich studierte die Krankengeschichte und erfuhr, dass die Bäuerin nicht so wie versprochen gesund wie eine Rübe sei, sondern unter anderem ab und zu unter Migräneanfällen leide, und noch wichtiger, was Herr Doktor in solchen Fällen erfolgreich tue. Die Massnahmen, welche ich bei dem störrischen Auto ergreifen sollte, waren dagegen nicht ganz einfach, und ich nahm an, bei einem solch dringenden Notfall, werde ich sie schneller beheben, wenn mir mein zehnjähriger Sohn dabei hilft. Wir fuhren los und bald sollten wir am Ziel sein. Weit und breit war kein Haus zu sehen. So fuhren wir weiter bergaufwärts, bogen wie befohlen bei der nächsten Gelegenheit nach links, und sahen zwei- bis dreihundert Meter unten das Haus, das wir vom Bild schon kannten, aber es war kein Zugang von der Strasse dazu zu erkennen. So fuhren wir wieder nach unten, bogen bei der nächsten Möglichkeit nach rechts – und sahen das besagte Haus zwei- bis dreihundert Meter oberhalb von uns. Diesen Vorgang wiederholten wir noch zweimal, worauf wir verzweifelt beschlossen, zu unserer Basis zurück zu kehren. Die Arztgehilfin bestätigte, dass wir richtig gefahren waren, aber, da sie dort selbst nie war, wusste sie nicht, wo der Haken sein könnte, hatte aber die erlösende Idee dort anzurufen und sie zu bitten, dass uns jemand auf der Strasse erwarten solle. Wir fuhren erneut los, und in der Tat, auf der Strasse wartete ein Mädchen im Alter meines Sohnes, die uns den fast parallel zur Strasse versteckt abbiegenden ganz schmalen Feldweg zeigte. Wir sind ihr sicherheitshalber zu Fuss gefolgt. Ich entschuldigte mich bei der Patientin, dass wir so spät kamen und verabreichte ihr die angegebene Spritze. Erleichtert und doch auch stolz kehrten wir von meinem ersten ärztlichen Besuch nach Hause zurück. Ich lernte dabei etwas Wichtiges, Nützliches für meine Zukunft – im Zweifel soll bei neuen Besuchen, wenn möglich, jemand auf mich draussen auf der Strasse warten.
Entsprechend meinen oben beschriebenen Wünschen hatte ich die erste Praxis in Zweisimmen, im Berner Oberland. Daneben war ich Belegarzt, und während meinen Wochenenddiensten und bei seiner Abwesenheit vertrat ich den medizinischen Chefarzt im Spital. Heute unvorstellbar. Das Gebiet erstreckte sich über gut fünfundzwanzig Kilometer. Viele wohnten in weit voneinander liegenden Häusern, zum grossen Teil ohne eigenes Auto, sodass Besuche unser tägliches Brot waren. Manche Patienten überschritten nie die Grenze des Tales und so war für sie natürlich und selbstverständlich, dass jeder wissen sollte, wo sie leben. Sie betrachteten auch den Weg aus der Sicht ihres Standpunktes, und wenn sie sagten, ich solle nach links abbiegen, war es von mir aus rechts. Auch die Entfernung schätzten sie nicht sehr zuverlässig. An einem späten Winternachmittag rief eine junge Mutter, ihr kleiner Sohn sei nicht in Ordnung, habe Fieber, weine und halte sich oft an einem Ohr. Sie könne mit ihm wie üblich nicht in die Praxis kommen, ob ich sie ausnahmsweise nicht besuchen könnte. Ich fragte, wo ich sie finde. Ich solle die Strasse fahren soweit ich könne. Dann soll ich den Wagen dort abstellen und ungefähr fünfhundert Meter weiter zu Fuss gehen, dann rechts abbiegen. Zufällig war der nächste Patient erst nach sechs bestellt, sodass ich ihr sagte, sie habe Glück, ich fahre gleich los. Ich packte im Rucksack ein, was ich für eine Mittelohrentzündung eines kleinen Kindes für nötig hielt. Ich kam zur Stelle, wo ich den Wagen verlassen musste, da nur ein schmaler, von Menschen im Schnee gestampfter Pfad weiterführte. Da es so gut klappte, war ich guter Dinge. Nach fünfhundert Metern fand ich keine Abbiegung nach rechts, erst weiter nach mehr als einem Kilometer sah ich rechts ein Bauernhaus mit einem grossen Stall. Meine Schuhe hatte ich weder für den Weg noch für die Entfernung gewählt und ich begann Feuchtigkeit zu spüren. Ich war froh, dass ich nicht zu den Häusern weiter oben musste, wo ich Lichter sah. Als ich das Haus erreichte, fragte ich den Bauer im beleuchteten Stall, ob ich da richtig sei. Er zeigte auf die Häuser oben am Hang und sagte, dort müsse ich nach rechts in den Wald abbiegen und dann noch drei- bis vierhundert Meter weiter. Es stimmte. Als ich in das „gelobte“ Haus eintrat, untersuchte ich in Ruhe nicht nur den Knaben, aber auch dessen Schwester, die inzwischen ähnliche Beschwerden hatte. Ob Bakterien oder „nur“ Viren die Verursacher waren, bemühte ich mich, in Anbetracht der Umstände nicht zu entscheiden und ohne Zweifel und Gewissensbisse hinterliess ich für beide ein Antibiotikum, Ohrentropfen und Zäpfli gegen Schmerzen. Endlich konnte ich meine Frau anrufen und sagen, sie solle den Patienten nach Hause schicken, es dauere mindestens noch eine Stunde bis ich nach Hause komme. Sie habe es bereits getan, antwortete sie mir, rücksichtsvoll, ohne sich nach den Gründen für meine Verspätung zu erkundigen. Als ich mich verabschiedete, fragte ich die Mutter ruhig, ob sie meine, es seien zu ihnen nur fünf hundert Meter. Sie fragte überrascht und überzeugend ehrlich zurück: "Stimmt es nicht?" Schon ein paar Jahre später wurden solche Besuche einfacher – man holte mich mit dem Motorschlitten ab.
Wie man sieht, die Besuche waren ein Stück harter Arbeit, auch als ich die Gegend und die Patienten besser kannte. Einmal am Sonntagnachmittag wurde ich zu einer Frau gerufen. Sie wohnte nicht weit von der Praxis und so nahm ich meinen Koffer und ging zu Fuss dorthin. Unten im Geschäft fand ich ihren Mann etwas ordnen, richten. Ich fragte ihn, wo ich seine Frau finde, und er erklärte mir ruhig, ohne etwas zu fragen, in welchem Zimmer sie im ersten Stock sei. Dort lag in ihrem Bett eine, wegen Fieber und Müdigkeit vom Schlaf übermannte, schwer kranke Frau, dachte ich. Ich weckte sie sanft. Sie reagierte sehr überrascht, wie wenn sie einen Spuk und nicht den Dienstarzt vor sich hätte. Nicht nur ihre von Fieber bedingte Verwirrung zu prüfen, sondern auch die Situation zu klären, fragte ich sicherheitshalber, ob sie Frau P. sei. Sie sagte ja. Sie sei doch krank, wollte ich sie überzeugen. Nein, antwortete sie. Ich sei doch zu ihr gerufen worden. Vielleicht sollte ich zu ihrer Schwägerin, die aber anderswo wohne, erklärte sie mir. So war es auch. Das ist die Berner Natur: Wenn ich zu seiner Frau will, ist es meine Angelegenheit, in die er sich nicht einmischen möchte. Ich lernte davon wieder etwas Wichtiges.
An manchen Wochenenden, zum Beispiel während der Grippesaison, musste ich mehr als dreissig Mal ausrücken. Daneben noch die Patienten in der Praxis und im Spital betreuen. Jeden Besuch, tagsüber oder nachts meldete ich meiner Frau, damit sie mich erreichen konnte, wenn sich etwas änderte: Entweder musste ich nachher anderswohin als geplant fahren oder sogar, wo ich gerade war, überhaupt nicht beginnen, stattdessen zu einem noch dringenderen Fall, manchmal ins Spital oder in die Praxis zurückfahren. Nicht selten hatte ich eine Liste von bis zu zehn Besuchen, der Geografie nach auf der Karte in mühsamer „Handarbeit“ zusammengestellt und geordnet, die dann über den Haufen geworfen wurde. Jetzt, wenn überhaupt noch nötig, besorgen es verschiedene Computerprogramme.
Ende der achtziger Jahre, inzwischen sind wir nach Romanshorn an den Bodensee gezügelt, kamen die ersten tragbaren Telefone. Mit den Erfahrungen aus Zweisimmen, hier warteten zwar jetzt nicht mehr so schwierige Aufgaben, da das Gebiet flach und kleiner war, ich brauchte Patienten ins Spital nur zu überweisen, und nicht noch dort zu betreuen, hatte weniger Patienten, und das mit besseren Transportmöglichkeiten, dachte ich doch, ich muss unbedingt diese neue Errungenschaft haben, sie wird uns das Leben noch zusätzlich erleichtern. Es war eine ziemlich grosse und schwere Kiste, viel schwerer als mein Notfallkoffer. Ich musste sie in einem vierzig Kilometer entfernten Geschäft abholen. Das alles ginge noch, aber der Empfang war in unserem Grenzgebiet zu Deutschland nicht überall sicher. Swisscom wollte nicht, dass man auch nach und von Deutschland mit demselben Tarif wie in der Schweiz telefonieren konnte. Als ich zu einem Unfall in eine Fabrik musste, legte ich das Gerät neben mir ab und versorgte den Patienten. Überrascht war ich, als die Sekretärin in Eile kam und mir von meiner Frau etwas Dringendes, Wichtiges ausrichten liess. Sie konnte mich nicht mit dem tragbaren Telefon erreichen. Die Telefonfirma anerkannte mein Problem und war noch so anständig, dass ich die fast tausend Franken, die ich bereits für das Gerät bezahlte, zurückerhielt. Ich blieb aber skeptisch gegen weitere Verbesserungen dieser Geräte und benützte erst Jahre später eines, als ich nach Aufgabe der eigenen Praxis einen Kollegen vertrat. Bei allen Vorteilen gefiel mir nicht, dass ich während den Fahrten und bei Besuchen von nicht selten unnötigen, sogar sinnlosen Anrufen gestört wurde. Früher filtrierte sie meine Frau, und ich konnte ruhiger arbeiten.
Die neue, junge Generation der Ärzte mit Handys, GPS, i-Phones, i-Pods-, i-Pads und wie alle die Geräte heissen, hat es in dieser Hinsicht einfacher, bequemer, leichter. Ich glaube, sie verzichtet gerne auf die Unsicherheiten, Überraschungen, Spannungen und Abenteuer, die wir bei unserer Arbeit hatten.
Das alles und noch mehr kam mir in den Sinn, als Tim, mein zweieinhalb jähriger Enkel, einen kleinen Spielarztkoffer bekam. Nebst Stethoskop, Spritze, Verband, Fiebermesser, Reflexhammer und Otoskop lag dort wie selbstverständlich, eine ziemlich grosse Attrappe eines, wie wir eben erfuhren, enorm wichtigen Gerätes – ein Handy! Wie schnell sich der Inhalt, die Ausrüstung von Ärztekoffern ändert. Und die Zeiten.
Schweiz Ärzteztg 2011;92:512-13. Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH.



Vor kurzem veröffentlichte New England Journal of Medicine einen Artikel (2016;375(17):1610-2)) über die Zeit, die man im letzten Halbjahr des Lebens zu Hause oder im Heim verbrachte, als Massstab für die Qualität der medizinischen Versorgung – je länger, desto besser. Es erinnerte mich an folgende Geschichte, die schon Jahre in der Schublade lag:
Vor geraumer Zeit lebten in einem schönen Ort am Bodensee zwei ältere Männer, die Kaninchen züchteten. Dem einen ist die Frau gestorben, und so musste er aus seinem Häuschen in eine Wohnung umziehen. Das Haus hatte er günstiger verkauft, dafür durfte er seine Kaninchen weiter dort versorgen. Und so marschierte er jeden Morgen und jeden Abend, manchmal auch dazwischen, aus der naheliegenden Wohnung zu seinen Kaninchen. Der andere lebte weiter in seinem Haus zusammen mit der Frau und den Kaninchen im Stall hinter dem Haus.
Beide Männer waren schon seit mehreren Jahren kurzatmig - sie litten unter zunehmender Herzinsuffizienz. Sie wurden von demselben Arzt betreut und nahmen verschiedene Medikamente, unter anderem schon seit Jahren auch Digoxin. Immer wieder versuchte der Arzt nach dem Besuch irgendeiner Fortbildung, wo er über die Nutzlosigkeit, sogar Gefährlichkeit des Digoxins belehrt wurde, diesen zwei Männern das Digoxin vorzuenthalten, aber trotz anderen teuren Medikamenten, ging es den Kaninchenzüchtern ohne Digoxin schlechter. Der nicht mehr mit Kaninchen unter einem Dach lebende litt auch unter Schwindel, der durch den tiefen Blutdruck, den die neuen Medikamente noch verstärkten, nur schlimmer wurde. Und so behielten beide ihr geliebtes Digoxin. Trotzdem ging es leider beiden langsam immer minder. Der Arzt wollte sie ins Spital einweisen, damit sie dort eine bessere, wirksamere Therapie bekamen, aber sie wehrten sich, wer würde in der Zeit für ihre Kaninchen sorgen?

Eines Abends ging der eine zu seinen Kaninchen. Als er länger als üblich nicht zurückkam, fand ihn seine Frau leblos neben seinen Kaninchen liegen. Sie meinte, und sie war nicht die einzige, dass es für ihn ein schöner Tod war. Bald danach ging es auch dem verbliebenen Kaninchenzüchter schlechter. Kaum konnte er den Weg zu den Kaninchen zurücklegen. Die Familie sorgte sich zunehmend um ihn und nützte die Ferienabwesenheit des schwachen, nachgiebigen, die neuesten Kenntnisse missachtenden Arztes und liess den Grossvater vom Notarzt ins Spital einliefern, mit der Versprechung, es sei nur für ein paar Tage, und sie würden sich inzwischen um die Kaninchen kümmern.
In Spital erschraken die Ärzte ob des Scharlatan-Kollegen, der sich offensichtlich nicht weiterbildete, stellten das Digoxin sofort ab, aber trotz der neuen Medikamente ging es dem Patienten nicht besser. Aus den ein paar Tagen wurden bereits zwei Wochen, und er fragte immer wieder nach seinen Kaninchen, da er wusste, dass die Familie nicht so lange genug Zeit für sie aufbringen konnte. Und wirklich, nach einer weiteren Woche und seinen eindringlichen Fragen haben sie zugegeben, dass sie die Kaninchen abschaffen mussten. Der alte Mann begann zusätzlich zur Atemnot unter untröstlicher Trauer zu leiden und keine Antidepressiva, kein Zureden konnten ihm helfen. Es ging ihm immer schlechter, er stand nicht auf, und die letzten zwei Wochen verbrachte er, reichlich versorgt mit Sauerstoff, Infusionen und Morphium, in der Agonie.
Diese (nicht erfundene) Geschichte zeigt anschaulich die Probleme der Therapie der (terminalen) Herzinsuffizienz und die Rolle des Digoxins dabei: Es verbessert die Qualität des Lebens (bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz ist man froh, wenn man schon in Ruhe besser atmen kann), somit vermindert es die Hospitalisationen, verlängert aber das schon genug schwere Leben während des terminalen Stadiums nicht. Im Rahmen einer Fortbildung über die Therapie der Herzinsuffizienz, beklagte einer der damals führenden Schweizer Kardiologen die Ohnmacht dabei. Ich wandte ein, die Natur habe damit für eine Art der natürlichen Sterbehilfe gesorgt. Ja, mit der schweren, terminalen Herzinsuffizienz ist nicht leicht zu leben. Und sterben muss man einmal, nicht selten wegen eines schwachen Herzens. Wenn es geht, sollte es möglichst würdig geschehen. Mit dieser Kränkung müssen wir vermutlich noch lange leben.
Grundlage für einen Leserbrief in Prim Hosp Care (de). 2017;17(07):130.

Seine Genesung nach der Operation verlief nicht nach Plan, und so verlängerten wir meine Vertretung im Nachbarstädtchen, das ich nur von zwei, drei früheren Besuchen meiner Patienten und gelegentlichen Spaziergängen entlang der schönen Bodenseeuferpromenade kannte, noch um eine Woche, in der der Kollege den bereits seit längerem festgelegten Mittwoch-Dienst übernommen hatte. Die Arztgehilfin schrieb daher nicht so viele Patienten ein, eine für den Vormittag unnötige Massnahme, da die Hälfte der im Notfallkreis praktizierenden Kollegen, meistens nur am Nachmittag frei nahm.
Aber schon anfangs Nachmittag wurde ich zu einer bewusstlosen älteren Diabetikerin gerufen. Ich liess ausrichten, man solle ihr Zuckerwürfel in den Mund legen und fuhr los. Zum Glück wohnte sie in einer mir aus früheren Besuchen bekannten Gegend. Ich fand sie zwar am Boden liegend, aber bei Bewusstsein, nur ziemlich verwirrt. Sie wusste weder wie, wann und warum sie umgefallen war, welche ihre Medikamente sind, wann sie sie zuletzt genommen hatte, noch wo sie sind. Die Nachbarin fand sie vor nicht einmal einer halben Stunde in diesem Zustand und da bei Bewusstsein, gab sie ihr keinen Zucker. Die Patientin konnte ihre Beine bewegen, aber aufstehen mochte sie wegen ihrer Schwäche und wegen der bewegungsabhängigen linksseitigen Brustschmerzen nicht, die wie ich mühsam erfuhr, bei einem Sturz vor ein paar Tagen entstanden waren. Den vom Hausarzt abgegebenen Rippengurt trug sie auch nicht. Die Lunge rasselte nicht, der Puls war um 90, unregelmässig, ohne periphere Differenz, der Blutdruck 105/75. Die Nachbarin fand in der Küche folgende Medikamente: Aspirin Cardio, Digoxin, Reniten und zwei Blutzuckermittel, und so vermutete ich, dass das Vorhofflimmern bekannt, der Blutdruck aber ungewöhnlich tief war. Inzwischen traf eine Nichte der Patientin ein und berichtete, die Patientin sei wegen eines ähnlichen Zustandes vor 2-3 Monaten im Spital gewesen. Es war klar, sie musste wieder dorthin. Der Tagesarzt hatte Verständnis sowohl für meine lückenhaften Kenntnisse, wie auch für die illustren Verdachtsdiagnosen: transiente ischämische Attacke oder prolongiertes ischämisches neurologisches Defizit auf Grund des Vorhofflimmerns und/oder der diabetischen Angiopathie, hypotone Störung medikamentös und/oder durch diabetische autonome Neuropathie bedingt, glykämische Störung, Epilepsie, stummer Herzinfarkt, Lungenembolie? Bis die Ambulanz kam, versuchte ich vergebens, einen Venflon in die Vene zu bringen. Die Patientin tröstete mich, bei ihr die Vene zu treffen, sei immer eine schwierige Prozedur. Erst später kam mir in den Sinn, dass die Läden noch zu waren und wie üblich in den Schlafzimmern, das Licht erbärmlich war.

(1) Meine Ärztetasche in Romanshorn; In Zweisimmen hatte ich eine fast doppelt so grosse; im Kofferraum war eine Notfalltasche mit Intubationsbesteck und ein Defibrillator, wie auch eine Kiste mit Medikamenten
Ich hoffe, das Verhalten des Dienstarztes zeigt die veränderte Einstellung der Spitalärzte zur Situation extra muros. Noch nicht vor vielen Jahren, als ich einmal in einer bahnhofnahen Beiz zu einem unbekannten, durchreisenden, bewusstlosen Patienten unter den Tisch kriechen musste, um den sich, ausser seinem jede meiner Bewegungen argwöhnisch knurrend beobachtenden Hund niemand kümmern wollte - alle tranken teilnahmslos, möglichst ungestört ihr Bier, da sie ihre Pflicht gegen diesen vermutlich Drogensüchtigen durch den Anruf beim Notfallarzt bereits reichlich erfüllt hatten, fragte mich der Dienstarzt, dem ich den bevorstehenden Eintritt gemeldet hatte, ob ich den neurologischen Status erhoben hätte. Als ich ihm die Umstände kurz erklärte, beharrte er weiterhin auf die seiner Meinung nach berechtigte Frage, worauf auch ich zu knurren, wenn nicht zu bellen begann, was keinem der Beteiligten diente.
Ende des Nachmittags musste ich wieder ausrücken. Diesmal konnte ich warten, bis ich mit der Sprechstunde fertig war. Ein alter, nach Apoplexie gelähmter Mann, löste seit dem Vormittag kaum Urin. Die Frau meinte, der Katheter sei wieder verstopft und er habe deswegen eine Blasenentzündung, da er auch Fieber bekommen habe. Die Beine seien auch mehr geschwollen als sonst. Der Katheter war gut durchgängig, der Blutdruck 110/70, der Puls 100-110 unregelmässig mit 15-20 peripherer Differenz und die Lunge rasselte fein hinten beidseits, links etwas deutlicher. Die Füsse waren bis zu den Knöcheln weich geschwollen. Der Patient war antikoaguliert, aber nicht digitalisiert. Ich konnte mich nicht entscheiden, handelte es sich vordergründig um eine Herzinsuffizienz oder eine Lungenentzündung. Ich nahm Blut, spritzte dann durch dieselbe Kanüle Lasix und Digoxin, liess Digoxin-Tabletten und ein Antibiotikum in Reserve und bat die Frau, sie solle in etwas mehr als einer Stunde anrufen. Je nach den Ergebnissen der Blutuntersuchung würde ich ihr sagen, was sie weitergeben solle. Die einsatzfreudige Arztgehilfin verlängerte ihre Arbeitszeit und nach einer Stunde wusste ich, dass Kalium und Natrium im Normbereich, Leukozyten, Kreatinin, Blutsenkung und CRP leicht erhöht waren. Die Lungenentzündung war im Anfangsstadium noch immer möglich, aber als die Frau angerufen hatte und berichtete, der Mann habe bereits mehr als 200 ml Urin gelöst, liess ich nur eine Tablette Digoxin am selben Abend und am nächsten Morgen, aber kein Antibiotikum geben, erhöhte die übliche halbe Tablette Lasix morgens auf eine ganze und empfahl ihr, im Laufe des Vormittags den Hausarzt, dem ich alles faxen würde, anzurufen. Ich hätte gerne erfahren, wie sich der Zustand weiterentwickelte, ob es richtig war, die Digitalisierung zu beginnen und die Antibiose zu unterlassen.
Wegen der für Notfälle zu grossen Entfernung von zu Hause, übernachtete ich in einem Hotel in der Mitte des Ortes. Während des Abendessens läutete im Restaurant mein Handy. Ich wollte das Gespräch nicht öffentlich in diesem Lärm führen, stand sofort auf, aber bereits nach viermaligem Klingen, als ich den ruhigen Nebenraum erreicht hatte, verstummte es. Ich dachte, anscheinend war es doch nicht so dringend und ass weiter. Nach zwanzig Minuten rief die Notfallzentrale an. Sie wollten sich nur überzeugen, ob ich erreichbar war, da es jemand vergebens versucht habe. Ich liess ausrichten, weder der Gerufene noch der Anrufende seien in der Wüste, er sollte nur etwas mehr Geduld und Ausdauer haben. Nach zehn Minuten verlangte ein junger Mann einen dringenden Besuch bei seiner Freundin, die unter hohem Fieber und unerträglichen Kopfschmerzen leide, was nach ihrer Meinung für eine Hirnhautentzündung (vorigen Tag konnte man in den Zeitungen über einige Fälle lesen) und für eine Überweisung ins Spital spreche. Ich liess mir die Lage erklären und fuhr sofort los.
Unterwegs meldete sich ein Mann, der wegen unerträglichen Schulterschmerzen unverzüglich kommen wollte. Ich erklärte ihm meine dringendere Aufgabe. Er wollte wenigstens sofort eine Salbe holen. Ich versprach ihm, ihn unmittelbar nach dem Besuch anzurufen, er erkundigte sich noch, wie lange es dauern würde. Ich erreichte das Haus der fiebernden jungen Frau. Von unten schaute ich das Verzeichnis der Bewohner an, und da bereits im ersten Stock der gesuchte Name angegeben war, drückte ich den entsprechenden Knopf. Keine Antwort, auch nach mehrmaliger Wiederholung. Ich ging von aussen schauen - kein Licht im ersten Stock, kein Lebenszeichen. Offensichtlich sind sie, nach dem vergeblichen ersten Anruf ungeduldig geworden, direkt ins Spital gefahren. Ich rief den unter den Schulterschmerzen Leidenden an. Niemand meldete sich auch nach mehrmaliger Wiederholung. Entweder ist er inzwischen zum Notfallarzt im Nachbarkreis gegangen oder, was ich aus dem ganzen Verhalten eher vermutete, irgendeine Verabredung war doch dringender als seine Schmerzen. Wie auch, offensichtlich war es nicht mein Abend.
Ungefähr nach einer Stunde rief der Freund der fiebernden Patientin wiederum an und fragte, ob ich überhaupt gedenke zu kommen. Ich sagte verdutzt, ich sei schon längst dort gewesen, aber niemand habe geöffnet. Es stellte sich heraus, dass im Haus auch im vierten Stock noch jemand mit dem gleichen Namen wohnte! Die Patientin hatte keine Meningitis, sondern einen viralen Infekt, was sich noch bis Ende der Woche meiner Vertretung bestätigte. Nach dem ich sie beruhigt, und sicherheitshalber Blut genommen hatte, wartete sie zu Hause, vom Freund liebevoll betreut, auf ihre Genesung.
In der Nacht kam ich nicht zur Ruhe, ich schlief kaum fünf Stunden. Der letzte Anruf erreichte mich beim Frühstück um 07.15 Uhr. Die Frau klagte über unerträgliche Rückenschmerzen. Meinen Vorschlag, die kurze Weile zu warten und spätestens um 8 Uhr ihren Hausarzt, der sie kennt, zu beanspruchen, lehnte sie ab: Er praktiziere in einem 8 km entfernten Ort, mache hier keine Hausbesuche, es sei Donnerstag, an dem er den ganzen Tag frei nehme und ich habe doch noch Dienst, oder?
In fünf Minuten war ich mit dem Frühstück fertig und bald stand ich beim Eingang des Wohnhauses. Ich las zuerst die Namen aller Einwohner, was ich nach dem gestrigen Vorfall für den Rest meiner Lebtage tun werde. Ich läutete - keine Reaktion. Im Abstand von einer halben bis ganzen Minute wiederholte ich es mehrmals. Als ich nach ca. 5 Minuten unverrichteter Dinge verzweifelt abziehen wollte, summte endlich der Türöffner. Die Türe zur Wohnung war offen, und ich vernahm den Ruf aus dem Schlafzimmer. Die Frau lag bewegungslos im Bett und wegen der unerträglichen Schmerzen, durfte ich kein Lasegue-Zeichen oder etwas Ähnliches prüfen, sie auch kaum berühren. Wie wenig ich tun durfte, desto mehr fragte sie fast dauernd, wie es möglich sei und warum sie unter solchen Schmerzen leide. Ich staunte etwas über diese Ahnungslosigkeit, als ich erfuhr, dass sie bereits am Rücken operiert worden war und mehrere Erholungskuren und Spitalaufenthalte wegen Rückenschmerzen hinter sich hatte. Sie wollte wieder ins Spital, fragte aber, wer nun ihre Kinder, die eben in die Schule gegangen seien, versorge. Als ich ihr versuchsweise eine Spritze oder Medikamente offerierte, stellte sich heraus, dass sie unter einer Art, genau wusste sie nicht mehr welcher, Blutkrebs leide und sie nicht beliebig Medikamente nehmen dürfe. Da ich inzwischen schon mit der Sprechstunde anfangen sollte, drängte ich auf eine Entscheidung und schlug folgende Möglichkeiten vor: ich rufe den sie betreuenden Hämatologen an und gebe dann die erlaubten Medikamente oder sie wartet den Verlauf ab, und falls keine Besserung eintritt, ruft sie mich an und dann oder gleich jetzt, bestelle ich die Ambulanz. Sie entschied sich für den letzten Vorschlag.
Früher, als ein junger, unerfahrener oder weniger abgestumpfter Arzt, hätte ich sofort die Gründe für das merkwürdige Krankheitsverhalten der Patientin wissen und die Rätsel lösen wollen. Gut, der Weg zum Türöffner dauerte den Schmerzen entsprechend sehr lange, aber zurück im Bett war die Patientin ehe ich die Treppe in den dritten Stock hochkommen konnte, sie erwähnte (und auch ich) nicht das Warten. Es schien mir, sie wusste über ihre Krankheiten, ihren geistigen Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechend, zu wenig Bescheid. Sie bedrängte mich mit den Fragen nach dem Grund der Schmerzen, ohne mir die Möglichkeit zu geben, durch Nachfragen oder Untersuchungen mehr zu erfahren. Sie erwähnte die ganze Zeit weder den Ehemann, noch einen Partner, noch kam sie bei ihrer Überweisung auf das Problem der Betreuung der Kinder während ihres Spitalaufenthaltes so wenig zurück, wie vorher auf die Probleme beim Türöffnen. Ich sollte nicht zu viel erfahren, aber doch schlussendlich die ihr genehme Entscheidung treffen.
Mit meinen alten Knochen blieb mir aber die Neugier. Hatte der Zustand der Patientin doch einen entsprechenden körperlichen Grund und meine psychosozialen Beobachtungen und Betrachtungen waren zweitrangig? Ausser der Neugier blieben auch Zweifel. Wäre es nicht wichtiger als die Sprechstunde zu führen, die bei dieser Frau wahrscheinlich nicht häufige Gelegenheit zu ergreifen, und wie ich es früher getan hätte (eben mit mässigem Erfolg), sich in ein ruhiges, verständnisvolles Abklärungsgespräch zu vertiefen?
Auf die Herausforderung, einen Bericht über den Notfalldienst zu schreiben bin ich eingegangen, da ich auf folgendes hinweisen wollte: Wie wichtig ist das gute, verständnisvolle, möglichst ruhige Verhältnis der Beteiligten in den schon von Natur aus spannungsvollen, belastenden Notfallsituationen, wieviel wir in den Notfallsituationen lernen, auch aus den Schlussberichten der involvierten Spezial- und Spitalärzte, die mir nach den Vertretungen oft fehlen. Ich entschied mich, im Rahmen meiner (nicht ausweisbaren aber umso effektiveren) Fortbildung jeweils auch eine Kopie zu verlangen.
Schweiz Ärzteztg 2002;83:1795-7. Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH.

„Alles wird seinen Sinn einst zeigen.“
Hermann Hesse, Rotes Haus (1919)
„Mir scheint, dass der Sinn der schöpferischen Tätigkeit eines Schriftstellers darin besteht, alltägliche Dinge so zu schildern, wie sie sich in den freundlichen Spiegeln künftiger Zeiten zeigen werden, in ihnen die duftige Zartheit aufzuspüren, die erst unsere Nachkommen in jenen fernen Tagen empfinden werden, wenn jede Kleinigkeit unseres gegenwärtigen Alltags schon an sich schön und festlich sein wird, in jenen Tagen, wenn einer, der das einfachste heutige Jackett anzieht, bereits für den feinsten Kostümball herausgeputzt ist.“
V. Nabokov: Stadtführer durch Berlin, 1925
Diese hoffentlich im Sinne der Schwinger "bösen" Zeilen hätte ich ohne Herausforderung des Chefredaktors dieser Zeitschrift nicht geschrieben. Nach meiner "Praxisaufgabe" (1) meinte er, ich solle versuchen, eine Bilanz zu ziehen, meine Erfahrungen zusammenzufassen, mich zu äussern, was ich gleich, was ich anders getan hätte, was ich mehr und was ich weniger schätzte. Sie sind subjektiv und erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit.
Die Motive unserer Einstellung und unseres Handelns überblicken wir nie ganz. Für das Studium der Medizin entschied ich mich wegen der Breite der Materie, der Verbindung von Naturwissenschaft und Psychologie, der Möglichkeit, den Leidenden unmittelbar helfen zu können, der damit verbundenen Anerkennung. Für meine Eltern war auch die Sicherheit wichtig. Während des Krieges bekam der Onkel in schlechten Zeiten als Arzt genug Lebensmittel und konnte auch uns vor grösserem Hunger bewahren.
Allgemeinpraktiker, noch dazu in der Schweiz, wurde ich auf Umwegen. Während des Studiums in der Tschechoslowakei begann ich in Bratislava im Institut für Biochemie zu „schnuppern“ und wurde Mitautor von zwei Publikationen (2,3). Man kann es der hiesigen Doktorarbeit gleichsetzen. Die Forschung faszinierte mich. Ausser Ehrgeiz erfüllte sie auch meine Neigung, sich in ein Problem zu vertiefen. Die Grundlagenforschung war dort damals (50 - 60-er Jahre) vielleicht der freiste Bereich des Berufslebens. Da konnte man auch westliche, selbstverständlich nur fachliche Zeitschriften lesen, ohne eine Bewilligung einholen zu müssen, die man z.B. im klinischen Bereich zur Durchsicht von Freuds Schriften brauchte. In der Forschung konnte man auch noch am freiesten Meinungen äussern, diskutieren, was ich mit Leidenschaft tue. Nach sieben Jahren als Assistenzarzt im selben Institut bekam ich ein Humboldt-Stipendium in der Bundesrepublik Deutschland. Wie es auch unschön klingt, ich ging bereits mit der Entscheidung, nicht mehr, womöglich nie mehr zurückkehren zu können. Ich wollte aus dem geistigen (und in gewissem Masse auch dem körperlichen) Käfig ausbrechen, Neues kennenlernen, in meinem Fachgebiet die optimalen Möglichkeiten nutzen, mich durchsetzen, mich frei sowohl bewegen wie auch persönlich entfalten, wozu auch die besseren finanziellen Bedingungen gehörten. Wegen meiner beengten Erfahrungen war es teilweise naiv. Nach drei Jahren guter Forschung in einem Physiologischen Institut in Deutschland bewarb ich mich um eine Stelle in der Schweiz, die ich auch erhielt. Mein Arbeitsplatz war in Zürich, und als Neurochemiker geriet ich hier in die für mich fantastisch anziehungskräftige, interdisziplinäre, eng verflochtene "Neuropsychoszene" mit gemeinsamen Kolloquien, hochgradigen ausländischen Gästen und anregenden Diskussionen, die mein damaliger Chef, Professor Akert, wesentlich förderte. Wie es auch merkwürdig scheint, dies trug dazu bei, dass ich die Forschung verliess. Die breitere, klinische Seite zog mich an. Ich spürte, dass mir die Konzentration auf ein enges Gebiet nicht (mehr) passte und die Beschäftigung mit Menschen fehlte. Mit der Zeit würde ich eher ein Laborantinnen und Doktoranden führender, mit verschiedenen Sitzungen die Zeit verbringender Manager, als ein im Labor selbst arbeitender Mensch sein. Ich sah auch ein, dass ich meine hochgesteckten Ziele, etwas Wesentliches zu entdecken, etwas Entscheidendes für die ganze Menschheit zu tun, wahrscheinlich verfehlen würde. Um sich so lange um einen nicht sicheren Erfolg bemühen zu müssen..., vermutlich könnte ich wirksamer den einzelnen Menschen als gleich auf einen Schlag der ganzen Menschheit nützen.
Was war naheliegender als mit diesen Voraussetzungen ein Psychiater zu werden. Mein Vater litt zeitweise unter schweren Depressionen, während des Studiums war Psychiatrie eine meiner bevorzugten Fächer. In der Zeit der Entscheidung war ich wegen persönlicher Probleme in Kontakt mit einer Psychologin, die mir jedoch, auch auf Grund meiner Schrift, davon abgeraten hatte. Ich brauche Abwechslung und die Möglichkeit, verschiedene Gebiete zu verbinden. Beides könne ich am ehesten als Allgemeinpraktiker. Wie dankbar war und bin ich für ihren Rat! Bei all meiner Liebe zu psychiatrischen Patienten und Problemen war ich nach dem dritten depressiven Patienten pro Vormittag schon erschöpft und dachte, wie können es nur die Psychiater aushalten. Auch eine Reihenuntersuchung, ob von Schulkindern oder Turnvereinen, sogar Grippewellen waren für mich eintönige, langweilige Angelegenheiten.
Und so begann ich mit meinen inzwischen gut dreissig Jahren die klinische Weiterbildung, die ich mit der damals noch nicht anerkannten Praxisassistenz bei einem Pädiater beendete. Es ist klar, dass ich für all die verschiedenen Aufgaben einer Allgemeinpraxis im Berggebiet nicht genügend gerüstet war, nicht sein konnte. Zugute kamen mir die Erfahrungen und Fähigkeiten, erworben während der Forschungsjahre. Schon während der Weiterbildung sagte mir ein Kollege, er wisse nicht, was für ein Arzt ich werde, aber sicher werde ich die beste Bibliothek weit und breit haben. Bei Problemen suchte ich, bei Bedarf auch in Anwesenheit des Patienten, die Lösung in Fachbüchern und Zeitschriften, falls nichts zu finden war, rief ich erfahrenere Kollegen oder das Zentrum an. In den letzten Jahren erfüllte das Internet weitgehend diesen Bedarf. Schon während der Weiterbildung, während der Anästhesiezeit, trat ich einer Balint-Gruppe bei. Die Kollegen wunderten sich, was ein Anästhesist da suche. Aber so wie die Anästhesie die angewandte, praktische Pharmakologie ist, ist sie auch eine intensive Psychosomatik. Die Gespräche vor und nach der Anästhesie, das Verhalten des Patienten während der Narkose sind psychosomatische Handlungen. Bei einem ruhigen, vertrauensvollen, parasympatikotonen Patienten verläuft die Narkose in der Regel einfacher, man braucht weniger Narkotika als bei einem ängstlichen, misstrauischen, sympatikotonen. Die Balint-Gruppe half mir sehr im Praxisalltag, die Patienten und mich zu verstehen, verbesserte meine Fähigkeiten, mit Menschen auszukommen und war eine grosse Hilfe und eine Stütze in der "Einsamkeit des Landarztes" (4,5). Mit einer Unterbrechung von vier Jahren, während der ich mich einer Psychotherapie unterzog, die aus mir einen einigermassen erträglichen Menschen machen half, war ich fast immer Mitglied einer Balint-Gruppe. Das "balinten" (5) führte mich zum Autogenen Training und später zur einfacheren, für viele Menschen dadurch geeigneteren, nicht weniger wirksamen Muskelrelaxation. Bei einem Kurs im psychosomatischen Bereich lernte ich ein anderes, enorm wirksames Lehrmittel - das Rollenspiel. Dabei erlebt man den Patienten, seine Gefühle, teilweise seinen Zustand mit "eigener Haut", mit dem eigenen Körper. Man spürt, was man mit ihm während des Gesprächs macht, was man in ihm erzeugt. Ich bedaure, dass man das Rollenspiel bei der Aus-, Weiter- und Fortbildung nicht vermehrt verwendet.
Es blieb mir unverständlich, wie gleichgültig, fast unfreundlich man viele Kollegen aus den Balint-Gruppen im Alltag, bei gelegentlichen Treffen erleben konnte, mit denen man intensive, bis ins Intime reichende Gespräche während der Sitzungen führte und wo man sich dauernd mit der Wichtigkeit der Beziehungen zwischen Menschen beschäftigte. Dazu mehr später.

(1) Praxishaus in Zweisimmen; Erdgeschoss Praxis, 1. Stock Wohnung, 2. Stock Ferienwohnung des Besitzers, Estrich zwei Zimmer und WC für Daniel und Haushaltshilfe. Foto von Silvia Marko.
Bereits ein Jahr nach der Praxiseröffnung begann ich mit den Kursen in Manueller Medizin. Diese PARON (praktische angewandte Rheumatologie, Orthopädie und Neurologie) betont den anderen Pol der Psychosomatik mit intensivem körperlichen Kontakt an der Grenze zur Gewalt, die man aber tunlichst nicht überschreiten sollte. Die Kenntnisse und Fähigkeiten der Manuellen Medizin halfen mir, den grössten Teil der Patienten in einer allgemeinen Praxis, den mit den Problemen des Bewegungsapparates, besser zu untersuchen, zu behandeln und zu verstehen. Nach der Rückkehr vom ersten Kurs klagte meine Frau zu meiner Freude über Kreuzschmerzen, deren Ursache ich stolz als Blockierung der beiden Ileosakralgelenke feststellte. Ich schritt unmittelbar zur entsprechenden Therapie. Nach der Manipulation des ersten Gelenkes, stand sie auf, schüttelte sich kurz, wie ein Hund, der aus dem Wasser stieg, bog sich und sagte zufrieden - es ist gut. Ich war begeistert, und sagte, sie solle sich wieder hinlegen, ich müsse auch das andere Gelenk in Ordnung bringen. Noch vertrauensvoll tat sie es. Nach der zweiten Manipulation, stand sie weniger "tiffig" auf und sagte mit verzogener Miene - es tue wieder weh. Die vorgeschlagenen weiteren Manipulationen lehnte sie zu meiner Enttäuschung ab. Unerfahren, kannte ich noch nicht folgende Geschichte des ersten Präsidenten der Schweizer Manuellmediziner, des verstorbenen Kollegen Terrier, die er bei einer Jahresversammlung bei einer geselligen Tischrunde zum Besten gab: Nach etlichen Jahren manuellmedizinischer Tätigkeit schenkte ihm seine Frau zum Geburtstag eine elektrisch verstellbare Liege. Nach der Lagerung der nächsten Patientin mit Rückenschmerzen drückte er auf ein Pedal, um sie auf die richtige Höhe zu hieven. Ehe er zur Manipulation ansetzte, läutete das Telefon. Er nahm ab, führte ein kurzes Gespräch und als er sich wieder zur Patientin wandte, sagte sie zu seiner Überraschung: " Danke Herr Doktor, es war prima, die Schmerzen sind weg!" Erfahren und weise genug, war er mit dem wie auch immer erreichten Erfolg zufrieden und sah von den offensichtlich nicht mehr nötigen Griffen ab. Ich erzähle diese Begebenheiten, um zu zeigen, dass in der Praxis andere Kriterien herrschen als in der Wissenschaft und es auf die Perfektion der Mittel und Einrichtungen nicht immer ankommt. Während der ganzen Praxiszeit manipulierte ich auf einer normalen Liege, stieg aber dabei auf einen kleinen Schemel. Nützlich war auch ein kleiner Hocker, auf dem die Patienten während der Untersuchung und Manipulation der Halswirbelsäule sassen, mit der es auch so seine Bewandtnis hatte: Nach einem weiteren manuellmedizinischen Kurs wagte ich mich, meiner Meinung nach vorsichtig genug, auf diese empfindlichere, höhere Etage mit dem durchschlagenden Erfolg, dass eine Patientin im Dorf erzählte, sie komme nie mehr zu mir, ich habe ihr fast den "Grind" abgerissen! Mehr als alle Kontrollen und Prüfungen zwingen einen solche Vorkommnisse, eine Methode aufzugeben oder sich zu bessern. Mit der Zeit lernte ich, wem ich was zumuten kann, aber auch neue schonendere, feinere Methoden der Mobilisation, die ich jetzt ausschliesslich anwende. Zu den feineren, aber sehr wirksamen Methoden gehört die Trigger-Punkt-Behandlung. Mit ihr kann man nicht selten Patienten helfen, die schon in allen möglichen Röhren untersucht wurden und verschiedene schulmedizinische, auch operative und alternative Behandlungen erfolglos über sich ergehen lassen mussten. Wenn sie rechtzeitig einen diesbezüglich Kundigen finden, kann man ihnen und den Kostenträgern vieles ersparen.
Die Entwicklung im Bereich des diagnostischen Ultraschalls erlebte ich fast von Anfang an. Zu Beginn der 70-er Jahre hörte ich während der Weiterbildung erstmals einen Vortrag über die Grundlagen dieser zukunftsträchtigen Methode am Beispiel von Echokardiographie im damals möglichen M-Modus. 10 Jahre später besuchte ich den ersten Kurs über Real-Time Darstellung. Als Allgemeinpraktiker war ich dabei eine Rarität. Die besten Fachleute in diesem Gebiet waren stolz, uns die Umrisse der Organe mit etwas Struktur zu demonstrieren. Wir waren beeindruckt von den klaren, schönen Darstellungen der Gallensteine. Ich glaubte, wenn man die eigenen Grenzen kennt, sei Ultraschall auch für uns Allgemeinpraktiker die Methode und kaufte mir ein Occasionsgerät. Es war ein Riesending, ein mehrere Zentner wiegender Mammut mit mehreren Rüsseln (verschiedenen Schallköpfen, sogar auch einem für Echokardiographie), der 2-3 Jahre vorher über
Fr.200'000.00 kostete. Ich bekam das Gerät für Fr.4'000.00, da die Firma froh war, es so nützlich entsorgen zu können. Die Grösse störte uns nicht, wir hatten genug Platz. Nach der Öffnung des Eisernen Vorhanges schenkte ich das Gerät meinen Kollegen in der Slowakei, wo es noch immer der Ausbildung der Studenten dient. Ich habe ebenfalls damit und mit dem neueren, kleineren, leistungsfähigeren, wieder mit Occasions-Nachfolger-Geräten geübt. Selbstverständlich verrechnete ich lange Zeit die Untersuchungen nicht. Ich konnte den Patienten die unangenehme Kathetrisierung, um den Resturin zu bestimmen, ersparen und etliche Gallensteine habe ich ebenfalls selbst entdeckt. Im Zweifelsfall schickte ich die Patienten weiter zu einem erfahrenen Kollegen mit einem besseren Gerät, eine Regel, an die ich mich noch immer halte. Ich glaube, unsere Hauptaufgabe ist, ähnlich den Arztgehilfinnen mit den Blutbildern, einen pathologischen von einem normalen Befund zu unterscheiden. Die genaue Diagnose müssen wir den Spezialisten überlassen, schon weil wir zu wenig pathologische Fälle zu sehen bekommen. Es waren aber viele Patienten froh, wenn sie notfallmässig mit einem schnell wachsenden schmerzhaften Knoten in der Brust oder auf dem Hals kamen, und ich ihnen beruhigend zeigen konnte, dass es sich um eine Zyste, eventuell mit einer Blutung handelte, oder ich konnte die Entwicklung eines Ergusses ohne zu röntgen in der Praxis beobachten und ihnen die jeweilige Fahrt ins Spital ersparen. Mit der Zeit war mir die sonographische Untersuchung auch bei der Differentialdiagnose akuter und chronischer Bauchprobleme eine grosse Hilfe. Die Diagnose der tiefen Venenthrombose in Kombination mit der Doppler-Untersuchung und jetzt auch mit der D-Dimer-Bestimmung ist auch eine geeignete Ultraschalluntersuchung für die Praxis, die man ziemlich schnell beherrschen kann. Noch mehr gilt es für die Blutdruckmessung der Beinarterien mit dem Doppler-Gerät. Diese einfache Methode erlernt man zwar selbst in wenigen Minuten, aber gegenwärtigen Neigungen entsprechend könnte man Kurse organisieren und dann Fähigkeitsnachweise verteilen und diese dann für die Abrechnungen dieser Leistung verlangen.
Allzu viele Fortbildungsveranstaltungen konnte ich wegen der Entfernung und des Zeitmangels nicht besuchen, (6) und so bildete ich mich selbst weiter, so gut ich konnte. Die Jahre in der Forschung kamen mir dabei wieder zugute: Ich war gewohnt, eine Methode nach der schriftlichen Beschreibung anzuwenden. So erlernte ich z.B. die epidurale Injektion und die Kolposkopie. Mit den heutigen bildgebenden Fortbildungsmitteln wie CD-ROM und Internet kann man es noch leichter und effizienter. Ich gewöhnte mir an, in die Ferien einen Haufen von Literatur oder mindestens 1-2 Bücher mitzunehmen, manchmal über skurrile Bereiche, wie Handlesen und Krankheiten. Zwei Gebiete, die ich gerne ausgeübt hätte, konnte ich trotz Kursen nicht beherrschen: Die Akupunktur wegen der anfänglich unerreichten Reproduzierbarkeit und meines ungenügenden Feingefühls und die Homöopathie, da später neben mir zwei spezialisierte Homöopathen praktizierten und mir die geeigneten Patienten fehlten. Ich begriff aber andere interessante Gedankensysteme. Die erlernte Akupunkturtechnik hilft mir jetzt beim Needling der Triggerpunkte. Wäre die Homöopathie nur eine Plazebo-Therapie, wäre ihr Nutzen nicht viel kleiner, da ein gutes Plazebo, an das sowohl der Patient wie der Arzt glauben, in der Praxis oft enorm wertvoll ist. Bei Insektenstichen hilft nichts besser als die Schüsseler-Salbe No. 8, mit homöopathischer D6 Verdünnung von Kochsalz. Die Neuraltherapie wandte ich fast täglich in der Praxis an.
Es ist kein Wunder, dass ich mit solchen alternativen Neigungen eines der ersten Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Alternativmedizin wurde. Als nach einem ausgezeichneten, witzigen, sowohl gegen Schul- wie Alternativmedizin kritischen Vortrag über Kopfschmerzen von Kollege Isler aus Zürich an der Jahresversammlung dieser Gesellschaft über eine Vorzensur solcher (auch gegenüber alternativen Methoden) kritischer Vorträge ernsthaft, ohne grossen Widerstand diskutiert wurde, trat ich enttäuscht aus. Von den anderen verlangte man Verständnis und Toleranz, die man selbst nicht aufzubringen imstande war. Ich hoffe, dass in dieser Gesellschaft inzwischen eine andere, freiere, liberalere Geisteshaltung herrscht.
Damit bin ich bei einem heiklen Punkt angelangt, den ich schon bei den Balint-Gruppen erwähnte - zu den Beziehungen zwischen uns Ärzten. Kaum ein Beruf beschäftigt sich mit Beziehungen im Allgemeinen und Konkreten und mit der Kollegialität soviel wie wir, aber auch kaum ein Beruf ist in dieser Hinsicht so gehemmt wie wir. Ich meine nicht das komplizierte, von vielen Einflüssen abhängige Auskommen am Ort, wo man praktiziert, das ein wesentlicher Faktor der Lebensqualität ist, sondern die einfachen menschlichen, gelegentlichen Beziehungen bei Fortbildungen, Jahresversammlungen, und anderen mehr oder weniger fröhlichen Treffen. Als Unbekannter wird man selten in ein Gespräch miteinbezogen, manchmal an einem Tisch bleiben auch die Frauen stundenlang unbeachtet, unangesprochen sitzen. Häufig führt man kein richtiges Gespräch, sondern übt sich im Durchsetzen. Ein Kollege, mit dem ich in einem Kurs eine Woche lang gegenseitig Manipulationsgriffe übte und mit dem ich mich gut verstand, wollte mich ein paar Monate später bei einer Begegnung nicht mehr kennen. Merkwürdigerweise oder bezeichnenderweise, je alternativer und sanfter die Methode, der sich die entsprechende Ärztegesellschaft widmet, desto leichter ist der Kontakt, der Umgang freundlicher, kollegialer. Meiner Erfahrung nach liegen, stehen oder sitzen die Homöopathen diesbezüglich an der Spitze. Ich liess mich belehren, dies soll durch die Rivalität während des Studiums und der Weiterbildung hervorgerufen worden sein, nun, dann wäre es Zeit für den Numerus clausus. Als sich die Arztgehilfinnen bei uns vorstellen kamen, ersetzten wir ihnen die Fahrkosten und schickten ihre Unterlagen zurück. Wir wollten nicht glauben, dass wir damit eher eine Ausnahme waren. Jetzt passiert es auch mir manchmal, wenn ich mich um eine Vertretung interessiere, dass ich trotz Versprechung auf eine Antwort vergebens warte.
Auch wenn nach vier Jahren ein vollamtlicher medizinischer Chefarzt und ein Anästhesist nach Zweisimmen kamen, waren die Belastung und der unbewusste Wunsch nach Abwechslung die Hauptgründe, warum wir nach zehn Jahren Zweisimmen Richtung Romanshorn verliessen. Dabei blieb uns das Erlebnis eines „Karenzjahres“ nicht erspart. Trotz meiner zehnjährigen Praxistätigkeit, ohne Probleme mit Abrechnungen; ich gehörte zu den wenigen Ärzten, die im ersten Jahr der Praxistätigkeit unterdurchschnittliche Rechnungen stellte, haben sich die Krankenkassen quer gelegt und anerkannten meine Leistungen nur während der Dienste. Die Patienten waren ziemlich verwirrt, wenn ich sie während des Wochenenddienstes behandelt hatte und die Rechnungen von den Krankenkassen bezahlt wurden, nicht aber für die anschliessenden zwei Wochen der Ferienabwesenheit ihres Hausarztes, während der sie wünschten, weiter von mir betreut zu werden. Es brachte mir sicher keinen guten Ruf, keinen grossen Haufen Patienten, einen ziemlichen finanziellen Verlust und viele Erfahrungen. Ich war Arzt, Arztgehilfin und Putzfrau in Personalunion. Ich machte Labor, wozu mir meine früheren Erfahrungen zugute kamen, röntgte, bediente das Telefon, einzig die Abrechnungen überliess ich weiterhin meiner Frau. Dazu würde mich offensichtlich nur ein Arbeitslager bringen. Ich sah, dass eine Praxis fast im Leerlauf viel Zeit braucht, und selbst mit manchmal nur 3-4 Patienten pro Tag war ich voll beschäftigt. Um 10.00 Uhr herum hatte ich oft eine stressige Zeit, da alle Patienten dann kommen wollten, das Telefon läutete und der Pöstler mit mir „Versteckis“ spielte: Wie ich auch meine Notdurft verschoben und verhalten hatte, er kam mit irgendeiner Unterschrift, als ich im WC sass. Zeit-, sinnfüllend und als gute Abwechslung erwies sich eine Studie über Antikoagulation in der Praxis (7), die ich für diesen Zweck unbeabsichtigt, noch in Zweisimmen zu planen und zu organisieren begonnen hatte. Wegen der finanziellen Belastung und auch anderer Unsicherheiten war es eine harte Zeit, aber mit den neuen Kenntnissen und Erfahrungen konnte ich die Praxis auch in Abwesenheit oder Krankheit der Arztgehilfin führen, und auch sonst habe ich über das Leben viel gelernt.
Während der ganzen Praxiszeit stellte sich bei mir kein Gefühl von „Verbranntsein“ und kein Bedürfnis nach einer längeren Pause ein. Der Übergang von der Forschung in die Praxis und die Verlegung der Praxis sorgten für genug Wechsel und Spannung. Es ist sicher eine Ausnahmelösung, offensichtlich meinen persönlichen Neigungen und denjenigen meiner Frau entsprechend.
Die treuen Besucher einer Praxis, die (guten) Pharmavertreter, habe ich sehr geschätzt und ich hoffe, sie werden nicht “wegrationalisiert“. Ich war unzufrieden, wenn sie mir manchmal neue Medikamente zu spät vorgestellt hatten, auch wenn ich bereits, meistens aus der Presse, informiert war. Manche Aspekte konnte ich mit ihnen immer wieder näher besprechen. Unsere Diskussionen waren offen, und ab und zu flogen dabei Fetzen. Leider kann man in unserem medizinischen Betrieb nur selten so unmittelbar, sachlich, prestige-, macht- und hierarchiefrei über fachliche Probleme sprechen. Bei Bedarf besorgten sie mir weitere Informationen und Unterlagen aus ihrer Zentrale und manchmal hatte ich sogar den Eindruck, sie hätten meine Anliegen wirklich weitergeleitet, wozu der Meinungsaustausch auch dienen sollte. Die Änderung der unsinnig kleinen 50-er Packung von Glucophage mite ist mir trotz Bemühungen auf verschiedenen Ebenen der Firma nicht gelungen. Da man die Zuckerpatienten üblicherweise in mehrmonatigen Abständen kontrolliert, müssen sie nicht selten mehr als 4 Packungen mitnehmen, was umständlich ist und ungute Gefühle hervorruft, womit auch den Produzenten nicht gedient ist. Mit diesen Zeilen unternehme ich den letzten (vergeblichen?) Versuch. Ich wurde zwar mit den Mustern jeweils spärlich versorgt, aber die Auseinandersetzungen waren mir wichtiger und nützlicher. Falls die Pharmavertreter mit den Bettlern eine ähnliche Verständigung pflegen, wurde sicher heimlich irgendwo am Eingang meiner Praxis das Zeichen „Vorsicht, lästiger Chaib“ hingekritzelt.
Wie die Dienste und die Ferien eingeteilt werden, ist nicht nur für das eigene Familienleben wichtig, aber auch für die Mitarbeiter. Vielleicht dank der Einstellung und dem Berner Temperament, wussten wir in Zweisimmen manchmal erst 2-3 Wochen vor den Ferien, wann wir sie nehmen konnten. In Romanshorn war es besser. Ein Kollege teilte die Dienste ein, und die Ferien wurden gemeinsam, nach langdauernden Diskussionen, doch oft nicht früh genug, ausgehandelt. Wir mussten häufig nachträglich die Dienste ändern, da die Termine dem Einzelnen nicht entsprachen. An einem Kurs erfuhr ich im Gespräch mit einem Kollegen aus Wetzikon über ein System, das wir mit Erfolg übernahmen: Die Ferien wurden bereits ein Jahr, die Dienste mehr als vier Monate im Voraus „versteigert“. Die Ferien konnten wir leichter anpassen, und mit Diensten ging es ohne langes Hin und Her, jeder nahm so viele Dienste und wie und wann er wollte. Gott sei Dank waren zwischen uns keine „Drückeberger“. Ich kann das System wärmstens weiterempfehlen.

(2) Romanshorn Praxishaus: Erdgeschoss Praxis, 1. Stock und 2.Stock Wohnung des Besitzers. Foto Silvia Marko
Abgesehen von manchen Verständigungsschwierigkeiten hatte ich während der vielen Jahre des Berufslebens keine Probleme als Ausländer. Einmal kam eine Frau und fragte, ob sie wegen ihres Asthmas ihre Finken weggeben solle. Ich sagte, warum denn nicht. Sie hänge sehr an ihnen, erwiderte sie. Ich dachte, die Leute hängen an komischen Dingen, und ich gab ihr zu verstehen, sie könne doch problemlos neue kaufen, was sie nicht verstand, wozu soll sie ihre vertrauten, geliebten gegen unbekannte austauschen? Selbstverständlich kannte ich bis dahin die Finken nur als Pantoffeln unserer Kinder. Ein anderes Mal kam eine Frau zu mir und sagte, sie habe ein "böses Mul". Ob ihrer Einsicht und Ehrlichkeit überrascht, wollte ich es etwas abschwächen und sagte: "Es macht nichts, meine Frau auch". Sie lachte und zeigte mir ihren Mund voll Aphten. In der nahen Bäckerei erzählte sie es dann, und die Bäckersfrau wusste nichts Besseres als es meiner Frau weiterzuberichten. Als ich den Patienten in der Ostschweiz nach dem Eintritt in das Sprechzimmer das aus dem Berner Oberland gewöhnte "Hocken Sie ab" sagte, merkte ich, dass ich damit irgendwie daneben liege. Meine Ostschweizer Frau belehrte mich, es gehöre hier eher zu den groben Ausdrücken.
Die Betreuung und Begleitung der Sterbenden ist eine schöne, manchmal aber schwierige Aufgabe. Am Anfang der Praxis kam zu mir wegen bereits mehrere Monate dauernder Schwäche ein älterer, lediger Bauer. Er verschwieg uns, dass er die Diagnose ahnte. Es dauerte ein paar Tage, bis wir sie auch kannten. Der grosse Teil seiner Familie war, wie bei Napoleon, an Magenkrebs gestorben. Die Operation lehnte er kategorisch ab, mit den Bluttransfusionen, aber nur in der Praxis, war er einverstanden. Er wollte immer wieder, leider für immer kürzere Zeit, etwas stärker werden, selbständig bleiben. Später halfen sie nicht mehr, so hörten wir auf seinen Wunsch mit ihnen auf. Die Schmerzen wurden allmählich stärker. Wenn die Tabletten gegen sie nicht reichten, besuchte ich ihn immer öfters in seinem schönen alten Simmentaler Bauernhaus, wo er mit der Familie seines Bruders wohnte, um ihm etwas Stärkeres für die Nacht zu spritzen. Eines Vormittags wurde ich in der Mitte der Sprechstunde gerufen, es war ihm gelungen, ohne den von ihm tunlichst gemiedenen Spitalaufenthalt im Kreis seiner Leute zu sterben. Während der Rückfahrt nach der Ausstellung des Totenscheins musste ich anhalten und weinen. Auch weil ich mir überlegte, ob ich einmal so stark sein werde, und es mir vergönnt wird, so würdig zu sterben? Einen anderen alten, aber rüstigen Patienten überredete ich, sich dieser Operation zu unterziehen. Anderthalb Jahre später, kurz vor seinem Tod, sinnierte er über sein Leben. Er bedaure nur eins, sagte er mir mit Ruhe und vorwurflos, dass er sich operieren liess. So wird man in dieser Hinsicht zurückhaltender. Die Schwierigkeiten beim Sterben machen eher die Verwandten. Sie richten sich wegen ihrer eigenen Ängste vor dem Tod oder ihrer Schuldgefühle gegen den Arzt. Nicht selten wird eine gute, langjährige Beziehung jäh unterbrochen, und der Arzt wird ohne sein Verschulden gewechselt. Wir alle erleben solche überraschenden, unerfreulichen Entwicklungen und lernen damit umzugehen und zu leben. Wenn man die Gelegenheit hat, einen solchen Fall in der Balint-Gruppe zu besprechen, kann es sehr hilfreich sein und von den übertragenen Schuldgefühlen entlasten.
Es wurde mir nahegelegt, aufzuzeigen, was ich in der Praxis anders, besser gemacht hätte. Mit den Jahren versteht man eher, warum im Leben etwas geschieht, warum es so und nicht anders läuft (s. das Motto von Hesse). Dank den freien, demokratischen Verhältnissen in der Schweiz konnte ich meine Neigungen ziemlich entfalten und im Berufsleben auch meinen Bedürfnissen entsprechend handeln. Es mag anmassend klingen, aber ich würde nicht viel ändern, wie man später lesen kann, eher umgekehrt. Sicher würde ich wieder lieber auf dem Land als in einer Grossstadt praktizieren wollen. Die zeitliche Belastung zu Beginn der Praxis in Zweisimmen mit den Nebenbeschäftigungen als Belegarzt und Anästhesist war den Kindern sicher nicht zuträglich und manchen Bereichen sollte ich mich früher widmen. Ich denke, ausser an meine persönliche Psychotherapie, vor allem an die Gesprächsführung (5).. Was ich darunter meine, wurde kürzlich trefflich beschrieben: Als Studenten wurden wir gut unterrichtet, wie man die Anamnese erhebt und den Patienten untersucht, um die Diagnose der Krankheit zu stellen. Wir sollen sie benützen, auch den Patienten kennenzulernen. ... Die gegenwärtige Berufsbildung beschäftigt sich mit den Symptomen und den Zeichen der Krankheit und wir widmen uns wenig der Beurteilung der Person. Wir überlasssen es dem „klinischen Blick“ und setzen voraus, dass wir ihn durch Osmose und Erfahrung lernen. Leider ist dieser Eindruck unzuverlässig, und wir sollten lernen, wie man das Krankheitsverhalten beurteilt“ (8). Die entprechenden Kurse werden jetzt bereits den Studenten angeboten, eine vorteilhafte Errungenschaft, die ich allen angehenden Ärzten, die mit Patienten zu tun haben, wärmstens empfehle. Trotzdem habe ich mich heftig ins Kreuz gelegt mit der dann Gott sei Dank verlassenen Absicht mancher führender Häupter der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, angehende Allgemeinpraktiker dazu zu zwingen. Da dabei sehr die eigene Person, die „eigene Neurose“ einbezogen wird, muss man dafür selbst bereit und geeignet sein, sonst verfehlt es den Zweck, und wir tragen zu einem totalitären System bei, an das wir, mit den vielen Vorschriften, Obligatorien, Prüfungen, schon gefährlich nahe hinsteuern. Ich genoss mehr Freiheit und weniger Zwang, was bekanntlich kaum weniger, aber anders belastet und mit mehr Eigenverantwortung verbunden war. In allen anderen Berufen setzt sich diese Einstellung durch, nur die Ärzte sollen zunehmend auf die Primarschulstufe zurückversetzt werden. Wäre es nicht einen Versuch wert, unsere Verhandlungspartner zu überzeugen, dass es Erfolg versprechender ist, statt durch verschiedene Zwänge, Kontrollen und schulmeisterliche Prüfungen, die Energie und die Zeit für geeignetere Methoden der Messung der Gesamtqualität und für wirksamere Massnahmen zu ihrer Besserung einzusetzen?
Die Einzelpraxis, ähnlich dem Tante-Emma-Laden, solle keine Zukunft mehr haben. Mit dieser Meinung gibt auch unsere Standesorganisation dem Zeitgeist und dem Beispiel von Banken, Post, Bahn und Migros, die ihre kleinen Zweige schliessen, nach. Sie werden teilweise durch Nischenfüller und Abwicklung über das Internet ersetzt. Aber wer sollte, wenn nicht die Ärzteschaft, auch den Service public erfüllen? Die Leute leben nicht nur in den grossen städtischen Agglomerationen. Sie werden zunehmend mit ihrem Beruf, Stand- und Wohnort ungebundener. Paradoxerweise brauchen sie während den dadurch häufigeren Lebenskrisen und Krankheiten noch mehr eine Vertrauensperson. Schon jetzt sind viele Menschen mit den grossen, unübersichtlichen, anonymen Spitälern, Polikliniken, Gesundheitszentren, mit dem häufigen Wechsel der betreuenden Personen nicht zufrieden. Sie können (noch) den (Haus-) Arzt in der Nähe nach Bedarf, nach ihrer oder der Zufriedenheit der Verwandten und Bekannten aussuchen, mit dem sie eventuell schon manch Gutes und Schlechtes erlebt, sich auseinandergesetzt, getrennt und wieder gefunden haben.
Die Auslastung der teuren Geräte ist ein weiteres Argument gegen die Einzelpraxis. Die Preise werden sich jedoch mit der Zeit ähnlich den Computern, Handys und anderen elektronischen Geräten nach unten bewegen. Die Geräte werden den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Betriebe angepasst, wie es bereits mit Labor- und Ultraschallgeräten geschieht. Neue, strahlenmässig schwächere, trotzdem leistungsfähigere und umgänglichere Röntgen- und einfachere elektronische Entwicklungsgeräte sind noch für einzelne Praxen unerschwinglich, aber mit der Zeit... Ein Quick-, und ein Blutzuckermessgerät soll sich für einen einzelnen Patienten lohnen, nicht aber ein Trockenchemiegerät für eine einzelne Praxis? Abgesehen davon hat z. B. eine Röntgenröhre nicht einfach eine unendliche Lebensdauer. Zwei Ärzten dient sie nur die Hälfte der Zeit als einem Arzt. Jedes System funktioniert je nach finanziellen Bedingungen (9). Das Tarifsystem ist auch ein Steuerungssystem. Wenn man für die Laborbestimmungen, die man sofort in der Praxis durchführt, keine höheren Preise verrechnen darf, kann man sich nicht wundern, dass Gemeinschaftslabors entstehen, grosse Labors florieren und das Praxislabor draufgeht. Dass eine vernünftige, gerechte, stetige Anpassung der Tarife an die technischen und anderen Entwicklungen wichtiger und effizienter ist, als verschiedene nachträgliche, komplizierte, künstliche, gesetzliche Eingriffe in das Gesundheitssystem, sollten alle beteiligten Seiten begreifen. Hoffentlich wird man die mehr als tausend Positionen des TarMeds leichter jeweils den neuen Bedingungen anpassen können, als die durch unsere Vorahnen nicht umsonst einfacher geschaffenen Tarife. Es gibt noch andere Gründe, die Einzelpraxis nicht aussterben, sondern hochleben zu lassen. Kurz vor Beginn meiner Praxistätigkeit Mitte der siebziger Jahre ging in einem Nachbarsort eine der ersten allgemeininternistischen Gemeinschaftspraxen der Schweiz bereits nach kurzer Zeit auseinander. Nach einigen Jahren unternahm der Kollege einen neuen Anlauf. Zwei Jahre später sass ich bei einem Essen nach einem Vortrag neben seinem neuen Kompagnon. Ich fragte, wie es mit der Praxis gehe. Er sagte, sehr gut. Als ich mich nach eventuellen Schwierigkeiten erkundigte, gab er unverbindlich manches zu, man müsse in einer Gemeinschaftspraxis halt eine gewisse menschliche Grösse haben. Ich bemerkte, eben diese fehle mir. Zwei Jahre später ist auch diese Gemeinschaft auseinander gegangen. Mit anderen Worten, für diese sehr anspruchsvolle Aufgabe mit einer Mischung aus finanziellen Interessen, Verantwortung, Ehrgeiz, Loyalität, alles sehr nahe und unmittelbar erlebt, sollten alle Beteiligten, Arztgehilfinnen, Arztfrauen und Ärzte (fast) Engel sein. Es ist z. B. leichter für mich, alleine eine Arztgehilfin zu finden als eine, die gleichzeitig für zwei oder mehr Kollegen geeignet sein soll. Es gibt immer wieder ausgezeichnete Arztgehilfinnen, die nach einer Erfahrung in einer grossen Praxis mit mehr Angestellten lieber härter, aber alleine arbeiten wollen. Nicht nur ich wundere mich über die Effizienz der grossen Praxen mit mehreren Angestellten in unserem nördlichen Nachbarland, wo eine besondere Signalisation dem Inhaber zeigen soll, zu welchen Patienten, in welchen der vielen Räume er sich zu begeben habe. Praxen, in denen alle mit vollem Einsatz und ungeteilter Verantwortung gut und gern für den Patienten übersichtlich arbeiten, tragen wesentlich zur (unmessbaren?) Qualität des Gesundheitswesens bei. Die Arztpraxen, wie jeder Betrieb, haben ihren Aufgaben entsprechend eine optimale Grösse.
Dank Internet kann man auch in einer einzelnen Praxis die Patienten immer besser und breiter beraten und betreuen. Zwei Beispiele. Einem 80-jährigen Patienten mit einem erfolgreich operierten Bauchaneurysma, dessen Vater daran verschied, stirbt eine der Töchter an einer akuten Hirnblutung, nach derselben blieb eine ihrer Tanten jahrelang gelähmt. Er fragt mich, ob es einen Zusammenhang gebe, seien er, bzw. seine Gene daran schuld? Spontan habe ich, um ihn zu beruhigen, nein geantwortet. Wie konnte man sich früher über die Richtigkeit dieser Aussage überzeugen? Am einfachsten durch einen Anruf bei einem Neurologen oder einem Neurochirurgen. Weiss er aber den neuesten Stand der Evidenz? Oder ich könnte in die nächste grosse Bibliothek (Zürich) fahren und dort, je nach Fragestellung, stundenlang, wenn nicht tagelang in den Zeitschriften suchen und wühlen. Mit dem Internet brauchte ich 45 Min., um sicher zu erfahren, nicht nur dass es tatsächlich einen Zusammenhang gibt, aber auch, dass man in so einer Familie bei den Männern über 50 ihre Bauchader (was ich bereits wusste) und bei den Frauen über 40 ihre Hirngefässe regelmässig kontrollieren sollte. Das Problem mit der Meinung einzelner Fachkundiger illustriert die zweite Geschichte. Im Gesundheitsforum der Zürcher Hausärzte (www.hausarzt.ch) fragte ein Patient (aus der BRD, was ich wegen den geografisch unbeschränkten Möglichkeiten erwähne) mit Induratio penis plastica, ob die Aussage seines Urologen richtig sei, dass er zuerst Vitamin E nehmen solle, falls es nicht helfe, müsse man ihn operieren. Wegen der engeren Fragestellung wusste ich bereits nach 20 Min. surfen, dass es noch viel wirksamere konservative Massnahmen gibt als Vitamin E, die man vor der Operation unbedingt ausschöpfen sollte. Ja, das Internet demokratisiert und dezentralisiert. Dies gilt nicht nur für Entwicklungsländer, aber auch für die Ärzte und ihre Fortbildung in der Schweiz. Diese Beispiele zeigen, wie man sich viel schneller, effizienter den Praxis-, Problem-, Patientbedürfnissen entsprechend jederzeit informieren kann. Viele ineffiziente(re) bisherige Formen der kollektiven Fortbildung werden überflüssig. Sie bleiben wichtig, wofür sie auch geeignet sind - für die Übung und Aneignung der Handfertigkeit.
Die Patienten können sich im Internet von mehreren Ärzten beraten lassen, (dann) uns ihre Probleme per e-mail vorankündigen (von vielen Seiten gewünscht, wird man bald einfach diktieren und wegschicken können), wir können uns dann besser vorbereiten, was das Gespräch mit Patienten nicht überflüssig, aber leichter, gezielter und wirksamer macht, womit dessen Bedeutung noch steigt. Die gut (vor-) informierten Patienten brauchen nicht weniger, aber mehr Beratung: Der erfahrene, ausgebildete Arzt kann die Informationen für die spezielle Situation des Patienten gewichten, beurteilen und das weitere, geeignete, diagnostische und / oder therapeutische Vorgehen empfehlen. Es gibt viele Kurse, die uns in die technischen Seiten des Internets, in die Möglichkeiten der Suche nach Informationen, einweihen, vorläufig aber keine, die sich den Änderungen des Praxisalltags, der Bildung, Weiterbildung und Fortbildung widmen. Unsere Ärztegesellschaften sind z. Zt. mit TarMed zu beschäftigt. Durch die umfangreichere Information der Patienten und ihre steigenden Ansprüche (und unsere zunehmende Konkurrenz) werden viele Formen der mühsam vorbereiteten und zeitraubenden Kontrollen unseres Wissens und unserer Fähigkeiten überflüssig.
Wenn wir schon bei den Problemen der Informationen und der Fortbildung sind: Ich weiss nicht, wie es anderen geht, vielleicht ist mein Gedächtnis besonders löchrig, aber ich habe immer schon Probleme gehabt, die nützlichen Informationen, die ich während Vorträgen und anderen Fortbildungen erworben habe, die gelesenen Artikel, die ausgerissenen Zeitschriftenseiten bei Bedarf schnell zu finden. Mit den jetzt vorhandenen Computerprogrammen ist es ein leichtes Spiel. Meiner Erfahrung nach lohnt sich die Zeit, die man für die Speicherung der Daten braucht. Mit dieser einfachen Massnahme steigt die Wirksamkeit der Fortbildung und die Qualität unserer Arbeit. Wir widmen ihr zu wenig Aufmerksamkeit. Weil sie unauffällig ist und sich der direkten Kontrolle entzieht?
Es wäre schade, und unsere Nachkommen würden uns ebensowenig verstehen, wie wir die überflüssigen, groben Einschnitte unserer Vorahnen, wenn sie die hochentwickelte und hocheffiziente Einzelpraxis, die den geographischen, historischen und politischen Gegebenheiten dieses Landes entspricht, nach ihrer Ausrottung, den Aufzeichnungen des medizinhistorischen Museums nach, mühsam wiederherstellen müssten, wie wir es mit den ausgestorbenen Pflanzen und Tieren versuchen. Sie werden die Einzelpraxis nämlich (wieder) brauchen.
Ich nahm mir die Freiheit zu diesen Bemerkungen, da ich nicht mehr im Verdacht stehe, meine persönlichen Vorteile und Pfründe zu verteidigen. Ich versuchte zu zeigen, dass ich nicht (nur) aus sentimentalem Hang zu schönen Erlebnissen am Alten, Gewohnten klebe.
Die Simmentaler sagen am Ende ihrer Ausführungen „ich habe geschlossen“.
* Diese Zeilen sind subjektiv und erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit.
1 Niederland TR, Dzurik R, Kovaes P, Hostyn L, Marko P: Dynamische Änderungen derLipidfraktionen in der Niere und Lunge nach grossen Dosen von Salicylaten. Bratisl Lek Listy 1959;39:732-7 (slowakisch).
2 Niederland TR, Kovacs P, Dzurik R, Hostyn L, Marko P: Dynamische Änderungen der Lipidfraktionen in Leber nach grossen Dosen von Salicylaten.Cas Lek ces 1960;99:98-101 (slowakisch).
3 Niederland TR, Kovacs P, Ozurik R, Hostyn L, Marko P.: Dynamische Änderungen der Lipidfraktionen in Leber nach grossen Dosen von Salicylaten. (slow) Cas Lek Ces 1960;99:98-.
4 Marko P: Familienarzt, Familientherapie und ein Fall. Psychosom Med 1980;9,238-44.
5 Marko P: Über die endliche und unendliche Balintgruppenarbeit und ein Wunsch eines Balintveterans. Psychosom Med 1987;15.163-6.
6 Marko P: Ich fuhr nach Grubenwald. Schweiz Ärzteztg. 1981;62:1436-7.
7 Marko P, Flückiger H, Christeller S: Zur oralen Antikoagulation in der Praxis. Schweiz Med Wschr 1002;122:732-741.
8 Waddle G: The Back Pain Revolution. Churchill, Livingstone, Edinburgh, 1998, S. 157-8.
9 Sylla R: Am Anfang war das Finanzsystem - dann kam der Erfolg. Neue Zrch Ztg 2000;221(145):99.
Schweiz Ärztezeitg 2000;81:2744-9. Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH.

50 Jahre nach der Praxiseröffnung kehre ich zurück in den Ort, den ich damals so beschrieb: «In unserem Dorf praktizieren drei Ärzte: ein Chirurg, ein Internist und ich als Allgemeinpraktiker. Wir vertreten uns gegenseitig während der Ferien und leisten abwechslungsweise Wochenenddienste, auch im Spital, so dass wir über unsere Patienten eine gute Übersicht haben. Unser Gebiet ist zirka 25 km lang. Ungefähr die Hälfte unserer Patienten sind Bergbauern, die in den kälteren Jahreszeiten ihre Zipfelmützen tragen.» Jetzt gibt es zwar weniger Bergbauern, aber immer noch viele Bewohner tragen die «gäbigen» Zipfelmützen. Das Haus, in dem ich die Praxis hatte und im ersten Stock wohnte, ist schöner, stattlicher, aber nach 100 Jahren gibt es dort keine Arztpraxis mehr. Der Besitzer, mein Nachfolger, hat mit der Praxistätigkeit, die er nach dem Muster seines Vaters als Chirurg im Spital und praktizierender Arzt führte, aufgehört und im Erdgeschoss die Praxisräume in eine Wohnung für die Familie seiner Tochter umgebaut. Das ist nicht alles, nach der Blütezeit mit mehreren Ärzten, praktiziert im Dorf keiner mehr.
(1) Praxishaus in Zweisimmen; Erdgeschoss Praxis, 1. Stock Wohnung, 2. Stock Ferienwohnung des Besitzers, Estrich zwei Zimmer und WC für Daniel und Haushaltshilfe. Foto von Silvia Marko.
Das schöne Spital, das ein Jahr nach Anfang meiner Praxistätigkeit eröffnet und mehrmals um- und ausgebaut wurde, wollten sie noch vor ein paar Jahren im Wahn der Liebe zu Grossspitälern schliessen. Nach heftigen Protesten der Einwohner, wie im ganzen Land bei solchen Vorhaben üblich, überlegten sie sich eines Besseren. Die Proteste wären vermutlich ins Leere gegangen, aber die verantwortlichen Politiker, die Vorsteher der kantonalen Gesundheitsdirektionen, die es durchsetzen wollten, wurden prompt abgewählt und ihre Parteien büssten bei den nächsten Wahlen jeweils Stimmen ein. Es zeigte die Stärke der direkten Demokratie. Darauf wurde nach längeren Diskussionen in der Standes- und allgemeinen Presse ein neues Modell des peripheren Spitals entwickelt, wie es auch hier jetzt bestens funktioniert. Es besteht aus einem Kreisssaal von Hebammen geführt, mit Zimmer für Wöchnerinnen, weiter einer geriatrischen Abteilung. Die Angehörigen der alten Patienten brauchen nicht weit das Tal runter zu fahren, um sie zu besuchen. Ähnlich ist es mit der Demenzabteilung. In der Pflegeabteilung werden Patienten, wenn nötig auf die Operationen in den grösseren Spitälern vorbereitet und nachher nachbehandelt, wie auch andere Patienten, die zwar nicht zu Hause betreut, aber auch nicht in einem grösseren, besser ausgerüsteten Spital versorgt werden müssen. Im Ambulatorium werden kleinere operative Eingriffe, Wundversorgungen vom Personal des Spitals durchgeführt, anspruchsvolle Endoskopien und Ultraschalluntersuchungen jedoch von auswärtigen Spezialisten, die jeweils dafür einreisen. Sie benützen dafür Geräte, die von den Zentralspitälern aussortiert wurden.
(2) Das neue Spital Zweisimmen in den 70-er Jahren. Die Quelle des Fotos ohne Schutzwarnung um Copyright angefragt, keine Antwort erhalten.
Die Medikamente für die einzelnen Patienten bereitet ein Roboter vor. Die Spitalapotheke hat auch einen Vorrat an Notfallmedikamenten für die Bevölkerung des Tales. Ihren normalen Bedarf beziehen sie über eine Versandapotheke, was für sie und ihre Versicherer günstiger ist. Die Dorfapotheke schloss bereits vor mehreren Jahren ihre Türe. Die Patienten werden zum grossen Teil von Robotern auch gepflegt. Zuerst wagten es nur die Mutigen. Als sie Gefallen an den ruhig summenden und arbeitenden Maschinen fanden, folgten ihnen weitere. Die pflegenden Menschen sind nicht verschwunden. Sie springen ein, wenn die Roboter überfordert sind, oder jemand sie ablehnt. Die Qualität der Patientenbetreuung hat enorm zugenommen: Die Patienten werden öfters gepflegt, gewendet, schneller, ohne lange warten zu müssen, gereinigt und genährt. Das Personal hat mehr Zeit, ihren Ängsten und Sorgen zuzuhören, und da manche dafür besonders geschult wurden, können sie auch in diesem Bereich besser helfen. Wegen der guten Spracherkennungssysteme und einheitlichen elektronischen Krankengeschichten verminderten sich die ungeliebten Schreibarbeiten, und es gibt mehr Zeit für die Uraufgabe, die Pflege und Betreuung der Patienten. Dank Telemedizin braucht das Spital keine eigenen Ärzte. Als Unterricht für Studenten und junge Assistenten findet einmal pro Woche eine Visite mit einem erfahrenen Arzt, nicht selten einem Professor aus einem Zentrumsspital statt.
In einer Zeit, in der es aus verschiedenen Gründen immer weniger Allgemeinärzte gab, wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass in Gebieten, wo sie vorhanden waren, die Gesundheit besser und die Sterblichkeit tiefer war. Dann steigerte man noch die Bemühungen, um mehr Allgemeinärzte zu haben. Es half nicht. In der Not besann man sich, dass eigentlich die Funktion, die Erfüllung der Aufgaben wichtig ist und in der Zeit der künstlichen Intelligenz, diagnostischen und therapeutischen Algorithmen, Telemedizin, auch weniger gründlich und weniger lange ausgebildete Personen ohne Hochschulabschluss es tun können. Schon seit längerer Zeit übernahm doch nichtakademisches, gut und speziell ausgebildetes Personal viele ehemalige ärztliche Aufgaben wie Diätberatung, Pflege der Wunden bei Diabetikern, Betreuung der Dementen, Versorgung einfacher Wunden. Nebst der Labormedizin, spielte die Anästhesiologie eine Vorreiterrolle. Bereits vor mehr als 60 Jahren war es üblich, dass die Patienten von Pflegefachleuten narkotisiert wurden. Dieser Trend verstärkte sich unter dem Titel «Fachüberschreitende Zusammenarbeit». Die immer besseren Geräte für die bildgebenden Untersuchungen ermöglichten ihren Einsatz in der Röntgenologie und bei Endoskopien. Nach 50 Jahren seit der Eröffnung meiner allgemeinärztlichen Praxis werden die Patienten im Tal von besser und speziell ausgebildetem Spitexpersonal im Ambulatorium des Spitals betreut. Sie besuchen die Patienten selbstverständlich auch zu Hause. Der Vorteil dieser Lösung ist, dass sie meistens ortsgebunden und ortskundig sind und damit weniger ihre Stellen wechseln. Ihre Arbeit ist interessant und sehr begehrt. Das Modell mit speziell ausgebildeten Plegepersonal aber ohne Besuchen übernahmen auch grosse zentrale Spitäler, um ambulante Patienten mit kleinen Wunden und banalen Krankheiten zu triagieren und zu versorgen.
Durch diese Entwicklung sowohl im Spital- wie im ambulanten Bereich entschärfe sich in relativ kurzer Zeit der Mangel an Ärzten und Pflegepersonal. Ihre Zuwanderung aus Ländern mit einer schlechteren Belohnung wurde weitgehend aufgehalten. Diese Länder litten darunter mehr und begannen deswegen mit den beschriebenen Änderungen zuerst. Wie alle technischen Fortschritte führten sie zu einer grösseren Effizienz und kürzeren Arbeitszeiten.
Schweiz Aerztezeitg 2019;100(27/28):9545. Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH.

Lieber Herr Kollege Raether
Ihre Gleichung vom Schlafen in Rückenlage = Schnarchen geht von zwei falschen Voraussetzungen aus. Dass nicht alle Leute, die auf dem Rücken schlafen, auch schnarchen, dürfte ziemlich klar sein, aber (leider) auch nicht alle Schnarcher tun es nur in Rückenlage. Vielleicht wissen Spezialisten auf diesem Gebiet die genaue prozentuelle Verteilung. Einem echten Schnarcher ist die Lage jedenfalls egal, er tut es lageunabhängig. Haben Sie sich wirklich schon eine (durchgebohrte) Kugel (in die Rückseite Ihres Schlafanzuges) gegeben? Ich würde es nie tun, aber meine Patienten, denen ich einen Tennisball empfohlen habe, befolgten es nicht einmal eine ganze Nacht. Wissenschaftlich gesagt: Ihre Compliance war miserabel.
Den Schnarcher stört sein Schnarchen meistens nicht, ausser wenn er wegen seines eigenen Schnarchens nicht einschlafen kann. Dann ist die Mittagsruhe eher vorbei, als er in einen tiefen, gesunden Schlaf fallen kann. Wenn er nicht das Glück (und Vermögen) hat, in einem separaten Zimmer zu schlafen, ist er von seiner Partnerin schon genug durch Zupfen, Stossen und Schütteln gestört, als dass ihm bei jedem Umdrehen irgendeine Kugel im Rücken noch den Rest seines Schlafes rauben sollte. Ja, Schnarchen ist ein Leiden und nicht eine Leidenschaft, wie es dem Danebenschlafenden während der langen Nacht fälschlicherweise vorkommt. Dazu eine schwere und teure Last. Wissen Sie, wieviel uns die getrennten Einzelzimmer während der Ferien kosten? Dazu sind es die miesesten Zimmer ohne Meersicht. Es wurde uns schon beim Eintreffen in einem Hotel an der Reception diskret angedeutet, dass wir hier auch in einem Zimmer zusammen schlafen dürfen! Was es bedeutet und welche Konsequenzen es hat, in separaten Zimmern und vor allem separaten Betten schlafen zu müssen, brauche ich Ihnen nicht zu schildern. Die Diabetiker können ihre zusätzlichen Kosten von der Steuer abziehen und so ihre Belastungen einigermassen abgelten lassen. Ein Schnarcher sollte es auch einmal versuchen, seine Ansprüche und Anliegen gegebenenfalls bis vor das Bundesgericht durchzuziehen.
Um die Horrorgeschichten über Schnarchen und Gesundheitsschäden kümmere ich mich keinen Deut. Sie lassen mich kühl, da meine Mutter, deren Schnarch-Schallpegel und die Breite der Palette an Schnarchgeräuschen ich (noch) nicht erreichte, wurde trotz ihrer koronaren Herzkrankheit, Herzrhythmusstörungen und Synkopen in ziemlicher geistiger Frische neunzig Jahre alt. Ich weiss, Sie wollen in Abwandlung der Märchen sagen, wenn sie nicht geschnarcht hätte, würde sie heute noch glücklich leben ... Sie starb jedoch an Krebs.
Med.Tribune 1996

(1) Meine gegenwärtige Ausrüstung für einen guten, gesunden, tiefen Schlaf: Eine Kieferbinde und eine Augenbinde.


(1) Vor der Abmagerungskur
"Du wirst, wie auch ich, nie dick werden", pflegte mein Vater zu sagen. Ausser eines Onkels mütterlicherseits war in der Familie niemand übergewichtig. Dreissigjährig sprang ich mit nicht ganz siebzig Kilo bei hunderteinundachtzig Zentimetern (d.h. mit damals noch nicht gebräuchlichem BMI knapp oberhalb der Normgewichtsgrenze) über den Eisernen Vorhang. Auf der anderen Seite gelandet, stillte ich während der nächsten fünf Jahre meine Neugier und mein Bedürfnis nach all den guten bisher nicht gekannten Speisen oder solchen, die man sich finanziell nicht erlauben konnte, wie verschiedene Käse- und Fleischsorten, Schokolade, Bananen und brachte bald achtzig Kilo auf die Waage. Dann warfen mich Salmonellen, die sich in einem Rest eines Hühnchens im Kühlschrank während einer Woche genügend vermehrten, auf mein ursprüngliches Gewicht zurück. Es war der letzte Tropfen, der mein Junggesellendasein zum Überlaufen brachte. Während den Ferienreisen lernten wir neue Speisen kennen, gern haben (meistens ich) und zuzubereiten (nur meine Frau). So begann ich nach dem Englandbesuch den Tag nicht selten mit Speck und Eiern. Wenn man schon im täglichen Leben stark belastet ist, sollte es an gutem Essen nicht fehlen. Ich bekam so oft wie möglich meine Lieblingsgerichte aufgetischt, und nach jedem Mittagessen durfte Dessert nicht fehlen. Zur Entspannung klang der Abend mit einem Glas Bier oder Wein aus. In den Restaurants suchten wir möglichst erlesene Speisen aus. Meine Hemden, Jacken, Hosen wurden dauernd etwas enger. Klar, mit dem Alter richten sich die Rippen auf, und der Brustkorb verbreitert sich dadurch. Meine Frau machte mich ab und zu darauf aufmerksam, dass mir das Fett über den Gurt zu quellen beginne. Eben, auch die Haut wird weniger elastisch und bildet leichter Wülste. Als ich ihn auf dem Rücken liegend betrachtete, war der Bauch aber doch flach auf der Ebene des Brustbeines. Ich dachte, es sei nur Sache des Standpunktes und beruhigte sie oder mich mit den Worten meines Vaters, die ich anfangs erwähnte.
Es war immer mühsamer in der Zeitnot schnell zu den Zügen zu laufen und etliche Male fuhr mir das Tram vor der Nase weg. Nach dem Restaurantbesuch während der Ferien kletterte ich in unsere Wohnung mit schwerem Atem und nötigen Pausen den Berg hinauf und wünschte, die Lage wäre umgekehrt, ich könnte zuerst mit leerem Magen hinauf ins Restaurant laufen und dann mit vollem, rundem Leib leichter runter in die Wohnung kugeln. Offensichtlich meldete sich bei mir schon die Altersherzschwäche. Als ich den neuen Handgelenk-Blutdruckmesser für die Praxis kaufte, probierte ich geschwind stehend, ob er funktionierte. Unmöglich, ich, der immer einen normalen Blutdruck hatte, sollte plötzlich 105 diastolisch haben?! Ich setzte mich zum Tisch und mass den Blutdruck mit dem üblichen Gerät nochmals - er war normal. Ich muss diesen neuen Mist zurückschicken! Ich besann mich, doch den Blutdruck nochmals mit dem neuen Gerät zu messen - der Wert war sitzend normal. Sicherheitshalber wiederholte ich die Messung stehend mit dem alten Gerät. Ergebnis: 105 diastolisch. Es war klar - ich litt unter Hyperkinesie. In der Tat, ab und zu eine kleine Dosis eines Betablockers besserte den Blutdruck für eine gute Weile.
Während der nächsten Weihnachtsskiferien in den österreichischen Bergen genoss ich wieder einmal alle aus der Kindheit bekannten Mehlspeisen und andere Spezialitäten. Wie allgemein bekannt, ist die österreichische Küche nur eine Mischung aus ungarischen und tschechischen Speisen auf solider slowakischer Grundlage. Als Kind habe ich all diese Köstlichkeiten selten bekommen, jetzt mehrmals täglich. Als ich die Skistiefel schliessen musste, konnte ich mich, nicht wegen Rückenschmerzen, kaum biegen, und mein Freund musste immer wieder warten, bis ich ihm am Hang folgen konnte. Nach Hause zurückgekehrt wog ich zweiundneunzig Kilo. Jetzt reichte es mir, es musste etwas geschehen!
Wegen ihrer Kopf- und Knieschmerzen sowie Knoten in der Brust berührte meine Frau schon seit Jahren keine Süssigkeiten, keinen Kaffee, Alkohol und Fleisch mehr. Letzteres auch aus Liebe zu den Tieren und dem Wunsch, selbst etwas gegen die Zerstörung der Umwelt zu tun. Anfangs wies ich sie auf diesen "grün-komplementären" Weg, aber inzwischen suchte sie erfolgreich neue Pfade, und so begann sie im Kampf gegen ihre Allergien sogar zu rotieren, d.h. sie ass nur einfache, klar und übersichtlich zusammengestellte Speisen und kein Lebensmittel öfters als in einem Abstand von vier Tagen. Entgegen der üblichen Meinung auch mancher Allergieexperten wird die Ernährung durch diese strenge Regel nicht ärmer, sondern vielfältiger. Stellen Sie sich vor, man kann Brot nur jeden fünften Tag essen - notgedrungen muss man für jeden der restlichen drei Tage einen anderen Ersatz finden. Ein Stück weit begleitete ich sie bereits dabei. Zu ihren ständig wechselnden Salaten, Gemüsen und Beilagen bekam ich aber weiterhin meine Sossen und mein Fleisch, zu den Zwischenmahlzeiten die mit Fleisch oder Käse belegten Brötchen oder einen Kuchen und trank weiterhin mein geliebtes Bier oder ein Glas Wein. Die beschränkte "Mitrotation" merkte ich somit kaum.
Jetzt war aber Schluss damit! Ich begann konsequent und vegetarisch mitzurotieren. Ich ass regelmässig, fünf- bis sechsmal pro Tag, damit sich der Hunger nie meldete, da er ähnlich dem Alkohol den Willen bricht und den Weg zum Ziel erschwert. Als Zwischenmahlzeiten nahm ich Obst, rohes Gemüse (Kohlraben, Karotten, Radieschen, Blumenkohl - schmeckt vorzüglich, und ich bekam dadurch weder grosse Ohren noch Hasenzüge) oder verschiedene Getreidewaffeln und -fladen. Reiswaffeln kann man fertig kaufen, und die anderen, aus Mais, Buchweizen, Hirse und Kartoffeln buk meine Frau je nach Rotationsschema. Ich ass auch nur so viel, wie es nötig war, den Hunger vom Leibe zu halten und nicht wieviel ich mochte. Damit gewöhnte ich mich leichter an die neuen einfachen, "reinen" Speisen und begann wieder ihren guten Geschmack zu schätzen. Eigentlich alle die Beilagen, Sossen, Majonäsen und raffinierten Gewürzmischungen verdarben ihn nur. Anfangs, um Entzugserscheinungen zu vermeiden, schnitt ich mir ab und zu, am Tag des Schweines doch drei "Schnifeli" der geliebten Wurst, welche ich aus Italien mitbrachte. Ich hielt es vielleicht auch deswegen aus, da ich aus den Kriegszeiten gewohnt war, mich einzuschränken. Damals als Kind genoss ich eine Tafel Schokolade, die ich weiss Gott wie erhalten hatte, monatelang in kleinen Brocken. Jetzt trieb mich aber nicht die äussere Not, nein, aus freien Stücken hatte ich mich dazu entschlossen wegen des hehren und nützlichen Ziels, wegen der Gewichtsabnahme! In der Tat, ich schmolz langsam. Nach einem Monat war ich bereits um drei Kilo leichter. Bei Einladungen und anderen Anlässen ass ich noch, was angeboten wurde. Als ich jeweils am nächsten Tag auch wegen der (zu) gut gesalzenen Speisen und der zurückgehaltenen Flüssigkeit um ein, zwei Kilo schwerer wurde, die ich erst während Tagen wieder mühsam verlor, bereute ich die Schwäche und Nachgiebigkeit und wurde pickelhart und wählerisch - ich nahm nur die kalorienarmen Speisen und keinen Tropfen Alkohol dazu. Merkwürdig, meiner Laune machte es keinen Abbruch und auch "trocken" fühlte ich mich mit den Alkoholtrinkenden gleich wohl. Langsam gewöhnten sich die Freunde an unsere "Ernährungsfaxen" und fragten zuerst, was wir am Tag der Einladung der Rotation nach essen dürfen. Mit der Vorbereitung der einfachen Speisen hatten die Gastgeber keine Mühe, und manche begannen, sich ähnlich zu ernähren. In Restaurants bestellte ich meistens nur Salat mit Öl als Vorspeise und als Hauptspeise die Beilage mit Gemüse, ohne Fleisch und Sosse. Auch wenn es umgekehrt ist, meint man aus unerklärlichen Gründen, dass die Vegetarier nicht viel zu essen brauchen, und ihre Portionen sind meistens kleiner als die der Fleischesser. Um satt zu werden, bestellte ich nicht selten die Beilage nochmals als Dessert, manchmal ohne Skrupel sogar doppelt. Ich gab für das Entgegenkommen und um den Umsatzverlust auszugleichen (es wurde mir meistens weniger verrechnet als für das Menu mit Fleisch) etwas mehr Trinkgeld, und so wurde ich trotz meiner Sonderwünsche ein willkommener Gast. Während einer mehrwöchigen Vertretung in Basel wusste der Kellner schon bei meinem Eintritt ins Restaurant, was er mir an welchem Tag servieren soll.
Mit den verlorenen Kilos fühlte ich mich immer wohler. Ich kann mich beherrschen, das Ziel verfolgen, mein Geist kann die niedrigen Gelüste des Körpers besiegen, kurzum, ich bin ein starker, erfolgreicher Mensch. Ich fühlte mich wie ein Hobbygärtner - was immer ihm auch beruflich und persönlich zustösst, die Pflanzen, welche er gesetzt hat, gedeihen und er sieht, schmeckt und geniesst die Früchte seiner Bemühung (ausser, wenn ihm Hagel alles zerstört!). Bei verschiedenen Gelegenheiten beobachtete ich mit gewisser Erhabenheit die eher rundlichen Gestalten neben mir, die plan- und hemmungslos dick belegte Brote, schuhsohlengrosse Steaks, fantasievolle Desserts in sich stopften, genüsslich mampften und alles mit Wein runterspülten und so ihre Gesundheit langsam aber sicher, ob bewusst oder unbewusst ruinierten, während ich zum fast heiligen Zweck an meinem Glas reinen Mineralwassers nippte.
(2) Nach der Abmagerungskur
Nach einem Jahr verschwanden die Fettwülste, der Bauch war auch stehend auf dem Niveau des Brustbeines, liegend machte er sogar eine Delle, ich bekam wieder Taille, lief den "Stutz" aus dem Restaurant in die Ferienwohnung trotz vollem Magen wie ein Reh hinauf und der Freund musste beim Skifahren achten, dass ich die Piste nicht als erster runtersauste. Die lästigen Erkältungsviren, die mir jahrelang während des Winters fast ununterbrochen das Leben erschwerten, machten plötzlich einen weiten Bogen um mich, der Blutdruck war auch ohne Betablocker immer im Normbereich, meine Gicht hatte ich mit einem Bruchteil der bisherigen Medikamentendosis unter Kontrolle, beim Belastungstest erreichte ich überdurchschnittliche Werte und auf der Waage fünfundsiebzig Kilo. Ich durfte zufrieden sein, oder? Das reichte mir aber nicht, ich wollte das Gewicht meiner Jugend haben, wie die von mir bewunderten Tenniscracks aussehen.
Jetzt begann ich mich zu plagen. Ich ass nur noch kalorienärmere, vorwiegend aus zellulose- und anderen Fasern bestehende Speisen, also fast nur Gemüse und Obst und schwamm ein, zwei Kilometer pro Tag, manchmal bei siebzehn Grad Wassertemperatur, aber ausser eines unerträglichen Hungers erreichte ich nicht viel. Wenn ich mich schon einmal den dreiundsiebzig Kilo näherte, brachte mich ein unvermeidlicher Ausrutscher, den ich früher in drei bis vier Tagen korrigierte, wieder auf die fünfundsiebzig Kilo, die ich wochenlang nicht wegbringen konnte. Ich sah zwar immer noch nicht wie ein Hase aus, aber offensichtlich begann ich allmählich wie ein Ochse sogar die Zellulose zu verwerten. Schweren Herzens begrub ich den Traum und steckte den Misserfolg ein. Bekanntlich hat auch das Anti-Aging Grenzen. Jetzt rotiere ich gelassen schon mehrere Jahre zwischen fünf- und sechsundsiebzig Kilo. Zwei-dreimal pro Woche esse ich wieder Fleisch, weiterhin ohne Sossen. Ab und zu, bei Einladungen und Festen schlage ich mit besonderem Genuss über die Stränge. Ich habe den Eindruck, ich ernähre mich wie ich es in der Kindheit gewohnt war, fast wie unsere Vorahnen, die auch gerne ab und zu festeten.
Schweiz Ärzteztg 2006;87:2100-1. Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH.


(1) Vater getrübt - vor der Therapie
Die ganze Familie begab sich in die Klinik, um den Eintritt festzulegen. Die Kinder blieben unten im Hof und vertrieben sich mit Spielen die Zeit, während wir die Treppen hinaufstiegen. Oben angelangt, empfing uns ein Oberarzt. Wir schilderten ihm kurz die unerträgliche Situation, dann liess er sich von Vater seine Lebensgeschichte, seine Erlebnisse, Erfahrungen und Ansichten erzählen. Sein Zustand und seine Krankengeschichte schienen ihn kaum zu interessieren. Wie sollte er dann wissen, was ihm fehlte? Das lange Gespräch wurde immer aufregender, witziger und Vater immer gelassener. Am Ende sagte der Psychiater, es sei sehr interessant gewesen, mit Vater zu sprechen, und er bewundere seine geistigen Fähigkeiten. Vater stelle für ihn ein schönes Beispiel für die Möglichkeit dar, sich auch im Alter noch eines ausserordentlich guten Zustandes zu erfreuen. Abschliessend meinte er, ein Mensch in so einer Verfassung gehöre nicht in eine Klinik.

(2) Vater heiter - nach der Therapie
Vater war plötzlich wie ausgewechselt und schien fröhlich und zufrieden zu sein. Wir hingegen fühlten uns blossgestellt und dachten uns: Mal sehen, wie lange dieses Wunder anhält, wenn wir wieder zu Hause sind. Überrascht und erleichtert stellten wir dann jedoch fest, dass Vaters Verwandlung über längere Zeit anhielt, vielleicht auch, weil wir mit ihm seither etwas anders umgingen. …
PrimaryCare 2005;5:651. Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH.
Hautärzte

Diese Geschichte spielte sich anfangs der siebziger Jahre ab. Ich bekam davon einen Wartezimmerkomplex, und mit neurotischem Eifer bemühte ich mich, meistens mit Erfolg, solche Foltern in meiner Praxis zu vermeiden. Ich wollte die Übersicht behalten und holte jeden Patienten selber aus dem Wartezimmer, um bei Bedarf eingreifen zu können. Ferner versuchte ich, bei den Arztgehilfinnen alle üblichen Fehler beim Einschreiben der Patienten auszumerzen. Obwohl ich über zwei Sprechzimmer verfüge, benutzte ich meistens nur eines.
Ein Jahrzehnt später litt ich wieder an einem Hautproblem. Diesmal suchte ich einen Dermatologen auf, der in einer anderen Gegend praktizierte. Die Arztgehilfin kannte mich von den häufigen Überweisungen und verriet mir bei der Anmeldung freundlicherweise einen Tipp: Falls ich nicht lange warten wolle, solle ich überhaupt nicht ins Wartezimmer gehen, sondern im Gang auf einer Bank bei der Wand warten. Nach dem Eintritt warf ich einen flüchtigen Blick in das überquellende Wartezimmer und mit schlechtem Gewissen blieb ich im Gang auf der Bank sitzen. Nach mir kamen noch mehrere Leute, die ahnungslos direkt das Wartezimmer betraten und es weiter füllten. Schliesslich kam ein Mann, der neben mir auf der Bank Platz nahm. Nach einer Weile, als eine Hand voll Patienten die Praxis verliessen, wurde mein Nachbar, offenbar noch prominenter als ich, ins Sprechzimmer gerufen. Nach den nächsten drei, vier Patienten wurde ich geholt und fand mich diesmal in einem echten Sprechzimmer. Die Wartezeit verkürzten mir zwei Wellensittiche, die vielleicht auch als natürliche Teststoffe für die vielen Allergiepatienten der Praxis dienten. Der Kollege kam nach nur etwa zwanzig Minuten, und ich wurde ruhig und gut beraten.
Zwei Jahrzehnte später musste ich wieder zu einem Dermatologen, und wieder war der Ort ein anderer. Da ich für das Parkieren länger brauchte als eingeplant und drei Minuten zu spät in der Praxis erschien, erwartete mich der Kollege bereits im Sprechzimmer. Ich entschuldigte mich, wurde aber trotz meiner Verspätung mit viel Geduld und Kompetenz behandelt.
Als ich diese Geschichten einer Bekannten aus Amerika erzählte, meinte sie, bei ihnen müsse man, um die psychischen Schäden nach einer Konsultation beim Dermatologen gering zu halten, immer unverzüglich einen Psychiater aufsuchen. Es ist jedoch bekannt, dass die Amerikaner wegen jeder Kleinigkeit zum Psychiater oder zum Rechtsanwalt rennen. Da sind wir in Europa eben doch noch härter im Nehmen.
Wo sind nur die schönen alten Zeiten hin, als ein Besuch beim Arzt noch ein interessantes, spannendes, lehrreiches und unvergessliches Erlebnis, ja gelegentlich sogar eine gute Gedächtnisübung war? Wie fade und langweilig wird es in den künftigen glatten, von Betriebsberatern gleichgeschalteten Gemeinschaftspraxen, sogenannten Zentren, zugehen, in denen man mittels E-Mail oder SMS einen Termin bekommt, durch Computer ausgefragt und von Robotern abgefertigt wird, ohne einem Menschen begegnen zu müssen. Als ich einmal mit meiner Mutter Benzin tankte und am Automaten bezahlte, fragte sie, eine Geschäftsfrau von altem Schrot und Korn: «Hat dich denn niemand begrüsst, niemand die Scheibe geputzt, niemand das Geld kassiert, und hast du denn mit niemandem gesprochen?» «Nein, wozu auch?», erwiderte ich konsterniert. «Schrecklich, schrecklich. Die Welt geht zugrunde», sagte sie.
Tja, wie man sieht, manchen Menschen kann man es wirklich nie recht machen. Es wäre wohl besser, ich müsste nicht mehr zum Arzt gehen. Leider ein frommer Wunsch, vermutlich beiderseits …
Kniespiegelung oder die Grenzen der Aufklärung

Schon am nächsten Tag nach der Arthroskopie konnte ich wieder die Praxis machen, aber bei Belastung tat es auch nach zwei Monaten noch weh. Nach einem halben Jahr, das Knie war weitgehend schmerzfrei, versuchte ich wieder Tennis zu spielen. Nach zehn Minuten hielt ich es nicht aus, das Knie schmerzte für eine Weile wie vor der Operation. Ans Tennis war noch nicht zu denken. Bald störte es mich aber nicht mehr, da ich eine zervikale Diskushernie bekam, wegen der ich beim Servieren nicht auf den Ball hinaufschauen konnte. Damit war Tennis für mich zweifellos für immer erledigt. Anderthalb Jahre nach der Arthroskopie war das Knie tipptopp, ich konnte mit dem Velo auch bergauf fahren, und so ist es geblieben.
Ein Problem blieb, die Videoaufnahme der Arthroskopie, die mir der Orthopäde präoperativ vorschlug. Ich weiss nicht, wollte er mich seine Künste bewundern lassen oder mich fortbilden, jedenfalls schämte ich mich zuzugeben, dass wir kein Videogerät haben. Vor der Operation übergab ich verabredungsgemäss eine Videokassette, die wir von einer Freundin der Tochter geliehen bekamen. Nach dem Aufwachen aus der Narkose fand ich sie wieder neben mir. Aus unklaren Gründen suchte ich keine Gelegenheit sie anzuschauen. Nach Jahren schickte ein Vetter vier Kassetten mit Aufnahmen eines Familientreffens. Sie waren nicht gezeichnet. Ohne es zu merken, legte ich sie zu der friedlich ruhenden mit der Arthroskopie. Als ich die mit dem Familientreffen zum Überspielen geben wollte, musste ich erst alle beim Göttikind anschauen. Schon die zweite Kassette zeigte die Arthroskopie. Ich sah wie immer wieder gestochen, gebohrt, geschliffen, geschnitten wurde. Inzwischen erschien ein Drachen, der nach den abgebrochenen weissen Riesenstücken schnappte, an diesen zerrte und sie wegtrug. Sogar Explosionen fanden statt, die die Sicht für eine Weile verschleierten. Die Höhle, in der sich das alles abspielte, war mein eigenes Knie, die verschlungenen Stücke waren Teile meines Leibes! Es wurde mir fast schlecht. Vielleicht hätte die Geschichte mit meinem Knie kein Happyend gehabt, hätte ich diesen Gruselfilm bald nach der Aufnahme angeschaut. Am nächsten Tag gab ich endlich die Kassette, selbstverständlich ohne sie zu überspielen, der Besitzerin zurück.
PrimaryCare 2005;5:279. Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH.
Blutspende

Ich wollte ihn fragen, aber irgendwie kam es nicht aus meinem Mund, wie oft er eigentlich spende.
Urologen

Augenschau

Operation gelungen - Patient unzufrieden

Psychotherapie

Als ich über sechzig war, begann der nächste weh zu tun. Ich befürchtete wieder eine ähnliche Tortur und war überrascht, als der erfahrene Zahnarzt meinte, er könne ihn auch ohne eine schmerzbetäubende Spritze ziehen. In der Tat: Er drehte nur kurz an ihm, und schon war er draussen. Dies erinnerte mich an die Leichtigkeit, mit der ich die Milchzähne verloren hatte. Doch statt erleichtert zu sein, dass ich es jetzt so einfach und problemlos überstanden hatte, begann ich schwermütig zu werden und zu grübeln, besonders als der Zahnarzt den Zahn vor meine Augen hielt und sagte, ich solle ihn mir gut ansehen: Der Zahn sei gesund, ohne Loch. Ich wollte wissen, warum er dennoch solche Schmerzen verursacht habe und warum es trotzdem nötig gewesen sei, ihn zu ziehen. Es sei ein Zahnfleischproblem, Parodontose, sagte der Zahnarzt. Diesmal bekam ich zwar keinen Schüttelfrost, ich fühlte mich aber noch elender als vor dreissig Jahren.
Ich meldete mich bald wieder in der Zahnarztpraxis. Die Zahnarztgehilfin war überrascht, als ich mich weigerte, auf dem Behandlungsstuhl Platz zu nehmen. Der Zahnarzt kam und man merkte, dass er etwas angespannt war. Ich las in seinem Gesicht die Frage, weshalb ich schon wieder da sei und was wohl schief gegangen war. Seine Verzweiflung wuchs noch, als ich ihm eröffnete, ich käme wegen einer Psychotherapie. Er möge doch so gut sein und mir erklären, wie es weiter gehen solle, und ob mir nun bald der Reihe nach alle Zähne einfach ausfallen würden. Der Zahnarzt versuchte mich zu beruhigen und meinte, wegen der besonderen Lage der Weisheitszähne bilde sich das Zahnfleisch dort hinten stärker und schneller zurück, aber sicherheitshalber überweise er mich trotzdem an einen Spezialisten für Zahnfleischprobleme, der in Amerika speziell dafür ausgebildet worden sei und ganz in der Nähe vor kurzem seine Praxis eröffnet habe. Offensichtlich hatte auch ihn eine gewisse Angst ergriffen. Die Psychiater nennen dieses Phänomen Übertragung. Die Parodontose wurde gestoppt, die restlichen Zähne sind noch drin - ich hoffe, noch für lange Zeit.
PrimaryCare 2005;5:703. Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH.

Es schien mir keine üble Art, einen Arzt zu ehren, indem man sein Praxisschild am Haus liess. Ansonsten war ich von Dr. Künzli und seinem Haus nicht sehr beeindruckt, da ich von Kollege Furlenmeier in die Homöopathie eingeweiht worden war, der ähnliche fachliche und menschliche Qualitäten besessen hatte. Ich bedauerte ein wenig, dass ich weder neben dem einen noch dem anderen gewohnt hatte. Denn wie die Forschung auf diesem Gebiet zeigt, verbreiten sich in sozialen Netzwerken Einstellungen und Eigenschaften, zum Beispiel Übergewicht, gewissermassen «von selbst». Nachbarn beeinflussen sich, vielleicht sogar während des Schlafes. Was Homöopathie betrifft, sind wir also zu spät nach St. Gallen umgezogen, weil solche Übertragungen vermutlich mit dem Tod aufhören, auch wenn es manche verneinen. Hätte ich die Scharen der Patienten gesehen, die in die Praxis von Dr. Künzli geströmt waren.

(1) Künzli-Freud Liege
Nach nicht zu langer Zeit hatte ich genug von Praxisvertretungen und beschloss, wieder eine, was Tätigkeitsspektrum und Zeitaufwand betrifft, beschränkte Alterspraxis zu führen. Was war naheliegender, als dies in der ehemaligen Praxis von Dr. Künzli zu tun? Nach mehreren vergeblichen Anrufen gelang es mir eines Abends, die Tochter von Dr. Künzli zu erreichen. Ich erklärte ihr, was ich im Sinn hatte, und durfte die Räume anschauen, was mich schon sehr zuversichtlich stimmte. Ich war begeistert, als ich genau das sah, was ich mir vorgestellt und gewünscht hatte: Ein grosses Zimmer mit einem Lavabo und einem separaten WC. Am besten gefiel mir eine Liege aus dunkelbraunem Holz, bedeckt mit einem gemusterten feinen Teppich. Sie war fast gleich wie die Liege, die Freud in seiner Praxis hatte, die man an der Bergstrasse 19 in Wien besichtigen kann. Die Tochter hatte nichts gegen mein Ansinnen. Sie räumte aber ein, die Mutter, die nicht mehr im Hause lebte, müsse es noch bewilligen. Ich stellte mir schon vor, wie ich die Patienten auf der Liege untersuchen und behandeln werde, und so war ich sehr enttäuscht und betrübt, als ich nach ein paar Tagen einen negativen Bescheid bekam. Ich fragte, ob ich mindestens die Liege kaufen könne. Die Mutter schlug mir auch diesen Wunsch ab. Die Liege stamme noch vom Urgrossvater und sei ein Erinnerungsstück an die drei Generationen der Künzli-Ärzte. Das Haus, das ich jeden Tag sah, verkörperte für mich seither eine ziemlich hohe Zahl unerfüllter Wünsche, die sich in meinem Leben angesammelt hatten. Schweren Herzens fand ich andere Räume und eine gebrauchte, schlichte, nichtssagende, übliche Metalliege dazu.
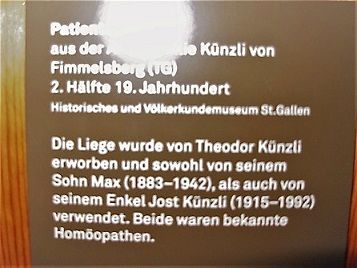
(2) Tafel bei der Ausstellung
Es vergingen ein paar Jahre. Eines Abends rief mich Frau Künzli Junior an und fragte, ob ich die Liege noch immer haben wolle. Selbstverständlich, antwortete ich sofort. Wie viel sie denn dafür haben möchte? Nichts, sie seien froh, wenn ich sie nähme, da sie das Haus renovieren würden, und die Liege ihnen nur im Wege stehe. Die Liege war nicht nur massiv (der Hauptgrund, warum sie die mehr als hundert Jahre in gutem Zustand überlebt hatte), sondern auch schwer. Die Schubladen waren voller Instrumente und jahrzehntealter Medikamente. Man sah, dass der letzte Dr. Künzli kein strenger Homöopath gewesen war, sondern ein Arzt, der, wenn nötig, auch allopathische Mittel einsetzte. Mit Mühe und trotz der kalten Jahreszeit in Schweiss gebadet, verfrachteten meine Frau und ich wieder die Liege und separat die vollen Schubladen auf einen gemieteten Lastwagen und nachher von dort mit Hilfe eines Nachbarn in unsere Praxis. Sie roch etwas nach dem lange ungebrauchten Raum, in dem sie wie Dornröschen geweilt hatte, bis wir sie befreiten.
In dem gutfrequentierten Raum und mit den geöffneten leeren Schubladen verlor die Liege den Geruch, und so konnten wir sie bei Bedarf auch für Patienten benützen. Manche merkten nichts, manche fragten, wo wir dieses Museumsstück, überzogen mit dem bereits hundert Jahre alten, dunkelgrünen Leder, aufgestöbert hätten. Gerne erzählten wir, dass sie noch von Grossvater Künzli stamme, der nicht weit im Kanton Appenzell Ausserrhoden in der Zeit um die vorletzte Jahrhundertwende eine Praxis geführt und hoch zu Ross die Patienten besucht hätte. Dank den Fortschritten der Medizin begannen die Ärzte damals Patienten vermehrt in Praxisräumen zu behandeln und brauchten neu neben einem Wartezimmer auch eine Liege im Behandlungsraum. Die interessante Geschichte der drei Generationen der Künzli Ärzte wurde uns von der Mutter über die Tochter weiter geliefert. So trug die Liege auch zum Familienbewusstsein unserer Nachbarn bei. Wir hatten Freude an diesem schönen Möbelstück. Nicht selten machte ich während der Mittagspause auf der Liege ein erquickliches Schläfchen, und wenn ich auf die Patienten wartete, streckte ich meine Glieder darauf aus. Ich hoffte, mindestens in dieser Beziehung Freud und den Künzlis ähnlich zu sein.
Dann war endgültig Schluss mit der Praxistätigkeit. Was sollte mit der Liege, diesem Prachtstück, geschehen? Zuerst bot ich sie den Kollegen aus dem Qualitätszirkel an. Alle waren mit Liegen versorgt, niemand wollte mein Juwel – sicher nur, weil sie es nicht kannten. Dann schrieb ich das Medizinhistorische Museum in Zürich an. Es zeigte auch kein Interesse, vermutlich aus demselben Grund, da ich ein Bild der Liege beizulegen versäumt hatte. Ich erhielt aus Zürich aber den Hinweis, das Historische Museum in St. Gallen würde sich vielleicht für die Liege interessieren. Dieser Tipp war ein Volltreffer. In St. Gallen war nämlich just eine Ausstellung über die Geschichte der Medizin in dieser alten, geschichtsträchtigen Stadt in Vorbereitung. Sicherheitshalber kam zuerst die Kuratorin bei uns vorbei, um die Liege in Augenschein zu nehmen. Sie meinte sofort, das Stück sehe aus wie die Freud-Liege, auch wenn sie jetzt, ohne den alten Teppich, irgendwie nackt dastand. Kurz danach kam sie mit einer Hilfe und einem grösseren Wagen, um die Liege abzuholen.
Eigentlich hätte ich keinen besseren Zeitpunkt wählen können, um meine Praxistätigkeit zu beenden. Die Liege ist neben anderen sehenswerten Exponaten im Rahmen der Ausstellung «Zeit für die Medizin! Einblicke in die St. Galler Medizingeschichte» noch bis 20. Mai 2012 im Historischen und Völkerkundemuseum St. Gallen zu bewundern.
Schweiz Ärztezt. 2011;92:1890-1. Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH.

16.3.20:
Von zwei Seiten bekam ich die Aufforderung über "die Zeit des Coronavirus zu schreiben. Unser Herr Bohli hat uns dazu herausgefordert und ein Mitglied de "Bundesverbandes der deutschsprachigen Ärzteschriffsteller" schlug vor, die Zeit in der zweiten Hälfte von Mai, wenn unser, wegen eben dieses Viruses abgesagte Kongress in Sztrahlsund stattfinden sollte zu nützen und über den Virus zu schreiben. Ich denke, es ist besser, lebendiger gleich während seines Wütens es in Form eines Tagebuches, jetzt auch "Blog" genannt, tun.
17.3.20:
Mit Leidenschaft schreibe ich Leserbriefe, weil ich vielleicht falsch hoffe, dass ich so den Verlauf der Dinge etwas beeinlussen kann, was mir im Kleinen manchmal auch gelingt. Das verstärkt diesen meinen Trieb. Und so konnte es nicht anders sein, ich schrieb mehrere Leserbriefe zu Coronavirus:
Wozu ist ein «unheimlicher» Virus gut (geschickt am die "Neu Zürcher Zeitung" (NZZ) am
Wie auch der «unheimliche» Virus gefährlich sein möge, die Angst vor ihm bringt Tatsachen und Probleme zu Tage, die niemandem, weder Politikern, noch Fachleuten bewusst wurden: Viel sprach man über die Gefahr der Abhängigkeit von einer Macht im Bereich der Telekommunikation, aber unbemerkt und ungeachtet sind wir in einem wichtigeren Bereich abhängig geworden – der Medikamentenproduktion. Dadurch sind wir auch politisch erpressbar. Die Abhilfe ist eine dezentrale Produktion an mehreren Standorten. Sie bringt u.a. den Vorteil der kürzeren Transportwege, damit der Schonung der Umwelt.
Der Virus bringt mit sich, dass wir etliche bereits vorhandene technische Möglichkeiten schätzen und vermehrt benützen werden, die wir aus Trägheit nur beschränkt einsetzten – die Roboter in Spitälern und Pflegeheimen, den Einsatz von Fernunterricht in den Schulen, sowie die Heimarbeit. Der Lebensstil wird sich noch beschleunigt ändern. Es ist eine grosse Herausforderung für die Gesellschaft, wie sie damit umgehen wird. Die Bedeutung der menschlichen Beziehungen, des direkten persönlichen Kontakts wird steigen.
*
Da die "NZZ" es nicht veröffentlichte blieb für die "Schweizerische Ärztezeitung (SÄZ) die Kurzfassung, die am 12.3.20 veröffentlicht wurde:
Die positiven Nebenwirkungen des Coronavirus
Der Coronavirus öffnete uns die Augen für die Gefahr der Produktion von Medikamentenrohstoffen an wenigen Standorten. Ausser Engpässen bei der Versorgung sind wir u.U. auch politisch erpressbar. Im Bereich der Medizin wird er auch andere positive Nebenwirkungen haben. Z.B. es wird den Einsatz der vorhandenen technischen Möglichkeiten wie Roboter und Telemedizin in der Pflege und Betreuung von Patienten beschleunigen. Ähnlich wird sich das Leben auch in anderen Bereichen wie Schulunterricht und Heimarbeit ändern. Die Bedeutung der menschlichen Beziehungen, des direkten persönlichen Kontakts wird steigen. Wie froh werden die Bewohner von Norditalien sein, wenn sie Fussballspiele ihrer Clubs wieder in Stadien und nicht nur in Fernsehen verfolgen können.
*
ZurAbsage der Sportveranstaltungen schrieb ich am der "NZZ":
Betr.: Germann D: Ohne Publikum ist der Profisport eine Alibiübung. NZZ 6.3.2020, S. 11.
Ja, das Coronavirus brachte auch die Sportwelt in einen Ausnahmezustand, der schöpferische, neue nicht entweder-oder Massnahmen verlangt. Es gibt mehrere gute Gründe, die Sportanlässe auch ohne Zuschauer auszutragen, desto mehr, als sie in der Schweiz nicht selten vor fast leeren Zuschauerrängen stattfinden. Es gilt für Sportvereine wie für andere Betriebe, dass es vorteilhafter ist, auf die Teilzeitarbeit überzugehen, als sie vorübergehend zu schliessen. Um so eher, da sie bald wieder auf vollen Touren laufen sollen. So bleiben Teileinnahmen, die Angestellten kommen nicht aus der Übung und verlieren nicht ihre Bedeutung.
Der Vergleich mit Konzerten und Filmen stimmt nicht. Nicht nur kann man Musik auch sonst hören und Filme ohne Zuschauer anschauen, aber eine beliebte chinesische Band hat kürzlich sein Konzert im Internet veröffentlicht. Youtube lässt grüssen. Die Zusammenarbeit von Sportvereinen und lokalen Fernsehsendern kann aufblühen. Herr Bach täte gut, wenn er eine neue Form für olympische Spiele als Plan B vorbereiten würde und nicht stur beim Alten bliebe, auch wenn zu hoffen ist, dass die Infektion bis Sommer abklingt.
*
Mit dem Vorgehen des "Bundesamtes für Gesundheitswesen" (BAG) war ich ebenfalls nicht zufrieden und am 7.3.20 schrieb ich, ohne je eine Antwort zu bekommen;
"Guten Tag,
zu der Einstellung und Infromation von BAG betr. Coronavirus in den letzten Tagen möchte ich
Folgendes bemerken:
-
Die «hotmail « des Medgates wurde abgeschafft. Kaum war es wegen Desinteresse, eher wegen Überlastung. Dann gibt es andere, weniger destruktive, diktatorische Mssnahmen: Man konnte alte, pensionierte Fachpersonen mit sortieren der Mails beeauftragen, den Schreibern erklären, dass ihre Fragen gesammelt bald beantwortet werde, u.ä.
-
Ich habe nach Gefährlichkeit des Besuches eines Hallen- und Thermalbades gefragt. Vielleicht ist es nicht nur theoretisch: In einem ml Wasser gibt es Milliarden Viren. Werden dies Coronaviren durch die hygienische Massnahmen der Bäder vernichtet? Wenn nicht, sind sie beim Schwimmen nicht gefährlich. Telefonisch bekam ich nur ausweichende Antworten, sowohl meine Bitte es weiterzuleiten wie noch gesndete e-mail brachten vorläufig weder persönliche noch allgemeine Antwort.
-
Die Behauptung, es hat wenig-keine Bedeutung Schutzmasken zu tragen ist auf wackeligen sachlichen Beinen. Sie ist auch eine negativistische Zweckbehauptung, da wir nicht genug Schutzmasken haben und für Spitäler und Heimen, vor allem aber für die Betreuung der Coronavirenkranken brauchen. Wochenlang wurden Nachrichten Tagesschau über Coronavirus mit einem Bild der maskentragenden Chinesen begonnen. Tun sie es aus Spass? Es wäre ehrlicher, positiver, schöpferischer, beruhigender und wirksamer, wenn man den Leuten empfehlen würde, wie sie Stoffmasken selbst machen können, wie sie sie reinigen, eventuell desinfizieren können.
Zu einem Meinungsaustausch gerne bereit verbleibe ich
mit besten Grüssen
Peter Marko, ehemaliger Hausarzt "
Die Schutzmasken liessen mich nicht in der Ruhe. Ich versuchte es mit einem Leserbrief in der SÄZ", dem ich auch ein instruktives Foto beilegte:
Gesichtsmaskenmangel einfach beheben
Den folgenden Vorschlag habe ich bereits BAG über die Hotline unterbreitet, ohne Reaktion. Deswegen versuche ich es auf diesem «Kanal»:
Meine Frau Silvia hat für uns je drei Gesichtsmasken aus doppelt gelegtem Baumwollstoff angefertigt, in die man noch Papier einlegen kann. Sie werden mit einem Gummiband hinter den Ohren befestigt (siehe Bild). Dreimal, weil drei Tage (72 Std.) nach dem Auswaschen auch die Spuren der Coronaviren verschwunden sein sollten. Die Infektionalität verlieren sie allem nach schon früher.
(1)
Die Redaktion lehnte leider die Veröffentlchung mit folgenden Worten; "Leider können wir beides nicht veröffentlichen, da wir als offizielles Organ der FMH keine Anleitungen, Regeln etc. in Bezug auf das Corona-Virus publizieren. Dafür ist der Bund zuständig."
*
Am Montag, den 16.3.20 erschien die "NZZ" mit einer neuen Einteilung der Teilen und Rubriken. Hauptsache war "Coronavirus". Man konnte sich nicht orientieren, mühsam und zeireibend suchen. Ich schickte der Redaktion folgenden Brief:
"Sehr geehrte Redaktion,
nicht Corona- sondern Tollwutvirus hat sie befallen. als sie die neue, absolut unübersichtige Einteilung Ihrer bisher und inhaltlich nach wie vor hochgeschätzter Zeitung begonnen haben. Oder soll es die gegenwärtig verbreitete Tollheit spiegeln. Sie verstärent sie sie damit tatsächlich."
Worauf ich folgende Antwort bekam:
"Wir befinden uns in einer ausserordentlichen Situation – die NZZ nimmt diese sehr ernst und versucht, der Leserschaft die besten Informationen, Analysen, Serviceleistungen und Einordnungen zu bieten. Das beinhaltet auch Anpassungen an der Zeitungsstruktur. Diese beschränken sich allerdings auf ausserordentliche Nachrichtenlagen – wie am Montag aufgrund der bundesrätlichen Massnahmen.
In der morgigen Ausgabe kehren wir zur gewohnten Struktur zurück, mit wenigen Ausnahmen."
Es geschah In der Tat und mindestens die "NZZ" kehrte zum Glück im normalen Zustand.
18.3.20:
Wir sind "über Berg" auf dem "Naturweg" gegangen, der teilweise so eng ist, dass man nicht im Abstand von 2m vorbeigehen kann. Man merkte nicht nur die Angst von uns, aber auch die Meinung, solche grauhaarige alte Knochen sollen zu Hause hocken, wie es der Bundesrat verordnet hat und nicht Mütter mit Kindern und andere junge, sicher gesunde Leute gefährden. Ich teilte meinen vier Cousinen per e-mail, dass Silvia die letzte Burka erwischt hat. Allen anderen telefonisch.
19.3.20:
Heute auf demselben Weg war es besser: Die Leute gingen nicht so weit von uns und grüssten - eine bessere Auslese, oder Gewohnheit?
Ein Schwager wurde in St. Gallen erfolgreich wegen engem Spinalkanal operiert, der Schwägerin, der Schwägerin, die auch in einem Privatspital aber in Zärich verschoben sie den Termin von nächster Woche auf unbestimmte Zeit - keine angenehme Lage.
Es hat mich sehr gefreut, dass in der heutigen "NZZ" kritische Leserbriefe zu den Massnahmen der Politik gegenüber Coronavirus veröffentlicht wurden. Ein Leser kritisierte die Redaktion für den "Durcheinander" der letzten Tage. "NZZ " ist wirklich eine gute Zeitung.
*
Ich möchte meine Einstellung zu Massnahmen gegen Coronavirus zusamenfassen:
Ich meine, sie sind übertrieben, unnatürlich, unnötig. Vor Paar Tagen veröffentlichze die "NZZ" einen Artikel, der mehr Hysterie im Umgang mit dem Coronarvirus verlangte.
20.3.20:
Der Autor meinte die Übertriebenhei (der unechten Gefühle), die für Hysterie charakteristisch ist. Aber sie gründet auf Unreife. Auch in der Krise, i der Gefahr brauchen wir Reife, Ruhe, Besonnenheit. Sie sind Grund für richtige Massnahmen. Ein anderer Redaktor schrieb heute "Ein Reifetest für die Gesellschaft". Eben, eine hysterische Gesellscaft kann nicht reif sein.
*
Heute war ich mit meiner Maske (s. Bild oben) erstmals in der Stadt. Es überraschte mich, dass sowohl die Leute im Bus, wie auf der Strasse taten, als ob es normal wäre. Unser Sohn Daniel machte uns aufmerksam, dass die Bilder des amerikanischen Malers Edward Hopper zur heutigen Corona-Situation passen. Ja, die Strassen sahen ähnlich aus. Auf dem Marktplatz traf ich noch eine ältere Frau mit einer Maske. Und sogar die Alkoholiker am ihrem Treffpunkt hielten mehr als zwei Meter Abstand voneinander - das ist die Schweiz!
Interessant war auch Gespräch mit unserer Freundin in der Slowakei - Eva Valovicova, Als einzige warf sie sich nicht in die selbstgewählte, sinnlose, schädliche "e-mailkontaktquarantene und braten sich in ihrer "Angstsause" meldete sich und erkundigte, wie es uns geht, worauf ich sie telefonisch anrief. Die
Slowaken gehen mit dem Poblem des Maskenmangels anders, schöpferischer um als wir Schweizer. Es gibt modebewusste Männer (und Produzenten) , die Masken aus dem gleichen Stoff wie ihre Hemden tragen. Ausserdem viele Anleitungen, wie man Masken selbst macht im Internet. Aber bei ihnen
versteigerte sich der Minister für die Gesundheit nicht zu solcher "fake" Aussage wie unser, der
verkündet:"Die Gesichtsmasken sind nicht effizient". Wieviel Infizierte und Tote gehen auf sein Konto,
werden wir nie erfahren. Jedenfalls war es ein gefährlicher Blödsinn.
21.3.20:
Ich kann die Masken nicht verlassen: Heute erschien in der JAMA, Zeitschrift der amerikanischen
Ärztegesellschaft ein Aufruf der Redaktion mitzuteilen Ideen, wie kann man ihren Mangel beheben
(Conserving Supply of Personal Protective Eqiupment - A Call for Ideas),
Und in der "NZZ" ein Artikel, i dem der Autor U. Bühler, den gefährdeten alten Menschen an Herz liegt, ihre Häuser und Wohnungen (überhaupt) nicht verlassen. Es rief folgenden Leserbrief hervor:
In seinem lesenswerten Artikel appeliert U. Bühler an uns alte Leute, unsere Häuser und Wohnungen (überhaupt) nicht verlassen. Es ist ein Beispiel für das schwarz-weiss, entweder-oder Denken, das nicht nur die Diskussionen aber leider auch die Massnahmen zum Coronavirus beherrscht. Kann mir Herr Bühler erklären, wie gefährde ich meine Mitmenschen und mich, wenn ich in einer Zeit/Gegend ausgehe, in der sich kaum jemand dort und unterwegs befindet? Sogar, wenn ich auf meinem Waldweg bei jemanden vorbeigehe, muss ich eigentlich keinen Abstand von 2 m halten, da die Coronaviren keine Zecken sind, und nicht während der 10-20 Sekunden ob vom mir oder vom meinem Gegenschreitenden überspringen.
Ob man das Seeufer in Zürich gleich sperren muss, ist auch fraglich. Gestern in der Mitte der Stadt am beliebten Treffpunkt, sah ich vormittags zwei Männer mit den Bierdosen in der Hand diskutieren. Sogar sie hielten mehr als 2 m Abstand voneinander. Wie Herr Bühler richtig schreibt, die Durchsetzung der Massnahmen braucht Geduld. nicht nur am Zürichseeufer. Verdienterweise schreibt die «NZZ» auch über die Schäden, die die Isolation hervorruft. Man sollte sie mit Massund gesundem Menschenverstand einsetzen.
Übrigens, in meiner Patientenverfügung steht, dass ich auf Lebenverlängerungsmassnahmen verzichte. Nicht anders wäre es auch bei einer schweren Coronainfektion – keine Intensivstation, kein Beatmungsgerät, aber genug Morphiumtropfen.
Mal sehen, ob ihn die Redaktion veröffentlicht.
Meine bisherige Ausführungen sind etwas "nonkonform".Gerne schreibe ich sie schon jetzt, mit Gefahr, dass sie sich als falsch erweisen werden.
22.3.20:
Gestern Abend hat uns Corinne sehr besorgt angerufen und uns deutlich an Herz gelegt, "vernünftig" und vorsichtig zu sein. Silvia soll nicht mehr einkaufen gehen. Da es auch unser kinesiologischer Muskeltest bestätigte, wird sie sich daran halten. Ihr "Vernunfthauptargument" ist, dass wir sollen helfen, die Spitäler nicht noch zu belasten, weil die Pfleger und Ärzte schon "am letzten Zahn beissen" und die normale Versorgung bedroht ist. Schon das "Staffeln", Verzögerung und damit Verminderung des Andrangs wurde wirken. Eine ihrer Nachbarinnen ist Frau vom dem Chefarzt eine Infektologieabteilung und sieht jetzt ihren Mann kaum mehr.
Ich möchte meine Einstellung zur Problematik des Coronavirus, die ich oben am 19.3. schrieb endlich erläutern. Sie scheinen hart, gefühllos, zynisch zu sein. Sie sind Ansichten eines unbeteiligten, entfernten "Marsmenschen". Dieser Blick kann uns nicht schaden. Wie es auch traurig in Einzelfällen ist, der Virus ist noch gnädig. Er schädigt Kinder und junge, gesunde Leute kaum und vom älteren eher die schon Schwerkranke. Die Zahl der Gestorbenen ist hoch, aber unvergleichbar mit denjenigen der Opfer der Kriege, sogar der Verkehrsopfer (Jedes Jahr sterben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO 1,35 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen). Unsere Massnahmen, unsere Waffen im Krieg gegen den Virus sind stumpf, ihre Wirkung unsicher, weil wir ihn, den Feind eigentlich erst jetzt beginnen kennenzulernen. Sie sind unverhältnismässig. Wegen Retten von hunderttausenden Menschen verderben wir das Leben von allen, von Milliarden. Wieviel Todesfälle es kostet, werden wir erst später realisieren. Warum tun wir es, warum sind wir es bereit? Wir möchten den Tod überlisten wie der Arzt im Märchen "Gevatter Tod". Allmählich akzeptieren wir ihn in Einzelfällen, nicht jedoch in der Gesellschaft. Die Politikerin China fürchteten die Unruhen und ihre Absetzung, diejenige in Demokratien ihre Abwahl. So sind sie bereit zu fragwürdigen, ob finanziellen oder anderen Schritten, die sie sonst meiden wie Pest. Ob sie wirksam werden, ist unsicher und belasten die weitere Generationen. Ich wundere mich, dass diese es (noch) so ruhig hinnehmen. So wie ich fürchten sie die Vorwürfe der Gefühll- und Rücksichtslosigkeit. Aber einmal erwachen sie sicher und die Weisheit der jetzigen Politiker wird, wie es üblich ist, in Frage gestellt. Wenn meine Kinder und Enkelkinder bedroht sind, ob von gefährlicher Krankheit oder sonst, wärde ich die Gefahr gerne übernehmen. Jetzt belasten wir sie bedenkenlos. Den Politikern imponiert auch der Zuwachs an Macht, den ihnen der Kampf gegen Virus mit sich bringt. So grosszügig können sie mit ihr, mit Geboten und Verboten, mit Finanzen, nicht umgehen.
Das wirksame Mittel gegen den Ausbruch von Coronavirus
Meine Schwägerin singt in einem gemischten Chor. Bei der Probe vor drei Wochen sass und stand neben ihr eine Frau, die "erkältet" war. Als sich ihr Zustand verschlechterte, wurde sie positiv auf Coronavirus getestet. Niemand aus dem Chor mit vorwiegend über 60-jährigen Menschen ist bisher erkrankt. Wie viele sind Träger (gewesen) bleibt unklar.
Es geht nicht anders, morgen kehre ich zu meinem beliebten Thema - zu den Schutzmasken.
24.3.20:
Gestern war ich sehr beschäftigt, konnte ich leider nicht hier schreiben. Silvia liess sich von Corinne überzeugen und bat eine unsere Nachbarin, die sich schon früher angeboten hatte, die Lebensmitteleinkäufe für uns zu besorgen .Sie ist eine nichtberufstätige Ärztin mit Neigung zu Alternativmethoden. Ich verdächtige sie, dass sie eine Vegtarierin ist. Sie bekommt jetzt Übersicht, wie (gesund) eir uns ernähren. Heute brachte sie sie, sogar zu Zufriedenheit heikler Silvia. Sie war mit dem Einkauf zufrieden, aber merkte, dass sie erst im Geschäft ihr einfällt, was wir brauchen. Die Nachbarin geht jedoch nur einmal pro Woche einkaufen, was für Silvias Bedarf an (frischen) Gemüse und Obst nicht reicht. So haben wir es mit Hauslieferung bei den Grossisten versucht. Beim MIGROS war es hoffnungslos, beim COOP war dei Homepage fürchterlich mühsam für jemanden, der das erste Mal per Internet einkaufen möchte. Wir mussten erst zweimal telefonieren, bis klug geworden sind. Es dauerte über jeweils 10 Minuten bis wir durchkamen. So eine schlecht funktionierende Homepage ohne Einleitung ist Schande für so ein Betrieb.
Die übertriebene, krankhafte Mischung von Ausdauer und Konsequenz nennen die Psychiater "Klebrigkeit". Nein, ich bin nicht klebrig, wenn ich wieder über die Schutzmasken schreibe. Gestern habe ich vernommen, dass die slowakische Präsidentin eine sehr gute Rede zur Nation in Fernsehen gehalten hat. Dabei hat sie die Bluse und die Schutzmaske aus demselben Stoff! In der "NZZ" war wieder ein überflüssiger Artikel darüber, ob sie Masken nützen. Dagegen im letzten "Spiegel" konnte man die klar positive Stellung eines Virologe lesen. Er meinte, jeder könnte sich so eine Maske selbst nähen, sogar aus einem bunten Stoff, was sogar "schick" sein könnte (Nr. 13, S. 105).
In einem Pflegeheim in Würzburg wurde Coronavirus eingeschleppt - die "worst case" Situation, die Katstrophe: völlige Überforderung des Personals, die Unmöglichkeit die ängstliche Demenzpatienten in Masken zu betreuen, zu pflegen. Was tun? War nicht angebracht, "palliativ" die Patienten nur grundhygienisch zu pflegen und Morphium-Tropfen zu geben? Vermutlich wurde es so getan.
Es erinnerte mich an die Kriegszeit als sowohl die Strelingers ihre Grossmutter, wie wir unseren Grossvater verlassen mussten, wenn mindestens wir wollten uns eventuell retten. Mit ihnen wären wir sicher alle umgekommen. Ein ethisches Problem? Nein, eine schwere Belastung, aber im Krieg nicht unüblich. Und jetzt sind wir im Krieg. Nicht von Menschen angezettelt, sondern von einem Virus und gegen ihm. Er führt zu übertriebenen Ansprüchen, Erwartungen und Massnahmen, wie ich am 19.3. bemerkte.
Ausserdem wäre hilfreich, wenn wir bereits Pflegeroboter hätten.
Morgen zum Thema "Wie gefährlich oder wie gnädig ist der Coronavirus".
25.3.20:
Beides. Gnädig ist er, weil er für Kinder und junge Leute nicht gefährlich ist. Kaum ein Kind ist jetzt auf seine Infektion gestorben. Es tönt zynisch, aber er tötet meistens Leute, derer Leben sich sowieso zum Ende neigt. Er macht eine "natürliche" Auswahl, Selektion. In einem Artikel in der heutigen "NZZ" weist der ehemalige Stanford-Professor H. U. Gumbrecht, dass bis Ende des 2. Weltkrieges üblich war, die jungen Leute als Soldaten für den Tod zu selektionieren (eigentlich in Balkankriegen und anderswo auch nachher).
Ich wundere mich, dass sich junge Menschen noch nicht wehren dagegen, was mit ihnen, mit ihrer Zukunft geschieht. Sie begreifen es vielleicht noch nich und befürchten als Verbrecher beurteilt zu werden.Aber wenn der Shock, die Starre vergeht?
Warum künnen, bzw. müssen diesen Kampf gegen Virus mit solchen "harten Bandagen" führen? Während wir den individuellen Tod beginnen einigermassen zulassen, in der Schweiz auch den Freitod, als Gesellschaft akzeptieren wir ihn nicht. Er muss, koste es was wolle, verhindert werden.
26.3.20:
Heute erschienen im "New England Journal of Medicine" mehrere Artikel über Coronavirus. In einem analysierten die Wissenschaftler aus Wuhan, wo der Virus seinen Weg begann, die WEge seiner Verbreitung. Sie kamen zu u.a. zu einem enorm wichtigen Erkenntnis: Der Virus verbreitet sich nur über direkten Kontakt zwischen Personen am ehesten durch sog. Tropfeninfektion, nicht über Gegenstände! Das heisst, die Desinfektion der Gegenstände ist nicht so wichtig, wie der Schutz beim Niessen, Husten und nahen Atmen. Wir wissen, was wir tun un was lassen sollen. Damit können die strengen Isolationvorschriften gelockert werden, die Leute können arbeiten, die Kinder wieder in die Schule gehen. Ich bin neugierig, wie lange wird es den massgebenden Politiker und ihren Fachberatern dauern, bis sie diese Schlussfolgerungen ziehen und anwenden.
27.3.20:
Es bedeutet auch, dass man als ein gewöhnlicher Sterbender keine Schutzhandschuhe tragen muss und die Hände nicht zu viel waschen und desinfizieren muss. Ausser bei Kontakt mit Corona-Patienten. Silvia bekam gestern rote, juckende Hände nach ständigem Waschen - heute nicht mehr.
*
Am 19.3. habe ich die Massnahmen gegen Coronavirus übertrieben, unnötig, hysterisch genannt. Jetzt bürgerte sich die Bezeichnung "unverhältnismässig". Es beruhigt mich, dass in der Schweiz ein "Bundesamt für Justiz" (BJ) existiert, der wacht darüber, dass die Politiker in Rausch ihrer Macht während Notstandes sie nicht missbrauchen. Auch den Parlamentariern gefällt nicht, dass Bundesrat so frei walten kann, und Corona hier oder her, ihre Sitzung spätestens in einem Monat durchführen möchten.
28.3.20:
Nachdem ich am Morgen neue Arbeiten über die Verbreitung von Coronavirus ((u.a. von einer schwangeren, infizierten Mutter auf ihr Kind im Mutterleib - ja!) gelesen habe, kam mir in Sinn, dass man weder in China, USA, Italien, nirgendwo die Verbreitung auf die Kinder der Infizierten, also von Erwachsenen auf die Kinder verfolgte. Es gibt zwei Möglichkeiten, warum Kinder und Jugendliche nicht erkranken. Entweder können nicht infiziert werden, oder sie zeigen keine Krankheitszeichen, sie sind damit gefährliche, unbemerkte Träger und Verbreiter des Virus. Im zweiten Fall muss man sie wie kranke Erwachsene isolieren, im Ersten dürfen sie sich frei bewegen und können auch die Schule, Krippe, Kindergarten besuchen, sich treffen und frei bewegen. Dies veranlasste mich an die Chefs von epidemiologischen Institute in der Deutschschweiz folgendes Mail zu schicken:
"Sehr geehrte Epidemiologiehäuptlinge der Deutschschweiz,
in dieser Woche sind 3 Arbeiten erschienen, die weitgehende praktische Konsequenzen haben.
-
Die Übertragung des Covidvirus ist nur mit direkten persönlichen Kontakt möglich (1,2).
-
Auf der anderen Seite die Überträger können auch Tiere sein, was eventuell sie bisher unerklärliche starke Verbreitung in manchen Ländern begründen (3).
Was jedoch noch fehlt, ist die Beantwortung der enorm wichtigen Frage mit praktischen Konsequenzen - wie ist es mit Kindern und Adoledzenten? Infizieren sie sich nicht, oder erkranken sie nur klinisch nicht. Wenn nicht, ist es eine gute Quelle für Forschung.
Ich denke, in Zusammenarbeit könnten Sie diese Frage schnell beantworten.
Mit bessten Grüssen
Peter Marko, Dr. med.
1doi/full/10.1056/NEJMoa2001316
2 DOI: 10.1056/NEJMoa2005412
3 doi: 10.1056/NEJMc2005157 "
Mal sehen, wie sie reagieren werden.
*
In der Tagesschau um 19,30 sahen wir, wie man in Südafrika weiterhin die Gegenstände auf den Strassen desinfiziert. Sie wissen noch nicht, dass es sinnlos ist. Und in Italien steigen trotz den strengen Massnahmen die Zahlen der Infizierten, der Kranken und der Gestorbenen unbeeinflusst weiter im schnellen Tempo. ES sollte klar sein, dass wir auf falschem Weg sind, falsche, unwirksame Massnahmen anwenden. Der Virus hat irgendeine Eigenschaften, die wir nicht kennen und er findet Wege, sich weiter zu verbreiten. Umdenken ist nötig. Das ist aber schwierig. Es erinnert an den Kampf im Finanzsektor gegen die Finanzkrise..
29.3.20;
In der gestrigen "NZZ" schrieb der ehemalige, sehr erfolgreiche Chefredaktor der "Schweizerischen Ärztezeitung" B. Kesseli eine Kolumne, in der er die Arbeit der Bundesbehörden in der Coronakrise, wenn auch nicht lobte, so guthiess. Heute morgen schickte ich ihm folgendes Mail :
"Sehr geehrter, lieber Herr Kesseli,
es war sehr interessant, Ihren Artikel über Alltag in der Allgemeinpraxi in der Cronazeit. Er wird zur Geschichte unseres Faches gehören.
Ihrer wohlwollenden Einstellung zur Aktivität der Gesundheitsbehörden in der Coronazeit kann ich hauptsächlich aus folgendem Grund nicht zustimmen: Es zucke in mir als, ich die Beurteilung der Wirksamkeit der Schutzmasken aus dem Mund des Bundesrates hörte «sie sind nicht effektiv». Gleich habe ich meine Meinung dem BAG sowohl schriftlich, wie auch telefonisch über Hotmail mitgeteilt. Bis heute ohne Reaktion. Es spricht nicht die «beleidigte Wurst» aus mir, aber es zeigt sich immer mehr, dass der Mundschutz eine wichtige Waffe gegen Verbreitung des Coronavirus ist, da er sich zum Glück nicht über Gegenstände, aber «nur» durch direkten Kontakt verbreitet. Es ist auf eine Weise sehr beruhigend, hat auch weitgehende praktische Konsequenzen, z.B. tragen der Masken.
Nicht nur die Schweiz hat(te) Mangel an Schutzmasken. Sie reagierten ehrlicher, schöpferischer, wirksamer: Sie veranlassten die Bewohner, die Masken selbst anfertigen mit unzähligen Anleitungen im Internet. Die slowakische Presidentin hielt die «Coronanasprache» zur Nation in einer Bluse aus demselben Stoff wie ihre Schutzmaske, was dort schon vorher zur Mode wurde.
Nach der Veröffentlichung der wichtigen Berichte über Verbreitung der Infektion in Wuhan und in einem Alterspflegeheim in der USA (und im Mutterleib) ist mir in Sinn gekommen, dass wir merkwürdigerweise nicht wissen, warum die Kinder und Jugentliche nicht erkranken: Reagieren nur nicht und siind Träger oder vermehrt sich bei ihnen Virus überhaupt nicht, was enorme praktische Bedeutung hätte. Ich habe es den Deutschschweizerepidemiologen mitgeteilt.
Zum Ruhmseite der Bundesgesundheitsbehörden gehört auch nicht, dass sie kein Beratungsgremium aus Fachleuten zugezogen haben.
Mit besten kollegialen Grüssen
Peter Marko"
*
Warum steigt die Zahl der Cornapatienten und der Gestorbenen in Italien weiterhin stark? Warum zeigt sich nicht die Wirkung der drastischen Massnahmen? Gibt es eine Kombination von einer Übertragung durch Tiere und dann vom Mensch zum Mensch, wie es ein chinesischer Epidemiologe vermuren (DOI: 10.1056/NEJMc2005157) für Pangoline (Schuppentiere),? Vielleicht erklärt es teilweise auch die grosse Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern. Der Virus bietet uns Rätsel.
*
Man setzt gedankenlos Beatmungsgeräte auf den Intensivstationen auch bei >80-85-jährigen Patienten. Hoffentlich wir man schauen auch nach ihrer Rettung im welchen Zustand sie überlebten, welche Schäden sie davon tragen. Man wünscht sich aus guten Gründen, dass viele diese Behandlung ablehnen.
*
Die Frage der hohen Zahlen der Kranken und der Sterbenden stellte ich (telefonisch) auch unserer Nachbarin einer Spanierin. Sie konnte mir keine Erklärung geben. Am Abend rief sie mich an und berichtete, sie sprach mit einem befreundeten Ärzteehepaar in Spanien. Sie sagten, in Fachkreisen gibt es die Meinung, die Italiener und Spanier hätten einen anderen Immunsystem. Sie widerstehen länger der Infektion, sind zuerst Träger, dann nur leicht krank, bis das Immunsystem überfordert ist, und dann schnell versagt. Jede Hilfe ist vergeblich.
Es ist eine nachvollziehbare Erklärung. Werden wir sehen, ob sie sich bestätigt.
30.3.20:
Ich habe vergesse, dass ich vor einer Woche folgenden Leserbrief der "NZZ" schickte:
"Betr.: Bühler U: Alte verdienen von uns … NZZ 21.3.20, S.15.
In seinem lesenswerten Artikel apeliert U. Bühler an uns alte Leute, unsere Häuser und Wohnungen (überhaupt) nicht verlassen. Es ist ein Beispiel für das schwarz-weiss, entweder-oder Denken, das nicht nur die Diskussionen aber leider auch die Massnahmen zum Coronavirus beherrscht. Kann mir Herr Bühler erklären, wie gefährde ich meine Mitmenschen und mich, wenn ich in einer Zeit/Gegend ausgehe, in der sich kaum jemand dort und unterwegs befindet? Sogar, wenn ich auf meinem Waldweg bei jemanden vorbeigehe, muss ich eigentlich keinen Abstand von 2 m halten, da die Coronaviren keine Zecken sind, und nicht während der 10-20 Sekunden ob vom mir oder vom meinem Gegenschreitenden überspringen.
Ob man das Seeufer in Zürich gleich sperren muss, ist auch fraglich. Gestern in der Mitte der Stadt am beliebten Treffpunkt, sah ich vormittags zwei Männer mit den Bierdosen in der Hand diskutieren. Sogar sie hielten mehr als 2 m Abstand voneinander. Wie Herr Bühler richtig schreibt, die Durchsetzung der Massnahmen braucht Geduld. nicht nur am Zürichseeufer. Verdienterweise schreibt die «NZZ» auch über die Schäden, die die Isolation hervorruft. Man sollte sie mit Mass und gesundem Menschenverstand einsetzen.
Übrigens, in meiner Patientenverfügung steht, dass ich auf Lebenverlängerungsmassnahmen verzichte. Nicht anders wäre es auch bei einer schweren Coronainfektion – keine Intensivstation, kein Beatmungsgerät, aber genug Morphiumtropfen."
Heute hat sie den kursiv gezeichneten Text veröffentlicht.
31.3.20:
Heute hat Silvia meiner Cousine Jean in Irland auf ihr Mail geantwertet: Es illustriert etwas, wie wir leben:
"Dear Jean,
thanks very much for your kind mail. First of all we are glad that your family is ok. As we see you have to behave like we have to do as well. The only difference between you and Peter an me is thatwe have the forest with lots of ways for walking next to our apartment, so we go out at least once a day for a nice walk. We have also nearby a farmer, who sells fruits of his own, potatoes, even meet, fresh and already cooked, of course also milk and cheese. She bakes cakes every day, which one can eat there or take it home. So we envited once my youngest brother with his wife. First we had a nice walk together, but always with a certain distance and then we had coffee and cake together and as it was a special situation the farmer and his wife came with a bottle of a home-made herbal liqueur and we drank alltogether a little glass ecept stron abstinent Silvia). It was like having a feast. But otherwise a woman in the neighbourhood purchasing for us. In the beginning I went to the shops myself but our daughter Corinne forbid it.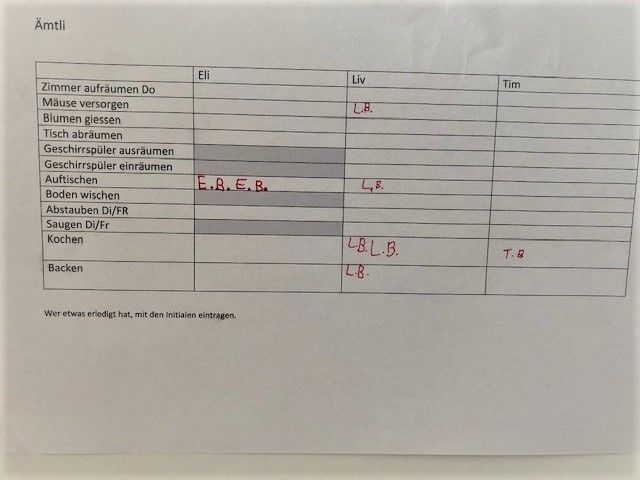
(2) Coronaaufgabenplan.
That is also the reason why we answer only now, because I had to sew masks for Corinne and her family, so the children can allow themselves more easily to go out and play at least in the courty yard. The children in Switzerland are not allowed to go to school. They have to work at home. So for Corinne this is not very easy. She should also work at home and with 3 children at home it is not funny at all. To keep them active, she told Liv and Tim to cook for the whole family and they had to produce extravagant meals. Sea the enclosed pictures and Peter with the mask I made.
Switzerland has not enough masks for all the people. So they tell that they are not effective and did not change this stupid meaning. Thats why I had to sew them myself. In addition to the mask one should also wear glasses, because according to the neighbour, a medicine, eyes are the forgotten gates for corona. Peter had to go to the hospital because of his eye-pressure. He was the only patient with a mask and the doctor asked first, whether he was infected, but then he was quite happy and thankfull and said that he was a conserated man.
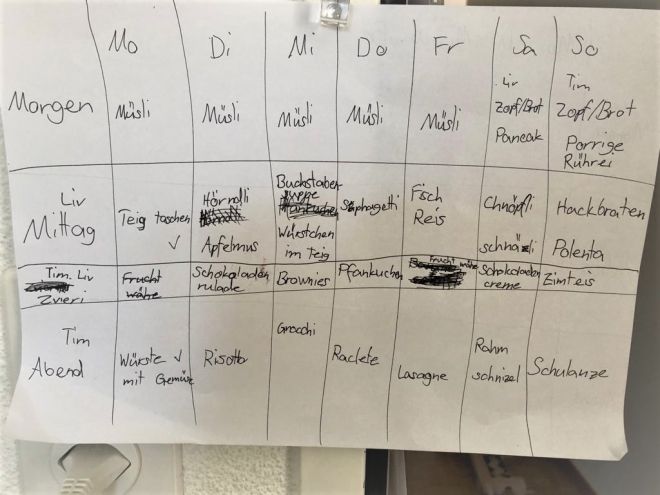
(3) Coronakocheinteilong.
Keep your head high, the ears stiff and the mood good – keep healthy"
Inzwischen "normalisiert" sich die Lage und die Reaktion der Behörden, Institutionen, Menschen. Während vor einer Woche die Infektion in einem Alters. Pflegeheim in Würzburg (s. 25.3.20) zu einer Katstrophe führte, betreuen jetzt unsere Heime infizierte Patienten weiterhin, falls sie sich es wünschen. Die Leute sollen auch weiterhin arbeiten gehen und die Vorsichtsmassnahmen halte, unter welche endlich auch Tragen der Masken gehärt. Ofiziell wurde es weder vom BAG (Bundesamt für Gesundheitsweden) noch von Bundesrat Berset verkündet. Und wie lange es noch dauert, bis sie begreifen und verkönden, dass man sich nicht über Gegenstände infizieren kann? In der "NZZ" gibt es Artikel mit Überschriften wie "Das Notrecht stiesst rasch an die Grenzen", … Ja, es beginnt wieder der gesunde Menschenverstand herrschen und wir kehren von der "Anfangshyterie" zurück, Zumm Glück.
1.4.20:
Ausserdem schrieb dort der Lausanner Epidemiologe Salthé ein Lonlie auf die Masken und ich sprach telefonisch mit meinem Freund Viliam Krivan, emeritiertem Professor für Analytische Chemie in Ulm, der in einer Arbeit die Wirksamkeit verschiedener Masken für Stoffe mit kleineren Molekülen als Viren bestimmte. Die Unwirksamsten filtrierten noch immer 80%! Ermachte mich aufmerksam auch darauf, dass die Luftverschmutzung ein günstiger Faktor für die Verbreitung der Viren ist. War in Wuhan, Norditalien dei Luft rein? Die gegenwärigen Massnahmen vermindern die Luftverschmutzung. Wann zeigt sich ihre Wirkung auf die Verbreitung des Virus?
Heute morgen erschien auf der ersten Seite der "NZZ" ein Artikel mit dem Titel "Bund widersprichst sich bei Masken"! Ich verfasste gleich folgenden Leserbrief;
"Betr.: Surber M, Rhyn L: Bund widerspricht sich bei Masken. NZZ 1.4.20, S.1.
Als Bundesrat Berset vor drei Wochen am Anfang der Verbreitung des Coronavirus in der Schweiz verkündete «Die Masken sind gegen Coronavirus nicht effektiv», zuckte es in mir. Seine Absicht die Bevölkerung durch eine Lüge (falsch) zu beruhigen war mir klar, nicht dass der Mangel an Masken selbstverschuldet war. Seit dem Tag bin ich nicht müde, leider vergebens, BAG zu bitten, diesen Lapsus zu korrigieren. Mehr noch, die Einwohner der Schweiz auch herauszufordern und zu instruieren, die Masken selbst anzufertigen, wie es zum Beispiel in der Slowakei auch durch die Präsidentin in einer Ansprache geschah. Sie trug dabei eine Maske aus dem gleichen Stoff wie die Bluse, inzwischen dort sinnvolle Mode bei Frauen wie bei Männern mit ihren Hemden.
Bisher hat sich niemand ohne Kontakt mit einem Menschen über Gegenstände infiziert. Die Schlussfolgerung davon, dass das übertriebene Händewaschen und die Desinfektion unnötig sind, wagt niemand zu ziehen, auch wenn es sehr beruhigend ist."
*
Leider muss ich meine Behauptung vom 23.3. zurückziehen. Singen wirkt nicht gegen Coronavirus. Vom Chor der Schwägerin wurden doch mehrere Personen angesteckt. 6 hatten Symptome und ein Ehemann musste ins Spital. Niemand ist gestorben. Schwägerin möchte wissen, ob ihre Leichte Symptome in den Tagen nach singen durch Coronavirus verursacht wurden. Falls ja, ist sie immun und kann furchtlos leben. Dedr Arzt hat es bisher abgelehnt, auch wenn sie zu Risikogruppe gehört. Mal warten auf mehr Tests.
3.4.20:
Heute schlugen wir W.N., einem Vetter von Silvia, dass wir uns auf dem Halbweg am Montag bei unserem Baue treffen könnten und dort zum von Bäuerin selbstgemachten Kuchen Kaffee trinken, was ich jetzt fast täglich tue. Wir vergassen, dass W. ein ehemaliger Kommandant der Kripo von St. Gallen und damit vielen Leuten bekannt ist. Für so eine Person gehört sich heutzutage nicht auszugehen und sich im Kreise von 4 Personen unterhalten. Vielleicht korrigiert bis Montag der Bundesrat seine Vorschriften. Jedenfalls seine Frau Y. will kommen.
4.4.20:
Heute morgen habe ich dolgendes Mail an BAG geschickt. Es spiegelt auch meine veränderte Einstellung zu Maken;
"Die gegenwärtigen gut begründeten Kenntnisse und Mssnahmen gegen Coronavirus:
-
Virus verbreitet sich nur direkt vom Menschen zum Menschen, nicht über Gegenstände.
-
Der Kontakt muss dazu eng,
-
Er muss auch länger dauern.
-
Virus wird schon durch waschen mit Seife unschädlich gemacht.
-
Desinfektion, ob der Hände oder Gegenstände ist (ausser vielleicht beim Kontakt mit Infizierten) überflüssig.
-
Maskentragen ist im Freien überflüssig. Beim Vorbeigehen kann man sich nicht einstecken.
-
Maskentragen ist nötig bei Kontakt mit Infizierten, Aufentalt in Spitälern, Arztparxen. u.ä.
Dies ist gut begründet und durch die relativ geringe Zahl der Infizierten auch bewiesen. Diese Kenntnisse und Mssnahmen würden die Leute beruhigen, befreien, sicherer machen und Zeiz und Gels sparen. Bitte verkündet Sie sie so bald wie möglich.
*
Gestern erhielten wir einen Packet von unseren Enkelkindern mit folgenden Gegenständen:
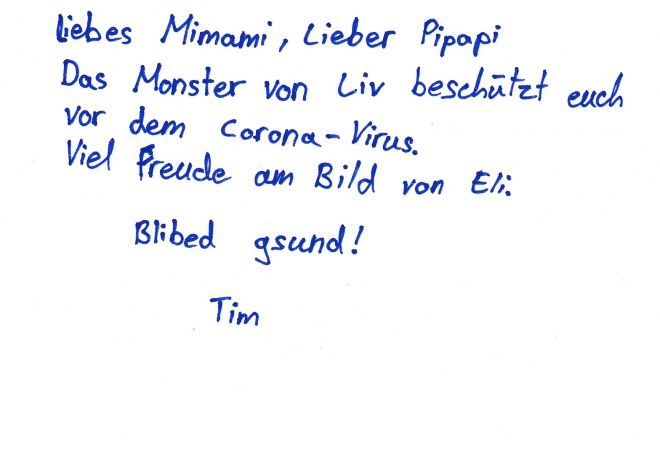
(4) Begleitbrief von Tim.

(5) Spuck von Liv, derCoronaviren abschrecken wird.

(6) Bild von Eli, das sein Zustand und Einstellung zum Virus darstellt samt kackendem Tier und Viecher in der Erde.
5.4.20;
Die Angst vor Corona hat eine weitere unerwünschte Nebenwirkung: Die ernsthaft kranke Patienten wagen nicht sich behandeln lassen. Wie viele sind es, wie viele sterben daran, erfahren wir nie.
*
Es ist ein wunderschönes Wochenende. Die Städte haben unterschiedliche Einstellung zum Ausgang; manche sperren beliebte Gebiete, wo sich die Menschen sammeln können, wie Zürich und Luzern die Seeufer, andere appellieren auf die Vernunft und Einhalten der Verhaltensregel wie Basel, die Rheinufer frei, aber unter Kontrolle lässt. Mal sehen, welche Art sich bewährt. Ich bin für Basel.
Klare, vernünftige Empfehlungen der Gesudheitsbehörden würden helfen.
*
Das Singen ist nicht nur nicht gegen Corona wirksam (s.23.3. und 1.4.), aber vermutlich verbreitet den Virus besonders wirkungsvoll: Bei Husten, Niessen und vermutlich auch Singen entstehen "Wolken", die sich viel weiter, bis 20m verbreiten, als die einzelne Viren beim Atmen. Deswegen sollen Personen, die Kontakt mit Coronapatienten haben unbedingt Masken tragen. Hoffentlich bald, nach dem genug Tests vorhanden wird, erfahren wir, ob unsere Schwägerin, die nach dem Singen leicht erkältet mit Fieber war, Coronainfektion überstand. Ihr e Tochter und Enkelkind hatten damals auch "Grippe". Auf positiv ich tippe.
*
Eine Bekannte war beidem einem Arzt mit der Maske, der sich gewundert hat, warum. Sie soll wieder gehen und ist verunsichert - mit oder ohne. Es ist Folge von derchwammmigen, nicht detaillierten Informationspoltik ders "BAGs". Niemand würde ihnen die eventuelle aber gut begründete Widerrufung ihrer auch gut begründeten Empfehlungen. Unsere Kenntnisse über Virus ändern sich auch.
8.4.20:
Gesttern war ich im Spital wegen der Spritze in das rechte Aue. In Unterschied zum lezten Mal (20.3.) trugen viele Patienten und fast alle Angestellten auch draussen Masken. Sie wollten mir statt meiner Stoffmaske (17.3.) eine Chirurgische verpassen, was ich als Mistrauen und Entwürdigung von Silvias Werk betrachtete und strikt ablehnte.
*
Der¨österreichische Bundeskanzler leitete die Normalisierung ein. Es ist zu hoffen, dass unsere Politiker bald ihn folgen werden. Ich schrieb wieder einen Leserbrief der "NZZ", quasi ale Empfehlung für die beschleunigte Normalisation:
"Da das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit der Verkündigung folgender Tatsachen und ihrer Folgen zögert, bitte ich die «NZZ» um die Veröffentlichung:
-
SARS-CoV-2 ist nur über direkten Kontakt zwischen Menschen, nicht jedoch über Gegenstände übertragbar. Ihre Desinfektion ist überflüssig. Für die Reinigung der Hände reicht das Waschen mit Seife, Seife tötet den Virus (auch NZZ vom 4.4.2020).
-
Der Virus wird bei einer normalen Atmung nicht über eine Distanz von 2m übertragen. Beim Husten, Niessen kann sie bis 20m steigen.
-
Die Übertragung braucht eine gewisse Menge des Virus (virus load), somit auch die Dauer des Kontakts.
-
Die Schutzmasken sind wirksam und wichtig bei einem längeren Aufenthalt mit Menschen in geschlossenen Räumen wie in Arztpraxen, Spitälern und anderen Räumen mit länger weilenden Menschen. Im Freien sind sie überflüssig ausser s. P. 2 und 3.
-
Beim Kontakt mit SARS-CoV-2-Patienten sollte man auch Schutzbrille tragen
Diese Kenntnisse haben weitgehende Folgen für die Arbeit, Wirtschaft und das tägliche Leben. Man sollte das Leben so weit wie möglich erleichtern und nicht unnötig erschweren.
Die Fachliteratur wird Interessierten gerne zur Verfügung gestellt."
"
Heute erschien wieder ein Artikel über Wirksamkeit und Sinn der Masken gegen Corona- Ich schrieb wieder einen Leserbrief:
"Betr.: Schöchli H: Was Masken gegen Viren wirklich bringen. NZZ 7.4.2020, S. 13.
In gewohnt klaren Worten und sachlich fasst der Autor das Problem der Masken im Schutz gegen SARS-Covid-2 Virus zusammen. Wie er richtig schreibt, muss man differenzieren und nicht Birnen und Äpfel vergleichen. Dieser Virus ist nicht ein Grippevirus, und man müsste wissen, unter welchen Bedingungen die Studien durchgeführt wurden. Beim Husten, Niessen nützen die Masken sicher weniger als beim ruhigen Atmen. Im gestrigen Leserbrief fasste ich die Schlussfolgerungen folgendermassen zusammen: «Die Schutzmasken sind wirksam und wichtig bei einem längeren Aufenthalt mit Menschen in geschlossenen Räumen wie in Arztpraxen, Spitälern und anderen Versammlungen mit länger zusammen weilenden Menschen. Im Freien sind sie überflüssig, sofern der Abstand von 2 m eingehalten wird». Heute ist eine Arbeit über die Schutzwirkung der Masken beim Husten der Patienten mit Covid-2 erschienen (DOI: 10.7326/M20-1342 ). Beide, sowohl Chirurgische- wie Baumwollemasken schützen nicht vor der Verbreitung des Virus beim Husten, die Baumwollmasken schneiden noch etwas besser ab. Eine andere Veröffentlichung zeigt, dass die Krankenschwester, die einen hochinfektiösen aber nicht hustenden Säugling fütterte und wickelte, erkrankte nicht. Sie trug selbstverständlich eine Schutzmaske. (DOI: 10.7326/M20-0942 )."
9.4.20:
Heute habe ich folgenden Leserbrief der "NZZ" (ohne Literatur und leich verändet) und der "SÄZ" geschickt:
"Der weisse Fleck der Coronaepidemie
Trotz Appellen mancher Epidemiologen und Pädiater (1-3) kennen wir leider die genauen Daten über die Ansteckung und Verbreitung des Covidvirus bei Kindern und Jugendlichen
Diese Lücke ist desto merkwürdiger, als die entsprechenden Kenntnisse mit einem relativ kleinen persönlichen und finanziellen Aufwand zu gewinnen wären: Man braucht nur die weitere Ausbreitung des Virus in Familien der kranken Erwachsenen mit Kindern zu verfolgen.
1 Rasmussen SA,Thompson LA: Coronavirus disease 2019 and children What pediatric health care clinicians need to know. JAMA Pediatr. Published online April 3, 2020. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.1224.
2 John E, Wong L Leo YS Tan,CC;: COVID-19 in Singapore current experience Critical global issues that require attention and action JAMA. 2020;323(13):1243-1244. doi:10.1001/jama.2020.2467.
3 Wei M, Yuan J, Liu Y, al: Novel coronavirus infection in hospitalized infants under 1 year of age in China. JAMA. 2020;323(13):1313-1314. doi:10.1001/jama.2020.2131.
4 Qun Li, Xuhua Guan, Peng Wu, at al: Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus–infected pneumonia. N Engl J Med 2020; 382:1199-1207, DOI: 10.1056/NEJMoa2001316-
5 Zhu N, Zhang D, Wang W, et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. N Engl J Med 2020; 382:727-33. doi: 10.1056/NEJMoa2001017.
.6 Liu W, Zhang Q, Chen J,, et al: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32163697">Detection of covid-19 in children in early January 2020 in Wuhan, China. N Engl J Med. 2020 Apr 2;382(14):1370-1371. doi: 10.1056/NEJMc2003717
7 Mizumoto K, Kagaya K, Zarebski A, Chowell G. : www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32183930">Estimating the asymptomatic proportion of coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases on board the Diamond Princess cruise ship, Yokohama, Japan, 2020. Euro Surveill. 2020 Mar;25(10). doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.10.2000180.
8 Sominsky L, Walker DW, Spencer SJ: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32205119">One size does not fit all - Patterns of vulnerability and resilience in the COVID-19 pandemic and why heterogeneity of disease matters. . Brain Behav Immun. 2020 Mar 20. pii: S0889-1591(20)30366-4. doi: 10.1016/j.bbi.2020.03.016. "
10.4.29:
Nach dem ich einen Berict in der gestrigen "NZZ" ("Mit Munschutz und Gummihandschuhen -der Halbleiterzulieferer VAT arbeitet im St. Galler Rheintal unter strengen Hygieevorschriften" gelesen habe, in dem beschrieben wird, wie die Leute die Probleme mit Coronavirus am Arbeitsplatz selbständig und gu lösen, schrieb ich folgenden Lesserbrief:
"Der Artikel ist ein schönes Beispiel, wie Leute «mit gesundem Menschenverstand» vernünftig handeln, wenn man ihnen die Verantwortung für die Folgen überlässt, wenige richtige, gut begründete Anweisungen gibt und sie nicht unnötig beschränkt:
-
Bei jeglichen Versammlungen 2m Abstand halten. Beim Kontakt unterhalb 2m Schutzmasken tragen.
-
Hände mit Seife waschen. Desinfektion der Hände und Gegenstände ist überflüssig, da das SARS-Covid-2-Virus nur über direkten Kontakt zwischen Menschen übertragbar ist.
-
Ausnahmen sind die Betreuung der nfizierten Menschen, bei der auch Augenschutz nötih ist, Aufenthalt im Spital und Arztpraxen.
Bei Einhaltung dieser zwei Regeln kann man sofort ein fast «normales Leben» beginnen: Die Geschäfte und Restaurants können öffnen, die Menschen können sich draussen ohne Masken frei bewegen, die öffentlichen Verkehrsmittel beschränkt benützen (ein direkter Kontakt unterhalb 2-3 Minuten ist unbedenklich). Ob die kleinen Kinder in den Kindergarten und in die Schule gehen können, sollte eine nicht schwierige und zu komplizierte Studie über die Übertragung des Virus bei ihnen zuerst schnell zeigen. Es ist ein weisser Fleck in unseren Kenntnissen über die Verbreitung des Virus, mit weitgehenden Folgen, der baldmöglichst verschwinden sollte. Wir kämpfen nicht nur gegen ein Virus, das relativ gutmütig ist, aber auch gegen (teilweise unbegründete) Angst davor."
Die ungeklärte Problematik der Infektion bei den Kindern lässt mich nicht in Ruhe.
*
Einen abschreckenden Beispiel für eine Entweder-oder, schwarz-weis blödsinjnige Dekweise haben wir in der "Tagesschau" gesehen: Sowohl die Schweizer wie noch mehr die niederländische Gärtnereien vernichten tonnenweise Blumen stat eine neue Formen des Verkaufs zu entwickeln. Warum könne die Kunden nicht wie in anderen Läden nur tropfenweise in die Riesengeschäfte nicht kommen, oder die Blumen draussen holen und bezahlen? Auch wenn der Umsatz nicht derem Vorjahr entspäche, aber so klein, dass es sich nicht lohnt, wäre es sicher nicht. Die Garten werden dieses Jahr unnötigerweise weniger bunt und schön.
13.4.20:
Heute habe ich zum Leserbrief vom 9.4.20 noch folgenden Absatz beigefügt:
"Auch über die Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen gegen die Verbreitung des SARS-Covid-19-Virus herrscht merkwürdigerweise noch immer Unklarheit (9). Man könnte sie einfach beheben: Eine kleine Anzahl (6?) Patienten, die den Virus sicher noch verbreiten (2-4 Tage nach Beginn der Symptome) lässt man zuerst 2,5 und 10 Minuten atmen, dann durch die Schutzeinrichtungen husten. Man bestimmt die Virusbelastung in der ausgeatmeten und in der ausgehusteten Luft. Und somit ist Ende der Unklarheit."
Mit folgender Referenz:
9 Mahase E: Covid-19: What is the evidence for cloth masks? BMJ 2020;369:m1422 doi: 10.1136/bmj.m1422.
*
Der "NZZ" habe ich folgenden Leserbrief geschickt und bat die zwei letzten vom 7. und 9.4. zugunsten von diesen eventuell nicht veröffentlichen:
"Betr.: Fischer PA: Lange darf es so nicht weitergehen. NZZ 11. April 20202, S.10.
Dem Autor stimme ich gerne zu. Um eine U-Kurve der Folgen der Coronaepidemie in eine möglichst V-ähnliche umzuwandeln (das heisst schnell zur Normalität zurückzukehren) und eine L-Kurve (unveränderte Verhältnisse) zu vermeiden, sollte man das wirtschaftliche und tägliche Leben nicht mit unnötigen, unwirksamen, damit schädlichen Massnahmen belasten und erschweren. Inzwischen weiss man, dass auch ein allgemeines Ausgangsverbot zu ihnen gehört. Da man sich nur durch direkten Kontakt infizieren kann, ist eine Desinfektion der Gegenstände überflüssig. Auch die Luft in Räumen mit Infizierten ist nicht ansteckend. Es sind «nur» die Tröpfchen aus den Luftwegen, die beim Atmen, noch mehr und weiter beim Husten und Niessen entweichen. Ihre Reichweite übersteigt nicht 2m, beim Husten und Niessen können sie sich bis 20 m verbreiten. Bei einem Aufenthalt in geschlossenen Räumen sollte man deswegen den Abstand von 2m unbedingt einhalten. Hustende und Niessende haben dort selbstverständlich Eintrittsverbot. Draussen bei kurzen Kontakten (2-3 Minuten) braucht man keine Schutzmasken zu tragen. Für die Desinfektion der Hände reicht ein halbminütiges Händewaschen mit Seife. Eben, ein Coronavirus ist zum Glück kein Norovirus, das den Durchfall verursacht.
Strengere Regeln gelten selbstverständlich bei Kontakt mit kranken Menschen und in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Die obengenannten relativ einfachen Massnahmen gelten auch für die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel, wie auch für die Schulen. Dabei wäre es sehr nützlich, so bald wie möglich die leidliche Frage zu beantworten, wie leicht sich die Kinder infizieren und wie sie die Infektion weiter geben. Man kann es geht relativ einfach eruieren. Noch einfacher und schneller kann man die Wirksamkeit der verschiedenen Schutzmasken überprüfen. Beide Antworten sind enorm wichtig für den Umgang mit dem Coronavirus."
*
Es mehren sich die Stimmen, die für einen vernünftige, nicht wegen Angst übertriebenen Umgang mit der Gefahr plädieren. Desto mehr überrascht mich, dass Italien bei der Ausgangsperre bleibt, und noch mehr, ass die AMA (American Medical Association) die Desinfektion der Gegenstände empfiehlt. Verschiedene Länder haben ganz verschiedene Zugänge zur Coronainfektion. Die Auswertung ist und wird enorm schwierig. Am ehesten noch der geografisch naheliegender Länder mit ähnliche wirtschaftlichen Verhältnissen und ähnlichen Gesudheitswesen wie die Skandinavische Länder oder die Mittelmeerstaten..
17.4.20:
Heute ist in der "NZZ" mein Leserbrief vom 7.. erschienen. Ausserdem eine zweiseitiger Artikel über Probleme mit Masken. Teilweise kritisch. Und ein Artikel über Infizierte in manchen Pflegeheimen in Zürich. Auf Stationen ohne Corona-Kranken war keiner positiv, auf Stationen mit Corona-Kranken waren 80 von 180 Insassen positiv (44%9), davon aber nur 53 (40%) hatten Symptome. Die restlichen waren Träger, die wieterhin das Virus verbreiten konnten. Ich wünsche mich eben eine ähnliche Studie mit Verfolgung der Posotivitat bei Kindern. Isländer haben eine Studie der Verbreitung veröffentlicht, leider ohne sich speziell den Kindern zu widmen (DOI: 10.1056/NEJMoa2006100)..
18.4.20:
Gestern las ich in der "NZZ", dass nach der Lockerung der Massnahmen, Bundesrat Berset sie wieder erschweren, strenger machen kann, wenn die Zahl der Neuinfizierten pro Tag wieder 100 übersteigt. In der Nachrichten wurden die Erleichterungen verlesen. Sie sind unkonsequent, unlogisch, ungerecht - schlecht begründet. Z.B. Warum sollen Coiffeusesalons öffnen dürfen, aber nicht normale Geschäfte, warum Grossverteiler aber nicht kleine Geschäfte, usw. worauf ich der "NZZ" folgenden Brief schickte:
"So, so, Herr Bundesrat Berset meint, er kann die Massnahmen gegen Corona-Virus Infektion je nach Zahl der Infizierten und/ oder Verstorbenen steuern. Er begriff noch immer nicht, was für ein Desaster man eingerichtet hat und mit seinem beschränkten Vorstellungsvermögen auch nicht, dass es nicht geht. Er möchte uns oder das Virus zum Gehorsam bringen. Es ist Verhalten eines macht betrunkenen pubertierenden Knaben.
Die heute angekündigten Massnahmen (und Fristen) sind auf Widersprüchlichkeit kaum zu übertreffen. Vermutlich tragen sie seine Handschrift."
Ich vergass beizufügen, dass die Bundesräte zu Witzfiguren verkommen, wenn sie solche Massnahmen zulassen.
20.4.20:

(7) Durch Seil die Generationen sicher in mehr als 2m-Entfernung getrennt.
Am Samstag, 18.4.,kam Corinne, Christian und Kinder zu uns. Trafen wir uns am Parkplatz und im Gänsemarch, mit mindestens 2m Abstand spazierten wir zu "unserem Bauer"*. Zuerst gingen wir zum Grillplatz, der bereits besetzt war, dann am Waldrand zum Bauernhof. Corinne und Kinder kannten ihn schon, Christian war dort das erste Mal und staute über das Angebot. Er konnte sogar mit dem Smartphone zahlen. Die Kinder genossen den Spaziergang, fuhren Kindertratktoren und spielten, fütterten und bestaunten wieder einmal die Gänse, Ziegen, Ferkel, Kälber, Hasen und Hühner, tranken dort gemachten Saft und assen von Bäuerin gebackenen Kuchen. Die Erwachsenen tranken zu ihm Kaffee. Es war "urgemütlich". Es dauerte nur zwei Wochen, Corinne und Christian überzeugen, dass dies erlaubt und möglich war.
Mit Christian teilen wir nicht die gleiche Meinung über die Bewältigung der Epidemie. Er ist linienförmig zu frieden mit dem Bundesrat. Da ist Dani eher auf unserer kritischen Seite. Er schickte uns gestern ein Video mit Gespräch mit Altbundesrat Blocher, mit dem wir völlig einig sind - wir übertreiben, komplizieren das Leben, belasten unnötig finanziell die junge Generation (mit der wir eben wanderten). -.
*
|
Land |
Einwohner |
Covid-Verstorbene |
0/00 |
|
Schweiz |
8,57 |
1142 |
0,1332 |
|
Schweden |
10,23 |
1540 |
0,151 |
|
Österreich |
8,60 |
452 |
0,0525 |
|
Deutschland |
83,0 |
4 600 |
0,055 |
|
Italien |
60,30 |
22 000 |
0,364 |
|
Frankreich |
72,0 |
20 000 |
0,27 |
|
Grossbritanien |
81,0 |
16 000 |
0,198 |
|
Spanien |
48,0 |
22 000 |
0,46 |
|
Belgien |
83,0 |
4 600 |
0,54 |
|
USA |
328,0 |
40000 |
0,121 |
21.4.20:
In dieser Tabelle sind (einigermassen) richtige, sichere Werte auf sich bezogen, die Zahl der Corona-Virusverstorbenen und der Einswohner eines Landes. Der häufige Bezug auf die Zahl der Infizierten ist falsch, da von Land zu Land die Kriterien und Meldungart verschieden sind.
Aber auch hier sollte man nur ähnliche Länder vergleichen. Vor allem die Geografie spielt eine Rolle. Inzwischen ist bekannt, dass man ür geosse Länder nur grundsätzliche und keine detaillierte Vorschriften erlassen soll. Aber warum sind so grosse Unterschiede zwischen ähnliche Ländern wie z.B. Frankreich und Spanien, Frankreich und Detschland, Österreich und der Schweiz? Die !Österreicher haben kein Tessin mit einer regen Mobilität der vielen Arbeiter aus Lombardei.
Es gibt ein grosser Unterschied zwischen Norwegen und Schweden. Wahrscheinlich ist es die Folge von der "leichtsinniger", riskanter Gesundheitspolitik der Schweden, die keine Beschränkungen in Kontakt verhängt haben un die Kindergarten und Volksschule nicht schlossen. Aber vielleicht werden sie die Durchseuchung eher erreichen. Vor allem die Wirtschaft leidet nicht so stark wegen ungefähr 500 alten, kranken alten Menschen.
Gie Analyse der Unterschiede zwischen den Ländern bringt wertvolle Kenntnisse über die Verbreitung dieses Virus. Schon jetzt weiss man, dass man dieselben Massnahmen nicht überall durchsetzen sollte, sondern nach Umständen anpassen.
Es beiben folgende grundsätzliche, überall nützliche Massmahmen:
- Beim Kontakt tin geschlossenen Räumen Abstand von 2 m halten
- und Masken tragen.
- Beides gilt auch draussen beim längeren Kontakt (>2 Minuten).
Das die Coronaepidemie vermutlich länger dauern wird, ist gut, wenn wir uns mit unnötigen Beschränkungen nicht belasten.
*
Die heutige "NZZ" brachte eine Gespräch mit dem Chef des Zürcher Fughafens, in dem erwähnt wir, dass man in einem Flugzeug unmöglich der Abstand von 2m einhalten kann. Darauf habe ich folgenden Brief geschrieben:
"Sehr geehrte Herren Widrig und von Ledebur,
der Abstand in den Flugzeugen braucht (fast) sicher nict 2m betragen, wie zeigt die beigelegte Facharbeit aus einem der angesehenen medizinischen Fachzeitschriften. In Kürze:
Auf dem mehrstündigen Flug von Wuhan nach Frankfurt mit zwei Infiziertenam Bord, hat sich niemand mehr eingesteckt. Grund: Entweder die Luftzirkulation im Flugzeug oder/und die vorn Herrn Widrig erwähnte Filter. Übrigens der eine hatte nur leichte Symptome, der andere wurde nur durch den Test entlarvt.
Freien Flug für freie Leute wünscht
ein grüner Gegner von Vielfliegerei
Peter Marko"
Eben, verschiedene Umstände verlangen verschiede Lösungen. Eine sture Einhaltung von Regeln ist nicht angebracht.
22.4.20:
Zufällig sind in der heutigen "NZZ" gleiche Berechnungen erschienen Die Analyse der Zahlen, ihre Deutung sind nicht einfach. Die Grösse des Landes, Häufigkeit der Bestimmungen, Melde- und Gesundheitssystem, Nähe zu Herden, Mobilität, u, andere Faktoren spielen eine Rolle. Kaum aber die Frühzeitigkeit der Massnahmen, da die drei Länder Österreich, Deutschland un die Schweiz sie gleichzeitig eingeführt haben.Hoffentlich wierd man später klüger.
*
Im Feulleiton der "NZZ" erschien ein Artikel "Hygiene in Scherben"in dem nebenbei wieder behauptet wurde, die Coronaviren können auf dem Glass lange überleben und ansteckend bleiben. Meiner schlechten Gewohnheit entsprechend, habe ich flgenden Brief der Redaktion geschickt:
"In diesem geistreichen Artikel liegen die Fakten in Scherben: Wenn man auf den Oberflächen Viren nachweisen kann, bedeutet es nicht, dass man sich mit diesen Viren auch anstecken kann. Noch niemand hat sich ohne eines direkten Kontakts mit einem infizierten Menschen mit dem Coronavirus infiziert! Also auch nicht von einer Glasoberfläche und/oder einem Glas, ausser beim eventuellen unmittelbaren Trinken aus demselben. Aber auch dann reicht die Menge des Virus kaum dafür.
Die Journalisten, auch im Feuilleton, sollen nicht unbegründet die Ängste der Leser schüren. Eine unserer Bekannten desinfizierte die Zeitungen (nicht die NZZ). Ich wollte sie nicht bloss stellen und fragte lieber nicht nach Details.
Eigentlich würde der obengenannte Artikel zum «Korrigendum» gehören."
23.4.20:
In der "NZZ" ist heute ein Artikel über die Wichtigkeit des Handy.Sesinfektion erschienen. Mein Leserbrief dazu:
"Betr.: Golmer P: Gerade jetzt ist Handy-Hygiene wichtig. NZZ 23-4-2020, S. 31.
Gerade jetzt, wenn die Angst vor dem Coronavirus unser Leben wesentlich mehr und länger, nachhaltiger als das Virus selbst zerstört, sollten Journalisten nicht unbegründet die Angst schüren. Ich schätze die «NZZ» wegen ihrer Ausgewogenheit und Besonnenheit. Warum verstösst dieser Artikel dagegen: Der Nachweis des Virus auf den Oberflächen ist nicht mit seiner Ansteckungsfähigkeit gleich zu setzen. Noch niemand hat sich ohne direktem Kontakt mit diesem Coronavirus angesteckt. Der Fall, dass ein infizierter Mensch auf ein Handy hustet und ein Gesunder dieses sofort berührt und mit den Händen gleich in seine Augen, Nase oder Mund fasst, dürfte extrem selten vorkommen und auch dann ist es nicht sicher, da für die Infektion eine genügend grosse Menge (load) des Virus vorhanden sein muss. Das Preis-Leistung-Verhältnis der Handy Hygiene ist unendlich klein, der Schaden enorm gross."
26.4.20:
Gestern habe ich vom Präsidenten der "Schweizerischen Akademie der Meizinischen Wissneschaften" Professor Tanner Literatur, die zeigt, dass bei den Kindern Es is unglaublich, wie wenig sich richtigen wissenschaftlichen Kenntnisse durchsetzten, wie wenig die Politiker darauf achten und widersprüchliche, falsche, verwirrende und angstmachende Aussagen und sogar Beschlüsse machen. Kann man erklären, warum können die Kinder schon nächste Woche in die Schule. Auch wenn der Unterricht nicht perekt vorbereitet und durchgeführt wäre, ist es besser als wenn sie weiterhin zu hause bleiebn.
Die EU-Komissionpräsidentin von Leyen vekündete heute, man soll die Öffnung der Geschäfte in der EU vereinheitlichen, damit die Einwohner eines Landes nicht in das andere gehen (und as Virus einschleppen). Aber, wenn sie die einfache Grundmassnahmen, Abstand halten und eventuell Maskentragen einhalten, was spricht dagegen. Die Lust der Politiker an Verboten und damit an der Demonstration ihrer Macht? Sie demonstrieren nur ihre Dummheit.
Zum Glück in unserer Familie hat sich Vernunft durchgesetzt: Kinder gehen nach draussen spielen, Nachbarkinder und sogar Erwachsene kommen zum Besuch.
27.4.20:
In der herutigen "NZZ" erschien ein Artikel, zu dem ich folgenden Leserbrief verfasst habe:
"Betr.: Speicher Ch: Wie kommt man gut aus dem Lockdown? NZZ 27.4.2020, S. 14.
Da die gegenwärtige Corona-Epidemie nicht so bald abklingt, ist die Auswahl der richtigen Massnahmen gegen ihre Verbreitung enorm wichtig. Alle unwirksamen beschränken unnötig die Freiheit und belasten die Menschen auch psychisch. Sie vermindern damit die Einhaltung der wirksamen Massnahmen. Wir sollen uns mehr auf die inzwischen reichhaltige Fachliteratur und den gesunden Menschenverstand verlassen, als auf das Jonglieren mit unzuverlässigen Zahlen und Modellen. Im Unterschied zum Spezialisten, Professor Feuerriegel, wage ich als ehemaliger praktischer Arzt folgende grundsätzlichen, allgemeingültigen Empfehlungen auszusprechen:
1. Bei Ansammlungen von Menschen, die nicht in einem Haushalt leben, 2 m Abstand voneinander halten. 2. Wenn ein kleinerer Abstand unvermeidbar ist, Masken tragen. 3. Beim Kontakt im öffentlichen Raum Standort nach >10 Minuten wechseln. 4. Keine Beschränkungen für Kinder Bei Einhaltung dieser Regeln entfällt Absperrung (Lockdown), allgemeine Schliessung von Geschäften und Restaurants, Besucherverbote und auch die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel ist möglich. Das Leben wird dadurch leichter, angstfreier und wirtschaftlich effizienter."
*
30.4.20:
Gestern erschien in der NZZ ein Artikel darüber, wie man sich in den öffentlichen Verkehrsmitteln verhalten und gegen Coronainfektion schützen kann. Mein Leserbrief dazu:
"Betr.: Stalder H: Es braucht ein Maskenobligatorium. NZZ 27.4.2020, S.9.
Um die Benützung des öffentlichen Verkehrs gegen den Coronavirus zu sichern, kann man auch Platz-, bzw. Standwechsel nach Art des «Sesseli-Tanzes» machen. Am Anfang der Epidemie wurde in der Schweiz (richtigerweise) verkündet, dass zur Übertragung des Covid-19-Virus eine gewisse Menge davon nötig ist, somit auch die Dauer des Kontaktes. Damals wurden 15 Minute genannt. Ob es genau stimmt, ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass man leider diesen Einfluss ganz vergessen hat. Beim Vorbeigehen auf Feld- und Waldwegen geraten manche ängstliche Menschen lieber in den Graben, nur damit sie den 2m-Abstand einhalten können, was milde bezeichnet, unnötig ist."
*
4.5.20:
Am 1.5. schrieb ich folgenden Leserbrief der "NZZ" über die (Gesundheit-) Politik:
"Fragliche Coronapolitik
Als einen zwar «eingekauften», aber desto glühenderen Anhänger des schweizerischen politischen Systems, schmerzen mich desto mehr die Irrungen und Wirrungen der Politik im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie. Allem nach dauert sie noch Monate, eventuell flammt sie in einer neuen Welle wieder auf. Mindestens droht man uns mit ihr und dann wieder mit verschärften Massnahmen wie früher den Kindern mit dem Schmutzli. Deswegen ist es angebracht und nützlich, den Spreu vom Weizen zu trennen und das richtige, angemessene und wirksame Vorgehen zuerst zu diskutieren, vorzubereiten und sich um ihre konsequente Durchführung zu bemühen. Dazu kann uns auch der Vergleich mit Schweden dienen.
Sie wurden zu ihrem Weg durch ihre Gesetze gezwungen, die ihnen drastische Beschränkungen der Freiheit, wie die Absperrung, verbieten. Eine Kommission der Schwedischen Gesundheitsagentur (entsprechend unserem BAG), die aus ca. 15 Leuten besteht, diskutierte seit Anfang der Epidemie jeden Morgen die neusten Kenntnisse und änderte ihnen entsprechend das weitere Vorgehen. Zweimal pro Woche sprechen sie auch mit regionalen Behörden. Sie verlassen sich auf Empfehlungen und Überzeugungen statt auf Verbote und Schmutzlis.
Schweden schloss die Grenzen nicht, da die Verbreitung des Virus mehr ein lokales Problem ist. Auch keine Schulen der Unterstufe. Es gibt kein Maskenobligatorium ausser im Kontakt mit Covid-2-kranken Menschen. Beim letzten Anstieg der Kranken und Verstorbenen in Altersheimen in Stockholm suchten sie nach den Gründen, um sie gezielt zu beheben. Diese für uns «frivole», leichtsinnige, unverantwortliche Politik brachte vorläufig keine alarmierenden Zahlen von Kranken und Verstorbenen und trägt zur höheren Durchseuchung der Bevölkerung bei. Damit zu weniger hohen Wellen und vielleicht zu besseren Gesamtergebnissen in Vergleich zu anderen Ländern. Sicher aber belastete sie die Bevölkerung weniger körperlich, seelisch und wirtschaftlich.
Die Politiker überliessen ihre Entscheidungen wie auch die Information der Öffentlichkeit weitgehend auch der Kommission der Gesundheitsbehörde. Dadurch vermieden sie nicht nur unser diesbezügliches «Durcheinander», brachten aber sich und die Wissenschaft nicht in einen lang dauernden Verruf. Es gibt Fachleute für Kommunikation und Verhaltensänderung. Manche unserer Politiker und Wissenschaftler sollten ihre Hilfe in Anspruch nehmen statt die persönliche Profilierung zu betreiben. Der Schuss geht nämlich nach hinten hinaus."
*
Und heute, nachdem ich einen verwirrenden Artilek über Maden gelesen habe, diesen:
"Betr.:Bueche L, Rietz H: Welche Maske ist die richtige? NZZ 4.4.2020, S. 22.
Sehr geehrte Autorinnen,
leider trägt Ihr Artikel mehr zu Verwirrung als zur Auf- und Erklärung der Maskenproblematik bei.
Grundsätzlich: Offensichtlich bemerkten Sie noch nicht, dass verschiedene Institutionen und Personen leider an Glaubwürdigkeit einbüssten, beginnend mit Bundesrat über BAG, Robert-Koch- Institut bis zu manchen Wissenschaftlern. Und zwar nicht durch Änderung ihrer Aussagen, die sind begreiflich, sondern wegen ihrer Widerspüchlichkeit, Inkonsequenz und mangelnder Begründung. Was zählt, sind gut begründete Fakten, an denen es auch in Ihrem Artikel fehlt:
-
Sie benützen den Begriff «Öffentlicher Raum» und aus dem Text kann man entnehmen, Sie meinen geschlossenen Raum. Für die meisten der Leser kann es auch die Strasse, der Platz, der Wald sein, bzw. ist. Dort ist das Tragen der Masken nur in Ausnahmesituationen eventuell nützlich z.B. bei länger dauerndem Kontakt
-
Die Dauer des Kontaktes ist ein Faktor, der bei Überlegungen und Aussagen sträflich vernachlässigt wird. Am Anfang sagte man, wahrscheinlich richtig, 15 Minuten seien nötig, um eine genügende Menge des Virus zu übertragen.
-
Das heisst auch, eine der vergessenen, aber vermutlich sehr wirksamen Massnahmen, wo auch der Standort-, der Platzwechsel (auch im geschlossenen öffentlichen Räumen wie Bus, Zug) stattfindet.
-
Es gibt keine Ansteckung ohne direkten Kontakt mit den Kranken (lassen wir ausser acht die anfänglichen von irgendwelchen Tieren). Das heisst auch nicht über Gegenstände, Luft (ohne Tröpfchen, z.B. in Zimmern von Kranken), Wasser. So auch nicht von einer Berührung der Masken. Der Grund ist eben die Menge des Virus und seine kurze Ansteckungsgefahr. Sein Nachweis ist kein Beweis, dass es ansteckend ist – allem nach ist es eben nicht.
-
Die Desinfektion von Masken oder anderen Gegenständen ist im Falle der Covid-19-Viren ein überflüssiges Ritual. Es reicht eine normale Reinigung (mit Seife der Hände) der Gegenstände oder sie einfach stehen lassen. Nach 72 Stunden sind die Viren nicht einmal mehr nachweisbar.
-
Können Sie bitte begründen, noch besser Beweise erbringen, dass die Masken von der relativ konzentrierten Menge der Viren in der ausgeatmeten Luft (einigermassen) schützen sollen, nicht jedoch diejenige der schon um Potenzen dünner der weit entfernten Personen?
-
Ich habe zu Beginn der Epidemie von unseren Epidemiologen verlangt, dass man eine relativ einfache Versuchsanordnung durchführt, die weitgehend Klarheit über die Wirksamkeit der verschiedenen Maskentypen bringen würde. Bisher vergebens. Ich erlaube mir, den Leserbrief beizulegen, der in der neuen Nummer der «Schweizerischen Ärztezeitung erscheinen soll.
Ich wünsche Ihnen für Ihre verantwortungsvolle weitere Arbeit viel Erfolg und verbleibe
mit besten Grüssen
Peter Marko"
*
Inzwischen sind mehrere interessante Fachartikel erschienen. Einer regt aus, und zwar über Übertragung des Virus und Zeitverlauf der klinischen Symptome von Taiwan. Sie untersuchten , wie sich es von den ersten 100 Patienten weiter verbreitete und wer , wie gelitten hat. Die Wichtigsten Kenntnisse:
1. Da sich das Virus bereits schon vor der Erkrankung und während der ersten 5 Tage, wie AUVON Menschen ohne Krankheitszeichen ohne vverbreiten, ist die alleinige Isolation der Patienten kein wirksame Massnahme.
*
10.5.20:
Leider habe ich mehrere Tage pausiert. Es erschienen viele Fachartikel, die ich lesen wollte. Und oh, Wunder, auch mein letzter "NZZ"- Leser bief in leicht gekürzter Fassung, die nicht unterstrichenen Zeilen wurden ausgelassen. (Diese Textänderung ist die einzige, die ich nachträglich getan habe, ausser den grammatikalischen, die Silvia noch vornimmt.)
*
Irgendwie scheint mir überflüssig, die einzelne Kenntnisse zu präsentieren und kommentieren, da sich langsam zeigt, welche Massnahmen wichtig sind. In allen Ländern vermindert sich die Zahl der Kranken und Infizierten, ihre Kurve flacht sich ab. Es bleibt der grosse Unterschied in ihrer Menge. Langsam sieht man die Gründe dafür:
-
Der Zustand des Gesundheitssystems und der Versorgung der alten Menschen (Alters- und Pflegeheime). Die Zahl der Patienten und Bewohner in einem Zimmer
- Einhaltung der einfachen Grundsätze der Seuchenbekämpfung, wie Isolierung der kranken und Schutzmassnahmen bei Umgang mit ihnen.
-
Je früher man die Massnahmen ergreift, desto besser. Ein Frühwarnsystem wichtig.
- Distanzhaltung ist vor allem beim Kontakt in geschlossenen Räumen nützlich, wie auch
- Tragen der Masken. Sie sollen sonst nur die gefährdeten Menschen benützen.
Die Absperrung ist nutzlos und bringt die grösste psychische, körperliche und wirtschaftliche Schäde mit sich. So auch Schliessung der Krippen, Kindergarten, Kittas, Unterstufen der Schulen. Die Desinfektion der Gegenstände ist im Falle von Covid-19-Virus überflüssig.
Diese Feststellungen sind sehr wichtig, weil man die zweite Welle der Corona-Epidemie erwartet. Bei Epidemien mit anderen Viren braucht man so schnell wie möglich seine Eigenschaften wissen. So wusste man von Anfang an, dass Coronaviren nicht oder weniger ansteckend sind als Noroviren. Da man lokalen Bedingungen und lokaler Verbreitung des Viren entsprechend handeln soll, frage ich mich, ob die Lockerung nicht schneller erfolgen sollte in Anbetracht der gegenwärtig kleinen Zahl der Infizierten.(<50) in der Schweiz. Heute vernahm ich, dass Geschäftsleute wieder ins Ausland reisen dürfen. Die Schweden haben die Überschreitung der Grenzen nie verboten. Die Zahl der Infizierten ist nicht wesentlich höher als bei uns. Dafür gingen sie den Ursachen nach und fanden in schlechten Umgang mit Infizierten in Altersheimen in der Region um Stockhol, was sie sofort gezielt änderten, ohne die Massnahmen überall zu "verschärfen", was man auch unter dem versteht.
*
Wie erwartet, leider steigt die Unzufriedenheit der Bevölkerung in Deutschland mit der Corona-Politik. Wie wird es in Italien, Frankreich und Spanien, wenn die echte Gründe des Versagen auf den Tag kommen?
*
11.5.20:
Meine Hoffnung, die Situation wird sich weitgehend "normalisieren", bekam einen schmerzhaften Schlag: Es wurde bekannt, dass in Südkorea, die so erfolgreich mit wenigen Toten mit dm Coronavirus umgegangen ist, wieder eine kleine Epidemie ausbrach, nachdem ein Infizierter mehrere Bars besuchte. Dann ist das Virus doch nicht so gut mutig und wird uns länger belasten. Desto wichtiger ist, länger ertragbare und wirksame Massnahmen zu ergreifen und unnötiger Ballast abzuwerfen. Es war tragikomisch gestern in der "Tagesschau" zu sehen, wie Angestellte der "SBB" die Einrichtungen desinfizierten als Vorbereitung für den normalisierten Betrieb. Eine PR-Aktion, die über Unbelehrheit und Dummheit zeugt.
*
Also beende ich doch die Lehren aus Taiwan, die ich began zu beschreiben am 4.5. (s. o.) :
1. Da sich das Virus bereits schon vor der Erkrankung und während der ersten 5 Tage, wie AUVON Menschen ohne Krankheitszeichen ohne verbreiten, ist die alleinige Isolation der Patienten kein wirksame Massnahme.
2. Das Virus verbreitet sich bei Patienten, also Kranken, in den ersten 5 Tagen nach Beginn der Beschwerden (Symptome).
3. Das Virus verbreitet sich vor allem in den Familien, ob sie zusammen leben oder nicht, also bei längerdauernden engen Kontakt.
4. Ungefähr 5 Mal weniger in Einrichtungen des Gesundheitswesen und 40-50 Mal weniger sonst!
5. Junge (65 Jahre) werden weniger oft infiziert als die "mittelalte" (20-64 jährige).
*
"Die Ungewissheit, was man darf und was nicht, ist ein Faktor, der bei vielen für Verunsicherung sorgt " R. Schifftan, Psychologin in der NZZ vom 11.5.20, S. 10. Die ganze Zeit bemühe ich mich sowohl bei Nächsten, wie in der "NZZ" und "SÄz" diesen Faktor zu mindern.
*
uarantene Internet NZZ Bedürfnis nach Nähe
Machtgefühl
Achtsamkeit
Kassandrarufe
Impfungen

Schon während des Studiums war ich Mitautor von zwei wissenschaftlichen Veröffentlichungen im Bereich der Biochemie (1,2). Nach der Promotion folgten weitere mehr als drei dutzend. Ich wollte etwas Bedeutendes für die Menschheit entdecken, etwas Wichtiges tun. Als Assistent des Biochemischen Instituts beteiligte ich mich an der Ausbildung von neuen Aerzten. Die pädagogische Tätigkeit machte mir Spass.
Nach der Emigration, merkte ich, dass ich trotz der besseren Arbeitsbedingungen ein «gewöhnlicher Arbeiter im Weinberg der Wissenschaft» blieb und mir die Arbeit im geschlossenen Raum sowohl des Labors, wie der Wissenschaft, das lange Warten auf einen eventuellen Erfolg nicht (mehr) entsprach. Ich holte meine klinische Ausbildung nach, während der ich auch eine Balint-Gruppe besuchte und wurde ein Allgemeinarzt, der gerne Hausbesuche machte und als Gipfel der Tätigkeit die Betreuung der ganzen Familie betrachtete (3). Gerne hatte ich Fälle mit unklaren Diagnosen, die ich mithilfe der Literatur (damals ohne Internet) und Überweisungen zu Spezialisten versuchte zu lösen, ein Rudiment der wissenschaftlichen Arbeit. Sowohl die Reihenuntersuchungen der Vereine, wie die eintönigen Grippesaisons befriedigten mich schon weniger. So weit, so gut.
Vom Geschriebenen kann man spüren, dass ich ein Mensch bin, der ändern, bessern möchte, wozu der ärztliche Beruf ununterbrochen Gelegenheit bietet. Aber fast so häufig braucht man dazu Geduld und Verständnis für die Ansichten, Gefühle, Lage und Grenzen der Patienten und der eigenen Wirkung. Da blieb ich der „vernünftige“ Wissenschaftler. Die extreme Situation der Kinderärzte könnte ich nicht ertragen, wenn die Eltern eine nötige Behandlung des Kindes ablehnen und damit das Kind für das ganze Leben schädigen oder sogar seinen Tod verursachen. Sicher spürten auch Erwachsene mein Missbehagen, wenn sie sich nicht an meine gut gemeinten (und von mir aus) auch so begründeten Empfehlungen hielten.
Sicher habe ich mehr Patienten durch meine übertriebene (väterliche) Fürsorge verloren als durch Vernachlässigung und schlechte Behandlung. Ein Beispiel waren Patienten mit Herzkrankheiten oder anderen potentiell gefährlichen Zuständen, die Ferien in Ländern mit zweifelhafter Gesundheitsversorgung, nicht selten noch mit einem längeren Flug verbunden, verbringen wollten. Dafür hatte ich kein Verständnis und versuchte ihnen, meistens vergebens, ihren Wunsch mit Vernunftsargumenten auszutreiben. Die Angst, dass ich für die eventuellen Schwierigkeiten und Schäden, mitverantwortlich wäre, spielte sicher auch eine Rolle.
Meine Fürsorge um leidende Frauen kannte (fast) keine Grenzen. In den Balint-Gruppen, denen ich jeweils trotz wechselnden Wohnsitzen immer wieder angehörte, waren solche Fälle das Hauptthema meiner Fallvorstellungen. Und immer wieder wurde mir bewusst, dass ich, ohne Grenzen zu setzen, «mitagiere» und den Zustand meiner Patientinnen trotz grossem Einsatz nicht besserte. Die Gründe dafür versuchte ich in einer persönlichen Psychotherapie zu finden. Einer davon ist, dass ich Leid und Leiden aus der eigenen Geschichte kenne, der andere das Helfersyndrom. Unter diesem litt mehr meine Familie und meine Patienten als ich. Das Gefühl der Stärke, der Überlegenheit tat mir (und tut) gut. Eben, die Grenzen zu halten, die weise und vornehme Zurückhaltung, das Abwarten der richtigen Zeit, die richtige Dosierung meines Zuhilfekommens fällt mir schwer.
Ende der 60-er Jahre arbeitete ich im Physiologischen Institut der Universität in Freiburg i.Br. als Humboldt-Stipendiat. In der Zeit war es das einzige Institut für Parapsychologie in Deutschland, vielleicht in ganz Europa. Ich besuchte die überfüllten, öffentlich zugängigen Vorlesungen von Professor Bender. (Später wurde er nicht durch das Fachgebiet, sondern seine persönliche Geschichte umstritten.) Auch diese Neigung zur Metaphysik führte mich zur «Metamedizin» - zur Komplementärmedizin. Ich bildete mich in Homöopathie aus, die mir einen anderen Zugang, eine andere Sichtweise der Krankheiten vermittelte, und begann auch mit Akupunktur. Aber die Suche nach den vielen Punkten war zu fein für mich. Meine Frau leidet unter Nahrungsmittelallergien. Es ist nicht einfach zu wissen, welche Speisen oder deren Bestandteile die Beschwerden verursachen. Ein ehemaliger Kantonschemiker, mit dem ich Ansichten über Osteoporose als Folge der säureproduziernden Nahrung teilte, wies uns auf die Möglichkeit kinesiologischer Prüfung hin. Wir begannen uns in der angewandten Kinesiologie auszubilden. Sie hilft nicht nur körperliche aber auch seelische Schwierigkeiten zu bessern. Sie ist eine der körperbetonten Therapien, deren Bedeutung steigen wird. In der Tat, sie half u.a. meiner Frau die „schuldigen“ Einflüsse zu erkennen. Sie meidet sie und dadurch besserten auch ihre Beschwerden von Urtikaria bis Herzrhythmusstörungen. Hätte ich diese Methode der immer mehr verbreiteten «body-mind- therapien» schon früher gekannt und in der Praxis angewandt, wäre ich ein besserer Arzt gewesen.
Mit dem Fortschreiten meiner Karriere als Patient stört mich etwas bei meinen Ärzten, was ich selber als Arzt auch tat: Sie sprechen bei Untersuchungen mit ihren Helferinnen und Helfern, Kolleginnen und Kollegen über Befunde und weitere Vorgehen beabsichtigt so leise, dass ich es nicht verstehen kann und offensichtlich auch nicht soll. Warum tun wir es (unbewusst)? Schon als Kinder lernen wir doch, dass es unhöflich ist. Wir verhindern damit die unmittelbaren natürlichen Erklärungen und Gespräche darüber und erfahren nicht, was Patienten interessiert. So kann in ihnen Verunsicherung, Misstrauen und Angst keimen. Fürchten wir der Spontaneität nicht Herr zu werden? Die späteren Besprechungen unter «ruhigen, geordneten Umständen», zu denen wir «vorbereitet» sind, können es aber kaum wiedergutmachen. Die Beziehung bekam einen Kratzer. Oh, wie einfältig war ich eigentlich!
1 Niederland TR, Dzurik R, Kovaes P, Hostyn L, Marko P: Dynamische Aenderungen der Lipidfraktionen in der Niere und Lunge nach grossen Dosen von Salicylaten. (slowakisch). Bratisl Lek Listy 1959;39:732-7.
2 Niederland TR, Kovacs P, Dzurik R, Hostyn L, Marko P: Dynamische Änderungen der Lipidfraktionen in Leber nach grossen Dosen von Salicylaten. (slow). Cas Lek ces 1960;99:98-101.
3 Marko P: Familienarzt, Familientherapie und ein Fall. Psychosom Med 1980;9,238-44.

Philosophieren heisst sterben lernen.
Michel de Montaigne
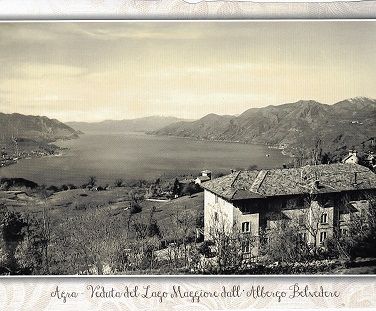
(1) Hotel Belvedere in Agra (Italien) vor geraumer Zeit
In Zweisimmen genossen wir eine Ferienwohnung im nicht weit entfernten Montreux. Vor dem Umzug nach Romanshorn haben wir sie schweren Herzens verkauft, da sie vom neuen Wohnort zu weit und zu mühsam zu erreichen gewesen wäre. Und in Romanshorn hatte ich den See zum Windsurfen 300 Meter entfernt. Unsere Kinder wurden schon während des Studiums selbständig und führten ihr eigenes Leben. Sie kamen selten nach Hause. Es wurde uns klar, dass unser schönes Haus zu gross für uns wäre. Nach diesen guten Erfahrungen mit der Wohnung in Montreux suchten wir nun etwas in einer wärmeren Gegend, wo wir nach der Pensionierung auch länger leben könnten. Von meinen Fortbildungskursen kannten wir das Tessin. Bei einem der letzten lasen wir eine Anzeige über eine Wohnung in einem umgebauten Hotel Belvedere in Agra oberhalb vom Lago Maggiore auf der italienischen Seite des Monte Lema, in dem auch Papst Johannes XXIII. einmal seine Ferien verbrachte. (Den Blick auf den Lago Maggiore kann man im Vorwort und Epilog sehen.) Wir bereuen keinen Augenblick, dass wir die Wohnung erworben haben. Wir verbringen dort so viel Zeit, wie es uns die Umstände erlauben und gehen selten anderswo in Urlaub. Die Gegend um Agra wurde unsere zweite Heimat. Auch die Kinder und Enkelkinder verbringen dort, nicht selten auch mit uns, gerne ihre
Ferien.
(2) Condominio Belvedere mit 32 Wohnungen in Agra (Italien)

Erlauben Sie mir, lieber Herr Kollege Taverna, vielleicht nicht nur in meinem Namen, sondern auch anderer Greise, Grufties, Senioren (ich stehe im 73. Lebensjahr, also bin ich schon älter als Frau B. aus Brechts Kalendergeschichte, die Sie anfangs Ihres Artikels erwähnen) zu Ihren Überlegungen und Ausführungen Stellung zu nehmen. Ich bin Ihnen ausgesprochen dankbar, dass Sie mir Anlass zum Sammeln und Formulieren meiner Empfindungen und Gedanken zu diesem Thema gegeben haben.
Ja, ich crawle und schwimme auf dem Rücken, fahre Ski, wandere, übe fast jeden Morgen und achte eifrig, fanatisch, fast zwanghaft auf meine Ernährung. Ich arbeite auch noch. Warum? Ich tue das alles zwar viel langsamer, schwächer, aber mit grosser Freude, Befriedigung, Genugtuung und Dankbarkeit, dass ich es immer noch tun kann, dass ich es schaffe, ähnlich dem Kind, das sich freut, dass es schon greifen, laufen, sprechen kann. Wissen Sie, wie schön es war, der Enkelin das Skifahren und Schwimmen beizubringen, sie dabei zu begleiten, ihre Freude und ihren Stolz zu beobachten, mit ihr zu wandern? Kann man es mir übel nehmen, dass ich gerne, wenn es mir vergönnt sein wird, auch mit den weiteren Grosskindern all dies erleben möchte, und mich bemühe, meines zur Erfüllung dieses Wunsches beizutragen? 
(1) In Macugnaga mit Alexa
Die Wanderungen sind ein besonderes Erlebnis. Während der vollen Berufsjahre haben wir wenig Zeit dafür gehabt. Jetzt entdecken wir neue Wege oder schreiten die alten ohne Eile in gemächlichem Tempo, weil es nicht mehr darum geht, wie schnell wir einen Weg schaffen, sondern es uns freut, dass wir es überhaupt noch können. Dabei vertiefen wir uns in und kauen an den frei schwebenden Gedanken und Erinnerungen. Es gibt für uns keine bessere Ablenkung von den täglichen Sorgen, Problemen, eine bessere Erholung.
Nicht nur von anderen Altersgenossen, denen es leider nicht gegönnt ist, so aktiv zu bleiben, weiss ich, dass es nicht selbstverständlich ist. Auch ich erlebte Zeiten, als die Nerven in der Lenden- und dann Halswirbelsäule eingeklemmt waren und meine Bewegungsfreiheit stark beschränkt war. Seither lernte ich besser crawlen und Rückenschwimmen, weil das Brustschwimmen immer noch zu Beschwerden führt. Aber wissen Sie, lieber Herr Kollege Taverna, wie schön es ist, in dem Weiher oberhalb unserer Stadt unter den über dem Wasser hängenden Ästen der Uferbäume auf dem Rücken neben den Enten zu schwimmen, und am frühen Morgen die oben zwitschernden Vögel dabei zu beobachten? Jahrelang litt ich auch unter den trotz mehrerer Operationen schmerzhaften Leistenbrüchen. Jetzt, nach der laparoskopischen Operation mit Netz kann ich wieder unbeschränkt Lasten heben, mich bewegen – ich bin jünger, leistungsfähiger geworden!
(2) Unterwegs zum Wasserfall
Wir achten sehr auf die Ernährung. Auch dieser Bereich ist im Alter empfindlicher und weniger belastbar. Man sollte sich dem anpassen. Wir merken, was uns nicht gut tut, korrigieren es und bemühen uns, das Gewicht zu halten, weil wir mit jedem Kilo spüren, wie wir uns schwerfälliger bewegen.
Ich arbeite mit der Hilfe meiner Frau noch. Anders als früher. Wir haben keine Apparate, aber Zeit für die Patienten. Ich treibe einen psychosomatischen, bioenergetischen Zugang zu ihren Problemen, mit gezieltem Ausgleich von Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen, wenn sie fehlen, und einer gesunden, einfachen, abwechslungsreichen Ernährung als unabdingbare Voraussetzungen für Heilung und Gesundheit. Ich versuche den Patienten auch meine Einstellung zur Bewegung und zur Lösung der Probleme zu vermitteln. Davon leben könnten wir aber sicher nicht.
Vor kurzem habe ich ein neues Auto gekauft. (Das kleinste Modell einer Firma. Für unsere Bedürfnisse reicht es vollständig, da wir dank dem GA der SBB längere Strecken mit der Bahn fahren.) Dabei wurde mir bewusst, dass es der letzte Wagen meines Lebens ist. Unterschwellig ist diese Bedrohung, Mahnung, dieses Gefühl eigentlich ständig da. Weiss ich, ob ich noch ... ? Selbstverständlich werden sich meine Fähigkeiten und Möglichkeiten weiter verringern. Wenn ich einmal auf diese Tätigkeiten ganz verzichten müsste und noch geistig fähig wäre, würde ich mich freuen, wenn meine Frau sie dann auch für mich geniessen und mir ihre Erlebnisse mitteilt würde.

(3) Oberhalb vom Lago Maggiore
Sie befürchten, dass wir Senioren das alles (nur) unter Druck tun, weil uns sonst vorgeworfen wird, unnötig Kosten für unsere Behandlungen zu verursachen. Diesem „sozialen Druck“ möchten Sie uns nicht aussetzen. Wie ich geschildert habe, bewege ich mich hauptsächlich für mich und meine Nächsten. Aber ich bin froh, dass ich dabei auch die Allgemeinheit, die „Mitmenschen“ möglichst nicht unnötig belaste, wie ich im Treppenhaus, auf der Strasse und in der Natur meine Abfälle nicht hinterlasse, den gemeinsamen Besitz nicht schädige. Wie wir aus neueren Untersuchungen wissen, beeinflusst unser Verhalten die Verbreitung vieler guter und schlechter Gewohnheiten auch im gesundheitlichen Bereich. Auch Dank dem sozialen Druck und der entsprechenden Aufklärung erreichten wir unseren hohen hygienischen, gesundheitlichen und zivilisatorischen Zustand. Kann man ihn bei Bemühungen um Änderungen, Fortschritt überhaupt irgendwie „weglassen“? Dasselbe betrifft die Bedeutung der finanziellen Anreize. Im Gesundheitsbereich denken wir dabei vorwiegend an „Strafen“, auch wenn Belohnung, z.B. bei einer (dauerhaften) Gewichtsabnahme wirksamer ist als andere Massnahmen. Die Kraft der (schlecht gestalteten) finanziellen Anreize, der Boni, wurde uns vor kurzem demonstriert.
Sie zweifeln auch, ob wir die üblichen hohen Kosten der letzten sechs Monate des Lebens sparen, wenn wir es auf gesunde Weise verlängern. Während meiner jahrzehntelangen Praxis habe ich oft mit alten Menschen zu tun gehabt, die sich nicht um den Tod sorgten, sondern um das Leiden dabei, um die Abhängigkeit, um das „zur Last fallen“, um den „Anschluss an Schläuche und Maschinen“. Ich habe ihnen, meine Mutter eingeschlossen, immer wieder gesagt, je länger sie leben, desto schneller und leichter kommt der Tod. Es ist sowohl körperlich wie psychisch begründet. Ein Mensch in den Siebzigern, noch nach dem Leben hungrig, nimmt eher in Kauf, dass von der Allgemeinheit tausende Franken für die Verlängerung seines Lebens um ein paar Monate ausgegeben werden, als ein Neunzigjähriger. Aber ich habe auch über achtzigjährige Patienten gehabt, die sagten, das Jahr nach der Operation des Magenkrebses bis zum Tod sei trotz des Leidens sehr schön und wertvoll für sie und ihre Angehörigen gewesen. Ja, mit den Jahren ändert sich die Einstellung zum Leben und zum Tod.
Ich weiss, dass je länger man lebt, desto länger man die Rente bezieht. Ich denke, mit der Zeit werden wir immer mehr schätzen, wenn wir den Möglichkeiten und Fähigkeiten entsprechend länger arbeiten können. Zum Leben, zum Menschsein gehört auch nützlich sein, etwas (nicht nur sich) bewegen, wirken, ändern, einen „Lebenssinn“ haben. Solche kulturellen Änderungen geschehen manchmal relativ schnell. Z.B. bei der jungen Generation steigt die Geburtenrate, weil sie begriff, dass zu einem erfüllten Leben auch Kinder gehören. Durch neue Erkenntnisse und Umstände wurden wir aus dem Paradies der Sorglosigkeit auf die Erde der Verantwortung vertrieben. Es wird uns nicht mehr vergeben, weil wir inzwischen wissen, in meiner Kindheit war es noch nicht so, dass Rauchen, falsche Ernährung, wenig Bewegung und Umweltverschmutzung unsere Gesundheit wesentlich beeinträchtigen und das Leben verkürzen. Die kurativen Massnahmen dagegen sind immer teurer, nebenwirkungsreicher und ihre Kosten kann kaum jemand selbst tragen. Das war vor nicht allzu langer Zeit auch nicht so. Deswegen ist die Vorbeugung so wichtig. Zugegeben, sie ist für viele Leute naturgemäss nicht leicht, aber auch nicht unmöglich. Wir sollen ihnen dabei wirksam helfen, aber sie nicht bestrafen. Neuerlich geben (noch nicht in der Schweiz) die Rentenversicherungen den Rauchern und Übergewichtigen Boni (gibt es eine bessere Warnung vor diesen Gefahren?). Wieso sollten Krankenkassen sie den Nichtrauchern und den Normgewichtigen nicht auch gewähren?
Ich glaube, aus verschiedenen guten Gründen wird die Schweiz bei der neuen Einstellung zu Chancen, Aufgaben, Pflichten, Genüssen und Würde des Alters weiterhin eine Vorreiterrolle spielen.
Schweiz Ärztezt. 2009;90:2024-5.Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH.


Diese feindliche, angespannte Atmosphäre führt dazu, dass der Schwamm schneller Schaden nimmt. Und hier sind wir beim wunden Punkt des sonst ausgezeichneten Artikels: Der Schwamm geht nicht kaputt wegen der Feuchtigkeit. Nach dem Gebrauch lege ich ihn auf eine kleine Plastikschale. Dort trocknet ihn die Luft bald von oben und unten. Seine traurige Vergänglichkeit ist mechanisch verschuldet. Bedenken Sie, dass auch Titangelenke und ihre armen Träger unter Abrieb leiden. Im Grossen und Ganzen ist der Abwaschschwamm (schon diese schöne Bezeichnung!) ein klarer Beweis, dass die Zivilisation nicht nur Nachteile bringt.
Neue Zürcher Ztg 2016;

Ob wegen meines «grünen» Gewissens, der durch die Fahrt verlorenen Zeit oder der Ansicht, dass ich mich erst richtig am neuen Ort einlebe, wenn ich dort auch einen Coiffeur finde, wechselte ich zur nächsten Coiffeuse um die Ecke. Sie hatte immer einen freien Termin, dafür musste man manchmal fast eine Stunde warten. Wenn endlich ein Stuhl frei wurde, band mir zuerst eine Lehrtochter ein Tuch um den Hals und ich wartete weiter, bis die Chefin bei anderen Kunden oder Kundinnen mit ihrer Aufgabe fertig war, dann fummelte sie kurz an meinen Haaren herum, um die Arbeit wieder einer anderen Lehrtochter zu überlassen. So wartete ich wieder, bis sie kam. Solche Zyklen wiederholten sich. Es lief wie mit Privatpatienten in manchen Operationssälen, nur hier wurde man nicht betäubt und nahm das Geschehen scharf wahr. Einmal wagte ich schüchtern anzudeuten, dass bei mir die Lehrtochter ruhig die ganze Arbeit verrichten könne, was schlicht überhört wurde. Während der kurzen Abschnitte, die sie bei einem verbrachte, fragte und sprach die Chefin ununterbrochen. Als ich versuchte, in der mitgebrachten Zeitung zu lesen, spürte ich ihren Unwillen, was für ein unfreundlicher und unhöflicher Sonderling da sitzt. Beim Zahlen fragte eine der Lehrtöchter jeweils die Chefin (nicht mich), wieviel sie verrechnen solle, und obwohl die Länge meiner Haare von Fall zum Fall kaum um 2–3 mm änderte und die Frisur gleich blieb, wechselte die Grösse der Rechnung hin und her. Das schlimmste war, dass die Lehrtochter jedesmal auch meine Augenbrauen zurechtzuschneiden versuchte. Ich verstand nicht, warum sie mit ihnen, damit eigentlich mit meinem Aussehen unzufrieden war, betrachtete es als eine grobe Einmischung in meine Intimsphäre und Persönlichkeit und lehnte es strikte ab. Ich kam, um meine Haare zu schneiden und nicht um kosmetische Eingriffe über mich ergehen zu lassen.
So blieb mir nichts anderes übrig, als zu probieren, wie die nächste Coiffeuse ist, die ein Stück weiter ihren Salon hatte. Sie arbeitet alleine, man muss trotzdem oder eben deswegen nie warten, der Preis ist stabil und sogar um ein Viertel tiefer. Sie wäscht aber zuerst meinen Kopf, damit sie die Haare gut schneiden kann. Ich muss also vorher mühsam planen, wann ich sie selbst wasche, damit sie unter dem zu häufigen Waschen nicht leiden und noch spröder werden, als sie schon sind. Ihr Schnitt ist, wie es früher im Militär oder in Strafanstalten üblich war, was den Vorteil hat, dass ich die Frequenz der Besuche bei ihr ungefähr um die Hälfte senken konnte. Es dauert aber jeweils zwei Wochen, bis ich wieder etwas zivilisierter aussehe. Anfangs versuchte sie am Ende der Behandlung meine Haare mit einer stark und mehrere Tage riechenden Salbe einzuschmieren, wovon ich sie, im Unterschied zum Haarewaschen, abbringen konnte.
So war ich froh, als ich erfuhr, dass zwei Dörfer tiefer unten im Tal, wo wir die Ferienwohnung haben, ein Coiffeurgeschäft existiert. Ich kann dort mit dem Bus hinfahren, aber noch lieber laufe ich eine Stunde hin und zurück. Der Wanderweg führt entlang der vor Jahrhunderten angelegten Terrassen im Wald mit zerfallenen Rustici, an einem grossen Gehege vorbei, in der manchmal Pferde grasen, durchquert rauschende Bäche und Lichtungen, auf denen im Sommer Schmetterlinge schwärmen. Kitschig, aber wahr, die Vögel singen dazu, und im Frühjahr ruft der Kuckuck. Die Wildschweine wühlen die Erde manchmal auf. Ende Mai muss man zwischen echten und falschen Erdbeeren unterscheiden, im Juni sind Himbeeren fällig, später Brombeeren. Auch die Düfte wechseln ständig. Den ganzen Sommer hindurch bange ich, ob sich die schmalen gelbgrünen Stengel der Kastanienblüten rechtzeitig in die runden dunkelbraunen Marroni umwandeln. Sie schaffen es jedes Jahr. Noch vor den Marroni sammle ich die Walnüsse. Im Winter polstern den Weg die noch nicht verwehten Blätter, und man hat freien Blick durch die Bäume auf den See.
Diese Coiffeuse schneidet die Haare unheimlich schnell. Ich kann kaum die neusten Sportresultate in der Zeitung durchschauen, schon ist sie fertig. Die Frisur ist trotzdem perfekt. Unmittelbar vor den Feiertagen sollte man aber nicht zu ihr gehen, da die älteren Frauen und Männer aus dem ganzen Tal bei ihr Schlange stehen und sitzen, sowie heftig und laut Neuigkeiten oder Ansichten austauschen. Leider können wir nicht immer den Aufenthalt dort der Länge meiner Haare anpassen. So kehre ich ab und zu zur Coiffeuse am Wohnort zurück. Sie wundert sich heimlich, warum ich so lange pausiere und doch immer wiederkomme. Wie soll ich es ihr sagen?
Schweiz Ärzteztg 2008;89:542-3. Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH.

Vor einigen Jahren feierten wir Ende Juni die Hochzeit unseres Neffen auf der Alpe Roccolo am Hang des Tals zwischen Due Cossani und Curiglia.Um die vorletzte Jahrhundertwende wurde dort eine Villa als herrschaftlicher Sommersitz am oberen Rande einer grossen Wiese gebaut. Wie von Monteviasco hat man einen herrlichen Blick ins Tal mit den am gegenüberliegenden Hang angeklebten Dörfern, von einer Stelle aus sieht man sogar den See. Obwohl die Villa jetzt zweckentfremdet als bäuerlicher Betrieb dient, blieb das Gebäude unverändert und behielt seinen Charme. Fast das ganze Jahr ist es samt Pergola mit verschiedenen Blumensorten reichlich geschmückt.

(1) Alpe Roccolo Seiteneingang
In der warmen Zeit, die hier ziemlich lange dauert, sitzt man draussen im Schatten der Kletterreben an einfachen Holztischen. Es kommen und gehen mehrere Katzen und Hunde, die zu gut erzogen sind, als dass sie, wie anderswo nicht selten üblich, einen mit Betteln ständig beim Essen stören. Im Stall und auf der Wiese kann man Pferde, Esel, Kühe, Ziegen, Kaninchen, Hühner, Truthähne, Gänse und Enten
antreffen – ein Paradies auch für kleine Kinder, das an die Arche Noah erinnert. 
(2) Vorbereitung zur 1. Augustfeier
Das Fest dauerte schon mehrere Stunden, man konnte schon längst die Sterne sehen. Die Wirtsleute mussten am nächsten Morgen früh in den Stall. Die Müdigkeit, verstärkt durch eine Menge Wein, schlug auf meine Augen, aber niemand von den anwesenden Abstinenten, die alte oder faule Hochzeitsgäste mit dem Auto auf dem kurvigen und holprigen Weg nach oben auf die Alp gebracht hatten und auch wieder zurück nach Hause transportieren sollten, wollte schon aufbrechen. Ich entschied mich, den schönen, direkten Waldweg, auf dem wir zu Fuss nach oben gekommen waren,
(3) Erwachsne feiern 1. August auf Roccolo
wieder zurückzuwandern, was allgemeine Empörung hervorrief: «Jetzt nachts, ohne Licht, alleine durch den Wald?» Ich solle vernünftig sein und schön warten, bald gingen auch andere nach Hause. Ich liess mich nicht umstimmen. Am unteren Ende der Alp bog der Weg in den Wald ab. Plötzlich sah ich unzählige kleine Lichter herumschwirren, blinken, auf mich zusteuern, dann ihren Flug plötzlich ändern. Es waren Glühwürmchen, die ich in dieser Gegend schon hie und da in den Büschen am Wald oder Wegrand beobachtete, aber nie so viele und so muntere. Jetzt war ich in ihrer Mitte, von ihnen umgeben, umschwärmt. Sie tanzten und tobten. Auf einer Lichtung schien es, als ob eine grosse Stadt ihre reichhaltige, bunte Weihnachtsbeleuchtung hier einlagerte und sie vergass abzuschalten. Sie blitzten sogar an einer Stelle mit zwei beleuchteten Häusern. Als ob sie sich von mir verabschieden wollten, am Ende des Weges in einem dichten Waldstück war es fast am wildesten, am schönsten – dann endete die Vorstellung. Ich war von ihr so eingenommen, dass ich vergass, auch einmal zu den Sternen zu schauen. Ich dachte, oh mein Gott, was für ein Naturwunder!
(4) Auf Alpe Roccolo
Zu Hause merkte ich, dass mir der Schlüssel fehlte. Ich wartete vor dem Haus und sah, dass auf dem See unten das traditionelle Feuerwerk zum Peter und Paul Tag voll im Gange war. Künstlich arrangiert, geordnet, schien es mir jetzt gewöhnlich und nichtig im Vergleich mit dem Natürlichen, Wilden, Chaotischen, aber Zweckmässigen, das ich soeben im Wald erlebt hatte. Nach einer langen Weile erschien meine Frau mit dem Auto und den ersten Gästen, die zum Aufbruch bereit waren, und vor allem mit dem Schlüssel. Ich hätte dort oben auf der Alp lange warten müssen. Endlich wurde meine Sehnsucht nach dem Bett erfüllt. Als Hochzeitsgeschenk durfte das frischgebackene Ehepaar auf der Alp übernachten, damit sie ohne Rückweg ins Bett gelangen, dort genug lange verweilen und ausschlafen konnten. Die Hochzeitsnacht des Ehepaares dauerte aber nicht viel länger als diejenige der Glühwürmchen.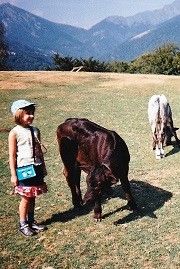
(5) Alexa auf Alpe Roccolo
Wir waren noch nicht wach, als sie bei uns unten erschienen – das Krähen des Hahns und die Geräusche anderer Tiere und der Menschen, die sie versorgten, liessen sie nicht länger schlafen. Die ungefähr zwei Flitterwochen der Glühwürmchen, während der sie strahlen, um den Partner anzulocken, dieses Naturwunder wird immer wertvoller, da sie sehr empfindliche Wesen sind und leider, wie die von mir heiss geliebten Walderdbeeren, zu den bedrohten Spezies gehören.
Schweiz Ärzteztg 2011;92:913 . Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH.


(1) Blick von Alpe Roccolo auf Curiglia
Wir steigen noch zu Fuss, wenn auch immer langsamer, hinauf. Auch die engen Gassen in Monteviasco sind mit Steinen gepflastert. Eine etwas breitere Stelle, nicht viel grösser als eine gute Stube, nennt sich stolz Piazza. Nicht, wie sich in Italien gehören würde, Piazza Garibaldi oder Piazza Vittorio Emanuele, sondern Piazza 1. Maggio – und das in einem Bergdorf, das nicht nur keine Fabrik, sondern auch kaum eine Werkstatt mit Arbeitern kennt. Zuerst meint man, es sei ein Witz und eine masslose Übertreibung, diese kleine Ausbuchtung Piazza zu nennen, aber je öfter man Monteviasco besucht und dort verweilt, desto mehr fragt man sich umgekehrt, wozu eigentlich alle die Trafalgar Squares, Places de la Concorde, Rote und Tiananmen-Plätze so gross sind.
Die Abgeschiedenheit von Monteviasco hatte früher einen grossen Vorteil – kein Steuervogt wagte es, dort hinaufzuklettern, und so hatten sich die Herrschaften und die Kirche mit Gaben zu begnügen, die ihnen die Einwohner als angemessen betrachtet freiwillig abgaben. Das Leben hier musste aber auch noch mehr bieten. Bereits vor mehr als zweitausend Jahren hinterliessen Menschen hier ihre Spuren. Ausser mit Jagd, Landwirtschaft, Vieh- und Bienenzucht beschäftigten sich die gut über hundert Einwohner zeitweise, vor allem in Kriegszeiten, mit Schmuggeln. Jetzt leben hier dauernd nicht einmal zwanzig Menschen. Viele Häuser werden neuerlich nach strengen Vorschriften in begehrte Feriendomizile umgewandelt und renoviert. Sie sind an Wochenenden und während der Ferien gut besetzt.

(2) Piazza mit zwei Restaurants in Monte Viasco; auf dem Bänkli vor dem einen sitzt Schwager Frido und unser Nachbar aus Agra, Carlo Bertuzzi.
Eine andere breitere Stelle, wo sich die zwei Hauptverkehrsadern von Monteviasco treffen – in die nicht einmal ein Fiat Cinquecento passen würde, auch eine trächtige Kuh hätte dort vielleicht Probleme durchzukommen – wird nicht als Piazza bezeichnet, auch wenn sich dort zwei Restaurants befinden. Wäre es eine Piazza, die Dichte der Restaurants würde diejenige auf dem Bärenplatz in Bern oder der Piazza Carignano in Turin glatt übertreffen, und sie wäre für das Guinnessbuch der Rekorde geeignet. Vor dem oberen Restaurant kann man an einem einfachen Tisch aus Holz auf dem einzigen Bänkli sitzen und das Treiben in Monteviasco und wie sich das Aussehen der Hänge gegenüber nach Tages- und Jahreszeit ändert, beobachten und sich, je nach Laune und Menge des getrunkenen Weines sowie der Zusammensetzung der Gesellschaft, in mehr oder weniger ernsthafte Gedanken oder Gespräche vertiefen.
Vom Dorf aus führen mehrere Wanderwege weiter. Einer von ihnen hoch auf die Alpe Corte. Aber nach dem steilen Aufstieg, einheimischen Antipasti und einfachem, gutem, «rechtem» Wein, hatten wir keine Lust weiterzugehen. Einmal im Spätfrühling schlug ich vor, dass wir zuerst auf die Alp hinaufsteigen und uns erst nachher auf dem Bänkli vor dem Restaurant ausruhen sollten. Der schmale Weg schlängelt sich anfangs durch den Wald mit Birken, Tannen, Föhren, dann in Serpentinen durch eine steile Naturwiese. Blickt man hier etwas seitlich, sieht man unten den See liegen, unmittelbar umrahmt von Bergen, und im Hintergrund die immer weisse Alpenkette. Die Wiese wird weder gedüngt noch gemäht, und so wächst auf ihr eine Vielfalt von Blumen, die man heutzutage kaum noch irgendwo sieht, dazu schwirrt eine Menge von verschiedenen Schmetterlingen herum. Am Ende kommt man zu einem einfachen Haus mit einem grossen Stall und Garten mit Blumen und Gemüse. Der Stall war leer, die Läden am Haus geschlossen. Wäre der Garten nicht da, könnte man meinen, man benütze die Alp nicht mehr.

(3) Alpenrosenfelder auf der anderen Seite des Bergkammes mit Blick auf die Dörfer am Gegenhang.
Wir hätten auf demselben Weg zurückkehren können. Aber ich gehe, wenn es nicht sein muss, nicht gerne denselben Weg zurück. Auf der Karte war die Fortsetzung des Weges zwar geradeaus bezeichnet, aber kein Pfeil, nichts zeigte ihn an, nur ein schmaler Grasstreifen – hoffentlich die Spur menschlicher Schritte – sah etwas anders als der Rest aus. Offensichtlich benützt man ihn nicht häufig. Ich überzeugte meine Frau, die Unsicherheiten, Unklarheiten grundsätzlich nicht schätzt, doch diesen Weg durch das tiefe Gras gegen den nahen Bergkamm zu nehmen. 
(4) Alpenrosen mit silbrig schimmernden "Weissdornbäumchen" im Hintergrund.
Als wir ihm näher kamen, sahen wir auf einem Stein wieder die Markierung – wir waren also auf dem richtigen Weg –und wenige vereinzelte Büsche roter Alpenrosen. Hier nennt man sie «rododendri». Oben auf dem Kamm verschlug es uns fast den Atem. Auf der anderen Seite, an einem Hang, der sich sanft nach unten neigte, war eine grosse Wiese dicht, fast wie von einem Teppich, mit Alpenrosen bedeckt. Zwischen ihnen strahlten viele weissblühende kleine Bäume, die vereinzelt, wie in einem Obstgarten, verteilt waren. Wer hat hier in der Höhe, so abgelegen, Obstbäume gepflanzt? Wir haben schon viele Hänge mit Alpenrosen gesehen, aber eine solche Mischung noch nie. Es war uns, als ob man Vivaldis «Vier Jahreszeiten » das erste Mal hört, einen Bergsee unerwartet erblickt oder eine Stadt wie Jerusalem oder Assisi erstmals besichtigt. Später erfuhren wir, dass die weissen Bäumchen Weissdorne sind. Warum wachsen sie aber hier so vereinzelt und sehen wie Obstbäume aus, sind jedoch nicht wie üblich buschig, mehrere in einer Reihe nebeneinander? Hat sie doch jemand gepflanzt? Wächst diese besondere Mischung hier, weil es an dieser Stelle für die Weissdorne genug warm und für die Alpenrosen genug hoch und kalt ist?
Seither versuchen wir fast jedes Jahr, dieses umwerfende Bild wieder zu erblicken. Vergebens. Entweder sind wir zu früh oder zu spät. Es ist nicht schwierig, die Alpenrosen zu erwischen, aber der Weissdorn – er blüht hier kürzer und je nach der Länge und Härte des Winters früher oder später. Ohne diese weissen Blüten ist es nur ein gewöhnlich schöner Hang mit Alpenrosen. Dieser Wunsch, ja fast eine Sehnsucht, ist ein guter Grund, wieder in Monteviasco auf dem Bänkli vor dem Restaurant draussen zu sitzen, den Blick über die Dächer auf die Berge gleiten zu lassen und über die Welt, ihren Gang, die Kürze und Vergänglichkeit der Weissdornblüten und des Lebens zu sinnieren. Nachher steigen wir, wegen der Treppen zunehmend mit dem Gefühl, nur aus Knien zu bestehen, ins Tal hinab, warten auf den nächsten Frühling und hoffen, es gelingt uns nächstes Mal … Oder ist es uns, wie vieles im Leben, nur einmal gegönnt?
Schweiz Ärztezt. 2010;91:962-3. Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH.

In den längst verflossenen Zeiten, die niemand von uns mehr erlebte, bekam man im Dorfladen meines Grossvaters alles, was man brauchte. Kunden waren bei ihm auch Herrschaften aus den umliegenden Curien, die den Kaffee nicht nur kannten aber auch tranken, zwar auch sie nicht jeden Tag, sondern nur am Sonntagmorgen und nach einem guten Essen mit ihren vornehmen Gästen. Und so hatte auch Grossvater in seinem Sortiment den Kaffee. Je nach der Ernte und anderen Umständen wurde er aus Arabien, Südamerika oder Fernost transportiert. Noch in meiner Kindheit musste sich jeder den Kaffee selbst rösten, da sonst das Aroma durch Lagerung, die damals nicht so perfekt war, verloren gegangen wäre. Man röstete die grün-grauen Kaffeebohnen in dafür bestimmten Pfannen, damit sie dabei keinen Beigeschmack irgendwelcher anderer Speisen bekamen. Man mahlte ihn kurz vor dem Kochen in kleinen Kaffeemühlen, die man dabei fest, am besten zwischen den Schenkeln halten musste oder in den grösseren, die an der Wand befestigt waren. Gekocht wurde er dann nach verschiedenen Arten, je nach eigenen und der Gäste Lust und Laune. Zwei Kaffee, die man zu verschiedenen Zeiten trank, gleichen sich kaum, aber gleichzeitig bekamen alle den selben Kaffee, auch gleich heiss.
Inzwischen ist es mit dem Kaffee einfacher geworden. In den Läden bekommt man viele verschiedene Sorten, die schon geröstet, sogar wenn man will gemahlen und gut verpackt sind. Man entsann sich nach dem Beispiel der Teemaschinen, sogenannten Samovars (Selbstkocher), die aus Russland kamen, auch der Kaffeemaschinen. Die ersten Exemplare findet man noch in manchen Hotels beim Frühstückbuffet. Sie rufen aber den Eindruck hervor, dass man einen alten Kaffee trinkt. Zuerst in den Bars und Kaffeehäusern erschienen ihre weitere, komplizierte Entwicklung, Maschinen, die mahlen, kochen und den fertigen Kaffee, sogar nach Wunsch in verschiedenen Mengen, in die Tassen spritzen. Solange nur eine Person den Kaffee haben möchte, ist es perfekt. Mit der Zahl der Personen, die gleichzeitig nach einem frischen, duftenden, heissen Kaffee lechzen, beginnen die Probleme. In einer Bar wartet man ruhig und zufrieden, bis man an die Reihe kommt. Manche Bars haben, um die Zeit des Wartens auf einem erträglichen Mass zu halten, nicht nur mehrere Kaffeemaschinen, aber auch mehrere Personen, die sie bedienen. In den Selbstbedienungsrestaurants besorgt man sich den Kaffee, wie der Namen anzeigt, selbst. In einem normalen Restaurant sollen nie mehrere Personen gleichzeitig einen Kaffee bestellen, da mit der Zahl solcher Personen naturgemäss die Zahl der nicht mehr duftenden, zunehmend kalten Kaffees steigt. Den alten, nicht seltenen Wunsch, den Kaffee gleichzeitig mit dem Dessert zu bekommen, um beide in Abwechslung besser auskosten und geniessen zu können, sollte man mit einer Kaffeemaschine lieber vergessen. Selten erscheinen sie gleichzeitig auf dem Tisch und der Kaffee ist nicht mehr genug warm.
Vor ein paar Jahren kam eine Firma auf die Idee, für den privaten Gebrauch kleine Kaffeemaschinen zu bauen und für diese kleine Kapseln mit je einer Portion Kaffee zu verkaufen, um auch im Büro, in der Werkstatt und zu Hause die Arbeit mit dem Kochen des Kaffees zu ersparen. Eine gute Idee für höchstens drei bis vier Menschen, die mehrmals pro Tag in dem Raum, wo die Maschine ist, den Kaffee trinken. Je mehr Personen und je grösser die Entfernung, desto länger müssen manche warten oder die ersten den immer kälteren Kaffee trinken, will man den Kaffee, zum Beispiel zu einem guten Dessert geniessen.
Noch schlimmer ist es mit dem Tee bestellt. Den Tee im Beutel, ein Schreck für jeden echten Teeliebhaber, kann man noch akzeptieren. Er wird mit einem separaten Wasserstrahl aus der Kaffeemaschine, besser gesagt Kaffee-Teemaschine begossen. Das Wasser ist nicht genug heiß, weil die Maschinenproduzenten Geld und Strom sparen wollen. Die Isolationen sind dann weniger aufwendig. Sie meinen auch, den Kaffee solle man sofort, ohne Verzögerung trinken können. Dazu sind die Gläser und Tassen zimmertemperaturkalt, wer macht sich schon die Mühe und wäscht sie zuerst mit dem warmen Wasser aus. Aus falschen hygienischen Gründen, bringt das Servicepersonal den Teebeutel neben der Tasse mit dem lauwarmen Wasser, die noch zusätzlich neben der Maschine auf der Theke warten musste, bis man sie abholte. Die Person, die den Tee bestellte, solle nämlich eigenhändig den Teebeutel in die Tasse versenken. So entsteht kein Tee, sondern eine nach nichts schmeckende pastellfarbige Flüssigkeit. (Ausser man bestellt einen sogenannten Fruchttee, der mit künstlichem Aroma, künstlicher Farbe und künstlichem Süssstoff zubereitet nach Fruchtbonbons schmeckt).
Die Maschinen sollten gesäubert und gepflegt werden. Eines Frühjahrs, Anfang März, besichtigten wir ein malerisches, pittoreskes Städtchen auf einem Berg in der Toskana. Nach der Fahrt wollten wir uns erwärmen und gingen in ein passendes Restaurant, wo emsig gearbeitet wurde. Wir verlangten einen Kaffee lungo, der einer Hälfte unseres Kaffee Crème entspricht, aber doppelt so stark ist und einen Schwarztee. Sie schmeckten gewöhnlich. Die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten mussten wir dann unterbrechen, da erst mich, dann meine Frau Übelkeit mit Bauchschmerzen plagte. Wir lagen wie Halbleichen auf den Treppen des schönsten Gebäudes. Den Blick von dort in die Umgebung interessierte uns nicht. Nach anderthalb Stunden war der Spuk vorbei, aber geschwächt und lustlos brachen wir unseren Ausflug ab. Der Grund für diese Malaise - das Restaurant öffnete nach der Winterpause eben sein Tor und die Kaffee- und Teemaschine wurde noch nicht geputzt – die Bakterien und Viren hatten genug Zeit, sich in dem gestauten Wasser gut zu vermehren und ihre Gifte auszusondern.
Die Pflege der Kaffeemaschinen braucht Zeit, die Kapseln mehr Geld, und egal aus welchem Material verschmutzen sie die Umwelt. Überall kann man, besser gesagt muss man, denselben Kaffee trinken. Alle diese Nachteile hindern ihre Anhänger nicht daran, mit missionarischem Eifer sie zu verbreiten. Meine rücksichtsvoll und mild vorgebrachten Argumente betrachten sie als Anlass, uns bereits zwei Kaffeemaschinen zu schenken. Eine ist zu Hause, eine in unserer Ferienwohnung.
PrimaryCare 2013;13:421-2. Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH.

Eines föhnigen Sonntags anfangs September fuhren wir nach Zweisimmen, wo ich zehn Jahre praktizierte und jeweils unter Föhn litt, mit der Gondelbahn auf den 2000m hohen Rinderberg. Nach zwei-dreihundert Meter bekam ich auf der linken Seite der Brust einen Druck, ähnlich wie vor Jahren bei Föhn, nur viel stärker. Ich dachte, der Föhn ist inzwischen, anders wie ich, mächtiger, und ich mit den Jahren empfindlicher geworden. Oben angekommen, kehrte ich mit der Bahn lieber sofort zurück. Und in der Tat, der Druck liess nach, aber verschwand nicht ganz. Ich wollte so weit weg von zu Hause nicht ins Spital gehen, auch wenn es mir gut vertraut war. Zu Hause mass ich dann den Blutdruck – er war 160 systolisch und 95 diastolisch, die ganze Zeit spürte ich keine Herzrhythmusstörungen. Der Druck auf der Brust liess nach, und so beschloss ich, nichts zu überstürzen und bis zum nächsten Tag abzuwarten. Am nächsten Tag war ich beschwerdefrei, saugte problemlos Staub und schleppte Lasten, trotzdem liess ich beim befreundeten Kollegen ein EKG aufzeichnen, das tadellos aussah. Mit dem Blut, das ich selbst ins Labor brachte, gab es unerwartete Probleme, sodass ich den Wert erst vier Tage später im Spital bekam. Ich fuhr nachts dorthin wegen diesmal kaum erträglichen Schmerzen. Meine Frau erwachte trotz meiner Vorbereitungen nicht, was ich als ein gutes, günstiges Zeichen wertete.
Auf der Notfallstation wurde ich schnell und ruhig behandelt. Sie erklärten mir, warum sie was taten, wie auch alle Werte, die sie erhoben hatten. Und so erfuhr ich gleich, dass mein Blutdruck 230/113 war. Ich hoffte immer noch, es plage mich nur der hohe Blutdruck, und es handle sich nur um eine hypertone Krise. Ich wurde auch so behandelt, aber sicherheitshalber, trotz immer noch nicht eindeutigen EKG-Zeichen, wie wenn ich einen Herzinfarkt hätte. Gegen Schmerzen bekam ich Morphium. Erst nach Nitroglyzerin verschwanden sie ganz. Der Blutdruck kehrte langsam zu fast normalen Werten zurück. Nach nicht ganz einer Stunde erhielten wir die Laborwerte, die einen subakuten Infarkt zeigten, der den Werten nach, offensichtlich bereits am Sonntag in Zweisimmen begann. Um 8.00 Uhr wurde ich schmerzfrei auf die Abteilung verlegt. Es wurde mir angekündigt, dass mir mittags die verstopften Herzgefässe erweitert würden. Ich wurde beruhigt, dass es bei einem subakuten Infarkt nicht eile, weil, wenn die Erweiterung nicht bereits zu Beginn des Infarktes erfolge, jetzt dazu die optimale Frist sei, denn die Gefahr der gefährlichen Rhythmusstörungen, die bei einem schlecht durchbluteten Herzmuskel auftreten könne, wieder gering sei.
Von Anfang an, schon vor der Morphiumspritze, war und blieb ich ruhig, auch nach dem ich wusste, dass ich einen Infarkt erlitten hatte. Ich dachte, jetzt kann ich selbst nichts mehr für mich tun, und Aufregung und Angst würden sowohl meinen Zustand, wie die Arbeit meiner Betreuer*, denen ich völlig vertraute, verschlimmern. Meine Ruhe, wie auch, dass ich keine Angst vor dem Tod spürte, überraschten mich. Es beschäftigten mich auch keine Gedanken, was mit mir nach dem Tod sein würde – es war mir gleichgültig, nicht wichtig. Vor mehr als dreissig Jahren, als ich wegen des Verdachts auf einen Hodentumor operiert wurde, war ich nicht nur viel ängstlicher, aber ich machte mir auch grosse Sorgen, was mit meiner jungen Familie geschehen würde. Jetzt war ich bereit zu sterben, da ich das Wichtigste in meinem Leben bereits erledigte, Vieles erlebte, auch wenn ich nichts dagegen hätte, das Leben noch eine Weile zu geniessen. Merkwürdig, die „Sünden“, Versäumnisse, Fehler, Ungerechtigkeiten, Verstösse gegen Anstand und Moral, die ich sicher genug begangen hatte, kamen mir nicht in den Sinn, auch wenn ich früher dachte, sie werden mich in einer solchen oder ähnlichen Situation, so wie manchmal nachts, sicher plagen. Aber vielleicht war es noch nicht genug bedrohlich, und bei nächster ähnlicher Gelegenheit kommen sie doch. Eigentlich genügte mir, und ich war froh und allen dankbar, dass die Schmerzen nachgelassen hatten, und sich alles zum Besseren wandte. Ich glaubte, alles sprach dafür, dass ich „über dem Berg“ war.
Auf der Bettenstation wurde ich von der Schwester, Entschuldigung Pflegefachfrau, liebevoll empfangen. Sie schlug mir aber gleich vor, dass sie mir beim Duschen helfe, was ich mit all den Schläuchen, Elektroden und Verbänden, dazu der Müdigkeit nach der halben Nacht ohne Schlaf, mit Schmerzen und Morphium dagegen (vielleicht spritzten sie mir auch Valium), nicht passend fand und entschieden ablehnte. Ich konnte dem wirklich keinen Sinn abgewinnen. Als sie insistierte, vermutlich wegen der Manipulation in der Leiste bei der Herzkathetrisierung mittags, was ich erst später begriff, verkündete ich, ich sei ein bekannter Schmutzfink. Ich konnte ruhig übertreiben. Der Closomat ist eine vornehme Einrichtung.
Vor der Kathetrisierung mit Angiographie wurde mir ans Herz gelegt, wegen der Kontrastmittelausscheidung genug zu trinken, was ich pflichtbewusst erfüllte. Als ich dann im Behandlungsraum wartete, weil der „Dilatator“ zu einem Notfall gehen musste, füllte sich meine alte, zusammengeschrumpfte, dazu noch leicht gereizte Blase immer mehr. Der Druck nahm bei der Desinfektion mit einer raumtemperaturkalten Flüssigkeit noch zu. Inmitten dieser sterilen „Hightechgeräte“, wagte ich auf der Liege nicht, um eine Urinflasche zu bitten, und so den Raum, auch wenn nur symbolisch, zu verunreinigen. So konnte ich mich eigentlich nicht darauf konzentrieren, was mit meinem kranken Herzen geschah, da ich mit dem Zustand meiner Blase und ihres Schliessmuskels völlig beschäftigt war. Aber eher wegen des Könnens des Kardiologen spürte ich bei der Kathetrisierung und der Gefässerweiterung, auch wenn er immer wieder nachfragte, keine Schmerzen. Das Ganze war sowieso überraschend schnell vorbei. Ich begreife immer noch nicht, wie man einen Katheter so schnell und problemlos in eine Koronararterie einschieben kann. Als ich wieder im Vorraum landete, verlangte ich sofort nach der Urinflasche. Es wurde mir gesagt, dass ich mich bereits im Untersuchungsraum erleichtern sollte. Eigentlich war es mir peinlich, vor all den Anwesenden (und es waren einige, die beim Eingriff helfen mussten), Wasser zu lösen.
Nachmittags kamen die Enkelkinder zu Besuch. Die noch nicht dreijährige Enkelin ahmte die Krankenschwester nach und forderte mich bei den kleinsten Bewegungen bestimmt auf, ich solle ruhig liegen, damit der Druckverband sich nicht verschiebe und die Wunde nicht zu bluten beginne. Während der nächsten Nächte und auch am Sonntagmorgen spürte ich wieder ein ähnliches Ziehen ums Herz wie früher im Simmental. Ich meldete es der Schwester, die die Dienstärztin zu mir rief. Diese untersuchte mich und nahm ein EKG auf. Sie stellte nichts Verdächtiges fest. Sie verordnete wieder den Troponintest. Um das Blut dazu abzunehmen, kam eine Schwester in Ausbildung. Offensichtlich waren die erfahrenen Pflegerinnen* am Sonntagmorgen mit anderen Aufgaben voll beschäftigt. Meine nicht gerade bäumigen Venen waren schon durch die vielen Stiche und perivasalen Blutungen kaum auffindbar und ich zweifelte, ob eine noch nicht sehr erfahrene Pflegerin Erfolg haben wird, aber behielt es für mich. Nach drei zusätzlichen Stichen, die von mir heroisch ohne Zuckungen ertragen wurden, sagte sie, sie müsse den Pfleger rufen. Nach zwei bis drei weiteren vergeblichen Versuchen wollte er es aufgeben. Ich riet ihm, es an einer meiner Beinkrampfadern zu versuchen. Offensichtlich kannte er eine solche Quelle noch nicht. Nach dem nächtlichen Liegen waren die Krampfadern aber kaum sichtbar, so stand ich auf. Er legte sicherheitshalber noch den Stauschlauch an und bekam genug Blut. Der Test war negativ. Als ich wegen des Ziehens in der nächsten Nacht erwachte, belastete ich damit niemanden mehr. Schon am nächsten Tag nach der Dilatation durfte ich zuerst Treppen steigen, nachher sogar im Garten spazieren, und am vierten Tag wurde ich mit vier Medikamenten, zwei davon gegen hohen Blutdruck, nach Hause entlassen.
Mit der Betreuung im Spital war ich äusserst zufrieden. Alle waren sehr entgegenkommend, lieb, achtsam. Man merkte, sie meinen es gut mit den Patienten, ihr Wohl liegt ihnen am Herzen. Sie stellten sich auch jeweils mit Namen und Funktion vor. Ich nahm mir zuerst vor, ich werde mir die Namen merken. Auf der Notfallstation dachte ich noch, es gehe nicht, weil ich noch unter Stress, Schmerzen und Wirkung der Medikamente war. Ich schaffte es auch unter günstigeren Bedingungen auf der Bettenstation nicht. Der Alterungsprozess nagt nicht nur an meinen Herzarterien. Von Beginn bis Ende des Aufenthaltes, vom Chefarzt bis zu den Pflegefachfrauen* deutete mir niemand an, dass es falsch war, mit der Selbsteinweisung mehrere Tage zu zögern, und dann mit dem eigenen Auto ohne Begleitung zu erscheinen. Mehrmals hörte ich, dass sich das Gesundheitspersonal in der Regel so verhalte. Ändern konnte man daran sowieso nichts mehr, und die Selbstvorwürfe belasteten mich weniger. Hoffentlich werde ich bei nächster Gelegenheit vernünftiger.
Nachdem sich das Ziehen zu Hause jede Nacht wiederholte, mass ich den Blutdruck, und stellte fest, dass er jeweils dabei um 160 systolisch war, wesentlich höher als tagsüber. Der Troponintest war erneut negativ, EKG unauffällig. Ich begriff, dass ich ein „inverse dipper“ bin, das heisst unter einer nächtlichen Hypertonie leide, die gefährlicher als die tägliche und in der Regel schwieriger zu behandeln ist. Dazu besitzt mein Herz irgendeinen empfindlichen Sensor auf den erhöhten systolischen Blutdruck in Ruhe. Der diastolische war nie über 85 und die Brustbeschwerden verschwanden jeweils bei körperlicher Belastung. Da ich ein eifriger, leidenschaftlicher Schnarcher bin, dachte ich zuerst an Schlafapnoe als Grund dafür, aber während der ambulanten Somnografie schnarchte ich zwar häufig und kräftig, aber ohne einer einzigen Apnoe. Zuerst nahm ich alle blutdrucksenkenden Medikamente am Abend. Es half nicht. Dann begann ich mit den Medikamenten und ihrer Dosierung zu experimentieren. Mit Erfolg. Ich nehme vier Antihypertensiva dreimal, dazu andere Medikamente, insgesamt also viermal täglich. Als ich versuchte, diese zeitliche Einteilung zu vereinfachen, stieg der Blutdruck wie die Ahle aus dem Sack irgendwann in den unerwünschten Bereich auf.
So ein kompliziertes Regime hätte ich einem Patienten kaum zugemutet und lieber nur die Dosierungen erhöht, wahrscheinlich mit dem Ergebnis, dass der Blutdruck zeitweise zu tief wäre und der Patient eher unter Nebenwirkungen leiden würde. Dann hätte ich neue Medikamente suchen müssen. Bei einem weiteren Misserfolg hätte ich kapituliert und es als eine therapieresistente Hypertonie bezeichnet, oder versucht, den Patienten zu überzeugen, dass ein Blutdruck von 150-160 nachts keine Katastrophe, und sein Herzziehen „funktionell“ sei. Er würde sich mit Recht missverstanden, „nicht ernst genommen“ fühlen, und wahrscheinlich einen neuen Arzt* suchen. In der Hoffnung, dass sie sich dadurch eher daran halten, zwang ich Patienten mit ihren verschiedenen Stoffwechseln, Rhythmen, Hormonhaushalten, psychischen Eigenschaften und Darmbakterien in ein möglichst einfaches Schema, anstatt das Schema den Bedürfnissen ihres Körpers anzupassen. Es ist eine späte Lehre am eigenen Leib, dass es auch anders geht. Ich hoffe, mit der Zeit kann ich doch die Zahl der Medikamente vermindern, das Schema vereinfachen. Ein alter, nicht mehr tätiger Arzt kann über sein Verhalten, seinen Arbeitsstil, seine Tätigkeit nur sinnieren, er kann sie nicht mehr ändern, verbessern. Es gibt darüber einen wunderbaren, rührenden Film – Bergmanns „Walderdbeeren“, der dazu beitrug, dass ich einen Teil meines Lebens als Allgemeinarzt verbrachte.
Bereits im Spital wurde mir mit Nachdruck nahe gelegt, dass ich mich einer ambulanten kardialen Rehabilitation unterziehen sollte. Ich war nicht begeistert, da ich dachte, ich turne (fast) jeden Morgen, laufe auch bergauf (fast) jeden Tag, und sich von Maschinen in einem geschlossenem Raum foltern zu lassen, entspricht nicht meinen „Naturneigungen“. Aber widerspenstig und undankbar wollte ich mich nicht zeigen, und so begann ich zweimal pro Woche meinen Kampf mit den Fitnessmaschinen, die Gespenstern ähnlich auf einen lauerten, wie Don Quijote mit den Windmühlen. Während er dabei übel zugerichtet wurde, bin ich immer stärker geworden, und konnte morgens besser und länger turnen. Einmal pro Woche, am Mittwoch, sind wir zuerst in die Natur gegangen. Da ich nicht wusste, wie es verläuft und wie lange es dauert, schloss ich mich der führenden Gruppe an, die nicht wanderte, sondern fast im Stil der Gehsportler* rannte. Als ich etwas hinten hängen blieb, kam eine unserer Begleiterinnen (und Aufseherinnen) zu mir, und sagte, ich könne mich ruhig in die zweite, langsamere Gruppe fallen lassen, was für mich nicht in Frage kam. Erst als ich nach weiteren paar hundert Metern fast meine Seele ausspuckte und doch hinten lief, nahm ich dieses Angebot und die Niederlage an. Nach einem solchen „Spaziergang“ erwarteten uns im Turnsaal jeweils für mehr als eine halbe Stunde verschiedene Arten von Gymnastik, und nach einer Kaffeepause ein Vortrag darüber, was unsere Krankheit verursacht, und was wir selbst dagegen tun können. Gegen Ende der mehrwöchigen Rehabilitation hielt ich es in der schnellsten Gruppe während der ganzen Zeit aus, aber nur Dank dem, dass unsere besten „Renner“ mit ihr bereits fertig waren. Die Gruppe hatte einen ziemlich hohen Umsatz und die neuen Leidgenossen bildeten wieder die zweite Gruppe und wunderten sich, wie schnell wir laufen können. Alleine hätte ich mich nie getraut, ein solches Tempo anzuschlagen. Aber die Physiotherapeuten* und ein in Reanimation erfahrener Arzt* begleiteten uns, und so wagten wir es, ohne Schaden zu erleiden, sogar nur Nutzen davon zu haben.
Jetzt laufe ich die Hänge hinauf durch die Wälder, über Feld und Wiesen, so schnell wie schon lange nicht mehr. Ich hoffe, es bleibt eine Weile noch so, und bin allen dankbar, die dazu beigetragen haben. Ich schätze es sehr, dass mir die nicht geringe finanzielle Last der ganzen Behandlung von der Allgemeinheit fast vollständig übernommen wird. Während der Krankheit wunderten sich nicht wenige, wie es möglich ist, dass ich mit einer fast zwanghaft gesunden Lebensweise einen Herzinfarkt erleiden konnte. Mehrere Teilnehmer* in der Rehabilitationsgruppe sagten, ihnen sei es gleich ergangen. Aber so kann ich mit einem besseren Gewissen die Kostenträger belasten, und allem nach verstopfte sich das Gefäss dadurch später, der Infarkt war kleiner und der Verlauf günstiger.
* Es sind jeweils beide Geschlechter gemeint.
Schweiz Ärzteztg 2013;94:41-2. Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH.

Dein Mail hat mich sehr berührt – sicher ohne Absicht traf es eines der schmerzhaftesten Probleme unserer Ehe in letzter Zeit. Vorläufig gelingt es mir noch, meinen wie immer gut begründeten Standpunkt zu verteidigen und zu halten. Aber wie lange? Wie Du Deinen Mirek so beschuldigt mich meine Silvia, dass ich schlecht höre. Sie verlangt von mir, dass ich diese, einzig von ihr und nie von mir festgestellte Schwäche, diesen fiktiven Mangel mit einem Gehörapparat behebe. Statt ihm liegt sie mir damit fast dauernd im Ohr. Zufällig schickte einmal irgendeine Institution eine Einladung zur kostenlosen Untersuchung des Gehörs, die mir leider nicht gelungen ist, rechtzeitig aus dem Posthaufen zu entfernen und zu vernichten. Wohl oder übel, in der Hoffnung auf Ruhe mindestens in dieser Angelegenheit, meldete ich mich an, und mit einem gewissen Druck im Bauch, nicht im Ohr, begab ich mich zu der angegebenen Zeit dorthin. Zu meiner angenehmen Überraschung und grossen Zufriedenheit bestätigten sie, sogar mit Stempel und Unterschrift, dass mein Gehör in Ordnung sei – ich höre meinem Alter entsprechend. (Nur zwischen uns, so beruhigend ist es nicht, da mit den Jahren alles nachlässt, sich verschlechtert: Verdauung, Muskelkraft, Beweglichkeit, Stimme(!), Gedächtnis – das aber nur weil es mit der Zeit überfüllt wird – mit den Geschlechtsorganen ist es besonders traurig, ja ungerecht. Während man in der Jugend Lust und Kraft, aber ungenügend Zeit hatte, im Alter ist es umgekehrt.) Das positive Urteil überraschte mich umso mehr, als sie eigentlich Hörgeräte verkaufen. Deswegen kann niemand daran zweifeln, würde ich meinen. Wie man sieht, auch in diesen verdorbenen Zeiten, in denen nicht nur Gehör, aber auch Moral nachlassen, gibt es noch anständige Leute und Unternehmen. Wenn Du meinst, dass dann Ruhe in unserer Ehe eingezogen sei, mindesten was das Gehör betrifft, so irrst Du Dich gewaltig und kennst Silvia nicht. Sie meint, ich sollte mich wieder untersuchen lassen, da von ihr aus seither schon wieder geraume Zeit verflossen sei. Als ob die Untersuchung etwas an unserer Situation ändern würde.
Als einem ehemaligen Wissenschaftler blieb mir nichts anderes übrig, als mit einem Feldversuch zu beginnen, in welchem Rahmen ich scharf beobachtete, was sich bei uns tut, um was es eigentlich geht. Hier in Kürze die Ergebnisse:
Mirek sagt, dass Du murmeln würdest und genau so behaupte ich es auch von Silvia. Auch wenn sie sonst alle Regeln und Vorschriften genau befolgt, verachtet sie leider das Grundgesetz der Akustik, dass die Verständlichkeit mit der Entfernung sinkt und verkündet ihre Belehrungen, Anweisungen (nicht zu sagen Befehle) und Vorwürfe an meine Adresse desto lieber, je weiter sie von mir entfernt ist. Sicher nicht aus Angst vor meiner Reaktion.
Mit der Länge ihrer Aussagen sinkt natürlich die Kraft ihrer Stimme. Wenn sie meiner höflichen Bitte entspricht und sich wiederholt, verstehe ich zwar den Anfang, aber wieder nicht das Ende der Meldung, was sich dann noch einmal wiederholt. Erst bei der dritten Verkündung, nach dem ich ihr ruhig und rücksichtsvoll, wie es meine Gewohnheit ist, erklärt habe, spricht sie endlich genug klar und kräftig, auch wenn mit einer Prise Ungeduld und Empörung. Anschliessend empfiehlt sie mir erneut, ein Hörgerät zu besorgen, wie alle anständigen und rücksichtsvollen Männer es tun. Benützen sie es aber auch?
In Grunde genommen hören wir Euch, aber wie Du weisst, wir Männer beschäftigen uns ununterbrochen mit wichtigen Angelegenheiten und sind in unseren Gedanken und Überlegungen dauernd vertieft. Infolgedessen schalten wir nicht sofort auf „Empfang“ Eurer Botschaften um. Mit dem Alter dauert auch diese Umschaltung etwas länger. Durch Nachfragen gewinnen wir Zeit zum Begreifen. Ich schlug bereits vor, dass ich Silvia zu ihrem Geburtstag eine Pfeife kaufe, nicht zum Rauchen, sondern um mich zuerst aufmerksam zu machen, dass sie mir etwas mitteilen möchte, damit ich mit der Konzentration beginnen kann. Wie es ihre Gewohnheit ist, ohne zu zögern und zu überlegen, lehnte sie meine Idee ab. Unter dieser ihrer Neigung leide ich noch mehr als unter ihrem Murmeln.
Wie Deine Zeilen bezeugen, handelt es sich um eine allgemeine Problematik der Ehen im fortgeschrittenen Alter. Ihre Gründe wurzeln sicher schon in der Kindheit, wenn nicht in den Verfehlungen im Leben der Vorahnen. Es ist somit eine naive Vorstellung, man könne sie mit irgendeinem Gerätchen aus der Welt schaffen.
Eigentlich handelt es sich hier um einen Vorgang, der Freud als Verschiebung bezeichnete. In diesem Falle erfolgt sie sogar doppelt: die Schuld verschiebt sich von Frauen zu Männern und vom Hirn zum Ohr.
Jetzt verstehst Du vielleicht besser, warum mich Dein Mail so erfreute. Die Welt ist voll von älteren Männern, die fast dauernd an ihren Ohren fummeln, da die dort nur mühsam und unsicher befestigten „Hörgeräte“ nur stören, in dem sie das Ohr verstopfen, summen, pfeifen und ihren angeblichen Zweck damit gründlich verfehlen. Kein Wunder, dass ihre enttäuschten, eigentlich betrogenen Träger sie gerne wo immer nur möglich vergessen würden, zum Beispiel in Hotels und Ferienanlagen.
Und so gehören Mirek und ich zu den letzten Mohikanern, die die Fahne des Widerstandes und Kampfes gegen diese nutzlosen so genannten technischen Errungenschaften hochhalten. Wir wollen uns nicht das Leben komplizieren und verderben lassen. Schon genug Zeit und Mühe verwenden wir mit der ständigen Suche nach unseren Brillen. Richte bitte meinem tapferen Kampfgenossen Mirek meinen aufrichtigen Dank, meine Bewunderung und herzliche Grüße aus.
* Wurde an der ASEM (Association Suisse des Ecrivains Médecins) Lesung in Affoltern am Albis am 27.2.2016 präsentiert.

den Frühling erlebe ich nicht.
Der Kuckuck auf der Alp
mir nachrufen nicht mehr wird.
Ein slowakisches Volkslied
Geboren im Jahr 1937, hatte ich während des Krieges genug Gelegenheiten den Tod kennen zu lernen. Eine Tante, die mit uns wohnte und die ich vielleicht mehr als meine eigene Mutter liebte, verschwand plötzlich ohne Vorwarnung aus meinem Leben. Von einer anderen mit ihrem Mann und zwei Cousinen konnte ich mich schmerzlich verabschieden. Mein Bruder fiel im Kampf. Mehrmals war ich in Situationen, in denen ich schon dachte, den Atem des Todes zu spüren. Zum Beispiel bei einem Bombardement schrie ich, weinte und geriet in Panik. Es war umso schwieriger, mit dieser Angst umzugehen, da sogar die Eltern und andere Erwachsene sie auch hatten und mir keinen sicheren Schutz bieten konnten. Vermutlich wollte ich die hintergründige Angst überwinden, die mich auch nach dem Krieg mehr oder weniger begleitete, in dem ich mich mit einer gewissen Sorglosigkeit den Gefahren aussetzte, was meinen Vater, der bereits einen Sohn verloren hatte, veranlasste, mich übertrieben vor ihnen zu schützen und meinen Übermut nur steigerte. Manchmal hatte ich den Eindruck, mein Bruder und die Cousinen halten wie Engel ihre schützende Hand über mich, damit ich auch für sie lebe.
Nach dem Krieg, lernte ich den „natürlichen“ Tod kennen. Er kann auch grausam sein, wenn er Kinder, junge Leute, Mütter und Väter, nicht selten unter grossen Qualen wegrafft. Wurde ich Arzt, auch weil ich dem abhelfen wollte? Noch während des Studiums eines wunderschönen Sommers, wir kosteten mit vollem Munde die schönen und angenehmen Seiten des Lebens aus, kam ein hundertjähriger Mann mit Magenschmerzen ins Spital, der dauernd den Wunsch äusserte, sterben zu können und zu dürfen. Sein Wunsch schien mir unnatürlich, wenn nicht sogar abartig.
Als ich als junger Vater wegen Verdacht auf Hodentumor mehr als zwei Wochen auf die Operation warten musste, packte mich eine grosse Angst. Es war mir nicht klar, ob vor dem eigenen Tod, oder vor dem, dass ich die Familie in einer unsicheren Situation und das Leben zu früh verlassen muss, ohne viele seiner „üblichen“ Seiten zu erleben, sie auszukosten, ohne meine Aufgaben zu erfüllen. Mit den fortschreitenden Jahren begann ich mich zu fragen, ob ich wie mein Vater die Stärke haben werde, dem Tod ruhig ins Antlitz zu schauen. Als er zu fürchten begann, er werde zu schwach und könne zur Last werden, hörte er auf zu essen und zu trinken. Er meinte, dass er nach vierzehn Tagen gesegnet wird, was zwar weit verbreitet, aber falsch ist. Es dauerte sechs Wochen, die er in Gleichmut, ungewohnt fröhlich erlebte. Er schätzte es, dass er eines natürlichen, dazu noch von ihm bestimmten Todes sterben konnte.
Vor nicht allzu langer Zeit kam die zweite Prüfung. Mit starken Brustschmerzen fuhr ich in tiefer Nacht ins Spital. Es überraschte mich, dass ich die ganze Zeit, noch vor der Morphiumspritze, ruhig blieb und keine Angst vor dem Tod spürte. Ich wusste jetzt, sowohl meine Frau, wie die Kinder müssen und werden sich früher oder später auch ohne mich gut durch das Leben schlagen. Ich erlebte viel und erledigte das Wichtigste, auch wenn ich nichts dagegen hätte, das Leben noch eine Weile zu geniessen, die Enkelkinder wachsen zu sehen. Eigentlich sollte ich Platz auf dieser Welt für sie machen. Ausser den Nachkommen bleiben Erinnerungen, materielle und immaterielle Werte von mir. Vielleicht weiche ich einem späteren schwer belastenden Leiden aus, wenn ich jetzt sterbe, wie ich es nicht selten sah bei Patienten, die gerettet wurden, tröstete ich mich. Merkwürdig, die «Sünden», Versäumnisse, Fehler, Ungerechtigkeiten, Verstösse gegen Anstand und Moral, die ich sicher genug begangen hatte, kamen mir nicht in den Sinn, auch wenn ich früher dachte, sie würden mich in einer solchen oder ähnlichen Situation, so wie manchmal nachts, sicher plagen. Wahrscheinlich war es besser, dass ich mich mit dem Tod schon früher beschäftigte, oder war es jetzt noch nicht bedrohlich genug, und bei nächster Gelegenheit kommen sie doch? Ich fürchtete auch nicht, diejenigen, die ich verletzt hatte, irgendwo im „Reich der Verstorbenen“ zu treffen. Ich hoffe, sie verzeihen mir, wie auch ich denen, die mich plagten. Falls dies doch möglich wäre, würde ich mich freuen, die von mir geschätzten, lieben Verstorbenen wieder zu treffen. Während der Rehabilitation nach dem Herzinfarkt traf ich einen Mann, der nur dank der schnellen Hilfe seinen plötzlichen Herztod überlebte. Er konnte über keine Treffen und Erlebnisse jenseits berichten, aber vielleicht war er dort noch nicht lang genug – er kam ja noch zurück. Früher plante ich mein Begräbnis und wollte, dass dabei die Abschiedsrede, die ich selbst verfasse, verlesen wird, weil mir die Abschiedsworte oft nicht gefallen, möglichst bemüht, das Leben des Toten nur in schönen Farben zu schildern. Ich dachte, mein Begräbnis gehöre noch zu mir, sei meine Sache. Als ich auf der Notfallstation lag, war mir egal, was nach dem Tod mit mir geschieht und vertraute meinen Nächsten, dass sie es gestalten, wie es zu mir passt.
Viele behaupten, dass sie sich eigentlich nicht vor dem Tod und was es darnach gibt, sondern vor dem Sterben fürchten. Wir können aber eine Verfügung darüber verfassen, wie weit die Therapie und die Pflege gehen sollen. Es ist die äussere, formelle Seite der Sorge. So wie man eine Aufgabe, eine Reise gut, erfolgreich verwirklichen kann, wenn man sich vorbereitet und überlegt, wie man die Schwierigkeiten, Hindernisse überwinden kann, wie man das Ziel erreicht, so ist es auch mit der „letzten Reise“. Seit mehreren Jahren begleite ich im Spital und zu Hause als „Hospizdienstler“ Menschen vor dem Tod. Entweder weil sie sich alleine fürchten, oder weil sie nicht mehr alleine trinken, essen, auf die Toilette gehen können. Damit entlasten wir Familienangehörige und Pflegepersonal. Mit den geistigen und körperlichen Kräften, die mir noch geblieben sind, setze ich in einer „beschränkten Weise“ damit auch meinen Beruf fort, der aber keine Voraussetzung für diese Aufgabe ist. Ich habe für die Sterbenden Zeit, und ich kann beobachten, wie Menschen unterschiedlich sterben. Ich mache mich mit dem Tod besser bekannt, vertraut und hoffe auch, dass er damit seinen Schrecken für mich verliert. Ich merke, dass meine Einstellung zum Tod auf die Sterbenden wirkt. Im Mittelalter, während der Pestseuchen, die einen grossen Teil der Bevölkerung umbrachte, entstand die „Ars moriendi“. Die Sterbenden schauten sich eine Reihe Bilder an, die ihnen halfen, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen und abzufinden – sie übten sich in der Kunst des Sterbens. Eine der wichtigsten und schönsten Aufgaben in meinem Beruf, die mich tief trafen und befriedigten, war die Begleitung bei einem „schönen Tod“, oder sogar die Hilfe bei der Umwandlung eines schwierigen, schlechten Todes in ein schönes, würdiges, gutes Sterben, wozu die Familienangehörigen den grössten Beitrag leisteten.
Oft frage ich mich, warum manche Menschen beim Sterben so stark und so lange leiden, sogar auf der Palliativstation, wo sie eine Verfügung vorlegen müssen. Haben die Ärzte vorher unnötige, belastende Massnahmen ergriffen, die das Leiden verlängern, weil sie mit dem Patienten oder seinen Angehörigen die schwierigen Gespräche über ihre Ohnmacht und sein Sterben scheuten, oder waren es der Patient und seine Angehörigen, die solche Gespräche nicht wünschten, sich in der „Ars moriendi“ nicht üben wollten? Etliche hoffen, den Tod besiegen zu können. Wie das Märchen „Gevatter Tod“ zeigt, es gelingt nicht. Den Tod zu verschieben bringt nicht selten nur mehr Leid und Belastung. Manche sogar „bestellen ihr Haus“ nicht und belasten ihre Angehörigen, die ihren Besitz dann räumen und verteilen müssen, den sie oft mühsam errungen haben, oft sogar mit Erbstreitigkeiten. Dadurch gerät dann ein beträchtlicher Teil in fremde Hände, was eigentlich nicht ihrem Willen entspricht. Man kann sich auf das Sterben vorbereiten, lernen kann man es nicht.
Mit dem Sterben verbinden wir den Begriff der Würde. Es ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Während ein pensionierter Professor den Selbsttod wählt, wenn er merkt, dass er einen Artikel nicht mehr verfassen kann, weil er den weiteren Verfall befürchtet, beansprucht sein Kollege alle Möglichkeiten, sein Leben soweit es geht mit allen Mitteln zu verlängern, weil er sich dazu verpflichtet fühlt und gewohnt war, um alles zu kämpfen. Dank der besseren wirtschaftlichen Umstände und der Fortschritte der Zivilisation, erfüllt sich oft der Spruch „wie man lebt, so stirbt man“. In den primitiven Mangelgesellschaften entsorgten sich die alten, nicht mehr nützlichen Menschen selbst, in dem sie sich von der Gemeinschaft entfernten. Diese Errungenschaft verwirklicht noch hier auf der Erde das kommunistische Ideal „jedem nach seinem Bedürfnis“, das nach Vorstellungen vieler Religionen sogar im Jenseits nicht gilt. Nur die Gerechten dürfen dort ins Himmelreich, die Sünder nicht.
Ich wäre froh und dankbar, wenn meine Beziehung zum Tod ähnlich endet, wie im Gedicht „Der Schwan Epilog“ von Mascha Kaléko:
Der Schwan, wenn er sein Ende ahnt,
Das heisst: wenn ihm sein Sterben schwant,
Zieht sich zurück, putzt das Gefieder
Und singt das schönste seiner Lieder.
So möcht auch ich, ist es soweit,
Mal eingehn in die Ewigkeit.
Mal sehen, ob der Tod einverstanden ist.

In mehrerer Hinsicht ist Sterben eine Grenzsituation. Es ist eine schöne, nicht selten schwierige Aufgabe, dazu beizutragen, dass der Mensch auf eine möglichst würdige Art diese Welt verlässt. Stimmt es, dass jeder auf die Weise stirbt, wie er gelebt hat?
*
Vor dem Einsatz in einem Heim wurde ich gewarnt, dass die bald neunzig jährige Patientin zwar immer schwächer werde, aber für Unruhe könne sie noch sorgen. Sie schreie schon mehrere Abende, bis sie um Mitternacht einschlafe. Als ich um 20.00 Uhr kam, hörte ich ihre Stimme schon auf dem Gang. Es schien, als ob sie meine Anwesenheit nicht mehr wahr nehmen würde. Ich versuchte, sie auf verschiedene Art und Weise zu beruhigen. Ich sprach zu ihr, fragte was ihr fehle, ohne eine Antwort zu bekommen. Ich nahm ihre Hand und streichelte sie vorsichtig, sang sogar etwas. Die beschränkte Qualität meiner Aufführung störte sie nicht, aber auch die anderen Bemühungen fruchteten nicht. Nur wenn sie ermüdete, hörte sie für eine Weile auf, sich zu wimmeln und eintönig zu schreien. Ich hoffte bei jeder Pause vergebens, sie schlafe endlich ein. Wie verabredet, um 24.00 Uhr verliess ich die arme Frau mehr seelisch als körperlich ermüdet und emotionell aufgewühlt. Ich hoffte, sie würde diese Nacht ihre Ruhe und auch bald für immer finden.
Mehrere Fragen beschäftigten mich. Warum schreit diese Frau? Von der Pflegefachfrau erfuhr ich, dass sie kaum körperliche Schmerzen hat. Warum lindert man ihre Unruhe nicht? Warum versuchen die Ärzte nicht, sie wirksam zu beruhigen? Hat sie sich oder ihre Angehörigen dagegen gewährt? Wie lange muss sie noch leiden? So möchte ich nicht enden.
*
Die nicht einmal sechzigjährige Frau wurde wegen eines bösartigen Hirntumors operiert und bestrahlt. Sie war „nicht gut im Kopf“, verwirrt und konnte das Gleichgewicht nicht halten, also auch nicht gehen. Man wollte sie nicht im Bett einsperren, das hätte sie nicht ertragen. Ich sollte jedoch aufpassen, dass sie nicht aufsteht. Sonst sorgte ihr Mann für sie, der sogar ein Spitalbett im Zimmer hatte. Am selben Tag musste er etwas erledigen und übernachtete zu Hause in einem Dorf in Appenzell. Vor dem Bett lag eine Matte, die sollte melden, falls sie doch aufstehen würde, wenn niemand bei ihr weilte. Ich stellte mich vor. Sie wunderte sich, was ich bei ihr wolle, auch wenn ich nicht der erste vom Dienst bei ihr war. Sie brauche mich nicht, meinte sie, ich könne gehen. Ich erwiderte, es sei für mich eine Freude, die drei Stunden mit ihr zu verbringen. Ob sie etwas dagegen habe, was sie verneinte. Die Wände waren voll von Fotografien. Ein schönes, modernes Haus mit einer grossen Terrasse, wahrscheinlich mit wunderbarem Blick auf den Bodensee, ein grosser Hund (der jetzt in ein Heim musste, wie ich später erfuhr), sie mit ihrem Mann in den Ferien irgendwo im Süden, lustig und ausgelassen. Ein einziges Kind war auf der Seitenwand – ich wusste, mit dieser Frau soll ich lieber nicht über Kinder sprechen. Aber wir fanden genug Gesprächsstoff und bald kamen ihre verspielten, anmutigen Seiten zum Vorschein. Plötzlich bat sie mich, ihr vom Nachttisch auf der unteren Seite des Bettes ihr Handy zu reichen. Sie wählte mehrmals etwas unbeholfen irgendeine Nummer, aber die Verbindung klappte nicht. Sie war unzufrieden, leicht verzweifelt, als ob das Gespräch enorm wichtig wäre und fragte mich, ob ich ihr helfen könne. Ich sagte, ich könne es versuchen, auch wenn ich selbst nur ein altes, primitives besitze und wenig Erfahrung mit Smartphone habe. Es gelang mir wie ein Wunder der Anruf. Es war ihr Mann. Sie fragte ihn, wann er komme, war unzufrieden mit seiner Antwort und machte ihm Vorwürfe. Es entbrannte ein kleiner Streit. Es schien mir, er betrachte nicht ihren Zustand, und blieb als erfolgreicher Geschäftsmann der Realität treu, „nahm sie ernst“ und wich nicht aus, wie man es mit Kleinkindern tut, wenn man sie ablenken, beruhigen möchte. Es fehlte ihm wegen der vermuteten Kinderlosigkeit die Erfahrung dazu. Verärgert beendete sie das Gespräch. Eine Weile blieb sie verstimmt. Ich wusste nicht, soll ich sie auf das Gespräch und ihre seelische Lage ansprechen, wagte es aber nicht. Plötzlich bat sie mich, das Radio einzuschalten. Zum Glück kamen auf einem Kanal Schlager aus unserer Jugend. Sie hellte auf, begann mitzusingen, was ich nach ihrer Aufforderung mit meinem falschen Brummen begleitete. Plötzlich setzte sie sich auf den Bettrand, ohne zu versuchen aufzustehen. Sie blieb folgsam und liebenswürdig, wie es vermutlich ihrer Natur entsprach. Kurz darnach begann sie auf der ausgeschalteten Meldematte im Rhythmus mit den Beinen „zu tanzen“. Wie selbstverständlich forderte sie mich auf, es ihr gleich zu tun, was ich meinen beschränkten Fähigkeiten entsprechend auch tat und ihr gegenüber sitzend möglichst im Rhythmus mit den Füssen auf die Matte schlug. Eine Krankenschwester (Pflegefachfrau) kam, um etwas zu kontrollieren und einzustellen, und wunderte sich, was wir da treiben. Die Patientin sagte mit Selbstverständlichkeit: Wir tanzen. Offensichtlich gefiel es der Schwester. Die Patientin war gelöst. Das Gespräch mit ihrem Mann, ihre Krankheit und ihr Zustand waren weit weg. Die Musik leider bald auch. Nach einer Weile kam die Krankenschwester wieder, um die Patientin für die Nacht vorzubereiten, und ich wurde etwas früher als geplant nach Hause entlassen.
Diese Nacht schlief ich ausgezeichnet. Hoffentlich auch die Patientin.
* Vorgetragen anlässlich der ASEM-Lesung in der Pro Senectute in Biel am 7.2.2015
Entäuschung und Versagen

Die Leiterin unseres Hospizdienstes fragte mich, ob ich zu einer Frau schauen könne, die im Endstadium eines Lungenkrebses mit Metastasen ihre letzten Tage in einem Altersheim verbringe. Ich wusste nicht, wieviel Zeit ich für den Weg in die Gemeinde unweit von uns benötige, und so stand ich am nächsten Tag, etwas früher als angegeben, vor einem stattlichen, dreistöckigen, schönen, alten, solitären Haus und hatte genug Zeit zu sinnieren, wozu es früher dienen konnte. Gebaut noch in einer Zeit ohne Hotels und Fabriken war es für ein Patrizierhaus zu schlicht und für eine Schule dieses Dorfes, falls es sie damals überhaupt schon gab, zu gross. Nach dem ich durch den alten, einfachen Eingang ins Haus kam, wurde ich nicht schlauer. Niemand war da und so suchte ich alleine das Zimmer der Patientin. Ich ging neben vielen alten Türen mit den Namen der Bewohner dieser offensichtlich kleinen Räume, die für Schulklassen sicher ungeeignet waren. Im letzten Zimmer im obersten Stock sass die Frau auf dem Bettrand mit einer aufgesetzten Sauerstoffbrille. Im Vorraum summte der Apparat für die Anreicherung des Sauerstoffs. Sie hatte Besuch von einer Freundin, die sich aber bald verabschiedete.
Das Zimmer war ohne die warmen Täferwände, die ich in den Gemeinschaftsräumen im Erdgeschoss sah und in den anderen Zimmern vermutete. Schlicht und notdürftig war es eingerichtet: Ausser des verstellbaren Bettes und des auch verstellbaren Tischchens, zwei Stühlen und eines Sessels, guckte nur ein grosser Bildschirm aus der Ecke hervor. Ich hatte den Eindruck, dass alles, ausser dem Koffer am Boden, dem Altersheim gehörte. Ich sah keinen persönlichen Gegenstand, kein Bild, kein Foto. Bald kam der Pfleger, froh, dass er mich bei der Patientin entdeckte und fragte, ob wir Lust auf Kaffee hätten. Er brachte nicht nur Kaffee, sondern auch Kuchen. Weder er aus einem Nachbarland, noch die Frau aus dem Dorf wussten, wozu das Haus einmal gebaut wurde. Wir hatten es gemütlich. Draussen war es kalt, die Sicht war schlecht, aber ich konnte mir vorstellen, dass der Blick aus dem Fenster schön war. Ja, sagte die Patientin, bei Föhn habe man den Säntis fast direkt vor der Nase. Ich bedauerte, dass ich nie dazu kam, von diesem Sehnsuchtsberg der Ostschweizer auf den Skiern runterzufahren. Sie sagte, sie hätte es mit ihrem verstorbenen Mann mehrmals getan. Wir berichteten über unsere Skierlebnisse und meinten, hie und da auf einer Piste oder im Sommer bei einer Wanderung hätten wir uns treffen können. Ich bekam immer mehr den Endruck, die Frau und die Einrichtung des Zimmers passten irgendwie nicht zusammen. Nach einer Weile äusserte sie den Wunsch, das Zimmer zu verlassen. Sie rief den Pfleger, der sie in den Rollstuhl setzte, mit einer Sauerstoffflasche versorgte und mit einer Decke den Oberkörper einhüllte. Zuerst dachte ich, wir fahren etwas auf dem Gang hin und her, aber sie steuerte mich zum Lift, sie wollte nach draussen gehen. Ich meinte, sie sollte dann die Füsse besser schützen. Sie erwiderte, sie habe warme Füsse und nie kalt. Draussen an der frischen Luft zog sie aus der Tasche eine Zigarette und Streichhölzer und inhalierte mit Genuss den Rauch. Ich schob sie eine Weile nicht weit vor dem Haus hin und her und bald nach der zweiten Zigarette kehrten wir ins Zimmer zurück. Gegen Ende meiner vorgesehenen Zeit kam eine andere Freundin mit dem Hund der Patientin, der mich freundlich beschnupperte und wie sie, eine riesige Freude zeigte. Ich verabschiedete mich mit der Hoffnung, wieder zu ihr zu kommen. Beim Ausgang traf ich ein paar Pflegerinnen, dem Dialekt nach aus dem Dorf oder der Umgebung, aber sie konnten mir auch nicht sagen, was früher im Haus war.
Schneller als ich dachte, schon in vier Tagen kehrte ich zu der Frau zurück, weil einer Kollegin etwas dazwischen kam. Die erste Freundin war wieder bei ihr, verabschiedete sich aber bald. Die Frau sah schlechter, eingefallener aus, die Füsse waren kalt und blau verfärbt. Sie war unruhig, ich musste ihr beim ständigen Aufsitzen, Abliegen, Drehen helfen. Wir bekamen den Kaffee, aber es war nicht mehr gemütlich. An einen Ausflug mit Zigarette war nicht zu denken. Sie seufzte und meinte, wenn nur das Ende käme. Ich fragte sie, ob sie Angst davor habe. Ruhig und überzeugend sagte sie: Wieso, vor was? Sie läutete nach dem Pfleger und wollte etwas gegen Schmerzen haben, die vom rechten Unterbauch in den Oberschenkel ausstrahlten. Er sagte, dass sie vor nicht langer Zeit bereits Tropfen gegen Schmerzen bekommen habe. Sie liess nicht nach und so brachte er ihr die Tropfen wieder. Sie fiel in den Schlaf und erwachte erst, als die Freundin mit dem Hund kam. Die Begrüssung war weniger stürmisch als das letzte Mal. Ich dachte mir, der Tod steht schon bereit am oberen Ende des Bettes. Später erfuhr ich, dass man das Bett nicht wie im Märchen „Gevatter Tod“ umdrehte, sondern die Patientin ins Spital verlegte. Dem Tod dauerte es vier Tage, bis er sie dort fand.
Warum musste er diesen Umweg machen? Deutete schon die schlichte Einrichtung des Zimmers darauf? Wollte sie sich dort nicht heimisch fühlen? Die Patientin schien bereit, den Tod zu treffen. Überlegte sie sich es doch noch? Waren die Pflegeleute sparsam und überfordert mit den Tropfen? Warum verschrieb der Arzt kein länger wirksameres Medikament? Wollte eine der Freundinnen sie „noch nicht“ verlieren? Starb sie im Spital doch ruhiger, leichter?
Beschäftigt mich diese Geschichte, weil dabei die Früchte unseres Einsatzes, den Menschen zu helfen, dort zu sterben, wo sie es sich wünschen, kurz vor der Erfüllung zunichte gemacht wurden? Jedenfalls möchte ich nicht, dass man meinen Willen vor dem Tod nicht beachtet. Oder reut es mich, dass die Patientin das Haus verliess, das mich an die heimeligen Altersheime erinnerte, in denen ich die Patienten nicht selten bis zum Tod betreute oder sogar an das im Vergleich winzige Grosselternhaus, das ein paar Jahrzehnte weniger auf dem Buckel hatte als dieses Haus? Es wurde zwar weit weg ganz anderswo gebaut, aber die Wände wurden auch mit warmem dunkelbraunem Täfer belegt und die ähnlichen Türen hatten ähnliche Schlösser wie hier.
Ich fragte das Gemeindeamt, zu welchem Zweck das Haus gebaut wurde. Erst nach mehreren Tagen schickte mir der offensichtlich an Geschichte interessierte Gemeindeammann einen langen Auszug aus einem Buch mit Bildern über die Gemeinde – von Anfang an diente es fast ein Jahrhundert als Waisenhaus für die ganze Umgebung. Damals brauchte man Waisenhäuser und nicht Altersheime, weil die Leute früher und schneller starben. Ob auch leichter und würdiger als in unserer Zeit?

(1) Ehemaliges Altersheim. Photo Silvia Marko.
Vor kurzem las ich in der Zeitung, das Haus sei nicht mehr zeitgemäss eingerichtet und werde in Wohnungen umgebaut. Die Zeiten ändern sich und wir mit ihnen – ein slowakisches Sprichwort.
Schweiz Ärzteztg 2018;99(17):562–563. Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH.

Ärztinnen und Ärzte als Patienten
Medizinische Betreuung à la française 3
Peter Marko
Dr. med., Mitglied FMH
An Ostern kamen wir dazu, mit der Bahn nach Fréjus zu fahren, um endlich die Ferienwohnung von unserem Sohn Daniel und seiner Frau Barbara in Saint-Raphaël an der Côte d’Azur zu bewundern. Sowohl gemäss den Angaben im Internet wie auch des Bahnanzeigers sollte Fréjus die Endstation sein. Arglos stiegen wir abends in der Dunkelheit in Nizza in den Zug. Hinter uns sass ein Mann mit einem Mädchen, der hielt sich die linke Hand und jammerte dauernd. Nach einer Weile fragte ihn meine Frau Silvia, was mit seiner Hand sei. Er zeigte sie und erklärte, er habe einen Gichtanfall. In meinen langen Praxisjahren sah ich nur in Atlanten ein solches Bild. Nicht nur die Finger waren von Harnsäureablagerungen verformt und gerötet. Wir empfahlen ihm, gleich zum Arzt zu gehen, da er keine richtigen Medikamente gegen einen Gichtanfall hatte. Bald darnach stieg er sowieso aus. Wir ahnten nicht, dass diese Begebenheit ein schlechtes Zeichen war.
Raus- und aufgeschmissen
Als wir in Fréjus eintrafen und niemand Anstalten machte, auszusteigen, kam uns dies merkwürdig vor. Wir sahen kein Bahngebäude und fragten die Mitfahrer, ob wir in Fréjus seien, was sie bejahten. Warum steigt denn niemand aus? Sie würden halt weiterfahren, antworteten sie. Kann man das denn? Ja, lautete die Antwort. Silvia ging zur Türöffnung, um auf den Bahnsteig zu schauen, während ich mit dem grossen Koffer unruhig sitzen blieb. Als sie zwischen den Türflügeln stand, wurden ihre Unentschlossenheit und ihr Zögern energisch beendet – die Türen schlossen sich und spuckten sie aus mehr als einem Meter Höhe auf den asphaltierten Weg. Ich blieb ohne Geld, Handy und Ahnung, in welchem Hotel wir übernachten sollten, und mit meinen rudimentären Französischkenntnissen im Zug. Meine Unruhe stieg. Silvia wurde raus- und ich fühlte mich aufgeschmissen. Zum Glück bemerkten nicht nur die Ausgestiegenen, sondern auch der Lokführer, was passiert war, weshalb er nicht losfuhr. Die Türe wurde wieder geöffnet, so dass ich aussteigen und mich um meine Frau kümmern konnte, die inzwischen aufgestanden war und sich frei bewegte. Anstelle des Mannes mit dem Gichtanfall, hielt sie nun ihr linkes Handgelenk. Sie klagte über Schmerzen und lachte, jetzt sei sie daran, den Arm zu halten und zu jammern. Ich benutzte ihren Schal, den sie zufällig bei sich trug, um das Handgelenk notdürftig zu fixieren. Sofort tat es ihr auch weniger weh. Wir gingen zu Fuss ins nahegelegene Hotel. Unterwegs realisierten wir, dass gegenüber der Stelle, an der wir ausgestiegen waren, etwas erhöht auf der anderen Seite der Geleise, sich ein hübscher Jugendstilbahnhof befand. Aus dem Zug hatten wir ihn nicht sehen können.
Im besseren Licht unseres Hotelzimmers schaute ich die Hand an. Im Bereich des Kahnbeins fand sich eine blaue, weiche Schwellung, die sehr druckempfindlich war. Auch die Bewegungen im Handgelenk schmerzten dort. Da wir keine Binden bei uns hatten, fixierten wir das Gelenk wieder mit dem Schal und beschlossen, Barbara und Daniel nicht mit einem Anruf unnötig zu beunruhigen. Daniel sollte uns ohnehin am nächsten Vormittag um halb zehn im Hotel abholen. Er könnte uns dann gleich mit dem Auto ins nächste Spital bringen.
Auf ins nächste Spital
Die Nacht war nicht schlecht, aber die Schmerzen in der Hand waren am nächsten Morgen unverändert. Auf der Notfallstation waren schon zwei Patienten. Gleich nach der Aufnahme der Personalien wurde Silvia aufgefordert, einer Pflegefachfrau zu folgen. Als wir sie begleiten wollten, sagte die Frau: Nein, nur die Patientin dürfe mit ihr rein. Wir blieben im schönen, warmen Wetter draussen auf dem Parkplatz vor der Notfallstation. Nachdem wir die wichtigsten Neuigkeiten und Probleme besprochen hatten, kam uns nach anderthalb Stunden wieder in den Sinn, warum wir eigentlich hergekommen waren. Wir gingen zum Empfang, aber niemand war dort, und wir fanden auch keine Glocke, mit der wir uns hätten bemerkbar machen können. Wir schöpften Hoffnung, als die Ambulanz mit einem liegenden, aber offensichtlich nicht schwer kranken Menschen kam. Leider gelang es uns nicht, mit ihnen ins Gespräch über unsere Patientin zu kommen. Wir waren verzweifelt. Nach einer weiteren Stunde, also nach insgesamt mehr als zweieinhalb Stunden, erschien Silvia in einer merkwürdigen Montur, ihre Bluse und Jacke in der rechten Hand haltend, gut gelaunt. Auffallend war ein klobiger Gips bis hinter den Ellbogen. Sie war nicht bereit, in dieser Aufmachung in die Stadt zu fahren, auch wenn das «Gwändli» sicher von einem Modehaus in Paris entworfen worden war und ihr nicht schlecht stand. Wir kehrten ins Hotel zurück, wo sie sich ein Reservehemd von mir anzog, denn der Gips war für ihre Garderobe zu dick.
Dass die Behandlung so lange dauerte, will Silvia mir auch heute noch nicht glauben. Jedenfalls berichtet sie, dass sie zunächst in einem Gang sitzen gelassen wurde. Das Treiben dort sei interessant gewesen, aber als sie des Wartens dann doch überdrüssig geworden sei, habe sie sich bemerkbar gemacht. Danach sei sie zuerst ins Röntgen, dann in einen Raum geführt worden, wo drei Personen mühsam und lange versucht hätten, ihr den Ehering abzunehmen. Sie hatten offenbar nicht das
(1) Frejus
Silvia Marko verliess die Notaufnahme gut gelaunt – mit einem klobigen Gips und in einem neuen, schicken «Gwändli».
geeignete Instrument dazu, wie wir es für solche Fälle in unserer Praxis verwenden. Und die Eheringe in Frankreich sind wahrscheinlich dünner, auch wenn unsere nicht besonders dick sind und genau der Schweizer Norm entsprechen (s. Bild). Das Gipsen ging gemäss ihrem Bericht zügig voran, und das «Gwändli» mussten sie auch nicht lange suchen und anpassen. Es ist einheitlich, eben égalité. Eigentlich war Silvia mit dem Ganzen zufriedener als der Rest der Familie, was auch ihr Lächeln auf dem Foto bezeugt.

Nach der Entlassung
Auf dem Röntgenbild sah man keinen Knochenbruch, was bei einem frischen Kahnbeinbruch nicht selten ist. Auch das Computertomogramm zeigte bei der Kontrolle nach einer Woche zu Hause keinen solchen Bruch, aber auf dem üblichen Röntgenbild einen ins Gelenk reichenden, nicht verschobenen Speichenbruch, der problemlos nach sechs Woche verheilte.
Die Rechnung für die ganze Behandlung, also die Röntgenaufnahmen, das Gipsen, ein kleines Zeugnis, das «Gwändli» nicht zu vergessen, betrug 74 Euro. Für unsere Krankenkasse gilt: Im Falle eines Falles in Frankreich fallen. Daniel möchte, dass wir ihn und seine Frau wieder in Frankreich besuchen. Sollen wir es wagen?
Bildnachweis:
Porträtfoto von Silvia Marko: Daniel Rüfenacht
Foto vom Ehering: Silvia Marko
Schweiz Ärzteztg 2018;99(7):215-6. Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH.

Im Gesicht der vom Bad in Formalin ausgedörrten Leichen konnte man ihre persönlichen Züge gut erkennen. Sie warteten auf den Obduktionstischen auf unsere erste ärztliche Tätigkeit. Jedem von uns wurde ein Körperteil zugewiesen. Es brauchte eine ziemliche Überwindung, die unversehrten, wehrlosen Menschen mit dem Skalpell zu verletzen, den ersten Schnitt zu setzen. Bei der Präparation schielten wir dauernd in die anatomischen Atlanten, die neben den Leichen lagen, und achteten, dass wir sie mit unseren von Fett und anderen Geweben verschmutzten Gummihandschuhen nicht verschmierten. Je mehr wir in den Körper vordrangen, desto mehr fiel die Mischung von Scheu, Rücksicht und Ekel von uns ab, verschwanden unsere Hemmungen, und wir bekamen eine eigentümliche Beziehung zu „unserer“ Leiche, die uns bereitwillig und reglos als Lehrmittel diente. Die Leichen glichen immer weniger einem Menschen, bestanden zuletzt nur noch aus Knochen, aber wir schätzten sie zunehmend. Ausser Anatomie lernten wir unbemerkt noch etwas Wichtiges - sich auf ein Gebiet, eine Aufgabe zu konzentrieren, den Blick und das Interesse einzuengen. Ein Arzt, in welchem Fach auch, braucht solche Fokussierungen, um seine Arbeit richtig gut zu verrichten. Die Kunst ist, sich von dieser nützlichen vorübergehenden Verengung wieder zu befreien und den Patienten in den verschiedenen Zusammenhängen als ganzen Menschen wahrzunehmen, zu berücksichtigen und zu betreuen. Ohne diese
Fähigkeit ist man zwar ein guter Spezialist, aber kein guter Arzt.

(1) Kommilitonin Sona M. beim praktischen Anatomie-Unterricht (rechts des sitzenden Lehrers). Mit Dank Foto von ihr erhalten.
Gewohnte Umstände, die bieten, was man benötigt, um die Arbeit ungestört verrichten zu können, erleichtern die Fokussierung. Es gibt Ärzte, die ausserhalb der Praxis oder des Spitals nicht arbeiten können. Dagegen machen andere gerne Hausbesuche oder eilen zu Notfällen. Einmal in den Ferien in einem fremden Land, dessen Sprache ich nur sehr spärlich beherrschte, fuhren wir mit dem Linienbus. An einer Haltestelle stieg eine alte Frau mit einem langen schwarzen Rock ein. Sie wollte nicht absitzen. Bald sah man, dass sich auf dem Boden zwischen ihren Beinen eine Blutlache ausbreitete. Ich war ohne die Notfalltasche, die mir mit dem Blutdruckmesser Anlass zu einer einigermassen vernünftigen, gewohnten und vor allem mich beruhigenden Tätigkeit bieten würde. Ich war im ganzen Bus vermutlich der Einzige, der eine Ahnung über die Gefährlichkeit der Lage hatte. Ich wurde blass, mir wurde schlecht, ich fiel fast in Ohnmacht. Der Bus hielt unbeirrt auf allen vorgesehenen Haltestellen, aber dann bog er doch von seiner Strecke mehr als hundert Meter ab zum Spital. Der Fahrer übergab die Frau dem Pflegepersonal, holte einen Kübel mit kaltem Wasser, wischte ruhig die Blutlache weg und kehrte wieder auf die vorgegebene Route zurück. Ich beruhigte und erholte mich auch. Meine Frau verstand meine Reaktion nach den vielen viel schlimmeren Notfallsituationen in Spitälern, der Praxis und den Notfalleinsätzen draussen nicht.
Kurz nachdem ich die Praxis aufgab, begann ich im freiwilligen Hospizdienst mitzuarbeiten. Ich verweilte Stunden neben den schwer kranken, oft sterbenden Menschen. Am Anfang war es schwierig, daran zu denken, dass sie am Sterben sind. Besonders bei den jüngeren dachte ich auch, was, wenn es eigene Kinder wären. Nach dem ich in der Praxis Sterbende betreute und der Schwiegervater wie meine Mutter bei uns zu Hause starben, dachte ich, ich ertrage es leichter. Aber damals war ich dabei selten allein, eher kurz und abgelenkt von Gesprächen, Aufgaben und Überlegungen, was noch getan werden soll. Jetzt bin ich stundenlang alleine mit teilweise schwer leidenden, unruhigen, verwirrten Menschen und treffe nur einfache Entscheidungen aber mit unmittelbaren Folgen. Mit der Zeit blende ich die Traurigkeit und die Schwere des Sterbens immer mehr aus. Nicht selten denke ich, der Tod solle sich beeilen und das Leiden beenden. Ich bemühe mich, den Patienten die Gegenwart so angenehm zu gestalten, wie es nur geht, unabhängig davon, was sie erwartet. Wenn sie es möchten, lese ich Kurzgeschichten vor. Ich versuche den Lesestoff der Person und deren Vergangenheit, Interessen und Beruf anzupassen. Manchmal haben wir es zusammen sogar lustig, eine Erfahrung, die ich auch von anderen „Hospizlern“ höre.
Ab und zu liest man, dass Leute auch im hohen Alter unerwartet sterben. Diese Ansicht kann ich, als ein ehemaliger Pfadfinder, der die Parole „sei bereit!“ verinnerlichte, nicht teilen. Nebst anderem habe ich mir lange Zeit den Kopf zerbrochen mit den Gedanken, wie meine Urne aussehen und wo sie aufbewahrt werden soll. Schlussendlich vermachte ich meine Leiche dem Anatomischen Institut. Meine Frau folgt mir in dieser Entscheidung. Wir vereinfachen unseren Verbliebenen, die damit einverstanden sind (was bleibt ihnen übrig?), das Leben. Ein Anruf (so bald wie möglich nach unserem Tod) reicht und man kommt uns holen. Die Form der Urne ist einheitlich, und sie wird, falls wir es wünschen, auf dem Gebiet des Friedhofs, das für die Universität reserviert ist, aufbewahrt. Kein schlechter Platz nach einer mehrjährigen akademischen Karriere auf drei Alma Mater. Als ein unermüdlicher, oft lästiger Möchtegernpädagoge und Weltverbesserer freut mich die Aussicht, dass die Studenten dazu an mir auch noch zu fokussieren lernen werden. Auf eine Weise wird es der Gipfel und das Ende meiner Eitelkeit. - Mit diesem Schritt trennt also der Tod unsere Ehe nicht.
Schweiz Ärzteztg 2016;97:952–953. Dank für ©Schweizerischer Medizin Verlag EMH..

16.3.20:
Von zwei Seiten bekam ich die Aufforderung, über "die Zeit des Coronavirus zu schreiben. Unser Herr Bohli hat uns dazu herausgefordert und ein Mitglied des "Bundesverbandes der deutschsprachigen Ärzteschriftsteller" schlug vor, die Zeit in der zweiten Hälfte von Mai zu nützen, wenn unser eben wegen dieses Virus abgesagte Kongress in Strahlsund stattfinden sollte, über den Virus zu schreiben. Ich denke, es ist besser, lebendiger gleich während seines Wütens es in Form eines Tagebuches, jetzt auch "Blog" genannt, zu tun.
17.3.20:
Mit Leidenschaft schreibe ich Leserbriefe, weil ich vielleicht falsch hoffe, dass ich so den Verlauf der Dinge etwas beeinflussen kann, was mir im Kleinen manchmal auch gelingt. Das verstärkt diesen meinen Trieb. Und so konnte es nicht anders sein, ich schrieb mehrere Leserbriefe betr. Coronavirus:
Wozu ist ein «unheimlicher» Virus gut (geschickt an die "Neu Zürcher Zeitung" (NZZ) am
Wie auch der «unheimliche» Virus gefährlich sein möge, die Angst vor ihm bringt Tatsachen und Probleme zu Tage, die niemandem, weder Politikern, noch Fachleuten bewusst wurden: Oft sprach man über die Gefahr der Abhängigkeit von einer Macht im Bereich der Telekommunikation, aber unbemerkt und ungeachtet sind wir in einem wichtigeren Bereich abhängig geworden – der Medikamentenproduktion. Dadurch sind wir auch politisch erpressbar. Die Abhilfe ist eine dezentrale Produktion an mehreren Standorten. Sie bringt u.a. den Vorteil der kürzeren Transportwege und somit der Schonung der Umwelt.
Der Virus bringt mit sich, dass wir etliche bereits vorhandene technische Möglichkeiten schätzen und vermehrt benützen werden, die wir aus Trägheit nur beschränkt einsetzten – die Roboter in Spitälern und Pflegeheimen, den Einsatz von Fernunterricht in den Schulen, sowie die Heimarbeit. Der Lebensstil wird sich noch beschleunigt ändern. Es ist eine grosse Herausforderung für die Gesellschaft, wie sie damit umgehen wird. Die Bedeutung der menschlichen Beziehungen, des direkten persönlichen Kontakts wird steigen.
*
Da die "NZZ" es nicht veröffentlichte, blieb für die "Schweizerische Ärztezeitung (SÄZ) die Kurzfassung, die am 12.3.20 veröffentlicht wurde:
Die positiven Nebenwirkungen des Coronavirus
Der Coronavirus öffnete uns die Augen für die Gefahr der Produktion von Medikamentenrohstoffen an wenigen Standorten. Ausser Engpässen bei der Versorgung sind wir u.U. auch politisch erpressbar. Im Bereich der Medizin wird er auch andere positive Nebenwirkungen haben. Z.B. es wird den Einsatz der vorhandenen technischen Möglichkeiten wie Roboter und Telemedizin in der Pflege und Betreuung von Patienten beschleunigen. Ähnlich wird sich das Leben auch in anderen Bereichen wie Schulunterricht und Heimarbeit ändern. Die Bedeutung der menschlichen Beziehungen, des direkten persönlichen Kontakts wird steigen. Wie froh werden die Bewohner von Norditalien sein, wenn sie Fussballspiele ihrer Clubs wieder in Stadien und nicht nur im Fernsehen verfolgen können.
*
Zur Absage der Sportveranstaltungen schrieb ich am der "NZZ":
Betr.: Germann D: Ohne Publikum ist der Profisport eine Alibiübung. NZZ 6.3.2020, S. 11.
Ja, das Coronavirus brachte auch die Sportwelt in einen Ausnahmezustand, der schöpferische, neue nicht entweder oder Massnahmen verlangt. Es gibt mehrere gute Gründe, die Sportanlässe auch ohne Zuschauer auszutragen, desto mehr, als sie in der Schweiz nicht selten vor fast leeren Zuschauerrängen stattfinden. Es gilt für Sportvereine wie für andere Betriebe, dass es vorteilhafter ist, auf die Teilzeitarbeit überzugehen, als sie vorübergehend zu schliessen. Um so eher, da sie bald wieder auf vollen Touren laufen sollen. So bleiben Teileinnahmen, die Angestellten kommen nicht aus der Übung und verlieren nicht ihre Bedeutung.
Der Vergleich mit Konzerten und Filmen stimmt nicht. Nicht nur kann man Musik auch sonst hören und Filme ohne Zuschauer anschauen, aber eine beliebte chinesische Band hat kürzlich sein Konzert im Internet veröffentlicht. Youtube lässt grüssen. Die Zusammenarbeit von Sportvereinen und lokalen Fernsehsendern kann aufblühen. Herr Bach täte gut, wenn er eine neue Form für olympische Spiele als Plan B vorbereiten würde und nicht stur beim Alten bliebe, auch wenn zu hoffen ist, dass die Infektion bis Sommer abklingt.
*
Mit dem Vorgehen des "Bundesamtes für Gesundheitswesen" (BAG) war ich ebenfalls nicht zufrieden und am 7.3.20 schrieb ich, ohne je eine Antwort zu bekommen;
"Guten Tag,
zu der Einstellung und Information von BAG betr. Coronavirus in den letzten Tagen möchte ich
Folgendes bemerken:
-
Die «hotmail « des Medgates wurde abgeschafft. Kaum war es wegen Desinteresse, eher wegen Überlastung. Dann gibt es andere, weniger destruktive, diktatorische Massnahmen: Man könnte alte, pensionierte Fachpersonen mit dem Sortieren der Mails beauftragen, den Schreibern erklären, dass ihre Fragen gesammelt bald beantwortet würden, u.ä.
-
Ich habe nach der Gefährlichkeit des Besuches eines Hallen- und Thermalbades gefragt. Vielleicht ist es nicht nur theoretisch: In einem ml Wasser gibt es Milliarden Viren. Werden die Coronaviren durch die hygienischen Massnahmen der Bäder vernichtet? Wenn nicht, sind sie beim Schwimmen nicht gefährlich. Telefonisch bekam ich nur ausweichende Antworten, sowohl meine Bitte, es weiterzuleiten, wie noch gesendete e-mails brachten vorläufig weder persönliche noch allgemeine Antworten.
-
Die Behauptung, es habe wenig bis keine Bedeutung, Schutzmasken zu tragen, ist auf wackeligen, sachlichen Beinen. Sie ist auch eine negativistische Zweckbehauptung, da wir nicht genug Schutzmasken haben und für Spitäler und Heime, vor allem aber für die Betreuung der Coronavirenkranken brauchen. Wochenlang wurden die Nachrichten in der Tagesschau über Coronavirus mit einem Bild der maskentragenden Chinesen begonnen. Tun sie es aus Spass? Es wäre ehrlicher, positiver, schöpferischer, beruhigender und wirksamer, wenn man den Leuten empfehlen würde, wie sie Stoffmasken selbst machen könnten, wie sie sie reinigen, eventuell desinfizieren könnten.
Zu einem Meinungsaustausch gerne bereit verbleibe ich
mit besten Grüssen
Peter Marko, ehemaliger Hausarzt "
Die Schutzmasken liessen mich nicht in Ruhe. Ich versuchte es mit einem Leserbrief in der SÄZ", dem ich auch ein instruktives Foto beilegte:
Gesichtsmaskenmangel einfach beheben
Den folgenden Vorschlag habe ich bereits BAG über die Hotline unterbreitet, ohne Reaktion. Deswegen versuche ich es auf diesem «Kanal»:
Meine Frau Silvia hat für uns je drei Gesichtsmasken aus dreifach gelegtem Baumwollstoff angefertigt. Sie werden mit einem Gummiband hinter den Ohren befestigt (siehe Bild). Dreimal, weil drei Tage (72 Std.) nach dem Auswaschen auch die Spuren der Coronaviren verschwunden sein sollten. Die Infektionalität verlieren sie allem nach schon früher.
(1)
Die Redaktion lehnte leider die Veröffentlichung mit folgenden Worten ab; "Leider können wir beides nicht veröffentlichen, da wir als offizielles Organ der FMH keine Anleitungen, Regeln etc. in bezug auf das Corona-Virus publizieren. Dafür ist der Bund zuständig."
* ?
Am Montag, den 16.3.20 erschien die "NZZ" mit einer neuen Einteilung der Teilen und Rubriken. Hauptsache war "Coronavirus". Man konnte sich nicht orientieren, musste mühsam und zeiraubend suchen. Ich schickte der Redaktion folgenden Brief:
"Sehr geehrte Redaktion,
nicht Corona- sondern der Tollwutvirus hat sie befallen. als sie die neue, absolut unübersichtliche Einteilung Ihrer bisher inhaltlich nach wie vor hochgeschätzten Zeitung begonnen haben. Oder soll es die gegenwärtig verbreitete Tollheit spiegeln. Sie verstärken sie damit tatsächlich."
Worauf ich folgende Antwort bekam:
"Wir befinden uns in einer ausserordentlichen Situation – die NZZ nimmt diese sehr ernst und versucht, der Leserschaft die besten Informationen, Analysen, Serviceleistungen und Einordnungen zu bieten. Das beinhaltet auch Anpassungen an der Zeitungsstruktur. Diese beschränken sich allerdings auf ausserordentliche Nachrichtenlagen – wie am Montag aufgrund der bundesrätlichen Massnahmen.
In der morgigen Ausgabe kehren wir zur gewohnten Struktur zurück, mit wenigen Ausnahmen."
Es geschah in der Tat und mindestens die "NZZ" kehrte zum Glück in den normalen Zustand.
18.3.20:
Wir sind "über den Berg" auf dem "Naturweg" spazieren gegangen, der teilweise so eng ist, dass man nicht im Abstand von 2m aneinander vorbeigehen kann. Man merkte nicht nur die Angst vor uns, aber auch die Meinung, solche grauhaarige alte Knochen sollen zu Hause hocken, wie es der Bundesrat verordnet hat und nicht Mütter mit Kindern und andere junge, sicher gesunde Leute gefährden. Ich teilte meinen vier Cousinen per e-mail mit, dass Silvia die letzte Burka erwischt hat. Allen anderen telefonisch.
19.3.20:
Heute auf demselben Weg war es besser: Die Leute entfernten sich nicht so weit von uns und grüssten - eine bessere Auslese, oder Gewohnheit?
Ein Schwager wurde in St. Gallen erfolgreich wegen einem engen Spinalkanal operiert, der Schwägerin, der Schwägerin, die auch in einem Privatspital aber in Zürich verschoben sie den Termin von nächster Woche auf unbestimmte Zeit - keine angenehme Lage.
Es hat mich sehr gefreut, dass in der heutigen "NZZ" kritische Leserbriefe zu den Massnahmen der Politik gegenüber Coronavirus veröffentlicht wurden. Ein Leser kritisierte die Redaktion für das "Durcheinander" der letzten Tage. "NZZ " ist wirklich eine gute Zeitung.
*
Ich möchte meine Einstellung betr. Massnahmen gegen Coronavirus zusammenfassen:
Ich meine, sie sind übertrieben, unnatürlich, unnötig. Vor ein paar Tagen veröffentlichte die "NZZ" einen Artikel, der mehr Hysterie im Umgang mit dem Coronarvirus verlangte.
20.3.20:
Der Autor meinte die Übertriebenheit (der unechten Gefühle), die für die Hysterie charakteristisch ist. Aber sie gründet auf Unreife. Auch in der Krise, in der Gefahr, brauchen wir Reife, Ruhe, Besonnenheit. Sie sind Grund für richtige Massnahmen. Ein anderer Redaktor schrieb heute: "Ein Reifetest für die Gesellschaft". Eben, eine hysterische Gesellschaft kann nicht reif sein.
*
Heute war ich mit meiner Maske (s. Bild oben) erstmals in der Stadt. Es überraschte mich, dass sowohl die Leute im Bus, wie auf der Strasse taten, als ob es normal wäre. Unser Sohn Daniel machte uns aufmerksam, dass die Bilder des amerikanischen Malers Edward Hopper zur heutigen Corona-Situation passen. Ja, die Strassen sahen ähnlich aus. Auf dem Marktplatz traf ich noch eine ältere Frau mit einer Maske. Und sogar die Alkoholiker am ihrem Treffpunkt hielten mehr als zwei Meter Abstand voneinander - das ist die Schweiz!
Interessant war auch Gespräch mit unserer Freundin in der Slowakei - Eva Valovicova, Als einzige warf sie sich nicht in die selbstgewählte, sinnlose, schädliche "e-mailkontaktquarantene und braten sich in ihrer "Angstsauce" meldete sich und erkundigte sich, wie es uns geht, worauf ich sie telefonisch anrief. Die Slowaken gehen mit dem Problem des Maskenmangels anders, schöpferischer um als wir Schweizer. Es gibt modebewusste Männer (und Produzenten), die Masken aus dem gleichen Stoff wie ihre Hemden tragen. Ausserdem viele Anleitungen, wie man Masken selbst macht im Internet. Aber bei ihnen
versteigerte sich der Minister für die Gesundheit nicht zu solcher "fake" Aussage wie unser, der
verkündet:"Die Gesichtsmasken sind nicht effizient". Wieviel Infizierte und Tote gehen auf sein Konto,
werden wir nie erfahren. Jedenfalls war es ein gefährlicher Blödsinn.
21.3.20:
Ich kann die Masken nicht verlassen: Heute erschien in der JAMA, Zeitschrift der amerikanischen
Ärztegesellschaft ein Aufruf der Redaktion mitzuteilen Ideen, wie kann man ihren Mangel beheben
(Conserving Supply of Personal Protective Equipment - A Call for Ideas),
Und in der "NZZ" ein Artikel, in dem der Autor U. Bühler, den gefährdeten alten Menschen ans Herz legt, ihre Häuser und Wohnungen (überhaupt) nicht zu verlassen. Es rief folgenden Leserbrief hervor:
In seinem lesenswerten Artikel appelliert U. Bühler an uns alte Leute, unsere Häuser und Wohnungen (überhaupt) nicht zu verlassen. Es ist ein Beispiel für das schwarz-weiss, Entweder-oder-Denken, das nicht nur die Diskussionen aber leider auch die Massnahmen zum Coronavirus beherrscht. Kann mir Herr Bühler erklären, wie gefährde ich meine Mitmenschen und mich, wenn ich in einer Zeit/Gegend ausgehe, in der sich kaum jemand dort und unterwegs befindet? Sogar, wenn ich auf meinem Waldweg bei jemanden vorbeigehe, muss ich eigentlich keinen Abstand von 2 m halten, da die Coronaviren keine Zecken sind, und nicht während der 10-20 Sekunden ob von mir oder von meinem Gegenüberschreitenden überspringen.
Ob man das Seeufer in Zürich gleich sperren muss, ist auch fraglich. Gestern in der Mitte der Stadt am beliebten Treffpunkt, sah ich vormittags zwei Männer mit den Bierdosen in der Hand diskutieren. Sogar sie hielten mehr als 2 m Abstand voneinander. Wie Herr Bühler richtig schreibt, die Durchsetzung der Massnahmen braucht Geduld, nicht nur am Zürichseeufer. Verdienterweise schreibt die «NZZ» auch über die Schäden, die die Isolation hervorruft. Man sollte sie mit Mass und gesundem Menschenverstand einsetzen.
Übrigens, in meiner Patientenverfügung steht, dass ich auf Lebenverlängerungsmassnahmen verzichte. Nicht anders wäre es auch bei einer schweren Coronainfektion – keine Intensivstation, kein Beatmungsgerät, aber genug Morphiumtropfen.
Mal sehen, ob ihn die Redaktion veröffentlicht.
Meine bisherigen Ausführungen sind etwas "nonkonform". Gerne schreibe ich sie schon jetzt, mit der Gefahr, dass sie sich als falsch erweisen werden.
22.3.20:
Gestern Abend hat uns Corinne sehr besorgt angerufen und uns deutlich an Herz gelegt, "vernünftig" und vorsichtig zu sein. Silvia soll nicht mehr einkaufen gehen. Da es auch unser kinesiologischer Muskeltest bestätigte, wird sie sich daran halten. Ihr "Vernunfthauptargument" ist, dass wir sollen helfen, die Spitäler nicht noch zu belasten, weil die Pfleger und Ärzte schon "auf den letzten Zahn beissen" und die normale Versorgung bedroht ist. Schon das "Staffeln", die Verzögerung und damit die Verminderung des Andrangs würde wirken. Eine ihrer Nachbarinnen ist die Frau vom dem Chefarzt einer Infektologieabteilung und sieht jetzt ihren Mann kaum mehr.
Ich möchte meine Einstellung zur Problematik des Coronavirus, die ich oben am 19.3. schrieb endlich erläutern. Sie scheinen hart, gefühllos, zynisch zu sein. Sie sind Ansichten eines unbeteiligten, entfernten "Marsmenschen". Dieser Blick kann uns nicht schaden. Wie es auch in Einzelfällen traurig ist, der Virus ist noch gnädig. Er schädigt Kinder und junge, gesunde Leute kaum und von den älteren eher die schon Schwerkranken. Die Zahl der Gestorbenen ist hoch, aber unvergleichbar mit denjenigen der Opfer der Kriege, sogar der Verkehrsopfer (jedes Jahr sterben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO 1,35 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen). Unsere Massnahmen, unsere Waffen im Krieg gegen den Virus sind stumpf, ihre Wirkung unsicher, weil wir ihn, den Feind eigentlich erst jetzt beginnen kennenzulernen. Sie sind unverhältnismässig. Wegen dem Retten von hunderttausenden Menschen verderben wir das Leben von allen, von Milliarden. Wieviele Todesfälle es kostet, werden wir erst später realisieren. Warum tun wir es, warum sind wir es bereit? Wir möchten den Tod überlisten wie der Arzt im Märchen "Gevatter Tod". Allmählich akzeptieren wir ihn in Einzelfällen, nicht jedoch in der Gesellschaft. Die Politikerin China fürchteten die Unruhen und ihre Absetzung, diejenige in Demokratien ihre Abwahl. So sind sie bereit zu fragwürdigen, ob finanziellen oder anderen Schritten, die sie sonst meiden wie die Pest. Ob sie wirksam werden, ist unsicher und belasten die weitere Generationen. Ich wundere mich, dass diese es (noch) so ruhig hinnehmen. So wie ich fürchten sie die Vorwürfe der Gefühl- und Rücksichtslosigkeit. Aber einmal erwachen sie sicher und die Weisheit der jetzigen Politiker wird, wie es üblich ist, in Frage gestellt. Wenn meine Kinder und Enkelkinder bedroht sind, ob von einer gefährlicher Krankheit oder sonst, übernehme ich die Gefahr gerne. Jetzt belasten wir sie bedenkenlos. Den Politikern imponiert auch der Zuwachs an Macht, den ihnen der Kampf gegen den Virus mit sich bringt. So grosszügig können sie mit ihr, mit Geboten und Verboten, mit Finanzen, nicht umgehen.
Das wirksame Mittel gegen den Ausbruch von Coronavirus
Meine Schwägerin singt in einem gemischten Chor. Bei der Probe vor drei Wochen sass und stand neben ihr eine Frau, die "erkältet" war. Als sich ihr Zustand verschlechterte, wurde sie positiv auf Coronavirus getestet. Niemand aus dem Chor mit vorwiegend über 60-jährigen Menschen ist bisher erkrankt. Wie viele sind Träger (gewesen) bleibt unklar.
Es geht nicht anders, morgen kehre ich zu meinem beliebten Thema - zu den Schutzmasken zurück.
24.3.20:
Gestern war ich sehr beschäftigt, so konnte ich leider hier nicht schreiben. Silvia liess sich von Corinne überzeugen und bat eine unsere Nachbarin, die sich schon früher angeboten hatte, die Lebensmitteleinkäufe für uns zu besorgen. Sie ist eine nicht berufstätige Ärztin mit Neigung zu Alternativmethoden. Ich verdächtige sie, dass sie eine Vegetarierin ist. Sie bekommt jetzt die Übersicht, wie (gesund) wir uns ernähren. Heute brachte sie sie, sogar zur Zufriedenheit der heiklen Silvia. Sie war mit dem Einkauf zufrieden, aber merkte, dass ihr erst im Geschäft einfällt, was wir brauchen. Die Nachbarin geht jedoch nur einmal pro Woche einkaufen, was für Silvias Bedarf an (frischen) Gemüse und Obst nicht reicht. So haben wir es mit der Hauslieferung bei den Grossisten versucht. Beim MIGROS war es hoffnungslos, beim COOP war die Homepage fürchterlich mühsam für jemanden, der das erste Mal per Internet einkaufen möchte. Wir mussten erst zweimal telefonieren, bis wir klug geworden sind. Es dauerte über jeweils 10 Minuten bis wir durchkamen. So eine schlecht funktionierende Homepage ohne Anleitung ist eine Schande für so einen Betrieb.
Die übertriebene, krankhafte Mischung von Ausdauer und Konsequenz nennen die Psychiater "Klebrigkeit". Nein, ich bin nicht klebrig, wenn ich wieder über die Schutzmasken schreibe. Gestern habe ich vernommen, dass die slowakische Präsidentin eine sehr gute Rede zur Nation im Fernsehen gehalten hat. Dabei hat sie die Bluse und die Schutzmaske aus demselben Stoff! In der "NZZ" war wieder ein überflüssiger Artikel darüber, ob die Masken nützen. Dagegen im letzten "Spiegel" konnte man die klar positive Stellung eines Virologe lesen. Er meinte, jeder könnte sich so eine Maske selbst nähen, sogar aus einem bunten Stoff, was sogar "schick" sein könnte (Nr. 13, S. 105).
In einem Pflegeheim in Würzburg wurde der Coronavirus eingeschleppt - die "worst case" Situation, die Katastrophe: völlige Überforderung des Personals, die Unmöglichkeit die ängstlichen Demenzpatienten in Masken zu betreuen und zu pflegen. Was tun? War es nicht angebracht, "palliativ" die Patienten nur grundhygienisch zu pflegen und Morphium-Tropfen zu geben? Vermutlich wurde es so getan.
Es erinnerte mich an die Kriegszeit, als sowohl die Strelingers ihre Grossmutter, wie wir unseren Grossvater verlassen mussten, denn mindestens wir wollten uns eventuell retten. Mit ihnen wären wir sicher alle umgekommen. Ein ethisches Problem? Nein, eine schwere Belastung, aber im Krieg nicht unüblich. Und jetzt sind wir im Krieg. Nicht von Menschen angezettelt, sondern von einem Virus und gegen ihn. Er führt zu übertriebenen Ansprüchen, Erwartungen und Massnahmen, wie ich am 19.3. bemerkte.
Ausserdem wäre es hilfreich, wenn wir bereits Pflegeroboter hätten.
Morgen zum Thema: "Wie gefährlich oder wie gnädig ist der Coronavirus".
25.3.20:
Beides. Gnädig ist er, weil er für Kinder und junge Leute nicht gefährlich ist. Kaum ein Kind ist jetzt an seiner Infektion gestorben. Es tönt zynisch, aber er tötet meistens Leute, deren Leben sich sowieso zu Ende neigt. Er macht eine "natürliche" Auswahl, Selektion. In einem Artikel in der heutigen "NZZ" weist der ehemalige Stanford-Professor H. U. Gumbrecht darauf, dass es bis Ende des 2. Weltkrieges üblich war, die jungen Leute als Soldaten für den Tod zu selektionieren (eigentlich in den Balkankriegen und nachher auch anderswo).
Ich wundere mich, dass sich junge Menschen noch nicht dagegen wehren, was mit ihnen, mit ihrer Zukunft geschieht. Sie begreifen es vielleicht noch nicht und befürchten als Verbrecher beurteilt zu werden. Aber wenn der Schock, die Starre vergeht?
Warum können, bzw. müssen wir diesen Kampf gegen den Virus mit solchen "harten Bandagen" führen? Während wir beginnen den individuellen Tod einigermassen zuzulassen, in der Schweiz auch den Freitod, als Gesellschaft akzeptieren wir ihn nicht. Er muss, koste es was es wolle, verhindert werden.
26.3.20:
Heute erschienen im "New England Journal of Medicine" mehrere Artikel über den Coronavirus. In einem analysierten die Wissenschaftler aus Wuhan, wo der Virus seinen Weg begann, die Wege seiner Verbreitung. Sie kamen u.a. zu einer enorm wichtigen Erkenntnis: Der Virus verbreitet sich nur über den direkten Kontakt zwischen den Personen, am ehesten durch eine sog. Tröpfcheninfektion, nicht über Gegenstände! Das heisst, die Desinfektion der Gegenstände ist nicht so wichtig, wie der Schutz beim Niessen, Husten und nahen Atmen. Wir wissen, was wir tun und lassen sollten. Damit können die strengen Isolationsvorschriften gelockert werden, die Leute können arbeiten, die Kinder wieder in die Schule gehen. Ich bin neugierig, wie lange wird es den massgebenden Politikern und ihren Fachberatern dauern, bis sie diese Schlussfolgerungen ziehen und auch anwenden.
27.3.20:
Es bedeutet auch, dass man als ein gewöhnlich Sterbender keine Schutzhandschuhe tragen muss und die Hände nicht zu viel waschen und desinfizieren sollte. Ausser bei Kontakt mit Corona-Patienten. Silvia bekam gestern rote, juckende Hände nach dem ständigen Benützen des Desinfektionsmittels. Jetzt nicht mehr, seit sie darauf verzichtet und die Hände nur mit Seife wäscht.
*
Am 19.3. habe ich die Massnahmen gegen den Coronavirus übertrieben, unnötig, hysterisch genannt. Jetzt bürgerte sich die Bezeichnung "unverhältnismässig" ein. Es beruhigt mich, dass in der Schweiz ein "Bundesamt für Justiz" (BJ) existiert, das darüber wacht, dass die Politiker im Rausch ihrer Macht während des Notstandes sie nicht missbrauchen. Auch den Parlamentariern gefällt nicht, dass der Bundesrat so frei schalten und walten kann, und Corona hin oder her, ihre Sitzung spätestens in einem Monat durchführen möchten.
28.3.20:
Nachdem ich am Morgen neue Arbeiten über die Verbreitung von Coronavirus (u.a. von einer schwangeren, infizierten Mutter auf ihr Kind im Mutterleib - ja!) gelesen habe, kam mir in den Sinn, dass man weder in China, USA, Italien, nirgendwo die Verbreitung auf die Kinder der Infizierten, also von Erwachsenen auf die Kinder verfolgte. Es gibt zwei Möglichkeiten, warum Kinder und Jugendliche nicht erkranken. Entweder können sie nicht infiziert werden, oder sie zeigen keine Krankheitszeichen, sie sind damit gefährliche, unbemerkte Träger und Verbreiter des Virus. Im zweiten Fall muss man sie wie kranke Erwachsene isolieren, im ersten dürfen sie sich frei bewegen und können auch die Schule, Krippe, Kindergarten besuchen, sich treffen und frei bewegen. Dies veranlasste mich an die Chefs der epidemiologischen Institute in der Deutschschweiz folgendes Mail zu schicken:
"Sehr geehrte Epidemiologiehäuptlinge der Deutschschweiz,
in dieser Woche sind 3 Arbeiten erschienen, die weitgehende praktische Konsequenzen haben.
-
Die Übertragung des Covidvirus ist nur mit direkten persönlichen Kontakt möglich (1,2).
-
Auf der anderen Seite die Überträger können auch Tiere sein, was eventuell die bisher unerklärliche starke Verbreitung in manchen Ländern begründet (3).
Was jedoch noch fehlt, ist die Beantwortung der enorm wichtigen Frage mit praktischen Konsequenzen - wie ist es mit Kindern und Adoleszenten? Infizieren sie sich nicht, oder erkranken sie nur klinisch nicht. Wenn nicht, ist es eine gute Quelle für Forschung.
Ich denke, in Zusammenarbeit könnten Sie diese Frage schnell beantworten.
Mit besten Grüssen
Peter Marko, Dr. med.
1doi/full/10.1056/NEJMoa2001316
2 DOI: 10.1056/NEJMoa2005412
3 doi: 10.1056/NEJMc2005157 "
Mal sehen, wie sie reagieren werden.
*
In der Tagesschau um 19,30 sahen wir, wie man in Südafrika weiterhin die Gegenstände auf den Strassen desinfiziert. Sie wissen noch nicht, dass es sinnlos ist. Und in Italien steigen trotz den strengen Massnahmen die Zahlen der Infizierten, der Kranken und der Gestorbenen unbeeinflusst weiter im schnellen Tempo. Es sollte klar sein, dass wir auf dem falschen Weg sind, falsche, unwirksame Massnahmen anwenden. Der Virus hat irgendwelche Eigenschaften, die wir nicht kennen und er findet Wege, sich weiter zu verbreiten. Umdenken ist nötig. Das ist aber schwierig. Es erinnert an den Kampf im Finanzsektor gegen die Finanzkrise.
29.3.20;
In der gestrigen "NZZ" schrieb der ehemalige, sehr erfolgreiche Chefredaktor der "Schweizerischen Ärztezeitung" B. Kesseli eine Kolumne, in der er die Arbeit der Bundesbehörden in der Coronakrise, wenn auch nicht lobte, so guthiess. Heute morgen schickte ich ihm folgendes Mail :
"Sehr geehrter, lieber Herr Kesseli,
es war sehr interessant, Ihren Artikel über den Alltag in der Allgemeinpraxis in der Coronazeit zu lesen. Er wird zur Geschichte unseres Faches gehören.
Ihrer wohlwollenden Einstellung zur Aktivität der Gesundheitsbehörden in der Coronazeit kann ich hauptsächlich aus folgendem Grund nicht zustimmen: Es zuckte in mir als, ich die Beurteilung der Wirksamkeit der Schutzmasken aus dem Mund des Bundesrates hörte: «sie sind nicht effektiv». Gleich habe ich meine Meinung dem BAG sowohl schriftlich, wie auch telefonisch über Hotmail mitgeteilt. Bis heute ohne Reaktion. Es spricht nicht die «beleidigte Leberwurst» aus mir, aber es zeigt sich immer mehr, dass der Mundschutz eine wichtige Waffe gegen die Verbreitung des Coronavirus ist, da er sich zum Glück nicht über Gegenstände, aber «nur» durch den direkten Kontakt verbreitet. Es ist auf eine Weise sehr beruhigend, hat auch weitgehende, praktische Konsequenzen, z.B. das Tragen der Masken.
Nicht nur die Schweiz hat(te) Mangel an Schutzmasken. Sie reagierten ehrlicher, schöpferischer, wirksamer: Sie veranlassten die Bewohner, die Masken selbst anzufertigen mit unzähligen Anleitungen im Internet. Die slowakische Präsidentin hielt die «Coronanasprache» zur Nation in einer Bluse aus demselben Stoff wie ihre Schutzmaske, was dort schon vorher zur Mode wurde.
Nach der Veröffentlichung der wichtigen Berichte über die Verbreitung der Infektion in Wuhan und in einem Alterspflegeheim in den USA (und im Mutterleib) ist mir in den Sinn gekommen, dass wir merkwürdigerweise nicht wissen, warum die Kinder und Jugendlichen nicht erkranken: Reagieren sie nur nicht und sind jedoch Träger oder vermehrt sich bei ihnen der Virus überhaupt nicht, was eine enorme praktische Bedeutung hätte. Ich habe es den Deutschschweizerepidemiologen mitgeteilt.
Zur Ruhmesseite der Bundesgesundheitsbehörden gehört auch nicht, dass sie kein Beratungsgremium aus Fachleuten zugezogen haben.
Mit besten kollegialen Grüssen
Peter Marko"
*
Warum steigt die Zahl der Cornapatienten und der Gestorbenen in Italien weiterhin stark? Warum zeigt sich nicht die Wirkung der drastischen Massnahmen? Gibt es eine Kombination von einer Übertragung durch Tiere und dann von Mensch zu Mensch, wie es ein chinesischer Epidemiologe vermutet (DOI: 10.1056/NEJMc2005157) für Pangoline (Schuppentiere),? Vielleicht erklärt es teilweise auch die grossen Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern. Der Virus bietet uns Rätsel.
*
Man setzt gedankenlos Beatmungsgeräte auf den Intensivstationen auch bei >80-85-jährigen Patienten ein. Hoffentlich wird man auch nach ihrer Rettung schauen, in welchem Zustand sie überlebten, welche Schäden sie davon tragen. Man wünscht sich aus guten Gründen, dass viele diese Behandlung ablehnen.
*
Die Frage der hohen Zahlen der Kranken und der Sterbenden stellte ich (telefonisch) auch unserer Nachbarin, einer Spanierin. Sie konnte mir keine Erklärung geben. Am Abend rief sie mich an und berichtete, sie sprach mit einem befreundeten Ärzteehepaar in Spanien. Sie sagten, in Fachkreisen gibt es die Meinung, die Italiener und Spanier hätten ein anderes Immunsystem. Sie widerstehen länger der Infektion, sind zuerst Träger, dann nur leicht krank, bis das Immunsystem überfordert ist und dann schnell versagt. Jede Hilfe ist dann vergeblich.
Es ist eine nachvollziehbare Erklärung. Werden wir sehen, ob sie sich bestätigt.
30.3.20:
Ich habe vergesse, dass ich vor einer Woche folgenden Leserbrief der "NZZ" schickte:
"Betr.: Bühler U: Alte verdienen von uns … NZZ 21.3.20, S.15.
In seinem lesenswerten Artikel appeliert U. Bühler an uns alte Leute, unsere Häuser und Wohnungen (überhaupt) nicht zu verlassen. Es ist ein Beispiel für das schwarz-weisse Entweder-oder-Denken, das nicht nur die Diskussionen aber leider auch die Massnahmen zum Coronavirus beherrscht. Kann mir Herr Bühler erklären, wie gefährde ich meine Mitmenschen und mich, wenn ich in einer Zeit/Gegend ausgehe, in der sich kaum jemand dort und unterwegs befindet? Sogar, wenn ich auf meinem Waldweg bei jemanden vorbeigehe, muss ich eigentlich keinen Abstand von 2 m halten, da die Coronaviren keine Zecken sind, und während der 10-20 Sekunden weder von mir noch von meinem Entgegenschreitenden überspringen.
Ob man das Seeufer in Zürich gleich sperren muss, ist auch fraglich. Gestern in der Mitte der Stadt am beliebten Treffpunkt, sah ich vormittags zwei Männer mit den Bierdosen in der Hand diskutieren. Sogar sie hielten mehr als 2 m Abstand voneinander. Wie Herr Bühler richtig schreibt, die Durchsetzung der Massnahmen braucht Geduld. nicht nur am Zürichseeufer. Verdienterweise schreibt die «NZZ» auch über die Schäden, die die Isolation hervorruft. Man sollte sie mit Mass und gesundem Menschenverstand einsetzen.
Übrigens, in meiner Patientenverfügung steht, dass ich auf Lebenverlängerungsmassnahmen verzichte. Nicht anders wäre es auch bei einer schweren Coronainfektion – keine Intensivstation, kein Beatmungsgerät, aber genug Morphiumtropfen."
Heute hat sie den kursiv gezeichneten Text veröffentlicht.
31.3.20:
Heute hat Silvia meiner Cousine Jean in Irland auf ihr Mail geantwortet: Es illustriert etwas, wie wir leben:
"Dear Jean,
thanks very much for your kind mail. First of all we are glad that your family is ok. As we see you have to behave like we have to do as well. The only difference between you and Peter and me is that we have the forest with lots of ways for walking next to our apartment, so we go out at least once a day for a nice walk. We have also nearby a farmer, who sells fruits of his own, potatoes, even meat, fresh and already cooked, of course also milk and cheese. She bakes cakes every day, which one can eat there or take it home. So we envited once my youngest brother with his wife. First we had a nice walk together, but always with a certain distance and then we had coffee and cake together and as it was a special situation the farmer and his wife came with a bottle of a home-made herbal liqueur and we drank alltogether a little glass (except the strong abstinent Silvia). It was like having a feast. But otherwise a woman in the neighbourhood purchasing for us. In the beginning I went to the shops myself but our daughter Corinne forbid it.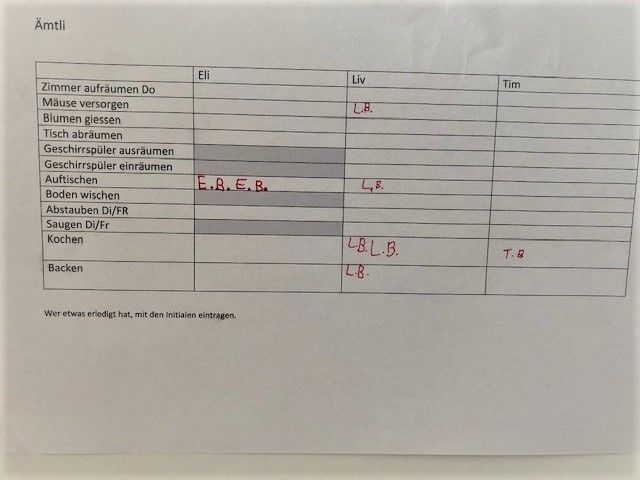
(2) Coronaaufgabenplan.
That is also the reason why we answer only now, because I had to sew masks for Corinne and her family, so the children can allow themselves more easily to go out and play at least in the court-yard. The children in Switzerland are not allowed to go to school. They have to work at home. So for Corinne this is not very easy. She should also work at home and with 3 children at home it is not funny at all. To keep them active, she told Liv and Tim to cook for the whole family and they had to produce extravagant meals. Sea the enclosed pictures and Peter with the mask I made.
Switzerland has not enough masks for all the people. So they tell that they are not effective and did not change this stupid opinion. Thats why I had to sew them myself. In addition to the mask one should also wear glasses, because according to the neighbour, a medicine, eyes are the forgotten gates for corona. Peter had to go to the hospital because of his eye-pressure. He was the only patient with a mask and the doctor asked first, whether he was infected, but then he was quite happy and thankfull and said that he was a reasonable man.
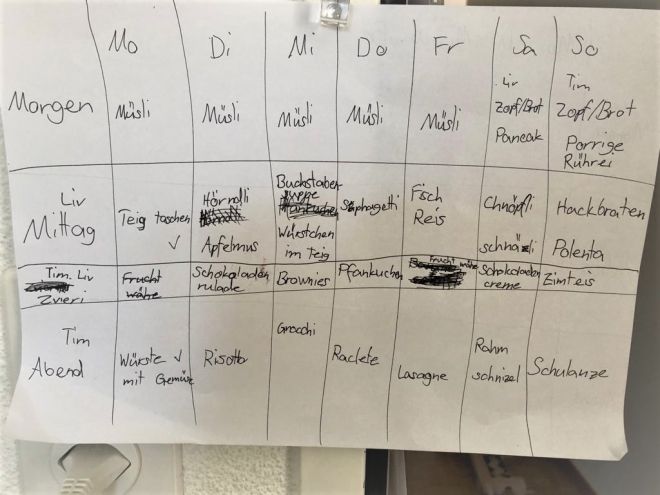
(3) Coronakocheinteilong.
Keep your head high, the ears stiff and the mood good – keep healthy"
Inzwischen "normalisiert" sich die Lage und die Reaktion der Behörden, Institutionen, Menschen. Während vor einer Woche die Infektion in einem Alters-Pflegeheim in Würzburg (s. 25.3.20) zu einer Katastrophe führte, betreuen jetzt unsere Heime infizierte Patienten weiterhin, falls sie sich es wünschen. Die Leute sollen auch weiterhin arbeiten gehen und die Vorsichtsmassnahmen halten, unter welchen endlich auch das Tragen der Masken gehört. Ofiziell wurde es weder vom BAG (Bundesamt für Gesundheitswesen) noch von Bundesrat Berset verkündet. Und wie lange dauert es noch, bis sie begreifen und verkünden, dass man sich nicht über Gegenstände infizieren kann? In der "NZZ" gibt es Artikel mit Überschriften wie: "Das Notrecht stiesst rasch an die Grenzen" … Ja, es beginnt wieder der gesunde Menschenverstand zu herrschen und wir kehren von der "Anfangshysterie" zurück zum
Glück.
1.4.20:
Ausserdem schrieb dort der Lausanner Epidemiologe Salthé ein Loblied auf die Masken und ich sprach telefonisch mit meinem Freund William Krivan, emeritierter Professor für Analytische Chemie in Ulm, der in einer Arbeit die Wirksamkeit verschiedener Masken für Stoffe mit kleineren Molekülen als Viren bestimmte. Die Unwirksamsten filtrierten noch immer 80%! Er machte mich auch darauf aufmerksam, dass die Luftverschmutzung ein günstiger Faktor für die Verbreitung der Viren ist. War in Wuhan, Norditalien die Luft rein? Die gegenwärtigen Massnahmen vermindern die Luftverschmutzung. Wann zeigt sich ihre Wirkung auf die Verbreitung des Virus?
Heute morgen erschien auf der ersten Seite der "NZZ" ein Artikel mit dem Titel "Bund widerspricht sich bei Masken"! Ich verfasste gleich folgenden Leserbrief:
"Betr.: Surber M, Rhyn L: Bund widerspricht sich bei Masken. NZZ 1.4.20, S.1.
Als Bundesrat Berset vor drei Wochen am Anfang der Verbreitung des Coronavirus in der Schweiz verkündete: «Die Masken sind gegen Coronavirus nicht effektiv», zuckte es in mir. Seine Absicht die Bevölkerung durch eine Lüge (falsch) zu beruhigen war mir klar, nicht dass der Mangel an Masken selbstverschuldet war. Seit dem Tag bin ich nicht müde, leider vergebens, BAG zu bitten, diesen Lapsus zu korrigieren. Mehr noch, die Einwohner der Schweiz auch herauszufordern und zu instruieren, die Masken selbst anzufertigen, wie es zum Beispiel in der Slowakei auch durch die Präsidentin in einer Ansprache geschah. Sie trug dabei eine Maske aus dem gleichen Stoff wie die Bluse, inzwischen dort sinnvolle Mode bei Frauen wie bei Männern mit ihren Hemden.
Bisher hat sich niemand ohne Kontakt mit einem Menschen über Gegenstände infiziert. Die Schlussfolgerung davon, dass das übertriebene Händewaschen und die Desinfektion unnötig sind, wagt niemand zu ziehen, auch wenn es sehr beruhigend ist."
*
Leider muss ich meine Behauptung vom 23.3. zurückziehen. Singen wirkt nicht gegen Coronavirus. Vom Chor der Schwägerin wurden doch mehrere Personen angesteckt. 6 hatten Symptome und ein Ehemann musste ins Spital. Niemand ist gestorben. Schwägerin möchte wissen, ob ihre leichten Symptome in den Tagen nach dem Singen durch den Coronavirus verursacht wurden. Falls ja, ist sie immun und kann furchtlos leben. Der Arzt hat es bisher abgelehnt, auch wenn sie zur Risikogruppe gehört. Mal warten auf mehr Tests.
3.4.20:
Heute schlugen wir W.N., einem Vetter von Silvia, vor, dass wir uns auf dem Halbweg am Montag bei unserem Bauer treffen könnten und dort zum von der Bäuerin selbstgemachten Kuchen Kaffee zu trinken, was ich jetzt fast täglich tue. Wir vergassen, dass W. ein ehemaliger Kommandant der Kripo von St. Gallen und somit vielen Leuten bekannt ist. Für so eine Person gehört es sich heutzutage nicht, auszugehen und sich im Kreise von 4 Personen zu unterhalten. Vielleicht korrigiert bis Montag der Bundesrat seine Vorschriften. Jedenfalls seine Frau Y. möchte kommen.
4.4.20:
Heute morgen habe ich folgendes Mail an BAG geschickt. Es spiegelt auch meine veränderte Einstellung zu Masken;
"Die gegenwärtigen gut begründeten Kenntnisse und Massnahmen gegen den Coronavirus:
-
Der Virus verbreitet sich nur direkt vom Menschen zum Menschen, nicht über Gegenstände.
-
Der Kontakt muss dazu eng sein.
-
Er muss auch länger dauern.
-
Der Virus wird schon durch das Waschen mit Seife unschädlich gemacht.
-
Die Desinfektion, ob der Hände oder Gegenstände ist (ausser vielleicht beim Kontakt mit Infizierten) überflüssig.
-
Das Maskentragen ist im Freien überflüssig. Beim Vorbeigehen kann man sich nicht anstecken.
-
Das Maskentragen ist nötig bei Kontakt mit Infizierten, Aufentalt in Spitälern, Arztpraxen. u.ä.
Dies ist gut begründet und durch die relativ geringe Zahl der Infizierten auch bewiesen. Diese Kenntnisse und Massnahmen würden die Leute beruhigen, befreien, sicherer machen und Zeit und Geld sparen. Bitte verkündet sie so bald wie möglich.
*
Gestern erhielten wir ein Packet von unseren Enkelkindern mit folgenden Gegenständen:
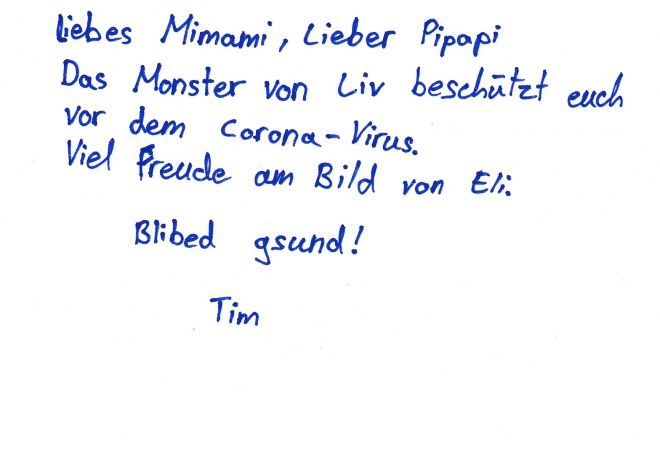
(4) Begleitbrief von Tim.

(5) Spuck von Liv, derCoronaviren abschrecken wird.

(6) Bild von Eli, das sein Zustand und Einstellung zum Virus darstellt samt kackendem Tier und Viecher in der Erde.
5.4.20;
Die Angst vor Corona hat eine weitere unerwünschte Nebenwirkung: Die ernsthaft kranke Patienten wagen nicht sich behandeln lassen. Wie viele sind es, wie viele sterben daran, erfahren wir nie.
*
Es ist ein wunderschönes Wochenende. Die Städte haben unterschiedliche Einstellung zum Ausgang; manche sperren beliebte Gebiete, wo sich die Menschen sammeln können, wie Zürich und Luzern die Seeufer, andere appellieren auf die Vernunft und Einhalten der Verhaltensregel wie Basel, die Rheinufer frei, aber unter Kontrolle lässt. Mal sehen, welche Art sich bewährt. Ich bin für Basel.
Klare, vernünftige Empfehlungen der Gesudheitsbehörden würden helfen.
*
Das Singen ist nicht nur nicht gegen Corona wirksam (s.23.3. und 1.4.), aber vermutlich verbreitet den Virus besonders wirkungsvoll: Bei Husten, Niessen und vermutlich auch Singen entstehen "Wolken", die sich viel weiter, bis 20m verbreiten, als die einzelne Viren beim Atmen. Deswegen sollen Personen, die Kontakt mit Coronapatienten haben unbedingt Masken tragen. Hoffentlich bald, nach dem genug Tests vorhanden wird, erfahren wir, ob unsere Schwägerin, die nach dem Singen leicht erkältet mit Fieber war, Coronainfektion überstand. Ihr e Tochter und Enkelkind hatten damals auch "Grippe". Auf positiv ich tippe.
*
Eine Bekannte war beidem einem Arzt mit der Maske, der sich gewundert hat, warum. Sie soll wieder gehen und ist verunsichert - mit oder ohne. Es ist Folge von derchwammmigen, nicht detaillierten Informationspoltik ders "BAGs". Niemand würde ihnen die eventuelle aber gut begründete Widerrufung ihrer auch gut begründeten Empfehlungen. Unsere Kenntnisse über Virus ändern sich auch.
8.4.20:
Gesttern war ich im Spital wegen der Spritze in das rechte Aue. In Unterschied zum lezten Mal (20.3.) trugen viele Patienten und fast alle Angestellten auch draussen Masken. Sie wollten mir statt meiner Stoffmaske (17.3.) eine Chirurgische verpassen, was ich als Mistrauen und Entwürdigung von Silvias Werk betrachtete und strikt ablehnte.
*
Der¨österreichische Bundeskanzler leitete die Normalisierung ein. Es ist zu hoffen, dass unsere Politiker bald ihn folgen werden. Ich schrieb wieder einen Leserbrief der "NZZ", quasi ale Empfehlung für die beschleunigte Normalisation:
"Da das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit der Verkündigung folgender Tatsachen und ihrer Folgen zögert, bitte ich die «NZZ» um die Veröffentlichung:
-
SARS-CoV-2 ist nur über direkten Kontakt zwischen Menschen, nicht jedoch über Gegenstände übertragbar. Ihre Desinfektion ist überflüssig. Für die Reinigung der Hände reicht das Waschen mit Seife, Seife tötet den Virus (auch NZZ vom 4.4.2020).
-
Der Virus wird bei einer normalen Atmung nicht über eine Distanz von 2m übertragen. Beim Husten, Niessen kann sie bis 20m steigen.
-
Die Übertragung braucht eine gewisse Menge des Virus (virus load), somit auch die Dauer des Kontakts.
-
Die Schutzmasken sind wirksam und wichtig bei einem längeren Aufenthalt mit Menschen in geschlossenen Räumen wie in Arztpraxen, Spitälern und anderen Räumen mit länger weilenden Menschen. Im Freien sind sie überflüssig ausser s. P. 2 und 3.
-
Beim Kontakt mit SARS-CoV-2-Patienten sollte man auch Schutzbrille tragen
Diese Kenntnisse haben weitgehende Folgen für die Arbeit, Wirtschaft und das tägliche Leben. Man sollte das Leben so weit wie möglich erleichtern und nicht unnötig erschweren.
Die Fachliteratur wird Interessierten gerne zur Verfügung gestellt."
"
Heute erschien wieder ein Artikel über Wirksamkeit und Sinn der Masken gegen Corona- Ich schrieb wieder einen Leserbrief:
"Betr.: Schöchli H: Was Masken gegen Viren wirklich bringen. NZZ 7.4.2020, S. 13.
In gewohnt klaren Worten und sachlich fasst der Autor das Problem der Masken im Schutz gegen SARS-Covid-2 Virus zusammen. Wie er richtig schreibt, muss man differenzieren und nicht Birnen und Äpfel vergleichen. Dieser Virus ist nicht ein Grippevirus, und man müsste wissen, unter welchen Bedingungen die Studien durchgeführt wurden. Beim Husten, Niessen nützen die Masken sicher weniger als beim ruhigen Atmen. Im gestrigen Leserbrief fasste ich die Schlussfolgerungen folgendermassen zusammen: «Die Schutzmasken sind wirksam und wichtig bei einem längeren Aufenthalt mit Menschen in geschlossenen Räumen wie in Arztpraxen, Spitälern und anderen Versammlungen mit länger zusammen weilenden Menschen. Im Freien sind sie überflüssig, sofern der Abstand von 2 m eingehalten wird». Heute ist eine Arbeit über die Schutzwirkung der Masken beim Husten der Patienten mit Covid-2 erschienen (DOI: 10.7326/M20-1342 ). Beide, sowohl Chirurgische- wie Baumwollemasken schützen nicht vor der Verbreitung des Virus beim Husten, die Baumwollmasken schneiden noch etwas besser ab. Eine andere Veröffentlichung zeigt, dass die Krankenschwester, die einen hochinfektiösen aber nicht hustenden Säugling fütterte und wickelte, erkrankte nicht. Sie trug selbstverständlich eine Schutzmaske. (DOI: 10.7326/M20-0942 )."
9.4.20:
Heute habe ich folgenden Leserbrief der "NZZ" (ohne Literatur und leich verändet) und der "SÄZ" geschickt:
"Der weisse Fleck der Coronaepidemie
Trotz Appellen mancher Epidemiologen und Pädiater (1-3) kennen wir leider die genauen Daten über die Ansteckung und Verbreitung des Covidvirus bei Kindern und Jugendlichen
Diese Lücke ist desto merkwürdiger, als die entsprechenden Kenntnisse mit einem relativ kleinen persönlichen und finanziellen Aufwand zu gewinnen wären: Man braucht nur die weitere Ausbreitung des Virus in Familien der kranken Erwachsenen mit Kindern zu verfolgen.
1 Rasmussen SA,Thompson LA: Coronavirus disease 2019 and children What pediatric health care clinicians need to know. JAMA Pediatr. Published online April 3, 2020. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.1224.
2 John E, Wong L Leo YS Tan,CC;: COVID-19 in Singapore current experience Critical global issues that require attention and action JAMA. 2020;323(13):1243-1244. doi:10.1001/jama.2020.2467.
3 Wei M, Yuan J, Liu Y, al: Novel coronavirus infection in hospitalized infants under 1 year of age in China. JAMA. 2020;323(13):1313-1314. doi:10.1001/jama.2020.2131.
4 Qun Li, Xuhua Guan, Peng Wu, at al: Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus–infected pneumonia. N Engl J Med 2020; 382:1199-1207, DOI: 10.1056/NEJMoa2001316-
5 Zhu N, Zhang D, Wang W, et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. N Engl J Med 2020; 382:727-33. doi: 10.1056/NEJMoa2001017.
.6 Liu W, Zhang Q, Chen J,, et al: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32163697">Detection of covid-19 in children in early January 2020 in Wuhan, China. N Engl J Med. 2020 Apr 2;382(14):1370-1371. doi: 10.1056/NEJMc2003717
7 Mizumoto K, Kagaya K, Zarebski A, Chowell G. : www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32183930">Estimating the asymptomatic proportion of coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases on board the Diamond Princess cruise ship, Yokohama, Japan, 2020. Euro Surveill. 2020 Mar;25(10). doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.10.2000180.
8 Sominsky L, Walker DW, Spencer SJ: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32205119">One size does not fit all - Patterns of vulnerability and resilience in the COVID-19 pandemic and why heterogeneity of disease matters. . Brain Behav Immun. 2020 Mar 20. pii: S0889-1591(20)30366-4. doi: 10.1016/j.bbi.2020.03.016. "
10.4.29:
Nach dem ich einen Berict in der gestrigen "NZZ" ("Mit Munschutz und Gummihandschuhen -der Halbleiterzulieferer VAT arbeitet im St. Galler Rheintal unter strengen Hygieevorschriften" gelesen habe, in dem beschrieben wird, wie die Leute die Probleme mit Coronavirus am Arbeitsplatz selbständig und gu lösen, schrieb ich folgenden Lesserbrief:
"Der Artikel ist ein schönes Beispiel, wie Leute «mit gesundem Menschenverstand» vernünftig handeln, wenn man ihnen die Verantwortung für die Folgen überlässt, wenige richtige, gut begründete Anweisungen gibt und sie nicht unnötig beschränkt:
-
Bei jeglichen Versammlungen 2m Abstand halten. Beim Kontakt unterhalb 2m Schutzmasken tragen.
-
Hände mit Seife waschen. Desinfektion der Hände und Gegenstände ist überflüssig, da das SARS-Covid-2-Virus nur über direkten Kontakt zwischen Menschen übertragbar ist.
-
Ausnahmen sind die Betreuung der nfizierten Menschen, bei der auch Augenschutz nötih ist, Aufenthalt im Spital und Arztpraxen.
Bei Einhaltung dieser zwei Regeln kann man sofort ein fast «normales Leben» beginnen: Die Geschäfte und Restaurants können öffnen, die Menschen können sich draussen ohne Masken frei bewegen, die öffentlichen Verkehrsmittel beschränkt benützen (ein direkter Kontakt unterhalb 2-3 Minuten ist unbedenklich). Ob die kleinen Kinder in den Kindergarten und in die Schule gehen können, sollte eine nicht schwierige und zu komplizierte Studie über die Übertragung des Virus bei ihnen zuerst schnell zeigen. Es ist ein weisser Fleck in unseren Kenntnissen über die Verbreitung des Virus, mit weitgehenden Folgen, der baldmöglichst verschwinden sollte. Wir kämpfen nicht nur gegen ein Virus, das relativ gutmütig ist, aber auch gegen (teilweise unbegründete) Angst davor."
Die ungeklärte Problematik der Infektion bei den Kindern lässt mich nicht in Ruhe.
*
Einen abschreckenden Beispiel für eine Entweder-oder, schwarz-weis blödsinjnige Dekweise haben wir in der "Tagesschau" gesehen: Sowohl die Schweizer wie noch mehr die niederländische Gärtnereien vernichten tonnenweise Blumen stat eine neue Formen des Verkaufs zu entwickeln. Warum könne die Kunden nicht wie in anderen Läden nur tropfenweise in die Riesengeschäfte nicht kommen, oder die Blumen draussen holen und bezahlen? Auch wenn der Umsatz nicht derem Vorjahr entspäche, aber so klein, dass es sich nicht lohnt, wäre es sicher nicht. Die Garten werden dieses Jahr unnötigerweise weniger bunt und schön.
13.4.20:
Heute habe ich zum Leserbrief vom 9.4.20 noch folgenden Absatz beigefügt:
"Auch über die Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen gegen die Verbreitung des SARS-Covid-19-Virus herrscht merkwürdigerweise noch immer Unklarheit (9). Man könnte sie einfach beheben: Eine kleine Anzahl (6?) Patienten, die den Virus sicher noch verbreiten (2-4 Tage nach Beginn der Symptome) lässt man zuerst 2,5 und 10 Minuten atmen, dann durch die Schutzeinrichtungen husten. Man bestimmt die Virusbelastung in der ausgeatmeten und in der ausgehusteten Luft. Und somit ist Ende der Unklarheit."
Mit folgender Referenz:
9 Mahase E: Covid-19: What is the evidence for cloth masks? BMJ 2020;369:m1422 doi: 10.1136/bmj.m1422.
*
Der "NZZ" habe ich folgenden Leserbrief geschickt und bat die zwei letzten vom 7. und 9.4. zugunsten von diesen eventuell nicht veröffentlichen:
"Betr.: Fischer PA: Lange darf es so nicht weitergehen. NZZ 11. April 20202, S.10.
Dem Autor stimme ich gerne zu. Um eine U-Kurve der Folgen der Coronaepidemie in eine möglichst V-ähnliche umzuwandeln (das heisst schnell zur Normalität zurückzukehren) und eine L-Kurve (unveränderte Verhältnisse) zu vermeiden, sollte man das wirtschaftliche und tägliche Leben nicht mit unnötigen, unwirksamen, damit schädlichen Massnahmen belasten und erschweren. Inzwischen weiss man, dass auch ein allgemeines Ausgangsverbot zu ihnen gehört. Da man sich nur durch direkten Kontakt infizieren kann, ist eine Desinfektion der Gegenstände überflüssig. Auch die Luft in Räumen mit Infizierten ist nicht ansteckend. Es sind «nur» die Tröpfchen aus den Luftwegen, die beim Atmen, noch mehr und weiter beim Husten und Niessen entweichen. Ihre Reichweite übersteigt nicht 2m, beim Husten und Niessen können sie sich bis 20 m verbreiten. Bei einem Aufenthalt in geschlossenen Räumen sollte man deswegen den Abstand von 2m unbedingt einhalten. Hustende und Niessende haben dort selbstverständlich Eintrittsverbot. Draussen bei kurzen Kontakten (2-3 Minuten) braucht man keine Schutzmasken zu tragen. Für die Desinfektion der Hände reicht ein halbminütiges Händewaschen mit Seife. Eben, ein Coronavirus ist zum Glück kein Norovirus, das den Durchfall verursacht.
Strengere Regeln gelten selbstverständlich bei Kontakt mit kranken Menschen und in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Die obengenannten relativ einfachen Massnahmen gelten auch für die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel, wie auch für die Schulen. Dabei wäre es sehr nützlich, so bald wie möglich die leidliche Frage zu beantworten, wie leicht sich die Kinder infizieren und wie sie die Infektion weiter geben. Man kann es geht relativ einfach eruieren. Noch einfacher und schneller kann man die Wirksamkeit der verschiedenen Schutzmasken überprüfen. Beide Antworten sind enorm wichtig für den Umgang mit dem Coronavirus."
*
Es mehren sich die Stimmen, die für einen vernünftige, nicht wegen Angst übertriebenen Umgang mit der Gefahr plädieren. Desto mehr überrascht mich, dass Italien bei der Ausgangsperre bleibt, und noch mehr, ass die AMA (American Medical Association) die Desinfektion der Gegenstände empfiehlt. Verschiedene Länder haben ganz verschiedene Zugänge zur Coronainfektion. Die Auswertung ist und wird enorm schwierig. Am ehesten noch der geografisch naheliegender Länder mit ähnliche wirtschaftlichen Verhältnissen und ähnlichen Gesudheitswesen wie die Skandinavische Länder oder die Mittelmeerstaten..
17.4.20:
Heute ist in der "NZZ" mein Leserbrief vom 7.. erschienen. Ausserdem eine zweiseitiger Artikel über Probleme mit Masken. Teilweise kritisch. Und ein Artikel über Infizierte in manchen Pflegeheimen in Zürich. Auf Stationen ohne Corona-Kranken war keiner positiv, auf Stationen mit Corona-Kranken waren 80 von 180 Insassen positiv (44%9), davon aber nur 53 (40%) hatten Symptome. Die restlichen waren Träger, die wieterhin das Virus verbreiten konnten. Ich wünsche mich eben eine ähnliche Studie mit Verfolgung der Posotivitat bei Kindern. Isländer haben eine Studie der Verbreitung veröffentlicht, leider ohne sich speziell den Kindern zu widmen (DOI: 10.1056/NEJMoa2006100)..
18.4.20:
Gestern las ich in der "NZZ", dass nach der Lockerung der Massnahmen, Bundesrat Berset sie wieder erschweren, strenger machen kann, wenn die Zahl der Neuinfizierten pro Tag wieder 100 übersteigt. In der Nachrichten wurden die Erleichterungen verlesen. Sie sind unkonsequent, unlogisch, ungerecht - schlecht begründet. Z.B. Warum sollen Coiffeusesalons öffnen dürfen, aber nicht normale Geschäfte, warum Grossverteiler aber nicht kleine Geschäfte, usw. worauf ich der "NZZ" folgenden Brief schickte:
"So, so, Herr Bundesrat Berset meint, er kann die Massnahmen gegen Corona-Virus Infektion je nach Zahl der Infizierten und/ oder Verstorbenen steuern. Er begriff noch immer nicht, was für ein Desaster man eingerichtet hat und mit seinem beschränkten Vorstellungsvermögen auch nicht, dass es nicht geht. Er möchte uns oder das Virus zum Gehorsam bringen. Es ist Verhalten eines macht betrunkenen pubertierenden Knaben.
Die heute angekündigten Massnahmen (und Fristen) sind auf Widersprüchlichkeit kaum zu übertreffen. Vermutlich tragen sie seine Handschrift."
Ich vergass beizufügen, dass die Bundesräte zu Witzfiguren verkommen, wenn sie solche Massnahmen zulassen.
20.4.20:

(7) Durch Seil die Generationen sicher in mehr als 2m-Entfernung getrennt.
Am Samstag, 18.4.,kam Corinne, Christian und Kinder zu uns. Trafen wir uns am Parkplatz und im Gänsemarch, mit mindestens 2m Abstand spazierten wir zu "unserem Bauer"*. Zuerst gingen wir zum Grillplatz, der bereits besetzt war, dann am Waldrand zum Bauernhof. Corinne und Kinder kannten ihn schon, Christian war dort das erste Mal und staute über das Angebot. Er konnte sogar mit dem Smartphone zahlen. Die Kinder genossen den Spaziergang, fuhren Kindertratktoren und spielten, fütterten und bestaunten wieder einmal die Gänse, Ziegen, Ferkel, Kälber, Hasen und Hühner, tranken dort gemachten Saft und assen von Bäuerin gebackenen Kuchen. Die Erwachsenen tranken zu ihm Kaffee. Es war "urgemütlich". Es dauerte nur zwei Wochen, Corinne und Christian überzeugen, dass dies erlaubt und möglich war.
Mit Christian teilen wir nicht die gleiche Meinung über die Bewältigung der Epidemie. Er ist linienförmig zu frieden mit dem Bundesrat. Da ist Dani eher auf unserer kritischen Seite. Er schickte uns gestern ein Video mit Gespräch mit Altbundesrat Blocher, mit dem wir völlig einig sind - wir übertreiben, komplizieren das Leben, belasten unnötig finanziell die junge Generation (mit der wir eben wanderten). -.
*
|
Land |
Einwohner |
Covid-Verstorbene |
0/00 |
|
Schweiz |
8,57 |
1142 |
0,1332 |
|
Schweden |
10,23 |
1540 |
0,151 |
|
Österreich |
8,60 |
452 |
0,0525 |
|
Deutschland |
83,0 |
4 600 |
0,055 |
|
Italien |
60,30 |
22 000 |
0,364 |
|
Frankreich |
72,0 |
20 000 |
0,27 |
|
Grossbritanien |
81,0 |
16 000 |
0,198 |
|
Spanien |
48,0 |
22 000 |
0,46 |
|
Belgien |
83,0 |
4 600 |
0,54 |
|
USA |
328,0 |
40000 |
0,121 |
21.4.20:
In dieser Tabelle sind (einigermassen) richtige, sichere Werte auf sich bezogen, die Zahl der Corona-Virusverstorbenen und der Einswohner eines Landes. Der häufige Bezug auf die Zahl der Infizierten ist falsch, da von Land zu Land die Kriterien und Meldungart verschieden sind.
Aber auch hier sollte man nur ähnliche Länder vergleichen. Vor allem die Geografie spielt eine Rolle. Inzwischen ist bekannt, dass man ür geosse Länder nur grundsätzliche und keine detaillierte Vorschriften erlassen soll. Aber warum sind so grosse Unterschiede zwischen ähnliche Ländern wie z.B. Frankreich und Spanien, Frankreich und Detschland, Österreich und der Schweiz? Die !Österreicher haben kein Tessin mit einer regen Mobilität der vielen Arbeiter aus Lombardei.
Es gibt ein grosser Unterschied zwischen Norwegen und Schweden. Wahrscheinlich ist es die Folge von der "leichtsinniger", riskanter Gesundheitspolitik der Schweden, die keine Beschränkungen in Kontakt verhängt haben un die Kindergarten und Volksschule nicht schlossen. Aber vielleicht werden sie die Durchseuchung eher erreichen. Vor allem die Wirtschaft leidet nicht so stark wegen ungefähr 500 alten, kranken alten Menschen.
Gie Analyse der Unterschiede zwischen den Ländern bringt wertvolle Kenntnisse über die Verbreitung dieses Virus. Schon jetzt weiss man, dass man dieselben Massnahmen nicht überall durchsetzen sollte, sondern nach Umständen anpassen.
Es beiben folgende grundsätzliche, überall nützliche Massmahmen:
- Beim Kontakt tin geschlossenen Räumen Abstand von 2 m halten
- und Masken tragen.
- Beides gilt auch draussen beim längeren Kontakt (>2 Minuten).
Das die Coronaepidemie vermutlich länger dauern wird, ist gut, wenn wir uns mit unnötigen Beschränkungen nicht belasten.
*
Die heutige "NZZ" brachte eine Gespräch mit dem Chef des Zürcher Fughafens, in dem erwähnt wir, dass man in einem Flugzeug unmöglich der Abstand von 2m einhalten kann. Darauf habe ich folgenden Brief geschrieben:
"Sehr geehrte Herren Widrig und von Ledebur,
der Abstand in den Flugzeugen braucht (fast) sicher nict 2m betragen, wie zeigt die beigelegte Facharbeit aus einem der angesehenen medizinischen Fachzeitschriften. In Kürze:
Auf dem mehrstündigen Flug von Wuhan nach Frankfurt mit zwei Infiziertenam Bord, hat sich niemand mehr eingesteckt. Grund: Entweder die Luftzirkulation im Flugzeug oder/und die vorn Herrn Widrig erwähnte Filter. Übrigens der eine hatte nur leichte Symptome, der andere wurde nur durch den Test entlarvt.
Freien Flug für freie Leute wünscht
ein grüner Gegner von Vielfliegerei
Peter Marko"
Eben, verschiedene Umstände verlangen verschiede Lösungen. Eine sture Einhaltung von Regeln ist nicht angebracht.
22.4.20:
Zufällig sind in der heutigen "NZZ" gleiche Berechnungen erschienen Die Analyse der Zahlen, ihre Deutung sind nicht einfach. Die Grösse des Landes, Häufigkeit der Bestimmungen, Melde- und Gesundheitssystem, Nähe zu Herden, Mobilität, u, andere Faktoren spielen eine Rolle. Kaum aber die Frühzeitigkeit der Massnahmen, da die drei Länder Österreich, Deutschland un die Schweiz sie gleichzeitig eingeführt haben.Hoffentlich wierd man später klüger.
*
Im Feulleiton der "NZZ" erschien ein Artikel "Hygiene in Scherben"in dem nebenbei wieder behauptet wurde, die Coronaviren können auf dem Glass lange überleben und ansteckend bleiben. Meiner schlechten Gewohnheit entsprechend, habe ich flgenden Brief der Redaktion geschickt:
"In diesem geistreichen Artikel liegen die Fakten in Scherben: Wenn man auf den Oberflächen Viren nachweisen kann, bedeutet es nicht, dass man sich mit diesen Viren auch anstecken kann. Noch niemand hat sich ohne eines direkten Kontakts mit einem infizierten Menschen mit dem Coronavirus infiziert! Also auch nicht von einer Glasoberfläche und/oder einem Glas, ausser beim eventuellen unmittelbaren Trinken aus demselben. Aber auch dann reicht die Menge des Virus kaum dafür.
Die Journalisten, auch im Feuilleton, sollen nicht unbegründet die Ängste der Leser schüren. Eine unserer Bekannten desinfizierte die Zeitungen (nicht die NZZ). Ich wollte sie nicht bloss stellen und fragte lieber nicht nach Details.
Eigentlich würde der obengenannte Artikel zum «Korrigendum» gehören."
23.4.20:
In der "NZZ" ist heute ein Artikel über die Wichtigkeit des Handy.Sesinfektion erschienen. Mein Leserbrief dazu:
"Betr.: Golmer P: Gerade jetzt ist Handy-Hygiene wichtig. NZZ 23-4-2020, S. 31.
Gerade jetzt, wenn die Angst vor dem Coronavirus unser Leben wesentlich mehr und länger, nachhaltiger als das Virus selbst zerstört, sollten Journalisten nicht unbegründet die Angst schüren. Ich schätze die «NZZ» wegen ihrer Ausgewogenheit und Besonnenheit. Warum verstösst dieser Artikel dagegen: Der Nachweis des Virus auf den Oberflächen ist nicht mit seiner Ansteckungsfähigkeit gleich zu setzen. Noch niemand hat sich ohne direktem Kontakt mit diesem Coronavirus angesteckt. Der Fall, dass ein infizierter Mensch auf ein Handy hustet und ein Gesunder dieses sofort berührt und mit den Händen gleich in seine Augen, Nase oder Mund fasst, dürfte extrem selten vorkommen und auch dann ist es nicht sicher, da für die Infektion eine genügend grosse Menge (load) des Virus vorhanden sein muss. Das Preis-Leistung-Verhältnis der Handy Hygiene ist unendlich klein, der Schaden enorm gross."
26.4.20:
Gestern habe ich vom Präsidenten der "Schweizerischen Akademie der Meizinischen Wissneschaften" Professor Tanner Literatur, die zeigt, dass bei den Kindern Es is unglaublich, wie wenig sich richtigen wissenschaftlichen Kenntnisse durchsetzten, wie wenig die Politiker darauf achten und widersprüchliche, falsche, verwirrende und angstmachende Aussagen und sogar Beschlüsse machen. Kann man erklären, warum können die Kinder schon nächste Woche in die Schule. Auch wenn der Unterricht nicht perekt vorbereitet und durchgeführt wäre, ist es besser als wenn sie weiterhin zu hause bleiebn.
Die EU-Komissionpräsidentin von Leyen vekündete heute, man soll die Öffnung der Geschäfte in der EU vereinheitlichen, damit die Einwohner eines Landes nicht in das andere gehen (und as Virus einschleppen). Aber, wenn sie die einfache Grundmassnahmen, Abstand halten und eventuell Maskentragen einhalten, was spricht dagegen. Die Lust der Politiker an Verboten und damit an der Demonstration ihrer Macht? Sie demonstrieren nur ihre Dummheit.
Zum Glück in unserer Familie hat sich Vernunft durchgesetzt: Kinder gehen nach draussen spielen, Nachbarkinder und sogar Erwachsene kommen zum Besuch.
27.4.20:
In der herutigen "NZZ" erschien ein Artikel, zu dem ich folgenden Leserbrief verfasst habe:
"Betr.: Speicher Ch: Wie kommt man gut aus dem Lockdown? NZZ 27.4.2020, S. 14.
Da die gegenwärtige Corona-Epidemie nicht so bald abklingt, ist die Auswahl der richtigen Massnahmen gegen ihre Verbreitung enorm wichtig. Alle unwirksamen beschränken unnötig die Freiheit und belasten die Menschen auch psychisch. Sie vermindern damit die Einhaltung der wirksamen Massnahmen. Wir sollen uns mehr auf die inzwischen reichhaltige Fachliteratur und den gesunden Menschenverstand verlassen, als auf das Jonglieren mit unzuverlässigen Zahlen und Modellen. Im Unterschied zum Spezialisten, Professor Feuerriegel, wage ich als ehemaliger praktischer Arzt folgende grundsätzlichen, allgemeingültigen Empfehlungen auszusprechen:
1. Bei Ansammlungen von Menschen, die nicht in einem Haushalt leben, 2 m Abstand voneinander halten. 2. Wenn ein kleinerer Abstand unvermeidbar ist, Masken tragen. 3. Beim Kontakt im öffentlichen Raum Standort nach >10 Minuten wechseln. 4. Keine Beschränkungen für Kinder Bei Einhaltung dieser Regeln entfällt Absperrung (Lockdown), allgemeine Schliessung von Geschäften und Restaurants, Besucherverbote und auch die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel ist möglich. Das Leben wird dadurch leichter, angstfreier und wirtschaftlich effizienter."
*
30.4.20:
Gestern erschien in der NZZ ein Artikel darüber, wie man sich in den öffentlichen Verkehrsmitteln verhalten und gegen Coronainfektion schützen kann. Mein Leserbrief dazu:
"Betr.: Stalder H: Es braucht ein Maskenobligatorium. NZZ 27.4.2020, S.9.
Um die Benützung des öffentlichen Verkehrs gegen den Coronavirus zu sichern, kann man auch Platz-, bzw. Standwechsel nach Art des «Sesseli-Tanzes» machen. Am Anfang der Epidemie wurde in der Schweiz (richtigerweise) verkündet, dass zur Übertragung des Covid-19-Virus eine gewisse Menge davon nötig ist, somit auch die Dauer des Kontaktes. Damals wurden 15 Minute genannt. Ob es genau stimmt, ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass man leider diesen Einfluss ganz vergessen hat. Beim Vorbeigehen auf Feld- und Waldwegen geraten manche ängstliche Menschen lieber in den Graben, nur damit sie den 2m-Abstand einhalten können, was milde bezeichnet, unnötig ist."
*
4.5.20:
Am 1.5. schrieb ich folgenden Leserbrief der "NZZ" über die (Gesundheit-) Politik:
"Fragliche Coronapolitik
Als einen zwar «eingekauften», aber desto glühenderen Anhänger des schweizerischen politischen Systems, schmerzen mich desto mehr die Irrungen und Wirrungen der Politik im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie. Allem nach dauert sie noch Monate, eventuell flammt sie in einer neuen Welle wieder auf. Mindestens droht man uns mit ihr und dann wieder mit verschärften Massnahmen wie früher den Kindern mit dem Schmutzli. Deswegen ist es angebracht und nützlich, den Spreu vom Weizen zu trennen und das richtige, angemessene und wirksame Vorgehen zuerst zu diskutieren, vorzubereiten und sich um ihre konsequente Durchführung zu bemühen. Dazu kann uns auch der Vergleich mit Schweden dienen.
Sie wurden zu ihrem Weg durch ihre Gesetze gezwungen, die ihnen drastische Beschränkungen der Freiheit, wie die Absperrung, verbieten. Eine Kommission der Schwedischen Gesundheitsagentur (entsprechend unserem BAG), die aus ca. 15 Leuten besteht, diskutierte seit Anfang der Epidemie jeden Morgen die neusten Kenntnisse und änderte ihnen entsprechend das weitere Vorgehen. Zweimal pro Woche sprechen sie auch mit regionalen Behörden. Sie verlassen sich auf Empfehlungen und Überzeugungen statt auf Verbote und Schmutzlis.
Schweden schloss die Grenzen nicht, da die Verbreitung des Virus mehr ein lokales Problem ist. Auch keine Schulen der Unterstufe. Es gibt kein Maskenobligatorium ausser im Kontakt mit Covid-2-kranken Menschen. Beim letzten Anstieg der Kranken und Verstorbenen in Altersheimen in Stockholm suchten sie nach den Gründen, um sie gezielt zu beheben. Diese für uns «frivole», leichtsinnige, unverantwortliche Politik brachte vorläufig keine alarmierenden Zahlen von Kranken und Verstorbenen und trägt zur höheren Durchseuchung der Bevölkerung bei. Damit zu weniger hohen Wellen und vielleicht zu besseren Gesamtergebnissen in Vergleich zu anderen Ländern. Sicher aber belastete sie die Bevölkerung weniger körperlich, seelisch und wirtschaftlich.
Die Politiker überliessen ihre Entscheidungen wie auch die Information der Öffentlichkeit weitgehend auch der Kommission der Gesundheitsbehörde. Dadurch vermieden sie nicht nur unser diesbezügliches «Durcheinander», brachten aber sich und die Wissenschaft nicht in einen lang dauernden Verruf. Es gibt Fachleute für Kommunikation und Verhaltensänderung. Manche unserer Politiker und Wissenschaftler sollten ihre Hilfe in Anspruch nehmen statt die persönliche Profilierung zu betreiben. Der Schuss geht nämlich nach hinten hinaus."
*
Und heute, nachdem ich einen verwirrenden Artilek über Maden gelesen habe, diesen:
"Betr.:Bueche L, Rietz H: Welche Maske ist die richtige? NZZ 4.4.2020, S. 22.
Sehr geehrte Autorinnen,
leider trägt Ihr Artikel mehr zu Verwirrung als zur Auf- und Erklärung der Maskenproblematik bei.
Grundsätzlich: Offensichtlich bemerkten Sie noch nicht, dass verschiedene Institutionen und Personen leider an Glaubwürdigkeit einbüssten, beginnend mit Bundesrat über BAG, Robert-Koch- Institut bis zu manchen Wissenschaftlern. Und zwar nicht durch Änderung ihrer Aussagen, die sind begreiflich, sondern wegen ihrer Widerspüchlichkeit, Inkonsequenz und mangelnder Begründung. Was zählt, sind gut begründete Fakten, an denen es auch in Ihrem Artikel fehlt:
-
Sie benützen den Begriff «Öffentlicher Raum» und aus dem Text kann man entnehmen, Sie meinen geschlossenen Raum. Für die meisten der Leser kann es auch die Strasse, der Platz, der Wald sein, bzw. ist. Dort ist das Tragen der Masken nur in Ausnahmesituationen eventuell nützlich z.B. bei länger dauerndem Kontakt
-
Die Dauer des Kontaktes ist ein Faktor, der bei Überlegungen und Aussagen sträflich vernachlässigt wird. Am Anfang sagte man, wahrscheinlich richtig, 15 Minuten seien nötig, um eine genügende Menge des Virus zu übertragen.
-
Das heisst auch, eine der vergessenen, aber vermutlich sehr wirksamen Massnahmen, wo auch der Standort-, der Platzwechsel (auch im geschlossenen öffentlichen Räumen wie Bus, Zug) stattfindet.
-
Es gibt keine Ansteckung ohne direkten Kontakt mit den Kranken (lassen wir ausser acht die anfänglichen von irgendwelchen Tieren). Das heisst auch nicht über Gegenstände, Luft (ohne Tröpfchen, z.B. in Zimmern von Kranken), Wasser. So auch nicht von einer Berührung der Masken. Der Grund ist eben die Menge des Virus und seine kurze Ansteckungsgefahr. Sein Nachweis ist kein Beweis, dass es ansteckend ist – allem nach ist es eben nicht.
-
Die Desinfektion von Masken oder anderen Gegenständen ist im Falle der Covid-19-Viren ein überflüssiges Ritual. Es reicht eine normale Reinigung (mit Seife der Hände) der Gegenstände oder sie einfach stehen lassen. Nach 72 Stunden sind die Viren nicht einmal mehr nachweisbar.
-
Können Sie bitte begründen, noch besser Beweise erbringen, dass die Masken von der relativ konzentrierten Menge der Viren in der ausgeatmeten Luft (einigermassen) schützen sollen, nicht jedoch diejenige der schon um Potenzen dünner der weit entfernten Personen?
-
Ich habe zu Beginn der Epidemie von unseren Epidemiologen verlangt, dass man eine relativ einfache Versuchsanordnung durchführt, die weitgehend Klarheit über die Wirksamkeit der verschiedenen Maskentypen bringen würde. Bisher vergebens. Ich erlaube mir, den Leserbrief beizulegen, der in der neuen Nummer der «Schweizerischen Ärztezeitung erscheinen soll.
Ich wünsche Ihnen für Ihre verantwortungsvolle weitere Arbeit viel Erfolg und verbleibe
mit besten Grüssen
Peter Marko"
*
Inzwischen sind mehrere interessante Fachartikel erschienen. Einer regt aus, und zwar über Übertragung des Virus und Zeitverlauf der klinischen Symptome von Taiwan. Sie untersuchten , wie sich es von den ersten 100 Patienten weiter verbreitete und wer , wie gelitten hat. Die Wichtigsten Kenntnisse:
1. Da sich das Virus bereits schon vor der Erkrankung und während der ersten 5 Tage, wie AUVON Menschen ohne Krankheitszeichen ohne vverbreiten, ist die alleinige Isolation der Patienten kein wirksame Massnahme.
*
10.5.20:
Leider habe ich mehrere Tage pausiert. Es erschienen viele Fachartikel, die ich lesen wollte. Und oh, Wunder, auch mein letzter "NZZ"- Leser bief in leicht gekürzter Fassung, die nicht unterstrichenen Zeilen wurden ausgelassen. (Diese Textänderung ist die einzige, die ich nachträglich getan habe, ausser den grammatikalischen, die Silvia noch vornimmt.)
*
Irgendwie scheint mir überflüssig, die einzelne Kenntnisse zu präsentieren und kommentieren, da sich langsam zeigt, welche Massnahmen wichtig sind. In allen Ländern vermindert sich die Zahl der Kranken und Infizierten, ihre Kurve flacht sich ab. Es bleibt der grosse Unterschied in ihrer Menge. Langsam sieht man die Gründe dafür:
-
Der Zustand des Gesundheitssystems und der Versorgung der alten Menschen (Alters- und Pflegeheime). Die Zahl der Patienten und Bewohner in einem Zimmer
- Einhaltung der einfachen Grundsätze der Seuchenbekämpfung, wie Isolierung der kranken und Schutzmassnahmen bei Umgang mit ihnen.
-
Je früher man die Massnahmen ergreift, desto besser. Ein Frühwarnsystem wichtig.
- Distanzhaltung ist vor allem beim Kontakt in geschlossenen Räumen nützlich, wie auch
- Tragen der Masken. Sie sollen sonst nur die gefährdeten Menschen benützen.
Die Absperrung ist nutzlos und bringt die grösste psychische, körperliche und wirtschaftliche Schäde mit sich. So auch Schliessung der Krippen, Kindergarten, Kittas, Unterstufen der Schulen. Die Desinfektion der Gegenstände ist im Falle von Covid-19-Virus überflüssig.
Diese Feststellungen sind sehr wichtig, weil man die zweite Welle der Corona-Epidemie erwartet. Bei Epidemien mit anderen Viren braucht man so schnell wie möglich seine Eigenschaften wissen. So wusste man von Anfang an, dass Coronaviren nicht oder weniger ansteckend sind als Noroviren. Da man lokalen Bedingungen und lokaler Verbreitung des Viren entsprechend handeln soll, frage ich mich, ob die Lockerung nicht schneller erfolgen sollte in Anbetracht der gegenwärtig kleinen Zahl der Infizierten.(<50) in der Schweiz. Heute vernahm ich, dass Geschäftsleute wieder ins Ausland reisen dürfen. Die Schweden haben die Überschreitung der Grenzen nie verboten. Die Zahl der Infizierten ist nicht wesentlich höher als bei uns. Dafür gingen sie den Ursachen nach und fanden in schlechten Umgang mit Infizierten in Altersheimen in der Region um Stockhol, was sie sofort gezielt änderten, ohne die Massnahmen überall zu "verschärfen", was man auch unter dem versteht.
*
Wie erwartet, leider steigt die Unzufriedenheit der Bevölkerung in Deutschland mit der Corona-Politik. Wie wird es in Italien, Frankreich und Spanien, wenn die echte Gründe des Versagen auf den Tag kommen?
*
11.5.20:
Meine Hoffnung, die Situation wird sich weitgehend "normalisieren", bekam einen schmerzhaften Schlag: Es wurde bekannt, dass in Südkorea, die so erfolgreich mit wenigen Toten mit dm Coronavirus umgegangen ist, wieder eine kleine Epidemie ausbrach, nachdem ein Infizierter mehrere Bars besuchte. Dann ist das Virus doch nicht so gut mutig und wird uns länger belasten. Desto wichtiger ist, länger ertragbare und wirksame Massnahmen zu ergreifen und unnötiger Ballast abzuwerfen. Es war tragikomisch gestern in der "Tagesschau" zu sehen, wie Angestellte der "SBB" die Einrichtungen desinfizierten als Vorbereitung für den normalisierten Betrieb. Eine PR-Aktion, die über Unbelehrheit und Dummheit zeugt.
*
Also beende ich doch die Lehren aus Taiwan, die ich began zu beschreiben am 4.5. (s. o.) :
1. Da sich das Virus bereits schon vor der Erkrankung und während der ersten 5 Tage, wie AUVON Menschen ohne Krankheitszeichen ohne verbreiten, ist die alleinige Isolation der Patienten kein wirksame Massnahme.
2. Das Virus verbreitet sich bei Patienten, also Kranken, in den ersten 5 Tagen nach Beginn der Beschwerden (Symptome).
3. Das Virus verbreitet sich vor allem in den Familien, ob sie zusammen leben oder nicht, also bei längerdauernden engen Kontakt.
4. Ungefähr 5 Mal weniger in Einrichtungen des Gesundheitswesen und 40-50 Mal weniger sonst!
5. Junge (65 Jahre) werden weniger oft infiziert als die "mittelalte" (20-64 jährige).
*
"Die Ungewissheit, was man darf und was nicht, ist ein Faktor, der bei vielen für Verunsicherung sorgt " R. Schifftan, Psychologin in der NZZ vom 11.5.20, S. 10. Die ganze Zeit bemühe ich mich sowohl bei Nächsten, wie in der "NZZ" und "SÄZ" diesen Faktor zu mindern.
*
14.5.20:
Sieg für Schweden: Laut der gestrigen "NZZ" (S. ) auch bei einer weiteren Covid-19-Welle will die Schweiz bei Vereschärfung der Massnahmen die Menschen nicht absperren (lckdown) und Einrichtungen für Kinder Die Informationspoltik übernahm weitgehend der Leiter der wissenschaftlicher Berater des BAGs.
*
16.5.20:
Die "NZZ" veröffentlichte einen Artikel über Corona-Poltik in Schweden, der mich zum folgenden Leserbrief veranlasste:
"Sehr geehrter Herr Rasonyi,
Ihr Artikel ist zwar ausgewogen im Urteil, aber trotzdem blind an ein Auge – sie betrachten nicht, dass das schwedische Vorgehen weniger seelische, körperliche und doch auch witschaftliche Schäden verursacht. Dass Schweden Einbussen im Bruttosozialprodukt ertleidet, können sie nicht als ein ernsthaftes Argument meinen. Und es ist ein qualitativer Unterschied, ob ich mich als freier Bürger freiwillig beschränke oder auf Anordnung, Befehl der Obrigkeit. Das wirkt sich auch auf den seelischen Zustand aus.
Wie auch läppisch, ich erwäge nach Lappland zu ziehen."
*
19.5.20:
Heute erschien in der "NZZ" ein Artikel über Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmittel, der die Situation komplziert beschrieb und verlangte, dass sowohl die Fahrgäste, wie das Personal die Schutzmasken tragen muss. Das Personal in Zügen verweigert sonst wegen der Infektionsgefahr den Dienst. Mein Leserbrief:
"Betr.: Stalder H: Maskenpflicht in Zug, Tram und Bus verlangt. NZZ 19.5.2020, S. 13.
Im Artikel werden Aussagen und Behauptungen (nicht des Autors) wiedergegeben, die nicht den Tatsachen und Kenntnissen entsprechen. Im Interesse der Benützer, Betreiber und des Personals des öffentlichen Verkehrs müssen sie richtig gestellt werden:
-
Ein Chirurge trägt eine Maske, damit er das Operationsfeld vor einer Infektion schützt. Also, im Falle des Covid-19-Virus schützt die Maske vor allem die anderen Personen. Es gibt aber keinen Grund, warum sie auch den Maskenträger selbst nicht mindestens so gut schützen würde.
-
Für die Übertragung von Covid-19-Virus ist die Menge (load) entscheidend. Es braucht dafür (ungeschützten) Kontakt von ca. 15 Minuten in Entfernung von
-
Die Luftzirkulation in den klimatisierten Wagen vermindert die Ansteckungsgefahr. Flugzeuge, die dazu noch Filter haben, sind diesbezüglich das sicherste Transportmittel. (Kreuzfahrtschiffe sind aus anderen Gründen Seuchenschleudern.)
-
Weniger wichtig: Die Desinfektion ist überflüssig. In Unterschied zu manchen Viren, mit Covid-19-Virus hat sich niemand über Gegenstände infiziert.
Die angekündigte «Sensibilisierungskampagne» sollte diese Tatsachen berücksichtigen. Die Aussage von Herrn Tanner, dass man im Falle einer zweiten Welle gezielte Massnahmen ergreift, lässt hoffen, dass wir von einer Absperrung (lockdown) verschont werden. Also, für freie Bürger (fast) freie Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Vor allem ohne unnötiger Angst."
*
Es wäre sehr wichtig zu wissen, wann und wo die befürchtete zweite Welle der Infektion beginnt. Erstens, um die wirksame Massnahmen dort strenger anzuwenden, weil je früher, dest sind sie wirksamer. Zweitens, die Menschen lassen begreiflich nach sie einzuhalten, wenn die Gefahr nicht droht. In einem Mail an Professor Tanner habe ich es so ausgedrückt: " unseres Leben vereinfachen. Die Leute sind zwar nicht mehr in den Verteidigungsgräben, aber obman sie in Kasernen ohne sichtbaren Feind halten kann?" Ich habe ihm, wie vorher schon BAG eine Arbeit, die die Überwachung vereinfacht (doi:10.1001/jama.2020.7872). Mal sehen ob BAG diese Methode bals verwendet.
*
21.5.20:
In einem Artikel gestern (Aufritt der Narren auf dem Theater der Freiheit.) moralisierte der Autor, ein emritierter Literaturwissenschaftler über die Teilnehmer der Protestversammlungen gegen Corona-Politik. Mein Leserbrief an die Redaktio der "NZZ":
"Statt moralisieren sollten wir analysieren womit begünstigen wir den Auftritt der Narren auf dieser Bühne.
Es ist die Unverhältnismässigkeit der Massnahmen gegen die Covid-19-Epidemie. Wenn die Chinesen die Ausgangssperre (lockdown) in Wuhan verhängten, kann man es verstehen. Sie kannten das Virus nicht und wussten nicht, wie es sich verbreitet. (Vielleicht gibt es auch andere spezifische Gründe.) Aber mindestens die Schweden wussten es schon Wochen später und liessen davon ab. Unverhältnismässig ist auch die Dauer der Massnahmen. Warum bestimmt man im voraus, und ändert nichts bei veränderter Situation?
Schlechte und inkonsequente Information. Wie sollen die Leute Vertrauen haben und dem Bundesrat folgen, wenn er eine Zwecklüge in die Welt setzte, dass die Masken nicht effektiv seien und jetzt verlangt wird, man müsse sie in öffentlichen Verkehrsmitteln unbedingt tragen – nur ein Beispiel. Die widersprüchlichen Massnahmen werden nicht oder schlecht begründet. Ein Beispiel: Warum ist der Eintritt in ein Museum erlaubt, aber nicht in den nahe liegenden botanischen Garten? Wann hört man auf, die Wichtigkeit der Desinfektion zu betonen, die gegen Covid-19 unnötig ist, was die Leute bei den täglichen Einkäufen unbewusst erleben und so auch wahrnehmen?
Das alles weckt nicht Vertrauen in die Verkündigungen und Erlässe der Behörden und somit auch nicht ihre Befolgung. Deswegen folgen viele Leute die Narren auf dem Theater der Freiheit.
Dazu trägt auch ein neues Problem, eigentlich eine absurde Situation bei: Aus Angst vor einer neuen Infektionswelle sollen sich Einwohner eines ganzen Landes weiterhin beschränken, auch wenn die Zahl der Infizierten pro Tag ständig unter 50 ist. Die Behörden (BAG) und Epidemiologen möchten Beschränkungen beenden und entwickeln ein Frühwarnsystem, um dann gezielt örtlich die geeignete Massnahmen zu ergreifen. Eine positive, schöpferische Lösung, die den Zulauf zu Narren mindert."
*
23.5.20:
Nicht nur Menschen reagieren auf die Gefahr der Corona-Epidemie verschiede, aber auch Länder, sogar ihre Teile.Über die Unterschiede zwischen der selscher Schweiz und der Deutschschweiz berichtete heute die "NZZ".
Bei Menschen zeigen sich ihre Eigenschften. Auch innerhalb unserer Familie herrscht keine Einigkeit.
*
26.5.20:
Brief an BAG, NZZ, Professor Tanner, Professor Verzasca und Professor Salathe;
"Mit offensichtlicher Freude wurde gestern von mehreren Personen verkündet, dass man den Abstand von 2 m draussen, in nicht geschlossenen Räumen nicht streng einhalten muss. Leider bleibt eine andere Tatsache, die von Anfang der Epidemie (in der Schweiz bekannt, damals auch verkündet) noch immer versteckt: Der flüchtige Kontakt mit einer infizierten Personen reicht nicht zur Übertragung des COVID-19-Virus. Man braucht dazu mehrere Minuten, im Allgemeinen mehr als 10. Es muss eine genügende Menge des Virus (load) übertragen werden. Dies ist vermutlich auch der Hauptgeund, warum COVID-19 nicht über Gegenstände übertragen wird. Somit ist eine Desinfektion nur ein beruhigendes Ritual.
Diese Kenntnisse nicht nur vermindern die Angst vor dem Virus und erleichtern das Leben in dieser Epdemie, sondern führen auch zu einem leichteren und bessereu Einhalten der wirklich wirksamen Massnahmen."
*
27.5.20:
Aus der heutigen "NZZ":
"Das Total der Übersterblichkeit während der ersten Corona-Welle beträgt 1054 Todesfälle – in der Grippesaison 2015 starben 1322 Menschen mehr, als statistisch erwartet worden war. Sämtliche Fälle der jetzigen Übersterblichkeit Covid-19 anzurechnen, wäre falsch, denn die Lungenkrankheit ist www.nzz.ch/schweiz/corona-peak-in-der-todesfall-statistik-in-der-schweiz-sterben-bereits-seit-zwei-wochen-mehr-leute-als-sonst-ueblich-ld.1549448">selten die einzige Todesursache. Viele Patienten haben zum Teil schwere Vorerkrankungen. Bei den Personen unter 65 Jahren gibt es www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/sterblichkeit-todesursachen.html" target="_blank">laut den Zahlen des Bundesamtes für Statistik gegenwärtig keine Übersterblichkeit."
Kann man mit Shakespeare sage, "Viel Lärm um nichts? Sicher nicht, aber übertrieben wurde es schon. Am nfang hat Feulletonchef der "NZZ" ein Artikel geschrieben; Nicht weniger, mehr Hysterie brauchen wir". Als ob Hysterie gesund wäre. Wir bekamen von ihr eine Überdosis.
*
2.6.20:
Heute an die "NZZ":
Betr.: Bundesligabericht
Sehr geehrte Sportredaktion,
zur grossen Enttäuschung fehlte (mir) im heutigen Sportteil der übliche Bericht über die (Pfingsten-) Bundesligarunde. Warum diese Ignoranz? Der Verlauf der Bundesliga ist enorm wichtig, da lehrreich auch für andere Fussballwettbewerbe, u.a. die Schweizer «Superleague». Sie sabotieren damit die Normalisierung, bzw. die «neue Normalität» der Coronazeit. Die ist wichtig, weil es scheint, dass wir mit dem Virus länger leben müssen.
Mit besten Grüssen
Peter Marko
*
Die Antwort;
Sehr geehrter Herr Marko
Ich danke Ihnen für Ihr Feedback zur fehlenden Berichterstattung über die Bundesliga in der NZZ-Ausgabe vom Dienstag. Nun ist es so, dass wir auch in der Vor-Corona-Zeit in der Zeitung vom Montag selten über die Bundesliga berichtet haben – nämlich nur dann, wenn etwas Ausserordentliches vorgefallen oder eine Entscheidung gefallen war.
Es ist aber eine Unterlassung unsererseits, dass wir heute nicht wenigstens die Resultate und Tabellen publiziert haben (wie sonst jeweils auch) – das werden wir ab kommendem Wochenende ändern. Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass wir online jeweils sämtliche Resultate und Tabellen aktuell zeigen, inklusive Matchverlauf. Zusätzlich haben wir über die Pfingsttage online einen Hintergrundbericht über die Krise bei Schalke veröffentlicht (www.nzz.ch/sport/bundesliga-der-freie-fall-des-fc-schalke-04-ld.1559017" data-saferedirecturl="www.google.com/url?q=http://www.nzz.ch/sport/bundesliga-der-freie-fall-des-fc-schalke-04-ld.1559017&source=gmail&ust=1591213539154000&usg=AFQjCNFNPTPXeSfsrn3DClwfUFPgEEAjMA">www.nzz.ch/sport/bundesliga-der-freie-fall-des-fc-schalke-04-ld.1559017).
Freundlicher Gruss
Elmar Wagner
Leiter Sportredaktion
Neue Zürcher Zeitung / NZZ am Sonntag
*
5.6.20:
Brief an die NZZ:
Betr.: Schöchli H: Masken können das Virus stoppen. NZZ 3.6.2020, S. 11.
Sehr geehrter Herr Schöchli,
nach dem Sie über Masken Klartext geschrieben haben, bitte ich Sie, sich der Aufklärung einer weiteren Unklarheit zu widmen – der Dauer des Kontaktes. Schon seit Beginn der Corona-Epidemie in der Schweiz konnte man, aber nur versteckt vernehmen, und es blieb bis jetzt so, dass für eine Ansteckung ein Kontakt von mehreren Minuten (>10) nötig ist. Es ist eine Tatsache, die nicht nur beruhigt, aber auch das Verhalten, das Leben vereinfacht, erleichtert.
Bei den Behörden herrscht die irrige Meinung, je strenger, beschränkender eine Massnahme, desto wirksamer sei sie (s. lockdown). Eigentlich ist es mit einer guten Politik so, wie mit der Erziehung von Kindern, man soll sie nicht belügen und unbegründet streng sein. Wieviel Kranke hat Herr Bundesrat Berset auf der Kerbe mit seiner Lüge: «Die Masken sind nicht effektiv» gegen das Coronavirus?
Mit besten Grüssen
Peter Marko
*
9.6.20:
Am 7.6.20 schrieb ich folgenden Leserbrief:
"Betr.: Sprenger RK: Die Regierungen hatten keine Wahl. NZZ 6.6.2020, S. 28.
Sehr geehrter Herr Sprenger,
Ihr Artikel ist mehr «Ablass» und «Schmeicheln» (gegenüber den Politikern) als eine Analyse und Betrachtung der Tatsachen. Bleiben wir bei der Bewältigung der Covid-19-Epidemie in der Schweiz:
-
Die (vom Anfang Februar) früh warnenden Rufe der Fachleute (z.B. Professor Aguzzi) wurden nicht erhört.Somit wurden wichtige Massnahmen unnötig spät ergriffen.
-
Zur Bewältigung der Epidemie wurde erst Ende März auf Drängen der Fachleute bildete man eine «Science Task Force» gebildet, die aus einem «Advisory Bord» und zehn Expertengruppen besteht, die aus jeweils ca. 5 Personen bestehen. Sie ist eher für gründliche Verarbeitung und für ziehen der Lehren geeignet. Die Schweden reagierten schnel und sofort am Anfang der Epidemie bildeten eine Gruppe von ca. 15 Fachleuten, deren Zusammensetzung je nach Bedarf wechselte. Sie trafen sich täglich, um die Situation nach den neuen Kenntnissen zu beurteilen. Zweimal pro Wochde nahmen sie Kontakt mit den Regionen auf. Der Leiter verkündete und begründete täglich die Beschlüsse. Sie wussten von Anfang an, dass die Kindergarten, Horte, Kitas, Unterstufen nicht geschlossen sein mussten, aber straften die Leute nicht, die sich nicht daran hielten und die Kinder zu Hause liessen. Desinfektion gehörte nicht zu den wirklich wirksamen Massnahmen gegen die Verbreitung von Coronaviren.
-
In der Schweiz wurden die Massnahmen offensichtlich auch ohne Hilfe von Kommunikationsfachleuten verkündet. Die Informationen hatten auch entsprechende Qualität sowohl inhaltlich als formell. Die Entscheidungen waren schlecht begründet, unklar, widersprüchlich, der Situation verspätet angepasst.
Das krasse Beispiel ist die Aussage von Bundesrat Berset: «Die Masken sind nicht effektiv». Jetzt versucht man mühsam es in den Köpfen umzukehren. (Wieviele Kranke deiese offensichtliche Zwecklüge verursacht hat?) Dagegen analysiert in Schweden der erwähnte Leiter der Fachgruppe offen die Fehler, welche sie begangen haben und welche sie in Zukunft vermeiden werden – eine reife, vernünftige, richtige Einstellung und Vorgehen.
Nein, es geht weder um Anklagen, noch Verzeihen, sondern um die Lehren für die Zukunft nicht nur in den Epidemiezeiten.
Mit besten Grüssen
Peter Marko
St. Gallen"
*
16.6.20:
Leider scheint es, dass das Covid-19-Virus weder so harmlos ist, noch wir es einach und schnell los werden. Ja, es tanzt auf unserer Nase und ändert unsere Lebensweise. Wir müssen lernen einen wirksamen, aber so einfachen und wenig einschneidenden Umgang mit ihm, wie nur möglich ist.
Das "Böse", gefährliche an es:
- Es flammen immer wieder neue kleine Epidemien auf, die sich verbreiten können. In den letzten Tagen sogar in China.
. Auch bei manchen Infizierten, die keine Zeichen der Krankheit auswiesen gibt es (Spät-) Schaden,
- so auch bei Kindern.
- Die Ansteckungsgefahr dauert in Ausnahmefällen mehrere Wochen.
- Die Immunität nach einer Infektion ist unsicher, man kann sich also wieder infizieren.
- Das heisst, es ist schwierig einen Impfstoff zu produzieren. Man muss eine neue Art entwickeln
- Dazu kommt, dass wir eigentlich noch keine sichere Nachweismethoden haben.
Mich als einen glühenden Anhänger des "Schwedischen Models" stört, dass er weniger erfolgreich war und ähnlich der USA immer noch steigen. Die Fehler sind: keine Schliessung der Grenzen am Anfang der Epidemie, unkonsequentes, unfachliches Vorgehen mit Infizierten in Heimen, nicht Einhalten der Abstandsregel. Bei aller berechtigter Kritik, vergisst man die positiven Folgen - weniger psychisch geschädigte Menschen, weniger wirtschaftliche Schäden. Leider schliessen sich die Länder gegen schwedische Bürger, vor allem die skandinavische Nachbarn.
Wie soll man (nicht nur nach mir) mit der Infektion mit Covid-19 umgehen:
*
17,6.20:
- Keine Absperrung (Ausgangsperre) zu Hause ausser für infizierte Menschen
- Ein gutes, wirksames Überwachungssystem, das frühzeitig, noch vor dem Ausbruch neuer "Welle" warnt
- Möglichst vollständige Verfolgung der Kontakte von Infizierten
- Bei längeren Kontakten (>5-10 Min.) Masken tragen.
- Keine längere Versammlungen auch im Freien ohne Abstand (1-2m) und /oder Masken tragen. Besonders gefährlich sind solche mit Singen, Schreien.
*
18.6.20:
Problemlos sind:
- kurze Kontakte
Weniger gefährlich sind:
- Öffentliche Verkehrsmittel, besonders diejenige mit Klimaanlage und häufigen Wechsel der Fahrenden. Besonders sicher sind Flugzeuge (Luftzirkulation, Luftfilter), besonders gefährlich Kreuzfahrtschiffe
- Lokaler Situation entsprechend Kitas, Kindergarten, Schulunterstufe
- Physiotherapien, Restaurants, Geschäfte, Gesundheitswesen
Unnötig sind:
- Desinfektion
- Masken in Freien und in Geschäften bei kurzfristigen Aufenthalt auf einer Stelle ausser oben genannte Umstände
- Abstandhalten bei kurzen Kontakten in Freien (Vorbeigehen)
*
19.6.20:
Gefährlich sind:
Versammlungen von
- mehreren Personen auch in Freien ohne Masken, besonders wenn sie singen, schreien (Manifestationen, Sportanlässe)
*
23.6.20:
- längere Kontakte in geschlossenen Räumen ohne Abstand und/oder masken
*
Ich kehre zurück zu weiterhin steigenden Zahlen der Infizierten und Sterbenden in Schweden (s. 16.6.20). Der Grund ist allem nach nicht der freimutige Umgang mit der Absperrung, sonder merkwürdigerweise in ähnliche Zuständen in Alters- und Pflegeheimen, wie in anderen Ländern mit hohen Zahlen (Italien und Spanien). Offensichtlich gelingt es den Schweden schnell die Verhältnisse zu ändern.
Nach einem gestrigen langen Artikel in der "NZZ" am Besten geht Israel mit der Corona-Epidemie um. Sie haben sehr schnell, unbürokratisch reagiert. Die militärische Ausrüstungsfirmen produzierten sofort Geräte für Telemedizin. Die Überwachung und Meldesystem, wie auch andere Massnahmen geniessen breite Unterstützung der Einwohner ohne politische Unterschiede. Und die Regierung verzichtete sofort auf Notzustand als es möglich war.
Die Schweiz, scheint mir, normalisiert sich zu schnell, zu unvorsichtig und die zweite Welle kommt bald. Wahrscheinlich braucht man sie, um sich auf richtigen Umgang mit dem Virus einzustellen.
uarantene Internet NZZ Bedürfnis nach Nähe
Machtgefühl
Achtsamkeit
Kassandrarufe
Impfungen


(1) Männerweier oberhalb von St. Gallen: Am linken Rand des Gebäudes ist das Sprungbrett sichtbar. Mit Dank aus Mapio.net.
Ich liebte sie so innig, wie man es mit 16 Jahren nur kann, fürchtete aber, ihre Liebe zu verlieren, weil ich mich im Sommer jenes Jahres nicht so anmutig, wie mancher unserer Schulkollegen und viele andere Besucher der Badeanstalt, vom 3-m-Sprungbrett Kopf voran ins Wasser stürzen konnte. Eigentlich konnte ich es überhaupt nicht. Mehrmals bin ich auf den Turm geklettert mit dem festen Entschluss, den "Köpfler" zu wagen, es endete immer mit dem einfachen, schäbigen Sprung auf die Beine. Dass wir nicht Händchen haltend unter der Linde auf dem Bänkli vor dem Haus sitzend unseren Lebensabend verbringen, lag aber nicht daran. Später liebte ich auch innig, aber die Aufgaben, welche ich zu erfüllen glaubte, damit die Liebe erhalten bleibt, waren einfacher.
Nach etlichen Jahren, nachdem unser Sohn das Schwimmen erlernte, folgte unvermeidlich die nächste Stufe, der Sprung vom Startblock, den ich ihm problemlos zeigen und beibringen konnte. Wie zu erwarten war, wollte er dann höher hinaus, natürlich vom 3-m-Brett springen. Ich ging voran, wie es sich gehört. Nach ein paar Tagen, als wir schon mehrmals gesprungen waren, fragte er, ob ich auch den "Köpfler" von 3 m Höhe könne. "Nichts leichter als das", antwortete ich, kletterte bedächtig auf das Brett, stürzte mich Kopf voran runter, ohne Schaden zu nehmen, stieg triumphierend aus dem Wasser und erklärte ihm, wozu er mich gebracht hatte. Nachdem ich Jahre später monatelang unter einem Bandscheibenschaden an der Halswirbelsäule litt und froh war, wenigstens auf dem Rücken schwimmen zu können, dachte ich, mit dem "Köpfler", schon nur vom Schwimmbeckenrand aus, ist es bei mir für immer "Schluss-Fidibus".

(2) Vater und Sohn beim Synchronköpfler.
Es floss wieder viel Wasser die Sitter runter. Die Enkelin war sehr stolz, dass sie schon, vorläufig nur mit den "Flügeli" an den Armen, schwimmen konnte. Ihrem Wunsch entsprechend, zeigte ich ihr bereits den "Köpfler". Klar, sie konnte mir mit den Flügeln noch nicht folgen. Wir mieden Badeanstalten mit einem 3-m-Brett, aber es gibt in jeder, die etwas auf sich hält und kinderfreundlich gelten will, eine Säule mit Ketten. Die Kinder, und man sieht aus unbegreiflichen Gründen nur Kinder diesem Vergnügen frönen, hängen sich mit den Händen an den an einer Kette befestigten Bügel, stossen sich mit den Beinen ab und zu vom Boden ab und fliegen im Kreis herum. Je schneller, desto grösser ist der Spass. Im Land, in dem ich aufgewachsen bin, ist dieses Spiel unbekannt. Als es die Enkelin einmal probierte, landete sie auf den Knien. Die schmerzhaften Schürfungen schreckten sie jedoch nicht ganz ab, sie schaute immer wieder bewundernd und sehnsüchtig den Herumwirbelnden zu. Sie sagte nichts, aber man merkte, sie möchte es wieder versuchen. Ich würde sicher vorsichtiger, rücksichtsvoller angeben und mitfliegen als die Kinder.

(3) Alexa lernt schwimmen
Eines Morgens begab ich mich in die Badi, früh genug, um möglichst ohne Zuschauer zu trainieren, aber ich fand die Ketten noch verschlossen und an die Säule gebunden. Ein anderes Mal versuchte ich es gegen Abend, wartete bis die Kinder den Platz verlassen hatten, hing mich an einen Bügel, sprang, gab an und flog um die Säule herum. Es gelang mir immer leichter, schneller, besser, entspannter. Jetzt zeigten plötzlich auch Halbwüchsige und Erwachsene Interesse am Ringelspiel. Aber anstatt zu kommen und mitzudrehen und mitzufliegen, beobachteten sie nur aus sicherer Entfernung meine Übungen. Manche erdreisteten sich sogar und riefen etwas in meine Richtung. Macht nichts, Hauptsache, die Enkelin kann jetzt ruhig zu uns in die Ferien kommen. Ich ahne, bei der guten Tochter unseres Sohnes kommt unvermeidlich einmal die Zeit, wenn ich mich wieder Kopf voran vom 3-m-Brett ins Wasser werfen muss. Die Bandscheibe ist doch
verheilt.
(4) Alexa übt
Das Leben ist, frei nach Schopenhauer, eine Spiralbewegung. Mit der Zeit drehen wir uns immer schneller in immer kleineren Kreisen, wie die Nadel auf einer Schellackplatte. Wie oft werde ich noch ins Wasser, ob mit dem Kopf oder mit den Beinen voran springen (können)? 
(5) Grossvater auch


„Äbi“ und Mama oder die Entwicklung der Sprache
Während der Reise schlief Tim im Auto. Als er in der Ferienwohnung erwachte, schaute er das Bild oberhalb des Sofas mit den grossen grellen Farbflächen an und liess sich auch später davon nicht abbringen, sei es ob wir unsere freundlichen Gesichter oder verschiedene Plüschtiere und andere dem Alter angemessene Spielzeuge vor seinen Augen präsentierten. Wir dachten unisono, auch die Schwägerin, die Kindergärtnerin ist und damit über Kinder jeden Alters Bescheid wissen müsste, dass mit ihm etwas nicht in Ordnung sei. Es war sicher nicht unsere verletzte Eitelkeit, die uns dazu führte, der Tochter zu empfehlen, dies bei der nächsten Kontrolle zuerst der Säuglingsschwester, dann dem Kinderarzt zu sagen. Sie meinten, unsere Besorgnis sei fehl am Platz und ein Kind mit noch nicht ganz drei Monaten könne die Gesichter noch nicht genau wahrnehmen, was wir eigentlich in einem Buch oder im Internet hätten erfahren können, aber sicher ist sicher, und fragen kostet nichts.
Ein paar Monate später, musterte Tim inzwischen nicht nur uns genau, sondern auch die Bilder einer Ausstellung. Seine Mutter bereitete für ihre Klassen den Besuch vor und nahm ihn mit. Unermüdlich, mit Begeisterung beobachtete er ein Bild nach dem anderen. Später gab er immer wieder von sich so etwas wie „äbi“, was man von „abä“ nicht klar unterscheiden konnte, wenn er nach unten wollte oder dort etwas auf den Boden schmiss, was er zu unserem Verdruss leidenschaftlich auch mit dem Essen tat. Also ein „Durcheinander“ bis die Mutter merkte, dass es „ein Bild“ bedeuten sollte. Er sagte „ä bi“ mit immer demselben, zuerst leider unverständlichen Kommentar, auch bei den Bildern mit Landschaften und Tieren im Treppenhaus, bei denen wir jeweils anhalten mussten. Wir lobten seine Beobachtungsgabe und Ausdrucksvielfalt. Mit der Zeit wussten auch wir, was ein Hund und was ein Pferd bedeutete. Genauso beobachtete er vom Kinderwagen aus schon als Säugling die Blätter auf den Bäumen, wie sie sich im Wind bewegten oder bewunderte jede Blume, die man ihm zeigte. Er liebte es jeweils auch, ein Blatt oder ein Blümlein in der Hand zu halten, ohne es dabei in den Mund zu nehmen oder es kaputt zu machen, was normalerweise die Reaktion der Kinder in diesem Alter ist.
Tim wohnte zwar in einem der besten Wohnquartiere, aber an einer sehr befahrenen Strasse. Erstaunlicherweise oder eben wegen des Lärms blieb auf dem Hang gegenüber ihrem Haus ein noch nicht bebautes Grundstück. Dahinter reihten sich (wie lange noch?) Schrebergärten, durch die man sich den Weg zum Tram verkürzen konnte. Eines Tages sperrte man den Weg ab und zäunte das Grundstück ein. Man konnte das Tram nur auf einem Umweg erreichen. Bald darnach erschien ein Bagger, der ein riesiges Loch in den Hang zu graben begann, was Tim durch die tiefen Fenster in der Küche und seinem Zimmer mit grossem Interesse und Ausdauer verfolgte. Immer wieder stiess er begeistert aus: Baggär, Baggär! Der Bagger schaufelte die Erde zuerst aus und türmte sie zu einem Haufen auf, dann lud er sie mit höllischem Krach auf einen grossen Lastwagen ab. Bis der nächste kam, höhlte der Bagger den Hang weiter aus. Für uns war es eine Belastung, die nur durch Tims Freude gemildert wurde. Wie ein Wunder schenkte ihm jemand schon vorher einen ähnlichen kleinen gelben Bagger, mit dem er, bis der Richtige erschien, nicht viel anfing. Jetzt holte er ihn hervor, wenn er dem Treiben gegenüber zuschaute, und auch sonst spielte er oft mit ihm. Dabei rief er immer wieder stolz, wie ein Kämpfer vor der Attacke: Baggär, Baggär! Später, im Sandkasten, wollte er dagegen ganz still, wortlos alle Bagger für sich beanspruchen, umso mehr als sie meistens grösser waren als sein eigener. Er meinte, er ist dort der einzige Baggermeister. Es verlangte eine ziemlich diplomatische Anstrengung der Erwachsenen beider Seiten, um den Kampf zu schlichten. Das Haus wuchs. Irgendwann verschwand der Bagger von der Baustelle. Andere Maschinen, andere Geräusche kamen. Wird es Tim weiter so faszinieren? Ich hoffe, einmal in Ruhe sterben zu können. Wird mich dabei nicht die Neugier stören, wissen zu wollen, was wird aus Tim, ein Baggerfahrer, ein Baumeister oder etwas ganz Anderes?
Merkwürdig, er sagte noch nicht Mama zur Mutter und Papa zum Vater, wie wir uns alle auch darum bemühten. Ma-Ma galt für Menschen im Allgemeinen, auch wenn er zwischen Geschlechtern gut unterscheiden konnte: Bei einem Treffen zog er zuerst die Frauen den Männern vor, nach einer gewissen Zeit durfte ihn auch ein Mann in die Arme nehmen. Er wusste aber, um wen es sich handelte, wenn man „Mama“ oder „Papa“ sagte. Als er einmal wieder krank war, und wir ihn hüteten, erwartete er sehnsüchtig die Mutter. Als er sie endlich aus dem Auto durch das Fenster von oben aussteigen sah, tröstete ihn die Grossmutter immer wieder: „Siehst Du, Mama kommt“. Trotzdem blieb „Mama“ noch nicht nur für seine Mutter reserviert, auch wenn sein Sprachschatz immer grösser wurde. Später, während einer Italienreise, bezeichnete Tim den Schnaps richtig „Grappa“, aber immer noch nicht den Papa. Muss man sich nicht um seine Zukunft sorgen? Wird er nicht ein Alkoholiker?
Tims Coolheit
Wir hüteten Tim jeden zweiten Donnerstag. Seine Mutter ging fünfzig Kilometer weit mit dem Auto oder mit dem Zug arbeiten. Wenn sie den Zug nahm, übergab sie uns Tim am Bahnhof, da wir jeweils fast gleichzeitig ankamen. Statt uns wie letztes Mal freundlich zu begrüssen und Freude auszudrücken, dass er uns endlich wieder sieht, zeigte Tim mit grosser Begeisterung auf die grosse Uhr beim “Treffpunkt“, auf die blinkenden Lichter an der Decke des Bahnhofs und auf andere, eher unbedeutende Gegenstände wie ein Putzfahrzeug mit einem „doo“ oder „ooh“, „ooh“. Wir durften es nicht persönlich nehmen, da er unberührt weiter seine „doo“ und „ooh“, „ooh“ rief, auch wenn seine Mutter Richtung Zug verschwand, wie wenn nichts geschehen wäre. Das ist die heutige Jugend und sind die Folgen ihrer Erziehung.
Abä
Tim war eigentlich ein sehr einsichtiges Kind. Er nahm nicht mehr alles in den Mund und wenn man ihm sagte, er solle etwas nicht berühren, irgendwo nicht hingehen, gehorchte er, so weit er konnte. Vermutlich war es so, weil ihn seine Eltern nicht unnötig, unbegründet einschränkten. Er ass praktisch alles, was man ihm vorlegte, am liebsten zusammen mit Erwachsenen. Er war grosszügig: Manchmal nahm er die halbzerkauten Bisse aus dem Mund und bot sie uns an, stopfte sie sogar in unseren Mund. Meines Wissens nur ich kaute sie weiter und schluckte sie runter, auch in der Zeit, wenn er wegen Viren, die er in der Krippe immer wieder auffischte, erkältet war. Mit dem rechnete er aber nicht. Er wunderte sich nur, wohin das Stück verschwunden war. Offensichtlich verstanden wir uns in dieser Hinsicht nicht gut. Vermutlich sollte ich nur etwas daran kauen und es ihm wieder zurückgeben. Gerne pickte er mit den Händen das Essen auf vom Teller, nahm hie und da auch den Löffel dazu. Rote Karottenscheiben waren seine Lieblingsspeise. Wenn der grosse Hunger gestillt war, legte er die verschiedenen Stücke neben den Teller, zerdrückte sie, schmierte und warf sie häufig auf den Boden und sagte dabei mit Vergnügen „abä“ oder „doo“ bis man das Stück holte, in einer Art und Weise, wie wenn wir ein Hund wären. Manchmal schmiss er dasselbe Stück wieder runter. Es half hier kein Zureden, keine Erklärungen, dass es sich nicht gehörte und er damit aufhören sollte.
Ratlos fragten wir uns, ob es unsere Kinder auch getan hatten. Wir konnten uns nicht erinnern, auch die anderen Grosseltern nicht. Wir hatten die Kinder in dem Alter aber gefüttert, sie durften keinesfalls mit den Händen in die Teller und schon überhaupt nicht mit dem Essen spielen. Als wir uns bei Tims Eltern vorsichtig erkundigten, wie Tim in der Krippe esse, erfuhren wir, dass es dort zum guten Ton gehöre, Stücke von Speisen runter zu werfen und in dem Alter es alle tun. Sie werden es angeblich auswachsen und es liege an den Eltern, ihnen später gute Manieren beizubringen.Tim wurde ein paar Monate früher als üblich in die Gruppe der älteren Kinder befördert. Er erfüllte das wichtigste Mass dafür – er ass gut, das hiess alles. Wie, ist noch nicht wichtig.
Ja, andere Zeiten, andere Sitten. Vielleicht war Tim auch deswegen so zufrieden und pflegeleicht. Mal sehen, wie es weiter geht.
„Uffe“, Neugier oder die Vorbereitung zum Lauf
Tim sass nicht mehr länger ruhig in seinem Wagen und im Autositz. Lange Fahrten mit dem Auto, während derer er früher mit Interesse aufmerksam und geduldig die Umgebung beobachtete, waren vorbei. Er nahm auch nicht alles in den Mund, sondern wollte es jetzt eher berühren, bewegen, ändern. Wenn er sich vergass, konnte er schon stehen und machte sogar ein, zwei Schritte zwischen zwei nahen Gegenständen. Gerne und unermüdlich lief er, wenn man ihn an den Händen hielt. Merkte er aber, dass er alleine stand, liess er sich sofort zu Boden fallen. Wenn ihn die Neugier packte, benützte er seinen Essstuhl als Leiter und schob ihn zu den Abstellflächen in der Küche oder zu den Regalen in der Stube, kletterte darauf hinauf und stand, ohne sich zu stützen, auf den schmalen Leisten, um alle die neuen, interessanten, lange nicht erreichbaren Sachen wie Rechnungen, unbeantwortete Briefe, Fotos, Schnüre, Schlüssel, durch zu wühlen und gelegentlich mit einem siegreichen „abä“ runter zu schmeissen. Dabei lehnte er sich bedrohlich nach rechts oder links, weil er noch nicht begriff, dass er zuerst runter klettern sollte, um den Stuhl näher an die Gegenstände seines Begehrens heran zu schieben. Es war einem bange bei der Vorstellung, dass er es einmal ohne Aufsicht tat, ohne einen Schutzengel dabei zu haben, der bereit war, ihn sofort aufzufangen und vor Sturz und Verletzung zu bewahren. Einmal stand er triumphierend ganz oben. Wir schlugen Tims Eltern bereits vor, den Stuhl für einen weniger gefährlicheren Typ auszutauschen. Sie passten lieber dauernd auf ihn auf. Sie wählten das unmögliche Möbelstück aus. Hoffentlich wird Tim bald bewusst und sicher auf den Beinen stehen.
So begannen alle Alpinisten- und andere Karrieren.
Tim tanzt
Der Vater von Tim spielte jahrelang Gitarre in einer Band. Seit er Familie hat, übt er leider nur so für sich. Auf seiner Familienseite musizierten viele Familienangehörige, sogar seine beiden Eltern. Einer der Träume der Mutter meiner Frau, also Tims Urgrossmutter, war, dass aus ihren Kindern eine Musikgruppe mit nach oben offener Zahl wird. Aber nicht deswegen hatte sie neun Kinder. Die ersten bildeten noch ein Quartett aus zwei Geigen, einem Akkordeon und einem Klavier. Sie war stolz, wenn sie sie zum Spielen ins Altersheim oder Spital führte. Diese Herrlichkeit hatte mit der Pubertät des Ältesten ihr Ende. Für die jüngeren Kinder hatte sie nicht mehr genug Zeit und Energie, sie zum Üben zu bringen. Als alle Kinder aus dem Haus waren, begann sie leidenschaftlich in einem Chor zu singen. Jedes Jahr wussten wir auch ohne Kalender, dass Weihnachten bald naht, wenn wir eine nicht unangenehme Familienpflicht erfüllten und eines ihrer Konzerte besuchten.
Von meiner Seite brachte es einer meiner drei Onkel mit Musik auch ziemlich weit. Nach dem Jurastudium verschwand er plötzlich für Monate. In dieser Zeit spielte er in einer Zirkuskapelle Geige und begann dabei ein Techtelmechtel mit der Frau des Zirkusdirektors, vielleicht war es auch umgekehrt, und er trat in den Zirkus, nach dem er die Direktorin kennen lernte? Wie dem auch sei, nachdem es der Direktor entdeckte, musste der Onkel fluchtartig sowohl den Zirkus wie seine Geliebte verlassen. Später packte er ab und zu die Geige aus und spielte, am häufigsten Dvoraks „Humoreske“. Ich ahnte damals nicht, was in seinem Kopf und dem der anderen Familienmitglieder vor sich ging. All das konnte meine Mutter nicht abschrecken, sie bemühte sich unermüdlich, dass ich irgendein Instrument spielte. Sie hatte leider nicht die Geduld zu warten, bis der Wunsch in mir natürlich aufkeimen würde. Sie brachte andere Kinder, welche eben mit Klavier- oder Geigespielen begannen als Beispiel, was mich eher abschreckte – ich dachte mit Verachtung: Diese dressierten Affen. Und so verschlang ich, ohne grosse Fortschritte, ein Paar Geigen- und Akkordeonlehrer. In diese Familienlücke – keiner meiner älteren Vetter spielte irgendein Instrument, sicher ein weiterer Grund für meine oben erwähnte falsche Einstellung - sprang eine Cousine ein, die eine der bekanntesten Popsängerinnen des Landes wurde. Sie tritt noch immer im Fernsehen auf. Viel später, als frisch Verheirateter wollte ich es nachholen und lernte selbst während der Pikettdienste im Spital, wenn ich nicht im Einsatz war, Blockflöte zu spielen. In der eigenen Praxis fehlte mir dazu dann die Zeit. Unsere Kinder erbten leider meinen Widerstand gegen eine gewisse Dressur, die das Musizieren verlangt.
Ob sich Tim schon im Mutterbauch rhythmisch bewegte, als sein Vater die Gitarre spielte, wissen wir nicht, aber bereits als er sitzen konnte, wippte er bei Musik hin und her, sogar an einem Fest, als er krank, fiebrig und müde war. Wenn man mit ihm im Kinderwagen am Seeufer an den Strassenmusikanten vorbei spazierte, zeigte er sofort mit Begeisterung in ihre Richtung „doo, doo, doo“. Wir mussten anhalten und zuhören, und er war unzufrieden, wenn wir weiter schreiten wollten. Kurz nach dem er selbst zu gehen begann, spazierten wir in einem Park. In dessen Mitte trommelten wild zwei Männer, ein schwarzer und ein blonder, umgeben von ein paar Zuhörern. Viele Kinder spielten insgeheim, aber nur Tim lief sofort ohne Angst vor den lauten archaischen Geräuschen zu den Trommlern. Zwei bis drei Meter von den Trommlern entfernt ging er etwas in die Knie, wippte im Takt der Trommeln und schwang seine kleinen Hüften hin und her. Alle schmunzelten, wie das kleine Männli, kaum schon auf den Beinen, tanzte. Die Trommler hatten Freude an dem kleinen, aktiven Zuhörer, was wiederum auch ihm wohl tat.
Tim – ein Kommunist
Wir gingen oft mit Tim auf Spielplätze. Wenn auch andere Kinder dort waren, spielte er zuerst kurz für sich oder mit uns. Bald schaute er sich um und ging zu einem anderen Kind und wollte ihm die Schaufel, den Rechen, das Auto, den Bagger, oder was auch, wegnehmen. Meistens waren die Kinder und die begehrten Spielzeuge grösser als er und seine oder er hatte sie nicht. Die Grösse der Kinder schreckte ihn nicht ab. Die Begleitpersonen beiderseits mussten ihre diplomatischen und pädagogischen Fähigkeiten dabei voll einsetzen, damit nicht körperliche Kräfte zur Geltung kamen. Trotzdem flossen manchmal Tränen, was Tim überhaupt nicht verstand. Er blieb dabei ruhig, als ob es selbstverständlich wäre, dass er mit den fremden Sachen spielen wollte. Andere Kinder in dem Alter spielten schön zufrieden in der Nähe ihrer Begleitung nur mit ihren eigenen Spielzeugen. Wir verstanden nicht, wie es in der Krippe ging, warum sie es ihm noch nicht ausgetrieben hatten.
Kürzlich zogen sie in eine Siedlung mit vielen Spielplätzen um. Einer befand sich auch in ihrem Hof. Die Mutter ging mit Tim dorthin. Plötzlich hörte sie Tim schreien und sah wie zwei vierjährige Mädchen, welche „Indianerlis“ spielten, Tim an einen Baum fesseln wollten, weil er ihren Puppenwagen genommen hatte. In ihr Spiel passte, dass er ihn entführen wollte. Werden solche Ereignisse, eine natürliche Art der Erziehung, wirksamer als alles Zureden und Erklären?
Tim und Krippe
Es waren etwas bewegte Zeiten, als Tim zu den grösseren Kindern in der Krippe wechseln „durfte“, weil sie, wie bereits erwähnt, umgezogen waren. Damit Tim diesen Umzug nicht miterleben musste, verbrachte er die drei Tage bei den anderen Grosseltern. Ausgerechnet die Nacht vorher bekam er plötzlich das erste Mal Pseudocroup. Die verzweifelten Eltern brachten ihn auf die Notfallstation des Kinderspitals. Nach kurzer Zeit beruhigte sich seine Atmung und sie kehrten zurück nach Hause. Mit leichtem Schnupfen und Husten, dazu mit diskretem Ausschlag und Fieber, ging er am nächsten Tag doch zu den Grosseltern. Dort stieg das Fieber bedrohlich über 39°, aber die erste Nacht war trotzdem ruhig. Am nächsten Tag schnupfte und hustete er stärker, das Fieber sank nur dank den Fieberzäpfchen. Ich kam mit meinem Arztköfferchen, tastete die Lymphdrüsen, schaute in die Ohren und horchte mit dem Stethoskop die Lunge ab. Wir liessen Tim seinen Herzschlag hören. Weder er noch ich konnten etwas Besonderes feststellen. Das alles verlief in aller Ruhe. Ich dachte, wenn die Lymphdrüsen nicht vergrössert waren, musste ich ihn nicht mit einer Racheninspektion belasten. Er war unzufrieden, als wir wieder gingen. Weil es aber noch nach zwei Tagen nicht besserte, brachten ihn die Grosseltern zu ihrem Hausarzt, der auch das Blut untersuchte und bestätigte, dass es sich um eine Viruskrankheit handelte und Tim kein Antibiotikum brauchte. Der Familienrat entschied telefonisch, unter diesen Umständen sei es besser, wenn er noch einen Tag bei den Grosseltern bleibe. Die Eltern werden so die neue Wohnung schneller einrichten können. Am nächsten Tag ging es ihm besser, aber als sie ihn abholten, merkte man, bei all seiner riesigen Freude, einen leisen Vorwurf, wieso liessen sie ihn dort einen Tag länger als versprochen, als ob er es gemerkt hätte.
Die erste Nacht zu Hause schlief er unruhig und wachte mehrmals auf. Am nächsten Tag lebte er sich leicht ein, weil die neue Wohnung in einer grossen Siedlung ohne Verkehr war, mit vielen Innenhöfen. Jeder hatte einen anderen, eigenen Spielplatz. Im Treppenhaus konnte er den Ball hinaufwerfen und schauen, wie er zurückkam oder sogar weiter die Treppen nach unten hüpfen. Dann folgte er ihm, wenn man ihn an der Hand hielt, je einen Schritt eine Treppenstufe, und quietschte vor Begeisterung. Die Siedlung hatte mehrere Kinderkrippen. Es war nicht leicht, einen Platz dort zu bekommen. Eine davon, mit einem schönen Spielplatz, war nur einen Steinwurf entfernt von ihrer Wohnung. Als wir vorbei gingen, steuerte Tim gleich dorthin, nahm ein kleines Dreiradvelo, worauf ein Mädchen sofort zu schreien begann. Die Aufseherin erklärte, er müsse es dem Mädchen leider überlassen, auch wenn es jetzt auf einem anderen sitze, weil es nicht der Krippe, sondern ihm persönlich gehöre. Unberührt von dieser Zurückweisung ging Tim gleich in die Krippenräume und wollte dort mit den Spielzeugen spielen. Wir erklärten ihm, warum wir ihn herausziehen mussten.
Manchmal wartete Tim morgens schon bei der Wohnungstür bis auch Vater fertig war, und ihn in die Krippe brachte, wie wenn er sagen würde: „Komm Papi, wann bist du endlich fertig? “. Wir dachten, es wäre „gäbig“, wenn er in diese nahe Krippe gehen könnte. Die Tochter erklärte uns aber, dass es schwierig wäre an den Tagen, wenn er nicht in die Krippe gehe, und die Schwiegereltern und wir ihn davon abhalten müssten, einfach in der Krippe ein- und auszugehen. Er versuchte auch alle Parterrewohnungen mit durchgängigem Vorgarten zu inspizieren. Offensichtlich hatte er noch das Gefühl, die Welt gehöre ihm.

Am Anfang unserer Ehe schrieben wir Weihnachtsgrüsse wie bisher auf sorgfältig ausgewählten Karten. Später benützten wir die Weihnachtskarten von Corinne (s. voriges Kapitel). Unser Bekannten-, Freundes- und Familienkreis wuchs, und allen persönliche Grüsse zu schreiben wurde zunehmend belastend. Gerne übernahmen wir den angelsächsischen Brauch einen ausführlicheren allgemeinen Bericht zu verfassen und ihn eventuell kurz persönlich zu ergänzen. So entstanden Weihnachtsbriefe, die anfangs Silvia verfasste. Sie wurden Grundlagen für die Texte in den Kapiteln 8 - 10. In den letzten Jahren übernahm die Aufgabe Peter. Sie geben zusammen mit den Fotokollagen eine Übersicht über die wichtigsten Ereignisse im entsprechenden Jahr.
2010:
Die grösste Neuigkeit des Jahre 2010 (für uns) ist, dass wir mit der Praxis aufhörten. Es wurde uns langsam zu viel. Wir dachten auch, dass es wichtiger war, wenn wir bei Krankheiten der Grosskinder, was in ihrem Alter häufig vorkam, Corinne und Christian helfen, und Corinne dadurch ruhiger weiter arbeiten konnte. Eine Freundin schrieb uns, dass wir bald nicht begreifen werden, wie wir das alles bisher bewältigen konnten – sie hatte recht. Wir wollten auch vermehrt zwischen St. Gallen und Agra pendeln, so lange (wie lange?) es geht, unserer Leidenschaft, dem Wandern frönen, in Ruhe unsere Morgengymnastik absolvieren, die Zeitung durchlesen, unsere Italienischkenntnisse verbessern, wieder vermehrt gute Bücher lesen, vielleicht auch etwas schreiben. Es scheint, wir verkraften den Verlust der Praxistätigkeit mit allen positiven und negativen Auswirkungen ohne grössere Schwierigkeiten.
Auch sonst erlebten wir Vieles. Besonders schön waren die Familientreffen. Das erste an einem schönen Sonntag Ende Juni in Hauptwil, wo Silvia aufgewachsen ist, mit ihrer grossen Familie, draussen in der Waldschenke, unter dem Schutz der Bäume. Nicht nur wir Erwachsenen, aber auch die vielen Kinder jeden Alters haben es genossen, Neuigkeiten auszutauschen und zusammen zu spielen. Der Anlass waren einige runde Geburtstage (auch Silvias 70.)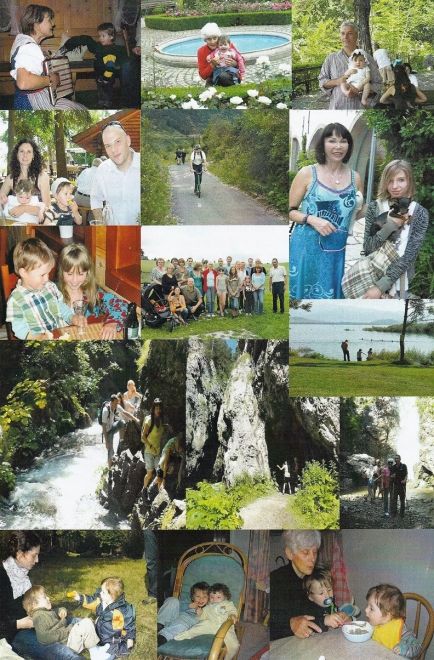
(1) Bilder zum Weihnachtsbrief 2010.
Anfangs August trafen wir uns mit Peters Familie im Ursprungsland – in der Slowakei, an einem grossen Stausee, einem wunderschönen Fleck des Landes, in der Nähe der Berge. Es waren wieder drei Generationen im Alter von neun Monaten bis dreiundsiebzig Jahren vereint. Während sechs Tagen wanderten wir zusammen, badeten, besuchten nach Lust und Laune in verschiedener Zusammensetzung die vielen Sehenswürdigkeiten der Umgebung und tauschten nach einem Abendessen in einer „Schafshirtenhütte“ mit guten slowakischen Spezialitäten Kenntnisse und Ansichten über den Einfluss der Geschichte der Familie auf unsere Leben aus. Wir waren überrascht und begeistert, wie es untereinander keine Probleme gab, wir gewisse äusserliche Schwierigkeiten (Suche des richtigen Weges, Eintreffen am richtigen Platz zur richtigen Zeit) mit Verständnis, Abstand und Humor ertrugen, und wie sich die junge Generation um die Geschichte der Familie interessierte. Manche schlugen gleich vor, wir sollen so ein Treffen wiederholen. Was will man mehr?
Es gab noch eine Aenderung in unserem Leben. Unsere Weihnachtsferien 2010 verbrachten wir erstmals in Malbun, im „Ländle“ Lichtenstein, wieder mit Corinne, Christian, Tim und Liv. Am Weihnachtsabend kamen auch Barbara, Daniel und Alexa.
2011:
Einen erheblichen Teil des Jahres verbringen wir, wie üblich, mit dem mehr oder weniger guten Schlaf im Bett. Ein anderer Teil, derjenige „unterwegs“, ist wesentlich gewachsen – wir sind ein fahrendes Volk geworden und pendeln entweder zwischen St. Gallen und Zürich, weil wir die gelegentlich kranken Kinder und auch sonst hüten, um Corinne ihr Berufsleben zu ermöglichen, und um Tim und Liv geniessen zu können, oder zwischen St. Gallen und Agra, da man dort nicht nur besser schlafen, sondern auch schreiben kann. Die Reisen sind sehr angenehm. Nirgendwo kann man sich so lange ungestört in einen Lesestoff, ob Zeitungen, Zeitschriften oder Bücher, vertiefen, wie im Zug oder ab und zu ein Nickerchen machen.
Auch nach bald zwanzig Jahren Agra entdecken wir in der Nähe neue schöne Wanderungen. Im Frühjahr springen uns dabei hungrige Rehe vor die Nase, im Sommer versperren uns junge Wildschweine den Weg, die wir und ihre versteckte, aber gefährliche Mutter mit Bellen verscheuchen müssen oder aufgescheuchte und aufgeregte Perlhühner, die aus ungeklärten Gründen auf unserem mit hohem Gras umgebenen Wanderweg vor uns herlaufen und erst dann nach links und rechts die Flucht ergreifen, wenn sie sich auch von der Gegenseite durch andere Wanderer bedroht fühlten. Unvergesslich sind Myriaden von Glühwürmchen, die uns jeweils Ende Juni in der Dunkelheit beim spät abendlichen Abstieg von der Alpe Roccolo, nach einem reichlichen Abendessen mit einem vollen Bauch von einheimischen Spezialitäten und einer entsprechenden Menge von Wein und Grappa, umschwärmen und den Weg beleuchten. Da die Wege grösstenteils im Wald verlaufen, ist es auch in der Sommerhitze nirgendwo so angenehm beim Wandern wie hier. Auf einer Wiese schauen wir einer grossen Herde von Kühen mit Stier zu, mehrere Muttertiere mit ihren Kälbern, die sie ruhig, nach Bedarf und nicht nach Befehl saugen lassen. Die Euter sind nicht übermässig gross, sie reichen für die Kälber und sollen keine überflüssige Milch produzieren, alle erwachsenen Tiere haben Hörner, und es gibt keine Hunde, Hirte oder Glocken. Wir kommen uns vor wie in Argentinien (wo wir nie waren, aber auch Karl May weilte nie in Amerika). Die Farm nennt sich auch sinngemäss „La Pampa“. Angeblich enden diese „glücklichen“ Tiere auf dem Teller in irgendeinem Luxusrestaurant. Schrecklich, schrecklich. Im Herbst lauschen wir dem Rauschen der fallenden Eicheln und Edelkastanien. Die Kastanienbäume bekamen dieses Jahr zu wenig Wasser. Dadurch gab es weniger grosse Marronis und praktisch keine Pilze. Silvia kochte Risotto und andere Getreidegerichte mit Kastanien. Leider ist ihr so ein unübertreffliches Marronibrot noch nicht gelungen, wie man es im Restaurant am Passo die S. Antonio bekommt, aber sie bleibt dran. Vor dem Einzug des Winters treffen wir Gämse und ihre Jäger in der Hoffnung, dass sie uns nicht verwechseln.
In St. Gallen genossen wir auch die Umgebung und holten nach, was wir während der Praxisjahre versäumten. Im Unterschied zu Agra sind viele Wanderwege, die zu den Bergen und zu vereinzelten Häusern führen, asphaltiert.
Jetzt lassen wir aber das alte Eisen, zwar schon etwas rostig, sonst aber immer noch rüstig (was wir enorm schätzen und dafür dankbar sind) und wenden uns der Jungmannschaft zu:
Daniel arbeitete nun vorwiegend als Lehrer auf einer Fachhochschule, was ihm sehr gefällt, die Lehrer versuchten es ihm schon in seiner Gymnasiumzeit schmackhaft zu machen, er wollte davon aber nichts wissen. Barbara hat auch genug zu tun als Mitarbeiterin im Lokalradio und bei der Lokalzeitung. Alexa entwickelt sich sehr gut, wird immer selbständiger und bekommt in der Schule sehr gute Noten. Trotzdem will sie vorläufig nicht auf das Gymnasium. Im Moment schwebt ihr ein Beruf im Gesundheitswesen vor. Sie hat eine gute Beziehung zu Kindern und bestand die Prüfung als Baby-Sitter. Aber auch Daniel wollte während einer gewissen Zeit lieber Maurer werden als studieren.
Corinne bekam zusätzlich eine Teilstelle an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Sie hofft, mit der Zeit sich ganz von den belastenden Fahrten nach Kreuzlingen befreien zu können, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Christian ist mit seinem Job bei der Helsana zufrieden, auch wenn er weniger freie Zeit hat als früher bei der CS. Sein Projekt als Vermögensberater entwickelt sich gut, und er studiert nebenberuflich noch weiter. Anstatt über Tim und Liv zu schreiben, lassen wir die Bilder sprechen.
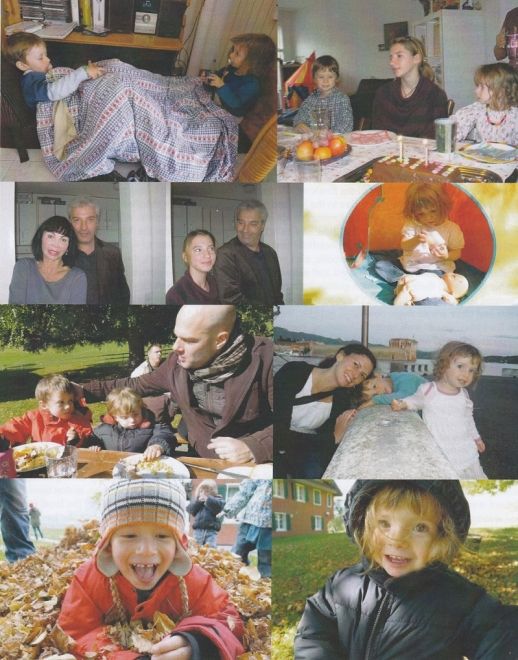
(2) Bilder zum Weihnachtsbrief 2011.
2012:
Unser letzter Jahresbericht könnte den Eindruck erwecken, wir pendeln nur zwischen St. Gallen, Zürich und Agra hin und her. Dem ist jedoch noch nicht ganz so. Aus Agra fahren wir in verschiedene mehr oder weniger berühmte und bekannte norditalienische Städte und Städtchen. Novara hat den Ruf eines uninteressanten Eisenbahnknotenpunktes, einer Industriestadt. In einem der Führer durch Italien fanden wir jedoch, dass es auch eine grosse Altstadt gibt, die an Turin erinnert. Als wir dort ankamen, waren wir überrascht, dass ähnlich wie in Pavia, die Kioske weder detaillierte Führer noch Ansichtskarten anboten. Unterwegs zur Buchhandlung, wo wir endlich einen eher schäbigen Führer erhielten, wurden wir dafür entschädigt: In einer schönen alten Konditorei bekamen wir in einem sorgfältig vorgewärmten Glas eine besonders lang zubereitete Mischung aus irgendwelchen Gewürzen, Liqueur, Kaffee und Schlagrahm, wobei diese Schichten scharf getrennt blieben.
Im romanisch-gotischen Dom erwartete uns eine weitere Überraschung – das Bild des „letzten Abendmahls“ mit einer ungewohnten Tiefe und einer lebendigen, ausdrucksvollen Darstellung der Teilnehmer an der reich gedeckten Tafel. Während bei Leonardo da Vinci eine geschlossene Gesellschaft in einem geschlossenen Raum tafelt, sind hier manche vom Tisch abgewandt und sprechen und gestikulieren auf beiden Seiten mit der Umgebung. Wer ist und was geschieht dort? Und so, wie die zwei Diener und die Betrachterin im ruhigen und beruhigenden Hintergrund, sind auch wir, etwas von oben schauend, an dieser Mahlzeit dabei. Der nachdenkliche Jesus, dem nur ein Teil der Apostel lauscht, auch wenn er das Brot verteilt, ist offensichtlich schon nicht wie früher mit dem Essen und den irdischen Problemen der Verbliebenen beschäftigt, in dem er Hungrige sättigte und kranke heilte. Es sind eigentlich zwei Bilder: Wenn wir den unteren Teil betrachten, nehmen wir den Hintergrund mit dem Ausblick in die Landschaft und der ruhig, gelassen wartenden und beobachtenden, anmutigen Frau im Minirock (Peters Phantasie) nicht wahr. Ist es Maria Magdalena? Und umgekehrt, schauen wir nach oben, rutscht uns die Mahlzeit aus dem Blick. Das Bild malten zwei Maler: Sperindio Cagnola und Gaudenzio Ferrari, jüngere Zeitgenossen von Leonardo da Vinci, dessen „letztes Abendmahl“ wir nach der Restaurierung dieses Jahr in Mailand auch bewunderten. Malte der eine den unteren, der andere den oberen, eher Renaissance-Teil des Bildes? Wie auch, man betrachtet eine der Frühchen der barocken Malerei. Das weitgehend unbekannte Bild beeindruckte uns unheimlich, sodass wir uns darüber so ausbreiten und eine Kopie beilegen.
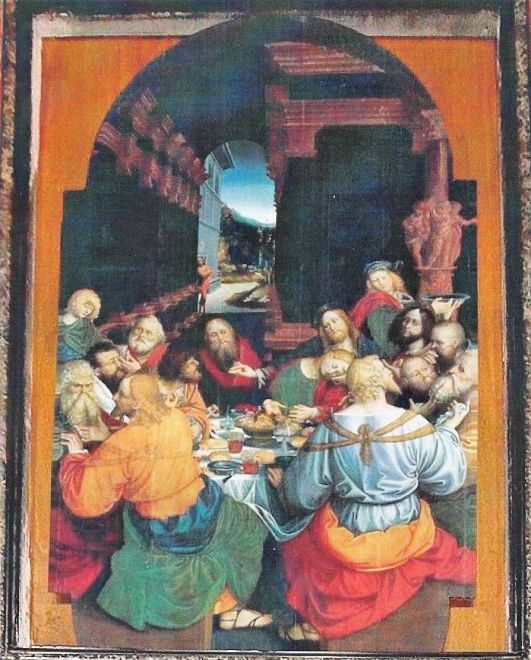
(3) Bild des "letzten Abendmahls" gemalt von Sperindio Cagnola und Gaudenzio Ferrari, jüngere Zeitgenossen von Leonardo da Vinci.
Auf die Bilder des „letzten Abendmahls“ stiessen wir auch auf unserer Frühjahresreise in die Slowakei anlässlich Peters Maturitätstreffens. Nahe der Grenze zur Ukraine und Polen besichtigten wir neun alte griechisch-katholische Holzkirchen, eine schöner und interessanter als die andere. Ihre Altare sind nach strengen Regeln und Schemas aufgebaut. Auf jedem befindet sich das Bild, die Ikone des „letzten Abendmahls“. Die Ikonen, wie die Altare und die Kirchen unterscheiden sich je nach dem, wann sie entstanden sind. Eine der Kirchen und eines der „letzten Abendmahle“ bilden wir als Beispiel auch ab.

(4) links eine der Holzkirchen, rechts "das letzte Abendmahl".
Eigentlich gehören auf einen Weihnachts- und Neujahrsbrief keine Osterbilder. Auch wenn wir noch nicht bei unserem „letzten Abendmahl“ sind, dafür beim „letzen Mal“ immer öfters: Das letzte Mal kaufen wir etwas, das letzte Mal waren wir hier oder dort, das letzte Mal erleben wir das oder jenes, das letzte Mal treffen wir jemanden… Und so vorbereiten wir uns auf unser „letztes Mal, auf unser „letztes Abendmahl“. Zur Vorbereitung gehört auch meine Beteiligung am „Hospizdienst“, womit ich meinem Zustand und meinen Möglichkeiten gemäss den Beruf fortsetze. Ich begleite die schwer kranken und sterbenden Menschen höchstens mit einfachen pflegerischen Massnahmen. Die Anwesenheit, und wenn möglich Gespräch, Vorlesen, sind jedoch wichtig.
Etwas näher zu meinem letzten Abendmahl war ich beim Herzinfarkt am 7. September 2012. Die Errungenschaften der modernen Medizin, verbunden mit einer liebevollen Pflege würden mich ihn körperlich vergessen lassen, wenn ich nicht eine Anzahl von Medikamenten schlucken und mich mannigfachen Untersuchungen aussetzen müsste. Was meine Gesundheit betrifft, verlor ich meine unschuldige Kindheit und bin plötzlich ein alter Mann geworden. Aber mit J.M. Simmel kann ich ausrufen: Hurra, wir leben noch!
(Meine Bemerkungen zu Peters Infarkt: Er bekam ihn eigentlich, als wir mit Corinne, Christian und den Kindern im Simmental waren und wir ihnen die Simmenfälle hinter Lenk zeigen wollten. Das Ausschlaggebende war aber der Föhn, der damals dort herrschte und wir als Abschluss noch mit der Bahn auf den Rinderberg wollten. Peter gab erst dann zu, dass er Probleme hatte und deshalb nicht mit uns auf den Rinderberg kam. Er wollte sich aber von keinem Arzt in Zweisimmen untersuchen lassen. So kehrten wir dann betrübt wieder nach Zürich und St. Gallen zurück. Er meldete sich darauf sofort beim Herzspezialisten zu einer Untersuchung an. Die Arztgehilfin checkte es nicht und gab ihm erst Ende Woche einen Termin, worauf er dann zwei Tage später nachts den Infarkt bekam und mich natürlich nicht weckte, sondern mir auf dem Boden vor der Zimmertür einen Zettel hinterliess: „ Ich bin im Spital wegen Brustschmerzen. Geh nach Zürich. Peter“ und in diesem Zustand selbst ins Spital fuhr, obwohl er in der Garage noch die Nummern am Auto befestigen musste. Die Aerzte im Spital meinten, das sei typisch Mediziner. Wir sollten die Kinder hüten. Deshalb war ich auch schon um 05.00 Uhr wach. Also rief ich zuerst im Spital an. Der Arzt meinte, sie seien jetzt daran, Peter zu untersuchen, es hätte keinen Sinn, wenn ich dorthin komme. Also fuhr ich nach Zürich und sandte unterwegs Corinne ein SMS. Sie rief mich an, sobald sie wach waren und sagte, ich solle wieder umkehren. Sie komme dann später mit den Kindern ins Spital. So fuhr ich mit dem nächsten Zug wieder nach St. Gallen und von dort direkt ins Spital. Inzwischen bekam Peter einen Stent, und es ging ihm schon bedeutend besser. Als Corinne mit den Kindern kam, konnte er sie sogar schon „geniessen“.)
(5) Bilder zum Weihnachtsbrief 2012.
Jetzt weg vom Übergang zum Winter zu den Anfängen des Frühjahres und des Frühsommers: Selbstverständlich hüten wir nach wie vor gerne Liv und Tim, meistens in Zürich, wenn sie krank sind, während der Sommerferien in Agra und hie und da sowie in Tims Herbstferien hier bei uns. Ja, Tim ist seit diesem Jahr im Kindergarten, worauf er mächtig stolz ist und Liv ihn sehr darum beneidet, sie weiss jedoch, dass sie zwar noch zwei Jahre warten muss, aber dann auch dieses Glück für sich in Anspruch nehmen kann. Tim machte mit dem Kindergarteneintritt einen grossen Sprung nach vorne. Er ist viel ruhiger und seiner Schwester gegenüber grosszügiger und liebevoller. Liv, die früher nur mit Lastwagen und Bauklötzen spielte, ist jetzt ein richtiges Puppenmütterchen geworden.
Auch für Corinne änderte sich nach den Sommerferien einiges. Keine Fahrten nach Kreuzlingen mehr, dafür zügelten sie mit der Pädagogischen Hochschule an den Hauptbahnhof in Zürich, wo sie seither als Dozentin jeweils von Montag bis Mittwoch arbeitet. So wie er vorher enorm lang war, so ist ihr Arbeitsweg jetzt wirklich kurz, ca. 20 Minuten von zu Hause bis zur Schule. Nicht nur dass sie in einem wunderschönen Gebäude unterrichten kann, sie findet ihre Arbeit enorm spannend. Das Lesen der vielen Berichte ihrer Schüler und Schülerinnen über ihre ersten Unterrichtserfahrungen sind zwar mühselig, aber die Besuche in den jeweiligen Schulen in den vielen Gemeinden im Kanton Zürich sind dafür umso spannender und zeitweise auch rührend, wenn Corinne die Erst- und Zweitklässler wieder so vor sich sieht, so werden auch Erinnerungen als Primarlehrerin von früher wach. Es war für Corinne ein happiges Jahr, zuerst die Vorbereitung und die Unsicherheit, ob sie die Stelle bekommen wird und jetzt die Einarbeitung erfordern viel Zeit und Energie. Schlussendlich wird es sich aber lohnen, denn die Arbeit gibt ihr eine neue Befriedigung, und sie muss nie mehr schon um 05.00 Uhr aufstehen, um zur Arbeit zu fahren und kommt auch früher von der Arbeit nach Hause als von Kreuzlingen, was für die ganze Familie angenehmer ist, weil Christian die Kinder jetzt nur in die Krippe bringen muss und Corinne sie dort abholen kann.
Wie man aus den Nachrichten erfahren konnte, ist Christian ein Trendsetter. Damit die Kinder nicht drei Tage pro Woche in der Krippe verbringen müssen, bleibt er nun jeweils am Montag zu Hause, so können Liv und Tim den Papa auch geniessen, was natürlich auch umgekehrt der Fall ist. Zudem sieht er wieviel Zeit die Kinder in Anspruch nehmen und wie wenig für den Haushalt bleibt, jedenfalls schätzt er den Montag zu Hause. Teilzeitarbeit der Männer ist eindeutig „in“.
Alexa hatte in diesem Jahr einige Schnupperwochen an verschiedenen Orten wie Kinderspital, Altersheim, Spital Stansstad und Kantonsspital Luzern, absolviert. Das Resultat war, dass sie Ende dieses Schuljahres eine Lehrstelle als Krankenschwester im Kantonsspital in Luzern beginnen konnte, worüber wir alle sehr glücklich waren.
Nachdem die Ortszeitung Stansstad aus finanziellen Gründen nicht mehr weiter existieren konnte, bekam Barbara aus Zug ein neues Angebot. Sie nahm die Stelle bei der Zuger Zeitung zwar an, da in der Umgebung nichts Besseres in Aussicht war, aber es gefällt ihr dort nicht so wie beim alten Arbeitgeber. Es arbeiten dort fast nur Männer, denen es nichts ausmacht, erst spät abends nach Hause zu gehen, was Barbara aber Mühe macht, da sie schliesslich nicht nur einen Mann, aber auch eine Tochter zu Hause hat, mit denen sie gerne mehr Zeit verbringen möchte. Daniel hat es einfacher, er kann meistens von zu Hause aus arbeiten und muss nicht täglich in die Fachhochschule in Windisch. Hoffen wir, dass auch für Barbara wieder ruhigere Zeiten kommen.
Dieses Jahr feierten wir Weihnachten bei Corinne und auf das neue Jahr 2013 stiessen wir in Agra mit Maria und Frido an. Gleichzeitig feierten wir dort auch noch unseren 40. Hochzeitstag.
2013:
Wie schon immer, so auch im Jahre 2013 wollte Silvia eine gute Frau sein. Gegen Ende einer schönen Sommernacht kroch sie in mein Bett, was leider immer seltener vorkommt und so früh morgens schon lange eher ungewöhnlich ist. Ihr Herz flatterte, auch nicht wie früher aus Sehnsucht nach mir. Mit ihrer Neigung zu tiefem Blutdruck und Puls, ergab das Herzflattern eine giftige Mischung, die schon liegend eine unerträgliche Schwäche und ein unangenehmes Gefühl verursachte, als ob das Herz zu schlagen aufhören würde, vielleicht für immer. Sie wollte mich mit Herzbeschwerden eben nicht alleine lassen. Sie konnte weder stehen noch sitzen. So mussten wir die Ambulanz rufen. Es dauerte eine Weile, bis sie kamen. Sie erwischten noch die Herzrhythmusstörungen, aber schon als sie ihr die Infusion steckten, war der Spuk vorbei. Trotzdem brachten sie Silvia sicherheitshalber unter vielen aufmerksamen Augen der Nachbarn liegend in den Notfallwagen. Im Spital wurde sie gründlich untersucht. Selbstverständlich fanden sie keine Störung mehr und keinen Grund für ihre Beschwerden. Zum Glück hatten wir den kurzen Elektrokardiogrammstreifen von zu Hause, sonst könnten sie uns wegen Vorgabe falscher Tatsachen verdächtigen. Schon kurz vor dem Mittag kehrte sie ohne Infusion aus dem Taxi zu Fuss zurück, was ihr sicher weit und breit den schlechten Ruf einer Simulantin einbrachte. Wir konnten den scharfen Beobachtern in der Umgebung den Streifen nicht zeigen, da sie ihn im Spital behielten. Ich musste unter ihrer detaillierten Anleitung das den Umständen entsprechend einfache Mittagessen zubereiten, was eine Premiere war. Inzwischen kann Silvia gut auch bergauf gehen, ich koche immer noch nicht. Auch wenn es gegen die Behauptung des jungen Oberarztes der Kardiologie verstösst, der meinte, Stress spiele dabei keine Rolle, setzt ihr Herz bei Lärm oder psychischem Druck manchmal kurz aus, aber sie kann trotzdem weiter gehen und noch wichtiger, auch weiter kochen. Man kann nur warten, wie es sich entwickelt. In diesem Stadium könnten Medikamente schaden, was zu Silvias Einstellung ganz gut passt.
Am nächsten Tag wollte uns unser Nachfolger in Zweisimmen seinem Nachfolger als „Grosseltern der Praxis“ vorstellen. Wir mussten es für später verschieben.
Der Zustand meines Herzens hat sich stabilisiert, aber ich muss unzählige Tabletten gegen hohen Blutdruck und einen weiteren Infarkt nehmen, was zwar meiner Einstellung nicht ganz entspricht, aber ich ertrage sie gut. Trotzdem spüre ich bei Stress und Föhn, dass ich ein Herz habe. Dafür kann ich mich problemlos körperlich belasten. Im September wurde mir wegen eines weissen Hautkrebses ein Stück vom Ohr abgehauen. Wir bekommen Hörner, Flecken und Körner, bröckeln langsam aber sicher ab. Und man kann auch dagegen kaum etwas tun.
Dafür entwickeln sich unsere Enkel prächtig. Alexa wurde konfirmiert. Wir feierten es auf dem Pilatus, dem Hausberg von Luzern. Unterwegs bewunderten wir die besondere Pracht von fast subtropischen bis hochalpinen Frühjahrsblumen, die man sonst kaum auf ein paar hundert Metern Höhe trifft. Im Herbst begann Alexa mit Freude ihre Ausbildung als Krankenschwester. Sie steht frühmorgens auf, fährt mit dem Zug nach Luzern und abends wieder zurück. Auf der hämatologischen Abteilung erlebte sie schon oft, dass die Patienten sterben, was sie, wie auch schwierige Pflegearbeiten gut erträgt. Barbara hat auch eine Ausbildung in der Pflege von dementen Patienten begonnen und Daniel fährt oft längere Strecken, da die Firmen, die er berät im Moment in Lausanne und Würzburg sind. Er unterrichtet weiterhin auch noch an der Technischen Hochschule der Nordostschweiz.

(6) Bilder zum Weihnachtsbrief 2013.
Tim und Liv erwarteten zu Corinnes 40. Geburtstag ein Brüderchen. Es kam aber schon einen Tag vor Weihnachten. Selbstverständlich wurden wir notfallmässig nach Zürich gebeten, da Corinne plötzlich heftige Wehen bekam. Wir blieben also bei Tim und Liv in der Wohnung und hofften, dass Corinne bei der Geburt im Spital Triemli keine Probleme hatte. Es dauerte aber nicht allzu lange, und wir bekamen den glücklichen Bericht, dass Tim und Liv ein Brüderchen namens Eli bekamen und wir es begrüssen dürfen. Das liessen wir uns nicht zweimal sagen und machten uns sofort auf den Weg dorthin. Wir wurden alle drei auch gleich in den Gebärsaal zugelassen. Eli war sogar noch an der Nabelschnur, die sie vor unseren Augen durchschnitten. Dann wurde er gewogen: 3970g! Kein Wunder war die Geburt wieder nicht einfach, aber Hauptsache, Corinne hatte es gut überstanden, und Tim und Liv durften ihr Brüderchen in die Arme nehmen. Glücklich machten wir uns nach diesem beeindruckenden Besuch wieder auf den Heimweg.
Am 28. Dezember 2013 feierten wir alle zusammen bei Daniel und Barbara Weihnachten.

(7) Weihnachten bei Barbara und Daniel nach Elis Geburt.
2014:
Alle Berichte und guten Wünsche, die wir jeweils Ende des Jahres erhalten, freuen uns sehr, und wir möchten uns für die diesjährigen schon im voraus bedanken. Sie werden immer öfter von Bildern aus der Kindheit begleitet, was verschiedene Gründe haben dürfte. Sie veranlassten uns auch, in die Kiste mit alten Fotos zu greifen. Dieser Griff half uns, ein Rätsel, das uns schon lange beschäftigte, zu lösen.
Es gibt verschiedene Gründe, warum zwei Menschen, nur durch kurze, mehr oder weniger häufige Missgefühle wie Aerger und Wut unterbrochen, Jahrzehnte im Grunde genommen glücklich und zufrieden zusammen verbringen. Auch wir hatten Prinzen und Prinzessinnen kennengelernt und das Leben mit ihnen mehr oder weniger eng geteilt und genossen. Wir fragten uns, zwar nicht ständig, aber oft selbstzufrieden, warum schlossen denn ausgerechnet wir zwei den Bund der Ehe, und vor allem warum hält er so, dass uns voraussichtlich und hoffentlich nur der möglichst gnädige Tod scheidet? Die zwei Bilder unserer Grosselternhäuser, bei Silvia mit der schweizerischen Beständigkeit blieb es auch ihr Elternhaus, sind sehr ähnlich, auch wenn sie zwei bis drei Jahrzehnte trennen. Auf dem älteren – Teil einer damaligen Ansichtskarte - dürfte mein Grossvater mit seinen engsten
(8) Langers Gasthaus Pribovce.
Gehilfen abgebildet sein, stolz auf seinen Besitz. Auf dem jüngeren ist Silvias Grossvater, nicht weniger stolz mit der Familie und den Gesellen gut erkennbar.
(9) Schmiede Hauptwil mit (v.l.) 2.Tante Rosa mit Velo, 5.Grossmutter, 6. Grossvater Schweiwiller.
In der nächsten Generation bildete sich der sehr lange, feine Faden zwischen uns weiter. Silvias Vater übernahm samt der jungen hübschen Tochter auch das jahrhundertealte Haus mit der Schmiede und erneuerte sie. Mein Vater bekam nebst der auch nicht hässlichen Frau als Mitgift ein Transportunternehmen mit mehreren Pferden. Wir waren gute Kunden beim einzigen Schmied in Martin. Er, seine Gesellen und die Schmiede ähnelten den Bildern von Titanen und Kyklopen aus einem meiner Märchenbücher, die in Vulkanen tief in der Erde arbeiteten. Wenn sie stritten, brachen die Vulkane aus. (Bei uns bisher nur Wut, aber wir sind keine Titanen.) Auch unser Schmied und seine Helfer hatten lederne Schürzen. Der Chef trug die schönste, festeste, ohne Fransen und Löcher. Die Schmiede war für mich die Verkörperung von Kraft und Können: Sie konnten geschickt mit dem Feuer umgehen, Metall biegen, die Tiere zähmen, und wenn sie freie Zeit hatten, sogar schöne Zäune, Kerzenständer und andere Gegenstände formen. Vielleicht waren sie nahe der Hölle mit Teufeln, und so dauerte es lange, bis ich es wagte, in die Dunkelheit der Schmiede einzutreten. Dafür durfte ich dann auf den Balg drücken (ein Geselle half mir dabei) und damit die besonders gute, reichlich Hitze spendende Kohle anfeuern. Wie sich manche Kinder mehr, andere weniger vor dem Haarschneiden fürchten und dabei weinen, so haben gewisse Pferde eine Abneigung gegen die Schmiede und das Befestigen der Hufeisen mit den Nägeln in ihre, wenn sie tief genug eindrangen, empfindlichen Hufe, wobei die dunklen, verrauchten Schmieden und ihre Vorräume weniger einladend wirken als die hellen, gut duftenden Räume der Haarschneider. Bei solchen feinnervigen Pferden müssen beim Hufbeschlag manchmal mehrere Personen das Bein des Tieres festhalten. Man versuchte sie wie Kinder abzulenken, liess sie vor dem Gang zur Schmiede hungern und stülpte ihnen dann einen Sack mit Köstlichkeiten wie Hafer oder Gerste über das Maul. Manchmal brauchte man bei solchen uneinsichtigen, widerspenstigen Tieren ausser Können auch Zeit und Geduld. Man konnte sie doch nicht auf den Strassen tagelang schwere Wagen ziehen lassen, ohne ihre Hufe zu schützen. Ein tierliebender, einfühlsamer Schmied, wie es der Vater von Silvia nicht nur mit Tieren war, konnte diese Aufgabe leichter erfüllen.
Das Schicksal webt unsichtbare, feine aber feste Fäden. Silvia und ich wuchsen mit den Pferden, mit ihrem Geruch auf. Wir erlebten mit, was unsere Eltern taten. Heutzutage können es nur Bauernkinder. Wir besitzen keine Pferde aber Autos. Ihr Geruch ist nichts Besonderes und ihre Marken trennen uns eher als verbinden.
Diese Zeilen könnten den Eindruck erwecken, dass wir schon grauenhaft rückwärts gerichtete Greise sind, die ihre Vergangenheit in rosigen Farben verklären und allen neuen Errungenschaften entgegen feindlich eingestellt sind. Dem ist überhaupt nicht so.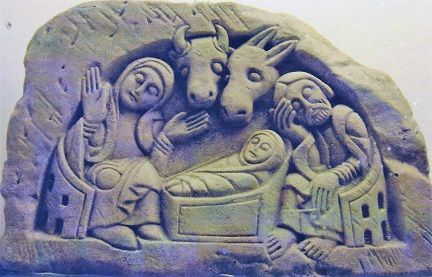
(10) Weihnachtskrippe aus der Sammlung unserer Freundin Madeleine Kissling.
Die weihnächtliche Krippe im Stall erinnert uns auch an Geburten, Erlebnisse und Erfahrungen mit unseren Enkelkindern (Alexa Pflegefachschule, Tim Erstklässler, Liv Kindergärtnerin), desto mehr als der Jüngste, Eli, am 23. Dezember einjährig wird. Die neuen Windeln und verschiedene andere sehr praktische Einrichtungen erleichtern und vereinfachen enorm das Leben der Eltern. Nicht zu denken wie es in Bethlehem war. Die gegenwärtig gut hygienisch verpackten Säuglinge und Kleinkinder verschieben jetzt ihre Neugier und den berechtigten Stolz auf ihre Leistung auf andere Gebiete und Fähigkeiten. Damit erfährt die ganze Gesellschaft einen nie da gewesenen schöpferischen Schub, wie alle die neuen Errungenschaften des Lebens beweisen. Wenn nicht unsere Kinder, dann Enkelkinder werden Kreuzfahrten auf den Mond und dann von dort auf den Mars und zurück zur Erde unternehmen. Mit dieser erfreulichen Feststellung und den rosigen Aussichten schliessen wir unsere, vielleicht zu langen vorweihnächtlichen Betrachtungen und hoffen auf ein gutes, erfolgreiches 2015.
2015:
Der Sinn des Lebens kann keinem Menschen gegeben werden, er kann nur vom Menschen selbst gefunden werden. Was der einzelne Mensch als Sinn seines Lebens wahrnimmt, kann sehr unterschiedlich sein.
Daniel Büche, Leiter der Palliative Care, St. Gallen.
Nach unserem letztjährigen Weihnachtsbrief äusserten manche die Hoffnung, dass wir mit alten Geschichten und Nostalgien aufhören und uns der Gegenwart und der Zukunft widmen sollen. Gerne erfüllen wir diesen Wunsch und bekennen uns zum schönen, anregenden und aufregenden Leben als pensionierte und passionierte Grosseltern.
Vor nicht all zu langer Zeit, als wir noch arbeiteten, blieb einem bekannten Ehepaar nicht viel Zeit für gesellschaftliche und gesellige Anlässe – die meiste Zeit hüteten sie ihre Enkelkinder. Wir dachten, wie kann man nur? Ein slowakisches Sprichwort sagt: „Schrei nicht hopp, eher du nicht übersprungen wirst“. Jetzt hören wir ähnliche Einwände zu unserem Lebenswandel. Wir hüten zwar nicht jede Woche, haben uns aber bereit erklärt, an Corinnes Arbeitstagen nach Zürich zu kommen, falls eines der Kinder krank ist.
Als Dozentin für Gestaltung an der Pädagogischen Hochschule kann Corinne sowohl ihre erzieherische wie auch künstlerische Neigung und Ausbildung entfalten und ausleben. Ihr Arbeitsplatz in der Nähe vom Hauptbahnhof in Zürich ist für sie einfach und schnell erreichbar, die Leitung, die Kolleginnen und Kollegen haben Verständnis für arbeitende Mütter. Solche Stellen sind selbstverständlich sehr begehrt. Würde sie eine längere Pause einlegen, wäre die Stelle vergeben und Corinne „weg vom Fenster“. Dabei befriedigen wir unsere, ob positiv oder negativ begründete Hilfsbereitschaft, die wir während langer Jahre auch im Beruf zu stillen gewohnt waren. Ich glaube, die Patienten waren mit mir eher unzufrieden, weil ich sie mit meiner Sorge und Zuwendung eher überforderte als vernachlässigte. Wir sind froh, dass unsere Gesundheit uns es noch erlaubt und dass wir jetzt dafür genug Zeit haben. (Nebenbei helfen wir dadurch auch, das Bruttosozialprodukt zu steigern.) Auch wenn wir nicht mit den Enkelkindern leben (was für alle Seiten wohltuend ist), können wir gut miterleben, wie sie wachsen und sich entwickeln, wie sie sich freuen und stolz sind, wenn sie zuerst die „einfachsten“, mit der Zeit immer komplizierteren Aufgaben erfüllen und Ziele erreichen, wie sie gleich und gleichzeitig schon früh verschieden sind. Wir beobachten, vielleicht bilden wir uns es nur ein, welche Eigenschaften sie von wem erbten. Wahrscheinlich ist es auch nur Einbildung, dass wir sie auch etwas erziehen in einem eher bescheidenen Rahmen, in dem es überhaupt möglich ist, wie wir zunehmend merken. Immer wieder kommt uns die eigene Kindheit in den Sinn, was natürlich mit unserem zunehmenden Alter zu tun hat. Wir sind froh, dass sie nur mit natürlichen Entwicklungsproblemen, ohne Armut, Diskriminierung und Verfolgung aufwachsen, und hoffen, dass es bald allen Kindern auf der ganzen Welt so ergehen wird. Wir bekommen fast Entzugserscheinungen, wenn sie länger gesund sind oder Corinne und Christian uns sonst nicht brauchen. Wir schätzen uns glücklich, dass wir, was nicht allen Grosseltern gegönnt wird, nicht nur für Feste, Feiertage und Geschenke da sind. Wir haben auch mit Alexa diese Zeit sehr genossen. Damals waren wir etwas jünger, hatten aber den Beruf. Nun sind wir dankbar, dass wir es noch können. Eine Gegebenheit sticht von all den schönen, die wir mit den Kindern erlebten, heraus. Kinder im Alter von Eli erweitern ihre Beziehungen und klammern sich an einen Gegenstand, ein Tier oder ein Stück Stoff. Eli wählte eine Mischung: ein Lappen mit einem Kuhkopf. Er nannte ihn Muh. Wehe, wenn man Muh vergessen würde, sie muss überall mit, ohne sie kann Eli nicht schlafen. Vor dem Einschlafen drückt er sie ans Gesicht. Muh hat eine Besonderheit – eine Etikette, die am Rand herausragt. Eli trainiert an ihr seinen Tastsinn und feine Bewegungen mit den Fingern, nimmt sie in den Mund und lutscht und kaut an ihr. Eines Tages als er mit Fieber stark erkältet war, hüteten wir ihn. Ich spielte mit ihm auf dem Sofa, er kaute an Muhs Zipfel, wie an einem Euter. Plötzlich, offensichtlich ein Zeichen der Dankbarkeit und Zuneigung, streckte er mir Muhs Zipfel gegen meinen Mund. Ich zögerte nur kurz und hielt ihn zwischen den Lippen, was Eli aufmerksam, zufrieden, sogar begeistert beobachtete. Ich dachte an die vielen Viren und gab ihm Muh bald zurück. Diesmal kriegte ich seinen Schnupfen nicht.
Unsere kinderlosen Freunde Beatrice (eine ehemalige Kollegin von Silvia) und Asif gründeten vor mehr als zwanzig Jahren in Hydarabad/Indien, von wo er kommt, zwei Schulen, die Corinne besucht hatte. In dieser armen Gegend mit noch verbreitetem Analphabetentum, Sekten- und Geschlechtsunterschieden lernen Mädchen und Knaben von der Grund- bis Mittelschule zusammen, zunehmend aus allen Schichten, weil die beiden Schulen einen guten Ruf haben. Asif und Beatrice bauten und unterhalten die Schulen aus Spenden und nicht mehr gebrauchten Materialien wie alte Schulbänke, Hotelbettwäsche etc. unserer verwöhnten Ueberflussgesellschaft, immer mehr auch aus dem Schulgeld der Reicheren. Es wurden und werden dort tausende Kinder ausgebildet. Eine der Schülerinnen aus einem armen Haus ist bereits eine Ärztin. Das nennt man echte Entwicklungshilfe und Kulturrevolution.
In diesem Jahr (2015) machte Barbara eine Ausbildung zur Alzheimerpatientenbetreuerin. Leider scheiterte nachher eine Anstellung daran, weil sie nur frühmorgens hätte arbeiten können, was schon wegen der Hunde nicht möglich gewesen wäre, sie hätte aber lieber bis spät abends gearbeitet. Wir konnten es auch nicht verstehen, denn meistens findet man niemanden, der gerne spät oder nachts arbeitet.
Daniel gründete mit drei Kollegen eine eigene Firma. Nebenbei unterrichtet er weiterhin als Dozent an der Technischen Hochschule in Windisch. Alexa beendete ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau und bereitete sich nun für die Berufsmatura vor.
Die Pädagogischen Hochschule in Zürich hofft, dass Corinne bald wieder 50% arbeiten kann, was im Moment noch nicht möglich ist.
Eli braucht sie noch. Vielleicht wenn er im Kindergarten ist. Christian wechselte von der Helsana wieder zurück zur CS-Bank. Vorher bildete er sich zum CFA: Chartered Financial Analyst aus. Jetzt ist er Vice President, Investment Reporting Advisor, als Berater für institutionelle Kunden. Tim wollte aufs Trampolin, kaum dass er den ersten Sprung machte, fiel er so unglücklich, dass er sich einen Armbruch holte. Er kam in den Genuss eines kurzen Spitalaufenthaltes mit verstellbarem Bett. Eli beneidete ihn, weil er mit der Ambulanz ins Spital fahren durfte. Sonst spricht und läuft er immer mehr. Liv übernachtet hie und da bei einem Freund oder einer Freundin. Zudem nimmt sie mit einer Freundin Ballettunterricht.
(11) Ende der Vorstellung; Liv zweite von links.

(12) Liv nach ihrer Ballettaufführung.
Nebst Agra/Italien besuchten wir im Herbst 2015 eine Woche Dijon und die Bretagne, wo wir ein Treffen mit dem Aerzteschriftstellerverband hatten. Wir übernachteten zuerst in Dijon, eine wirklich schöne alte Stadt, dann fuhren wir weiter mit dem Zug über Paris nach Quimper. Wir machten zusammen Ausflüge der Küste entlang. Es gab wunderschöne Sandstrände mit vielen Muscheln. Auch kein schlechter Platz, um Ferien zu machen, für uns nur etwas zu weit.
Peter machte weiterhin Hospizdienst und besuchte in seiner Geburtsstadt Martin die berührende Theatervorstellung seiner Tante Zoka, Mutter von Zuzka und Tanja, über die tragische Geschichte einiger Verwandten.
2016:
(13) Liv: Adventskranz 2016 (vollständig ihr eigenes Werk).:
1. Es war noch nie so schlimm, dass es nicht schlimmer sein könnte. Eine alte slowakische Weisheit.
2. Das Schicksal hat in seinem Köcher unendlich viele Pfeile, sodass wir froh sein sollten, dass uns nur manche treffen - dasselbe bildlich ausgedrückt.
3. Man gewöhnt sich auch an den Galgen. Eine alte internationale Erfahrung.
Diese Aussagen begleiteten uns durch das Jahr 2016. An dessen Anfang Silvia immer öfters Herzrhythmusstörungen bekam, die ihr meistens jegliche Aktivität verunmöglichten. Ihr Kardiologe veranstaltete eine Jagd nach ihnen. Auch wenn sie schlussendlich sieben Tage und sieben Nächte ein EKG-Aufnahmegerät trug, konnte er ihre gefährlichste Art weder bestätigen noch ausschliessen. Wie üblich, in jener Woche erlitt sie natürlich keinen bösen Anfall. Sicherheitshalber wollte er Silvia das Blut verdünnen, was wir gut begründet ablehnten. Dafür begannen wir nach den Ursachen der Anfälle zu suchen. Die Umstände, unter welchen sie auftraten, halfen uns dabei. Wenn sie ihre verminderten Calciumwerte und den Blutdruck erhöhte, Hitze und viele Speisen, vor allem solche mit Histamin, ausliess (ihre gute katholische Erziehung und die asketische Steinbocknatur helfen ihr dabei), blieb sie monatelang anfallsfrei. Ende August fuhren wir zwar nur mit einer Seilbahn in die Höhe, wanderten dort aber neben den durch die Sonne erwärmten Felsen, ohne genug zu trinken in der Mittagshitze zum Bergrestaurant Aescher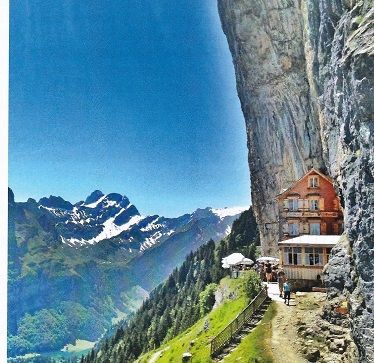
(14) Berggasthaus Äscher.
und siehe, nach dem Abstieg, auch wenn wieder mit der Seilbahn, begann das Herz, zwar nur mild und kurz, aber unregelmässig zu schlagen. Jetzt meidet sie solche Einflüsse und lebt glücklich und zufrieden ohne Herzrhythmusstörungen. Wir hoffen, es bleibt lange so.
Schon vor mehreren Jahren eröffnete mir mein Augenarzt, dass ich zu einer sogenannten Maculadegeneration neige. Sie kann zu weitgehendem Augenlichtverlust führen. Letztes Mal verkürzte er den Abstand zur nächsten Untersuchung und legte mir ans Herz, die Zusatzstoffe dagegen zuverlässig zu nehmen (was ich selbstverständlich schon immer tat). Bei einer Zugfahrt nach Agra merkte ich plötzlich, dass ich die Zeitung nicht lesen konnte und die Welt mit dem bisher besseren rechten Auge wie im Nebel sah. Ich war froh und stolz um den so gut voraussehenden Arzt. Als aber bald irgendwelche Stäbchen im Auge wilde Tänze ausführten, rief ich ihn an. Er empfahl mir, mich unverzüglich in die Augenklinik in Lugano zu begeben. Silvia konnte es zuerst nicht glauben, dann erschrak sie, als ich bei der Sehprüfung sogar die grössten Buchstaben überhaupt nicht sah. Sie verkündeten mir die frohe Botschaft, dass ich in die Netzhaut geblutet hätte, Augentropfen nehmen und Spritzen ins Auge bekommen solle, was für mich ein Horror war. Aber ich besann mich auf die oberen Sprüche, protestierte nicht und verhielt mich ruhig und gesittet. Die Aerzte verneinten zwar, dass, wenn nicht die Blutung, dann mindestens ihr Ausmass mit Aspirin zu tun hatte, das ich seit dem Herzinfarkt nehmen muss, aber ich dachte meines und fand dafür auch Unterstützung in der Fachliteratur. Ob der beschleunigte Verlauf der Augenkrankheit in den letzten zwei Jahren mit den Cholesterinsenkern zu tun hat, diskutiere ich mit ihnen lieber nicht, da ich meinen Ruf als Patient nicht komplett ruinieren und die falsche Meinung, dass ich ein eigensinniger, schwieriger Mensch bin, nicht bestätigen will. (Glaubt Ihr, ich konnte mich wirklich beherrschen?) Mit der Zeit hatte ich aber fast kein Cholesterin mehr im Blut, schmerzhafte Fusssohlen und Muskelkrämpfe – ich nehme also einfach nur die kleinste Menge des Cholesterinsenkers, und siehe da, die Beschwerden besserten. Ja, man hat es nicht einfach mit den Aerzten, auf beiden Seiten der Barrikade.
Nach dem Uebergang von einer gut beleuchteten in eine dunklere Umgebung sehe ich schlecht, das Lesen mit der Lupe geht nur langsam. Ich muss abwägen, was ich überhaupt lesen will und soll, auch was die Fachliteratur betrifft, was mich, eine Leseratte schmerzt und das Leben einschränkt. Die Farben strahlen auch nicht mehr. Naturgemäss wird es mit der Zeit trotz der Spritze nur schlechter. Bald darf ich überhaupt nicht Auto fahren. Und so werde ich dement nicht wegen des Hirns, sondern der Augen, im schlimmsten Falle wegen beiden. Die Einstellung unseres Freundes Jenda, der schon mehrere Jahre in einem solchen Zustand mit erhöhtem Haupt durch das Leben schreitet, hilft mir sehr. Ich wetteifere mit dem Verlauf, schreibe über meine Kindheit und verbinde es mit dem, was ich bereits über mein Leben verschiedentlich berichtet hatte. Es wird auf einer Seite des Historischen Institutes der Universität Zürich veröffentlicht. Silvia hat (noch) Hemmungen mit ihren Erinnerungen, die sie auch mit Familienbildern ausstattet, mir dort zu folgen. Sie schreibt es nur für unsere Nachkommen.
Die machten uns Freude. (Alexa (18) bereitet sich nach wie vor für die Berufsmatura vor. Ihre frische Altersreife nützte, bestätigte und feierte sie mit einer Reise nach London. Dort liess sie sich ein Tattoo machen, nur klein, relativ diskret – erinnert Euch, wie wir uns, an die slowakische Weisheit oben. Tim (9) hatte in Whist nicht nur seinen Vater, was noch ging, aber auch mich besiegt! Liv (7) ist stolze Erstklässlerin, malt schön
(15) Livs Märchenlandschaft mit Prinzessin und Schloss.
und geht ins Ballett. Eli (3) freut sich jeweils in die Krippe zu gehen, plagt dann dort Babys, sodass schon eine schriftliche Mahnung nach Hause kam. Er begründete dieses schändliche Verhalten damit, dass alle Babys blöd seien. Ein weiteres slowakisches Sprichwort passt dazu: „Vergass der Ochse, dass er ein Kalb war“. Diese diskriminierende, jetzt sagt man undifferenziert rassistische Aussage, passt nicht in die familiäre Tradition. Auf der anderen Seite grüsst er im Altersheim alte Leute, gibt ihnen spontan die Hand. Sie werden ganz weich. Er spielt ausschliesslich mit Spielautos und ist im Gegensatz zu Tim ein ungewöhnlich vorsichtiges Kind. Silvia meint, dass auch Corinne in dem Alter so war und z.B. lange nicht Velo fahren wollte. (Panta rhei = alles fliesst, ändert sich, besonders in dem Alter.) Inzwischen ist er gleich lieb zu Babys wie zu Greisen, „liest“ Bücher und beim Schaukeln will er ganz nach oben bis zu den Baumästen gelangen. Er übernachtete schon alleine bei uns ohne Probleme. In letzter Zeit wollten alle drei mit uns „Versteckis“ spielen. Sich zu verstecken geht noch, gekrümmt in einer unbequemen Lage zu verharren, ist schon mühsamer, und das Versteck kriechend zu verlassen, ist eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Aber was man nicht alles für die Enkelkinder tut!
Eine schöne Adventszeit mit Livs Adventskranz sowie frohe Weihnachten!
2017:
(16) Triptychon zum 80. Geburtstag von Pipapi; Liv (7): Regenbogen, Palme und Einhorn, Fensterbild, Handarbeit; Tim (9): Collage mit selbstgestricktem Stoff; Eli (3): Komposition.
Während des Jahres 2017 häufte sich eine Erscheinung, die mich sehr beunruhigte. Als mir das erste Mal eine junge Frau in einem voll besetzten Bus ihren Sitzplatz frei machen wollte, endete es in einer giftigen Auseinandersetzung, wer von uns ein rücksichtsloserer Mensch sei. Es schien mir, dass die Mitfahrer die Meinung dieses Grobians teilten, was meinen Verdruss nur noch steigerte. Aber kein Wunder, es waren fast nur jüngere Leute, die sich noch nicht in meinen Gefühlszustand versetzten konnten. Diese Art von Verletzung kennt keine Grenzen. In der Slowakei, in Bratislava stritt ich mit einem Mann, wer von uns älter sei, als er so eine Sünde beging. Später (nicht vor Gericht, so weit sind wir nicht gegangen) erfuhr ich, dass er ein im Fernsehen bekannter Professor der Rechte war, der zur Promotion seiner Studenten fuhr. Inzwischen gewöhnte ich mich, möglichst keine saure Miene aufzusetzen, lächle etwas gezwungen und bedanke mich artig für dieses gut gemeinte Angebot, das jedoch immer noch einen tiefen Kratzer an meinem Selbstbild eines mit Kraft strotzenden Kerls versetzt. (Auf den Ferienfotos sah ich, leider spät, zu spät, dass ich wirklich gebeugt wie ein alter bedauernswerter Trottel da stehe und mich bewege. Ja, wo ist der ehemalige „Feschak“ verschwunden, wo, wo, wo?
Eines Tages fühlte ich mich doch tatsächlich um Jahre älter. Wegen meiner Augen und einer schäbigen Anzahl von gefahrenen Kilometern verzichteten wir seit 1. April auf unser Auto in St. Gallen. Schon vorher ging Silvia oft mit dem Bus und dem „Einkaufswägeli“ einkaufen, das sie bereits vor Jahren von unserer weitsichtigen Corinne zu einem Geburtstag bekam. Als wir nach Südfrankreich fuhren, um Daniels Ferienwohnung zu bewundern, wurde Silvia aus dem Zug geworfen (nicht wegen eines unbotmässigen Verhaltens, sondern wegen den unmöglichen, französischen, automatischen Türen) und brach sich die Hand. In Folge musste ich diese Aufgabe übernehmen, beziehungsweise Silvia beim Einkauf begleiten, da schon längst bekannt war, dass ich, allein gelassen, bei der Wahl der Ware völlig versage und altes, halbverfaultes Gemüse und Obst oder ganz falsche, unerwünschte Produkte nach Hause bringe. Also musste ich mich zu all den Greisen einreihen, die aus verschiedensten Gründen nicht mehr vornehm mit dem Auto einkaufen gehen können. Einmal sah man mich dann vom Bus mit zwei Leidensgenossen aussteigen und im Gänsemarsch Richtung Migroseingang steuern. Ein Blick für Götter, den Silvia leider versäumte, schnell zu fotografieren. Und so, zwar aus verschiedenen Gründen, freuten wir uns beide auf Silvias Befreiung vom Gips.
Einmal ergab es sich, dass ich doch alleine, ausgestattet mit einem nicht allzu langen Zettel, einkaufen durfte. Es wurde für mich seit geraumer Zeit der grösste Stress. Schon das Suchen dauerte überdurchschnittlich lang, weil Silvia ausgerechnet solche Sachen des täglichen Lebens auflistete, die in dem grossen Einkaufsladen irgendwo unlogisch eingeordnet, besser gesagt versteckt, waren. Als ich fast so oft jemanden fragte, der im Laden heimisch war, wieviele Gegenstände auf dem Zettel aufgelistet waren, fuhr ich mit dem Wägeli zur Kasse, wo ich noch ziemlich zügig vorankam. Dann begann ich einzupacken. Mindestens ein halbes Dutzend eiliger Kunden standen in der Schlange, bis ich mit meinen nicht übermässig vielen Dingen fertig wurde und auch das Geld versorgte, das mir zum Komplizieren meiner Lage ausgehändigt wurde. In der Eile fiel mir nämlich das Portemonnaie aus der Tasche und etliche Münzen dabei auch, was mein Verweilen zusätzlich verlängerte, aber niemand beklagte sich, nur die Kassiererin atmete sichtlich erleichtert auf, als ich mich endlich entfernte. Man merkt, dass man zwar nicht langsam, aber doch langsam etwas langsamer wird.
In diesem Jahr beendete ich einigermassen meine mit Fotos illustrierte Lebensgeschichte. Sie ist vor allem für unsere Nachkommen bestimmt, damit sie uns und sich besser kennen und verstehen. Silvia ist noch dran und beschreibt ihre Ahnen, Kindheit und unser gemeinsames Leben chronologisch und spannend. Wir wetteiferten mit dem Nachlassen unserer geistigen Fähigkeiten, ich auch der Sehkraft. Da wir keine Gräber haben werden, sind sie unsere etwas erweiterten Grabschriften.
Zur Feier meines 80. Geburtstages wurde mein grosser Wunsch erfüllt - ich konnte allen Enkelkindern noch Turiec, die Gegend meiner Kindheit, zeigen. Es gefiel ihnen, und ich hoffe, sie waren nicht das letzte Mal dort. Es war ein ungetrübtes Vergnügen für die ganze Familie. Silvia und ich beendeten die Reise in Budapest, der Hauptstadt des Jugendstils. Dank der kundigen Führung meiner Cousine Judit sahen wir in drei Tagen sehr viele Sehenswürdigkeiten, die Touristen teilweise verborgen bleiben.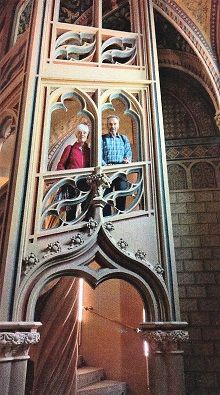
(17) Silvia und Peter in Budapest.
Wir wünschen Euch frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2018.
2018:
(18) Unten links Lago di Tenno: rechts von links Eli, Liv und Tim; unterhalb Liv mit Cousine Adika aus Schweden und rechts Eli bereit zu Bootsfahrt.
Erinnern heisst an der Zukunft arbeiten. NZZ 12.10.18
Liebe Bekannte, Freunde und Familienangehörige
Zwei Ereignisse dominierten das vergangene Jahr bei uns. Unsere Autobiografien wurden gedruckt. Menschen sollten ihren Ursprung kennen. Das macht sie sicherer. Manche meinen sogar, dass auch das, was man erlebt, die Nachkommen beeinflusst. Also wollten wir es ihnen vermitteln, damit sie uns und sich selbst besser verstehen. Gleichzeitig möchten wir unseren Eltern Tribut zollen. Auf der einen Seite baute Silvias Vater als Verdingkind, das nur die Primarschule besuchen durfte, durch Erfindungsgeist und Anpassung an die Umstände, die sich ständig änderten, ein kleines Unternehmen auf, anfangs noch mit einer Schmiede und Schlosserei, dann kamen aber auch Garagebetrieb, Chassisbauten und andere Arbeiten dazu. Auch wenn sie während des Krieges bereits vier kleine Kinder hatten (später noch fünf mehr), beherbergten sie bedürftige Flüchtlingsfamilien ohne Rücksicht auf Nationalität und Religion. Auf der anderen Seite erlebten meine Eltern Verfolgung, verloren einen Sohn und mehrere enge Familienangehörige. Es gelang ihnen, zu überleben, auch durch Suche nach Lösungen sowie Anpassung an die Umstände und Möglichkeiten und nicht zu einem kleinen Teil dank ihrem guten Leumund, den sie genossen. Das Geld, das sie immer wieder dazu benötigten, erhielten sie von Freunden und Bekannten, auch wenn es nicht sicher war, ob sie es je zurückzahlen konnten. Ja, überall gibt es gute, hilfsbereite, grossartige Menschen. Für mich war das Verfassen meiner Autobiografie eine gute Gelegenheit, mich erstmals öffentlich zu meiner jüdischen Herkunft zu bekennen, was mir aus verschiedenen Gründen nicht leicht fiel.
Ende Juli trafen wir 25 Familienangehörige aus der Slowakei, Schweden, Deutschland und der Schweiz nicht wie üblich in der Slowakei, aber aus Verkehrsgründen in Italien am Lago di Tenno, oberhalb Lago di Garda. Es war vielleicht die gelungenste aller unserer Zusammenkünfte. Alles passte, die wunderschöne subtropische Umgebung mit hohen Alpengipfeln im Hintergrund, ein smaragdgrüner kleiner See mit sauberem Wasser, ein gutes Hotel und vor allem gute Laune und Einvernehmen, die zwischen uns herrschten. Nach den gemeinsamen acht Tagen war dort keiner, der es nicht bedauerte, dass wir nicht länger bleiben konnten.
Wir leben mehr recht als schlecht. Silvia hat Probleme mit einer Hüfte und Muskeln, die sie aber nicht hindern, zu wandern. Manchmal sieht sie trotz langjähriger strenger Abstinenz doppelt. Das Hirn ist aber in Ordnung, sogar ohne Zeichen für beginnende Demenz, was sie beruhigte, weil sie, wie jeder in dem Alter die Namen nicht genug schnell abrufen kann. Offensichtlich leidet ein Augenmuskel unter Altersschwäche. Ich sehe immer schlechter, bekomme Spritzen in beide Augen, sodass ich manchmal nicht weiss, welches Auge wann an der Reihe ist. Tröstlich ist, dass auch die im Spital es nicht immer wissen. Schlussendlich einigen wir uns jedoch. So bin ich froh, dass ich keine Mischung aus Kyklop und Mensch bin und somit drei Augen hätte. Je dunkler es um mich wird, desto mehr Hilfsmittel brauche ich. Zur Zeit besitze ich eine Brille zum Lesen und drei Lupen: Eine einfache für helle Tage, eine mit Beleuchtung für die Dunkelheit, die ich am Hals tragen kann, und eine noch grössere mit Beleuchtung in einem Behälter, so dass ich damit noch besser und bequemer lesen kann. Nach der Sehberatung holte ich mir eine Lupe aus der «Systemsteuerung» auf den Bildschirm. Jetzt bekommt Ihr hoffentlich lesbarere e-mails von mir. Manchmal verliere ich auch hier die Übersicht und so weigere ich mich, noch eine Brille für die Fernsicht zu benützen. Auch für ein Hörgerät kann ich mich nicht erwärmen. Es würde mir das Leben weiter komplizieren. Seine Auswirkungen sind sowieso nicht über alle Zweifel erhaben, wie ich von ihren ehrlichen Benützern höre. Es ist der Hauptgrund, warum manche so viele Hörgeräte besitzen, wie ich wesentlich günstigere Lupen.
Es scheint, dass einer unserer grossen Wünsche erfüllt wird. Wir möchten helfen, bis mindestens der jüngste Enkel Eli in die Schule kommt. Er ist bereits im Kindergarten, wohin er stolz alleine geht (nur zwei Blocks weiter von ihnen), Liv übt Geigenspiel und Tim bereitet sich auf die Prüfung zur Aufnahme ins Gymnasium vor. Dazu sind beide begeisterte Pfadfinder geworden.
Alexa hat sich diesen Sommer selbständig gemacht und wohnt nun in einer eigenen Wohnung in Luzern, wo sie immer noch als Krankenschwester arbeitet. Daniel und Barbara benützten die Gelegenheit und zogen in die Nähe der Fachhochschule in Windisch, wo Daniel auch unterrichtet. Sie fanden zum Glück ein neues Zuhause an einem wunderschönen Ort, wo die drei Flüsse Reuss, Aare und Limmat zusammenfliessen, sodass es dort schöne Spaziermöglichkeiten gibt, die auch die beiden Hunde zu schätzen wissen.
In unserem Alter sagte meine Mutter: «Es scheint mir, ich werde langsam etwas älter». Uns scheint dagegen, dass die Zeit eilt, die Enkelkinder wie aus dem Wasser wachsen und wir im gleichen Tempo altern.
Wir wünschen Euch frohe Weihnachten und ein gutes 2019.
2019: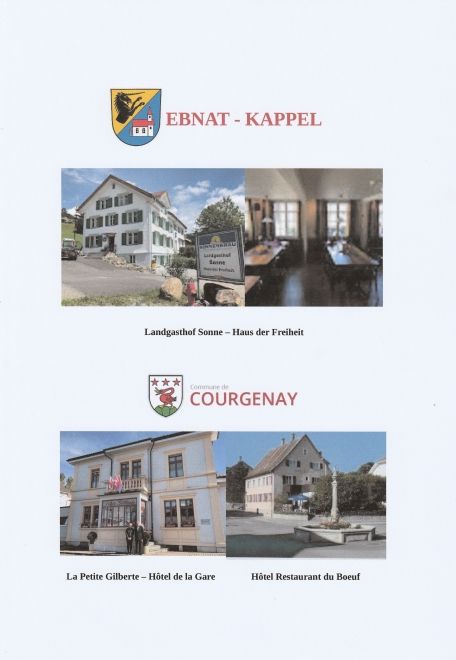
(19)
Liebe Bekannte, Freunde, Familienangehörige,
im Verlauf dieses Jahres konnte ich von der Liste meiner Pläne, Vorhaben und Wünsche zwei streichen.
Vor ein paar Jahren verzichtete der sehr erfolgreiche Präsident der rechtskonservativen Partei SVP (die unter ihm die besten Wahlergebnisse ihrer langen Geschichte erreichte) auf das wahrscheinlich sichere Amt eines Bundesrates. Kürzlich hat ihn die «Neue Zürcher Zeitung» so beschrieben: «Toni Brunner, das politische Ausnahmetalent der SVP: mit 21 Jahren in den Nationalrat gewählt, acht Jahre lang Parteipräsident, immer mit einem Spruch auf den Lippen und jegliche Kritik weglachend.» Ein Bundesrat zu werden ist das Höchste in der Karriere eines Schweizer Politikers. Seit der Gründung einer modernen Schweiz im Jahre 1848 gab es nur 119 Bundesräte. Das Amt entspricht dem eines Ministers, nur hat er auf einer Seite mehr Ressorts und Aufgaben, da es jeweils nur sieben Bundesräte gibt, auf der anderen Seite weniger Macht, was zum schweizerischen politischen System gehört. Mich überraschte seine Entscheidung, auf dem Gipfel seines Erfolges auf die politischen Ämter zu verzichten. (Übrigens tat es in diesem Jahr auch eine Politikerin der linken Sozialdemokraten). Er kehrte zurück auf seinen geerbten Bauernhof und zu seinem inzwischen erworbenen Restaurant mit Übernachtungsmöglichkeiten und einem kleinen Theatersaal, geeignet für nicht allzu grosse Versammlungen. Ich wollte ihm meine Bewunderung für diesen ungewöhnlichen Schritt ausdrücken.
Das Gasthaus von Herrn Brunner befindet sich im gebirgigen Gelände nicht weit von uns, liegt aber ziemlich weit vom Dorf mit einer Busstation. Da wir in St. Gallen kein Auto mehr haben, fragte ich einen Schwager, der dieser Partei nahe steht, ob er nicht Lust hätte, einen Ausflug dorthin zu unternehmen. Er war nicht begeistert. Teilweise aus Bescheidenheit, teilweise war es für ihn vielleicht brenzlig, mit einem ehemaligen Ausländer dort zu erscheinen, vermute ich. Zum Glück habe ich acht Schwager. Der nächste war begeistert und konnte nicht abwarten, bis ich dafür Zeit fand. Er fuhr mit seiner Frau gleich dorthin und machte sogar Duzis mit Toni Brunner. Eines eher düsteren Nachmittags begaben wir drei uns auf den Weg (Silvia, ähnlich ihrem ersten Bruder, hielt von Anfang an nicht viel von dieser Idee). Auf Nebenstrassen durch die wunderschöne, hügelige Landschaft kamen wir zum Gasthaus. Ich begriff unterwegs, dass die Bewohner der kleinen Dörfer und zerstreuten Bauernhöfe den Zustand weiterhin erhalten möchten, was sich auch in ihren politischen Einstellungen spiegelt. (Während der 10 Jahre in Zweisimmen war es mir dort nicht so deutlich bewusst.) Ich hatte auswendig gelernt, was ich Herrn Brunner ins Gästebuch (voll von Eintragungen bedeutender Besucher) schreiben wollte. Ich hoffte, ihn persönlich zu treffen. Er ist doch noch immer als Politiker und Redner gefragt. Als wir zum schönen altertümlichen Haus kamen, begann es zu regnen. Die Stube war fast voll, aber die Serviertochter führte uns zum letzten freien, runden Tisch. Als ich nach einem Gästebuch fragte, war sie überrascht – sie kennen so etwas nicht, aber ich könne mein Anliegen direkt dem Chef sagen. Er komme, wenn er das Gespräch mit einem Lieferanten beendet habe. Wir bestellten die Spezialität des Hauses – Fleisch von den eigenen Rindern, das in der Walliser Höhenluft trocknet, aber ungewöhnlich saftig bleibt. Toni Brunner bemerkte es mit Genugtuung, als er zu uns kam. Ich äusserte meine Bewunderung für seinen Verzicht, wozu leider nicht alle Politiker fähig seien und an ihren Sitzen kleben, auch wenn ihre Zeit vorbei sei. Dank dem politischen System ist es in der Schweiz nicht üblich. Er war damit zwar einverstanden, aber nicht sehr beeindruckt und sagte, er habe in der Politik genug erlebt, er wollte wieder Bauer werden und so habe er sich verabschiedet, weil die Kühe im Stall auf ihn warteten.
Ich lernte sowohl seine Eltern und die sympathische feine Lebensgefährtin kennen, wie auch den behinderten Bruder, der an der Theke aushalf. Alle, samt Serviertochter und Besucher (inzwischen war der Raum überfüllt) waren zu mir trotz der nicht heimischen Sprache sehr freundlich. Es fehlte nicht nur das Gästebuch, aber das Ganze strahlte eine eitelkeitsfreie Natürlichkeit aus. Erst nachher wurde mir bewusst, was mich eigentlich zu Toni Brunner hin zog. Vor kurzem sagte der ehemalige Vorsitzende des Roten Kreuzes Kellenberger, dass er nicht gern hatte, wenn der Raum über ihm dicht besiedelt war. Ein Bundesrat hat zwar nicht viele Vorgesetzte, aber ein Bauer und Restaurantbesitzer ist in seinen Entscheidungen und im Leben freier. Wie er auf weitere politische, so verzichtete ich auf meine akademische Karriere und machte, was mir besser passte. Der Unterschied zwischen uns betr. Herkunft und politischer Einstellung machte die Spannung, die Besonderheit, den Reiz meiner Anerkennung aus. Kürzlich las ich in einem älteren Artikel über Toni Brunner, dass uns noch etwas verbindet – beide sollten wir abgetrieben werden.
Mein diesbezüglicher Stolz auf die Schweiz wurde kürzlich leicht getrübt: Die Partei der erfolgreichen Stadtpräsidentin in Göteborg (Schweden) verlor die Mehrheit. Sicher hätte sie trotzdem einen guten Posten bekommen, aber sie kehrte zu ihrem Beruf als Lastwagenchauffeurin zurück und fährt nun ein städtisches Kehrrichtauto.*
Anfangs des Jahrtausends las ich einen Artikel über die angeblich einmalige «Martinimetzgete» in Porrentruit am 11. November, den St. Martins Tag. (Martin, damals St. Martin ist mein Geburtsort). Seither wollte ich eine Martinimetzgete in Porrentruit erleben. Leider konnte ich niemanden, auch keinen Schwager für die Reise zum anderen Ende der Schweiz erwärmen. Wir besuchten einmal in Porrentruit Annemarie, die Freundin von Silvia aus ihrer Kindheit, die dort einheiratete, aber beide haben für Metzgete, wo auch, nichts übrig. Mein Grossvater pflegte zu sagen: «Alleine trinkt nur der Ochse». Noch mehr gilt es für eine Metzgete, nicht nur weil es ohne Bier oder Wein nicht das Gelbe vom Ei sei. In diesem Sommer fuhren wir mit dem Zug hinter Basel, der nach einer weiteren Stunde in Porrentruit Endstation gehabt hätte. Wir stiegen auf der Bahnstation von Vetter Jano aus, dem aber unser damaliger Besuch nicht galt. Es wurde mir bewusst, dass Jano Porrentruit nahe, fast «hinter der Scheune» hat, und noch mehr, als stattlicher Gourmet (auch in Martin geboren) für eine Martinimetzgete enorm geeignet wäre. Welch glückliche Fügung des Schicksals, wieder einmal herrschte in unserer Beziehung Tauwetter. Ich habe mich nicht getäuscht, Jano war einverstanden! Ich schlug vor, dass wir mit dem Zug fahren, damit sich niemand der passenden Getränke entbehren muss, an die schon Grossvater dachte. Nach ein paar Tagen rief Jano an, dass wir von seiner Bahnstation mit dem Auto fahren werden. Ich äusserte Bedenken, ob er dann die Metzgete voll auskosten könne, aber er beruhigte mich, er habe einen Bekannten, der steuern werde. Nach zwei Wochen gab Jano bekannt, dass nebst Peter auch sein Sohn Igor mit Freundin separat direkt aus Bern anreisen. Einen Tag vorher entschied sich auch mein Schwager Frido, mit uns zu fahren. Ich weiss nicht, wer mehr Freude davon hatte, der Wirt oder ich, dass meine Idee so ein Echo fand. Es erinnerte mich an den Bau eines Schneemannes.
Die Metzgete des besagten Artikels fand in Courgenay, kurz vor Porrentruy im «Hôtel-Restaurant du Boeuf» statt. Schweinemetzgete im «Du Boeuf» (Ochsen) störte niemanden. Sie dauert zwei Wochen, was den Vorteil hatte, dass man nicht den Rummel des überfüllten Porrentruys am Martinitag ertragen musste. Im Bahnhofrestaurant spielte der Schweizer Filmklassiker aus dem Jahre 1941 «Gilberte de Courgenay» mit Anne-Marie Blanc als Serviertochter, mit dem ihre grossartige Karriere begann. (Sie verzichtete später auf die Angebote aus Hollywood.) Er sollte den Kampfgeist der Schweizer Armee stärken. Das Restaurant heisst jetzt «La Petite Gilberte». Leider hatten sie dort keine Metzgete und so mussten wir uns mit dem profanen «Du Boeuf» begnügen. Vegetarierin Silvia verbrachte den grossen Teil des «Schmauses» bei Annamarie.
Wegen Platzmangel kann ich die grossartige, die Amerikaner sagen dem «great», unsere Enkelkinder «mega», Metzgete nicht detailliert schildern. Es war eher fein als deftig. Nicht nur in Erinnerung aber auch im Gebrauch bleibt uns eine Mischung aus Senf und Birnenmus.
Es ist vorteilhaft eine grosse Familie zu haben. Man findet für jedes Vorhaben, jeden Bedarf jemanden, der mitmacht, der hilft. Das hättet Ihr ohne diesen Weihnachtsbrief sicher nicht gewusst.
Wir wünschen Euch frohe Weihnachten mit einem feinen, guten Essen und ein gutes, glückliches Jahr
2020:
(20)
Aus Ruth und Charles Lewinsky: Konversation. Nagel & Kimche, mit Dank für Erlaubnis der Autoren.
Liebe Bekannte, Freund und Famillienangehörige
Zu unserem letzten Weihnachtsbrief vernahmen wir noch mehr kritische Stimmen als andere Jahre: zu lang (es gibt auch hier «Genderunterschied» – vor allem Frauen haben vor Weihnachten weder Zeit noch Lust sich langen, langweiligen, langatmigen Ausführungen zu widmen, derer Sätze bis Sinnlosigkeit kompliziert sind; wir sollen uns von Trumps und seinen Tweets Beispiel nehmen, der Brief hatte ein völlig unpassende Thema (in der Zeit von Tierschutz und Vegetarismus über Metzgete sich verbreiten zeigt eine wesentliche Weltfremdheit. Bei den grassierenden Korruption und Lobbyismus wurden wir sicher vom Metzgerverband bezahlt), und es ist fast ein Verbrechen bei der Klimakatastrophe durch die Schweiz hin und her zu fahren, nur um sich den Bauch mit den Schweneleichenresten vollzustopfen. Die Linken monierten, wir verherrlichten Toni Brunner, den Rechte war es nicht Recht, dass seine Verdienste nicht genug gewürdigt wurden. Silvia übt zu wenig Aufsicht über mich und übersah, dass ich eine Gilberte in einem Gilbert umgetauft habe, kurzum wir sollen lieber über uns und die Familie berichten, was wir dieses Jahr gehorsam in einer gebührenden Länge tun.
Unser Leben verläuft unheimlich schnell von einem wöchentlichen Staubsaugen als Meilenstein, Höhepunkt zum nächsten. Als mir Staubsaugen immer mehr Spass zu bereitete begann, schrieb ich es fälschlicherweise dem Training zu, bis ich merkte, nein, ich bekomme weniger Rückenschmerzen dabei und muss sogar kaum eine Pause einliegen. Der wahre Grund ist, dass ich neu am Schreibtisch mit Computer eine wackelige Sitzanordnung installiert habe, die meine Rückenmuskel unbemerkt ununterbrochen stärkt. An der Coronaepidemie störte mich u.a., dass die Sonderschichten jeweils vor dem Gästeempfang vollständig entfielen. Ich befürchtete schon, ich komme aus der Übung. Staubsaugen ist nämlich auch eine anspruchsvolle geistige Arbeit, die höchste Konzentration verlangt. Man muss hier und jetzt sein und nicht die Gedanken irgendwo schweben, plämpern lassen, da man dann auch dreimal dieselbe Bodenfläche absaugt. Einmal machte mich Silvia sogar aufmerksam, dass ich erneut einen Raum beginne zu staubsaugen – eben wir sind ein «dream team» (mehr dazu s. der nächste Absatz). Staubsaugen ist eigentlich yogaähnlich, nur konzentriert man sich dabei höllisch auf das äussere und nicht das innere Leben. Äusserst selten ist Silvia mit meiner Leistung unzufrieden (nur betreffend Staubsaugen). Seit der erfolgreichen Starroperation kann ich mich weniger an meine schlechte Augen ausreden, auch wenn zum Glück in dieser Hinsicht die Maculadegeneration blieb. Auf die deswegen seltenere Schelten kann ich mich immer noch nicht gewöhnen und bekomme jeweils Minderwertigkeitsgefühle, komme ich mir als Versager vor, habe eine schlaflose Nacht und gerate am Rand einer Depression. So bin ich eben. Trotzdem liebe und pflege ich den Staubsauger wie andere Männer ihre Boliden. Und mir, einen glühenden Anhänger von Roboter und Algorhitmen, wäre es sin Greuel, wenn mich ein solcher beim Staubaugen ersetzen würde, was angeblich schon in etlichen Haushalten geschieht.
Wir verbringen die Zeit nicht mit der Suche nach ihr (wie Proust), sondern nach Folgen unserer wachsenden Vergesslichkeit (und meiner Maculadegeberation). Der Vorteil dabei ist unsere Spezialisation auf verschiedene Gebiete. Wir ergänzen uns, und auch in dieser Hinsicht sind wir ein «dream team», wie im tschechischen Märchen «Der Lange, der Breite und der Hellsehender»,
dem die aufkeimende Demenz nicht viel antun kann. Wir hoffen, sie schreitet nicht mit allzu grossen Schritten weiter, aber wie bisher nur inselartig auf leisen Pfoten. Wesentlich mehr Geld geben für für Wiedereinkäufe der vergessenen oder verlorenen Gegenstände, als für die Neue. Zusätzlich entstanden bei uns mehrere «schwarze Löcher», die fast alles verschlucken können. Sie spucken es leider zu selten wieder aus, meistens wenn wir etwas Anderes suchen, oder wenn wir bereits ihren Ersatz erworben haben. Kleine, unauffällige Gegenstände verschluckt gerne auch der von mir geliebte Staubsauger. Besonders gefährlich ist, etwas «gut aufbewahren« zu wollen. Am Anfang dieser nicht gerade erbaulichen Entwicklung versuchten wir sie mit Vorwürfen zu bremsen. Nach relativ kurzer Zeit stellten wir fest, dass die Vergesslichkeit gerecht zwischen uns verteilt ist, und vor allem, die Vorwürfe sind völlig unwirksam.
Ich kann über eine neue Errungenschaft berichten. Vom Kollegen und Freund Kai Zimmerli aus Zweisimmen habe ich ein Gerät geerbt, das die Seiten von Bücher und Zeitungen auf Monitor vergrössert überträgt, womit auch meine Lesefähigkeit beschleunigt und verlängert wird, und ich muss mich noch nicht auf mein Gehör verlassen. (Rosige Aussichten – es gibt auch Geräte, die lesen und mit Spracherkennungssystem schreiben können. So wird sich Eure Hoffnung, ich höre mit den langen Weihnachtsbriefen auf, noch nicht so bald erfüllen.) Wir haben keinen Fernseher mehr, sitzen bei Tagesschau vor dem am Notebook angeschlossenen grösseren Bildschirm wie Täubchen nebeneinandert (s. Bild – die zweite Taube müssen Sie sich vorstellen, da sie fotografierte). Seit ich eine schwere Niederlage erlitten und meinen Kampf gegen Hörgeräte aufgegeben habe, tragen wir dabeei keine Hörer wie Piloten im Cockpit auf den Köpfen. Da ich weder Enkelkinder noch Vortragende bei verschiedenen Fortbildungen verstehen konnte, entschied ich mich für diesen schwierigen Schritt, zu dem Verrat an der Sache. Ich bin hell begeistert und vom Saulus zum Paulus geworden, der Hörgeräte jedem tauben Greis empfiehlt. Ich trage sie nicht dauernd schon wegen Corona. Die Schnur der Maske, die Arme der Brillen und das Hörgerät vertragen sich nicht hinter einem Ohr. Die Corona änderte auch sonst unseres Leben. Als gute, gehorsame und rücksichtsvolle Bürger meiden wir seit Anfang engen körperlichen Kontakt und langsam sind wir so weit, dass wir auch unsere Auseinandersetzungen sicherheitshalber über die «sozialen Medien» austragen.
Während wir die runden Geburtstage dieses Jahres im engsten Familienkreis noch m 8. März feiern konnten, sowohl das von useren Neffen organisierte und betreute traditionelle, öffentlich zugängige Fischessen an der Sitter im August, bei dem sich die Familie trifft und einen grossen Teil der Bänkli besetzt, sodass die Organisatoren überlegen mussten, ob sie eine Auswahl der zugelassenen Familienangehörigen treffen müssen, wie auch die aufkeimende Tradition der Reise zur Martini-Metzgete nach Pruntrut im November wurden Opfer der Corona.
Zur Familie: Dani unterrichtet mit einem steigenden Einsatz und Begeisterung an der Technischen Hochschule, Barbara musste wegen Corona ihre freiwillige Sorge um vereinsamte und demente Menschen im hiesigen Heim unterbrechen. Zum Glück hat sie noch zwei Hunde. Alexa kehrte aus San Diego mit einem Freund von Uttwil neben Romanshorn, den wir nach mehr als einem Jahr immer noch nicht kennen. Es grenzt fast an Folter, wie ich mit meiner sprichwörtlichen Neugier darunter leide. Sie bildet sich zu Fachfrau für Psychiatrie, studiert und arbeitet in Zürich und Winterthur. Dort wohnt sie auch, 700m von dem mir immer noch nicht bekannten Freund.
Christian wechselte kurz vor den kriminellen Machenschaften in «Credit Suisse», an denen er selbstverständlich nicht beteiligt war, zur Stadt Zürich und ist dort sehr zufrieden. Corinne hatte während des «Lockdowns» sehr viel zu tun: Drei Kinder zu Hause mit «Homeunterricht», ihre Umstellung auf Fernunterricht in der Pädagogischen Hochschule. Tim ist vom Gymnasium begeistert, tschutet neben bei und ist begeisterter Pfadfinder, wie auch Liv und neulich der «Wolf» Eli. Liv verbrachte eine Woche der Ferien mit Reiten und kümmert sich, nebst Geigespiel im Orchester um die Tiere nicht weit von ihnen, wo neulich auch ein Eisfeld ist. Sie schätzen diese guten Bedingungen, auch weil sie bei ihren fernen Ferienreisen hiesige Familien kennenlernen und sehen, dass Kinder unter weniger günstigen Verhältnissen aufwachsen.
Leider müssen wir mit Corona weiterhin leben. Behalten wir den gesunden Menschenverstand und halten konsequent die wirksamen Massnahmen und lassen uns das Leben nicht von sturen, unbegründeten, überflüssigen verderben. Wir sind dankbar, dass bisher niemand von uns infiziert wurde. So sol es auch weiterhin bleiben, was wir auch Euch allen wünschen, dazu
ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2021
2021:
Weihnachten,
die Zeit
der Geschichten ...
Liebe Bekannte, Verwandte und Familienangehörige
Kenner unserer Wohn- und Besitzverhältnisse (zu denen nicht nur das Steueramt gehört) warfen uns vor, im letzten Weihnachtsbrief sich mit fremden Federn zu schmücken, indem wir pingelig genau (und langweilig) die Sicht aus unserer Wohnung beschrieben haben. Aber wir behaupteten nie, die Wohnung gehöre uns. Wir sind nur Mieter im Komplex des ehemaligen Blindenheims, jetzt Obvita genannt.
Als sie den Titel meiner Autobiografie "Die Suche und das Finden" gelesen haben, fragten manche, was ich eigentlich gefunden habe. Am Beispiel unserer Behausung versuche ich es zu erklären. Immer wieder wird das Buch des Psychoanalytikers Erich Fromm "Haben oder Sein", das vor 50 Jahren erschienen ist, verlegt und gelesen. Wenn das Ende des Lebens naht, wird das Sein immer wichtiger, auch weil man immer weniger (zu haben) braucht. Sowohl für uns, wie für unsere Nachkommen haben wir das Wichtigste bereits getan, nämlich ihnen eine Ausbildung ermöglicht, die vor allem ihnen, ihren Eigenschaften und Fähigkeiten entspricht. Was sie damit anfangen und erreichen, ist jetzt allein ihre Sache. Wir hinterlassen auch eine oft vernachlässigte, "unbewusste", aber wirksame Erbschaft - sie lernten unsere Lebensart und Einstellungen kennen. (Manche meinen jetzt dazu, dass mein Lebenswandel nicht immer nachahmungswürdig war.)
Unser "Haben" würde nicht erlauben, unsere gegenwärtige Wohnung zu besitzen. Sie entspricht unseren Eigenschaften und Bedürfnissen. Gärtnern ist nicht Silvias bevorzugte Tätigkeit und für das Handwerk habe ich zwei linke Hände. Obvita sorgt für den Unterhalt ihres Besitzes. Es reicht, die Zentrale anzurufen und in absehbarer Zeit erscheint der "Polyhandwerker" Antonio, der es entweder selbst in Ordnung bringt oder dafür sorgt, dass es eine auswärtige Firma erledigt. Im Alter ist man mit der Pflege und dem Unterhalt der eigenen Person genug beschäftigt. Zum Beispiel: Vor dem Schlafengehen muss ich mehr als ein Dutzend Handlungen verrichten, die ich hier wegen ihren teilweise intimen Charakteren nicht aufzähle, Interessenten jedoch auf Anfrage gerne mitteile. Und so sind wir froh, dass wir es mit unserer Bleibe einfach haben. Einmal im Monat treffe ich pensionierte Ärztekollegen. Mehrere verliessen ihre Eigenheime und wählten eine ähnliche Lösung.
Dieses Jahr wurden mit den neuen Mehrzweckgebäuden auch die leicht abfallenden Spazierwege für Bewohner des Altersheimes und der Sehbehinderten gelegt. (Bild). Sie sind eine ideale Rennstrecke für Trottinettes und den Traktor unserer Enkelkinder. Ich ziehe dann jeweils mein unbenutztes aus dem Keller hervor und fahre mit. Den grossen Spieltraktor erstand ich vor Jahren in einem Brockhaus für Fr. 15.--. Es scheint, es war die beste Investition meines Lebens. Leider ist er zu klein für mich.
Die Obvitaanlage ist direkt unter dem Bruggwald. In diesen Zeiten der Corona hat dies einen grossen Vorteil. Nach ein paar Schritten sind wir im Wald. Nicht weit oben am Rande des Waldes ist ein Bauernhof, der von Dählers einigermassen biologisch bewirtschaftet wird. In einem kleinen Laden (Bild) gibt es dort ausser Obst, Gemüse, Eiern, Fleisch, Salat, verschiedene selbstgebackene Kuchen, dazu auch eine Kaffeemaschine. Während der Lockdowns konnten wir dort die Bekannten und Familienangehörigen treffen. Kinder können aus einem reichhaltigen Spieltraktorenpark wählen und Kühe, Kälber, junge Schweine, Kaninchen, Ziegen, Hühner, zwei Hunde und eine Katze berühren. Zu zwei Gänsen haben wir eine besondere Beziehung, die nicht gut begonnen hat. Als ich nach dem Umzug vor 22 Jahren (nirgendwo verweilten wir so lange) einmal vor Weihnachten dort spazierte, sah ich dieses Paar. Sie schienen mir geeignet für das baldige Weihnachtsfestessen, läutete an der Haustür und fragte die Bäuerin, ob sie sie zu Weihnachten zu schlachten beabsichtige. Ich merkte ihre Entrüstung und bekam eine abschlägige Antwort. Erst im Frühjahr vorigen Jahres begannen wir unterwegs Löwenzahnblätter für die Gänse zu sammeln. Dank Corona gehen wir mehrmals pro Woche zum Bauernhof. Wenn wir jetzt in ihrer Sichtweite erscheinen, fangen sie aufgeregt an zu "gaagen" und freudig mit den Flügeln zu schlagen. Im Winter sammelt Silvia für sie die schönsten Salatabfälle. Sie haben es lieber, wenn wir ihnen die Blätter einzeln reichen und nicht lieblos auf die Erde werfen (Bild). Sie sind unsere "outscourte" Haustiere, die wir ohne sonstige Belastungen (vorläufig nur so) geniessen können. Während den Gänsen unser Grünzeug gut tut, treffen wir regelmässig jemanden, der sich freut, wenn er uns sieht (worauf wir nicht gewohnt sind). Silvia hat Mitleid mit den Kälbern und jungen Schweinen, wenn sie verschwinden und man sie ein paar Tage später in Form von Kalbshaxen, Würsten und Voressen kaufen kann. Wie endet meine Zuneigung zu unseren Gänsen? Man weiss nie, aber allem nach sind sie dem Tod näher als ich. Mit meiner Skrupellosigkeit bin ich im Stande, mit Lust sie zu verspeisen, wie ich es mit ihren Genossen, Suppenhühnern tue. Die kenne ich aber nicht persönlich, wie die Gänse. Die Lockdowns waren ein Segen für den Bauernhof. Viele Leute haben es notgedrungen entdeckt und blieben treue Kunden. Frau Dähler musste zeitweise 40 Kuchen pro Woche backen, nur ein kleiner Teil für unsere Gäste und mich. Corona führte auch uns dazu, dass wir unsere nächste Umgebung und ihre Bewohner besser wahrnahmen und schätzten.
Pflanzen wachsen je nach Boden und anderen Bedingungen.Nach einem slowakischen Sprichwort setzen sich Krähen nebeneinader (eine Abwandlung von: "Eine Krähe hackt der anderen kein Auge raus"). Mit Menschen ist es ähnlich. In fünf von acht Wohnungen unseres Hauses wohnen ehemalige oder gegenwärtige Angehörige des Gesundheitswesens, in drei sind Angestellte der Obvita oder Behinderte. Ein Paar, das neu aus einer ähnlichen Wohnlage umgezogen ist, kommt sich wie nach dem Fegefeuer im Himmel vor. Dort kujonierte der Besitzer des Mehrfamlienhauses, der auch selbst im Hause wohnte, die Mieter und sie waren untereinander zerstritten. Am Anfang des Lockdowns meldeten sich bei uns drei Nachbarn, die für uns einkaufen wollten. Als ich einmal im Lift stecken geblieben bin, versammelte sich das halbe Haus vor der klemmenden Tür und leistete mir Gesellschaft. Der einzige Hund des Hauses heulte dazu entsetzlich. Aus eigener Erfahrung weiss er, wie es ist, eingeschlossen zu sein. Unsere, vor allem meine Zufriedenheit stieg noch, seit wir jetzt im Hause sogar Partner für Whist haben und nicht ins Nebenhaus pilgern müssen, wo ein neunundneunzigjähriger, ehemaliger Nachbar regelmässig gewinnt. Unter uns wohnt eine weit und breit geschätzte ehemalige Optopistin (und Optimistin), die für meine Augen die geeignetste Sonnenbrille wählte.
Nein, diese Zeilen sind weder Selbstlob noch Protzerei, sondern Ausdruck unserer Dankbarkeit, dass uns alles noch gegönnt wird. Ich kann sagen, dass ich hier "angekommen" bin.
Wenn es uns da so "wohlet", droht die Gefahr, dass wir den richtigen Moment versäumen, diese Bleibe zu verlassen. Bekanntlich hatte Gorbatschow gesagte: "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben". Das gilt auch umgekehrt für diejenigen, die zu spät gehen - die plagt der Tod, bis sie ihn annehmen. So weit möchten wir es im Leben nicht bringen.
Wir wünschen Euch ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes 2022
2022:
Das Leben ist eine dauernde, ununterbrochene Reihe von Belastungen, Enttäuschungen, Hindernissen, Irrtümern, Missverständnissen, Missgeschicken und Misserfolgen.
Liebe Bekannte, Freunde und Familienangehörige
Im Verlauf dieses Jahres wurden wir immer wieder auf verschiedene Art und Weise auf mehreren Wegen aus dem Paradies der Sorglosigkeit und Unbekümmertheit vertrieben. Wir landeten auf einem rauhen, unsicheren, vielleicht sogar gefährlichen Feld, dessen Beackerung fast ununterbrochene Aufmerksamkeit und Konzentration verlangt. Wir müssen dauernd achten, wie wir Wärme und Energie sparen können, damit wir nicht nur die Umwelt schonen, aber auch und das ist neu, die Kriegsbedrohung und die Knappheit auf vielen Gebieten verringern können. Ob man schon und wie lange lüften, das Licht ein- und ausschalten soll oder das Kinderspiel „Blinde Kuh“ noch eine Weile fortsetzen kann, wieviel Wasser man braucht zum Kochen, das man im Schnellkochtopf wärmt – solche Fragen und Aufgaben beschäftigen uns fast dauernd. Mein geliebter Staubsauger muss auf seinen Einsatz bis früh abends oder am Wochenende warten. Auch Duschen ist nicht mehr das, was es noch im vorigen Jahr war. Schnell, nach Art von Tims diesjährigem Pfadfinder Bundeslager, das nur jede 14 Jahre stattfindet, soll es gehen. Im Sommer gesellte sich Hitze mit begleitender Trockenheit zu unseren Plagen. Zum Glück hat sich Corona besonnen und zurückgehalten.
Dank diesen und ähnlichen ständigen Bemühungen, die Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen, haben wir keinen Mangel an Diskussionsstoff und mehr oder weniger heftige Auseinandersetzungen. Unsere Ehe war noch nie so bedroht. Das Bemühen, energiemoralisch zu handeln, kostet sehr viel Energie. Die Leichtigkeit des Seins ist jedenfalls vorbei.
Diese Widrigkeiten führten dazu, dass wir uns wieder der Forschung auf dem Gebiet der Fäkalogie widmen, die wir gegründet haben (1). Wie bekannt ist, die Veterinärmediziner möchten durch die Zusammensetzung des tierischen Futters die Menge der umweltschädlichen Gase vermindern, die bei der Verdauung der Tiere, vor allem der Rindvieher, entstehen. Auch wir beobachten wieder scharf, wie diesbezüglich unsere Ausscheidung mit unserer Ernährung zusammenhängt. Wie es in der Forschung nicht selten vorkommt, gelang uns durch einen Zufall eine grosse Entdeckung, ein Durchbruch – wir merkten, dass das Mittel zur Reinigung der Zahnprothesen (die wir noch nicht haben) und Zahnspangen im Nu den abstossenden Geruch der Fäkalien beseitigt und sie zu fast einer wohlriechenden Masse umwandelt. Somit brauchen wir dazu nicht mehr die nur beschränkt wirkenden Streichhölzer anzuzünden und produzieren dadurch nicht noch zusätzlich das umweltschädliche CO%u2082. Die Folge ist, dass wir uns, man kann sagen ungetrübt von moralischen Vorbehalten, mindestens in diesem Bereich sorglos mit Wonne sowohl der Nahrungsaufnahme wie ihrer Ausscheidung widmen und ergeben können.
Wir sind froh, dass wir trotz den Kriegswirren einen Abschied von meinem Ursprungsland, der Slowakei, nehmen konnten. Es war eine wunderschöne Reise mit jungen Verwandten, Mutter mit zwei Töchtern, die sich für die Vergangenheit der Familie und das Land sehr interessierten. Sie schien uns zu kurz, denn sie war abwechslungsreich, auch weil wir unsere Begleiterinnen ins Whist Spiel einweihten. Die zwei Töchter, die nie Karten spielten, wurden schnell nicht nur gute, aber auch leidenschaftliche Whistlerinnen. Wir besuchten die wichtigsten Plätze, wo ihr Schwieger- und Grossvater, mein Vetter Jano lebte, aber auch Dolna Lehota in der Nizke Tatra, unser Versteck während des Krieges. Dort traf ich meinen damaligen Spielkameraden, den Sohn unserer Gastgeber Jaro Dolnan und seine Familie. In meinem Geburtsort Martin, das jetzt renoviert ein Juwel ist, entdeckten wir wieder den Grabstein meines Grossvaters väterlicherseits, den ich schon als zerstört glaubte, da ich ihn beim vorherigen Besuch nicht mehr fand – er wurde auf einen neuen, besseren Platz verlegt. Dagegen das Grab meines Bruders auf dem Friedhof für Gefallene im slowakischen Aufstand auf einer Anhöhe nicht weit von Martin blieb unverändert. Vermutlich wird es am längsten bestehen. Am Ende legten wir in Bratislava Blumen auf das Familiengrab.
Nach dieser unvergesslichen Reise in die Slowakei kann ich meinem Abschied von dieser Welt entspannter, gelassener entgegensehen. Erfolgt er langsam oder schnell, mit mehr oder weniger Belastung? Aber vielleicht werde ich ihn überhaupt nicht wahrnehmen können. Jetzt wird mir bewusst, wie glücklich wir sind, „im Bett“ sterben und uns darauf vorbereiten zu können. In meiner Kindheit und zur Zeit nicht allzu weit von uns entfernt war und ist das leider anders.
Was mit meinen Gebeinen geschieht, ist schon lange bestimmt.
Wir wünschen Euch frohe Weihnachten und ein friedliches, an Widrigkeiten ärmeres, fröhliches und erfolgreiches Jahr 2023.
1 Marko P: Fäkalogie, Ausscheidung, Microbiom und ich. Schweizerische Ärztezeitung 2014;95(6):220-1.
2023:
Die Zeit nahm alles mit, die Zeit nahm alles mit, und ich gebe meinen Kopf dafür, dass sie nie zurück gibt, was sie einmal nimmt.
Liebe Bekannte, Freunde und Verwandte,
der tschechische Barde Waldemar Matuska sang es Mitte der sechziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts. Schon die alten Griechen wussten, dass "alles fliesst" und "man nicht in denselben
Fluss steigen kann".
Was die Zeit mitnahm, kehrt zwar nicht zurück, aber etwas Wichtiges bleibt - die Erinnerungen und
die Beziehungen. Sie entstehen während des Zeitflusses. Im Alter hängt unser Leben zunehmend an
einem von Erinnerungen und Beziehungen geflochtenem Seil. Leider verlieren wir durch einen
natürlichen Prozess immer mehr Bekannte, Freunde und Familienangehörige - "man holzt schon
auch in unserem Wald". Ohne Kontakte schrumpft jedoch das Hirn
((Neurology doi: 10.1212/WNL.0000000000207602).
Wir sind Euch für Interesse, Zuwendung und Austausch von Erfahrungen, Meinungen und
Ansichten dankbar. Dadurch kommen wir zu Lösungen, die unser Leben vereinfachen und
erleichtern. Und "geteiltes Leid ist halbes Leid". Das alles hilft, das durch psychische und
körperliche Abnützung zunehmend anspruchsvolle Leben im Alter zu bewältigen. Eben, "alles
fliesst" noch schneller, aber wir sind immer langsamer. Nicht selten ändert unerwartet und
sprunghaft der Fluss des Lebens. Deswegen ist es gut, in ihm schwimmen zu können. Durch
die der alten Beziehungen bleibt man dafür in Übung und kann so auch neue anknüpfen. Sonst
wird man einsamer und einsamer und das Hirn kleiner und kleiner....
Das Seil aus Erinnerungen und Erfahrungen kann enorme Belastungen aushalten. Wir sind bereit für
Leute, zu denen wir eine gute, feste Beziehung haben, grosse Lasten zu tragen und Opfer zu bringen.
Manche Beziehungen bestehen früher oder später fast nur aus Erinnerungen.
Es gibt Leute, die gern in immer neue Flüsse steigen. Andere bevorzugen denselben, auch wenn er
sich durch die Zeit stetig ändert. Wie beim Bauen eines Schneemanns, sammeln sich neue
Erinnerungen, die ihre Beziehung zu diesem Fluss beleben und stärken. Vertrautheit beruhigt und
gibt grosse Sicherheit und Kraft. In der Regel kehren wir gerne in Gebiete zurück, wo wir schöne
Erlebnisse hatten sowie unsere Kindheit und Jugend verbrachten. Viele Verlassen die letzten Orte
sogar lieber nicht mehr.
Es ist leider nicht zu vermeiden, dass wir zu oft an einen bestimmten Zeitabschnitt keine guten
Erinnerungen haben. "Die Zeit ist wie ein Landarzt - sie eilt und heilt". Manchmal nimmt sie sich
oder geben wir ihr nicht genug Zeit dazu. Dann lässt der Schmerz über den Verlust einer Person,
einer Beziehung nicht nach und die Erinnerung bohrt in unserer Seele und erschwert oderr sogr
verdirbt die Beziehungen. Es ist dann an der Zeit, Hilfe zu suchen.
Wenn wir zurückblicken, sehen wir zum Glück, dass unser Schwimmen im Fluss des lebens
überwiegend sehr befriedigend war mit vielen Sternstunden des Glücks, der Zufriedenheit und des
Erfolgs, was wir Euch auch im neuen Jahr 2024 von Herzen wünschen
Silvia und Peter

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit;
Der Prediger Salomo, Kap. 3, 1-2.
In unserer Zeit erleben wir selten und eher von Ferne, wie Menschen vor dem nahenden Tod leben, wie sie dabei häufig leiden und wie sie schlussendlich sterben. Es überrascht mich immer wieder, wie tief und nachhaltig der Tod und die Art des Sterbens die Kinder und Enkelkinder der Verstorbenen beeindrucken und beeinflussen.
Als sich mein gesunder, 88-jähriger Vater eines Sommers nicht wohl fühlte, etwas hüstelte und leichtes Fieber hatte, wollte er keine Abklärungen und keine Therapie zulassen. Er fürchtete, er werde unselbständig und abhängig und spürte oder dachte nur, dass seine Zeit abgeklungen sei. Er entschied, nichts mehr zu essen und zu trinken. Dabei blieb er auch, als er kein Fieber und keinen Husten mehr hatte. Er unterlag der irrigen Meinung, dass er nach zehn bis vierzehn Tagen tot sein werde. Das kann für kranke, zerbrechliche Menschen gelten. Er war jedoch gesund, sodass es bei ihm als altem Mann mit verminderten Bedürfnissen sechs Wochen dauerte, bis er kurz nach seinem 89. Geburtstag ruhig starb. Er war während dieser ganzen Zeit für ihn ungewöhnlich sorglos, fröhlich, mit allem zufrieden und einverstanden, ausser mit dem, was sein Leben verlängern könnte.
Meine Mutter hatte viele Jahre hohen Blutdruck und Herzschmerzen. Als sie über achtzig war, entfernte man ihr einen bösartigen Knoten in der Brust. Sie wollte die Brust behalten und keine weiteren Therapien haben. Nicht lange nach ihrem 90. Geburtstag, bei dem sie frei eine ergreifende und lange Rede hielt, wurde sie gelb und begann unter unstillbarem Juckreiz zu leiden. Sie hatte keinen Appetit mehr und nahm schnell ab. Als ich sagte, sie könnte einen Tumorableger im Bauch haben, fragte sie, von welchem Tumor? Ich erwähnte die Brust. Sie entgegnete überrascht, das war doch schon vor fast zehn Jahren. Sie war einverstanden, keine Abklärungen mehr zu machen und litt tapfer unter dem Juckreiz. Eine Woche vor ihrem Tod sass sie in unserer Küche und schaute zu, wie wir frühstückten und fragte, immer schon und noch neugierig: Was kommt jetzt? Ich blieb ihr die Antwort schuldig.
Ich war bei meinem Herzinfarkt nicht weit vom Tod entfernt oder er von mir. Ich machte die Bilanz meines Lebens und war bereit zu gehen, wie ich es im entsprechenden Kapitel beschreibe. Aber, wenn er noch näher kommt …? Meine Frau und ich sprechen über ihn und immer mehr auch mit unseren Freunden und Bekannten. Wir bereiten uns auf verschiedene Möglichkeiten vor, wie vor einer Reise oder einem anderen Vorhaben, das gelingen soll. Bei meiner nicht wunscharmen Natur habe ich auch für mein Ende eine Vorstellung: In unserer Ferienwohnung auf den Lago Maggiore blickend (s. Vorwort), bei Bedarf mit Medikamenten gut versorgt. Diese schöne Vorstellung, wird mich, ähnlich den Bildern der Ars moriendi trösten, wo ich auch sterben werde.

(1) Blick von Agra auf den Lago Maggiore abends
Das ist der gegenwärtige Zustand: Ich sehe und höre zwar immer schlechter, vergesse immer mehr, aber ich kann noch wandern, die Wohnung putzen, auf die Enkelkinder Acht geben, die Fachliteratur auf Gebieten, die mich und meine Familie betreffen verfolgen – was will ich mehr? Wir hoffen, es bleibt so, bis der jüngste Enkel selbständiger wird. Aber, was wenn es schlechter wird und ich schwach sowie von Schmerzen und Übelkeit geplagt werde? Ob ich mit dem Tod dann so umgehe, wie meine Eltern, weiss ich nicht, ich hoffe nur.
Wir sprechen aber auch über unser Leben bis der Tod kommt. Wie sollen wir die verbleibende Zeit verbringen und geniessen, welche Aufgaben noch erfüllen, welchen Sinn dem Leben geben? Wir sind froh und dankbar, dass wir bei der Betreuung der Enkelkinder aushelfen können und unsere Tochter dadurch ihren schönen Beruf, der ihren Fähigkeiten entspricht, weiterhin ausüben kann.
Nicht nur unsere Tochter wundert sich, wie ich in letzter Zeit ruhig und gelassen reagiere oder eben nicht reagiere in Situationen, in denen ich früher explodierte. Bin ich gelassener geworden, da ich immer weniger Aufgaben und Pflichten habe, für immer weniger verantwortlich bin, oder ist es der Einfluss der Medikamente, die ich seit dem Herzinfarkt nehme? Sorge ich mich weniger um die Zukunft, weil sie nicht mehr meine ist? Bin ich schon in einem ähnlichen Zustand wie mein Vater in den letzten Wochen vor dem Tod?
Ich würde aber lügen, zu behaupten, dass ich kein Problem mit dem Tod habe. Der Gedanke an den Abschied von der gewohnten, bekannten, mit dem Abstand der Zeit mehrheitlich vergnüglichen Welt, fällt nicht leicht. Wie gerne würde ich sehen, wie meine Nachkommen leben werden, welche Berufe die Enkelkinder ergreifen - ausser bei der ältesten Enkelin. Sie hat inzwischen einen Beruf, sie ist Krankenschwester. Ich mache mir Sorgen, ob sie, in Wohlstand aufgewachsen, die Schwierigkeiten und Belastungen des Lebens meistern wird. Die Entwicklung der Umwelt und auf der politischen Bühne ängstigen mich auch. Ich hoffte, leider vergeblich, dass die Gräuel, die wir und unsere Eltern erlebten, sich nicht wiederholen werden. Dann hätte es wenigstens einen Sinn gehabt. Ich bin aber auch überzeugt, die Nachkommen werden damit so fertig, wie wir es wurden.
Nach so vielen Umbrüchen und Umzügen in meinem Leben, macht es mir keinen Kummer, wie es oben oder auf der anderen Seite sein wird. Wenn es so etwas gibt, bin ich fest überzeugt, ich werde auch dort heimisch.
Ich bin noch gelassener geworden, nachdem ich diese Schrift zustande brachte. Sie ist eine Art Grabschrift.